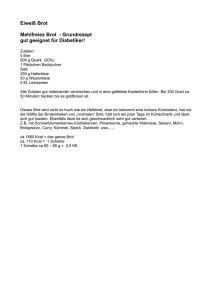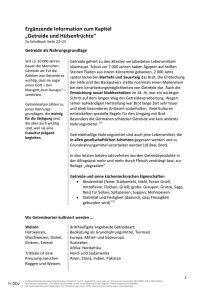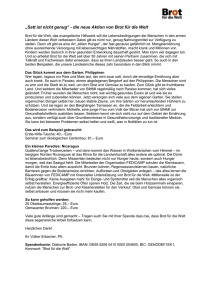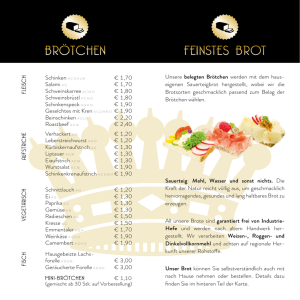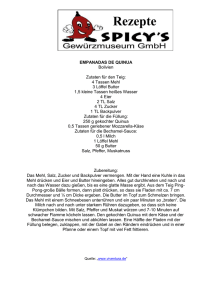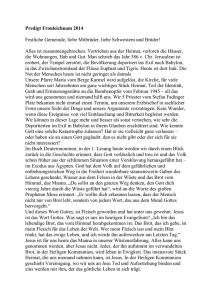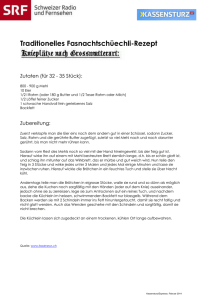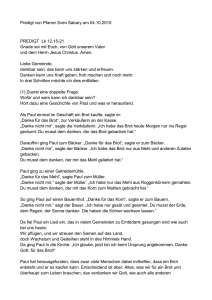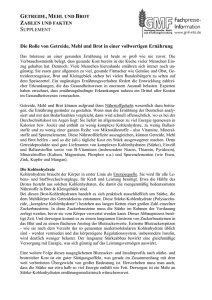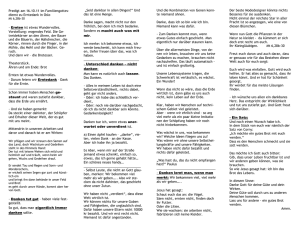Aufs Korn gekommen: Brot
Werbung

Aufs Korn gekommen: Brot von Brigitte Neumann Unser täglich Brot ist seit Jahrtausenden das Synonym für Nahrung schlechthin. Doch beim Anblick wogender Getreidefelder und voller Kornspeicher macht sich kaum jemand Gedanken, wie unsere Vorfahren überhaupt auf die Idee kamen, die Samen der unergiebigen Gräser zu ernten, zu mahlen und zu Brot zu verbacken. Bevölkerungswachstum, die Dezimierung des Wildes in den Wäldern, Sterben der Eichen, die die nahrhaften Eicheln lieferten - wir wissen nicht, was es war, aber wir wissen aus Skelettfunden, dass die Umstellung auf die Körnerkost die Lebenserwartung der Menschen drastisch reduzierte. Nicht ernährungswissenschaftliche Weisheit, sondern die pure Not zwang sie, buchstäblich ins Gras zu beißen. Reichlich war die Ernte der paar mickrigen Körner in den Halmen gewiss nicht, noch dazu schwer verdaulich. Aber sie reichte aus, den Hungernden erst einmal das Überleben zu sichern. Bis Anbautechniken zur Aussaat im Frühjahr entwickelt waren und durch gezielte Auswahl allmählich ertragreichere Sorten zur Verfügung standen, verging allerdings noch viel Zeit. Nicht zum Fressen gern Ebenso groß war die Herausforderung, aus den Grassamen bekömmliche Nahrung zuzubereiten. Schließlich ist der Mensch weder mit Kropf und Muskelmagen (wie die Hühnervögel), noch mit einem komplizierten Magensystem (wie die Wiederkäuer) ausgestattet. Sein Verdauungstrakt unterscheidet sich wesentlich von dem der beiden größten Tiergruppen, die größere Mengen Getreide schadlos vertilgen können. Im Gegensatz zu Mehlmotten oder Kornkäfern besitzt er keine speziellen Enzyme für den Abbau von unverträglichen Stoffen. Deshalb musste der Mensch viel ausprobieren bis er die Getreide- und Grassamen seinem Verdauungstrakt angepasst hatte. Er entwickelte spezielle Verarbeitungstechniken, die ihm den Nährwert des Getreides aufschlossen. In allen Kulturen der Welt wurde Getreide zwischen zwei Reibsteinen zu relativ feinem Mehl gemahlen. Aus dieser Urmühle entwickelten sich im Laufe der Zeit Mühlen, die mit Wind, Wasser oder Pferden betrieben wurden. Aus Roggen- und Weizenmehl buk man seit jeher Fladen und Brote. Vermutlich schon im 5. Jahrtausend vor Christus war die Teigsäuerung bekannt. Funde am Neuenberger See zeigen, dass bereits damals lockere Brote in der Asche Getreide, Mehl, Brot • Wer buk das erste Brot? ! 3 • Weißmehl: so alt wie Brot ! 4-6 • Vollbremsung für Vollkorn ! 7-9 • Ballaststoffe: Probe aufs Exempel • Phytin ! 10 11-12 Gentechnik aktuell • Kreuz und quer durchs Internet 13-15 Facts and Artefacts • Leukämie durch Fla­ vonoide • Getreideseuche • Gemischter Anbau statt Gentechnik • Wildreis bald für jedermann • Mehle à la Dior • Honig auf Wunden Kurznachrichten • Impfen verbreitet MKS des Feuers gebacken wurden. Später baute man Backöfen, aus denen die Asche vor dem Einschieben des Brotes aus dem Backraum entfernt werden musste. Bis ins letzte Jahrhundert galt die Getreidekleie als wertloses Abfallprodukt, das höchstens in Notzeiten mitgegessen wurde. Schon bei den Griechen und Römern gab es neben der Kleie drei Mehlsorten: Das feinste Weißmehl, cribrum pollinarum, machte etwa ein Drittel der gesamten Mehlmenge aus und wurde nicht nur zum Backen, sondern wohl auch zur Herstellung von Kleber genutzt. Das Mehl mittlerer Qualität hieß simila oder similago. Das ist das lateinische Wort für Weißmehl, das seinerseits aus dem Assyrischen übernommen wurde und bis heute in dem Wort „Semmel“ weiterlebt. Die beiden genannten Mehlty­ pen wurden vom similiginarus, dem Weißbrotbäcker zu panis candidus verarbei­ tet. Die schlechteste Mehlqualität war das cibarium oder secundarium, das reichlich Kleie enthielt. Es gab sogar ein reines Kleiebrot, das panis fufureus. Das fand als Hundefutter Verwendung. Auch die heilkundige Mystikerin des Mittelalters, Hildegard von Bingen hebt den Wert des weißen Dinkelmehls zum Brotbacken besonders hervor und emp­ fiehlt das „simila“ (Semmelmehl). Auf dem Lande wurde dunkleres Brot geges­ sen als in der Städten. Jedoch nicht die Kleie, sondern spezielle Nachmehle färbten die Roggenbrote der Landbevölkerung dunkler. Zum Festtagsschmaus zählte aber auch hier das helle Weizengebäck. Kopf oder Bauch Der Paradigmenwechsel trat erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Nicht mehr das, was gut schmeckte und bekömmlich war, galt fortan als gesund, son­ dern das, was aufgrund von chemischen Analysen gesund sein musste. Justus von Liebig war es, der den Nährwert der Kleie in Form von stickstoffhaltigen Ver­ bindungen entdeckte. Er legte damit einen Grundstein für die These vom gesun­ den Vollkornbrot. Erst die Vollwertbewegung brachte den Menschen auf die Idee, nicht mehr aus purem Hunger, sondern aus Gesundheitsgründen freiwillig die Kleie mitzuessen. „Lasst eure Nahrung so natürlich wie möglich“ hatte der Vater der Vollwertkost, Professor Werner Kollath, an die Ärzte appelliert. Aber was bitte ist „natürliche Nahrung“? Eingeweichte Körner oder unser täglich Brot? Herausgeber: Europäisches Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften (EU.L.E.) eV. Amselweg 7, D-65239 Hochheim Internet: http://www.das-eule.de Vorstand und V.i.S.d.P.: Josef Dobler, München Redaktion: Dipl. oec. troph. Brigitte Neumann (Chefredaktion) Dr. rer.nat. Bärbel Dittrich Dipl. oec. troph. Ulrike Gonder Dipl. oec. troph. Jutta Muth Lebensmittelchemiker Udo Pollmer Dr. med. Dipl. Ing. Peter Porz (Internist) Lebensmittelchemikerin Gertraud Rieskamp Dipl.-Lebensmitteltechnologin Ingrid Schilsky Dr. med. vet. Manfred Stein Dipl.-Biologin Susanne Warmuth Cand. oec. troph. Michaela Waibel Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Herman Adlercreutz, Helsinki Prof. Dr. Michael Böttger, Hamburg Prof. Dr. Gisla Gniech, Bremen Dr. Hans F. Hübner, MD, Berlin Prof. Dr. Hans Kaunitz (✝), New York Prof. Dr. Heinrich P. Koch, Wien Prof. Dr. Egon P. Köster, Dijon Prof. Dr. Bernfried Leiber, Frankfurt Prof. Dr. Karl Pirlet, Garmisch-Partenkirchen Prof. Dr. Hermann Schildknecht (✝), Heidelberg Spenden: EU.L.E. e.V. ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerabzugsfähig. Konto 52 000 190, BLZ 512 500 00, Taunus-Sparkasse Alfred-Mehl-Str. 50, D-91058 Erlangen Tel.: +49-91 31-60 40 77 Fax: +49-91 31-60 40 73 E-mail: [email protected] Bezug: Der EU.L.E.n-Spiegel erscheint alle 6 Wochen. Die Fördermitgliedschaft kostet 180,- DM für Privatpersonen und 975,- DM für Firmen. Wer buk das erste Brot? Von Sagen umwoben ist der Ursprung des täglichen Brotes. Glaubt man den Darstellungen, war es nicht Menschenwerk, sondern eine Göttergabe. Mal erfand die griechische Demeter den Ackerbau, mal der aztekische Mais-Gott Tezanthe. Auch orientalische Gottheiten lehrten die Menschen, Korn zu säen und zu ernten. Im Lande Sumer bat Enki, der Gott der Weisheit, die Erdmutter, dem schwächlichen Menschen Brot zu geben. Aber ließ göttliche Weisheit unsere Vorfahren duftendes Brot backen? Wenn Eichen weichen Bainbridge DA: The rise of agriculture: A new perspective. Ambio 1985/147/S.148-151 Das Kochen von Getreidebrei oder das Backen von Brot gibt der Archäologie Rätsel auf. Warum nahmen die Menschen Grassamen in ihren Speiseplan auf? Die Urformen unserer Getreide waren ein paar dürre Halme mit gerade so viel kleinen, dickschaligen Körnern daran, dass im folgenden Jahr wieder ein paar Gräser sprießen konnten. Sinnvolle Nutzung von Getreide jedoch erforderte vorausschauenden Ackerbau. Gleichzeitig bedurfte es Verfahren zum Entspelzen und Mahlen der geernteten Körner. Kaum vorstellbar, dass die Menschheit beide Fortschritte gleichzeitig vollbracht hat. Bainbridge glaubt, dass die Nutzung der Eicheln den Übergang vom Sammeln zum Ackerbau begünstigte. Ob Mexiko, Kalifornien oder China, ob mittlerer Osten oder Europa, überall prägten in vorgeschichtlicher Zeit weite Eichenwälder das Landschaftsbild. Eicheln lassen sich schnell sammeln, sind haltbar und nahrhaft. Aber erst das Mahlen zu Mehl und das Auslaugen in warmen Wasser reduziert den bitteren Tanningehalt und macht sie genusstauglich. Archäologische Funde aus Mexiko und China belegen, dass schon Jahrhunderte bevor Getreide gegessen wurde, Mahlsteine zum Mahlen sowie Tongeschirr zum Wasserkochen existierten. Doch die ergiebigen Eichelquellen versiegten im Laufe der Jahrhunderte. Die anwachsende Bevölkerung brauchte mehr Nahrung, und mehr Brenn- und Bauholz. Gleichzeitig nahm die Tierhaltung, insbesondere die der genügsamen Ziegen zu. Aber dort, wo Ziegen weideten, wuchsen kaum Eichen nach. Die Tiere fraßen die Schösslinge einfach ab. Vielleicht spielten auch Klimaveränderungen oder Baumkrankheiten eine Rolle beim Verschwinden der ausgedehnten Eichenwälder. Angesichts knapper werdender Ressourcen mussten die Menschen neue Nahrungsmittel suchen. Um den ärgsten Hunger zu stillen, begannen sie mit dem mühsamen Sammeln der Grassamen. Statt der Eicheln mahlten und kochten sie den dürftigen Ertrag in heißem Wasser zu Brei so wie ehedem das Eichelmehl. Eicheln sind nahrhafter als Weizen: Sie enthalten frisch 24 Prozent Eiweiß, 18 Prozent Fett und 53 Prozent Kohlenhydrate. Den Verzehr belegen bronzezeitliche Funde wie in Buch bei Berlin, wo man enthülste und geröstete Früchte fand. Der griechische Dichter Hesiod berichtet etwa um 700 v. Chr.: „Wo gerechte Menschen wohnen, ist Hungersnot unbekannt. Ihnen geben die Götter reichlichen Lebensunterhalt, Eichen, die mit Eicheln beladen sind, Honig und Schafe.“ Auch der Römer Plinius (23 bis 79 n. Chr.) bestätigt, dass Eicheln den Reichtum vieler Völker ausmachten. Der Konsum von Eicheln scheint bis in die Frühzeit der menschlichen Kultur zurückzureichen, wenn Maurizio schreibt, dass „in älterer Zeit (von der Eichel) wie von einer ehemaligen Mehlfrucht gesprochen (wird), die man dörrte, schälte und dann mahlte“. Bis ins Mittelalter buk man in ganz Europa Brot auch mit einem Zusatz an Eichelmehl. Es galt sogar als gut bekömmlich. „Dann nahm der Gebrauch ab, schon Mitte des Mittelalters sank die Eichel zum Viehfutter herab, besonders zur Schweinemast.“ Mit dem Schwinden der Eichenwälder fand auch das ein Ende. Das Sammeln von Eicheln geschah noch bis ins letzte Jahrhundert besonders dort, wo kein Ackerbau stattfand. So kochte man z.B. in den Bergen Sardiniens Eicheln, zerstampfte sie im Mörser und zerquetschte sie mit einem Walkholz zu Brei. Der wurde auf einer Steinplatte mit Tonerde vermengt und mit Öl und Fett zu Fladenbroten ausgebacken. Es ist wahrscheinlich, dass in Regionen, in denen keine Eichen gediehen, andere Rohstoffe zu Mehl verarbeitet wurden. Beispielsweise bereiteten die Aborigines in Australien Mehl aus wilden Samen, ja bei manchen Gesellschaften wurde Mehl sogar aus tierischen Rohstoffen gewonnen (v. Stokar: Die Urgeschichte des Hausbrotes. Leipzig 1951; Birket-Smith K: Kulturens veje. Kopenhagen 1941/42; Maurizio A: Die Geschichte unserer Pflanzennahrung. Berlin 1927) Weißmehl: so alt wie das Brot Einer populären Ideologie zufolge, die vor allem von v. , Männle und Leitzmann (Vollwert- Ernährung. Heidelberg 1993) verbreitet wird, soll das Weißmehl eine Erfindung der „zentralen Großmühlenbetriebe“ gewesen sein, die die „weitverbreiteten Kleinmüllereien“ abgelöst haben. Dies habe dazu geführt, dass das Mehl „über größere Entfernungen transportiert und über längere Zeiträume gelagert werden“ musste. Und da Vollkornmehl schneller ranzig wird, hätte man statt dessen Auszugs- oder Weißmehl produziert. Doch die Zweifel liegen auf der Hand. Mit der zeitgleichen Erfindung des Automobils dauerte der Transport über weitere Strecken schließlich nicht länger, als einst die kürzeren Wege mit den Pferdefuhrwerken. Außerdem hatten auch die verbreiteten Windmühlen nicht kontinuierlich Mehl geliefert, das täglich frisch in die Städte transportiert werden konnte. So ist die Lagerung von Mehl über längere Zeit wohl kaum eine Erfindung der letzten hundert Jahre. Müller und Bäcker in der Antike Andre J: L'alimentation et la cuisine à Rome. Paris 1961 Ursprünglich waren die Römer - im Gegensatz zu den Griechen - Breiesser. Sie speisten den puls, einen mit Milch gekochten Getreidebrei, der auch mit Käse, Honig oder Eiern verfeinert wurde. Als Grundlage rösteten sie unreife Gerste, vergleichbar unserem Grünkern. Oder sie stampften Weizen vorsichtig mit einem hölzernen Stößel, um die Randschichten zu entfernen. Die so gewonnenen Graupen boten eine gute Brei- und Suppengrundlage. Später, zur Kaiserzeit, verwendete der römische Koch Apicius für seine pultes nur noch reinstes Weißmehl mit Zugabe von Hirn, Fleisch und vielen Gewürzen. Die älteste, in vielen Schriften erwähnte „Mahltechnik“ wurde im Mittelmeerraum praktiziert und begann mit dem Rösten der Körner. Dadurch konnten bespelzte Weizenarten wie Emmer oder Einkorn im Mörser enthülst und anschließend zu Mehl gestampft werden. Hatte schon das Rösten den Gehalt an Antinutritiva vermindert, erfolgte mit dem Kochen zu Brei oder Suppe nochmals eine Reduzierung dieser dem menschlichen Verdauungstrakt unbekömmlichen Substanzen. Erst mit dem Aufkommen der Nacktweizenarten bürgerte sich das Dreschen ein. Allerdings wurde immer noch geröstet. Das machte das Korn haltbarer und leichter, ein Vorteil, der vor allem für die römischen Legionäre wichtig war. Die Mehlqualität bei den klassischen Völkern entsprach zwar nicht unserem modernen Weißmehl, denn beim Mahlen bröckelten die Mahlsteine ab oder Sand und Unkrautsamen wurden mit verarbeitet. Doch die Weißbrotbäcker verwendeten bevorzugt dieses weißes Mehl mit möglichst wenig Kleie. Daraus buken sie Brot (panus candidus) nach Rezepten, die sich grundsätzlich nicht von unseren heutigen traditionellen Backverfahren unterscheiden. Selbst die Teigsäuerung war schon von Bedeutung. Dazu verwendeten die Brotbäcker der Antike eine Art Sauerteig, den sie einmal im Jahr, zum Zeitpunkt der Weinlese, herstellten. Sie verkneteten Hirsemehl mit Most und formten daraus kleine Klößchen (pastilIi), die sie mit gutem Mehl (similago) aufkochten. In Gallien und Spanien benutzte man schon damals Bierhefen. Die Menschen in der Antike kannten nicht nur Weißmehl, sie gewannen sogar reine Stärke (amylum). Dazu wurden die Körner gut eine Woche eingeweicht, umgerührt und gemaischt. Dann entfernte man die Spelzen, drückte den Brei in Tüchern aus und legte die Masse zum Trocknen in die Sonne. Die Stärke diente sowohl als Soßengrundlage als auch zum Backen von Brot oder Kuchen. Mittelalter: Vollkornbrot nur aus Not Günther F: Mehl und Brot der deutschen Vergangenheit im Lichte der Gegenwart. Leipzig 1937 Jeder, der sich heute über Ernährung informiert, lernt, dass Vollkornbrot gesünder ist, weil es das ursprünglichere Brot sei. Weißes Brot hätten nur die Reichen genossen, während die Armen nur dank Körnerkost bei Kräften geblieben seien. Das verrät uns aber eigentlich nichts über den gesundheitlichen Wert, zumal die Lebenserwartung der Wohlhabenden gewöhnlich höher lag als die der Mittellosen. Bevor sich das Brot als Alltagsspeise etablierte, aßen die Menschen im Mitteleuropa Brei, meist aus Hafer oder Hirse. Der Hafer, das einstige Hauptgetreide unserer Vorväter, musste aber vor dem Kochen entspelzt werden. Zu diesem Zweck wurde das Getreide "gereIlt", d. h. die Schalen wurden durch zwei hochgestellte Mühlsteine abgerieben. Als der Weizen an Boden gewann, galt es, die mühlentechnischen Verfahren weiter zu verbessern, um möglichst viel Kleie vom Mehl abzutrennen. Hier halfen Siebe aus feinstem Weidengeflecht, Bast oder Flachs. Beste Ergebnisse erzielten die keltischen Gallier mit Geflechten aus dem Haar von Pferdeschweifen. Gut gebeutelt Eine grundlegende Verbesserung gelang im Mittelalter mit der Einführung der Mehlbeutel. Das Mehl landete nach dem Mahlen direkt in Stoffsäcken und wurde in speziellen Schüttelvorrichtungen so lange „gebeutelt“, bis nur noch die Kleie zurückblieb. Je feiner das Gewebe, desto besser das Mehl. Besonders Wohlhabende nutzten die teuren holländischen Seidenbeutel. Beliebt waren aber auch die engmaschigen sächsischen oder englischen Leinenbeutel. Für das Brot der Soldaten mussten die gröberen Beutel, die sogenannten Kommissbeutel, genügen. Auch aus Roggen wurde Auszugsmehl gemahlen, wie eine Urkunde des Stiftes Falkenhorst aus dem Jahre 1090 belegt. Dort wird es ausdrücklich unter der Bezeichnung "roggo subtilis" namhaft gemacht. Professor Felix Günther: „Beide mittelalterlichen Auszugsmehle, sowohl das Weizen- wie das Roggenauszugsmehl, haben sich nach allem, was uns darüber berichtet wird, von den Auszugsmehlen der Neuzeit nicht wesentlich unterschieden.“ Kleie fürs Vieh Nur wenn Schmalhans Küchenmeister war, wie in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, streckten die Hungernden das Mehl mit Kleie und verschiedensten anderen Zutaten, vor allem Eicheln. Sonst galt das Urteil des berühmtesten Müllermeisters des 18. Jahrhunderts, des Sachsen Johann Christian Füllmann: „Hat ein Mehl mehr Kleye, so verliert das Brod viel von seinem Wert; und der kleine Vorteil, dass man ein wenig mehr Mehl bekommt, kommt nicht in Vergleichung mit dem zehnmal größeren Schaden, den man an den Brod hat.“ Wer grobes, schwer verdauliches Brot servierte, galt schlichtweg als „Geizkragen“. Was geschah aber mit der Kleie? Auch sie wurde verwertet - als Futter fürs Vieh. Schon allein deshalb achteten die Bauern darauf, dass auch genügend Kleie übrig blieb. Dieses Viehfutter in die menschliche Ernährung einzuführen, hat sich die Ernährungswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten redlich bemüht. Und sie hat viel erreicht: Ob aus vollem Korn oder mit speziellen Ballaststoffzusätzen, unsere Bäckereien offerieren eine Vielzahl abführender Erzeugnisse. Das, was einst nur für Schweine gut war, avancierte mittlerweile zum gesundheitlichen Heilsbringer. Unverblümt urteilte darüber 1937 Professor Felix Günther: „Der Glaube, dass einem Volke seine Ernährungsform durch die Ergebnisse von Fäkal-Untersuchungen und Kalorienberechnungen aufgenötigt werden könnte, gehört zu den gewagtesten Verstiegenheiten, die es je auf geistigem Gebiete gegeben hat.“ Wozu Müller, wozu Bäcker? Warum aber mühten sich die Menschen überhaupt ab mit dem Mahlen und dem Backen? Sie brauchten Arbeitskraft, später auch Wind, Wasser oder Zugtiere, um Mehl zu mahlen. Für den Ofen mußte Holz geschlagen und zerkleinert werden. Selbst das Kneten erforderte Muskelarbeit, die anderswo dringend benötigt wurde. Erst die Entdeckung der Antinutritiva erklärt, warum Menschen seit Urzeiten ihr Getreide nicht roh aßen. Sie entwickelten aufwendige Verarbeitungstechniken, um diese unerwünschten Substanzen abzubauen und aus schwer verdaulichen Körnern bekömmliches Brot zuzubereiten. Wiedergekaut ist halb verdaut Wie die optimale Verarbeitung abläuft, machen uns die Wiederkäuer vor, deren Verdauungssystem auf die Nutzung von cellulosehaltigem Material wie Getreide angepasst ist. Die Tiere verschlingen innerhalb kurzer Zeit große Nahrungsmengen. Ihr komplexes Magen- System fermentiert die Nahrung wie in einem Gärbottich. Das im Magen aufbereitete Mahl wird nochmals zurücktransportiert, gut durchgekaut und dann endgültig hinuntergeschluckt und verdaut. Experiment geglückt Da der Verdauungstrakt des Menschen nicht auf dieses Gärverfahren ausgerichtet ist, musste er die Müllerei, die Teigführung und das Brotbacken entwickeln. Die Fermentation des Brotteigs bewirkt dasselbe wie das gründliche Kauen und der Gärprozess im Wiederkäuermagen: Sie schließt das Getreide auf für die Verdauung und Resorption der darin enthaltenen Nährstoffe. Gleichzeitig werden Abwehrstoffe durch die Sauerteigführung beseitigt oder durch den Backprozess zerstört. Kollath - ein Denkmal wankt Von Udo Pollmer Der Hygieniker Werner Kollath (1892-1970) gilt als der „Vater“ der Vollwerternährung. Von ihm stammt die Idee, jeden Morgen etwas geschrotetes und über Nacht eingeweichtes Getreide zu essen. Während er täglich zwei Esslöffel empfahl, stiegen nach seinem Tode die Dosierungen. Sind es bei Bruker bereits drei Eßlöffel Getreideschrot, so fordern v. Körber, Männle und Leitzmann „täglich mindestens 3 Esslöffel Getreide als Frischkornbrei“ zu verzehren. Bei einschlägigen Fortbildungen und Seminaren wird die Menge in der Regel nochmals erhöht wird, getreu dem Motto „viel hilft viel“. Hinzu kommen reichlich Dinkelbratlinge, Vollkornbrot und Vollkornnudeln. All diese Ratschläge gehen zurück auf Kollaths Experimente aus den Jahren 1930 bis 1945, die zunächst auf den gesundheitlichen Einfluss der Milch und nicht auf das Getreide hinwiesen. Die Ergebnisse seiner Rattenversuche hingen damals in erster Linie davon ab, welches Casein er fütterte. Nahm er Casein, das mit Alkohol bei 78° C gewonnen wurde, litten die Tiere unter Gedeihstörungen und starben vorzeitig. Verwendete er hingegen Casein, das mit Äther bei nur 35° C extrahiert worden war, blieben seine Ratten gesund und munter. Da Vitaminzulagen kaum Einfluss auf das Ergebnis hatten, vermutete Kollath, dass die Erhitzung des Alkohol-Caseins einen noch unbekannten „Lebensfaktor“ zerstört hatte. unbekanntes Vitamin entfernte oder zerstörte. Mit seinem Frischkornbrei, der bald als „Kollath-Frühstück“ in die Ernährung seiner Anhänger einzog, hoffte er, endlich den ersehnten Schlüssel zur Vorbeugung vor praktisch allen bekannten Zivilisationskrankheiten in Händen zu halten. Entscheidend: der Käfig ... Der Erfolg von Experimenten hing allerdings davon ab, ob die Tiere in Zinkkäfigen gehalten wurden: „Die Verwendung dieser Käfige ist Voraussetzung für das Gelingen der Versuche,“ schrieb er 1950. Die naheliegende Schlussfolgerung, dass damit seine Experimente nur noch bedingt auf den Menschen übertragbar sind, der nicht im Zinkkäfig hockt, wurde nicht mehr diskutiert. Dass unterschiedliche Lösungsmittel und Verfahren außerdem unterschiedliche Effekte auf das Substrat haben können, wurde von ihm ebenfalls nicht thematisiert. Durch die unkritische Übernahme seiner Schlussfolgerungen haben seine Jünger das genaue Gegenteil von Kollaths Zielsetzung bewirkt: Gesundheitsschäden durch Vollwerternährung bzw. Vollwertkost. Das ist tragisch - aber nicht Kollath anzulasten. Aus heutiger Sicht läßt sich aus seinen Versuchen nur eine Conclusio mit Sicherheit ableiten: Die klassischen Experimente der Vitaminforschung bedürfen dringend einer Überprüfung mit modernen Methoden. Nicht mehr - aber auch nicht weniger. Vollkorn - voll Wert? Auf Getreide kam Kollath, nachdem seine siechen Versuchstiere durch eine Zulage an Getreideschrot wieder gesund wurden. Nun vermutete er diesen Lebensfaktor auch im Vollkorn. Weißmehl und Zucker erwiesen sich hingegen als wirkungslos. Damit musste das neue Vitamin irgendwo in den Randschichten des ganzen Korns enthalten sein - eine Interpretation, die natürlich stark von der Gedankenwelt der damaligen Vitaminforschung geprägt war. Nachdem Kollath bei seinen Ratten infolge diätetischer Manipulationen zahlreiche degenerative Veränderungen feststellen konnte, glaubte er, die gemeinsame Ursache aller Zivilisationserkrankungen entdeckt zu haben: Die industrielle Lebensmittelverarbeitung war schuld an den meisten Malaisen der modernen Zeit. Sie war es, die durch Erhitzung und Raffination ein noch ... oder die Erkenntnis? Hätten jene, die Kollaths Namen stets im Munde führen, seine Schriften aufmerksam gelesen, dann wäre auch ihnen aufgefallen, dass es eine Erfindung unserer Zeit ist, Getreide roh zu essen. In der „Ordnung unserer Nahrung“ hebt Kollath eine wesentliche Erkenntnis auch im Schriftbild hervor: „Nun mußte es auffallen, daß die Menschen früher niemals den Weizen als Frischkornschrot gegessen haben.“ Warum wohl? Kollath W: Die Ordnung unserer Nahrung. Heidelberg 1977 Kollath W: Der Vollwert der Nahrung. Heidelberg 1981 v. Körber K et al: Vollwert-Ernährung. Grundlagen einer vernünftigen Ernährungsweise. Heidelberg 1981 Vollbremsung für Vollkorn Neben Vitaminen und Mineralstoffen sitzen in den äußeren Schichten des Getreidekorns zahlreiche pflanzeneigene Abwehrstoffe, die den potentiellen Fraßfeinden den Appetit verderben sollen. Im Rahmen der Züchtung wurden die unbekömmlichen Abwehrstoffe vermindert und zur Erhöhung des Nährwertes durch „leere Kalorien“ ersetzt. Deshalb bedürfen die Nutzpflanzen der Hege und Pflege des Menschen. Die Unkräuter hingegen, die nicht durch züchterische Maßnahmen ihrer Wehrhaftigkeit beraubt wurden, können ohne Pflanzenschutz in freier Wildbahn bestehen. Aus der Tierernährung ist bekannt, dass diese „Antinutritiva“ genannten pflanzeneigenen Abwehrstoffe zu Wachstums- und Gedeihstörungen führen können. Leider mangelt es an aussagekräftigen Untersuchungen über die antinutriven Effekte des Getreides auf den menschlichen Körper. Die Ernährungswissenschaft konzentrierte ihre Bemühungen in den vergangenen Jahren fast ausschließlich auf die vermuteten Vorteile der Vollkorn-Ernährung, ohne jedoch den ernsthaften Versuch zu unternehmen, ihre Spekulationen durch harte Daten zu stützen. Dass die Körnerwelle ihren Siegeszug in die Küchen nicht geschafft hat, mag seine Ursache wohl hauptsächlich in den nachteiligen Wirkungen der sekundären Inhaltsstoffe des Getreides auf die Bekömmlichkeit haben. Denn diese biologische Rückkopplung bestimmt unseren Appetit und nicht die viel beschworene „Ernährungsaufklärung“. Weizen: Durchgefallen Choct M, Annison G: The inhibition of nutrient digestion by wheat pentosans. British Journal of Nutrition 1992/67/S.123-132 Selbst bei Masthähnchen mit ihrem spezialisierten Verdauungstrakt führt zu viel Getreide zu Gedeihstörungen. Ursache sind unter anderem die Pentosane in den Randschichten des Kornes. In der Humanernährung werden sie unter dem Begriff der Ballaststoffe oder der Nicht-Stärke-Polysaccharide subsummiert und ihr regelmäßiger Konsum im Rahmen einer ausgewogenen und vollwertigen Ernährung empfohlen. Die Tierernährer hielten nie viel von den Pentosanen. Sie gestanden ihnen allenfalls einen geringen kalorischen Wert zu, da sie über die Fermentation der Darm- flora zu kurzkettigen Fettsäuren theoretisch etwas Energie liefern sollen. Mittlerweile mussten sie erkennen, dass Pentosane ab einer Dosis von 50 Gramm pro Kilo Futter genau das Gegenteil bewirken. Sowohl die βGlucane der Gerste als auch die Arabinoxylane des Roggens verursachen bei Masthähnchen Durchfall und vermindertes Wachstum. Ein Zusatz von Enzymen, die Pentosane spalten, wie Glucanasen oder Pentosanasen, hebt die nachteiligen Effekte weitgehend auf. Da auch Weizen reichlich Pentosane enthält, wurde der Einfluss wässriger Extrakte (sog. „lösliche Ballaststoffe“) an Geflügel getestet. Fazit der Autoren: „Die schwere Wachstumsdepression, verursacht durch die Weizenpentosane, war nicht nur das Ergebnis einer verringerten Futteraufnahme. Es kam auch zu einer dramatischen Verschlechterung der Futterverwertung und die Vögel zeigten beachtlichen gastrointestinalen Stress, da sie reichlich wässrige Stühle ausschieden. Es fiel auf, dass die Tiere schwerfällig und lethargisch auf Umweltreize reagierten. Das legt nahe, dass sich die Effekte der Weizenpentosane nicht darauf beschränkten, den Nährwert zu vermindern sondern auch - direkt oder indirekt - allgemeine Beschwerden hervorriefen.“ Anmerkung: Handelsübliche Futtermischungen für Geflügel enthalten deshalb möglichst nur zwei, höchstens vier Prozent Pentosane. Der Pentosangehalt des Weizens liegt bei sechs Prozent. Es ist anzunehmen, dass Spezies, die schlechter an den Verzehr von Körnern angepasst sind, bereits bei geringeren Mengen mit Verdauungsproblemen und Konsumverzicht reagieren. Roggen: Appetitverderber Musehold J: Alkyl-Resorcine in Nutzpflanzen - Versuch einer biologischen Bewertung unter besonderer Berücksichtigung von Getreide. Getreide, Mehl, Brot 1980/34/ S.304-306 Verfüttert man größere Mengen Roggen an Schweine oder Ratten, so verlieren die Tiere ihren Appetit und bleiben im Wachstum zurück. Schließlich treten Lähmungserscheinungen auf, die sogar zum Tode führen können. Als spezifische Ursache entpuppten sich die Alkylresorcine aus den Randschichten des Roggenkorns. In vitro erwiesen sich Alkylresorcine als zellschädigend, sie zerstören Liposomen sowie rote Blutkörperchen. Über ihre Toxizität beim Menschen ist bisher so gut wie nichts bekannt, außer dass sie bei empfindlichen Personen Dermatitis auslösen können. Alkylresorcine zählen zu den phenolischen Verbindungen, deren Konsum als sekundäre Pflanzenstoffe derzeit in der Ernährungsberatung hoch im Kurs steht. Sie befinden sich nicht nur in den Randschichten des Roggens, sondern auch in Weizen und Gerste, wenn auch in deutlich geringerer Menge. Ihre ausgeprägte antimikrobielle Wirkung schützt den Roggen beim Keimen im Erdreich vor einem Befall durch Mikroorganismen. Außerdem zielt die Pflanze mit den Alkylresorcinen auf den Verdauungstrakt ihrer Fraßfeinde ab. Dort wirken sie als Enzyminhibitoren. Durch ihre hohe Affinität zum Trypsin stören sie insbesondere die Eiweißverdauung und beeinträchtigen so den verfügbaren Nährwert. Nährwerttabellen fälschlicherweise als besonders hochwertig erscheinen. Tatsächlich mindern sie auch noch die Verfügbarkeit der verbleibenden Nährstoffe. Enzyminhibitoren sind gleichzeitig wichtige Allergene im Getreide und Auslöser von Mehlstauballergien. Anmerkung: Da Roggen traditionell auch als Backschrot verwendet wird, sind Rückstände im Brot zu erwarten. Während der Sauerteigführung und durch das anschließende Backen werden diese gesundheitlich bedenklichen Stoffe aber bis auf unbedeutende Restmengen abgebaut (Cereal Chemistry 1997/74/S.284-287). Anmerkung: Die Nebenwirkungen einer Ernährung mit Vollkorn lassen sich prinzipiell von den Folgen therapeutisch genutzter Enzymblocker wie Acarbose ableiten. Durch die Blockade des Stärkeabbaus im Dünndarm erreicht intakte Stärke das Colon. Dort wird sie von der Darmflora in Glucose aufgespalten. Durch das reichliche Zuckerangebot herrschen ideale Bedingungen für das Gedeihen von Hefen wie z.B. Candida. Deshalb kommt es durch Vollkorn zu Flatulenz sowie zur Bildung toxischer Metaboliten wie Fuselalkoholen, biogenen Aminen und mutmaßlich auch Mykotoxinen. (Die Heilkunst 1988/101/H.5/S.3) Dies wäre eine naheliegende Ursache für die beobachteten Leberschäden nach Einnahme von Acarbose. Gerste: garstige Eiweiße Weizen: im Fettnäpfchen Zhang N et al: Purification and characterization of a new class of insect α-amylase inhibitors from barley. Cereal Chemistry 1997/74/S.119-122 Cara L et al: Milling and processing of wheat and other cereals affect their capacity to inhibit pancreatic lipase in vitro. Journal of Food Science 1992/57/S.466-469 Nach anerkannter Lehrmeinung wird der Nährwert eines Lebensmittels durch die analytisch erfassbaren Nährstoffe definiert. Leider greift diese Ansicht zu kurz, denn pflanzliche Lebensmittel enthalten gleichzeitig Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde. Das beeinträchtigt die Verdaulichkeit und damit auch den Nährwert. Wenn diese Antinutritiva seitens der Ernährungswissenschaft unter der Bezeichnung „sekundäre Pflanzenstoffe“ pauschal als integraler Bestandteil einer gesunden Ernährung empfohlen werden, kann das fatal sein. Besonders prädestiniert für Fehleinschätzungen sind Eiweiße. Etwa 10 Prozent des Gerstenproteins wirken toxisch auf menschliche Zellkulturen, Insekten und Mikroorganismen. Die Hordothionine entfalten ihre schädigende Wirkung im Darm ihrer Fraßfeinde, indem sie die Permeabilität der Darmwand erhöhen und die Eiweißsynthese behindern. Thionine sind auch im Hafer bekannt. Andere Eiweiße wirken als Enzyminhibitoren. Sie sind selbst unverdaulich und blockieren im Verdauungstrakt spezifisch einzelne Enzyme, vor allem α-Amylasen, aber auch Proteasen und Lipasen. Da sich die meisten Enzyminhibitoren durch einen hohen Gehalt an essentiellen Aminosäuren wie Cystein und Lysin auszeichnen, lassen sie das Protein des Getreides in den Vollkorn soll nach Ansicht der Vertreter der Vollwerternährung die „Blutfette normalisieren“. In der Tat beeinträchtigt der Verzehr von Vollkorn die Fettresorption. Aleuronschicht und Keimling enthalten lipase-Inhibitoren, die das Schlüsselenzym zum Abbau von Nahrungsfetten hemmen. Besonders hohe Gehalte an inhibitorischen Eiweißen finden sich in Durum, Weichweizen und Millet-Hirse, mäßige in Gerste und Sorghum-Hirse. Durch die Gewinnung von Weißmehl lassen sich die Gehalte an Lipase-Inhibitoren um etwa 80 Prozent vermindern. Auch der Backprozess trägt wesentlich zu ihrem Abbau bei. Bei Hartweizen erwies sich hingegen die Herstellung von Pasta als besonders effektiv und senkte die Aktivität der Inhibitoren unter die Nachweisgrenze. Anmerkung: Auch im Falle der Lipase-Inhibitoren können die Nebenwirkungen von Vollkorn vom „Fettblocker“ Orlistat abgeleitet werden. Wird die Fettspaltung eingeschränkt, kommt es zur Ausscheidung eines Teiles des verzehrten Fettes über den Stuhl. Gleichzeitig senken Lipaseblocker auch die Resorption fettlöslicher Vitamine, was die Nährstoffbilanz bei einer Ernährung mit Vollkorn zusätzlich verschlechtert. Damit wäre die vermeintliche „Normalisierung“ der Blutfette auf einen toxischen Effekt zurückzuführen. Weizenkeime: Risikomaterial Pusztai A et al: Antinutritive effects of wheat-germ agglutinin and other N-acethylglucosamine-specific lectins. British Journal of Nutrition 1993/70/S.313-321 Das wohl brisanteste des Weizens ist zweifellos ein Lektin, das sich im Keimling befindet. Lektine sind Eiweiße, die, teilweise auch blutgruppenspezifisch, mit der Oberfläche der roten Blutkörperchen reagieren. Dieser Bindung verdanken sie ihren zweiten Namen Agglutinine. Gleichzeitig sind auch Reaktionen mit anderen immunologisch wichtigen Glycoproteinen und Glycolipiden wahrscheinlich, aber kaum untersucht. Während die allgemein als giftig bekannten Lektine aus Hülsenfrüchten durch Erhitzen weitgehend zersetzt werden, ist das Weizen-Lektin sehr hitzestabil und auch noch in Brot und Brötchen aktiv. Das Weizen-Lektin, kurz WGA (wheat germ agglutinin) genannt, ist außerordentlich giftig für Pflanzenschädlinge. Die insektizide Wirkung war Anlass für eine toxikologische Prüfung, da beabsichtigt wurde, das WGA-Gen auf andere Nutzpflanzen zu übertragen, um sie so auf natürliche Weise vor Insektenfraß zu schützen. Im Tierversuch verminderte ein WGA-Zusatz im Futter das Wachstum gegenüber der Kontrollgruppe um ein Drittel. Auch die Futterverwertung, speziell des Eiweißes, war beeinträchtigt. Das WGA schädigte vor allem die Schleimhäute des Dünndarms und löste dort starkes Wachstum der Zotten aus. Nach 10 Tagen Versuchsdauer war der Dünndarm 45 Prozent schwerer als bei der Vergleichsgruppe. Ein erheblicher Teil des WGA gelangte durch Endocytose bis in den Kreislauf. Außerdem war bei den Versuchstieren die Bauchspeicheldrüse erheblich vergrößert. Gleichzeitig wurde eine Thymusatrophie beobachtet. Die Autoren befürchten, dass ein regelmäßiger Konsum von WGA die Funktionen der Bauchspeicheldrüse und des Immunsystems nachhaltig beeinträchtigen, zumal das WGA nicht durch körpereigene Proteasen abgebaut wird. Von einer Nutzung als Insektizid musste aufgrund der hohen Toxizität abgesehen werden. Weizenkeime: Darmschäden Cordain L et al: Modulation of immune function by dietary lectins in rheumatoid arthritis. British Journal of Nutrition 2000/83/S.207-217 Die Autoren halten Lektine für eine wichtige Ursache entzündlicher Darmkrankheiten wie Morbus Crohn und in der Folge auch von rheumatoider Arthritis. Sie unter- mauern ihre These mit folgenden Beobachtungen: Lektine rufen Entzündungen im Darm hervor, erhöhen die Permeabilität der Darmwand und verändern die Zusammensetzung der Darmflora bis hin zu pathologischen Zuständen (Overgrowth-Syndrom). Außerdem begünstigen sie die Translokation von Darmbakterien, also die Aufnahme von Bakterien über die Darmwand in die Blutbahn. Auf diesem Wege können - wie im Tierversuch gezeigt wurde - lebensbedrohliche Keime die inneren Organe erreichen. Da rheumatoide Arthritis oftmals mit einer pathologisch veränderten Darmflora einhergeht, glauben die Autoren, dass Lektine auch hierbei eine ursächliche Rolle spielen. Lektine im Weizen erleichtern die Aufnahme anderer Antigene durch die Darmwand. Deshalb sollte dem Weizenvollkorn bei der Suche nach den Ursachen von Allergien und Autoimmunkrankheiten größere Aufmerksamkeit zuteil werden. Wenn Vollkorn entzündliche Darmerkrankungen, Arteriosklerose und Arthritis fördert, ist der Verzehr von Weizenvollkorn ein Risikofaktor ersten Ranges. Egal, ob Weizenflocken, Frischkornbrei oder Vollkornbrot - alle diese Produkte können die Gesundheit eher gefährden als Weißbrot und Marmorkuchen, denn bei weißem Mehl sind die Lektine weitestgehend entfernt. Dies erklärt auch die Beobachtungen des Internisten und Rheumatologen Karl Pirlet mit Patienten, die ganz bewusst Vollwertkost aßen: „Nach Jahren, eventuell erst nach 10 bis 20 Jahren, kommt dann der gesundheitliche Zusammenbruch. Oft ein überraschend einsetzender Alterungsprozess, etwa am arteriellen System, am Gelenksystem. Völlig verfahrene Zustände. Ich erlebe sie Tag für Tag in meiner Praxis. Natürlich will dann niemand wahrhaben, dass die doch so gesunde Ernährungsweise vergangener Jahre verantwortlich sein soll für das jetzt in Erscheinung tretende gesundheitliche Fiasko.“ (Erfahrungsheilkunde 1992/41/S.345-356) Trotz der bekannten Risiken wird der Verzehr lektinhaitiger Nahrungsmittel Diabetikern immer wieder zur Regulierung des Blutzuckers empfohlen. „Besonders Getreide und Hülsenfrüchte haben aufgrund ihrer speziellen nicht-nutritiven Inhaltsstoffe eine den Blutglukoseverlauf dämpfende Wirkung, was besonders bei Diabetikern von präventivem bzw. therapeutischem Nutzen sein kann“ (Watzl, Leitzmann: Bioaktive Substanzen in Lebensmitteln, Stuttgart 1995, S. 109110). Phytin: Energiereiche Abwehr In der Reihe der pflanzeneigenen Abwehrstoffe fehlt nun noch der bekannteste: das Phytin (myoInosit-hexaphosphat), das immerhin bis zu drei Prozent des Getreidekorns ausmacht. Bereits 1872 wurde dieser Stoff in der Aleuronschicht des Getreides nachgewiesen. Neben seiner Rolle, Fraßfeinde wie Insekten oder Säugetiere abzuwehren, fungiert Phytin in der Pflanze in erster Linie als „Batterie“: Es liefert die nötige Energie zum Keimen bis das Pflänzchen Chlorophyll bildet und so zur Photosynthese befähigt ist. Diesem Zweck dienen die sechs energiereiche Phosphatbindungen, vergleichbar dem ATP in der tierischen Zelle. Je nachdem, welche der Bindungen gespalten werden, entstehen Dutzende von Isomeren (Inositphosphate). Wenn alle Phosphatgruppen abgespalten sind, erhält man das myo-Inosit, einen sechswertigen cyclischen Alkohol. Weil es das Wachstum von Hefen fördert, wurde es sogar schon den BVitaminen zugeordnet. Auch im tierischen Gewebe kommen Phytin und seine Abbauprodukte vor. Der Körper bildet sie selbst und nutzt sie insbesondere als Neurotransmitter, Hormone und Wachstumsfaktoren wie Acetylcholin oder Vasopressin. Mineralstoffmangel durch Vollkorn Sandberg A-S: Antinutrient effects of phytate. Ernährung/ Nutrition 1994/18/S.429-432 Sandberg A-S, Svanberg U: Phytate hydrolysis by phytase in cereals. Journal of Food Science 1991/56/S. 1330-1334 Sandberg A-S et al: Iron absorption from bread in humans. Journal of Nutrition 1992/122/S.442-449 McCance, Widdowson EM: Mineral metabolism of healthy adults on white and brown bread dietaries. Journal of Physiology 1942/101/S.44-85 Phytin in der Nahrung bindet zweiwertige Ionen wie Zink, Eisen, Calcium oder Magnesium. Bei physiologischem pH-Wert während der Verdauung sind diese Komplexe unlöslich, so dass sie der Körper nicht verwerten kann. Daneben reagiert Phytin mit Eiweißen, insbesondere mit Verdauungsenzymen wie Amylasen. Das führt zu einer zusätzlichen Minderung des Nährwerts der aufgenommenen Nahrung. Die nachteiligen Effekte des Korns auf den Mineralstoffhaushalt kennt man seit sechzig Jahren. Damals zeigten Tierversuche, dass eine Ernährung, die reich an Cerealien ist, Rachitis fördert. Je höher der Phytingehalt desto stärker wurde die Calciumversorgung beeinträchtigt. Dramatische Folgen hatte das für viele Kinder während des Zweiten Weltkrieges in Irland. Da Getreide knapp war, mahlte man ab 1940 ausschließlich noch Vollkornmehl. Als Folge stieg die Zahl der an Rachitis erkrankten Kleinkinder sprunghaft an. Ab 1943 konnte wieder weißes Mehl gemahlen werden. Damit sanken die Rachitisfälle ebenso schnell wie sie zuvor angestiegen waren. (EU.L.E.N-SPIEGEL 1996/H.5/ S.5). Paradoxerweise gefährdet volles Korn ebenfalls die Versorgung mit Zink, obwohl die Nährwerttabellen gerade dem Weizen einen beachtlichen Zinkgehalt attestieren. Wachstumsprobleme durch Zinkmangel sind aus dem Iran und Ägypten von Personen bekannt. Ihre Kost besteht vorwiegend aus nichtfermentiertem Getreide (Brei, ungesäuerte Fladenbrote), oder anderen phytinreichen Nahrungsmitteln wie manche Arten von Hülsenfrüchten. Auch die Zufuhr an Eisen liegt bei Körnerkost weit niedriger als die Nährwerttabellen erkennen lassen: In frischem Weizen beträgt die Bioverfügbarkeit des Eisens unter physiologischen Bedingungen gerade einmal drei Prozent. Die Verarbeitung entscheidet Meuser F, Meissner U: Verfahrenstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des Phytatabbaus bei der Vollkornbrotherstellung. Ernährung/Nutrition 1987/11/S.102-109 Analysen von Broten aus dem Handel zeigen, dass der Phytingehalt in einem weiten Bereich schwankt. In Vollkornbroten fanden Prof. Friedrich Meuser und Mitarbeiter vom Institut für Lebensmitteltechnologie der TU Berlin dreimal so viel Phytin wie in Mischbroten. Der Spitzenwert im ballaststoffangereicherten Knäckebrot lag 16 mal höher als im Weißbrot. Da der Phytingehalt innerhalb der einzelnen Brotsorten ebenfalls Schwankungen unterlag, untersuchten die Autoren, inwieweit die Art der Brotzubereitung Einfluss auf das Phytin nimmt. Als besonders effektiv erwies sich der traditionell hergestellte Sauerteig. Innerhalb von acht Stunden reduzierte diese Art der Teigbereitung den Phytingehalt um 90 Prozent, innerhalb von 16 Stunden um 95 Prozent. Wichtigste Voraussetzung für den Phytinabbau ist, dass die im Korn bereits enthaltene Phytase optimal arbeiten kann. Entscheidend dafür war, dass die Löslichkeit des Phytins durch das langsame Absinken des pH-Wertes anstieg. Die Teigtemperatur spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Eine herbe Überraschung für die Bäckereitechnologie waren der schlechte Effekt bei Brühstück und Quellstück. Beide Verfahren wurden erfunden, um Körnerbrot ohne Sauerteig herstellen zu können. Beim Quellstück weichen die Körner über Nacht ein. Damit wird verhindert, dass die Körner dem Brotteig während des Backens das Wasser entziehen und das Brot trocken und krümelig werden lassen. Der ist dabei nur sehr gering. Jeglicher Abbau unterbleibt beim Brühstück. Dabei überbrüht der Bäcker die Körner mit heißem Wasser, um den Quellvorgang zu beschleunigen, wobei die in den Randschichten sitzende Phytase zerstört wird. Fazit: Ernährungsphysiologisch entsprechen diese Körnerbrote allenfalls gehobenen Abführmitteln. Kunstsauer: nur eine Krücke Fretzdorff B, Brümmer J-M: Reduction of phytic acid during breadmaking of whole-meal breads. Cereal Chemistry 1992/69/S.266-270 In deutschen Bäckereien wird statt des traditionellen Natursauerteigs häufig Kunstsauerteig verwendet. Für den Bäcker hat das den Vorteil, dass das Brotbacken weniger arbeitsaufwändig ist und weniger Zeit beansprucht. Braucht ein normales Sauerteigbrot mindestens 12 Stunden Reifezeit bis es in den Ofen geschoben wird, können Brote mit Kunstsauer schon nach drei bis vier Stunden gebacken werden. Kunstsauer ist eine Mixtur aus Säuren, Mineralsalzen, Enzymen und Trägerstoffen, die vor allem die nötige Säure liefert, um die Teigbildung auf chemischem Wege schnell einzuleiten. Besonders roggenreiche Brotsorten brauchen die Säure, denn die Kohlenhydrate des Roggens können nur im sauren Milieu die Krume des Brotes stabilisieren. Im Gegensatz zum Weizenmehl enthält Roggen kein Klebereiweiß, dass die Teigstruktur während des Backens festigt. Die biologischen Effekte der Sauerteigflora werden dabei nicht nachgeahmt. Von erheblicher ernährungsphysiologischer Bedeutung ist die Frage, ob bei der Verwendung von Kunstsauerteig ebenfalls ein Phytinabbau erfolgt. Das wäre zu erwarten, weil das Getreide ja das abbauende Enzym, die Phytase, enthält. Zu diesem Ergebnis kommen auch Untersuchungen der Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung in Detmold. Sie zeigen, dass der Abbau des Phytins davon abhängig ist, ob es gelingt, den optimalen pH für die getreideeigene Phytase zu schaffen. Abb.1: Phytinabbau im Sauerteig, Quellstück, Brühstück Anmerkung: Die Mikroflora des Sauerteigs schafft nicht nur den im Korn eine optimale Arbeitsumgebung, sie trägt selbst kräftig zum Abbau von Phytin mit bei. Die typischen Milchsäurebakterien Lactobacillus plantarum, L. acidophilus und L. Mesenteroides des Sauerteigs waren alle in der Lage, Phytin innerhalb von neun Stunden über 90 Prozent abzubauen. (Journal of Agricultural and Food Chemistry 2000/48/S.2281-2285) Anmerkung: Leider läßt sich den Daten nicht entnehmen, in welchem Umfang es tatsächlich zum vollständigen Abbau, d. h. zur Bildung von myo-Inosit gekommen ist. Die Autoren unterlassen es, mitzuteilen, was sie denn wirklich untersucht haben. Auch fehlen vergleichende Untersuchungen zum Phytingehalt von Handelsproben mit Natur- und Kunstsauer, so dass die Frage nach dem gesundheitlichen Wert des Kunstsauerbrotes bis heute nicht befriedigend beantwortet werden kann. Geht man aber von der Beobachtung aus, dass der 90prozentige Abbau des Phytins acht Stunden Zeit in Anspruch nimmt, liegt die Vermutung nahe, dass die künstlich gesäuerten Turbobrote einen höheren Phytingehalt aufweisen als ihre nach traditionellen Verfahren in Ruhe gereiften Pendants. Phytin: neues Wundermittel Shamsuddin AM: Inositol phosphates have novel anticancer function. Journal of Nutrition 1995/125/S. 725S-732S Takada K et al: Modification of N-Butyl-N-(4-Hydroxybutyl) nitrosamine-initiated urinary bladder carcinogenesis in rats by phytic acid and its salts. Food and Chemical Toxicology 1994/32/S. 499-503 „In vivo- sowie in vitro-Versuche haben ein bemerkenswertes anticancerogenes Potential (sowohl präventiv wie auch therapeutisch) für Phytin ... nahegelegt“, urteilt Abulkalam Shamsuddin von der Medizinischen Hochschule in Baltimore. Sieht man von eher suspekten Versuchen in Reagenzgläsern und mit Tieren ab, bei denen das Phytin in die Bauchhöhle oder intravenös gespritzt wurde, bleiben nur wenige Versuche, die Shamsuddins populäre Hypothese stützen. Mäuse entwickelten weniger Darmkrebs bei Gabe von Phytin im Trinkwasser, wenn als Tumorauslöser Azoxymethan und 1,2-Dimethylhydrazin verwendet wurden. Die Fütterung von Phytin bremste bei Ratten die Proliferation des Darmepithels und der Brustzellen. Schließlich vermutet der Autor, dass es mit Phytin sogar möglich sei, AIDS zu behandeln. Toxikologische Experimente anderer Arbeitsgruppen fallen ernüchternder aus. Die Fütterung von Ratten mit Natriumphytat zusammen mit einem Nitrosamin als Krebspromotor, erhöhte die Rate an Blasenkrebs. Kaliumphytat förderte die Bildung von Darmgeschwulsten, während Phytinsäure keinen Effekt auf die Krebsentstehung hatte. Anmerkung: Angesichts des seit Jahren propagierten Vollkornverzehrs wundert es nicht, dass die Ernährungswissenschaft nun bei einer Ernährung mit phytinreichen Lebensmitteln gesundheitliche Vorteile zu erkennen glaubt: Phytin schützt vor Krebs, lautet ihre Botschaft. Doch die Datenlage spricht gegen einen nennenswerten Einfluß, zumal der Körper Phytin gar nicht aufnehmen kann. Ratten lehnen Dosierungen von über einem Prozent Phytin im Trinkwasser instinktiv ab. Von daher ist ein Nettonutzen einer reichlichen Zufuhr selbst für Ratten zweifelhaft. Ballaststoffe: Probe aufs Exempel Was wird nun angesichts dieser Überlegungen aus den hochgelobten Körnersemmeln? Ob ihres Gehalt an unverdaulichen Nahrungsbestandteilen sollen sie nicht nur vor Verstopfung, sondern auch vor Darmkrebs und vielen Krankheiten schützen. Doch nach einem fulminanten Start ist den Bundesbürgern der Appetit auf Körner inzwischen wieder abhanden gekommen. Die Bäcker vermelden seit Jahren jedenfalls einen sinkenden Anteil an Körnerbroten. Offenbar hat das, was da unverdaut wieder ausgeschieden wird, seine Bewährungsprobe nicht bestanden. Unsere Vorfahren wussten das offensichtlich auch ohne moderne Ernährungswissenschaft. Keine Gesundheitsförderer Fuchs CS et al: Dietary fiber and the risk of colorectal cancer and adenoma in women. New England Journal of Medicine 1999/340/S.169-176 Ballaststoffe schützen vor Darmkrebs, behauptete der Tropenmediziner Burkitt vor nunmehr dreißig Jahren (EU.L.E.N-SPIEGEL 1998/H.9/S.7). Seine Hypothese beruhte auf der Beobachtung, dass sich die auf dem Lande lebenden Afrikaner ballaststoffreicher ernährten und seltener an Dickdarmkrebs erkrankten als die Weißen in den Metropolen Südafrikas. Nun widerlegten Ergebnisse der Nurses Health Study, einer prospektiven Studie mit knapp 90.000 amerikanischen Krankenschwestern, zum wiederholten Male diese Hypothese. Die Frauen nahmen täglich zwischen 8 und 35 Gramm Ballaststoffe auf. So sehr sich die Autoren auch bemühten, sie konnten keinen Zusammenhang zwischen der Höhe der Ballaststoffzufuhr und dem Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, feststellen. Selbst die Berücksichtigung von erblicher Belastung, Alter, Gewicht, körperlicher Aktivität, Rauchgewohnheiten oder dem Fett-, Fleisch- und Alkoholkonsum beeinflusste das Ergebnis nicht. Anmerkung: Dieses Ergebnis wird mittlerweile von allen Studien mit prospektiven Design bestätigt. (EU.L.E.N-SPIEGEL 2000/H.5/S.14) Patienten mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko profitierten nicht von einer täglichen Extraportion an Ballaststoffen (EU.L.E.NSPIEGEL 2000/H.4/S.13). Auch bestätigte sich nicht, dass ballaststoffreiche Ernährung den Cholesterinspiegel wirksam senkt (American Journal of Clinical Nutrition 1999/69/ S.30-33). Kreuz und quer durchs Internet Kaum jemand, der keinen Internet-Zugang hat und nicht täglich etwas im Netz „erledigt“ oder nachschaut. Aber bei der Suche nach geeigneten Informationen kann man schnell ungeduldig werden. Zu groß ist die Zahl der Angebote, zu unübersichtlich verzweigt und verlinkt sich alles. Bei der vermeintlich schnellen Suche nach Informationen ist sich der Nutzer zuweilen hilflos selbst überlassen. Auch unter dem Stichwort Gentechnik findet sich allerhand: erstaunlich Informatives und erschreckend Schlechtes. Hier ein paar ausgewählte Treffer zu Grundlagen der Gentechnik und gentechnischen Anwendungen in Lebensmitteln: Robert-Koch-Institut http://www.rki.de/GENTEC.HTM Das Angebot des Robert-Koch-Institutes in Berlin behandelt hauptsächlich den rechtlichen Rahmen gentechnischer Anwendungen. Hier kann man die gesetzlichen Bestimmungen nachschauen, sich über die Nutzung von gentechnischen Anlagen in den einzelnen Bundesländern informieren oder nachlesen, wie es aktuell mit Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen aussieht. Beantragte und genehmigte Freisetzungen sind ausführlich aufgelistet. Aber auch für diejenigen, die sich nicht für Paragraphen und Tabellen interessieren, ist diese Seite empfehlenswert. Das umfangreiche Linkangebot der Webseite zu den Themen Gentechnik und Biotechnologie kann sich sehen lassen. Von hier aus kann man sich durchklicken: von A wie American Soybean Association über B wie B90/Grüne, von G wie Greenpeace über N wie Novartis und M wie Monsanto bis zu Z wie Uni Zürich. Eine sehr ausgewogenen Auswahl von Gruppen, die mitreden wollen. Ich klicke auf: Forum für Grüne Gentechnik und Biotechnologie http://www.gen-Info.de Die Tagesmeldungen aus mehr als 50 deutschsprachigen Zeitungen und Journalen zum Thema Gentechnik und Ernährung werden hier präsentiert. Wer mit dem Pressespiegel bequem auf dem Laufenden des weltweiten Gentechnik-Geschehens bleiben will, sollte unbedingt das E-Mail-Abo nutzen. Dann kommt das Neueste über Genfood täglich per Mail. Verbraucher-Initiative e.V. http://www.transgen.de Wem der politische Diskurs der Zeitungen zu weltfremd ist, kann zur Verbraucher-Initiative klicken. Sie bietet umfassende Informationen darüber, was denn nun wirklich so auf unserem Tisch landet. In dieser beachtenswerten Sammlung von Wissenswertem kann man lange herumstöbern. Neben tagesaktuellen Nachrichten bietet das Forum ausführliche Hintergrundberichte zu ausgewählten Themen und vor allem umfangreiche Datenbanken. Diese lassen sich beispielsweise nach Lieblingslebensmitteln, Pflanzen oder Zusatzstoffen durchsuchen. Die Rubrik „Recht und Zulassung“ bietet einfache Erläuterungen, die selbst dem Laien den Gesetzestext verständlich machen. Sehr hilfreich ist auch die gut sortierte und kommentierte Linksammlung der Homepage. Kaum zu glauben, doch der unermessliche Fundus an Informationen ist darüber hinaus außergewöhnlich übersichtlich dargestellt. Erfreulich ist ebenfalls, dass die Verbraucher-Initiative trotz der tendenziell kritischen Beiträge keine unnötig polemischen Darstellungen unters Volk bringt. Hier besticht die Anhäufung von Informationen. Greenpeace http://www.greenpeace.de/ Für überzeugte Gentechnik-Gegner, die ohnehin wissen, was sie lesen wollen, ist diese Adresse durchaus zu empfehlen. Was die Seite von Greenpeace noch interessant macht, ist das „Einkaufsnetz“ der Umweltorganisation. Nur an dieser Stelle werden Produkte, die aus gentechnisch verändertem Mais oder Soja hergestellt sind, aufgelistet. Auf dieser „Positivliste“ stehen derzeit 16 tatsächlich gekennzeichnete Waren. Sie bietet zwar keine umfassende Hilfe für den „gentechnikfrei“ essenden Internet-Surfer, Bedeutung hat die Initiative von Greenpeace aber auf politischer Ebene. Produkte, auf die hier erst einmal aufmerksam gemacht wurde, haben auf Dauer kaum eine Marktchance. Die aktuelle Liste kann auch per Fax unter 040/38998088 abgerufen werden. wert, da sie nach Verbraucherorganisationen, Industrieund Regierungsinformationen, Internetquellen der Gentechnikopposition oder Internetseiten der Forschung unterscheidet und dem Nutzer so schon eine Vorauswahl ermöglicht. Wesentlich häufiger finden sich Datenbanken, die gentechnikfreie Produkte sammeln. Solche „Negativlisten“ sind insofern kurios, als dass der zuverlässige Nachweis, es handle sich um ein absolut gentechnikfreies Produkt kaum möglich und sehr teuer ist. Auch die Kennzeichnungsnomenklatur lässt hier Spielraum und kann den Verbraucher täuschen. Trotzdem: Nicht nur die University of Reading will durch sachliche Darstellungen ein Grundverständnis der neuen Technologien vermitteln. Auch in deutschen Einrichtungen geht man allmählich auf den Informationsbedarf von Laien ein. Lebensmittel ohne Gentechnik Max-Planck-Gesellschaft: „Biomax" http://www.infoxgen.com http://www.mpiz-koeln.mpg.de/~rsaedler/BIOMAX/ Biomax1/Biomax1.html Bekanntestes Beispiel einer „Negativliste“ ist die Datenbank der Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel ohne Gentechnik. Hier werden Saatgut oder Produkte verwaltet, die dem Lebensmittelhersteller garantieren sollen, gentechnikfreie Ware weiterzuverarbeiten. Bevor es zum Suchmodus der Datenbank geht, wird der Nutzer aber noch einmal auf die Problematik der „Negativlisten“ hingewiesen. Erst nach der Bestätigung: „Ich habe verstanden: Nur die Originalerklärungen der Hersteller sind maßgebend“ findet er Zugang ins gentechnikfreie Paradies. University of Reading http://www.eibe.reading.ac.uk/NCBE/GMFOOD/ main.html Wer etwas über die verschiedenen Regularien der Kennzeichnung im internationalen Vergleich erfahren möchte, findet alle notwendigen Informationen auf der Homepage der University of Reading. Das National Center for Biotechnology Education der Universität stellt ohne Unterstützung von Regierung oder Industrie Lehrmaterialien für Lehrer, Schüler und Laien zusammen. Neben Gesetzen, Richtlinien und Begriffsklärungen sind sämtliche gentechnisch veränderten Produkte zusammengestellt, die Einzug in den Lebensmittelsektor gehalten haben. Diese Kurzdarstellungen vermitteln einen guten Überblick über die Anwendungspalette einzelner Lebensmittel, wie Tomaten, Mais oder Hefe. Umfassend und übersichtlich gestaltet ist die weitere Textsammlung mit Zusammenfassungen über Risiken, Nutzen und Techniken der Biotechnologie, wissenschaftlichen Berichten und veröffentlichten Daten wie denen der berüchtigten Pusztai-Kartoffel (EU.L.E.NSPIEGEL 1999/H.8/S.15). Die Link-Sammlung ist empfehlens- Mit „Biomax“ wenden sich die biologisch-medizinischen Institute der Max-Planck-Gesellschaft an Lehrer und Gymnasialschüler, um über aktuelle Forschungsthemen aus Biologie und Medizin zu informieren. Die bislang erschienenen Broschüren beschäftigen sich mit Themen wie Novel Food, Gentherapie oder dem humanen Genomprojekt. Die Aufarbeitung der Themen erfolgt in gut strukturierten Zusammenfassungen, in denen die wichtigsten Argumente oder Methoden erläutert werden. Die Darstellungen sind sehr eingängig, setzen allerdings ein gewisses Grundverständnis voraus. Das Deutsche Human-Genomprojekt http://www.dhgp.de Diese Seiten wenden sich an den Laien und erläutern die Hintergründe und Prinzipien der Genomentschlüsselung, erklären Grundbegriffe der Genetik und gehen auf genetisch bedingte Erkrankungen ein. Im Kapitel über Brustkrebs wird das Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Umwelteinflüssen wie Ernährungsgewohnheiten und Lebensstil als Risiko einer Erkrankung beispielhaft erläutert. Biotechnik im Unterricht http://www.rdg.ac.uk/EIBE/DEUTSCH/DU1.HTM Hier stellt die Europäische Initiative für Biotechnik im Unterricht Unterrichtseinheiten vor, mit denen biotechnologische Fragen erarbeitet werden können, u.a. Anwendungen in Tieren und Pflanzen. Die Materialen können als PDF-Dateien geladen werden. Bundesforschungsanstalt für Ernährung http://bfew055.bfe.uni-karlsruhe.de/ Ein Klassiker in Sachen Gentechnik und Ernährung sind die Online-Publikationen von Professor Jany. Auf verständliche Weise nimmt er zu zahlreichen Fragen über Genfood, Risiken, Anwendungen und Entwicklungen Stellung. Eine mittlerweile schon ältere, aber dennoch hervorragende Übersicht über Methoden und Anwendungen bietet der Jahresbericht „Gentechnik und Lebensmittel“ (1998). BioTech Mobil http://www.biotechmobil.de/ Das BioTech Mobil des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie bietet unter anderem ausführliche Übersichten zu medizinischen und biologischen Themen. Zwar sind die Darstellungen zu den Themen Gentechnik in Lebensmitteln, Pflanzen- und Tierzucht durch und durch positiv gefärbt das Kapitel Risiken gleicht eher einer Informationsschrift aus der Industrie -, die Erläuterungen der zellulären Abläufe und neuen Technologien sind jedoch sehr umfassend und verständlich. man nicht nur Adressen, Telefonnummern und E-MailAnschriften von über 1500 Biotechnologie-Firmen in den USA. Auch Verzeichnisse von Biotechnologie-Investoren oder detaillierte „Up-to-date“-lnformationen aus der Biotechnologie-Gemeinde werden auf dieser Seite angeboten. Berkeley-University für Bürger-Infos http://plantbio.berkeley.edu/~outreach/ OUTREACH:HTM Vice versa kommen aus der Universität Berkeley keine Insider-Infos, sondern Belehrungen für den unbedarften Bürger: Auf ihrer Homepage stellt Dr. Peggy Lemaux einen ausführlichen Vortrag zur Verfügung, der klar an den Verbraucher gerichtet ist. Das 13seitige Redemanuskript vermittelt die Grundzüge der modernen Gentechnik und ihrer Anwendungen, nicht ohne vorher in einfachen Worten zu erläutern, wie Genmanipulation vor den neuen Techniken aussah. Die Erklärungen lassen sich nicht nur recht gut lesen, sie sind auch mit 58 ansprechenden Dias untermalt, die beispielsweise anschaulich vor Augen führen, wie unser heutiger Mais vor den altbewährten Züchtungsmanipulationen einmal aussah ... Europäisches Patentamt Schellfisch interaktiv http://www.dpma.de/patinfo/pinf_php.htm http://nbiap.vt.edu/indexmain.cfm Hier kann man mit Geduld und Spitzfindigkeit den neuesten Errungenschaften aus Forschung und Industrie auf die Schliche kommen. Die Online Patentrecherche bietet die Möglichkeit, nach Stichworten oder Firmen zu suchen. Was einfach klingt, führt jedoch nicht immer zum Erfolg. In der Regel hat das Kind einen anderen Namen und ist so im Sumpf der Patente nicht ohne weiteres aufzufinden. Unter „Links“ stehen die Internet-Adressen anderer Patentämter: Für die, die wissen wollen, was die Amis so vor haben ... Hier gibt's ökologische Lern- und Frühwarnprogramme für Gentechniker. Mit Unterstützung eines staatlichen Forschungs- und Ausbildungsfonds der Virginia Tech präsentiert die Homepage des Information Systems for Biotechnology interaktive Hilfe für gentechnisch versierte Fischforscher. Diese können sich durch einen Algorithmus arbeiten und erhalten am Ende der interaktiven Befragung Auskunft über ökologische Gefahren ihres speziellen Forschungsvorhabens. Die guten Ratschläge beschränken sich allerdings hauptsächlich auf Speisefisch und Mollusken. Steigende Nachfrage der Verbraucher nach den Meeresbewohnern lässt zunehmendes Forschungsinteresse erwarten. Institut für Industrie-Informationen http://www.biotechinfo.com Wer lieber direkt von den amerikanischen Anbietern wissen möchte, was so abgeht, ist auf der Webseite des Institute for Biotechnology Information richtig. Hier findet Neben fortschrittlicher Fortbildung für Forscher findet man auf dieser amerikanischen Internetseite übrigens auch eine Linksammlung zu den internationalen Feldversuchen. Offenbar interessiert die Amis auch, was die Gentechnik in Deutschland macht. Ein Klick auf die Adresse des Robert-Koch-Institutes bringt uns schnell zu unserer Ausgangsseite zurück. Leukämie durch Flavonoide Strick R et al: Dietary bioflavonoids induce cleavage in the MLL gene and may contribute to infant leukemia. Proceedings of the National Academy of Sciences 2000/97/ S.4790-4795 Flavonoide werden als Schutzfaktoren für Brust-, Darm- und Prostatakrebs diskutiert (EU.L.E.N-SPIEGEL 1998/H.1/S.7-8). Aufgrund dieses gesunden Images sind bereits flavonoidreiche Nahrungssupplemente im Angebot, wie z.B. der so genannte Quercetin-Komplex. Neue Untersuchungen über Säuglingsleukämien zeigen jedoch, dass zwischen einer hohen Aufnahme von Flavonoiden und der Entstehung von Leukämie im Mutterleib möglicherweise ein Zusammenhang besteht. In zwei Drittel aller Fälle von Säuglingsleukämie findet man eine Veränderung am so genannten MLL-Gen. Zumindest im Reagenzglas führten 10 von 20 getesteten Flavonoiden zur gleichen Schädigung am Erbgut. Fisetin aus Kräutern, Quercetin aus Obst und Gemüse und der als Nahrungssupplement erhältliche QuercetinKomplex erwiesen sich als ebenso effektiv wie das Medikament VP16, das als Vergleich diente. Von anderen Flavonoiden wie Genistein oder Myricetin wurde zwar die doppelte bzw. vierfache Menge benötigt, sie verursachten jedoch die selben Schäden. Anmerkung: Vermutlich sind nur Föten mit einer besonderen genetischen Disposition (im Verdacht stehen die Fähigkeit zur DNA-Reparatur und zur Verstoffwechselung von Flavonoiden) während einer kurzen Zeitspanne ihrer Entwicklung anfällig für die Flavonoide. Darauf deutet die Häufigkeit der Erkrankung hin: Mit 37 Fällen auf 1 Million Geburten in den USA ist die Säuglingsleukämie äußerst selten, obwohl Flavonoide in Lebensmitteln weit verbreitet sind. Vor Supplementen sollten Schwangere jedoch gewarnt werden. Getreideseuche droht Huth W: Im Getreidebau in Deutschland und in Europa wird eines der größten phytopathologischen Probleme erwartet: die bodenbürtigen Viren des Weizens und Roggens. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 2000/52/S.196-198 In Deutschland sind die Roggen- und Weizenernten der nächsten Jahre gefährdet. Zwei bodenbürtige Getreideviren, das Soil-borne cereal mosaic virus und das Wheat spindIe streak mosaic virus, breiten sich aus. Während bereits fast alle Roggenanbaugebiete Befall melden, gibt es beim Weizen bislang nur einzelne Fälle. Die beiden Viren, die immer zusammen auftreten, führen zu Ertragseinbußen von 50 Prozent und mehr. Der Winterweizen gerät zunehmend in Gefahr, da die Saattermine immer weiter vorverlegt werden. Im September/ Oktober jedoch ist der Vektorpilz, der die Viren überträgt, wegen der höheren Temperaturen noch recht mobil. Gehen die Pflanzen dann schon virusgestresst in den Winter, können die Ernteausfälle 70 Prozent betragen. Die Viren sind weder durch chemische noch durch ackerbauliche Maßnahmen aufzuhalten. Ein Resistenzzüchtung gegen die beiden neuen Erreger ist vorerst nicht zu erwarten. Noch fehlen bekannte resistente Pflanzen, mit denen man züchterisch arbeiten könnte. Außerdem wären vermutlich zwei verschiedene Resistenzmechanismen nötig, denn die beiden Viren gehören verschiedenen systematischen Gruppen an. Gemischter Anbau statt Gentechnik Zhu Y et al: Genetic diversity and disease control in rice. Nature 2000/406/S.718-722 Die chinesische Provinz Yünnan steht beispielhaft für eine Region, in der wegen des feuchten Klimas große Teile der alljährlichen Reisernte dem Reisbrenner zum Opfer fallen. Daran ändern auch kostspielige Fungizideinsätze nur wenig. Verursacht wird der Reisbrenner durch den Pilz Magnaporthe grisea. Im Jahr 1999 pflanzten - in einem bisher weltweit einmaligen Feldversuch - Tausende von chinesischen Kleinbauern auf einem über dreitausend Hektar großen Areal verschiedene Reisvarietäten nebeneinander: Zwischen jeweils vier Reihen Reisbrenner resistente ertragreiche Hybridreissorten setzten sie eine Reihe des anfälligen (und daher wenig ertragreichen), aber begehrten und entsprechend teuer bezahlten Klebreises. So sollte getestet werden, ob die Felder durch den gemischten Anbau besser vor dem Befall durch den Pilz geschützt sind. Die Ergebnisse waren überwältigend: Der Reisbrennerbefall der Klebreispflanzen ging um 94 Prozent zurück und die Ernteerträge steigerten sich um 89 Prozent. Aber auch die resistenten Pflanzen brachten höhere Erträge. Auf den Einsatz von Fungiziden konnte komplett verzichtet werden. Die Pflanzen profitieren mehrfach von dem gemischten Anbau: • Die einzelnen Saatgutvarietäten werden von jeweils spezifischen pathogenen Pilzstämmen befallen. Bei einer gemischten Pflanzung kann sich ein einzelner Erreger schwerer flächendeckend durchsetzen. • Das Phänomen der induzierten Resistenz: Auf dem „falschen“ Wirt können pathogene Pilze und Bakterien eine Resistenz auslösen, die diesen vor seinem spezifischen Erreger schützt. Je mehr Pathogene, desto mehr Resistenzbildungen. • Die Anpassung eines Pathogens an einen möglichen Wirt wird durch die Anwesenheit anderer Erreger erschwert, weil beim Wirt alle Abwehrmechanismen auf Hochtouren laufen. • Die Lichtausnutzung ist bei verschieden hohen Pflanzen insgesamt besser. • Die Ausbreitung der Erregersporen mit dem Wind wurde durch die unterschiedliche Höhe der Sorten ebenfalls behindert. Neu sind diese Erkenntnisse jedoch nicht. Bereits 1872 hatte Charles Darwin beobachtet, dass Felder, auf denen eine Mischung verschiedener Weizensorten ausgesät worden war, wesentlich höhere Erträge brachten. Die Landwirtschaft der Industrienationen hingegen setzt bis in die Gegenwart auf den Anbau sortenreiner Monokulturen. Sie entsprechen am ehesten den Anforderungen nach standardisierten Rohstoffen für die maschinelle Ernte und Weiterverarbeitung. Statt Sortenvielfalt wird heute der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen als Mittel der Wahl propagiert, um den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln zu senken. Anmerkung: Der britische Agrarwissenschaftier Wolfe fordert, trotz aller modernen Verfahren, die Forschungen mit Saatmischungen fortzusetzen. Besonders für Länder wie China liegt darin die Chance, einfach und kostengünstig Ertragssteigerungen zu erwirtschaften und mehr Menschen zu sättigen. Dass die Ernte nicht sortenrein ist, spielt dort keine Rolle: Die chinesischen Kleinbauern ernten ihren Reis ohnehin mit der Hand und trennen dann die verschiedenen Sorten direkt bei der Ernte. (Nature 2000/406/S.681-682) Wildreis bald für jedermann? Zeller FJ et al: Wildreis - Domestikation einer alten Nutzpflanze Nordamerikas. Naturwissenschaftliche Rundschau 2000/53/S.282-286 An den Flüssen im nördlichen Minnesota erntet man den Indianer- oder Wasserreis (Zizania palustris) noch genauso wie einst die Sioux oder die Chippewas. Die paddelten den Fluss entlang, bogen die im Wasser stehenden Reispflanzen über den Bootsrand und schlugen mit einem Stock die Reiskörner aus. Dieser sogenannte Wildreis gilt heute als kostspielige Delikatesse, die einigen wenigen Feinschmeckern vorbehalten ist. Selbst der im Supermarkt erhältliche „Wildreis“ ist so teuer, dass er in der Regel nur als optische und geschmackliche Bereicherung zu weißem Reis verwendet wird. Kultivieren könnte man Wasserreis jedoch in vielen Ländern, auch in Deutschland. Man benötigt lediglich Felder, die sich fluten lassen. Außerdem braucht die Saat eine dreimonatige Winterruhe vor dem Auskeimen. Das größte Problem bereitet derzeit noch die Ernte. Die Körner reifen sehr ungleichmäßig. Sobald sie aber reif sind, fallen sie aus. Diese Eigenschaft versucht man nun durch Züchtung zu beseitigen. Nahe liegend wäre eine Kreuzung des Indianerreises mit normalen Kulturreis (Oryza sativa). Da die beiden Reisarten aber nur entfernt verwandt sind, ist die sexuelle Kreuzung nicht möglich. Im vergangenen Jahr gelang es, die beiden Arten asexuell über zellwandlose Zellen (Protoplasten) miteinander zu vereinen. Dabei entstand ein vermehrungsfähiger Bastard mit kleinen, dunklen Reiskörnern. Mehle à la Dior Anon: Sind Müller Schneider? Brot und Backwaren 2000/ H.5/S.22-30 Mühlen, die einfach nur Mehl liefern, gibt es viele. Um sich von der Konkurrenz abzuheben und die Großabnehmer besser an sich zu binden, gehen einige Mühlen dazu über, spezielle Mehle herzustellen, die ganz genau auf den einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Dabei werden vor allem die Backeigenschaften der Mehle in engen Grenzen spezifiziert, aber auch die Farbe oder die mikrobiologische Sicherheit. Diese Vorgehensweise rechnet sich für beide Geschäftspartner: Die Mühle kann für ein solches Mehl einen höheren Preis erzielen, und die Fabrik erhält ein Mehl, das dem Betriebsablauf perfekt angepasst ist. Das bedeutet weniger Störungen in der Produktion, weniger Ausschuss und ein immer gleich bleibendes Produkt. Manche Mühlen kontrollieren die Mehlherstellung bereits bis hin zur Auswahl des Saatguts. Durch die Kombination verschiedener Mehlqualitäten lassen sich die erntebedingten Schwankungen ebenso korrigieren wie durch den Zusatz von Mehlverbesserern. Auf diese Weise können sich die Bäckereien teure AllroundBackmittel sparen, da gezielt nur die Zusätze beigemischt werden müssen, die für das jeweilige Mehl auch wirklich erforderlich sind. Hinzu kommt, dass „Mehlverbesserer“ im Gegensatz zu Backmitteln vollständig von der Deklaration befreit sind. Momentan lohnt sich die Entwicklung maßgeschneiderter Mehle aber nur bei großen Absatzmengen, sodass die „kleinen“ Bäcker den Backmittelfirmen als Kunden erhalten bleiben. Dennoch dürfte dieser Trend für die Backmittelindustrie eine schmerzliche Einbuße bedeuten, nehmen ihnen die Mühlen doch das lukrative Geschäft mit den Großkunden ab. Streich Honig auf deine Wunden Lord A: Sweet healing. New Scientist 2000/H. 2259/S. 32-35 Die Heilwirkungen des Honigs sind seit alters bekannt. Schon die alten Ägypter behandelten damit eiternde Wunden, während er bei uns fast nur für Halsentzündungen verwendet wird. Seit wir Antibiotika besitzen, sind die hervorragenden Eigenschaften des Honigs in Vergessenheit geraten. Doch einige Studien aus jüngster Zeit belegen, dass Honig sogar hartnäckige und entzündete Wunden heilen kann, die mit antibiotikaresistenten Keimen infiziert sind. Zur Heilwirkung des Honigs tragen verschiedene Stoffe bei. So findet man in fast allen Honigarten das Enzym Glucoseoxidase. Aktiviert durch die Plasmaflüssigkeit in der nässenden Wunde beginnt das Enzym aus Glucose Gluconsäure und Wasserstoffperoxid herzustellen. Wasserstoffperoxid wird auch in der Schulmedizin angewendet. Es wirkt antibiotisch gegen verschiedenste Erreger, schädigt aber auch das gesunde Gewebe. Im Honig liegt es in so geringen Konzentrationen vor, dass es der Haut nicht schadet. Dafür wird es durch die Glucoseoxidase ständig nachgebildet. Das Wasserstoffperoxid aktiviert an der Wunde außerdem körpereigene Enzyme, die zerstörtes Gewebe entfernen. Aber Honig ist nicht gleich Honig. Je nachdem auf welchen Pflanzen der Nektar gesammelt wurde, sind seine Heilwirkungen unterschiedlich. Als besonders effektiv erwiesen sich Honige aus dem Nektar von Pflanzen aus der Familie der Myrtengewächse. In ihrer australisch-neuseeländischen Heimat heißen sie Manuka (Leptospermum scoparium) bzw. Jelly bush (L. laevigatum und L. polygalifolium) Die entscheidenden Wirkstoffe wurden noch nicht identifiziert. Man weiß aber, dass der Wirkstoff des Manukahonigs wasserlöslich ist, das kranke Gewebe tief durchdringt, bei verschiedensten pH-Werten arbeitet und kein Enzym zur Aktivierung braucht. Der Jelly-bush-Honig vermag das Immunsystem zu aktivieren. Er regt die Monozytenbildung an, die das Wachstum von Hautzellen stimulieren, sodass sich die Wunde schneller schließt. Monozyten reifen zu Makrophagen, die Mikroben und totes Gewebe beseitigen. Weitere Anwendungsgebiete für die antibiotischen Honige deuten sich an. So wurde beobachtet, dass Manukahonig, auf nüchternen Magen verzehrt, Helicobacter pylori vertreibt, der für Magengeschwüre und Magenkrebs verantwortlich gemacht wird. In Osteuropa behandelt man bereits chronische Bronchitiden mit Honigaerosolen. Und im Labor kann Manukahonig dem antibiotikaresistenten Keim Burkholderia cepacia Einhalt gebieten, der vielen Mukoviszidosepatienten das Leben schwer macht. Anmerkung: Bevor Sie jetzt Ihren Honigtopf in die Hausapotheke stellen: Die meisten handelsüblichen Honige sind pasteurisiert, wodurch die Glucoseoxidase zerstört wird. Nicht zerstört werden dadurch jedoch Sporen von Clostridium botulinum, dem Erreger des Botulismus, den man sich besser nicht in eine offene Wunde schmiert. Falsch gewickelt Myers JH et al: Eradication revisited: dealing with exotic species. Trends in Ecology and Evolution 2000/15/S. 316-320 Hört und liest man die regelmäßig erscheinenden Schreckensmeldungen vom weltweiten Artensterben, könnte man glauben, das Ausrotten von Tierarten sei ganz einfach. Doch gezielte Versuche, sich unerwünschter, meist eingeschleppter Spezies zu entledigen, sind bislang meist gescheitert. Diese Erfahrung musste man auch in British Columbia, Kanada, bei der Bekämpfung des Apfelwicklers (Cydia pomonella) machen. Der Apfelwickler stammt ursprünglich aus Europa, schädigt aber mittlerweile die Apfelanbauer weltweit. Ein in den 70er Jahren durchgeführtes Pilotprojekt baute auf die umweltschonende massenhafte Freisetzung sterilisierter Apfelwicklermännchen. Damit sollte die Zahl der befruchteten Weibchen so weit wie möglich gesenkt werden. Die Kosten der biologischen Bekämpfung lagen mit 225 Dollar pro Jahr und Hektar zwar weit höher als die von 95 Dollar für die Bekämpfung mit Insektiziden, doch von Ausrottung keine Spur. Die sterilen Männchen konnten mit ihren wilden Konkurrenten einfach nicht mithalten. Deshalb spritzten die Forscher vor der Freisetzung Gift, um die wilden Apfelwicklermännchen schon einmal zu dezimieren. Dadurch stiegen zwar Zeitaufwand und Kosten, nicht jedoch die Erfolgsquote. Mittlerweile gehen die Apfelanbauer wieder zu Pheromonfallen und Insektiziden über. Von „Ausrottung“ ist nicht mehr die Rede. becel pro-activ: ausgeschmiert Mohn liefert Morphin Neu auf dem Markt ist becel pro-activ, eine mit Phytosterinen angereicherte Halbfettmargarine. Die cholesterinähnlichen pflanzlichen Verbindungen sollen die Absorption von Nahrungscholesterin und damit erhöhte Cholesterinspiegel senken. Nach Angaben des arzneitelegramms konnte ein herzschützender Effekt bisher weder mit Medikamenten, die das Phytosterin ßSitosterin enthielten, noch in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden. Das arznei-telegramm rät vom Verzehr aufgrund der dürftigen Datenlage eher ab. (arznei-telegramm 2001/32/S.14) Nicht nur der Konsum von Heroin, sondern auch der Genuss von Mohnkuchen kann Ursache sein, wenn Morphin im Urin nachgewiesen wird. Zu diesem Ergebnis kamen ungarische Forscher nach einem Mohnkuchen- Probeessen. Allerdings lagen die Morphinkonzentrationen im Urin nach dem Genuss von Mohnkuchen im Vergleich zu Heroinabhängigen sehr niedrig (max. 0,35 µg/ml verglichen mit 2,1-40 µg/ml). Wer jedoch sonntags bei Mutters Mohnkuchen allzu kräftig zulangt, könnte bei einer abendlichen Polizeikontrolle schon mal in ein schiefes Licht geraten. (Gesellschaft für Technische und Forensische Chemie, Symposium vom 22.- 24.4.2000 in Mosbach (Baden)) Wenn der Appetit vergeht Mit großen Versprechen wurde der Wirkstoff Sibutramin als Appetitzügler 1999 auf den Markt gebracht. Jetzt zeichnet sich ab, dass er, ebenso wie alle anderen bisher bekannten appetitzügelnden Substanzen, nur so lange wirkt, wie er eingenommen wird. Nach dem Absetzen steigt das Gewicht wieder mit dem bekannten JojoEffekt. Fünf Prozent aller Sibutramin-Anwender mussten die Therapie wegen Blutdruckanstieg ohnehin absetzen. (arznei-telegramm 2001/31/S.27). Der Hunger bleibt 800 Millionen Menschen hungern weltweit. Mit den neuen Zahlen zeigt die FAO, dass ihre bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers kaum gefruchtet haben. Auslöser für den Hunger sind neben Missernten durch Naturkatastrophen immer wieder politische Konflikte und Bürgerkriege, die eine erfolgreiche Agrarwirtschaft in den betroffenen Ländern verhindern. Erfolgsbeispiele aus Thailand, Nigeria und Ghana zeigen, dass nur dort, wo Regierungen sich aktiv an der Lösung des Problems beteiligen, der Kampf gegen den Hunger erfolgreich geführt werden kann.(www.fao.org) Schokoriegel als Kunstgalerie Die Schweizer Schokoladenfabrik Ragusa pflegt ein Mäzenatentum der besonderen Art: Kunstwerke von bekannten und weniger bekannte Künstlern werden auf den Papieren von Schokoriegeln verewigt mit einer Exklusivauflage von maximal 20.000 Stück. Damit verspricht sich die Firma weniger den besonderen Werbeeffekt, sondern vielmehr „eine in die Tiefe gehende Auseinandersetzung mit der Kunst“.(Tara 2000/612/S.27) Stroh nicht nur für Wiederkäuer Präparate aus Weizenstroh „bereichern“ immer mehr Frühstücksdrinks, Milchprodukte oder Brot. Man erhöht so den Ballaststoffanteil oder erzielt bestimmte technologische Vorteile. Deklariert wird das Stroh zurzeit als Weizenfaser oder Ballaststoff aus Weizenfaser. Nach Ansicht von Experten ist dies unzulässig, da Stroh üblicherweise nicht verzehrt wird. Vielmehr sei das Produkt als nicht zugelassener Zusatzstoff oder als Novel Food einzustufen. (Lebensmittelchemie 2000/54/S.75) Aus dem Institut Liebe Leserin, lieber Leser! Kaum ein anderes Ereignis hat die Republik im vergangenen Jahr so nachhaltig erschüttert wie die BSE-Krise. Als Skandale kamen und Minister gingen, liefen auch bei uns sämtliche Leitungen heiß. Ob Ra­ dio, Fernsehen oder Zeitungen, ob Landfrauen, Bau­ ern, Fleischer, Direktvermarkter oder Politiker - fast alle klopften sie beim EU.L.E. an. Dabei geriet der EU.L.E.N-SPIEGEL leider ins Hintertreffen. Doch jetzt erscheint er. Endlich! Wir bitten Sie um Verständnis für die Verzöge­ rung und sagen „Dankeschön, dass Sie so gedul­ dig gewartet haben“. Ihr EU.L.E.N-SPIEGEL-Team und der Vorstand des EU.L.E. e.V. PS: Sie finden uns im Internet jetzt auch unter www.das-eule.de Nachgelesen: Impfen verbreitet MKS Strohmaier K, Straub OC: Die Maul- und Klauenseuche Was ist nach Einstellung der Impfungen zu erwarten. Tierärztliche Umschau 1995/50/S.147-152 „Aus der zeitlichen Korrelation von Impftermin und Ausbruchsdatum ... mußten die Impfungen als häufigste Ursache für angesehen werden. Als zweithäufigste Ursache wurde das Entkommen des Virus aus Impfstoffwerken ermittelt.“ Eine Untersuchung der Bundesanstalt für Viruskrankheiten der Tiere in Tübingen ergab, dass die Maul- und Klauenseuche (MKS) häufig etwa 3 Wochen nach der vorgeschriebenen Impfung auftrat. Auch entkamen Viren aus Impfstoffwerken bzw. Einrichtungen zur Impfstoffprüfung, obwohl keine Sicherheitsmängel beobachtet wurden. Die USA hatten bereits eine Einfuhrsperre für impfende Länder verhängt, „da sie erkannt hatten, dass die Einschleppungsgefahr der MKS aus Ländern, die impfen größer ist als bei nichtimpfenden Ländern“. Als Reaktion untersagte die EG-Kommision die Impfungen. Trotzdem konzentriert Europa die Impfstoffproduktion vorsorglich auf einige Zentren. Dabei sollen auch exotische Stämme einbezogen werden. Das verstößt gegen die Empfehlungen des Internationalen Tierseuchenamtes. Unabhängig davon wird empfohlen, statt Impfung gegen MKS die klassischen Maßnahmen zu optimieren, wie das sofortige Schlachten betroffener Bestände.