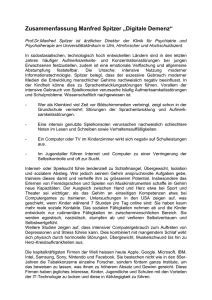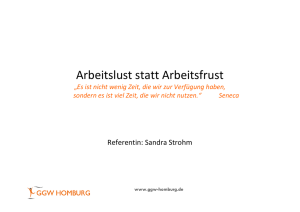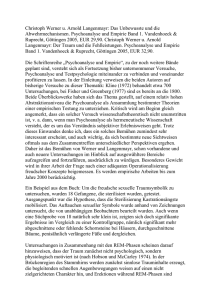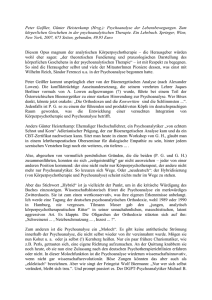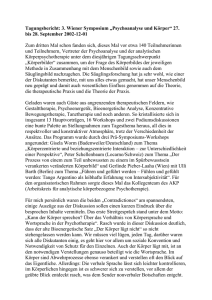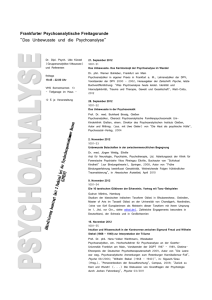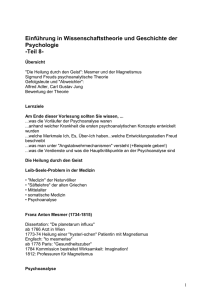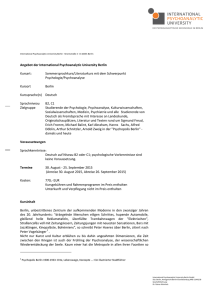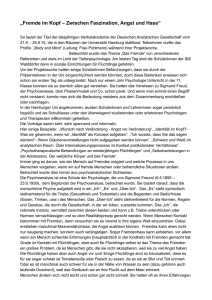47. Embodiment und Musik
Werbung

P S YC H O - N E W S - L E T T E R N R . 4 7 E IN KLEINER L ITERATURRUNDFLUG Im Auftrag des Vorstands der DGPT Verfasst von Michael B. Buchholz Email: [email protected] Mit einem Beitrag von Peter Geissler, Wien Email: [email protected] Mitte September 2006 EMBODIMENT D UND MUSIK aß Musik mit dem Körper zu tun habe, weiß jeder, der beim Swing rhythmisch zu zucken beginnt, den Takt mit dem Finger mitschlägt oder beim Anhören der Matthäuspassion aus scheinbar unbegreiflichen Gründen in Tränen tiefster Ergriffenheit ausbricht. Muß man Übende anhören, kann einen schon mal der Zahnschmerz packen und wenn einem beim Üben selbst etwas partout nicht gelingen will, durchaus auch eine körperliche, kaum zu bändigende Wut. Musik, wissen Musiker, hat mit dem Vorstellungsvermögen zu tun; gute Musiklehrer regen Kinder schon an, sich vorzustellen, beim Üben einer Tonleiter eine Treppe rauf und runter zu steigen und die Kinder merken zu ihrer Überraschung, dass sie dieselbe Tonleiter anders spielen, wenn sie sich dabei vorstellen, sich zu verstecken im Sinne von „sich in der Höhe verdünnisieren“ oder einen Angriff zu beginnen (beim Herunterkommen auf der Tonleiter). Jede Musikrezension führt vor, welches körperlich klingende Repertoire an Sprachbildern und Metaphern ihr Autor zur Verfügung hat und manchmal, wenn auch selten, meint man beim Lesen leise die Musik sogar hören zu können, über die da beredt geschrieben wird. Der Pianist David Sudnow (1978) gab in seinem Buch „Ways of the Hand: The organization of improvised conduct“ (Harvard University Press) eine wunderbare Beschreibung, wie er es geschafft habe, Jazz auf dem Klavier zu improvisieren. Er versuchte zunächst große Jazzmusiker nachzuahmen. Aber das erwies sich als extrem schwierig, denn er konnte Noten und Tempus gar PNL-47 ⏐ 2 nicht genau genug bestimmen. Selbst wenn er nah daran kam, solche Werte zu bestimmen, klang irgendwas nicht richtig. Die Noten selbst enthielten irgendwie nicht jene Information, die er brauchte, um seine Hände in der richtigen Weise über die Tastatur zu bewegen. Ein Durchbruch kam erst, als ein geübter Pianist darauf drang, dass Sudnow eine kleine Anzahl von Tonleitern, Phrasierungen und Akkordsequenzen, für den Jazzsound charakteristisch, üben sollte. Anfänglich also sah das so aus: „There were these three diminished scales to begin with, each identified by reference to a theoretical system that related its use to four of the twelve dominant chords, so on my thinking there was a ‘cognitive map’, each scale named by a starting place, each related to its class of chords” (Sudnow 1978, S. 21). Indem er sich nun ans Üben machte, bringt er es zu einem bemerkenswerten Ergebnis: „I recall playing one day, and finally as I set out into a next course of notes, after a lift-off had occurred, that I was expressively aiming for the sounds of these particular notes, that the sounds seemed to creep up into my fingers, that the depression of the keys realized a sound being prepared for on the way down” (S. 37). Der Sound wollte in die Finger kriechen – bevor er die Tasten niederdrückte. Es entstand ein ganz neues Rückkopplungssystem zwischen Wahrnehmung und Motorik, zwischen Absicht und Ausführung, zwischen Selbst und musikalischer Welt. Der Klang war gewissermaßen schon im Ohr, bevor das Klavier ihn erzeugte. Und Sudnow beschreibt genau, dass das „Wissen“ aus diesem Rückkopplungssystem ein anderes war als das kontextfreie musikalische Wissen, das er vorher aus den Noten hatte. „As I found the next sounds coming up, as I set out into the course of notes, it was not as if I had learned about the keyboard so that looking down I could tell what a regarded note would sound like. I do not have that skill, nor do many musicians. I could tell because it was the next sound, because my hand was so engaged with the keyboard that it was given a setting of sounding places in its own configuration and potentialities” (S. 45). Etwas passierte, so daß sich sein Bezugssystem änderte. Er lernt nichts mehr über das Spielen des keyboard (Bion hätte hier –K notiert), sondern es ist seine Hand-mit-keyboard-mit-Klangmuster, die jetzt etwas weiß: sein Wissen ist „embodied“ und es ist „situiert“ zugleich (Bion hätte K codiert). In der Situation des Spielens ist dies Wissen „da“, dann gelingt die Improvisation. Sudnow bestand seitdem darauf, dass jede Note innerhalb verschiedener Läufe einen anderen „Ton“ habe, auch der Ton wird „situiert“. Man könne Noten zwar „objektiv“ klassifizieren und transkribieren, aber das sei gerade nicht die dynamische Basis jener sensorimotorischen Abläufe, die ihn zum Erklingen bringen. Jeder, der ein Instrument erlernt hat, wird diese Erfahrung bestätigen können. Es gibt einen Schritt über schülerhaftes „Nachspielen“ der Noten hinaus in die Gestaltung performativer Praxis, der von den meisten als höchst befriedigende Erfahrung empfunden wird, als Gefühl des Eins-Seins mit dem Instrument. Nicht der Spieler spielt „auf“ dem Instrument, sondern der „Spieler-mit-dem-Instrument“. Beide verschmelzen zu einem dynamischen Prozeß, dessen Komponenten nur begrifflich im Nachhinein voneinander gelöst werden können, nicht aber im Vollzug. Diese Schwerpunktverlagerung von kategorialer wissenschaftlicher Analyse hin zum (musikalisch-professionellem) Vollzug ist für das Verständnis des dynamischen Prozesses von größter Wichtigkeit. Es ist eine Verlagerung, die in der Sprachwissenschaft sich genauso vollzieht; mehr und mehr treten die Eigenarten des Sprechens, also des Vollzugs in den Fokus der Aufmerksamkeit; die Eigenarten von „Sprache“ (an sich) verlieren an Interesse. Da neuerdings auch Psychoanalytiker sich mehr und mehr an die Analyse der Musik und ihrer „performance“ wagen, sollen hier einige Arbeiten als E r w e i t e r u n g e i n e r p s y c h o a n a l y t i s c h e n K u l t u r - u n d K ö r p e r t h e o r i e vorgestellt werden. ⏐ PNL-47 POSITIONEN DER „COGNITIVE Auf dieser rein phänomenologischen Grundlage seiner Selbsterfahrung als Pianist lernte und lehrt Sudnow zu begreifen, dass dem geschickten Handeln als Pianist nicht eine unabhängige mentale Planung und Entscheidung vorausläuft, die besondere Aspekte der „performance“ anleitet oder informiert. Gregory Bateson machte (in seinem Buch „Geist und Natur“) einmal ein interessantes Gedankenexperiment: Man stelle sich einen Blinden vor, der mit seinem Stock die Gegend abtastet. Soweit, so gut. Nun aber die knifflige Frage: Wo ist die Grenze des Kleine Literaturhinweise Am besten liest man Neueres zum Thema in der folgenden Reihenfolge: Leikert, S. (2005): Die vergessene Kunst. Der Orpheusmythos und die Psychoanalyse der Musik (Psychosozial-Verlag) Francisco Varela, Evan Thompson und Eleanor Rosch (1995): Der Mittlere Weg der Erkenntnis. Der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und menschlicher Erfahrung. [Goldmann Taschenbücher Bd.12514] Mark Johnson (1987): The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination and reason (University of Chicago Press) Sobchak, V. (2004): Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture (University of California Press) Zbikowski, L.M. (2002): Conceptualizing Music. Cognitive Structure, Theory and Analysis. (Oxford University Press) Spitzer, Michael (2004): Metaphor and Musical thought (The University of Chicago Press) Spitzer, Manfred (2002): (Schattauer) Musik im Kopf Knoblauch, S.H. (2000): The Musical Edge of Therapeutic Dialogue (The Analytic Press) Sowie die Arbeiten von Bernd Oberhoff, die zahlreich im Psychosozial-Verlag erschienen sind. HINWEIS: Manfred Spitzer und Michael Spitzer sind zwei ganz verschiedene Autoren! Selbst des Blinden? An der Hand, die den Stock umfasst? An der Spitze des Stocks, der einen Gegenstand berührt? In der Mitte des Stocks? Die Formulierung, dass der Blinde 3 SCIENCE“ den Stock „nutzt“, trifft die Sache nicht; denn die schwenkende Bewegung des Stocks ahmt nur nach, was ein Sehender auch macht: der sog. Nystagmus des Auges tastet nämlich in winzigen Bewegungen dauernd die Umwelt ab – und wenn man die entsprechenden Augenmuskeln durch ein Gift lähmt, hört der Betreffende auf, etwas sehen zu können, obwohl das Auge unverletzt, die nervöse Weiterleitung ans Sehzentrum erhalten bleibt und die entsprechenden Gehirnregionen aufleuchten. Wahrnehmen – so belehren uns Sudnow und Bateson (und Raymond Gibbs „Embodiment and cognitve science“ 2004) gleichermaßen, ist nicht etwa „Abbilden“. Nein, Wahrnehmen ist vielmehr aktive Organisation. Die Kontrolle findet nicht erst am „motorischen Ende“, sondern bereits beim „input“ statt. So der aufregende Ansatz von Scott Jordan („The embodiment of intentionality“) in dem von Wolfgang Tschacher und Jean-Pierre Dauwalder herausgegebenen Band „The Dynamical Systems Approach to Cognition“ (2003). Scott Jordan überwindet so die „alteuropäische“ Sicht, wonach der menschliche Geist seine Handlungen vorausplant und gemäß seinen Intentionen in dieser zeitlichen Abfolge exekutiert. Diese lineare und hierarchische Vorstellung wird ersetzt von der Idee, dass Intentionen am besten als dynamische Prozesse innerhalb einer physikalischen, historischen und sozialen Welt verstanden werden. Der Blinde mit dem Stock ist mit der Welt ebenso sinnlich und zirkulär verbunden wie der Sehende mit seinem Nystagmus. Die ältere Sicht implizierte eine lineare Richtung des Geschehens von einer inneren planenden Zentrale an die äußere Peripherie. „Cognitive science“ schlägt hingegen vor, lieber von zirkulärer Einbettung in situierte Kontexte zu sprechen, aus denen eine Person Selektionen vornimmt. „Cognitive Science“ meint also hier eine Sicht, die von der Situiertheit allen Handelns ausgeht und davon, dass die handelnde Person immer verkörpert ist. Das kommt doch Freuds Satz, dass das Ich vor allem ein körperliches PNL-47 sei, recht nahe. Situiertheit und „Embodiment“ brauchen ein wenig Klarstellung. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum zu glauben, der Begriff „kognitiv“ vernachlässige das Unbewusste oder auch schon das Erleben. Kognition und Intellektualisieren werden gern miteinander verwechselt, aber das ist nicht Dasselbe! Vergegenwärtigen wir uns, wie kompetente Vertreter im Band von Tschacher und Dauwalder Grundüberzeugungen der „cognitive science“ zusammenfassen: 1. Intentionale, zielgerichtete Kognition ist nicht als einzelnes Attribut des Geistes zu verstehen; vorgeschlagen wird vielmehr, Geist als Synergie, d.h. als Zusammenwirken von grundlegenderen und einfacheren Komponenten, insbesondere des Handelns zu verstehen 2. Geist muß als embodied aufgefasst werden, Geist hat Gehirn und Körper. Die Idee, erst sei brain da und dann folge mind, wird aufgegeben zugunsten der Vorstellung, dass schon primitive Einzeller kognitive Akte vornehmen müssen: Sie müssen in ihrer Umwelt überleben und können das nur, wenn sie z.B. Nahrung von Nicht-Nahrung unterscheiden können. Unterscheiden aber ist ein kognitiver Akt. 3. Kognition ist situiert, immer eingebettet in Umwelten, die einschränkend wirken und angetrieben werden von energetischen Gradienten 4. Spricht man von „embodied cognition“, muß man auch umgekehrt vom „cognitive body“ sprechen. Es gibt eine zirkuläre Interaktion zwischen einer Situation und der Art, wie diese ausgelegt wird. Varela et al. sprechen von „enactive cognition“; die Bedeutung einer Situation ist nicht „gegeben“, sondern wird handelnd hergestellt. Das ist in guter Übereinstimmung mit dem, was Sozialwissenschaftler, wenn sie mikroanalytisch arbeiten, ebenso feststellen wie die Autoren, die ich im PNL 46 über „mindreading“ erwähnt habe. 5. Durch solche Zirkularität entstehen selbstorganisierende Dynamiken, die helfen, Intentionalität zu verstehen. Wir den- ⏐ 4 ken nicht mehr: „Der Blinde hier, eine Welt dort“, sondern „Der-Blinde-mitStock-in-seiner-Welt“ und wir sehen, wie er sich tastend eine Welt und ein Bild von der Welt zugleich erschafft. Ich persönlich finde an solchen Konzeptualisierungen interessant, dass mit jedem Reduktionismus gebrochen wird; Erklärungen der Art, Geist sei nichts als Gehirn werden deutlich zurückgewiesen. Das Erleben als Interpretant einer Situation wird in einen Rang eingerückt, wie es auch von der Psychoanalyse gesehen wurde. Der Träumende träumt von einem Schellenklang einer Militärkapelle – aber er hat damit nur das Läuten des Weckers „interpretiert“, wie Freud uns das in der Traumdeutung vorführte. Das Unbewusste ist ja bei ihm keineswegs nur das, was gedeutet wird, sondern E s d e u t e t – in diesem Fall den rappelnden Wecker als Militärkapelle. Das wird noch deutlicher in der cognitive science so gesehen, wenn wir hinzunehmen, wie George Lakoff und Mark Johnson („Philosophy in the Flesh“, 1999) die Verkörperung des Geistes konzeptualisieren. Sie unterscheiden drei Ebenen: Der „neural level“ bezieht sich auf Phänomene wie beispielsweise das akustische Hören, die Farbkategorisierung oder Raumwahrnehmung. Der „phenomenological level“ ist der des Bewusstseins bzw. der bewußt zugänglichen Erfahrung, insbesondere unsere mentalen Zustände, unsere Umwelt, unsere körperliche Verfasstheit, unsere Interaktionen. Es ist auch der level der „Qualia“, also der ganz bestimmten Erlebnisse, die wir haben bei Zahnschmerzen oder dem Klang einer Violine. Der dritte level des „cognitive unconscious“ ist der für die Psychoanalyse besonders interessante: „Das kognitive Unbewußte ist jener riesige Teil des Eisbergs, der unter der Oberfläche liegt, unter der kleinen Spitze des Bewußtseins. Es besteht aus all jenen mentalen Operationen, die die bewusste Erfahrung möglich machen und sie strukturieren, einschließlich des Verstehens und des Gebrauchs von Sprache. Das kognitive Unbewußte gebraucht und steuert die wahrnehmenden und motorischen Aspekte des Körpers, besonders jene, die sich auf Konzepte der ba- ⏐ PNL-47 salen Ebene und der räumlichen Relationen beziehen. Es umfasst all unser unbewusstes Wissen und Denkprozesse. Deshalb umfasst es auch alle Aspekte des linguistischen Prozessierens – Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik und Diskurs.“ (Lakoff und Johnson 1999, S. 103). (Meine Übersetzung MBB) Wenn, wie Lacan behauptet hat, das Unbewußte wie eine Sprache strukturiert ist, dann hat die Psychoanalyse hier eine exzellente Anschluß-Möglichkeit an avancierteste Theorien der Cognitive Science. Gelten Erfahrungen wie die von David Sudnow nun nur für Höchstleistungspianisten oder kann man auch sagen, dass schon Anfänger diese ästhetisch so wertvolle Erfahrung machen können? SOUND, THERAPIE, GENUSS Zwei ganz unterschiedliche Arbeiten versuchen herauszuarbeiten, dass das ästhetische Empfinden nicht erst am Ende einer aufwendigen Musiksozialisation zu erreichen ist, sondern an deren Anfang liegt. Das ist nach der hier beschriebenen „EmbodimentThese“ der Cognitive Science eigentlich nicht anders zu erwarten. Das Buch von Sebastian Leikert macht dies im Anschluß an Lacan sehr schön deutlich; der Jazz-Musiker und Psychoanalytiker Steven H. Knoblauch verdeutlicht uns den praktisch behandlungstechnischen Wert solcher Sichtweisen. Nur ein bürgerliches Vorurteil wollte, dass Ästhetik zu den „höheren“ Empfindungen und Genüssen zu rechnen ist und es hat uns nicht sehen lassen, wie solches Empfinden mit unserer Körperlichkeit zusammenhängt. Musikästhetisches Empfinden ist also nicht ein aufgesetztes Bildungs-Plus, sondern steht im Zentrum der menschlichen Körpererfahrung. Leikert will nun den Nutzen dieser Überlegungen für ein Modell des musikalischen „Unterbaus“ des Sprechens erläutern. Leikert muß man zustimmen, wenn er feststellt, dass die Musik „seltener Gast in den Gefilden der psychoanalytischen Reflexion“ sei und da sie als „fundamental eigenständiges Medium“ aufgefasst werden muß, stellt sich die Frage: „Was ist dann ihre Botschaft?“ Indem er als ihr Gravitationszentrum richtig die Stimme ausweist, zeigt er schon die enge Verlötung mit der Körperlichkeit. Man kann sich ihr also nicht nähern, indem man das „Register des Sinns“ zieht, sondern man muß die Praxis des Genießens ansehen; ein bisschen umständlich, dass das 5 UND ARBEIT mit Lacan als Register der Perversion bezeichnet wird. Leikert tut dies deshalb, weil Lacan den Freud’schen „klassischen“ Triebobjekten noch zwei weitere, Blick und Stimme, hinzufügt – der Körper ist hier über die Maßen präsent. Mit dem Genuß aber ist auch die Stimme außerhalb des Bereichs des Signifikanten; sie offeriert eine andere Dimension. Leikert sieht hier die Quelle des blockierten Gesprächs zwischen Musikwissenschaft und Psychoanalyse: “Es gibt in der Musik nichts, worin sich das Subjekt spiegeln und wiedererkennen könnte. Diese vermeintliche Subjektlosigkeit der Musik ist Wurzel der verfehlten Begegnung zwischen Psychoanalyse und Musikwissenschaft: Das Subjekt hat in der Musik scheinbar keine Repräsentanz, folglich, so die Psychoanalyse, gibt es hier nichts für sie zu verstehen, folglich, so die Musikwissenschaft, hat die Psychoanalyse als Wissenschaft vom Subjekt in der Musikbetrachtung nichts zu suchen“ (S. 26). Das Seltsame freilich ist, daß Musiker wie Musikrezensenten, Komponisten wie auch Hörer in der Musikrezeption, wenn sie denn versprachlicht wird, stets körperliche Metaphern heranziehen. Aus Leikerts Schätzen zitiere ich nur Richard Wagner: „Harmonie und Rhythmus sind Blut, Fleisch, Nerven und Knochen ...die Melodie dagegen ist dieser fertige Mensch selbst, wie er sich unserem Auge darstellt.“ (Leikert, S. 29) Interessant, wie selbstverständlich wir gelten lassen, dass die Melodie sich „dem Auge“ darstellt! Hier kommt eine transmodale Kommunikation zur Geltung – vom Ohr zum Auge -, die Daniel Stern in der Säug- ⏐ PNL-47 lingskommunikation hat gelten lassen. Das Seelische im Klang, so fällt einem ein, hat uns auch der 26jährige Beethoven, als er die Klaviersonate op. 10,3 schrieb, durch seinen Biographen Anton Schindler überliefert. Diese Sonate sei „Der Seelenzustand eines Melancholischen mit all den Nuancen von Licht und Schatten im Blick der Melancholie“. Durch vielfältige und vergleichende Sichtungen der philosophischen Kommentare – von Hegel, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, Adorno – mit Äußerungen von Komponisten kommt Leikert zu der Auffassung, dass die Metapher solche Verschmelzungen zwischen den Sinnesmodi, aber auch zwischen dem Selbst und dem Anderen, aufzuheben in der Lage ist – Musik befreit im Genuß von der Entfremdung. “Sprache hebt in vielfältiger Weise die imaginäre Welt auf. Worte beziehen sich auf Bilder, die wiederum auf Dinge in der Welt verweisen. Die Satzstruktur mit ihrer Subjekt-Objekt-Ordnung bildet den Widerschein der dualen imaginären Beziehung ... Die musikalischen Kontextformen – Melodie, Thema, Motiv, periodische Anordnung, musikalische Form – bieten ein reichhaltiges Repertoire an Möglichkeiten der horizontalen Gliederung. Sie sind jedoch kategorial auf einer Ebene, kennen etwa nicht den Unterschied von Subjekt und Objekt, die Verbformen des Aktiv und Passivs oder die verschiedenen Zeitformen“ (Leikert, S. 39) In der Musik geht das Subjekt zurück, „an den Ursprung der Sprachlichkeit“ (S. 44), aber es ist keine Regression ins „Primitive“, wie manche vorschnell meinen könnten; sondern hat damit zu tun, „dass Musik sich nicht auf gesehene Objekte (Objektvorstellungen), sondern auf erlebte Körperspannungen bezieht. Sprache bildet ihre Bedeutung durch Zeichen und Vorstellungen, Musik dagegen symbolisiert subjektiv erfahrene Spannungszustände durch Imitation“ (S. 54) Das ist die hier relevante Generalthese, die Leikert nun vielfach noch ausdifferenziert, anschaulich etwa darin, dass Musik sich „nicht verurteilen“, sondern „nur fliehen“ lasse, mit theoretischem Gewinn darin, dass Musik eine Form der mimetischen Symbolisie- 6 rung sei, also der körperlichen Angleichung, die schon das Neugeborene mitbringe, indem es Rhythmen des Herzschlags kenne, die durch Musik nur nachgebildet seien – der Körper hat einen Primat, „Musik ist eine Sprache vor der Objektrepräsentanz“ (S. 59). Musik habe „Präsenzsuggestion“. Diese klaren theoretischen Distinktionen und Gewinne führt Leikert nun am Beispiel von J.S. Bach („Wohltemperiertes Klavier“) oder an der 9. Sinfonie von Beethoven oder in Verdis „La Traviata“ vor – und das in keineswegs schwelgender Betroffenheitslyrik. Nein, die theoretischen Mühen zahlen sich als konkrete Gewinne in handfesten Untersuchungen der musikalischen Notationen aus – und eine solche Leistung muß man würdigen, weil Leikert damit echte Dialogmöglichkeiten zwischen Psychoanalyse und Musik öffnet. Es ist, als würde Steven H. Knoblauch mit seinem, wenn auch früher geschriebenen Buch, der Leikert’schen Theorie das notwendige und stimmige, das behandlungstechnische accompagniato zur Seite stellen wollen; beide Bücher gemeinsam zu lesen, erzeugt ein Duett im Kopf. Das soll wohl auch so sein, denn Knoblauch improvisiert sowohl als Jazzmusiker wie auch als voll ausgebildeter Psychoanalytiker – wobei ich bei „improvisieren“ an das englische „to improve“ denke, das ja bekanntlich „verbessern“ heißt; das Eine gewinnt vom Anderen. Knoblauch sieht „improvising and accompagniment in jazz as a metaphor for clinical technique“ und führt seine Überlegungen, im Wechselgesang mit psychoanalytischen Theorietraditionen zu einem Konzept des “resonant minding” (S. 95) fort. Er will weg vom hydraulischen Triebmodell, aber auch von den starren Verräumlichungen der Objektbeziehungstheorie. “the resonant minding model shifts the metaphor for action, that is, to mind or to attend. In this model, the analyst continuously inquires of herself, ‘To what am I attending and to what am I not attending?’ … In a sense, minding is the active mediation of the interplay of an array of fields constrained only by the capacities for awareness of the dyadic psychoanalytic partners.” (S. 95) Und dann verdeutlichend: ⏐ PNL-47 7 “Whereas in the hydraulic model mutative activity is created by the transfer of energy and in the plastic model it is created by a restructuring of objects and their relationships, the operation in the resonance model that seems to trigger mutative activity is affective resonance, that is, the recognition and responsiveness to emotional displays, just as improvising jazz soloists and accompagnists recognize and respond to displays on nonverbal dimensions of tone, rhythm, and harmony. This kind of matched over mismatched patterning has been well documented in infant research, where infants and caregivers have been observed to influence the state and patterning of the actions and feelings of each other without the availability of symbolic verbal communication. Again, we can see how the minding metaphor is consistent with the conception of a musical edge constituted by process contours serving as a lens for therapists to recognize and respond to emotional displays without the availability of symbolic verbal communication” (S. 96/97). lich. Vielen Analytikerinnen und Analytikern sei aufgefallen, Man sieht deutlich die Übereinstimmung in den Grundlinien mit Leikerts Auffassung: emotionale Botschaften werden als ein anderes Register als die symbolischen aufgefasst, man kann miteinander kommunizieren, ohne ins Register des symbolischen Sinns eingreifen zu müssen. Leikert würde hier von mimetischer Symbolisierung sprechen. Was sinnvolle therapeutische Kommunikation möglich macht, ist emotionale Improvisation, für die es weder im Jazz noch in der therapeutischen Musik Regeln geben kann, sondern nur die Befähigung, sich einzuschwingen. Die aber ist weitgehend körper- Sowohl die Schreibung von “in-formation” als auch das Spiel mit den anderen Vorsilben spielt auf eine Dimension des Körperlichen in der Sprache an, die in der Cognitive Science seit dem Buch von Mark Johnson (“The Body in the Mind“) große Beachtung gefunden hat. Ihr entspricht im Deutschen die Vorsilbe „ent-“, die oft (wenn auch nicht immer) das Container-Schema artikuliert („Ihren Worten konnte ich entnehmen, ...“). Aber bleiben wir noch bei den therapeutischen Dimensionen des Körperlichen, auf die ein anderer Autor deutlich zu sprechen kommt. DER KÖRPER Das Buch 1 von James T. McLauglin („The Healer´s Bent. Solitude and Dialogue in the Clinical Encounter”, 2005) entstand aus der Zusammenarbeit des Psychoanalytikers James T. McLaughlin mit dem Körperpsychotherapeuten William Cornell. Dieser begann in den frühen 90ern seine Suche nach 1 Die Besprechung dieses Buches mit dem Text bis zur nächsten Überschrift verdanke ich Peter Geissler, Wien, der sie mir freundlicherweise für diesen PNL zur Verfügung gestellt hat. Ich bin ihm, mit dem mich ausführliche Korrespondenz verbindet, zu Dank verpflichtet. “how the affecting of analyst as well as analysand can be significantly mediated by her or his embodiment. Bodies in interaction construct and mediate affective fields as the nexus for in-formation”. (S. 97) Sprachmächtig und wortspielerisch muß sein, wer an reichen Fallbeispielen den gemeinten Zusammenhang darstellen will und dabei ja nicht anders kann, als sich der Sprache zu bedienen. Am Beispiel eines erregten gemeinsamen Atmens mit einem Patienten beschreibt Knoblauch das Geschehen dann so: “So my utterance, though unbidden, seemed to arise from the need to recognize that our conspiracy (i.e. our breathing in harmony with each other) had shifted to an exspiracy (a termination of our breathing). I reached for an inspiracy (a breathing of life back into our exchanges)” (S. 143) IN DER THERAPIE Psychoanalytikern, die sich zwar auf die Rolle des Körpers in der Therapie bezogen, jedoch anders als noch bei Wilhelm Reich. Er sprang an auf die Form der Selbstanalyse bei McLaughlin an – auf seine Art und Weise, therapeutische Fehler ehrlich zu analysieren. Auch Reich war ursprünglich - zwischen 1924 und 1930 – von therapeutischen Fehlern ausgegangen, die ihn zur Konzeption des Charakterwiderstandes führten und ihn – ähnlich wie Ferenczi – auf die nonverbalen Elemente im therapeutischen Dialog PNL-47 aufmerksam machten. McLaughlins Selbstanalyse, die Art und Weise der Exploration von Übertragung und Gegenübertragung einschließlich ihrer körperlichen und handelnden Elemente, wie McLaughlin sie anhand von Beispielen auf beeindruckende Weise zeigt und die man heute allgemein „Enactments“ nennt, reichte weit über das hinaus, was in den Schriften Wilhelm Reichs zu lesen war. 2002, während der ersten Konferenz der internationalen Assoziation für relationale Psychoanalyse und Psychotherapie in New York, lernten die beiden einander kennen. Über ein Jahr lang trafen sie sich fast jeden Sonntag morgen, um gemeinsam zu arbeiten. Im Unterschied zu tiefenpsychologisch fundierten Körperpsychotherapien einschließlich dessen, was man heute „analytische Körperpsychotherapie“ nennt, bleibt McLaughlin eindeutig Psychoanalytiker – es geht ihm nicht darum, „aktive Technik“ einzuführen, sondern ein neues Modell der Reflexion therapeutischer Praxis, die den Körper einschließt, vorzustellen. Im Sinne einer relationalen Psychoanalyse ist die Ansicht McLaughlins, dass die eigene Gegenübertragungsanalyse einen Kristallisationspunkt im therapeutischen Geschehen darstellt. Besonders therapeutische „Fehler“ (z. B. verbale Äußerungen oder aber auch Handlungen, die den Patienten irritiert oder verletzt haben) werden in dieser Hinsicht besonders relevantes „Material“; es gehe zunächst darum, dass der Analytiker den eigenen Beitrag anerkennt! All dies ist noch im geläufigen Kanon. Bemerkenswerter sind McLaughlins Äußerungen aber, wenn er einwirft, auch bestimmte Momente analytischen Schweigens können beim Patienten solche Irritationen auslösen und ein Gegenübertragungsagieren des Analytikers darstellen. Denn üblicherweise gilt doch die „Regel“, dass man dann, wenn das Material des Patienten zu verwirrend oder zu irritierend ist, im Zweifelsfall eher nichts sagt als eine vorschnelle Antwort zu geben. McLaughlins empfiehlt nun keineswegs „mutuelle Analyse“, wie sie Ferenczi einst mit einigen seiner Patientin probierte, und er befürwortet auch nicht die offenherzige Mitteilung bestimmter Gegenübertragungen wie ⏐ 8 Owen Renik dies vorgeschlagen hatte. Vielmehr macht er deutlich, dass sich entscheidende Momente des Verstehens auch auf einer nicht-verbalen Ebene vollziehen können – indem sie sich in Handlungen ausdrücken: „Instead, semiarticulate phrases allude to small analytic happenings, still resonant in these patients, that provided core perceptions of their having felt stood by, their pain and their joy recognized, their personal value affirmed, something essential in them believed“ (S. 222). Drei Grundannahmen durchziehen seinen therapeutischen Ansatz: 1. Sich gegenseitig beeinflussen zu wollen ist inhärentes und drängendes Motiv in lebendigen Systemen und ursächlich für jede kommunikative Aktivität, dies gelte bereits auf sehr früh (wie die neuere Säuglingsforschung zeigt); 2. die Überzeugung, dass das eigene Verhalten Antwort auf das Verhalten eines Anderen ist, d. h. ein relationaler Standpunkt wird mit einem kognitiven verknüpft: Verhalten beeinflusst sich wechselseitig, und davon sind wir innerlich überzeugt. Das aber macht auch unsere Irrtumsfähigkeit aus. 3. die Überzeugung, dass eigenes Verhalten im Verhalten des Anderen gründe, sei Grund für den analytischen „Kampf“ und die Energie, mit der dieser „Kampf“ geführt werde, solange beide Interaktionspartner voneinander etwas wollen. Der unbewusste Impuls dabei ist für McLaughlin nicht etwas, im Angesicht dessen wir Scham und Verzweiflung empfinden müssen, sondern der unser Leben reich und kraftvoll macht. Damit dies werden kann, brauchen Patienten ein „embodied“ Gegenüber, das sich seiner eigenen unbewussten Impulse nicht schämt oder an ihnen verzweifelt, oder sie durch technische Maßnahmen verbannen will, sondern sich frei fühlt, sich ihnen zu stellen. Mehr noch: Blinde Flecken des Therapeuten, Momente in denen er sprachlos wird, können auf diese Weise zum eigentlichen Fokus werden. Den gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus darauf zu richten, formt und be- PNL-47 grenzt das eigentliche Potenzial für die analytische Aufgabe. Wechselseitige projektive Identifikationen stehen daher im Zentrum. Es geht ihm um eine „balancierte“ Erfassung solcher wechselseitigen Zuschreibungen – sie sind nicht lediglich „Transplantate“ des Patienten, sondern eigene Anteile des Analytikers, hervorgelockt und unter dem Druck entstanden, das von einem anderen Persönlichkeitssystem ausgeht (S. 192). Der Patient „liest“ auch seinen Analytiker und er tut dies gerade in seinen körperlichen Merkmalen, in dem, wie er sich bewegt und atmet, sich räuspert oder schweigt. Auch hier also, wie bei Leikerts musikalischen Analysen, ein „Jenseits des symbolischen Registers“. Das macht auch einen Unterschied zu Bion, der den Analytiker eher als „Container“ ansah, bezogen auf das zunächst unverdauliche Material von Patientenseite. McLaughlin öffnet die Chance zu beidseitigem Lernen als der Essenz des psychoanalytischen Prozesses. Nonverbale Elemente des Körpers geben der Übertragung, die McLaughlin in ihrer weiteren Bedeutung versteht, Substanz und Form: „… these behaviors take shape from and give substance to the transference of both participants and provide commentary about the state of the analytic relationship“ (S. 122). Gestisches Verhalten ist älter als Wortsprache und in ihrer Kraft so stark wie Worte, um Affekte zu transportieren. „Idiosyncratic gestures are generally connected with spezial historical antecedents or particular dynamic conflict constellations, the essence of which can be visibly captured in their aptness. Background gesturs speak more of the intrapsychic conflict and of memories now an integral part of character and overall personality, yet still closely connected with the early object relations that helped to shape these conflicts over developmental time. I am suggesting that, in these background kinesics, one can glimpse the enactment of still active and important struggles of ambivalence over clinging and freedom, over merge and separation, over dominance and submission – child-parent relationships still being alluded to and dramatized even in patients whose well-evolved personality structure permits ⏐ 9 satisfactory application of the tripartite model” (S. 133). In einem eigenen Abschnitt mit dem Titel “On-the-Couch-Enactments” (S. 123-138) beschreibt er sehr persönlich diesen Austausch; im Grunde sei jeder der beiden Interaktionspartner daran interessiert, das „Herz“ des Anderen zu erreichen - und gleichzeitig das eigene zu schützen. In einer sehr schönen Formulierung gelingt es Joe Lichtenberg in seinem neuen Buch „Craft and Spirit“ (2005) eben diesen Zusammenhang zu fassen: „An interpenetration of mind/body states often is achieved through implicit nonverbal communication, but wisdom about one another is enhanced by words.“ (Lichtenberg 2005, S. 68) Lichtenberg wie McLaughlins implizite Annahme ist demnach: Ein genauer Blick auf den körperlichen Ausdruck ergibt Anhaltspunkte und Schlüsse in Bezug auf latente intrapsychische Konflikte im Feld früherer Objektbeziehungen – und genau diese aktualisieren sich im dynamischen Feld der analytischen Beziehung. Körper und körperliche Berührung wurden auf der diesjährigen Lindauer Fachtagung in den Brennpunkt des Interesses gerückt. Jörg M. Scharff stellte dazu fest:, dass eine Differenzierung zwischen konventioneller Berührung, körperlicher Berührung in akuten Krisensituationen bzw. bei starken Affekten, sowie körperliche Berührung zur Eingrenzung von Fantasmen notwendig und hilfreich sei. Dazu im einzelnen: Prozedurale Besonderheiten im Rahmen konventioneller Berührung wie beim Handschlag kommen oft erst dann zu Wort, wenn sie mit einer Störung verbunden sind, z. B. wenn sich die Hände der sich Begrüßenden nicht treffen. Durch das Nicht-Beachten einer solchen Störung entgehe dem Analytiker, so Scharff, eine wichtige Mitteilung, die der Patient evtl. nur durch eine derartige Handlung machen könne. Es sei daher wichtig, sich für die individuell sehr unterschiedlichen Bewegungsmodalitäten zu sensibilisieren, um das Spektrum der in diesen körperlichen Äußerungen verborgenen Mitteilungen wahrnehmen zu können (das schließt die PNL-47 Wahrnehmung der eigenen prozeduralen Reaktionen während konventioneller Berührung ein). Wird der Patient durch einen starken Affekt bewegt, wie z. B. bei Trennungspanik, kommt es seitens des Analytikers u. U. zu passageren, einmaligen Berührungen meist am Rande der Stunde, und auch hier folgt der Handlungsgestus vertrauten Gesten aus dem Alltag, wie eine Hand auf die Schulter des Anderen legen, dem Patienten wie schützend über die Schulter streichen etc. Es wird dabei der verbale Austausch unterstützt durch einen Rückgriff auf eine frühe Kontaktform, den „Haut-zu-Haut-Kontakt“. In der Berührung mit Mutter oder Vater erfährt das kleine Kind eine erste Form der Begrenzung, ein „Sich-umhüllt-Fühlen“, d. h. die Empfindung, wie in einem Behälter getragen zu werden, somit eine Vorform dessen, was später als „Containing“ bezeichnet wird Didier Anzieu spricht in diesem Zusammenhang vom „Haut-Ich“. Derartige Kontakterfahrungen führen zur Bildung früher Repräsentanzen. Auf die sensorische Seite dieser frühen Beziehung werde daher in bestimmten Ausnahmefällen zurückgegriffen, was natürlich erscheine und wofür es keinen Ersatz gebe. Wenn also Worte den Patienten nicht ausreichend zu berühren vermögen, dann sei das Angebot einer haltenden Hand beruhigend (oftmals reiche schon allein das Angebot für sich). Paradoxerweise ist manches Mal gerade körperliche Berührung zur Eingrenzung psychischer Fantasmen und zur Ausbildung reiferer Beziehungsmodi hilfreich. Scharff berichtete von einer Patientin mit autistischen Zügen, die in der Grundüberzeugung lebte „Nie kann jemand wirklich für mich da sein“, und die ihre Gedanken für Realität hielt und auf diese Weise mit dem Analytiker eine gleichsam halluzinierte innere Realität aufrecht erhielt. Durch „inszenierende Interaktion“, gedacht als „Rahmen im Rahmen“, wurde bei dieser Patientin gerade durch die Berührung des Analytikers die unbewusste Überzeugung sichtbar. Handeln als Probedenken gab Anstoß zu neuen Möglichkeiten des Sich-Beziehens, wodurch ein produktiver Trennungsprozess in Gang gesetzt wer- ⏐ 10 den konnte (dieses Fallbeispiel wurde ausführlich in „Psychoanalyse und Körper“, 1/2004 beschrieben). Berührung habe im psychoanalytischen Kontext nie eine lexikalische Bedeutung im Sinne von: „Wenn ich das tu, dann geschieht das.“ Es gehe nie um einfaches Anwendungswissen, sondern die jeweilige Bedeutung erschließe sich aus dem jeweiligen komplexen Wechselspiel von Übertragung und Gegenübertragung. Die unbewusste Bearbeitung des Patienten sei dabei immer im Auge zu behalten, und es geschehe immer mehr, als beide Beteiligte wissen können – so sei die methodisch bedingte Zurückhaltung des Psychoanalytikers gegenstandsangemessen. Berührung ist somit keine Technik, sondern Ereignis im analytischen Rahmen. Berührung ist somit „nur ein Spezialfall des großen Themas, wie Erkenntnisgewinn und seelischer Fortschritt, wie Gewähren und Versagen in der Psychoanalyse ausbalanciert werden, und ob man berührt oder nicht: Vor einem Agieren in die eine oder andere Richtung ist niemand geschützt.“ Selbstanalyse schließt somit notwendigerweise den eigenen körperlichen Ausdruck ein. Das Schmalz im Dritten Ohr, von dem Merton Gill einmal so pointiert sprach, kann durch konsequente Selbstanalyse entfernt werden. Wir hören besser – wenn wir selbst weniger wollen. Mit dem Hören ist der Bezug zur Musik wieder gegeben. Auch eine unbewusste Berührungsangst gegenüber dem Körper, vielleicht wissenschaftlichtherapeutisch rationalisiert, kann dazu gehören. Da es jedoch einfach nicht gut möglich ist, von der Gegenwart eines Anderen unbeeinflusst zu sein, ist es eigentlich kein Wunder, wenn ein gelungenes Stück Selbstanalyse die therapeutische Atmosphäre und damit auch den Patienten verändert. Daß die Aufmerksamkeit sich nicht nur auf eigene Biographie richten muß, sondern auf das Tun des Körpers in Gestik, Mimik und Stimme, erweitert den Fokus der Selbstanalyse beträchtlich. Der körperliche Ton macht auch hier die analytische Musik. Wenn Leikert die Tür für das Gespräch zwischen Psychoanalyse und Musikwissenschaft ein beträchtliches Stück aufgestoßen hat, dann könnte ⏐ PNL-47 hier das Gespräch mit den Körpertherapeuten auf eine anspruchsvolle Weise weitergehen. Der Gewinn wäre bemerkenswert, weil eine solche Form des Miteinander-Arbeitens DER KÖRPER Genau muß sein, wer die Körperlichkeit in der Sprache vernehmen will; das von Knoblauch zitierte Sprachspiel, auch das Exempel der deutschen Vorsilbe „ent-“, hat es ja schon gezeigt; auf die großen Linien, wie wir sie mit unseren Begriffen von Übertragung und Gegenübertragung beschreiben, kommt es wohl an, doch können wir auf die Details sowenig verzichten wie der Klang eines Orchesters nicht nur aus der Melodieführung, sondern aus dem so Vielen Anderen besteht, was man meist nicht bewusst hört – und das ist übrigens keineswegs nur „Genuß“ (wie Leikert Lacan einfach folgend, meint), sondern für diejenigen, die es erzeugen, durchaus harte „Arbeit“. Musik will ebenso erlernt und geübt sein wie das Analysieren. Katya Bloom bezeichnet sich nicht als Körpertherapeutin, sondern als „movement therapist“ in einer Londoner Privatpraxis. Sie hat Tanz gelernt und gelehrt, auch Tanztherapie und sie verbindet in ihrem Buch „The Embodied Self – Movement and Psychoanalysis“ (2006) dieses subtile Können mit psychoanalytischen Theorien auf eine intelligente Weise, die das hier nachgezeichnete Gespräch verstehend fortsetzt. Auch ihr ist nicht entgangen, wie sehr die Atmosphäre in therapeutischen Sitzungen vom körperlichen Habitus, von Gestik und Bewegungen, von eingeschobenen Lauten und plötzlichem Schweigen bestimmt wird und sie zeigt an psychoanalytischen Klassikern, wie wenig dort ein System für die Beschreibung des Körperlichen existiert. Man findet etwa in einem Fallbericht, das Kind habe sich „altklug“ verhalten – aber niemand weiß, was damit beschrieben ist. Hier bietet die Autorin ein System der Bewegungsbeschreibung an, das von Rudolf Laban entwickelt wurde, schon an vereinzelten Stellen von Judith Kestenberg aufgegriffen wurde, 11 letztlich eine Analyse „mit Herz“, Blut, Fleisch, Nerven und Knochen ist – und diese Körperlichkeiten eine Gesprächs-Melodie erzeugen können. IN BEWEGUNG aber weitgehend unbekannt ist 2 . Laban (1879-1958), eigentlich Rezso Laban de Varaljas, gilt neben Emile JacquesDalcroze als Förderer des Ausdruckstanzes. Laban war Pionier bei der Entwicklung von Bewegungsbeschreibungen, der Bewegung als Resultat eines Strebens nach einem Objekt oder aber nach einem bestimmten Selbstzustand auffasste- und er entwickelte nun ein Schema, um solche Bewegungen zu beschreiben. Die Begriffe „weight“, „space“, „time“ und „flow“ stehen im Zentrum. Sie können weiter differenziert werden. „Weight“ kann stark oder schwach sein und bezieht sich auf die physische Empfindung des Körpers, seine Haut und seinen Muskelapparat, seine Oberfläche und Tiefe und das Empfinden einer Berührung. Es artikuliert die Entwicklung einer Intention, etwas mit dem Körper zu tun: sich in Beziehung zu Anderen zu setzen oder sich zu deren Intentionen zu verhalten. „Space“ schließt den dabei in Anspruch genommenen mentalen Raum ein, „time“ bezieht sich auf die Rhythmisierung der Impulse und Handlungen und „flow“ schließlich ist assoziiert mit der Kontinuität einer Bewegung. Dies alles wird weiter differenziert und schließlich auf die Bewegung eines Körpers im Raum mit dem Begriff der „space harmony“ bezogen. Der Ausgangspunkt des Strebens nach einem Objekt verlötet sich für Katya Bloom dann mit psychoanalytischen Orientierungen sehr weitgehend: „unconscious phantasies and internalised object relationships become represented in the body and its patterns of movement. It would seem that, if not recognized, psychobiological patterns 2 Unter http://user.unifrankfurt.de/~griesbec/LABAN.HTML findet man eine differenzierte Anwendungsbeschreibung ⏐ PNL-47 may unknowingly be handed down from one generation to another” (S. 49) Unter Bezug auf einige Befund der Säuglingsforschung und ihre Integration in psychoanalytische Theoriebildung kann sie darauf hinweisen, dass Empathie mehr ist als nur die Konstruktion einer „theory of mind“; Empathie ist „a bodily based relationship, in which sensoriaffective as well as mental experience is communicated” (S. 56) und das gilt ja sicher für die frühen Entwicklungen des Säuglings. Er würde ohne diese gleichsam ontologische Dimension der Empathie gleichsam verhungern oder aber an den eigenen seelischen Ausscheidungsprodukten sich vergiften, wenn elterliche Empathie nicht unmittelbar verstünde, dass hier etwas gebraucht wird – und dies Verstehen ist körperlich, ja bezogen auf die Rhythmisierungen und Synchronisierung von Bewegungen eben auch wiederum tänzerisch und musikalisch. Bloom entwickelt aus diesen Überlegungen das Konzept der „embodied attentiveness“ und sagt dazu, es sei 12 attune to that which he felt but is not yet thought or verbalized, akin to Bollas’s ‘unthought known’” (S. 65) Diese Resonanzen zwischen dem Körperlich-Musikalisch-Tänzerischen und dem psychoanalytischen Denken werden nun an Fallbeispielen, teils aus der eigenen Säuglingsbeobachtung illustriert und insbesondere auf die therapeutische Gegenübertragung erhellend angewandt; ein letztes Kapitel zeigt schön die Signale aus dem Solar plexus, die Therapeuten bestens kennen; für die wir aber in unserer Theorie wenig Artikulationshilfe finden. Auch hier werden Türen aufgestoßen, durch die man in neue Räume des gemeinsamen Hauses gelangen kann. Der Autorin fällt deutlich auf, wie sehr in psychoanalytischen Texten die Metapher figuriert: “Images that refer to the body or physiological processes are frequently used to describe psychoanalytic processes; yet it is not always made clear by the authors whether these images are purely metaphorical or whether, and in what sense, they are describing real physical or psychophysical processes.” (S. 57) “the ability to engage with psychophysical states in a way that enhances the therapist’s ability to R E A L I TÄ T M E TA P H E R ? FA L S C H E FRAGE ... ODER Nun könnte es ja sein, daß diese Alternative sich so gar nicht stellt, sondern dass ein Blick in die Entwicklungen der cognitive science hier klärend wird. Geht es denn tatsächlich um „real physical“ versus „psychophysical“ Prozesse? Kann man sagen, das eine sei „real“, das andere aber nicht? Warum muß man dies so gegeneinander ausspielen, als wüsste man schon, was die „wahre und wirkliche Wirklichkeit“ sei? Das ist wohl auch nicht die Absicht von Bloom, aber es ist aufregend, wenn in anderen Arbeiten dieser Gegensatz durch die Metapher überwunden wird. Dazu kann man sich die Grundgedanken der kognitiv-linguistischen Metapherntheorie klar machen, auf die sich der britische Mu- sikwissenschaftler Michael Spitzer (2004) bezieht. Eine Metapher besteht aus drei Komponenten: ein Zielkonzept (bildempfangend), ein Quell- oder Ursprungskonzept (bildspendend) und eine Brücke zwischen beiden. „It is a mapping from one concept domain to another, and as such it has a three-part structure: two endpoints (the source and the target schemas) and a bridge between them (the detailed mapping)“ (Lakoff und Turner 1989). Es kommt darauf an, die Gerichtetheit der „metaphorischen Projektion“ zu verstehen. Gemeint ist damit nicht ein pathologischer Vorgang („Projektion“), sondern die Darstellung eines Konzepts durch ein anderes. Man beachte: ein Konzept! ⏐ PNL-47 Nicht etwa ein Wort allein. Konzepte aber sind in sich schon imaginativ-szenisch strukturiert und diese reiche bidlhafte Vorstellungsstruktur ist es, die „übertragen“ (die deutsche Bedeutung von griech. „metaphorein“) wird – aus einer Vorstellung wird eine Darstellung. Konzept – das bedeutet vor allem, dass es nicht nur um Worte, sondern um emotionales Erleben und dessen Konsequenzen im Handeln geht. Konzept ist gerade nicht rational gemeint, sondern als unbewusste Strukturierung. Deshalb sprechen Metaphern den imaginativen Nachvollzug auch bei Hörern in besonderer Weise an. QUELLE (Körperlich: sinnlich-anschaulich) Auf diese Weise können wir uns nicht nur konkrete „Ziele“ anschaulich machen, sondern auch abstrakte Domänen dem Verstehen erschließen, etwa wenn in der Mathematik die Rede von den „Schenkeln“ eines Dreiecks ist. Vor allem aber nutzen wir die metaphorische Projektion zur Veranschaulichung von „Domänen“, für die es keine abstrakten Definitionen geben kann. Dazu ein jüngeres Beispiel aus einem Text des FAZ-Musikkritikers Jürgen Kesting über den Tenor Rolando Villazón: „Vor allem aber überzeugt er durch seine singdarstellerische Spontaneität. So stellt er mittels onomatopoetischer Effekte in der Klein-ZackBallade mit dem Geschick eines Geschichtenerzählers die Figur des Zwergs vor das Auge des Ohrs, bevor er sich dem Gefühlsstrom der Hoffmannschen Liebeserinnerungen hingibt.“ (FAZ vom 25. Februar 2006, S. 44) Ein Text voller Metaphern, wie sie nicht selten in der Beschreibung von musikalischen Erlebnissen genutzt werden. Die in unserer Kultur privilegierte sinnliche Domäne ist das Auge, das hier als Bildspender genutzt wird, um die Erfahrung des Hörens zu erläutern: der Sänger stellt etwas vor das 13 Nehmen wir als Beispiel eine so simple Metapher wie “Achill ist ein Löwe”. Achill ist das Ziel, der Löwe der Bildspender, die Kopula „ist“ aber fungiert nicht in einem logischen Sinn der Gleichsetzung, sondern schafft eine kognitive Struktur, die vorschlägt, Achill mit dem Bild des Löwen zu sehen. Denn Achill ist natürlich kein Löwe, doch die Metapher behauptet gerade dies – aber eben bildhaft. Deshalb muß das „ist“ nicht als Definition, sondern als Projektion eines Bildkonzepts verstanden werden: ZIEL (Abstrakt) Auge des Ohrs – man beginnt zu „sehen“ (natürlich metaphorisch). Eine andere mit eingewobene Metapher ist die der Erzählung; die Musik erzählt eine Geschichte, der Sänger macht das hörbar. Und schließlich sind die Gefühle ein Strom, wobei die Doppeldeutigkeit dieses Wortes auf zwei Bildgeber verweist, die hier verdichtend ineinander gewoben werden: der elektrische Strom der Gefühle, der einen „durchglüht“ und manchmal durchzuckt, dann aber auch der Strom als jener Fluß, an dem der vernehmende Hörer still lauschend und meditierend sitzt wie einst Siddharta. Häufig ist der Sprachgebrauch, Musik male eine Landschaft. Die Landschaft ist die andere Domäne, der Bildspender, die auf den Bildempfänger „Musik“ projiziert wird. Man kann dann auch sagen, die Musik werde als Malerei gehört, erlebt und beschrieben. Diese Veränderungen durch das Wörtchen „als“ machen für das ästhetische Erleben sehr viel! Aber man darf sich nicht täuschen! Musik ist natürlich keine Landschaft. Gerade die vielfache Variation der Metaphorik in der Beschreibung der Musik belegt, dass Musik eine Art „contentless cognition“ (Spitzer, S. PNL-47 78) sei, also eine Art höherer Rationalität, die die Enge des Begriffs überschreite. Weshalb sprechen wir von „hohen“ oder „tiefen“ Tönen? Warum hören wir manche Melodieführungen als „steigend“ oder „fallend“ (musikalische Beispiele bei Michael Spitzer, S. 217 und S. 295)? Gerade im musikalischen Erleben versagt der abstrakte Begriffsapparat, gerade hier kommt die metaphorische Projektion zum Zuge. Was wird projiziert? Die abstrakte Struktur (Michael Spitzer spricht vom „sense of structure“) einer vertikalen Linienführung (von oben nach unten oder umgekehrt) und zugleich die Struktur in der zeitlichen Horizontalen des Verlaufs: “It is often said that music behaves like the body in motion, and that listeners project their experience of bodily movement onto their audition of musical processes, which are heard as ‘rising’ and ‘falling’, ‘traversing physical space’, ‘leaping’ and so on…This is because the ‘meaning’ of the music, to a large extent, inheres not within the notes themselves (the information, in this particular case, is too scant for that) but within a concept we apply to them” (S. 10) Wir verstehen, warum und wie sich Musik aus Bewegung und Tanz entwickeln konnte. Um nun zu erklären, was ein Konzept und dessen Struktur ist, beruft sich Spitzer auf Lakoff und Johnsons Theorie der körperlichen Schemata. Nehmen wir als Beispiel solche simplen Präpositionen wie „über“ oder „unter“. Warum sagen wir, dass wir im Wörterbuch „unter“ einem Stichwort nachschlagen? Weil die Imagination damit verbunden ist, dass das Gesuchte Teil eines Oberbegriffs ist, den wir schematisch höher ordnen. Der Oberbegriff wird als Container gedacht, der den Unterbegriff enthält; die Kategorie „Kategorie“ ist ein metaphorischer Container. Dabei machen wir auch von einer selbstverständlichen Raumorientierung nach der „Oben-Unten-Aufteilung“ Gebrauch, die schon Säuglinge lernen. Wenn die Mutter Milch in ein Glas füllt, steigt der Flüssigkeitsspiegel; wenn das Kind sich aufrichtet, wird es größer und gewinnt einen höheren Überblick – das Kind erwirbt sinnlich die Metapher OBEN IST MEHR. Und nutzt diese dann, ⏐ 14 um Konzepte wie „sozialer Aufstieg“ zu verstehen, dessen imaginativer Wert nach oben verweist. Auch die Metaphorik eines Satzes wie „Der Dollar fällt“ wäre ohne die Metapher, die hier vor der Sprache schon erworben wird, nicht verständlich! Deshalb also sprechen wir von Stimmungen wie „niedergeschlagen“ oder „sich wieder obenauf“ in dieser Weise – es wäre unmöglich, sich einen Deprimierten als „hochaufgerichtet“ sprachlich-evozierend zu imaginieren. In allen Kulturen, so hat man zeigen können, gibt es irgendein Äquivalent für „niedere“ Gefühle und „hohe“ Ansichten. Selbst das Wort „Tiefenpsychologie“ ist noch von dieser Metaphorik bestimmt – nicht aber: das Unbewusste! Jetzt verstehen wir, warum Freud sich gegen die Redewendung „das Unterbewusste“ gewehrt hat; er wusste, dass auch die „höheren“ Regungen unbewusst sein können. Selbst die Präposition „unter“ hat einen deutlich imaginativ-metaphorischen Gehalt. Weil oben „mehr“ ist, ist das Obere auch das Umfänglichere, es ist der „Container“ seiner Elemente. Hier ist also ein zweites Schema, das vom CONTAINER ebenfalls mit genutzt. Wir benutzen es auch bei der Präposition „in“, wenn wir sinnlich genau sagen, dass wir uns „im“ Zimmer befinden, genauso aber, wenn wir metaphorisch sagen, dass ein Artikel „in“ der Zeitung erschien oder dass „in“ den Worten eines anderen etwas Gutes steckte. Die gleiche Imagination findet sich häufig mit der deutschen Vorsilbe „ent-“ verbunden: „Ich ent-nahm seinen Worten, dass...“ – in einer solchen Wendung sind die Worte ein Container, der etwas enthält. Bemerkenswert finde ich, dass Lakoff das Container-Schema (neben vielen anderen) beschreibt, ohne auf Bions entsprechende Arbeiten zu sprechen zu kommen; es genügt die Übereinstimmung in der Sache. Vergleichbares gilt für die Präposition „über“. Lakoff (1987) zeigt in einer Fallstudie der Verwendung dieser Präposition, wie dem immer wieder ein Bildschema zugrunde liegt: Es gibt einen (gedanklichen) Weg, der höher verläuft. Das ist der Fall bei Sätzen wie: „Er sprang über den Zaun“ genau so wie bei Sätzen wie: „Sprechen wir einmal über das wei- ⏐ PNL-47 tere Thema...“ Die Sprecher positionieren sich höher als das Thema. Ein etwas anderes Bildschema des Pfades kommt zur Geltung, wenn einer sagt: „Gehen wir zum nächsten Punkt über“. Hier „gehen“ wir - und sehen die Übertragung einer imaginativen Struktur metaphorisch genau von einem metaphorischen Punkt zum nächsten. Auch wenn ich hier nur wenige Beispiele geben kann, dürfte der Grundgedanke deutlich sein: die körperliche Erfahrung der Bewegung im Raum findet sich als embodiment in der abstrakten, gleichwohl bildhaftimaginativen Struktur des Sprechens wieder. Die sinnliche Erfahrung des Körpers wird in andere Bereiche (Domänen) projiziert. Solche metaphorische Projektion nutzt dabei die Schemata der Körperlichkeit und ihrer Situiertheit.. Das gilt nun natürlich auch für musikalische Ausdrücke und Gestaltungen. Was sagen wir, wenn wir sagen, der Ton d sei höher als das c? Auf einer solchen metaphorischen MUSIK, SEELE W 15 Ton-Leiter könnten wir uns ohne die metaphorische Projektion des Oben-UntenSchemas nicht bewegen. Schemata und Kategorien helfen uns, die Welt zu ordnen. Diese beiden Strukturierungen sind sowohl körperlich als auch kulturell und Spitzer führt kenntnisreich an Beispielen vor, wie von hier aus die Wahrnehmung der Welt nicht grundsätzlich von der der Musik unterschieden werden muß. Das gilt für Rhythmus und musikalische Form, für Phrasierungen und selbst für den Taktstrich (S. 247), der einen metaphorischen Ruhepunkt in einer rhythmischen „Schlagreihe“ indiziert. Daraus werden allerlei Folgen v.a. für die Musikpädagogik abgeleitet. Und er kommt zu so schönen Themen wie „Melody and Life“, die er an Beispielen von Schuberts Vertonung von Märchen Wackenröders vorführt. „Wackenoder’s phantasies are famous for giving music to the nineteenth century as a new religion“ (S. 280), deutet sich ein Zusammenhang an. UND KOSMOS ir aber wollen abschließend dem Buch von Zbikowski ein musikhistorisches Beispiel für die metaphorische Projektion entnehmen. Nicomachus von Gerasa soll derjenige gewesen sein, dem Pythagoras die Entdeckung der grundlegenden musiktheoretischen Prinzipen verdankte. Gedankenverloren sei der Philosoph an einer Schmiede vorbeigekommen, als er vernahm, wie das Hämmern verschiedene Töne erzeugte. Er begann mit dem Gewicht der Hämmer zu experimentieren und entdeckte dabei, dass eine Oktave durch Gewichte im Verhältnis von 2:1 zu hören war, eine Quinte im Verhältnis der Hammergewichte von 3:2 und eine Quarte durch ein 4:3-Verhältnis. Die Dissonanz einer Sekunde entstand aus dem Verhältnis von 9:8 – und so wurde im Prinzip die Möglichkeit geschaffen, musikalische Töne durch mathematische Notierung in eine geschriebene Form zu übertragen – Notation als Metapher der musikalischen Konsonanz und Dissonanz. Aber das ist natürlich nicht naturgegeben, denn die Geschichte der Dissonanzen zeigt uns, dass es hier beträchtliche Wandlungen gab. Gioseffo Zarlino war in der Renaissance ein wortmächtiger Vertreter der sog. „mitteltönigen“ Stimmung. Hierbei wird die große Terz als eine reine Terz im Verhältnis 4:5 verstanden und so kommt es in seinem System zu einer viel größeren Anzahl von Konsonanzen als bei Pythagoras. Aber er konnte die kleine Sexte nicht mehr als harmonisch darstellen in seinem System musikalischer Mathematik. Überhaupt ist die Geschichte der Terz für die Bestimmung von Dissonanzen von großer Bedeutung. In der Kirchenmusik kam sie lange Zeit in einem System von Quinten, Quarten und Oktaven – also den Obertonreihen, die erst sehr weit oben eine Terz aufkommen lassen – überhaupt nicht vor. Wegen ihrer „sinnlichen Süße“ war die Terz sogar zeitweilig regelrecht verboten. Erst mit unserer Hörgewohnheit, zwischen Dur und Moll zu unterscheiden (was vom Unterschied zwischen kleiner und großer Terz bestimmt ⏐ PNL-47 16 wird) etabliert sich mehr und mehr ab dem 18 Jahrhundert unser heutiger musikalischer Kosmos, dessen mathematische Bestimmung Pythagoras begann. “The order of the cosmos, which was for Pythagoreans the order of number, thus found sounding expression in the domain of music” schreibt Zbikowski erhellend und macht uns vielleicht verständlich, was wir intuitiv ahnen, wenn wir bei Bach ergriffen sind. Dies innige Verhältnis zwischen der Musik und der Idealisierung des Unsterblichen spricht Goethe in einem Aphorismus aus: "Der herrliche Kirchengesang: Veni Creator Spiritus ist ganz eigentlich ein Appell ans Genie; deswegen er auch geist- und kraftreiche Menschen gewaltig anspricht." (Goethe, Maximen und Reflexionen, hg. von Harald Fricke, InselVerlag 2005, S. 27). Für die Zeitgenossen enthielt die Musik noch einen Bezug zu jenen Dimensionen des Menschlichen, die ihnen als rationalen und aufgeklärten Bürgern verwehrt war, die sie aber noch „genießen“ konnten, ohne sich dem Verdikt der Unaufgeklärtheit auszusetzen. „Musik ist eine unbewusste Übung in der Metaphysik, bei der der Geist nicht weiß, dass er philosophiert“, formulierte deshalb schon Arthur Schopenhauer. Als der Komponist Dieter Schnebel anno 1962 sein Stück Nostalgie aufführen ließ – ein Solo für Dirigenten ohne Orchester, reine körperliche Gebärde also ohne Klang – wusste die erstaunte Welt nicht, ob es sich noch um Musik handle; es ging vielleicht eher um die ausufernd dramatisierte und schwülstig-sentimentale Dirigentenverehrung, die hier ironisch vorgeführt werden sollte. In der bildenden Kunst stellten andere einen leeren Rahmen vor, ohne Bild. Von manchen „Modernen“ ist überliefert, dass sie privat keine moderne Musik hören, sondern Klassik und Romantik. Was vielleicht, vielleicht auch eine Aussage über ihre Beziehung zum Kosmischen ahnen lässt. Die metaphorische Projektion muß also, worin schon Adorno in seiner „Musiksoziologie“ die entscheidende Frage sah, manchmal auch in umgekehrter Richtung wirken können. Der Wert der Musik bestehe gerade darin, meinte er, dass sie nicht unter philosophische Konzepte subsumiert werden könne. Zwischen dem Körper und etwa der Musik Schuberts sah er unmittelbare Zusammenhänge; bei ihr „stürzet aus dem Aug’ die Träne“, schrieb der musikalisch Sensible und Gebildete. Und noch weiter gehend behauptete er in seiner Musikästhetik bekanntlich, dass solche rationale Unverfügbarkeit der Musik paradoxerweise ein partikulares Ideal der Vernunft schlechthin sei, weshalb die Musik die Vernunft zu belehren befugt sei. In ihrer Fähigkeit, das Absolute auszudrücken, lehre die Musik, jene Rigidität des Begrifflich-Abstrakten zu überwinden, denn sie artikuliere die Tragik, dass die Objekte nicht ohne Rest in ihren Begriffen aufgehen. Und es scheint, als könnte die kognitive Theorie (Michael Spitzer, S. 60) erstaunlicherweise uns in empirischer Zugänglichkeit auf eine überraschend genaue Weise verständlich machen, warum das so ist: weil aller Vernunft eine körperlich-sinnliche Erfahrung im Austausch mit frühen Anderen weit vorgelagert ist, die wir denkend nur in jenen seltenen Augenblicken einholen, die wir als geschenktes Glück empfinden. Das heilt. Der amerikanische Poet W.H. Auden formulierte deshalb wohl diese Strophe: “Every sickness is a musical problem”, so said Novalis, “and every cure a musical solution”: You knew that also.