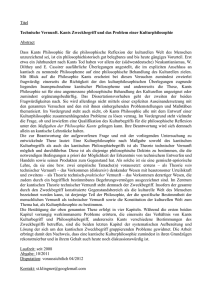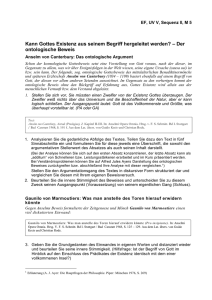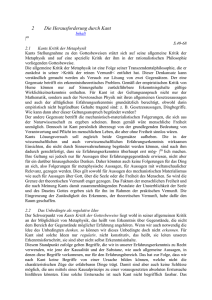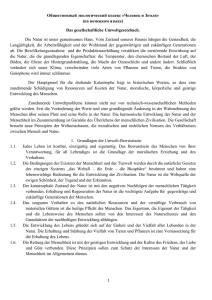Praxis der Vernunft – Theorie des Erlebens. „Menschheit“ bei Kant
Werbung

Praxis der Vernunft – Theorie des Erlebens. „Menschheit“ bei Kant und Dilthey von Margit Ruffing (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Es gerät leicht aus dem Blickfeld, dass Kants philosophisches Anliegen von Beginn an in der Beantwortung der Frage nach dem Menschen („Was ist der Mensch?“) besteht; sein bedeutendes erkenntnistheoretisches Werk, die Kritik der reinen Vernunft, will vorab die Bedingungen der Möglichkeit einer Antwort klären, indem die Bedingungen der Möglichkeit von Wissen – und Wissenschaft – überhaupt untersucht werden. Kants Fazit: „Es ist demütigend für die menschliche Vernunft, daß sie in ihrem reinen Gebrauche nichts ausrichtet, und sogar noch einer Disziplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen […]“. Der „größte und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft“ besteht darin, so wird vermutet, „anstatt Wahrheit zu entdecken, […] Irrthümer zu verhüten“ (B 823/A 795). Trotz dieser deprimierenden Einsicht geht Kant davon aus, dass es „irgendwo einen Quell von positiven Erkenntnissen geben [muß]“; und dieser Quell, so könnte man verkürzend behaupten, ist unsere Fähigkeit, zu systematisieren, oder: die Idee des Ganzen. Das „Ganze“ enthält den einen Zweck, auf den sich alle Teile beziehen und der sie untereinander verbindet, und es gibt dieser Verbindung zugleich eine Form. Kant vergleicht zur Veranschaulichung das Ganze mit einem „tierischen Körper“, „dessen Wachstum kein Glied hinzusetzt, sondern, ohne Veränderung der Proportion, ein jedes zu seinen Zwecken stärker und tüchtiger macht“ (B 861/A 833). Die von Dilthey konstatierte Anämie des Rationalismus kann m.E. therapiert, wenn auch möglicherweise nicht geheilt werden, wenn man vom lebendigen Organismus „Vernunftidee“ ausgehend das kantische Selbst- und Weltverständnis als Praxis – Realisieren, Erleben – der Vernunft auffasst. Diltheys „Erlebnis“ dagegen, das seinem Selbst- und Weltverständnis zu Grunde liegt, bildet den Kern einer Erkenntnistheorie, die ohne die Idee des Ganzen keinen Sinn ergäbe. Wenn auch Dilthey die abstrakte Sprache Kants meidet, so drückt er doch auf seine Weise aus, dass es ihm „ums Ganze“ geht, nämlich durch den Begriff des Lebens, der – übrigens in gleicher Weise wie der kantische Begriff der Vernunft – der Erläuterung und Auslegung bedarf, um nicht als „nichtssagend“ oder banal beurteilt zu werden. Eine Auswahl kommentierter Textstellen sollen die These stützen, die ich vertreten möchte: Im Begriff der Menschheit, von Kant aufgefasst als praktische Idee, stimmen die philosophischen Konzepte von Kant und Dilthey weitgehend überein, wenn es auch auf den ersten Blick nicht den Anschein hat. Diltheys Kantkritik ist nicht in jeder Hinsicht nachvollziehbar, aber sie kann als Korrektiv der Kantrezeption fungieren: Kant selbst bringt deurtlich zum Ausdruck, dass es der Philosophie (und ihm als Philosophen) um die Frage 1 nach dem Wesen des Menschen geht, die nur von der wissenschaftlichen Anthropologie angemessen geklärt werden kann. Kants „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ ist nicht nur seine als letztes veröffentlichte Schrift, sondern auch das Resultat seines lebenslangen Nachdenkens über das „Welt- und Lebensrätsel“, wie Dilthey sagen würde. Während seines gesamten Wirkens als Hochschullehrer bietet Kant Anthropologie-Vorlesungen an – die einzige philosophische Disziplin, in der s.E. empirisch vorgegangen werden kann bzw. sogar muss. Die Bedeutung dieses Teils des Kantischen Werkes wurde lange Zeit unterschätzt. Wir sind weit davon entfernt, Kant als Vertreter der „Lebensphilosophie“ und Dilthey als Rationalisten zu deuten; aber eine bedeutende Gemeinsamkeit der Philosophie der Vernunft und der Philosophie des Lebens scheint doch in der Feststellung eines theoretischen Ungenügens zu liegen, dem Kant die Hoffnung auf ein zukünftiges System, Dilthey eine resignierte Unermüdlichkeit entgegensetzt, die seinem Denken einen unsystematischen, nicht abgeschlossenen Charakter verleiht, wodurch es aber zugleich veritables Zeugnis der Idee einer Philosophie des Lebens wird. Kant stellt fest: „Es ist schlimm, daß nur allerst, nachdem wir lange Zeit, nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden Idee, rhapsodistisch viele dahin sich beziehende Erkenntnisse, als Bauzeug, gesammelt, ja gar lange Zeiten hindurch sie technisch zusammengesetzt haben, es uns denn allerst möglich ist, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken, und ein Ganzes nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen […]“ (B 863/A 835), was er „in jetziger Zeit, da schon so viel Stoff gesammelt ist, oder aus Ruinen eingefallener alter Gebäude genommen werden kann“, nicht nur für möglich, sondern nicht einmal für schwer hält (vgl. ibid.). Trotzdem sieht Kant davon ab, ein Ganzes der Wissenschaften architektonisch zu entwerfen, nicht darin sieht er seine Aufgabe als Philosoph; stattdessen er begnügt sich damit, „die Architektonik aller Erkenntnis aus reiner Vernunft zu entwerfen“, die als System menschlicher Erkenntnis die vorliegenden, aus unterschiedlichen Ideen entstandenen Systeme zu einem zweckmäßigen Ganzen zu verbinden erlaubt – Philosophie der Philosophie? Kant geht demnach davon aus, dass ein Endzweck existiert, dem Wissen und Wissenschaft unterstellt sind: als Vernunftbegriff entspricht diesem „die Idee der Menschheit als Zweck[.] an sich selbst“ (GMS, AA 04:429). Dieser Vernunftbegriff „Idee der Menschheit“ bleibt theoretisch unbestimmt, er ist nicht durchgängig bestimmbar, dennoch ist er wirklich und zumindest teilweise erfahrbar. Er braucht, wie jede Idee, „zur Ausführung ein Schema, d.i. eine a priori aus dem Prinzip des Zwecks bestimmte wesentliche Mannigfaltigkeit und 2 Ordnung der Teile“ (B 861/A 833), das sogar empirisch gewonnen werden kann – dann aber nur eine „technische Einheit“, die zufällige Momente und mehr oder weniger beliebige äußere Zwecke enthält. Um eines „einigen obersten und inneren Zweckes“, d.h. der auf das Ganze gerichteten architektonischen Einheit willen, fordert Kant ein erfahrungsunabhängiges Schema (vgl. B 861f./A 833f.). Das heißt aber nicht, dass es sich um ein theoretisches, wirklichkeitsfernes Gebilde handelt, im Gegenteil: Die Idee der Menschheit ist per se eine praktische Idee. Sie kann nur verstanden werden als die Ganzheit des menschlichen Lebens unter sich begreifend, eine Ganzheit, die vom Individuum, dem leiblich vereinzelten Menschen, nicht im empirischen Vollzug erlebt werden kann, aber dennoch für ihn wirklich ist: „So würde man sagen können: das absolute Ganze aller Erscheinungen ist nur eine Idee, denn da wir dergleichen niemals im Bilde entwerfen können, so bleibt es ein Problem ohne alle Auflösung. Dagegen weil es im praktischen Gebrauch des Verstandes ganz allein um die Ausübung nach Regeln zu tun ist, so kann die Idee der praktischen Vernunft jederzeit wirklich, ob zwar nur zum Teil, in concreto gegeben werden, ja, sie ist die unentbehrliche Bedingung jedes praktischen Gebrauchs der Vernunft. Ihre Ausübung ist jederzeit begrenzt und mangelhaft, aber unter nicht bestimmbaren Grenzen, also jederzeit unter dem Einflusse eines Begriffs einer absoluten Vollständigkeit. Demnach ist die praktische Idee jederzeit höchst fruchtbar und in Ansehung der wirklichen Handlungen unumgänglich notwendig. In ihr hat die reine Vernunft sogar Kausalität, das wirklich hervorzubringen, was ihr Begriff enthält1; daher kann man von der Weisheit nicht gleichsam geringschätzig sagen: sie ist nur eine Idee; sondern eben darum, weil sie die Idee von der notwendigen Einheit aller möglichen Zwecke ist, so muss sie allem Praktischen als ursprüngliche, zum wenigsten einschränkende Bedingung zur Regel dienen.“ (KrV, B 384f.) Es bleibt also Kant gar nichts anderes übrig, als die Idee der Menschheit als praktische aufzufassen, deren Besonderheit darin besteht, dass sie das Begriffene Realität werden lassen kann, indem sie zum Handeln führt. Das Handeln als Teil der Menschheit, im Bewusstsein dieser Teilhabe und zum Zwecke des Lebendigseins als Mensch, ist dadurch grundsätzlich ein geregeltes; das meint: Autonomie, Selbstgesetzgebung der Vernunft – die eben nicht technisch schematisiert, sondern das dem Menschsein entsprechende zweckgerichtete Wollen integriert. Daher heißt es in der Metaphysik der Sitten: „[…] die gesetzgebende Vernunft, welche in ihrer Idee der Menschheit überhaupt die ganze Gattung (mich also mit) einschließt, nicht der Mensch, schließt als allgemein gesetzgebend mich in der Pflicht des wechselseitigen 1 Alle Unterstreichungen in den Zitaten sind Hervorhebungen von mir, M.R. 3 Wohlwollens nach dem Princip der Gleichheit wie alle Andere neben mir mit ein […]“. Ist ein Mensch nämlich in der Lage, sich selbst wesentlich gattungshaft aufzufassen, als Wesen, das durch sich die Menschheit lebendig macht, ihre Idee „verkörpert“, erlebt er sich als zu wechselseitigem Wohlwollen verpflichet und weiß das zugleich von den anderen (MS, AA 06:451). Die im kategorischen Imperativ2 ausgedrückte Idee des moralischen Gesetzes ist die allgemeinste, voraussetzungsärmste und deshalb inhaltlich unbestimmte Regel, in der die Vernunft in ihrer Ganzheit als praktische, das Bewusstsein des Menschseins als die Idee der Menschheit präsent ist – d.h. erlebbar und erlebt wird: „Die | Idee des moralischen Gesetzes allein mit der davon unzertrennlichen Achtung kann man nicht füglich eine Anlage für die Persönlichkeit nennen; sie ist die Persönlichkeit selbst (die Idee der Menschheit ganz intellectuell betrachtet).“ (Rel, AA 06:28) Interessant ist dabei die Aussage, dass dieses inhaltsleere Gesetz gefühlt wird; es ist notwendig begleitet von dem Gefühl der Achtung, dem einzigen von der Vernunft hervorgebrachten Gefühl. Wir müssen also die vollendete Vernunft als praktische verstehen, gleichzusetzen mit dem guten Willen, d.h. als Ursache für ein Handeln, das durch sich das Menschsein in seiner weitesten Bedeutung ausdrückt, nämlich in der Gleichheit aller Menschheitsrepräsentanten, die die einzelnen menschlichen Lebewesen zu wechselseitigem Wohlwollen verpflichtet. In diesem Sinne heißt nach Kant die Idee der Menschheit „ganz intellectuell betrachtet“: „Persönlichkeit“ sein, das moralische Gesetz fühlen, oder anders ausgedrückt: Gut-Wollen. Es ist allerdings nicht selbstverständlich, dass ein menschliches Individuum „Persönlichkeit“ im ausgeführten Sinne ist; obwohl jeder Mensch das Vermögen der Vernunft hat, liegt darin nicht notwendig, dass sie auch realisiert, d.h. ge- und erlebt wird. In der Logik stellt Kant lapidar fest: „Die Idee der Menschheit, die Idee einer vollkommenen Republik, eines glückseligen Lebens u. dgl. m. fehlt den meisten Menschen. Viele Menschen haben keine Idee von dem, was sie wollen, daher verfahren sie nach Instinct und Autorität.“ (Logik, § 3; AA 09:93) Und in der „Anthropologischen Charakteristik“, im Kapitel über die „Art, das Innere des Menschen aus dem Äußeren zu erkennen“, führt Kant aus, wie es sich äußert, wenn ein Mensch seinen Willen kennt und sein vernünftiges Potential auf ihn anwendet: „Der 2 Meines Erachtens greift Diltheys Beurteilung zu kurz, wenn er schreibt, dass „der kategorische Imperativ Kants […] nur die logische Bedingung [enthält], unter welcher eine moralische Gesetzgebung möglich ist.“ Die daran anschließende Differenzierung steht m.E. nicht im Widerspruch zur kantischen Idee der Menschheit: „Man verwirrt aber die Natur der moralischen Gesetzgebung, wenn man einen Pflichtenkodex entwirft, der die Liebe zu Gott oder den Menschen oder das Streben nach Vollkommenheit in gleicher Weise verbindlich auffaßt als die Bindung in einer Obligation und die auf sie gegründete Wahrhaftigkeit und Rechtschaffenhheit. Die Verletzung dieser letzteren schließt den Menschen unweigerlich aus dem Zusammenwirken mit andern in einer Ordnung des Zusammenlebens aus. Die Verletzung der sogenannten Liebespflichten schließt aus der Sphäre der Sympathie und die der sogenannten Vollkommenheitspflichten aus dem gemeinsamen Vollkommenheitsstreben aus.“ (Studien zur Grundlegung der Geisterswissenschaften, II. Studie: Der Strukturzusammenhang des Willens, Bd. 7, 67) 4 Mann von Grundsätzen, von dem man sicher weiß, wessen man sich nicht etwa von seinem Instinkt, sondern von seinem Willen zu verstehen hat, hat einen Charakter. – Einen Charakter […] zu haben, bedeutet diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subjekt sich selbst an bestimmte praktische Prinzipien bindet, die er sich durch seine eigene Vernunft unabänderlich vorgeschrieben hat. […]. Es kommt hiebei nicht auf das an, was die Natur aus dem Menschen, sondern was er aus sich selbst macht. (2. Teil der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, recl.233 und 241f.) In diesem Zusammenhang spielt die Pädagogik für Kant eine ganz entscheidende Rolle, wie übrigens auch für Dilthey; denn die Wissenschaft von der Erziehung hat die Unterstützung der Entwicklung des unfertigen Menschen zum Zweck und damit zugleich eine zukunftsweisende Funktion: „Kinder sollen nicht nur dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglichen bessern Zustande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee der Menschheit und deren ganzer Bestimmung angemessen erzogen werden. Dieses Princip ist von großer Wichtigkeit.“ (Einleitung in die Pädagogik, AA 09:448) Ein aktiver Umgang mit den gegeben inneren Möglichkeiten, die Erziehung zum Selbstdenken und die Haltung der Verbindlichkeit den eigenen Urteilen und Entscheidungen gegenüber bilden die Grundlage für ein Bewusstsein der Idee der Menschheit. Diese muss aber nicht notwendig reflektiert werden, sondern kann auch einfach als Gefühl der Achtung für die selbstgesetzgebende Vernunft statthaben kann. Naturgemäß erweitert sich das einzige moralische Gefühl zur Liebe, denn, so Kant, „[…] der Mensch sucht etwas an ihm [diesem Zwecke, der ihm durch die Vernunft vorgelegt wird], was er lieben kann […]“ – gemeint ist der Endzweck des höchsten Gutes, die inhaltliche Bestimmung des Sittengesetzes. Da es sich nicht um irgendeinen Zweck handelt, der immer ein Gegenstand der Zuneigung ist, den man sich vermittelst einer Handlung aneignen will (vgl. Vorrede zur Religionsschrift), sondern um einen „ideellen“, und auch noch das höchste Lebensziel betrifft, ist auch das Gefühl der Zuneigung ein umfassendes und überpersönliches – und diese Bindung die eigentliche „religio“. Der Bogen von der (Moral-)Philosophie zur Religion wird in Kants Menschheitsbewusstsein zum sich schließenden Kreis; eine Passage aus dem Opus postumum bringt das konzentriert zum Ausdruck: Von dem Sohn Gottes. Ein jedes Geschopf hat Pflichten. Zu allen diesen Muß es ein Muster haben. – Dieses kan es in keinem Geschopfe finden (g denn das ist keiner Pflicht ganz adaeqvat, weil vor ihm noch eine Versuchung zu finden ist, die seinen Guten Willen stürtzt), auch nicht im Schöpfer, denn der hat keine Pflicht, |also nur in dem, was aus Gott ausgeht, der Menschheit zum Urbilde dient, so fern also Mensch ist, aber doch nur in Gott existiren kan, 5 also [zu] mit seinem Wesen verbunden ist als der Sohn Gottes, d.i. in der Idee der Menschheit im Gottlichen Verstande. (Niemand ist gut als der einige Gott.) das ist also der Gottmensch, und wer im Fortschritt zu diesem Urbilde ist, [ist] ist von ihm aufgenommen. (AA 18:606, Reflexion 6310, Nachlass 1780–1789) Kants Idee der Menschheit steht also im Mittelpunkt des vernünftigen Lebens; sie ist praktisch, bringt (gutes) Handeln hervor, wird als Achtung gefühlt, erweitert sich zur Liebe, kann als Prinzip der Erziehung des Kindes sein individuelles Menschsein in der vollen Bedeutung befördern sowie historisch gefasst Antrieb für die Entwicklung zum Fortschreiten des Menschengeschlechts zum Besseren sein. Dazu knüpft sie an ein „Urbild“ an, indem der Mensch ein Muster für den Endzweck des höchsten Gutes findet in dem, „was aus Gott ausgeht“. Sie ist nach unserer Auffassung kein theoretisches Konstrukt, keine blutleere Abstraktion, sondern hat den Charakter eines „Erlebnisses“. Das „Erlebnis“ ermöglicht an dieser Stelle den Übergang zu Diltheys Auffassung des Begriffes „Menschheit“ und seiner Bedeutung. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass Dilthey versucht, von etwas gegenständlich zu reden, das nicht im Begriff aufgehen kann, nämlich der Ganzheit menschlichen Seins. (Das gilt m.E. auch für Kant; der Vernunftbegriff „Idee“ soll auch mehr sein als ein Begriff.) Dilthey sieht zugleich die Gefahr des Überbewertens der Rationalität, er fordert daher mit Nachdruck eine Philosophie des Lebens, das mehr ist als „Vernunft“. Das „Er-lebnis“ als zentraler Begriff liegt nahe. (Lässt sich im Französischen nicht so deutlich wiedergeben.) Sie kennen alle die berühmte Aussage: „Der Grundgedanke meiner Philosophie ist, daß bisher noch niemals die ganze, volle, unverstümmelte Erfahrung dem Philosophieren zugrunde gelegt worden ist, mithin noch niemals die ganze und volle Wirklichkeit.“ (Ges.Schr. 8, 123) Damit hat Dilthey recht; die Situation ist immer noch unverändert die gleiche, und das wird auch so bleiben. Es gelingt ihm aber dennoch mit der Theorie des Erlebens bzw. Erlebnisses eine Beschreibung der menschlichen Bewusstwerdung; die Akzentuierung der Prozesshaftigkeit des Erkennens, das auf Ganzheit gerichtet ist und nicht nur wissen, sondern verstehen will, wird am Begriff des „Innewerdens“ deutlich: „Erleben ist eine unterschieden charakterisierte Art, in welcher Realität für mich da ist. Das Erlebnis tritt mir nämlich nicht gegenüber als ein Wahrgenommenes oder Vorgestelltes; es ist uns nicht gegeben, sondern die Realität Erlebnis ist für uns dadurch da, daß wir ihrer 6 innewerden, daß ich sie als zu mir in irgendeinem Sinne zugehörig unmittelbar habe. Erst im Denken wird es gegenständlich.“ (Bd. 6, 313) Die „Wirklichkeit“ besteht im zunächst begrifflosen inneren Erleben, drückt sich aber mit Notwendigkeit aus, wird zum „Außen“; im Denken tritt sie dem „Innen“ gegenüber, ist Objekt für ein Subjekt, und wird mit Hilfe des Denkens, der Re-flexion (im Sinne der Rückbeugung auf das „Innen“) auslegbar. „Im Erleben“, heißt es an anderer Stelle (GesSchr Bd. 7, 27), „ist Innesein und der Inhalt, dessen ich inne bin, eins.“ Zugleich sind die „äußeren Objekte […] eben Bestandteile der Erlebnisse. […] Als solche gehören sie dem Leben selber an.“ (Bd. 7, 334) Zusammenfassend heißt es in Das Ergebnis und die Dichtung: „Denn im persönlichen Erlebnis ist ein seelischer Zustand gegeben, aber zugleich in Beziehung auf ihn die Gegenständlichkeit der umgebenden Welt.“ (S. 140) Die Basis für eine intersubjektive, überindividuelle, „menschheitliche“ Auffassung des Erlebnisses ist im „Innewerden“ – das Erlebnis der Aneignung seiner selbst mit Hilfe von etwas, das „innen“ und doch nicht identisch mit dem Subjekt ist, denn hat einen Inhalt – nicht die gegenständliche Welt, aber die Bezugnahme auf sie. In diesem Sinne wird auch der Begriff der Erfahrung von Dilthey verwendet: „Was der Mensch sei und was er wolle, erfährt er erst in der Entwicklung seines Wesens durch die Jahrtausende und nie bis zum letzten Worte, nie in allgemeingültigen Begriffen, sondern immer nur in den lebendigen Erfahrungen, welche aus der Tiefe seines ganzen Wesens entspringen.“ (Bd. 6, 57) Verstehen kommt nach Dilthey nur durch Bezugnahme auf das Geschehen von Welt, d.h. auf die Geschichte, zu Stande. Wenn auch die „lebendigen Erfahrungen“ aus dem tiefsten Inneren „entspringen“, so sind sie doch untrennbar von der Wechselwirkung mit der äußeren Welt betroffen und entsprechen der Entwicklung des Menschen: was der Mensch sei – sein Wesen – und was er wolle – sein Zweck an sich – muss Dilthey zufolge erfahren werden, lässt sich nur a posteriori bestimmen. Konkrete Inhalte zur Bestimmung des Menschsein sind zwar nur empirisch anzugeben, aber sie sind eben auch nicht relevant für die Idee „Menschheit“, sie beziehen sich auf das Einzelwesen, das sie erfährt. Auch für Dilthey ist nicht die Geschichte Zweck an sich, das worum es geht, sondern der Mensch: „Alle letzten Fragen nach dem Wert der Geschichte haben schließlich ihre Lösung darin, daß der Mensch in ihr sich selbst erkennt. Nicht durch Introspektion erfassen wir die menschliche Natur. […] Es sind neue Kategorien, Gestalten und Formen des Lebens, an die wir uns wenden müssen und die am Einzelleben selber nicht aufgehen.“ (Bd. 7, 250f.) Für die Menschheit gilt Ähnliches; sie ist keine physische Tatsache – nach Kant eben eine Idee –, sondern vergegenständlichtes menschliches Sich-Mitteilen. Dilthey spricht von 7 Objektivationenen des Geistes „durch welche die Gemeinsamkeit menschlichen Wesens hindurchscheint und uns beständig anschaulich und gewiß ist“, s. nachfolgendes Zitat: „Die Menschheit wäre, aufgefaßt in Wahrnehmung und Erkennen, für uns eine physische Tatsache, und sie wäre als solche nur dem naturwissenschaftlichen Erkennen zugänglich. Als Gegenstand der Geisteswissenschaften entsteht sie aber nur, sofern menschliche Zustände erlebt werden, sofern sie in Lebensäußerungen zum Ausdruck gelangen und sofern diese Ausdrücke verstanden werden.Und zwar umfaßt dieser Zusammenhang von Leben, Ausdruck und Verstehen nicht nur die Gebärden, Mienen und Worte, in denen Menschen sich mitteilen, oder die dauernden geistigen Schöpfungen, in denen die Tiefe des Schaffenden sich dem Auffassenden öffnet, oder die beständigen Objektivationen des Geistes in gesellschaftlichen Gebilden, durch welche die Gemeinsamkeit menschlichen Wesens hindurchscheint und uns beständig anschaulich und gewiß ist: auch die psychophysische Lebenseinheit ist sich selbst bekannt durch dasselbe Doppelverhältnis von Erleben und Verstehen, sie wird ihrer selbst in der Gegenwart inne, sie findet sich wieder als Vergangenes; aber indem sie ihre Zustände festzuhalten und zu erfassen strebt, indem sie die Aufmerksamkeit auf sich selber richtet, machen sich die engen Grenzen einer solchen introspektiven Methode der Selbsterkenntnis geltend: nur seine Handlungen, seine fixierten Lebensäußerungen, die Wirkungen derselben auf andere belehren den Menschen über sich selbst; so lernt er sich nur auf dem Umweg des Verstehens selber kennen.“ (Aufbau…, Bd. 7, 86f.) Der Einzelmensch, die „psychophysische Lebenseinheit“, muss also über die Introspektion hinauskommen; zudem heißt es vom Einzelmenschen, dass er „als isoliertes Wesen ist eine bloße Abstraktion“ sei (Das Wesen der Philosophie, reclam S. 75). Nach Dilthey findet der Einzelne demnach das – gattungshafte – Menschsein nicht in sich, obwohl das zugleich vorausgesetzt wird: wie könnte er sonst die vergegenständlichten Gemeinsamkeiten menschlichen Wesens erkennen? Das Individuum kann also nicht ursprünglich und wesentlich sein, sonst blieben auch seine Handlungen, fixierten Lebensäußerungen etc. unverbundene und unverbindliche Abstraktionen und könnten keine Rückschlüsse auf das Menschsein selbst zulassen. Dilthey scheint also unausgesprochen etwas wie eine Idee der Menschheit vorauszusetzen; zwar geht er vom Individuum aus, auch wenn er es als Abstraktion bezeichnet, doch bleibt es nicht bei den „fortschreitenden Erfahrungen“, die „jeden einzelnen [lehren], worin für ihn das dauernd Wertvolle besteht“; denn die „Hauptarbeit des Lebens ist nach dieser Seite, durch Illusionen hindurch zu der Erkenntnis dessen zu kommen, was uns wahrhaft wertvoll ist. (Ibid. 73ff.) Drängt sich nicht der Gedanke an Kants Endzweck des Menschen auf, das 8 höchste Gut anzustreben? Der Gedanke, dass praktische Vernunft und guter Wille eines und dasselbe sind, weil das Praktische an der Vernunft bedeutet, dass sie ein ihr entsprechendes Handeln bewirken kann? Auch wenn Dilthey differenziert in Handeln aus „Streben nach einem Guten“ und „Bindung des Willens“, scheint er beides als Motive, als zur Tat bewegende und sie bewirkendes „vernünftige“ Einstellungen gelten zu lassen: „Die Handlung tritt nicht immer im Zusammenhang des Strebens nach einem Guten ein, sie kann auch das Ergebnis einer Bindung des Willens sein. Ich habe versprochen, muß also tun und entschließe mich zu tun. Bilde ich hier den Begriff eines mich bestimmenden Wertes von Treue, Verläßlichkeit usw., so lassen sich diese Tugenden nur definieren durch das innere Verhältnis, in dem der Wille sich gebunden findet und diese Bindung als zwingend anerkennt.“ (Studien zur Grundlegung der Geisterswissenschaften, II. Studie: Der Strukturzusammenhang des Willens, Bd. 7, 67) Ist das „innere Verhältnis, in dem der Wille sich gebunden findet und diese Bindung als zwingend anerkennt“, nicht auch eine Art Selbstgesetzgebung? Entspricht die beschriebene Bindung des Willens nicht dem Begriff der Pflicht? Eine letzte Bemerkung, die Mut macht, in der Idee oder dem Begriff der Menschheit bei Kant und Dilthey nach Verbindendem statt nach Trennendem zu suchen, bezieht sich auf die Bedeutung der Religion für „den Menschen“; es heißt in Bd. 4, 397: „Die Religion ist eine notwendige Funktion des Menschen. Nach den Bedingungen, unter welchen der Mensch lebt, ist der religiöse Prozeß eine unentbehrliche Vollendung des menschlichen Daseins“ – und zugleich „die beständige Bedingung des geistigen Lebens der Menschheit“. 9