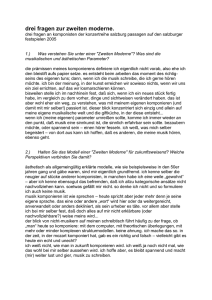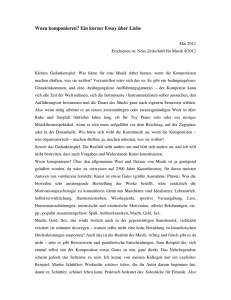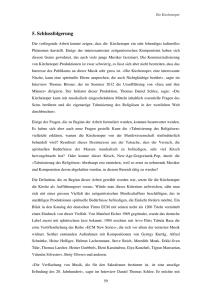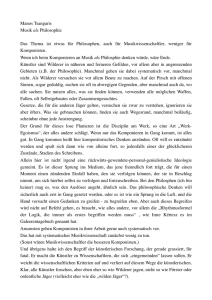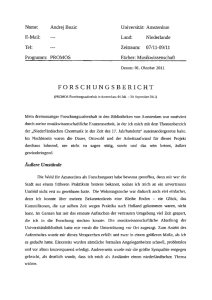zeitgenössische musik in frankreich
Werbung

© SACEM ZEITGENÖSSISCHE MUSIK IN FRANKREICH EIN DEUTSCH-FRANZÖSISCHER DIALOG Am 29. Februar dieses Jahres trafen sich Olivier Bernard (SACEM), Eric Denut (Durand – Salabert – Eschig), Frank Madlener (IRCAM), Rainer Pöllmann (Deutschlandradio Kultur / Festival Ultraschall) und Sophie Schricker (Deutschfranzösischer Fonds für zeitgenössische Musik / Impuls neue Musik) zu einem Gedankenaustausch über die Situation der zeitgenössischen Musik in den Nachbarstaaten. Das deutsch-französische Gespräch, initiiert von Sophie Schricker und Olivier Bernard, fand im IRCAM Paris statt und wurde von Sophie Schricker moderiert. 14 THEMA ■ Diskutanten (v.l.n.r.) Rainer Pöllmann, Olivier Bernard, Eric Denut im IRCAM, Paris fiziert: Die erste wäre die Generation der Komponisten, die zwischen 1908 (dem Geburtsjahr von Olivier Messiaen) und 1916 (dem Geburtsjahr von Henri Dutilleux, dem letzten noch lebenden Komponisten dieser Generation) geboren wurden. Hierzu zählt auch Pierre Schaeffer, der 1910 geboren wurde. Er hat einige neue Felder erschlossen, die noch immer sehr fruchtbare sind. Es folgt die zweite Generation der um 1925 herum Geborenen mit Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Henri Pousseur, André Boucourechliev, Claude Ballif oder Betsy Jolas. Darauf wiederum folgt die Generation der zwischen den 1920er Jahren und 1945 geborenen Komponis-ten. Diese noch immer aktive, aber schwer zu definierende Übergangsgeneration, die vom Unterricht Messiaens geprägt ist, scheint sich verpflichtet zu fühlen, sich von der vorhergehenden Generation abgrenzen zu müssen. Zu ihr gehören Gilbert Amy, Paul Méfano oder auch François-Bernard Mâche. Mit Georges Aperghis taucht eine Generation auf, mit der ich tagtäglich arbeite, nämlich die Generation von Komponisten, die die sechzig erreicht oder gerade überschritten hat: Philippe Manoury, Pascal Dusapin, Philippe Hurel, Philippe Fénelon, Hugues Dufourt, aber auch Philippe Hersant, Michael Levinas und Tristan Murail. Auch sie stellen eine Übergangsgeneration dar, die ganz andere Integrationspraktiken in der künstlerischen Arbeit entwickelt hat als die Generation der 1950er Jahre. Das ist die Generation französischer Komponisten, die derzeit im Ausland am deutlichsten wahrgenommen wird, zusammen mit all denen, die nach 1976 geboren wurden und heute extrem aktiv sind. Sophie Schricker: Könnten Sie die ästhetischen Strömungen sowie die großen Trends der zeitgenössischen Musik in Frankreich beschreiben? Welche Komponisten sind Ihrer Meinung nach heute besonders präsent? Eric Denut: Zunächst vielleicht eine allgemeine Bemerkung. Die Musik von heute ist direkt von der längeren Lebenserwartung der Menschen geprägt. Noch nie hat die französische Musiklandschaft gleichzeitig so viele aktive Generationen gezählt. Ich habe mindestens fünf identi- Olivier Bernard: Man muss dazu einige Schlüsselmomente hervorheben, die die kulturelle Landschaft sehr tiefgreifend verändert haben. Das Geschehen am Ende der 1970er Jahre ist wichtig, um die aktuelle Struktur der französischen Musikszene zu verstehen. Die Gründung des IRCAM und des Ensemble Intercontemporain, Erfolge des Boulez’schen Voluntarismus, fallen nahezu zeitgleich mit der Entstehung von 2e2m und Itinéraire zusammen, zweier Ensembles, die von Komponisten gegründet wurden, die stellvertretend für die beiden nachfolgenden Generationen standen. Die Neugründung der Groupe de Recherches Musicales (GRM) auf Betreiben von François Bayle 1975 stellte eine überzeugende Alternative zum IRCAM-Projekt dar, zumindest in Bezug auf die Forschung. All dies geschieht, als ob – abgesehen von den von der einen und anderen Seite geführten Kämpfen zur Durchsetzung konkurrierender Projekte (nebenbei bemerkt werden diese Kämpfe immer von Komponisten geführt) – die institutionelle Macht, die sich sicherlich nicht so leicht teilen lässt, nur durch subtile generationenübergreifende Allianzen erobert werden könnte. Denut: Bestimmte Komponisten aus der zwischen Kriegsende und 1960 geborenen Generation haben die schon bestehenden namhaften Institutionen gebraucht, weil sie sich insbesondere mit dem Schreiben von Opern oder der Forschung befasst haben – sie hatten somit weniger Zeit und Platz, sich der Entwicklung eigener Arbeitsumgebungen zu widmen. Andere haben sich dafür entschieden, zu unterrichten oder in Institutionen wie dem Rundfunk oder im Kulturministerium tätig zu sein. Wieder anderen – dies allerdings in nur wenigen Fällen – ist es gelungen, ihre eigenen Arbeitsumgebungen zu verwirklichen oder sich an schon existierende Institutionen wie das IRCAM anzulehnen. Bernard: Man könnte die Generationsanalyse erweitern, indem man sukzessiv Phasen des Eklektizismus und ganz unterschiedliche Momente der Konzentration einander gegenüberstellt. Bestimmte Generationen sind von Natur aus eher eklektisch, aber die ihnen nachfolgende Generation übernimmt dann aus Opposition eine Art rigorose, systematischere Leitlinie, die wiederum Anreize schafft für neue pragmatischere und somit eklektischere Herangehensweisen. Dieses Schema funktioniert für die «Dutilleux-Generation», die eine eklektische Generation ist, während dann in der Umgebung von Boulez und der Neo-Serialisten, d. h. der «Generation 1925», einer Rückbesinnung und Fokussierung erfolgt. 15 © SACEM Moderatorin Sophie Schricker Als Reaktion auf die Autorität von Boulez hat sich eine Übergangsgeneration von Komponisten herausgebildet, die zum Teil das Feld der institutionalisierten zeitgenössischen Musik verlassen haben, weil sie in der Boulez’schen Landschaft nicht genügend Luft zum Atmen fanden. Sie haben sich in Richtung Kino, funktionale Musik, Orchesterleitung oder Oper entwickelt, auch wenn einige von ihnen im Laufe ihrer Karriere schließlich wieder zur Konzertmusik zurückgefunden haben. So war es bei Antoine Duhamel, Maurice Jarre, Georges Delerue und in der darauffolgenden Generation bei Laurent Petitgirard. Mit den Spektralisten entstand ein neuer Moment der Kondensation. Die junge Generation wiederum erscheint mir sehr eklektisch. Dieses Ausbalancieren der Ge- 16 nerationen, das unterschiedlichen Arten der Wahrnehmung von Musik entspricht, erscheint mir ein äußerst interessantes Phänomen zu sein, und ich frage mich, ob etwas Ähnliches in Deutschland existiert. Rainer Pöllmann: Auch in Deutschland versucht man, verschiedene Generationen zu destillieren, und gleichzeitig hat es immer etwas Künstliches, Generationen festzulegen. Aber ich würde mich, was die deutsche Szene angeht, wesentlich schwerer tun, eine Generation als ästhetische Antwort auf eine andere zu verstehen.Vor dreißig, vierzig Jahren war das anders, aber heute, glaube ich, ist es vielmehr eine Frage von individuellen Prägungen, von individuellen Neigungen als von Generationszugehörigkeit. Frank Madlener: Ich denke, dass diese vertikale Generationenachse durch eine horizontale Achse ergänzt werden muss, die in Frankreich sehr stark wahrnehmbar ist. Es geht hier um die Art und Weise, in der man auf das reagiert, was anderswo komponiert wird. Diese zweite Achse wird durch eine große Durchlässigkeit zwischen allen Stilen charakterisiert, zu denen die Komponisten heutzutage Zugang haben. Darüber hinaus beeinflussen europäische Komponisten wie Lachenmann, Furrer, Rihm, Benjamin, Sciarrino die junge Generation in hohem Maße. Es gibt gewiss keinen Kampf mehr zwischen der Generation der Dreißigjährigen und ihren Vorgängern, statt dessen gibt es den Versuch, alles aufzusaugen, was man sehen und hören kann. Die Situation des Komponisten heute stellt sich so dar: Man steht vor einer riesigen Bibliothek, gefüllt mit dem, was gestern war, aber auch und insbesondere mit dem, was heute ist. Wie kann ein Komponist sich da von allem, was ihm zur Verfügung steht – und das ist gewaltig viel –, abheben? Was aber kann man tun, damit der Blick auf die anderen nicht in einem so großen Missverhältnis zur wahren Entwicklung der musikalischen Realitäten im jeweils anderen Land steht? In Deutschland beispielsweise kursieren Stereotypen über französische Komponisten, denen zufolge diese immer von einem gewissen verführerischen Charme, einer dekorativen Anmut umgeben seien. In Wirklichkeit treffen diese Klischees, wenn Sie die Musik von Komponisten wie Franck Bedrossian oder Raphaël Cendo hören – Letzterer erlangt übrigens gerade in Deutschland Berühmtheit –, überhaupt nicht zu. Die Analysen hinken eben oft der Realität dessen, was die Komponisten selbst entwickeln können, hinterher. Pöllmann: So schwierig es ist, individuelle Künstler in Generationen einzuordnen, so ist es doch nötig, um eine Ordnung zu finden, um Kategorien zu haben. Und es bleibt trotzdem immer unzureichend. Genau so schwierig ist es auch letzten Endes mit «Nationalcharakteren», bestimmten Traditionslinien, die vorhanden sind und die in einer globalisierten, europäisierten neuen Musikszene eigentlich gar nicht mehr da sein dürfen und trotzdem natürlich ohne Weiteres erkennbar sind. Nicht in jedem einzelnen Werk, aber in der THEMA Summe der Création musicale eines jeden einzelnen Landes. Bernard: Ein weiteres wichtiges Thema ist das Verhältnis zu den elektroakustischen Techniken und zur Computertechnik. Diejenigen, die diesbezüglich mit Pierre Schaeffer zumindest in Frankreich eine neue Sichtweise begründeten, stammten aus der Gründergeneration der Komponisten zu Beginn des letzten Jahrhunderts – und mit Varèse sogar noch davor. Aber seltsamerweise ist es erst die nachfolgende Generation, die sich – letztlich nicht ohne entsprechende Mühen – auch diese Art und Weise des Musikmachens angeeignet hat. Mit der Informatik ist man zu einem ganz anderen Paradigma übergegangen, das am IRCAM wahrnehmbar und außerordentlich präsent ist. Interessant ist, dass insbesondere durch das IRCAM diese Art des Schreibens die Zeit zurückholt. Dieses Jahr finden hier Lenot, Canat de Chizy, oder Amy – d. h. KomponistInnen früherer Generationen – die Mittel, ihre Kompositionsweise nicht vollständig zu ändern, aber immerhin ein ganz anderes Licht auf das zu werfen, was man bislang von ihnen kannte. Madlener: Ich möchte hier nicht die Geschichte des IRCAM erzählen. Aber wenn man über die Entwicklung des Instituts nachdenkt, könnte man sagen, dass sich die Technologie heute ästhetisch verweltlicht hat.Vor dreißig Jahren war man gezwungen, sich gegenüber der Computertechnik zu positionieren. Heute ist die Bereitstellung dieser Technologien Teil der regulären Ausbildung. Sie sind in die Studiengänge integriert – woher auch immer die Komponisten kommen, . Schricker: Rainer, wie ist die Situation in Deutschland? Pöllmann: Ich glaube, dieser pragmatische oder technologisch basierte Zugang ist auch in Deutschland vorherrschend. Elektronik ist selbstverständlicher Teil der musikalischen Praxis, ein Instrument unter anderen. Besonders spannend finde ich übrigens, dass es neben den großen Produktionsstudios – dem Experimentalstudio des SWR und dem ZKM – einen höchst ausgefeilten Umgang mit «Low Tech» gibt. Da entsteht gerade wirklich Neues. Schricker: Vielleicht können wir noch einmal kurz zu den Generationen zurückkehren und über das Verhältnis zwischen Orchester, Ensemble, Solist etc. sprechen? Bernard: Die «Generation Dutilleux / Messiaen» hat insbesondere für das Orchester viel getan, weil diese Komponisten in einer Zeit gelebt haben, in der dies durch die Organisation des damaligen ■ Ordnung der einzige Ort, an dem ein Komponist eine gewisse gesellschaftliche und medienwirksame Aufmerksamkeit erringen kann.Vor fünfzig Jahren wurde die Oper als überholt, spießig, veraltet bezeichnet. Heute hat man den Wunsch, die Schranken zwischen den Genres und den jeweiligen Hörerschaften zu durchbrechen, und davon profitiert die Oper. «Ich durchbreche den eingeschworenen Zir- « In Deutschland kursieren Stereotypen über französische Komponis- ten, denen zufolge diese immer von einem gewissen verführerischen Charme, einer dekorativen Anmut umgeben seien. In Wirklichkeit treffen diese Klischees, wenn Sie die Musik von Komponisten wie Franck Bedrossian oder Raphaël Cendo hören […], überhaupt nicht zu. Die Analysen hinken eben oft der Realität dessen, was die Komponisten » selbst entwickeln können, hinterher. musikalischen Lebens noch möglich war. In der nachfolgenden Generation – und Pierre Boulez ist dafür das beste Beispiel – übernimmt das Ensemble allmählich die Macht. Und dieser Durchbruch der Ensemblemusik hält bis heute an. Abgesehen davon, dass die Übergangsgenerationen und die jüngste Generation versuchen ihrerseits darüber hinauszugehen, indem sie auf das Orchester zugehen, sei es, dass sie sich anderen Formen wie dem Tanz, der Oper oder Installationen öffnen und sich vom engen Paradigma des «Ensemblekonzerts» lösen. Denut: Ich habe das Gefühl, dass der Wunsch, für Ensemble zu schreiben, insbesondere bei den bekanntesten Komponisten abzunehmen scheint. Warum? Woher stammt die Faszination so unterschiedlicher Komponisten wie Jonathan Harvey, Wolfgang Rihm oder Pascal Dusapin für das große Orchester? Ich habe den Eindruck, der Ensemblekomposition muss neues Leben eingehaucht werden, um sie wieder zu verzaubern, und dass die Landschaft dafür völlig offen ist. Madlener: Es gibt eine weitere Tendenz, die man hier unbedingt erwähnen muss und die vielleicht den relativen Bruch mit dem Ensemble erklärt, nämlich das wachsende Interesse an der Oper. Sie ist heute und aufgrund der soziologischen kel, das spezialisierte Ensemble, ich verlasse das Konzert. Selbst wenn ich mich auf das Gebiet einer so konventionellen Form wie der der Oper begebe, versuche ich dennoch, meine Eigenheit zu bewahren.» Das ist eine extrem riskante und verführerische Herausforderung. Pöllmann:Was die Oper angeht, würde ich das ein bisschen anders akzentuieren. Es gibt natürlich von großen bis zu kleinen Opernhäusern immer wieder auch Auftragswerke, d. h. die Möglichkeit, Opern zu schreiben. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass das ein Bereich ist, der von der eigentlichen Neue Musik-Szene eher unabhängig läuft. Ich beobachte innerhalb der neuen Musik die Entwicklung kleinerer, unabhängiger, unkonventioneller Formen von Musiktheater. Oft entstehen aus der «konzertanten» Musik selbst eine Szene oder zumindest szenische Momente, die nicht unbedingt die große Bühne brauchen. Und es gibt eine ganz neue Art von Musiktheater, welche das Werk aus der gleichberechtigten Zusammenarbeit von Komponisten, Interpreten und Regisseuren entstehen lässt. Auch das Ensemble halte ich nach wie vor für die wesentliche Besetzung in der neuen Musik. Orchester und Oper, die «repräsentativen» Gattungen, sind dabei, so glaube ich, weniger innovativ als kleinere, unkonventionelle Gattungen. 17 Madlener: Um das Thema «Generationen» abzuschließen, möchte ich noch gerne eine Überlegung hinzufügen: Die Idee, dass eine Institution eine Ästhetik vorschreiben kann, hat sich heute erschöpft. Dagegen kann sie ein Ort der Kritik sein, und ich glaube sogar, dass heute der kritische Blick, den man auf die zeitgenössische Musik bzw. auf die Praktiken, durch die sie geschaffen wird, richten muss, dieser ist: dass die Erfindung neuer Materialien, die sehr schnell jeden Erneuerungscharakter verlieren, sobald sie wiederholt werden, letztlich keine neuen Formen bzw. zu wenig neue Formen oder neue Dramaturgien hervorgebracht hat. Und der Begriff der Form, der neue Perspektiven ermöglicht, das Gedächtnis und den Blick auf Kommendes anregt, ist ein Thema, das die Komponisten mehr und mehr beschäftigt. Schricker: Nach den Ensembles und den Orchestern würde ich gern die Rolle der Festivals in Frankreich ansprechen. Sind es die so genannten «festivals spécialisés», die die zeitgenössische Musik tragen und fördern? Madlener: In Frankreich sind es vor allem die spezialisierten Festivals, die sich um musikalische Innovation kümmern, viel mehr als die jeweiligen Konzertsaisons. In diesen Festivals gehört es zu den Aufgaben der regionalen Orchester (etwa in Strasbourg oder Lyon) oder auch des Philharmonischen Orchesters von Radio France, zeitgenössisches Repertoire zu spielen. Bernard: Was beispielsweise das Festival «Musica» in Strasbourg betrifft, so entstand dies ursprünglich auf Wunsch des Kulturministeriums. Es sollte ein großes Festival für einen Bereich ins Leben gerufen werden, der in Frankreich unterrepräsentiert war, und das in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Körperschaften des Elsass, vor allem mit der Stadt Strasbourg. Dazu kamen nach und nach weitere Finanzierungen. Im Hinblick auf die Mittel, die sie für die lokale Kulturszene bereitstellen, befinden sich die französischen Regionen aber keinesfalls auf gleichem Niveau wie die Bundesländer in Deutschland. Denut: Eine französische Eigenheit besteht auch hinsichtlich der Bedeutung 18 der Finanzierungen aus der Musikwelt selbst. Die SACEM, die in Frankreich das ist, was die GEMA in Deutschland ist, gibt jedes Jahr vier Millionen Euro für zeitgenössische Musik aus. Dann kommen einige private Mäzene und Sponsoren dazu, die im Allgemeinen nicht wirklich der Kunstszene, sondern eher der Vermittlung nahe stehen. Und schließlich generiert die Branche einen Teil eigener nicht unerheblicher Mittel, die aus dem Kartenverkauf, aber auch aus der Produktionstätigkeit stammen. Eine Institution kann Veranstaltungen und Konzerte produzieren und sich dann um nachhaltigen Erfolg und Rentabilität bemühen. Madlener: Die Kulturszene in Frankreich ist in eine europäischere Phase eingetreten. Der Beitrag und die Bedeutung der Europäischen Union zur Kulturpolitik sind heute wichtiger geworden. Ich künstlerischen Leiters gegründet wurde. Ein Modell, das Frankreich noch nicht erkundet hat … Pöllmann: … und das jetzt nach vier Jahren zu Ende gegangen ist, aber natürlich unendlich viel angestoßen hat. Die Festivals für neue Musik in Deutschland – Donaueschinger Musiktage, Ultraschall, MaerzMusik, Eclat oder Witten – sind auch in Deutschland Basis der Neuen Musik. Finanziert von der öffentlichen Hand und vor allem auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn wir über Deutschland und Frankreich reden, darf man nicht vergessen, dass sehr viel in den Regionen und auch grenzübergreifend geschieht. Der enge kulturelle Austausch gerade zwischen dem Elsass und Baden und der Baseler Region ist ja historisch gewachsen. Diese Nähe und diese Verwandtschaft « Auf jeden Fall gibt es Modelle, die von Deutschland übernommen werden könnten. Diese Modelle basieren auf den Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, die sich durch Unternehmensstiftungen und private Stiftungen neu strukturieren müsste, entsprechend der Kulturstiftung des Bundes und ihren Projekten wie das «Netzwerk Neue Musik» […] Ein Modell, das Frankreich noch nicht erkundet hat … denke an die Schaffung des Produktionsnetzwerks «Varèse» (1999) und an die jüngst erfolgte Gründung des Netzwerks «Ulysses», das der Professionalisierung dient (Akademien in Europa für junge Komponisten); beide sind auf Initiative französischer Fachleute entstanden. Dann muss man die Frage nach den privaten Quellen der Finanzierung stellen. Man sieht sehr wohl, dass es immer wichtiger wird, neben den staatlichen Mitteln weitere Geldquellen zu finden. Auf jeden Fall gibt es Modelle, die von Deutschland übernommen werden könnten. Diese Modelle basieren auf den Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, die sich durch Unternehmensstiftungen und private Stiftungen neu strukturieren müsste, entsprechend der Kulturstiftung des Bundes und ihren Projekten wie das «Netzwerk Neue Musik», das unter Leitung eines kompetenten und anerkannten » gibt es seit Jahrhunderten, und es wäre völlig absurd, diese Verbindung zu kappen und den Rhein auch als kulturelle Grenze zu sehen. Es ist wunderbar, wenn sich so etwas über die Landesgrenzen, über die Nationengrenzen hinweg entwickelt aus einem kreativen Bedürfnis heraus. Das ist ja nicht oder nur zum Teil politisch verordnet, sondern entsteht aus künstlerischen Bedürfnissen heraus. Zum anderen wollte ich noch zum Kulturstiftung des Bundes und zum deutschen System ergänzen: Das alles ist wesentlich komplizierter als in Frankreich. Bildung und Kultur sind verfassungsrechtlich Angelegenheiten der Länder. Es gibt keinen Bundeskulturminister. Es gibt einen Beauftragten des Kanzlers für Kultur und Medien, er hat enorme Bedeutung, aber er ist wohlweislich kein Minister mit vollem Ressort. Die Länder sind sehr darauf bedacht, ihre Autonomie zu wahren. Schricker: In Deutschland verursachen das System der Projektförderung und die Bedeutung der Ausschüsse gewisse Probleme. Die Ensembles, die nicht dauerhaft öffentlich oder privat finanziert werden, sind gezwungen, immer neue Projekte ins Leben zu rufen, um zu überleben. Und im Endeffekt sind manche Ensembles so damit beschäftigt, neue Projekte ins Leben zu rufen, dass sie keine Zeit mehr haben, Musik zu machen. Man darf daher das deutsche System nicht idealisieren … ■ © SACEM THEMA Bernard: Mir scheint, dass die Musikszene gleichzeitig solide Institutionen und eine ausreichende kritische Masse von Projektförderungen braucht. Diese außergewöhnliche Verbindung besteht in Deutschland schon seit einigen Jahren. Aber in Frankreich hat man sich zu sehr damit begnügt, Institutionen ins Leben zu rufen, die heute Budgetkürzungen unterworfen sind. Und die seitens des Kulturministeriums neue Haltung zur Projektförderung, das sagt, dass es die Institutionen nicht mehr unterstützen kann, ist heikel, da sie die wirkliche Gefahr birgt, auf beiden Seiten zu verlieren: weniger personelle und finanzielle Mittel für die Institutionen, aber auch für die Projekte. Diskutant Frank Madlener Madlener: Ideal wäre, wenn die Institution als eigene Agentur für Projektförderung fungierte. Die Institution würde dann zugleich für die Nachhaltigkeit wie auch für die eigene Erneuerung und Infragestellung eben durch eigene Projekte sorgen. Neue Projekte zu betreiben ist für eine Institution unerlässlich, andernfalls geht sie zugrunde. Eines der aktuellen IRCAM-Projekte ist ein pluridisziplinäres Akademieprojekt: «acanthes@ircam». Es versammelt verschiedene nationale und internationale Partner (u.a. das Ensemble Intercontemporain). Das verweist auf eine sehr wichtige Angabe, die wir noch nicht erwähnt haben: die Frage der Vermittlung, der Ausbildung und der Professionalisierung, die notwendige Beziehung zu den Konservatorien und Hochschulen. Die Ausbildung der Interpreten im zeitgenössischen Bereich ist fundamental, und da lässt die aktuelle Situation zu wünschen übrig. In den Studiengängen müssen sich die jungen Musiker ein Repertoire des 20. Jahrhunderts aneignen können. Heute lernt der Interpret dieses Repertoire während sei- ner Ausbildung nicht unbedingt kennen. Kein französisches Ensemble hat es bis heute geschafft, eine Kooperation hinzubekommen wie die, die dem Ensemble Modern mit der Musikhochschule Frankfurt gelang und die äußerst produktiv ist. Denut: Es wäre interessant für uns zu erfahren, wer aus Frankreich den Durchbruch in Deutschland geschafft hat, wie Ihre Haltung zu den französischen Komponisten ist und wie Sie auf sie kommen? Pöllmann: Da sind zum einen natürlich die großen, alten Komponisten Frankreichs …, Messiaen ist im Repertoire. Der wird in Deutschland eigentlich nicht mehr als im engeren Sinn zeitgenössischer Komponist verstanden, taucht auch in den Festivals nicht mehr auf, aber dafür im Repertoire. Boulez ist an der Grenze zum Repertoire und steht natürlich eben- falls außer Frage. Das ist sozusagen der Olymp. Interessant finde ich die Situation der eingangs Genannten: Manoury, Dusapin, Dufour, Murail. Alle diese Namen spielen in Deutschland eine Rolle, aber ich würde von keinem sagen, dass er eine beherrschende Rolle spielt und eine Stellung hat, wie sie eine Generation vorher mit Boulez vergleichbar wäre. Ich habe dafür keine wirkliche Erklärung:Viel hängt von den konkreten Umständen ab, also von der Kenntnis der Musik, auch von persönlichen Begegnungen. Das betrifft Festivalleiter und Dramaturgen, aber auch die Zusammenarbeit von Komponisten mit Ensembles spielt für die Präsenz oft eine große Rolle. Entweder in Form eines eigenen Ensembles oder mit befreundeten Ensembles. Die Interpreten haben wiederum gute Kontakte zu den Festivals, so ergibt sich dann aus dem einem das andere und es entsteht ein Netzwerk. 19 ■ INFO Impuls neue Musik Der deutsch-französische Fonds für zeitgenössische Musik «Impuls neue Musik» begleitet und finanziert seit 2009 anteilig deutsch-französische Projekte in Deutschland und Frankreich. Die unterstützten Projekte sind Auftragswerke, Festivals, Konzertreihen sowie pädagogische Projekte, wobei die Veranstaltungsorte von eher unbekannten, alternativen Orten bis zu den klassischen anerkannten Sälen reichen. Die Gesamtfördersumme pro Jahr beträgt etwa 100 000 Euro. «Impuls neue Musik» wurde auf Initiative der französischen Botschaft in Deutschland, des Ministère de la Culture et de la Communication, der SACEM, des Bureauexport de la musique française, der Fondation Francis et Mica Salabert und Arte Actions Culturelles gegründet. Partner sind heute auch das Institut français, das Goethe-Institut, die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung (2010), der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (2011) und die Deutsche Bank AG (2013). Nächste Antragsfrist: 14. September 2012 Weitere Infos unter www.impulsneuemusik.com Olivier Bernard, seit 1986 verantwortlich für die kulturellen Fördermaßnahmen der SACEM, der französischen Verwertungsgesellschaft für Musik. Zwischen 2003 und 2010 Lehrbeauftragter für das Management von Musik und Darstellender Kunst an der Université d’Evry. Eric Denut, seit 2009 Promotion Manager beim Verlag Durand-Salabert-Eschig/Universal Music Publishing Classical. In der Spielzeit 2005/2006 Geschäftsführer des Ensemble Modern in Frankfurt am Main, zwischen 2006 und 2009 beim Pariser Ensemble «La Chambre Philharmonique». Frank Madlener, seit 2006 Leiter des IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), vorher u. a. künstlerischer Leiter des Festivals «Musica» in Strasbourg und des Festivals «Ars Musica» in Brüssel. Rainer Pöllmann, seit 1996 Redakteur und Produzent bei Deutschlandradio Kultur. 1999 Gründer und Künstlerischer Leiter des Berliner Festivals für neue Musik «Ultraschall». Seit 2003 Mitglied im Beirat der «Edition Zeitgenössische Musik» des Deutschen Musikrats. Sophie Schricker, seit 2011 Leiterin von «Impuls neue Musik» und verantwortlich für den Bereich Klassik im Bureau Export de la Musique (Berlin). 2008 Gründung des Festivals «Shared Sounds» im Berliner Radialsystem, 2011 Mitinitiatorin und künstlerische Leiterin des Vokalfestes «chor@berlin». Managerin der Vokalakademie Berlin. Die unterschiedliche Präsenz französischer Komponisten in Deutschland ästhetisch zu begründen, ist schwierig. Man bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Dass ein Komponist wie Bruno Mantovani, der in Frankreich sehr präsent ist, in Deutschland nicht dieselbe Popularität hat, hängt aber wohl schon mit seiner musikalischen Haltung zusammen. Er verfügt über ein exzellentes Handwerk, aber seine Musik ist für das deutsche Gemüt vielleicht doch «trop leger». Das ist natürlich kein Qualitätsurteil, sondern nur die Beschreibung einer unterschiedlichen Perspektive. Bei vielen anderen Komponisten kann ich mir vor- 20 stellen, dass sie genauso erfolgreich in Deutschland sind, wenn die Konditionen stimmen. Einen Komponisten habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, der aus Frankreich stammt und in Deutschland sehr präsent ist, der aber auch extrem typisch ist für die Ambivalenz im Verhältnis der beiden Länder: Mark Andre. Die Lachenmann-Schule ist nicht zu überhören, aber eigentlich wird er in Deutschland doch als aus Frankreich kommender Komponist betrachtet. Denut: Ja. Warum hat Mark Andre diesen Erfolg in Deutschland? Pöllmann: Er hat wirklich viele Aufführungen, sowohl Uraufführungen wie auch Folgeaufführungen. Ich glaube, er verbindet in seiner Musik auf sehr schlüssige Weise verschiedene Traditionslinien. Und sicher spielt auch die metaphysische, religiöse Seite dabei eine Rolle. Was die Aufführungspraxis angeht, gibt es im Grunde zwei Linien: Die klein besetzte Kammermusik ist eindrucksvoll, sie ist dem Hörer zugänglich, und sie ist für viele Interpreten realisierbar. Darüber hinaus gibt es aber auch die großen, extrem aufwändigen Werke, … hij 2 … und … hij 1 … oder … auf … . Alle drei Werke waren beim Publikum und bei der Kritik ein großer Erfolg.Vor zwei Jahren gab es in Berlin eine Aufführung des Musiktheaters … 22, 13 … . Alle Aufführungen waren ausverkauft. Schricker: Und wie ist die Situation für Mark Andre in Frankreich? Madlener: Er genießt eine besondere Unterstützung durch das Festival d’Automne, wo er als französischer, aber außerhalb von Frankreich etablierter Komponist angesehen wird, für den man also auch hierzulande etwas tun muss. Ist das Ausdruck der Faszination am Mythos des künstlerischen Exils? Im Ernst: In der Intensität seiner Musik liegt etwas den Zuhörer Faszinierendes, denn die Oberfläche ihrer Texturen ist sofort erkennbar. Das ist bezeichnend für eine an der Materialität des Klangs und der Rhetorik der Stille orientierte Musik: sie entsteht aus sehr komplexen Prozessen und aus der Haltung der Strenge, ihre Oberfläche ist allerdings homogen und unveränderlich. Schricker: Es ist sehr interessant zu sehen, dass Andre offensichtlich ein Komponist ist, der in Deutschland großen Erfolg hat, während er auf französischer Seite eher als Träger einer anderen ästhetischen Identität betrachtet wird, die weniger passend erscheint. Pöllmann: Welche Gründe sehen Sie denn aus französischer Perspektive für den großen Erfolg von Mark Andre in Deutschland? Denut: Das liegt an seiner apokalyptischen Seite, im biblischen Sinn. Dazu bringt er bringt ein perfekt entwickeltes Handwerk mit. Er hat zudem sehr wichtige Bezugspersonen in Deutschland: insbesondere Helmut Lachenmann natürlich. Er hat eine Weltsicht, die in Deutschland wirklich Anklang findet und die sich immer am Rande des Verstummens befindet: «Ich kann nicht weitermachen, ich werde weitermachen …, etc.» Eine Art Dramatisierung. Schricker: Gibt es ein Beispiel für ein anderes Extrem, für einen in Frankreich sehr bekannten, sehr präsenten französischen Komponisten, der in Deutschland nicht wirklich wahrgenommen wird? Denut: Mantovani ist in Frankreich sehr präsent, da ein Netzwerk von Interpreten und fachliches Können existiert. Er wurde schon sehr früh vom Ensemble Intercontemporain gespielt. Seine Musik wird von jungen Interpreten aufgeführt, ein wenig wie Jörg Widmann in Deutschland. Er tritt – selbstverständlich ohne ästhetischen Bezug - in die Fußstapfen von Pascal Dusapin mittels Aufbaus eines Katalogs und hat dabei die jungen Interpreten als Vermittler sehr wohl im Blick. Und er entwickelt eine starke musikalische Argumentation, um die Interpreten diesen Niveaus zu motivieren. Man muss wissen, dass die Interpreten, sobald sie erst einmal für einen eingenommen sind, unglaublich treu sind und dass sie dann den gesamten Katalog aufführen. Madlener: Mantovani besitzt außerdem die in Frankreich ziemlich seltene Haltung des Losgelöstseins: er kennt die komplette musikalische Literatur bestens, er hat die Vergangenheit, die Oper, das Spiel der Institutionen in sich aufgenommen und hat sich dabei gleichzeitig eine Art Leich- THEMA tigkeit und Lebendigkeit im Handeln bewahrt. Diese Haltung unterscheidet ihn von anderen Komponisten, die ihre Werke unter Schmerzen gebären, ja, manchmal bis an die Grenze zum Verstummen geraten. Mantovani wird aber auch angezweifelt: Seine letzte Oper wurde in Frankreich stark kritisiert. Pöllmann: Ein gutes Podium für Erfolg in Deutschland haben zum Beispiel jene Komponisten, die Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD waren. Aus Frankreich waren das in den letzten Jahren Fabien Lévy, Jean-Luc Hervé, zuletzt Clara Maïda, die in diesem Jahr auch den Stuttgarter Kompositionspreis erhalten hat für ein Stück, das beim Festival Ultraschall uraufgeführt wurde. Und es gibt Komponisten wie Ondrej Adámek, die so eng mit Paris assoziiert sind, dass sie, zumindest aus französischer Sicht, als «Franzosen» gelten. Was die Interpreten angeht: Der kontinuierliche Erfolg eines französischen Komponisten in Deutschland ist wohl eher zu erwarten, wenn sich ein renommiertes deutsches Ensemble das zu Eigen macht. Es kann aber durchaus sein, dass das Gastspiel eines französischen Ensembles mit einem bis dahin unbekannten französischen Komponisten erst einmal eine Initialzündung darstellt. Und dann geht es mit heimischen Kräften weiter. Das ist eigentlich der ideale Weg, wenn das Stück von anderen Ensembles nachgespielt wird. Der große Vorteil der deutschen Neue– Musik-Szene ist die Kleingliedrigkeit. Es gibt viele Ensembles, es gibt viele regionale Initiativen. Deshalb ist es ein guter Weg, diese regionalen Initiativen, die Künstler vor Ort, zu interessieren und zu begeistern. Schricker: Und Sie, Rainer, denken Sie, dass Deutschland etwas von Frankreich lernen kann? Pöllmann: Was es in Deutschland so nicht gibt, das ist eine aktive Exportförderung. Die gibt es in Frankreich, auch in der Schweiz und in Skandinavien; Deutschland ist in dieser Hinsicht eher importorientiert. Der Wunsch, Künstler nach Deutschland einzuladen, ist erfreulich groß. Aber das Bewusstsein, deutsche Kunst und deutsche Künstler auch als «Exportartikel» zu verstehen und das ent- sprechend zu unterstützen, wäre ausbaufähig. Das Goethe Institut leistet in dieser Hinsicht enorm viel, aber ein zusätzliches Exportbüro oder die sehr aktive Promotion mancher Musikinformationszentren gibt es bei uns nicht. Bernard: Ich sehe einen weiteren Unterschied: In Frankreich gibt es, mehr als in Deutschland, eine Netzwerkkultur. Als wir letztes Jahr mit Frank Madlener das «Ulysses»-Projekt entwickelt haben, hat- ■ Pöllmann: Ich glaube schon, dass auch wir in Netzwerken denken, und es gibt ja auch eine informelle Zusammenarbeit, die ohne institutionellen Überbau funktioniert. Das Problem dabei ist oft, dass die Informationen nicht wirklich Verbreitung finden. Es gab vor einigen Jahren die Idee, ein Büro einzurichten, das nur der Koordination dienen sollte, den Ensembles und den Komponisten mit Informationen helfen sollte, ein Ansprechpartner sein sollte.Vielleicht ist das inzwischen « Was es in Deutschland so nicht gibt, das ist eine aktive Exportför- derung. Das gibt es in Frankreich, auch in der Schweiz und in Skandinavien; Deutschland ist in dieser Hinsicht eher importorientiert. Der Wunsch, Künstler nach Deutschland einzuladen, ist hier erfreulich groß. Aber das Bewusstsein, deutsche Kunst und deutsche Künstler auch als Exportartikel zu verstehen und das entsprechend zu unterstützen, wäre ausbaufähig. » ten wir oft das Gefühl, dass wir unsere deutschen Freunde und Partner wachrütteln müssen, damit sie das Spiel mitspielen. Schricker: Meiner Meinung nach rührt das Problem vom Mangel an Institutionen her. Man wird immer einen deutschen Partner in Form einer Person finden (einen Festivaldirektor, einen Journalisten, einen Dramaturgen), aber eine Institution zu finden ist nicht leicht, da wir nicht über genügend öffentliche oder private Institutionen verfügen, die großen Einfluss haben und wirklich in die Musik integriert sind. Ich glaube, dass man in Deutschland den Institutionen noch immer misstraut. Ich habe das Gefühl, dass die französischen Institutionen näher an der Musik, den Komponisten, den Schaffenden, den Interpreten dran sind. Das musikalische Gefüge erscheint sehr lebendig. In Deutschland dominiert ein sehr individualistischer Zugang, der die Konfrontation mit den Institutionen verhindert. Ich denke, dass es sich dabei meistens um ein formales, nicht um ein inhaltliches Problem handelt. Alles ist stark mit dem Individuum, mit den Personen verknüpft, die oft nicht an Institutionen gebunden sind. auch überholt. Aber auch das hängt wiederum mit der dezentralen Struktur in Deutschland zusammen: Wer soll das machen, wo sollte ein solches Büro angesiedelt sein, wer soll das finanzieren, wer hat das Sagen … Schricker: Ich danke Ihnen allen für dieses interessante Gespräch. Übersetzung: Esther Dubielzig 21