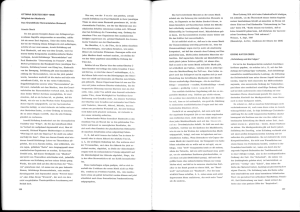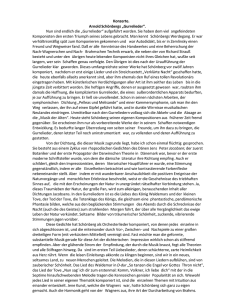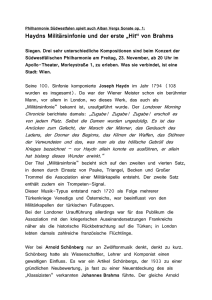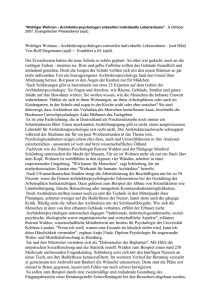Schönbergs Begriff der „Klangfarbenmelodie“
Werbung

Symposiumsreferat 15. September 2006, Auditorium KKL Luzern Schönbergs Begriff der „Klangfarbenmelodie“ Schönbergs am Schluss seiner Harmonielehre skizzierte Idee einer „Klangfarbenmelodie“ wird in der Sekundärliteratur häufig zitiert und ist heute allgemein gebräuchlich für bestimmte kompositionstechnische Phänomene der neueren Musik. Eine kritische Auseinandersetzung mit den ästhetischen und terminologischen Wurzeln des Begriffspaars „Klangfarben-Melodie“ steht jedoch noch weitgehend aus, insbesondere auch eine Untersuchung der von Schönberg intendierten semantischen Tragweite seiner Sprachschöpfung. Dabei rücken Schönbergs eigene Reflexionen über musikalische Wahrnehmungsvorgänge in den Vordergrund, verbunden mit der Frage, inwieweit diese Reflexionen, obwohl häufig spekulativ und nur inadäquat sprachlich fassbar, inspirierende Ausgangspunkte einer kompositorischen Ästhetik sein können. Arnold Schönbergs Harmonielehre von 1911 endet mit dem oft zitierten Satz „Wer wagt hier Theorie zu fordern!“ Vorausgegangen sind 500 Seiten eigenwilliger, jedoch durchaus noch konventioneller Abhandlung der tonalen Harmonielehre, ihrer Erweiterung etwa bis zum Stand der Kammersymponie op. 9 und eine abschliessende Reflexion über die „Ästhetische Bewertung sechs- und mehrtöniger Klänge“. Der letzte Abschnitt des Buches beginnt mit einer Parametrisierung des Klangs, an dem Schönberg drei Eigenschaften wahrnimmt: „seine Höhe, Farbe und Stärke“. Er erwähnt, dass bis jetzt in der Musiktheorie vor allem die Dimension der Tonhöhe systematisiert worden sei, beispielsweise in Form von Harmonielehren. Dagegen befinde sich „die Bewertung der Klangfarbe, der zweiten Dimension des Tons, […] in einem noch viel unbebauteren, ungeordneteren Zustand“. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Klangfarbe zu systematisieren? Schönbergs Antwort in der Harmonielehre ist allgemein bekannt. Er schreibt: F „Ich kann den Unterschied zwischen Klangfarbe und Klanghöhe, wie er gewöhnlich ausgedrückt wird, nicht so unbedingt zugeben. Ich finde, der Ton macht sich bemerkbar durch die Klangfarbe, deren eine Dimension die Klanghöhe ist. Die Klangfarbe ist also das grosse Gebiet, ein Bezirk davon die Klanghöhe. Die Klanghöhe ist nichts anderes als Klangfarbe, gemessen in einer Richtung. Ist es nun möglich, aus Klangfarben, die sich der Höhe nach unterscheiden, Gebilde entstehen zu lassen, die wir Melodien nennen, [...] dann muss es auch möglich sein, aus den Klangfarben der anderen Dimension, aus dem, was wir schlechtweg Klangfarbe nennen, solche Folgen herzustellen, deren Beziehung untereinander mit einer Art Logik wirkt, ganz äquivalent jener Logik, die uns bei der Melodie der Klanghöhen genügt.“ 1 Der Begriff „Klangfarbenmelodie“ hat bis heute unzählige Deutungen erfahren – mehrheitlich im Sinne eines instrumentatorischen Phänomens, also der Emanzipation der instrumentalen Klangfarbe gegenüber der Tonhöhe – aus dem bisherigen Akzidens wird so ein substanzielles Gestaltungselement. Schnell wurde rückgeschlossen, dass Schönbergs 1909 entstandenes Orchesterstück op. 16, No. 3, mit dem Titel „Farben“ die künstlerische Umsetzung dieser Vision sei. Tatsächlich scheinen in diesem Stück vertraute Gestalten wie Melodien oder rhythmisch einprägsame Motive weitgehend getilgt, was laut Theodor W. Adornos Darmstädter Vorlesung von 1966 eine wesentliche Voraussetzung für die Emanzipation der Klangfarbe sei, denn erst die Ausschaltung gewohnter Gestaltungselemente, also Thematik, Melodik, Harmonik und gar 1 Arnold Schönberg: Harmonielehre, Wien 1997, S. 503f. 1 der Rhythmik, vermag die Wahrnehmung des Hörers auf die bis anhin als akzidentiell empfundene Klangfarbe zu lenken. Das Stück wirkt insbesondere harmonisch statisch, es erinnert ein wenig an das prismenhaft farbliche Fluktuieren einer spiegelnden Oberfläche, was dem Stück in den Zwanzigerjahren auch den impressionistischen Titel Sommermorgen am See eintrug. Verschärft führte Adornos Reduktions-These zur bis heute allgemein verbreiteten Definition, eine „Klangfarbenmelodie“ sei die instrumentatorische Umfärbung eines ausgehaltenen Tons oder Akkords. Es wurde in diesem Zusammenhang sogar diskutiert, dass es sich bei op. 16, No. 3 gerade nicht um eine „Klangfarbenmelodie“ handeln könne, denn bei genauerer Betrachtung finden im Stück durchaus melodische und harmonische Bewegungen statt. Es oblag schliesslich Carl Dahlhaus, diese einseitige Sichtweise mit dem Hinweis zu korrigieren: F „Instrumentation wird nicht dadurch zur Klangfarbenmelodie, dass die Tonhöhenmelodie zur Monotonie einschrumpft, sondern durch ein Gleichgewicht zwischen Instrumentation und Tonhöhenmelodie statt der gewohnten Vorherrschaft der 2 Tonhöhenmelodie. Und das Gleichgewicht erreicht Schönberg in op. 16, No. 3 durch Reduktion der Melodik, nicht durch deren Aufhebung.“2 Dieses subtil ausgestaltete Gleichgewicht betont auch Schönberg selbst in einer Musizieranweisung. Er schreibt: F „Es ist nicht Aufgabe des Dirigenten, einzelne ihm (thematisch) wichtig scheinende Stimmen in diesem Stück zum Hervortreten aufzufordern, oder scheinbar unausgeglichen klingende Mischungen abzutönen. Wo eine Stimme mehr hervortreten soll, als die anderen, ist sie entsprechend instrumentiert und die Klänge wollen nicht abgetönt werden.“ Und schliesslich: Der Wechsel der Akkorde hat so sacht zu geschehen, dass gar keine Betonung der einsetzenden Instrumente sich bemerkbar macht, so dass er lediglich durch die andere Farbe auffällt.“3 Diese Anweisung führt auf interessante Weise wieder zurück zur Parametrisierung der Toneigenschaften, denn in unserer Wahrnehmung können sich die einzelnen Ebenen durchaus vermischen oder beeinflussen. In diesem Fall werden die Dynamik und die rhythmische Bewegung wesentlich mitgestaltet durch die Klangfarbe, oder allgemein gesagt: Die Klangfarbe kann eine Funktion der Dynamik und des Rhythmus sein. 1912 wird Schönberg durch den Peters Verlag gebeten, seinen 5 Orchesterstücken Titeln zu geben. Widerwillig gibt er dem dritten Stück den, wie er sagt, „technischen“ Titel: Akkordfärbungen.4 Technisch gesehen ist dieser Titel präziser als die später verwendete neutralere Bezeichnung „Farben“, denn es handelt sich tatsächlich um eine ständig fluktuierende instrumentatorische Umfärbung eines Akkords. • • • • Schematisch dargestellt. Lesen wie eine Partitur Farben nach Klangfarbenfamilien Immer neue klangfarbliche Kombinationen 2 Carl Dahlhaus: „Schönbergs Orchesterstück op. 16, Nr. 3 und der Begriff der „Klangfarbenmelodie“, in: Gesammelte Schriften, Bd. 8, Laaber 2005, S. 674. 3 Arnold Schönberg: „Farben“, aus: Fünf Orchesterstücke op. 16, Anmerkung in der Partitur, London etc. 1950, S. 31. 4 Vgl. Josef Rufer: Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel etc. 1959, S. 13f. 3 Eine genauere Analyse des Stücks zeigt aber, dass hier nicht nur ein Akkord raffiniert uminstrumentiert wird, sondern Schönberg diesen Akkord auch durch kleinste melodische Bewegungen subtil harmonisch umfärbt, stellenweise den ganzen Akkord im Tonraum mixturhaft verschiebt und dabei einem Prinzip von intervallischer Reduktion folgt, welches in seiner Durchdringung des harmonischen und melodischen Satzes grundlegend werden sollte für die spätere Entwicklung der Zwölftontechnik. • • • • Particell des Stücks Zwar einige Instrumentationsangaben Jedoch weitgehend die Niederschrift des harmonischen Satzes Weitgehend kleinste melodische Schritte: Durch diese Miniaturisierung der Harmonik entsteht ein durchaus ähnliches Fluktuieren wie in der Instrumentation, indem diese linearen Veränderungen nicht als Motive oder Gestalten wahrnehmbar werden, sondern vielmehr als harmonische Umfärbungen des Anfangsakkords. Durch diese Analogie verfliessen Harmonik und Klangfarbe zu einem unauflöslichen Komplex: Die Harmonik scheint hier zu einer Funktion der Klangfarbe geworden zu sein und umgekehrt. Dabei werden verschiedene Formen des Zusammenwirkens zwischen diesen zwei Parametern systematisch ausgelotet. T. 246 mit T. 248 • Zuerst harmonisch statisch, Klangfarben-Accelerando 4 • • • Dann ein Klangfarben-Accelerando gekoppelt mit einer Verdichtung des harmonischen Rhythmus Dabei Permutation der verwendeten Klangfarben Am Punkt der höchsten Verdichtung der harmonischen und instrumentatorischen Farben eine „harmonische Trübung“: Chromatische Linie im Cello (Chroma →griech. Farbe) Diese innere Beziehung von Instrumentation und Harmonik scheint mir kein Einzelfall zu sein, sondern geradezu ein Charakteristikum der freien Atonalität, insbesondere in Schönbergs Erwartung oder Der glücklichen Hand und ebenso in zahlreichen Werken Anton Weberns und Alban Bergs. Adorno bringt es in seiner Vorlesung von 1966 auf den Punkt: F „Wie in den vieltönigen Akkorden der neuen Musik diese nicht zu einer homogenen, in sich ununterschiedenen Einheit verschmolzen werden, sondern jeweils selbständig, gewissermassen als Stimmen erhalten bleiben und doch ein Ganzes bilden, so ist auch instrumentiert.“5 Die Definition der „Klangfarbenmelodie“ als ein rein instrumentatorisches Phänomen greift also zu kurz. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Gestaltungsebenen, die gesamthaft als Farbwirkungen wahrgenommen werden können. Man darf nicht vergessen, dass Schönberg den Begriff an den Schluss einer Harmonielehre setzt, es ist also unwahrscheinlich, dass nun plötzlich die Harmonik keine Rolle mehr spielen sollte. Wenn man Schönbergs Ausführungen genau liest, wird die Harmonielehre nicht einfach „aufgehoben“, oder höchstens im Hegelschen Sinn, nämlich „hinaufgehoben“, in 5 Theodor W. Adorno: „Die Funktion der Farbe in der Musik“, in: Heinz-Klaus Metzger e.a. (Hrsg.): DarmstadtDokumente 1, Musik-Konzepte Sonderband 1/99, München 1999, S. 295. 5 einen grösseren Verbund eines Klangfarbendenkens. Wenn das Primäre des Tons seine Farbe ist und die Tonhöhe eine seiner Farbeigenschaften, dann ist die Klangfarbe als Erweiterung des Harmoniebegriffs zu verstehen. Betrachtet man Schönbergs Äusserungen im Umfeld seiner Harmonielehre, so wird die semantische Weitung des Klangfarbebegriffs augenfällig. Er diskutiert mit Busoni über den Klang seiner Klavierstücke op. 11, spricht über „deren düstere, gepresste Klangfarbe“6, er vergleicht ihr Klangbild mit dem seiner Orchesterstücke, die sich auch deutlich abwenden vom „’Götter- und Übermenschen-Klang’“ des Wagnerschen Orchesters“, sondern „alles zarter dünner wird“, und er „gebrochene Farbtöne“7 bevorzugt und meint schliesslich über Pierrot lunaire, dass hier „die Farbe alles, Noten fast nichts bedeuten.“8 Als Busoni in die Satzstruktur von Schönbergs Klavierstücks op. 11, No. 2 korrigierend eingreift und eine Bearbeitung des Stücks anfertigt, empfindet dies Schönberg als eine wesentliche Veränderung der Farbwirkung und benutzt sogar eine eindeutig instrumentatorische Terminologie, um dies Busoni zu verdeutlichen. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, einen Blick auf Schönbergs Entwurf eines grösseren theoretischen Werks zu werfen, welches ca. 6 Jahre nach der Harmonielehre begonnen wurde und den Arbeitstitel trägt Zusammenhang – Kontrapunkt – Instrumentation – Formenlehre. Darin widmet er sich ausgiebig verschiedenen Instrumentationsfragen und kommt zu Schluss, dass die wahre Grundlage für alle Instrumentation der Satz sei. Vorerst müsse also der Schüler wissen, wie ein Satz beschaffen sein muss, der sich für diese oder jene Instrumentenzusammenstellung eignet. So rücken „Satzkunst“ (Tonsatz, Kontrapunkt) und „Setzkunst“ (Instrumentation) folgerichtig zusammen und werden auch im Kompositionsprozess enger verbunden, was in Schönbergs Forderung kulminiert, man solle direkt „für’s Orchester erfinden.“ Eine Erweiterung des Klangfarbenbegriffs als Zusammenwirken von harmonischen und instrumentatorischen Phänomenen ergibt sich auch stringent aus der Argumentationslinie von Schönbergs Harmonielehre. In den Kapiteln vor der „Klangfarbenmelodie“ widmet er sich der Frage der „Emanzipation der Dissonanz“. Da sich aufgrund der naturgegebenen Teiltonreihe, die grob gesehen alle Intervalle enthält, ein wesentlicher Unterschied zwischen Konsonanz und Dissonanz nicht mehr aufrechterhalten lässt, sondern höchstens eine graduelle Abstufung, wird aus der Dissonanz eine „fernere Konsonanz“. Natürlich war Schönberg kein Spektralist und seine Argumentationsweise hat eher apologetischen Charakter, doch bedeutet dies in logischer Konsequenz, dass jeder Akkord gewissermassen als künstlich nachgebildeter Ausschnitt eines Teiltonspektrums betrachtet werden kann. Schönbergs Äusserung der Klangfarbe als das grosse Gebiet und der Tonhöhe als eine Dimension davon steht in völliger Übereinstimmung mit der von Helmholtz ausgehenden und bis heute gültigen These, dass die Teiltöne unsere Klangfarbenwahrnehmung und einer davon, der Grundton, die Tonhöhenwahrnehmung bestimmen. Diese neuen entfernteren Tonbeziehungen als „Farben“ zu bezeichnen, liegt terminologisch also sehr nahe. Ernst Kurth, der bedeutende Berner Musikwissenschafter und Schönberg-Zeitgenosse unterscheidet in seiner Musikpsychologie denn auch zwei Arten der Farbigkeit, „die instrumentalen wie die harmonischen Farben“, wobei in der Harmonik insbesondere die Klangbewegung als Farbveränderungen wahrgenommen werden könne. Analog betont 6 Schönberg in einem Brief an Busoni vom 26.7.1909. Schönberg in einem Brief an Busoni vom 25.8.1909 8 Vgl. Stuckenschmitt 7 6 Adorno in seiner Darmstädter Vorlesung die Wichtigkeit der Klangfarbenrelationen auf dem Gebiet der Instrumentation. Dadurch wird sowohl die instrumentale als auch harmonische Klangfarbe zu einem Faktor der Formbildung. Auch Schönberg scheint dies bewusst zu sein, wenn er Richard Strauss über seine Orchesterstücke op. 16 schreibt: F „Ich verspreche mir allerdings kolossal viel davon, insbesondere Klang und Stimmung. Nur um das handelt es sich--absolut nicht symphonisch, direkt das Gegenteil davon, keine Architektur, kein Aufbau. Bloß ein bunter, ununterbrochener Wechsel von Farben, Rhythmen und Stimmungen.“9 Impliziert also die „Klangfarbenmelodie“ auch einen Formbegriff? Bis anhin kaum Beachtung fand eine der ersten musikwissenschaftlichen Rezeptionen des Begriffs „Klangfarbenmelodie“ durch Ernst Kurth. In seinem Buch Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan bringt er den Begriff in Zusammenhang mit Wagners unendlicher Melodie und schreibt: F „Der Ausdruck „Klangfarbenmelodien“ von Schönberg trifft den Kern der Erscheinung, braucht aber nicht auf die modernste impressionistische Richtung beschränkt zu bleiben. Fluss der Linien und Fluss der Farben sind von den Tiefen her gleichen Ursprungs. Auch bleibt vor allem zu beachten, dass hier nicht die einzelnen harmonischen Klangfarben, sondern vornehmlich die Fortschreitungswirkungen zwischen ihnen das Wesentliche sind […].“10 Schönberg selbst hat sich zum Begriff erst wieder im Todesjahr 1951 geäussert und zwar unter Umständen, die eine vorsichtige Bewertung seiner Aussagen erfordern. Nichtsdestotrotz deckt sich seine Auslegung des Begriffs verblüffend mit derjenigen Kurths: F „Aber insbesondere müsste es jedem klar sein, dass ich an Folgen von Klangfarben gedacht habe, die der innern Logik von Harmoniefolgen gleichkommen. Melodien habe ich sie genannt, weil sie im selben Maße geformt sein müssten, wie Melodien, jedoch nach eigenen, ihrer Natur entsprechenden Gesetzen. […] Denn sicherlich würden Folgen von Klangfarben andere Konstruktionen erfordern, als Tonfolgen, oder als Harmoniefolgen. Denn sie wären all das und noch dazu spezifische Klänge. Klangfarbenmelodien würden eine besondere Organisation erfordern, die vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen musikalischen Formen aufwiese, aber doch aus dem Umstand, dass die Erfordernisse eines neuen Faktors: den Klängen Konsequenzen ziehen müssten. […]“11 Noch deutlicher wird er in einem Brief an Dallapiccola aus dem selben Jahr: F „Denn ich meinte etwas anderes unter Klänge, un[d] vor allem aber, unter Melodie. An Klängen, wie ich sie hier meinte, würden solche Einzel-Erschienungen in meinen früheren Kompositionen in Betracht kommen, wie etwa die Gruftszene aus Pelleas und Melisande, oder vieles aus der Einleitung zum vierten Satz meines zweiten Streichquartetts, oder die Figur aus dem zweiten Klavierstück, die Busoni in seiner Bearbeitung so oft wiederholt hat und vieles andere. Das sind niemals bloss einzelne Töne verschiedener Instrumente zu verschiedenen Zeiten, sondern Kombinationen bewegter Stimmen. Aber das sind noch keine Melodien, sondern Einzelerscheinungen innerhalb einer Form der sie untergeordnet sind. Melodien werden es wenn man 9 Schönberg an Strauss, 14.7.1909. Ernst Kurth: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“, Hildesheim 1998, S. 565f. 11 Arnold Schönberg, Anton Webern: Klangfarbenmelodie, 1951 10 7 Gesichtspunkte fände, sie so anzuordnen, dass sie eine konstruktive Einheit bilden, von unbedingter Selbstständigkeit, eine Organisation, die sie nach ihren Eigenwerten verbindet.“12 Genau diese „Kombinationen bewegter Stimmen“ sind offenbar auch Wassily Kandinsky aufgefallen, der 1911 in einem Konzert in München die von Schönberg oben zitierten Werke, nämlich das Zweite Streichquartett op. 10 und die Drei Klavierstücke op. 11 gehört hatte. In seinem ersten Brief an Schönberg schreibt er: F „Sie haben in ihren Werken das verwirklicht, wonach ich in freilich unbestimmter Form in der Musik so eine grosse Sehnsucht hatte. […] das eigene Leben der einzelnen Stimmen in Ihren Kompositionen, ist gerade das, was auch ich in malerischer Form zu finden versuche.“13 Der amerikanische Musikwissenschafter Alfred Cramer14 hat versucht, die in Schönbergs Brief an Dallapiccola erwähnten Werkpassagen genauer zu identifizieren. Auffällig ist erstens, dass Schönberg auch Beispiele von monochromen Klangkörpern wie Streichquartett oder gar Klavier als „Klangfarbenmelodien“ bezeichnet. Zweitens weist Cramer darauf hin, dass die vermutlich gemeinten Passagen alle polyphon seien. Polyphon ist vielleicht etwas zu viel gesagt, sicher ist, dass es sich bei all diesen neuen Klängen um instrumentatorisch unauffällige, ja klanglich relativ durchsichtige, um nicht zu sagen dünne Komplexe bewegter Stimmen handelt. 12 Schönberg in einem Brief an Dallapiccola vom 19.1.1951. Brief Kandinskys an Schönberg vom 18. 1. 1911, in: Jelena Hahl-Koch, Arnold Schönberg, Wassily Kandinsky. Briefe, Bilder und Dokumente einer aussergewöhnlichen Begegnung. Mit einem Essay von Hartmut Zelinsky, Salzburg und Wien 1983, S. 19. 14 Alfred Cramer: …….Music Theory Spectrum 24/1 (Spring 2002): 1-34 13 8 Entscheidend ist also nicht nur die Verbindung von Harmonik und Instrumentation im übergeordneten Begriff der Klangfarbe, sondern durch die Verknüpfung mit dem Begriff der Melodie auch die wie es Adorno genannt hat „Identität des Klangs und der Struktur.“ Klang ist nicht mehr isolierbares punktuelles Phänomen, sondern ein Komplex unterschiedlicher Teile, ein Zusammenwirken verschiedener Parameter mit einer Eigenzeit, einer Struktur und vielleicht am wichtigsten: Klang ist nicht etwas Gegebenes, sondern muss vom Komponisten erst erschaffen werden. Klang ist Form – wer hier an Helmut Lachenmanns „Strukturklang“ denkt, liegt vielleicht gar nicht so fern. Leonid Sabanejew beschreibt in seinem Beitrag zu Kandinskys Almanach Der Blaue Reiter eine analoge Wahrnehmung beim Hören von Skrjabins Prometheus: F „Der Zuhörer, der sich in die Welt dieser Harmonien vertieft hat und ihre ‚konsonierende’ Natur fühlt, fängt an, das ganze Gewebe des Prometheus als etwas in hohem Grade Durchsichtiges zu sehen: es wird klar, dass Prometheus unendlich einfach ist und vollkommen ‚konsonierend’, so dass hier keine einzige Dissonanz zu finden ist. […] alle melodischen Stimmen sind auf den Klängen der begleitenden Harmonie gebaut, alle Kontrapunkte sind demselben Prinzip untergeordnet. Nur diese Tatsache gibt die Möglichkeit […], zur selben Zeit fünf bis sechs verschiedene Themata und den thematischen Ursprung der Figuren zu vereinigen. In der ganzen Weltliteratur ist Prometheus das komplizierteste polyphone und zur selben Zeit in seinem Gewebe durchsichtigste Werk“.15 Hier verschmilzt tatsächlich eine komplexe Polyphonie zum Klang, verschmelzen Dissonanz und Konsonanz zu höherer Einheit und lösen sich auf in ein faszinierendes Farbenspiel der Klänge. Sabanejew beschreibt im Grunde genommen Schönbergs Ideal einer „Einheit des musikalischen Raumes“, wo Melodie und Harmonie eine untrennbare Einheit bilden. In einem Text über Polyphonie von 192816 schreibt Schönberg, dass zwar in der freien Atonalität die Linearität der Stimmen primär sei, doch die dadurch entstehenden Zusammenklänge als Färbungen wirksam würden. In der Zwölftontechnik würden sich schliesslich Klang und Linearität einer einheitlichen Auffassung unterordnen. Die Idee der „Klangfarbenmelodie“, die sowohl die Einzelfarbe wie auch deren formbildende Funktion, der Klang und die Linie umfasst, kann also als eine frühe Ausformulierung der einheitlichen Wahrnehmung des musikalischen Raumes angesehen werden. Das mag eine Begründung sein, warum Schönberg nicht schon in der Harmonielehre konkrete Beispiele von „Klangfarbenmelodien“ gegeben hat, sondern vielmehr wörtlich von einer „Zukunftsphantasie“ sprach. Es gibt dafür aber noch eine andere Erklärung, denn Schönbergs Begriff trägt auch eindeutig kunstutopische und weltanschauliche Aspekte und verlässt den gewohnten Blickwinkel einer Harmonielehre. Schon mit den Zitaten von Ernst Kurth und Leonid Sabanejew haben wir die Ebene der Harmonielehre und des kompositorischen Handwerks verlassen – in Richtung einer Reflexion über Wahrnehmungsphänomene. Vielmehr nähern wir uns wieder Kandinskys Klangbegriff an, der ihn in dieser Zeit ungefähr gleichbedeutend mit „Wirkung“ verwendet hat, also „Klang“ eine spezifische Wahrnehmungsqualität. Interessanterweise lässt Schönbergs Zeitgenosse Josef Matthias Hauer den Begriff „Klangfarbenmelodie“ ausschliesslich so gelten und verneint eine konkrete kompositionstechnische Bedeutung. 15 Leonid Sabanejew, »Prometheus von Skrjabin«, in: Wassily Kandinsky und Franz Marc (Hrsg), Der Blaue Reiter, München 1965, S. 117. 16 Linearer Kontrapunkt – lineare Polyphonie, ASC T.35.36. 9 Schönbergs Ausführungen am Schluss seiner Harmonielehre gehen spürbar über in eine Reflexion über die Wahrnehmung von Klängen, sein Ohr wird dabei zur entscheidenden Instanz bei der Beurteilung dieser neuen Klänge. Dabei folgt er eindeutig Helmholtz, der auch davon überzeugt war, dass die im Harmonischen entwickelten Fähigkeiten des Gehörs sich in Zukunft auch in die Klangfarbenwahrnehmung erweiterten, also immer fernere Teiltöne noch als harmonische Werte verstanden werden können. Schönberg schreibt dazu: F „Klangfarbenmelodien! Welche feinen Sinne, die hier unterscheiden, welcher hochentwickelte Geist, der an so subtilen Dingen Vergnügen finden mag! Wer wagt hier Theorie zu fordern!“17 Mit diesen die Harmonielehre abschliessenden Sätzen verlässt Schönberg unverkennbar den sprachlichen Code einer Harmonielehre, ja er lässt sich seine Begriffsschöpfung „Klangfarbenmelodien“ geradezu auf der Zunge zergehen. Angesichts der Tatsache, dass man es hier mit dem seltenen Fall eines sowohl bedeutenden Komponisten als auch bedeutenden Theoretikers zu tun hat, liesse sich doch fragen, inwiefern gerade solche Begriffe nicht einfach auch einen äusserst inspirierenden Klang für einen Komponisten haben müssen? Gottfried Michael Koenig und György Ligeti schufen einen Begriff, der mit der „Klangarbenmelodie“ eng verwandt scheint: Die „Bewegungsfarbe“. Auch wenn dieser Begriff anders als Schönbergs „Klangfarbenmelodie“ mit bestimmten Satztypen der Moderne verknüpft ist und auf psycho-akustischen Grundlagen basiert – ist er nicht – unabhängig davon – auch eine inspirierende metaphorische Sprachschöpfung zur Bezeichnung eines kompositorischen Ideals? Es wäre interessant zu untersuchen, wie sehr sich gerade bei theoretisch reflektierenden Komponisten wie Schönberg oder Ligeti musikalische Gedanken bei Sprechen über Musik verfertigten. In der neusten Ausgabe von MusikTexte kann man eine fast deckungsgleiche Paraphrase von Schönbergs Ausführungen zur „Klangfarbenmelodie“ lesen. Dort erfährt man über die finnische Komponistin Kaija Saariaho, dass sie die Richtung der Klangfarbe als vertikal, die der Harmonik als horizontal empfindet. „In ihren Kompositionen sucht sie nach Möglichkeiten, deren Rollen zu vertauschen. Ausserdem möchte sie musikalische Formen mit Hilfe von Klangfarbenprozessen definieren. An Harmonik interessiert sie deren Eigenschaft, als klangfarbliche Komponente wirken zu können.“ Diese Ausführungen sind für die Hörwahrnehmung des Stücks durchaus hilfreich, noch vielmehr handelt es sich aber um eine persönlich inspirierende Wahrnehmungsweise der Komponistin. Dabei setzt sich bei Komponisten immer wieder ein erstaunliches sprachschöpferisches Potenzial frei. Bei aller definitorischer Unklarheit des Begriffs „Klangfarbenmelodie“ erweitern doch gerade solche, aus genuin musikalischen Vorstellungen entsprungene sprachliche Konstrukte rückwirkend unseren Begriff von Musik. Oder wie es Schönberg ausgedrückt hat: Man kann auch „mit Begriffen musizieren“. Michel Roth © 2006 17 Arnold Schönberg: Harmonielehre, Wien 1997, S. 504.. 10