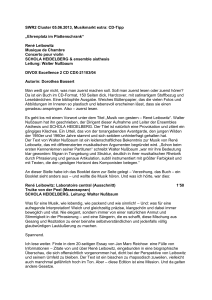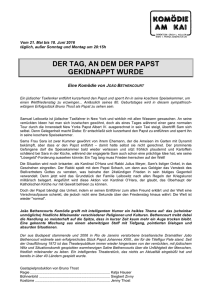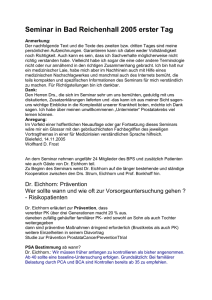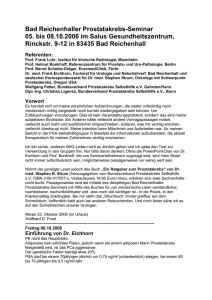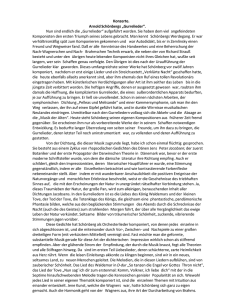Der Überlebende aus Warschau
Werbung

GEORG BECK DER ÜBERLEBENDE AUS WARSCHAU RENÉ LEIBOWITZ (1913-1972): KOMPONIST, DIRIGENT, AUTOR. foto: sacher stiftung (nmz 12/13) – Gesetzt den Fall, ein experimentierfreudiger Filmemacher verfiele irgendwann auf die tollkühne Idee, das Leben des René Leibowitz auf die Leinwand zu bringen – ein griffiger Anfang dafür wäre das Los Angeles des Jahres 1947. Nicht nur, weil es immer ein schönes Reibungsmoment ist, entschiedene Europäer wie René Leibowitz in Amerika auftreten zu lassen. So anzufangen hätte auch den Vorteil, dieses Leben im Umkreis von Kunst und Gewalt im 20. Jahrhundert in Rückblenden zu entwickeln. Wobei es bezeichnenderweise eine Kunsterfahrung ist, die die Erinnerung auslöst. Eine, die für Leibowitz überfallartig kommt und ihn ganz wie von selbst dahin bringt, sein Leben wie das seiner Familie und Freunde noch einmal wie im Film ablaufen zu lassen. Ausgerechnet in Kalifornien. I In der ersten Einstellung würden wir einem hochgewachsenen, hageren Herrn begegnen. Markante Brille, blasse Gesichtsfarbe. Die Zeichen des Intellektuellen, des gebildeten homme de lettres, der Leibowitz tatsächlich gewesen ist mit Interessen für Kunst, Literatur, Musik. Vorstellbar, dass er nach der Mode der Zeit einen dieser ausladenden Trenchcoats trägt. Der ganze Auftritt wahrscheinlich etwas zu europäisch für eine Umgebung, die ja nicht nur von der Sonne verwöhnt, sondern die in diesen Jahren gerade dabei ist, zum Vorbild zu werden für eine global werdende Beglückungsgesellschaft. Theodor Wiesengrund-Adorno, den Leibowitz wie so manchen anderen deutschen Emigranten ebenfalls in Kalifornien kennen lernt, hatte über dieses Phänomen ja bekanntlich zusammen mit Max Horkheimer ein paar Jahre zuvor die Studie „Dialektik der Aufklärung“ angefertigt. Was Leibowitz betrifft, so war es allerdings nicht das Studium der Kulturindustrie, das ihn dazu veranlasst hatte, sich von November 1947 bis Mitte Januar 1948 in einem Apartment am Havenhurst Drive einzumieten. Der Grund dafür wie überhaupt für die beschwerliche Anreise aus dem fernen kriegsversehrten Europa war ein anderer: Arnold Schoenberg. Seitdem Leibowitz sich als glühenden Schönbergianer sah, seitdem Schönberg das Zentrum seiner künstlerischen Existenz geworden war, war die persönliche Begegnung sein innigster Wunsch. Gewissermaßen intendierte Krönung alles Vorangegangenen: der Korrespondenz, des Partiturstudiums, der umfangreichen Lehr- und Publikationstätigkeit, nicht zuletzt des Aufführens der Werke Arnold Schönbergs, seiner Schüler und Geistverwandten. II Zu tun hat die erwähnte Kunsterfahrung – Schönberg zeigt Leibowitz das Particell seines op. 46 „Survivor from Warsaw“, Leibowitz erstellt daraus die Partitur – mit seinem jüdischen Familienhintergrund. Indessen anders als sein Freund Paul Dessau und anders auch als Schönberg selbst, die beide mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus anfingen, ihre jüdische Existenz auch in ihren Werken zu spiegeln – im Unterschied zu diesen hatte Leibowitz sein Judentum mehr oder weniger als Privatsache behandelt. In seiner Musik jedenfalls hat er es nicht oder zumindest nicht explizit zum Vorschein gebracht. Was vielleicht insofern überraschend ist, als er ja durchaus auf einen ausgeprägten OstjudentumHintergrund zurückblicken konnte. Gebürtig zu Warschau, 17. Februar 1913, begegnet in René Leibowitz der ältere der zwei Söhne der aus Riga stammenden russisch-jüdischen Fabrikantenfamilie Max und Nadia Leibowitz. Eltern, die ihren Söhnen ein reiches, bereicherndes Leben zu bieten hatten. Ungefähr so wie das von Renés berühmten Cousin, dem Naturwissenschaftler und Philosophen Jeschajahu Leibowitz – mit Privatlehrern, mit mehrsprachiger Erziehung. Eltern, die untereinander russisch sprechen, ein Vater, der mit seinen Söhnen deutsch, ein Kindermädchen, das englisch redet und die Mutter französisch als auch aufgrund ihrer Moskauer Herkunft wiederum russisch. Spanisch, Italienisch kommen über die Hauslehrer. Eine Vielfalt, die bleiben wird. Vor allem die Deutschkenntnisse werden ausschlaggebend, wenn Leibowitz in Frankreich den Exilanten aus Wien und Berlin auf Augenhöhe begegnen, wenn er die in Wien und Berlin erscheindende Fachliteratur studieren, sie sich aneignen wird oder wenn er, eben über den Jahreswechsel 1947/48 mit Schönberg zusammen kommen wird. III 1926. Es ist das Jahr, in dem René Leibowitz erstmals Paris betritt, seine Wahlheimat. Er kommt von Berlin, direkt von der Schulbank des damaligen Charlottenburger GoetheGymnasiums. Auslöser ist die Scheidung der Eltern, der Wegzug der Mutter in die französische Hauptstadt, der der 13jährige René mit seinem Bruder Joseph folgt. Dort angekommen, sollte der Direktor des von den Leibowitz’ ausgewählten Pariser Lysees sehr bald Gelegenheit haben, seinen neuesten Schüler aus der Nähe kennen zu lernen. Eine Episode, an deren Ende ein Eintrag ins Klassenbuch steht: “Elève doué, mais travail insuffisant. S’intéresse trop à Wagner.” „Begabter Schüler, Arbeitshaltung ungenügend. Interesse ganz konzentriert auf Wagner.“ Leibowitz wird mit Wagner-Partituren unter der Bank erwischt. Sicher, Wagner bleibt Jugendliebe. Sehr bald veschiebt sich der Focus auf Zeitgenössisches. Doch der Grundton hält sich. Die Formel dafür findet Dessau: „Sein ganzes Leben ist Musik.“ Dabei gingen Leibowitz’ eigene Überlegungen, was er denn werden soll, anfänglich in ganz andere Richtungen: Kunsthistoriker vielleicht? Oder doch lieber Geiger? Apropos. Als Komponist wahrt er die Nähe zu seinem Instrument. – Im Januar 1961 wird Ivry Gitlis, begleitet vom Orchester des Norddeutschen Rundfunks, sein Violinkonzert zur Uraufführung bringen. Ein berückendes Werk mit einem wunderbar fremden, insistierenden Klang. Dirigent am Pult im Funkhaus Hannover – sichtbares Indiz einer veritablen Doppelbegabung – der Komponist. IV In der Nachbetrachtung fällt die Rezeptions-Bilanz allerdings nüchtern aus: So wenig nämlich das von Leibowitz für Gitlis geschriebene Violinkonzert Eingang ins Repertoire gefunden hat, so sehr es das Schicksal des Vergessenwordenseins teilt mit rund einhundert anderen Werken des Komponisten, darunter: neun Streichquartette, fünf Opern (fast alles, man mag es kaum glauben, unaufgeführt) – so sehr hat es dieses Concerto pour violon doch zumindest schon einmal in den Konzertsaal geschafft, wenigstens für einen jener Hannoveraner Tage der Neuen Musik 1961. Wermutstropfen indes, wie so oft, bis heute: Eine Uraufführung als Begräbnis erster Klasse. Die Ursachenforschung führt hier leider auch auf ein Neue-Musik-Umfeld, das dem speziellen Ansatz dieses Komponisten skeptisch bis feindselig gegenüberstand. Es hat René Leibowitz nämlich nicht nur nichts genutzt, möglicherweise hat es ihm (heute sagen wir: kurioserweise) wohl sogar geschadet, dass er mit seinem Violinkonzert Nähe und Anschluss sucht an die erhabenen Vorbilder der Gattung. Eine Haltung gegen den Trend, ganz klar. Leibowitz’ Komponisten-Kollegen, sofern sie die (mit großem N geschriebene) Neue Musik repräsentieren, haben den Bruch mit der Tradition ja in Kauf genommen, wenn sie ihn nicht sogar willentlich herbeigeführt haben. Programm notes jedenfalls wie sie Leibowitz diesem Hauptwerk angefügt hat, hätten die allermeisten von ihnen wohl rundweg für indiskutabel befunden. „Als Modell“, so Leibowitz, „diente der langsame Satz des Beethovenschen Violinkonzerts, ein Werk dessen wirkliche Bedeutung heute noch scheinbar oft missverstanden wird und dessen äußerste Konsequenzen, erst heute zur völligen Entfaltung gelangen können.“ Nachdem glücklicherweise, will Leibowitz sagen, Schönbergs Kompositionsmethode mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen die Tonkunst so entscheidend revolutioniert hat. Dies die Entdeckung: Beethoven mit den Augen und durch die Brille Schönberg’scher Reihentechnik sehen lernen. Was an der dodekaphon-ornamentalen Variation des Themas in der Solostimme ohne Mühe abhörbar ist. (Höchst verdienstvoll deshalb, dass die jüngst beim Schweizer Label DIVOX erschienene, wichtige Leibowitz Doppel-CD mit Schola Heidelberg und ensemble aisthesis auch diesen Mitschnitt noch einmal transportiert. Dringende Empfehlung!) Der Komponist selbst spricht in diesem Zusammenhang übrigens vom „Reiz“, ein Violinkonzert zu schreiben und dabei an Schönberg und Beethoven gleichzeitig zu denken. Zwei Zentralgestirne, um die Leibowitz buchstäblich bis zu seinem unerwarteten Herztod 1972 kreisen wird. V Stichwort: René Leibowitz, der Dirigent. Stichwort: Beethoven. – Neujahr 1961. Nicht im Traum hätte Leibowitz daran gedacht, jemals eine solche Post in seinem Briefkasten vorzufinden. Absender: RCA, Radio Cooperation for Amerika, das amerikanische Plattenlabel. Das Angebot: Übernahme der musikalischen Leitung einer geplanten Gesamtaufnahme aller neun Beethoven-Sinfonien mit Royal Philharmonic Orchestra. Ein Paukenschlag! Leibowitz ist aus dem Häuschen, begeistert schreibt er an Dessau: „Du kannst Dir vorstellen, in welchem Zustande ich bin. Ich hätte so etwas nie erwartet und weiß nicht, ob ich vor Glück oder vor Angst umkommen soll. Es ist natürlich eine fantastische Chance (wie bekommt man so etwas?) Natürlich studier’ ich wie ein Wahnsinniger (hauptsächlich die Neunte, die ich nicht gemocht habe) denn es muss alles unbedingt gut werden. Bitte Daumen drücken!“ Schon im April soll es losgehen. Leibowitz fiebert dem Termin buchstäblich entgegen. Wird er der gestellten Aufgabe gerecht werden können? Vor allem einer ist nun sein bevorzugter Briefpartner: Rudolf Kolisch, der Primarius des Kolisch-Quartetts, der Schwager Schönbergs und, dies vor allem sucht Leibowitz jetzt in ihm, der große Kenner von „Tempo und Charakter in der Musik Beethovens“: „Glaubst Du, dass ich hätte absagen sollen, da es doch eine tolle Zumutung ist? Aber wie oft bekommt man so eine Chance? Wie schade (für mich), dass wir jetzt nicht in der gleichen Stadt sind. Ich hätte Dich um 1001 Ratschlag gefragt. Im Allgemeinen will ich jedenfalls keine Retuschen machen. Hab ich recht? – Sei mir nicht böse, wenn ich so viel von mir spreche, aber ich kann seit 2 Tagen (d.h. seitdem man mir den Vorschlag gemacht hat) an nichts anderes denken.“ Die Chance wird zum Höhepunkt der Karriere. Die Aufnahme selbst, Beethoven 1-9, ein Meilenstein – bis heute. Leibowitz erhält den Grand Prix du Disques und ist (und bleibt auch, bezeichnenderweise bis heute) der ‚Geheimtipp’ in Fachkreisen. VI Noch einmal Leibowitz-Schönberg. – Immer wieder geistert ein direktes Schönberg-Studium durch die (spärliche) Leibowitz-Literatur. Letzterer hat das Gerücht seinerseits wohl nicht ungern vernommen, passte es doch in das Bild, das er sich als eines hingebungsvollen Schönbergianers von sich gemacht hatte. Doch abgesehen von sporadischen Begegnungen mit Kapazitäten wie Maurice Ravel und dem Sacre-Uraufführungsdirigenten Pierre Monteux – abgesehen von solchen kaum kontinuierlich, geschweige denn systematisch zu nennenden Studien, verläuft Leibowitz’ Weg zur Tonkunst wie der Schönbergs auch: im wesentlichen als Autodidakt. Seine zählenden Schönberg-Begegnungen sind zwei. Und nur eine ist tatsächlich ‚real’. Die andere, die erste fällt in die Monate Januar-Februar 1931 als er zur Beerdigung des Vaters von Paris nach Berlin reist und bei dieser Gelegenheit (wann und wo genau ist unklar) als damaliger Noch-Schönberg-Skeptiker in eine, seinen Lebensweg entscheidende Pierrot Lunaire-Aufführung gerät – die Wende. Noch Jahre später wird er dieses von ihm gepriesene Werk zusammen mit seiner Tochter Cora aus zweiter Ehe einstudieren und aufführen. Die andere, die erste persönliche Begegnung fällt eben in das Jahr 1947. Als Leibowitz in Los Angeles ankommt, stehen ihm allerdings alles andere als spannungsfreie Wochen bevor. In der Nähe ist der alte Herr nämlich nicht ganz frei von Schwierigkeiten. Und doch – Leibowitz lässt sich nicht beirren. Er ist es schließlich auch, der, bedingt durch ein Augenleiden des Komponisten, aus dem großformatigen Particell von op. 46 die Orchesterpartitur erstellen wird. Mit welchen Gefühlen, vertraut er Erich Itor Kahn an: „Le Survivor me donne beaucoup de mal.“ „Der Überlebende tut mir sehr weh.“ René Leibowitz, der der Gestapo (im Unterschied zu seinem Bruder Joseph) im Untergrund entkommen war, ausgerechnet er hatte nun das (fragwürdige) Privileg, der erste sein, eine Musik lesen zu dürfen, die vom Tod als einem Meister aus Deutschland erzählt. Weshalb es denn auch keiner großen Fantasie bedarf, um sich vorzustellen, dass er über der Reinschrift vor allem immer wieder dies zu sich gesagt haben wird: Das bin ich! Dieser Survivor from Warsaw, dieser Überlebende aus Warschau bin ich – René Leibowitz.