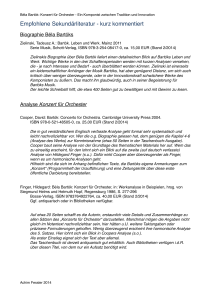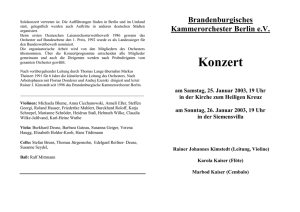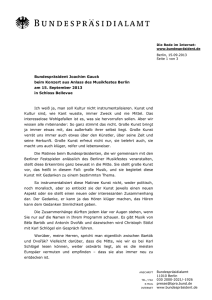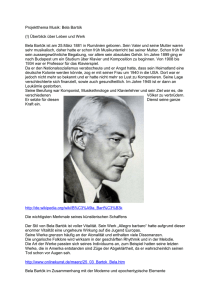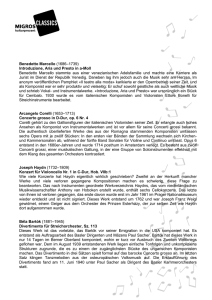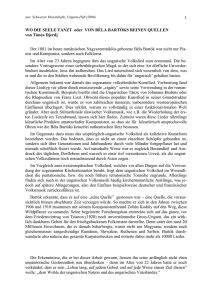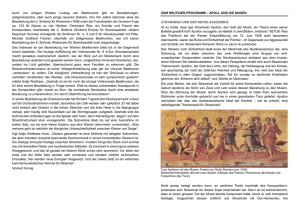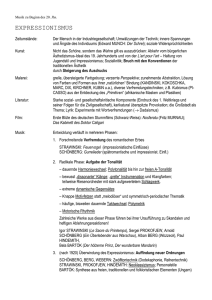Der wunderbare Mandarin Die Entstehung von Béla Bartóks Der
Werbung
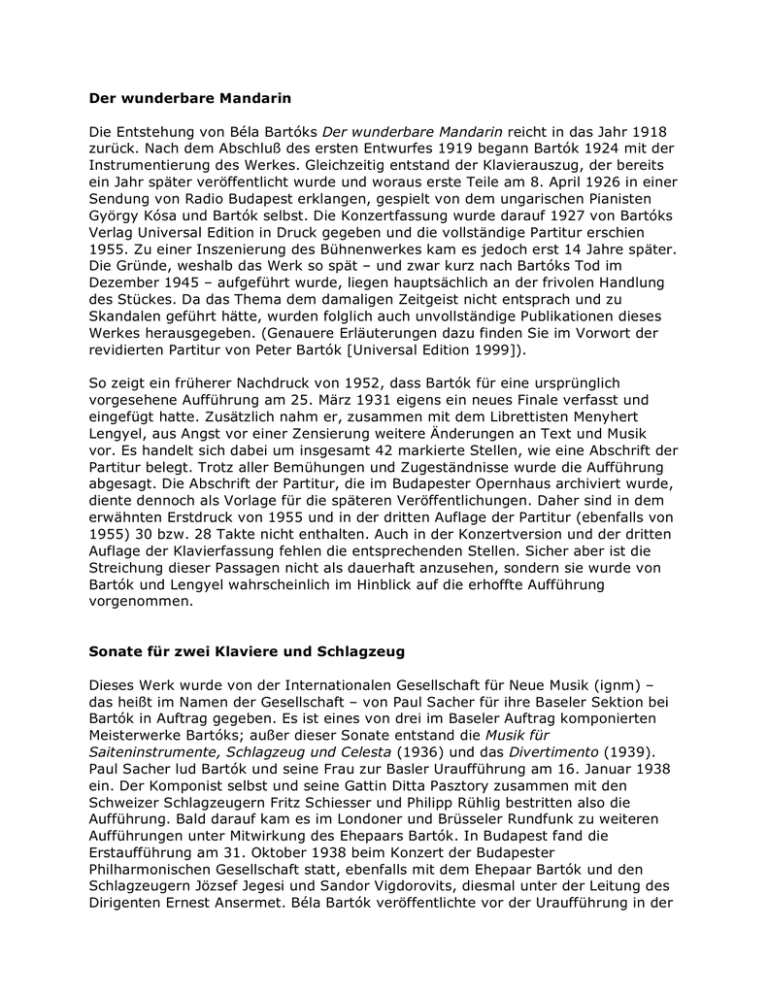
Der wunderbare Mandarin Die Entstehung von Béla Bartóks Der wunderbare Mandarin reicht in das Jahr 1918 zurück. Nach dem Abschluß des ersten Entwurfes 1919 begann Bartók 1924 mit der Instrumentierung des Werkes. Gleichzeitig entstand der Klavierauszug, der bereits ein Jahr später veröffentlicht wurde und woraus erste Teile am 8. April 1926 in einer Sendung von Radio Budapest erklangen, gespielt von dem ungarischen Pianisten György Kósa und Bartók selbst. Die Konzertfassung wurde darauf 1927 von Bartóks Verlag Universal Edition in Druck gegeben und die vollständige Partitur erschien 1955. Zu einer Inszenierung des Bühnenwerkes kam es jedoch erst 14 Jahre später. Die Gründe, weshalb das Werk so spät – und zwar kurz nach Bartóks Tod im Dezember 1945 – aufgeführt wurde, liegen hauptsächlich an der frivolen Handlung des Stückes. Da das Thema dem damaligen Zeitgeist nicht entsprach und zu Skandalen geführt hätte, wurden folglich auch unvollständige Publikationen dieses Werkes herausgegeben. (Genauere Erläuterungen dazu finden Sie im Vorwort der revidierten Partitur von Peter Bartók [Universal Edition 1999]). So zeigt ein früherer Nachdruck von 1952, dass Bartók für eine ursprünglich vorgesehene Aufführung am 25. März 1931 eigens ein neues Finale verfasst und eingefügt hatte. Zusätzlich nahm er, zusammen mit dem Librettisten Menyhert Lengyel, aus Angst vor einer Zensierung weitere Änderungen an Text und Musik vor. Es handelt sich dabei um insgesamt 42 markierte Stellen, wie eine Abschrift der Partitur belegt. Trotz aller Bemühungen und Zugeständnisse wurde die Aufführung abgesagt. Die Abschrift der Partitur, die im Budapester Opernhaus archiviert wurde, diente dennoch als Vorlage für die späteren Veröffentlichungen. Daher sind in dem erwähnten Erstdruck von 1955 und in der dritten Auflage der Partitur (ebenfalls von 1955) 30 bzw. 28 Takte nicht enthalten. Auch in der Konzertversion und der dritten Auflage der Klavierfassung fehlen die entsprechenden Stellen. Sicher aber ist die Streichung dieser Passagen nicht als dauerhaft anzusehen, sondern sie wurde von Bartók und Lengyel wahrscheinlich im Hinblick auf die erhoffte Aufführung vorgenommen. Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug Dieses Werk wurde von der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (ignm) – das heißt im Namen der Gesellschaft – von Paul Sacher für ihre Baseler Sektion bei Bartók in Auftrag gegeben. Es ist eines von drei im Baseler Auftrag komponierten Meisterwerke Bartóks; außer dieser Sonate entstand die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936) und das Divertimento (1939). Paul Sacher lud Bartók und seine Frau zur Basler Uraufführung am 16. Januar 1938 ein. Der Komponist selbst und seine Gattin Ditta Pasztory zusammen mit den Schweizer Schlagzeugern Fritz Schiesser und Philipp Rühlig bestritten also die Aufführung. Bald darauf kam es im Londoner und Brüsseler Rundfunk zu weiteren Aufführungen unter Mitwirkung des Ehepaars Bartók. In Budapest fand die Erstaufführung am 31. Oktober 1938 beim Konzert der Budapester Philharmonischen Gesellschaft statt, ebenfalls mit dem Ehepaar Bartók und den Schlagzeugern Jözsef Jegesi und Sandor Vigdorovits, diesmal unter der Leitung des Dirigenten Ernest Ansermet. Béla Bartók veröffentlichte vor der Uraufführung in der Baseler National-Zeitung am 13. Januar 1938 eine Erörterung über die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug: „Ich hatte schon vor Jahren die Absicht, ein Werk für Klavier und Schlagzeug zu schreiben. Allmählich verstärkte sich indessen in mir die Überzeugung, dass ein Klavier gegen den sehr oft recht scharfen Klang der Schlaginstrumente keine befriedigende Balance ergibt. Infolgedessen änderte sich der Plan insofern, als zwei Klaviere statt einem dem Schlagzeug gegenüberstehen. Als mich im vorigen Sommer die ignm Basel ersuchte, ein Werk für ihr Jubiläumskonzert vom 16. Januar 1938 zu schreiben, nahm ich die Gelegenheit gern wahr, meinen Plan zu verwirklichen.“ Zum formalen Aufbau des Werkes ist Folgendes zu sagen: Der erste Satz hebt mit einer langsamen Einleitung an, die ein Motiv des Allegro-Satzes vorwegnimmt. Der Allegrosatz selber steht in C und hat Sonatenform. In der Exposition wird die zwei Themen (das zweite ist das bereits bei der Einleitung erwähnte) enthaltende Hauptthemengruppe aufgestellt, anschließend folgt das Seiten-(Kontrast-) Thema, aus dem sich ein ziemlich breit ausgesponnener Schlussteil entwickelt, an dessen Ende ab Nachsatz das Kontrastthema nochmals kurz vorbeizieht. Die Durchführung besteht, nach einer kurzen Überleitung mit übereinanderliegenden Quartschichten, im Wesentlichen aus drei Abschnitten. Der erste verwendet – in E stehend – das zweite Thema der Hauptthemengruppe als Ostinatomotiv, über dem die imitatorische Verarbeitung des ersten Themas der Hauptgruppe in Gestalt eines Zwischensatzes vor sich geht. „… Die Reprise hat keinen eigentlichen Schlussteil; an dessen Stelle tritt eine ziemlich ausgedehnte Koda, die (mit einem Fugato-Ansatz) auf dem Schluss- Satzthema aufgebaut ist, zu dem sich zuletzt noch das Hauptthema gesellt … Der zweite Satz in F hat die schlichte Liedform a b a. Der dritte Satz in C stellt eine Verbindung der Rondo- mit der Sonatenform dar. Zwischen Exposition und Reprise erscheint eine von zwei imitatorisch verarbeiteten Teilen des ersten Themas gebildete neue Themengruppe. Mit der im Pianissimo verhallenden Koda schließen der Satz und das Werk.“ In der Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug kommt der „klassische“ Bartók-Stil der dreißiger Jahre zum Ausdruck. Der große Bartók-Kenner Ernö Lendvai hat darauf hingewiesen, dass in der Musiksprache des Werkes, in seiner Anordnung der Tonarten und Harmonien, wie auch im formalen Aufbau eigenartige und strenge Gesetze gelten, die auch in den übrigen großen Bartók-Werken dieser Epoche nachgewiesen werden können: Dazu gehören der Goldene Schnitt als wich tigstes Ordnungsprinzip und die Tonreihen- und Akkordtypen. Innerhalb der Musik tritt der Goldene Schnitt in zwei Formen auf. Zum einen können zwei Töne bzw. ihre Frequenzen zueinander in der Proportion des Goldenen Schnitts stehen. Andererseits kann die Komposition eines Stückes aus Teilen bestehen, deren Längen sich zueinander verhalten wie der Goldene Schnitt. Bartók selbst hat sich allerdings nie zu seinen strukturellen Kompositionsprinzipien geäußert.Im Reichtum der Ideen, der Themen, Klangfarben und -kombinationen und der Gesetzmäßigkeit der Form sowie in der klassischen Ausgeglichenheit dieser Elemente liegt die Kunst Bartóks und seines unverwechselbaren Stils.