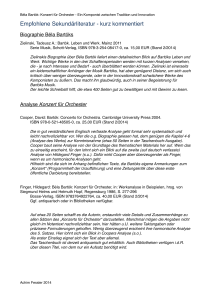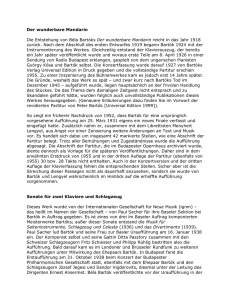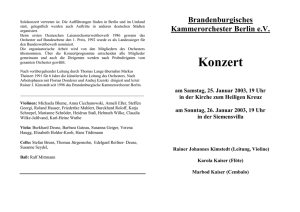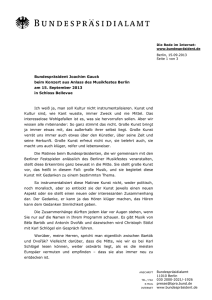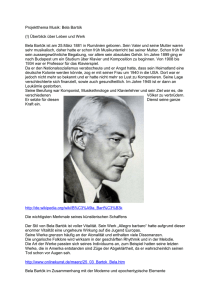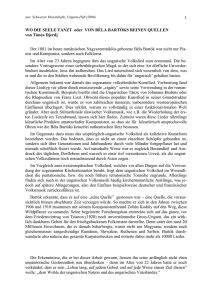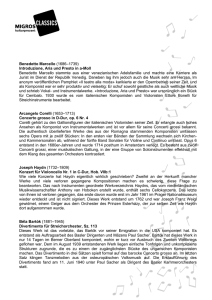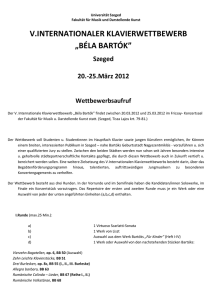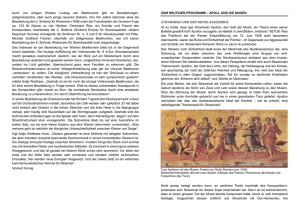Die Vier Orchesterstücke op. 12 wurden 1912 komponiert, aber erst
Werbung

Die Vier Orchesterstücke op. 12 wurden 1912 komponiert, aber erst 1921 für Orchester ausgearbeitet. Uraufführung: am 9. Januar 1922 in Budapest, dirigiert von Bartóks Förderer Ernst von Dohnányi. Reaktion des Freundes und Kollegen Zoltán Kodály: Bartók nehme mit seinem op. 12 deutlich Bezug auf seine beiden Bühnenwerke, Herzog Blaubarts Burg und Der holzgeschnitzte Prinz. »Der Trauermarsch mag als tragisches Nachwort zur Blaubart-Oper, das Intermezzo als sein elegischer Widerhall gelten, Preludio und Scherzo beschwören dagegen das sonnige Reich des Prinzen herauf.« Wie aber erklärt sich die fast zehnjährige Pause zwischen Komposition und Fertigstellung? Béla Bartók schildert in einer 1918 veröffentlichten autobiographischen Skizze, wie ihn bald nach der Jahrhundertwende »das erneute Studium von Liszt« seiner anfänglichen Richard Strauss-Begeisterung entfremdet und zur »Erforschung der bis dahin schlechtweg unbekannten ungarischen Bauernmusik« gebracht habe, mit der »Möglichkeit« am Horizont, sich »von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur- und Mollsystems« vollständig zu emanzipieren. Die Musik, die er damals komponiert, habe »in Budapest selbstverständlich großen Widerspruch « hervorgerufen: weder ein »verständnisvoller Dirigent« noch ein »geeignetes Konzertorchester « wollten sich dafür finden. Folge schließlich, »gegen 1912«: Bartók zog sich vom »öffentlichen Musikleben« zurück. Nach fünf langen Jahren kam er dann doch noch, der kaum mehr erwartete »entschiedene Umschwung «: »Ich hatte das Glück, ein größeres Werk, das Tanzspiel Der holzgeschnitzte Prinz, durch die Fürsorge des Kapellmeisters Egisto Tango endlich musikalisch tadellos aufgeführt zu hören. Im Jahre 1918 brachte er mein älteres Bühnenwerk, den 1911 geschriebenen Einakter Herzog Blaubarts Burg, zur Uraufführung.« Leider aber sei »dieser günstigen Wendung« erst einmal »der politische und wirtschaftliche Zusammenbruch im Herbst 1918« gefolgt. Bartóks Orchesterstücke op. 12 bilden, folgt man der Einschätzung durch Tadeusz Zielinski, »zusammen (ähnlich wie die Fünf Orchesterstücke op. 16 von Schönberg) eine integrale zyklische Form kontrastierender Sätze, die, ohne eine Sinfonie zu sein, wegen des großen expressiven Gehaltes auch nicht eine Suite genannt werden können. Es findet sich sogar eine Verwandtschaft der Motive des ersten und des letzten Satzes.« »Einheitlich« könne man das Opus dennoch nicht nennen. »Zweifellos tritt der zweite Satz, Scherzo, in jeder Hinsicht in den Vordergrund«: Bartóks »Vitalismus« zeige sich da in beispiellos »aggressiver Brutalität und Wildheit«. Das »lyrische Intermezzo« nehme sich dagegen »wie eine Erinnerung an die voraufgehende Schaffensperiode« aus. Ähnlich dürfe das Preludio als ein vielleicht letztes Beispiel »des Bartókschen ›Impressionismus‹« gelten, wenn es auch »an bitonalen Effekten« darin nicht mangle. Erst recht der Trauermarsch, der sich »harmonisch eher in überlieferten Bahnen « bewege, wenngleich er sich »in seiner melodisch-rhythmischen Zeichnung und im Ausdruckstyp« als »ein echtes Werk von Bartók « zeige. Ganz abgesehen davon, dass er, wenn auch wohl nicht so entschieden wie der Marsch in Alban Bergs Orchesterstücken op. 6, das Ohr für die »Schrecken und Katastrophen des Ersten Weltkriegs« zu öffnen scheint… »Es wäre seltsam um uns bestellt, wenn wir alles glauben müßten, solange es sich nicht als unglaubhaft erwiesen hat. Im Gegenteil müssen wir nur das glauben, dessen Wahrheit zweifelsfrei nachgewiesen wurde.« So heißt es, am 11. September 1907, in einem der Briefe Bartóks an die Geigerin Stefi Geyer (die damals schon, folgt man dem Opernkomponisten und Musikkritiker Wilhelm Kienzl, als »eine genial veranlagte Künstlernatur« gelten durfte: »Das liebliche junge Mädchen bringt in der Tat alles mit, was ein musikfreundliches Publikum zu entzücken vermag: eine reizende Erscheinung, kindliche Unbefangenheit, völliges Aufgehen in ihrer Kunst, ein sprühendes Temperament, wie es nur künstlerische Vollblutnaturen besitzen, und nicht zuletzt ein außerordentliches technisches Können. «). In der Wissenschaft – wir sind wieder bei Bartóks Brief – seien Hypothesen »nicht sehr beliebt«, ein jeder erwartete da Beweise. Die Existenz Gottes? Sie werde als »verpflichtende Wahrheit gehandelt, und diejenigen, die sie erfunden haben, glaubten ebenso blind an sie wie die, für die sie bestimmt war. Dabei entdeckt hier schon der nüchterne Verstand einige überaus verdächtige Umstände, die ihr wahrlich zur Genüge entgegenstehen …« Die »gottesfürchtige« Stefi Geyer nun konnte ihre Freundschaft mit einem »Gottlosen« nicht lange aufrechterhalten: am 13. Februar 1908 erklärte sie Bartók brieflich, dass sie keinen weiteren Umgang mit ihm wünsche. Acht Tage zuvor hatte Bartók eine neue Komposition abgeschlossen, das am 1. Juli 1907 begonnene Violinkonzert, das auf Stefi Geyers zweifaches Portrait hinauswollte: »als Mädchen und als Künstlerin«. Den ersten Konzert-Satz überarbeitete Bartok bald und nannte ihn Portrait, das Thema des anspielungsreichen zweiten übernahm er in sein erstes Streichquartett. Als das Portrait am 12. Februar 1911 in Budapest uraufgeführt wurde (vom LandesSinfonieorchester unter László Kun, Solo-Violine: Imre Waldbauer, der mit seinem Quartett damals bereits bevorzugter Interpret der »Neutöner« nicht nur Ungarns war), reagierten die Kritiker unterschiedlich. Géza Csáth war »hingerissen«, lobte die »so diskrete wie entschiedene rationale Note«, befand die »Art des Einsatzes der Solo-Violine« als neuartig und kam zu dem Schluss: »Von diesem Portrait wird noch viel gesprochen und geschrieben werden.« Anders Jenö Ákos Kálmán: »Diese Komposition ist nichts als Zügellosigkeit und Spott gegenüber allem, was Regel heißt, und man spürt aus ihr die Absicht heraus, daß sie das sein will.« Bartók habe sein Können, »anstatt es in einem schön geschliffenen venezianischen Spiegel zu prüfen «, mit einem Hohlspiegel konfrontiert, glaubend, »sein musikalisches Portrait sei, was ihm daraus entgegengrinst«. Bartóks Reaktion? Als hätte ihn Kritiker Kálmán auf eine Idee gebracht, fügte er dem »idealisierenden « ein »verzerrendes« Portrait an: er instrumentierte ein Klavierstück, das im März 1908 entstanden war und das, übrigens, ebenfalls jenes aus drei aufsteigenden Terzen gefügte Motiv verarbeitet, das Bartók in einem Brief an Stefi Geyer als »Ihr Leitmotiv« bezeichnet hat. Das Violinkonzert in seiner originalen Gestalt aber wurde erst, wie Stefi Geyer selber es sich gewünscht hat, nach ihrem Tod uraufgeführt – von Hansheinz Schneeberger und dem Basler Kammerorchester unter Paul Sacher, bei Gelegenheit des siebentägigen BartókFestes in Basel 1958. Uraufführungskritiker Willi Reich: »Was diesem Werk an Geschlossenheit noch abgeht, wird reichlich ersetzt durch den tiefen Einblick, den es in die Werkstatt des Künstlers gewährt.« In seinem »orchestralen Farbenreichtum « könne es im Übrigen neben dem zweiten, »dem meisterlichen Violinkonzert vom Jahre 1938«, »würdig bestehen«. Die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta komponierte Bartók von Juni bis Anfang September 1936 zum zehnjährigen Bestehen des Basler Kammerorchesters. Dirigiert hat Paul Sacher sie erstmals am 21. Januar 1937 in Basel. Und gleich konnte das Echo sich ›hören‹ lassen – aus einem Bericht über eine Aufführung wenig später: »Bartók war der geistige Höhepunkt, alles andere weit überragend. Das Werk hat unter den Musikern (aller Richtungen und aller Arten) eine Begeisterung entfacht, wie ich sie lange nicht erlebt habe. Der Publikumserfolg war sehr stark, dem Orchester wurden Ovationen gebracht, wäre Bartók dagewesen, wäre es wahrscheinlich ein Sensationserfolg geworden.« Endlich wieder ein Stück, das sich weniger konstruktiv denn emotionsgeladen an den Hörer wendet? Bartóks kühle Analyse scheint dem zu widersprechen: Der erste Satz sei »eine Art Fuge, streng durchgeführt«, einem genauen Tonarten-Plan folgend; das Thema beschränke sich gelegentlich auf »Bruchteile«, erscheine ab der Mitte des Satzes »in der Umkehrung«, präsentiere sich in der Coda »in beiderlei Gestalt«. Der zweite Satz orientiere sich an der Sonatenform; in der Durchführung tauche das Fugenthema aus dem ersten Satz wieder auf, »stark verändert«, akkordisch dargeboten jetzt von gezupften Streichern und Klavier; ihm schließe sich ein neues, »imitatorisch« geführtes Thema an, mit dem das Hauptthema des vierten Satzes vorweggenommen sei. Der dritte Satz sei in »Brückenform« gebaut; in seine einzelnen Teile seien die »vier Sektionen« des erneut in Erscheinung tretenden Fugenthemas »eingestreut«. Der vierte Satz, mit einem Form-Schema, das sich manchmal wie ein Rondo, manchmal wie eine Sonate ausnimmt, erinnere sich gegen Ende noch einmal des Fugenthemas, das nun »aus dem ursprünglichen Chromatischen ins Diatonische auseinandergezogen« sei … Bartók, auf diese verbindende Formel hat es seinerzeit der Physiker, Amateur-Geiger und (gleich Bartók) Emigrant Albert Einstein gebracht, »ist vielleicht der einzige, der imstande war, eine Synthese der primitiven und der artistisch differenzierten musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen«.