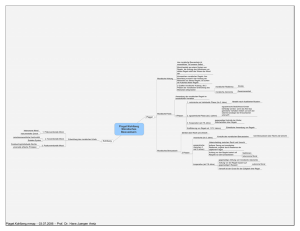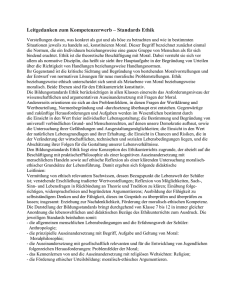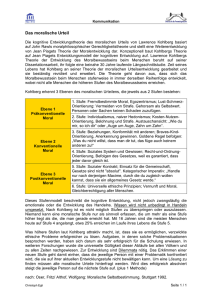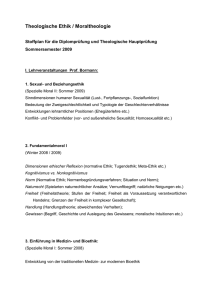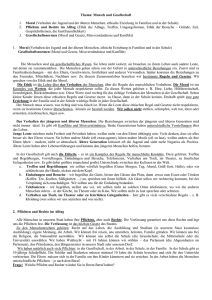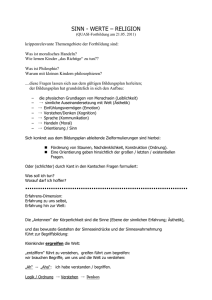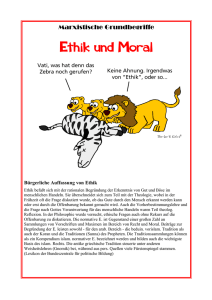Der Stellenwert moralischer Argumente in der Rechtskritik
Werbung

Moral in Rechtskritik 1998-03 / 18.03.1998 in: Wesche/Zanetti (Hg.), Dworkin, Paderborn: Mentis, 1999 Der Stellenwert moralischer Argumente in der Rechtskritik Georg Mohr (Berlin) In den folgenden Ausführungen befasse ich mich mit der Frage, ob und inwieweit die Forderung der Kritisierbarkeit des Rechts voraussetzt, daß moralische Argumente sowohl für die Rechtsetzung als auch für die Rechtsanwendung relevant seien. Mit dieser Frage ist unweigerlich die Diskussion über das Verhältnis zwischen Recht und Moral, zwischen positivem und “überpositivem” Recht angesprochen. Ronald Dworkin hat in diesem Zusammenhang eine einflußreiche Position entwickelt, die sich gegen beide klassischen Kontrahenten, sowohl gegen den Rechtspositivismus als auch gegen die Naturrechtstradition, kritisch abgrenzt (vgl. dazu auch die kurze Einführung in Mohr 1996). Dworkins Theorie der Rechtsprinzipien ist wiederum dem Vorwurf ausgesetzt worden, sie falle hinter die legitimationstheoretischen Errungenschaften des demokratischen Rechtsstaats zurück, da sie zwischen Recht und Moral nicht mehr hinreichend scharf trenne und dadurch sowohl das Prinzip der demokratischen Legitimation als auch die Rechtssicherheit aufs Spiel setze. Ich schlage eine differenzierende Bestimmung des Verhältnisses von Recht und Moral vor, die diesen Vorwurf ausräumt. Demokratischer Rechtsstaat In der neuzeitlichen politischen Philosophie setzt sich zunehmend die Auffassung durch, daß ein rechtlich verfaßtes politisches Gemeinwesen sich als freiwillige Assoziation von Individuen verstehen können soll. Das ist der Grundgedanke der mit Hobbes für die Neuzeit so einflußreich gewordenen und bis in das heutige Demokratieverständnis wirksamen Vertragstheorie des Staates. Bei Hobbes mündet die Theorie des Gesellschaftsvertrags jedoch noch in eine Legitimation absolutistischer Herrschaft. Der Souverän regiert “a legibus solutus”. Recht ist, was der Souverän befiehlt. Seine Machtfülle resultiert aus einer Übertragung aller Rechte der Individuen auf den Souverän. Dabei begründet der Rechtsverzicht der Individuen bei Hobbes die Entbindung des absoluten Souveräns von jeglicher Rechtfertigungspflicht gegenüber seinen Untertanen. Er kann an keinem überpositiven Recht (es möge von noch so hoher moralischer Dignität sein) ge- G. Mohr, Moral und Rechtskritik 2 messen und korrigiert werden. Einzig das individuelle natürliche Recht jedes Menschen − auch des Untertanen − auf Selbsterhaltung bleibt als unveräußerliches Recht stets erhalten und kann unter Umständen gegen den Souverän wirksam werden. Von einer Theorie des Rechtsstaats ist Hobbes‘ Staatsmodell damit aber ebenso weit entfernt wie von einer Demokratietheorie. In einem demokratischen Rechtsstaat hingegen ist das Volk der Gesetzgeber. Das Volk regiert sich selbst. Das ist das Prinzip der Volkssouveränität. Mit ihm überführt Rousseau die Theorie des Gesellschaftsvertrags in eine politische Philosophie der Demokratie. Kant folgt ihm hierin. Eine auf diesem Prinzip beruhende Staatsform nennen beide zwar “Republik” und nicht “Demokratie”. Die Gründe, aus denen sie gegen letztere Vorbehalte haben, können aber hier übergangen werden. Der Sache nach sind Rousseau und Kant Vorläufer von Rawls, Dworkin und Habermas als Theoretiker demokratiebegründender politischer Philosophie. An das Prinzip der Volkssouveränität schließt direkt das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit an, welches die staatlichen Gewalten an Recht und Gesetz bindet. (In Art. 20 GG stehen die Prinzipien der Demokratie bzw. Volkssouveränität und der Rechtsstaatlichkeit übrigens auch im Verfassungstext direkt beieinander.) Die sachliche Nähe beider Prinzipien ist leicht nachvollziehbar. Wenn sich in den Gesetzen nichts anderes als der Wille des Volkes manifestieren soll, dann handeln die ausführenden Gewalten nur dann “im Namen des Volkes”, wenn sie ihrerseits an Recht und Gesetz gebunden sind. Durch diese im Prinzip der Volkssouveränität verankerte Bindung der Amtsgeschäfte staatlicher Gewalten stehen diese unter einem doppelten Legitimationsdruck: (a) Die Ausübung politischer Herrschaft muß sich generell dadurch legitimieren können, daß sie auf die freiwillige Zustimmung der beherrschten Individuen rückführbar ist. (b) Jede Handlung – legislative, exekutive und judikative Handlung – legitimieren können als durch ein Verfahren zustande gekommen und autorisiert, das den Regeln demokratischer Genese folgt. Die Legitimationsforderung beschränkt sich nicht auf die Existenz des Staates überhaupt (wie z. B. Koller 1996 meint), sondern sie gilt für jede staatliche Zwangsmaßnahme. Wenn es nun um die Frage gehen soll, ob und inwieweit die Forderung der Kritisierbarkeit des Rechts voraussetzt, daß sowohl für die Rechtsetzung als auch für die Rechtsanwendung nicht nur rechtliche, sondern auch moralische Argumente relevant seien, dann benötigen wir zunächst einige präzisere Angaben zu G. Mohr, Moral und Rechtskritik 3 den betreffenden Begriffen, vor allem zum Rechtsbegriff. Dieser scheint relativ klar definiert, wenn man sich am gegenwärtig verbindlichen Modell des demokratischen Rechtsstaats orientiert (was ich hier tue). Dagegen sind die Anhaltspunkte für eine Bestimmung des Moralbegriffs wesentlich unschärfer. Dennoch wird man nicht umhinkommen, auch den Moralbegriff näher zu bestimmen. Dies soll hier in erster Linie in Gegenüberstellung zum Rechtsbegriff geschehen. Recht Das Recht begegnet uns als ein Korpus von Verhaltensregeln, die in positiven Gesetzen fixiert und durch eine staatliche Zwangsgewalt durchgesetzt werden. Diese Charakterisierung beinhaltet drei Merkmale. Danach ist eine Verhaltensregel nur dann eine Rechtsregel, wenn sie mindestens drei Bedingungen erfüllt: 1. Sie ist nach bestimmten Verfahrensregeln erzeugt, “positiviert”. 2. Sie ist als inhaltlich fixierte öffentlich bekanntgemacht. 3. Sie wird von einer autorisierten Zwangsgewalt durchgesetzt. Moral Keines dieser drei Merkmale, die alle für den modernen Rechtsbegriff konstitutiv sind, trifft auf die Moral zu. Keine dieser drei Bedingungen ist eine Bedingung dafür, daß wir eine Norm als moralische Norm qualifizieren. Wir können demnach zunächst lediglich einen gegen den Rechtsbegriff abgegrenzten negativen Moralbegriff festhalten: Für eine moralische Norm ist es keine Bedingung, daß sie positiviert ist, veröffentlicht ist und durch eine neutrale Zwangsgewalt durchgesetzt wird. Das reicht uns natürlich nicht, wenn wir wissen wollen, was denn eine Norm im positiven Sinne zu einer moralischen Norm macht. Unter den Begriff von einer Norm, die nicht die Bedingungen einer Rechtsnorm erfüllt, fallen viele Typen von Normen, die weder mit Recht noch mit Moral zu tun haben, angefangen von Konventionen und Bräuchen über Standards und Definitionen bis hin zu Befehlen von Bankräubern u v. m. Sobald wir aber weitere, positive Festlegungen treffen wollen, die den Moralbegriff bestimmen, geraten wir unverzüglich in das “weite Feld” kontroverser Moralkonzeptionen. Es ist nicht meine Absicht, hierüber eine These zu wagen, geschweige denn im Vorfeld ein bestimmtes Verständnis von Moral zu präjudizieren. Stattdessen soll es für die weiteren Zwecke der Überlegungen genügen, vier Bedeutungsmomente des Moralbegriffs zu un- G. Mohr, Moral und Rechtskritik 4 terscheiden, die gerade in der rechtsphilosophischen Diskussion – auf die ich im folgenden die Aufmerksamkeit lenken möchte – immer wieder durcheinandergehen. Unter “Moral” wird verstanden 1. jede Norm, die nicht durch eine autorisierte Instanz nach festgelegten Verfahren positiviert ist, also jede “überpositive” Norm – das ist die bereits eingeführte negative Bedeutung ins Positive gewendet; 2. bestimmte materiale Wertvorstellungen darüber, was moralisch geboten und was moralisch verboten ist, und zwar in dem Sinne eines handlungstypspezifischen Katalogs, der angibt, daß dieses erlaubt, jenes aber verboten, dieses nun wieder verboten, jenes aber geboten sei etc.; 3. unbedingt geltende Normen, deren Geltung unabhängig davon sein soll, ob wer wann die Gültigkeit der Norm für verbindlich erklärt hat, deren Geltung also nicht zur Disposition steht, sondern (gegebenenfalls) im Recht zum Ausdruck kommen soll; 4. allgemeingültige Normen, die überall und zu allen Zeiten gelten, im Unterschied zu Rechtsregeln, die nur in dem Rechtsgebiet Rechtsgeltung haben, für das sie positiviert sind; wenn wir das Tötungsverbot als moralisches verstehen, dann verstehen wir es als universal gültig, egal wo wir uns befinden und mit wem wir es zu tun haben, wohingegen es rechtlich nur gilt, wo es positiviert ist. (Das hindert nicht daran zu akzeptieren, daß es verschiedene, kulturvariante Moralen geben mag.) Moral im Recht Entgegen dem Anschein, den die soweit vorgenommene Abgrenzung von Recht und Moral erwecken könnte, gibt es gute Gründe anzunehmen, daß moralische Kriterien in das Recht Eingang finden dürfen oder sollen. Die Frage, ob und inwieweit es solche Gründe tatsächlich gibt, ist eine der grundlegendsten rechtsphilosophischen Fragen. Nach einer traditionsreichen Überzeugung ist der Grundbegriff allen Rechts und der Inbegriff aller Anforderungen an Recht der Begriff der Gerechtigkeit und dieser ein Gegenstand der Moralphilosophie. Nach dieser Überzeugung gründet Recht daher in Moral und kann sich unabhängig davon nicht legitimieren. Sowohl an einigen Merkmalen der Rechtsetzung als auch an solchen der Rechtsanwendung läßt sich die These, daß Moral auch im Recht wirksam ist, durchaus plausibel machen. G. Mohr, Moral und Rechtskritik 5 Rechtsetzung Wenn es in der Rechtsetzung darum geht zu entscheiden, ob eine Norm Rechtsnorm werden soll, können rein rechtliche Argumente allein nicht ausreichen. Denn, wenn sich diese Norm als Rechtsnorm aus anderen Rechtsnormen ableiten ließe, gäbe es keine inhaltliche Entscheidung mehr zu treffen, sondern kraft Normlogik müßte die fragliche Norm als rechtlich gültig anerkannt werden. Es stellt sich dann nur noch die Frage, ob nicht statt moralischer Argumente auch sozialtechnologische ausreichen, solche Argumente also, die lediglich die Wirksamkeit einer Norm als verhaltenssteuerndes Instrument betreffen. Nun ist es sicher richtig, daß das moderne Recht liberaler Verfassungsstaaten sich aus weltanschaulicher Fixierung lösen will und sich daher zunehmend auf Überlegungen zurückzieht, die lediglich oder doch so weit wie möglich die Vermeidung sozialschädlichen Verhaltens betreffen. Es ist aber ebenso richtig und nach wie vor grundlegend für unser Rechtsverständnis, daß nicht jedes effiziente Mittel schon aufgrund seines Effizienzgrades sich als akzeptable Maßnahme des Rechts qualifiziert. Stets wird eine Maßnahme, die instrumentell effizient erscheinen mag, auch daraufhin befragt, ob sie und ob überhaupt eine Maßnahme auch vertretbar, gerecht sei. (So stellt etwa Hegel in seiner Straftheorie in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, insbes. §§ 99 und 100, sehr deutlich heraus, daß die Frage der Gerechtigkeit allen weiteren, rechtswissenschaftlich traktierbaren Fragen vorgelagert ist und von ihnen vorausgesetzt wird. Vgl. dazu Mohr 1997b) Schon diese Frage der Vertretbarkeit einer Maßnahme, die eine Frage der Gerechtigkeit ist, ist eine moralische Frage. Darüber hinaus ist das Recht auch im Hinblick auf den inhaltlich-normativen Spielraum durch Verfassungsnormen eingegrenzt, die einen moralischen Gehalt und zugleich den Rang von Grundrechten haben. Die grundrechtliche Verankerung der Menschenrechte in Verfassungen ist gewiß ein aussagekräftiger Beleg dafür, daß Merkmale des Moralischen im Recht anzutreffen sind. Und für zahlreiche Gesetze, vor allem des Strafrechts, läßt sich Entsprechendes zeigen. Fazit: Daß das Recht moralisch neutral sei, genauer: daß es moralisch neutral sein könne und solle, scheint daher aus der Perspektive der Rechtsetzung wenig plausibel. G. Mohr, Moral und Rechtskritik 6 Rechtsanwendung Wie stellt sich die Sachlage nun im Bereich der Rechtsanwendung dar? Man sollte zunächst meinen, daß die Anwendung positivierter Rechtsnormen durch interne Regeln juristischer Normlogik hinreichend bestimmt sei. Die Begriffsjurisprudenz ist an dem Versuch, diese Überzeugung stark zu machen, jedoch unwiderruflich gescheitert. Dworkin hat im Zusammenhang seiner Kritik am Rechtspositivismus Harts gezeigt, daß die Rechtsanwendung auf überpositive Prinzipien angewiesen ist. Dies keineswegs nur, um hard cases zu lösen, sondern um überhaupt Gesetze im Sinne der “Absichten des Gesetzgebers und seinen in den Rechtssätzen niedergelegten Wertungen” (Creifelds, S. 152) zu interpretieren und insofern im Sinne geltenden Rechts zu entscheiden. (Diese These hat übrigens auch für Rechtssysteme Bestand, die kein case law angelsächsischen Zuschnitts sind.) Diese in einer Rechtsgemeinschaft geltenden Prinzipien bilden – so Dworkin (1978) und im Anschluß an ihn u. a. auch Habermas (1992) – den Gesamtrahmen moralischer Grundorientierungen der betreffenden Rechtsordnung. In solche Prinzipien gehen nach Dworkin ein die “Implikationen der Geschichte der Gesetzgebung und Rechtsprechung zusammen mit Bezugnahmen auf die Praxis und Vereinbarungen der Gemeinschaft” (Dworkin 1978, S. 76), “sich ändernde, sich entwickelnde und in Wechselwirkung stehende Maßstäbe”, “institutionelle Verantwortlichkeit, Gesetzesauslegungen, die Überzeugungskraft verschiedener Arten von Präzedenzfällen, die Beziehung all dieser Maßstäbe zur gegenwärtigen moralischen Praxis und eine Reihe anderer solcher Maßstäbe” (Dworkin 1978, S. 83). Nur unter Berücksichtigung solcher Prinzipien könne Recht adäquat ausgelegt und angewandt werden. Prinzipien soll sogar soweit geltungskonstitutive Funktion für Rechtsregeln zukommen, daß, wenn keine Prinzipien rechtlich bindend wären und insgesamt verlangten, “zu bestimmten Entscheidungen zu kommen”, man “von keiner Regel oder nur von sehr wenigen Regeln sagen <könnte>, daß sie für Richter bindend sind” (Dworkin 1978, S. 77). Damit verteidigt Dworkin die rechtliche Geltung von Prinzipien, die selbst nicht zum Bestand positiver Gesetze gehören, innerhalb des positiven Rechts und seiner Anwendung. (Vgl. dazu auch die Ausführungen in Mohr 1997a und Mohr 1998a). G. Mohr, Moral und Rechtskritik 7 Rechtssicherheit und demokratische Legitimation Nach einer entgegengesetzten Auffassung sind Recht und Moral strikt zu trennen, da beide ganz verschiedene Geltungskriterien hätten und die Moralisierung des Rechts die Grundfeste des demokratischen Rechtsstaats unterlaufe. Diese Auffassung wird im Gegenzug gegen Dworkins Kritik am Rechtspositivismus eindrucksvoll von Ingeborg Maus vertreten. Sie verbindet rechtspositivistische Grundannahmen mit einer politikphilosophischen Theorie demokratischer Legitimation und stellt so die Frage nach der Beziehung zwischen Recht und Moral in den Kontext einer Grundlagentheorie des modernen Rechtsstaats. Maus‘ Kritik bezieht sich erwartungsgemäß vor allem auf die Expansion des Rechtsbegriffs “über die Grenzen der gesetzten Rechtsregeln hinaus” (Maus 1989, S. 311). Durch die Einbeziehung moralischer Erwägungen in den Rechtsbegriff werde die “Spannung zwischen Sein und Sollen, die einen kritischen Maßstab des Rechts überhaupt erst zuläßt, zugunsten eines eindimensionalen Rechtsbegriffs aufgehoben” (Maus 1989, S. 313). Dadurch werde der Moral das Potential genommen, als Grenze des Rechts zu fungieren. Maus selbst strebt einen Rechtsbegriff und eine Verhältnisbestimmung von Recht und Moral an, die das Recht vor allem im Hinblick auf die Autonomie der Staatsapparate begrenzt. (Ihre Kritik verbindet sie mit Bedenken gegen die Moralisierung des Rechts durch das Bundesverfassungsgericht.) Durch die Engführung von Recht und Moral erhielten Richter einen Freibrief, ihre moralischen und rechtspolitischen Überzeugungen zur Rechtsgrundlage der Urteilsfindung zu machen. An die Stelle demokratisch festgeschriebener Prozeduren der Gesetzeslegitimation trete dann die Situativität richterlicher Entscheidungen. Moralische Argumente würden zum Demokratieersatz, Rechtentscheidungsstäbe wären zu Selbstlegitimation imstande. Dies komme sowohl einer Aufweichung des Grundsatzes der Rechtssicherheit als auch einer Loslösung des Rechts von den prozeduralen Voraussetzungen seiner demokratischen Genese gleich. Die Folge sei eine Aushöhlung des für moderne Rechtsstaaten fundamentalen Prinzips der demokratischen Legitimation des Rechts. Nach diesem Prinzip ist ein Gesetz “schlechterdings an die prozedurale Voraussetzung seiner demokratischen Genese” gebunden. Das demokratische Legitimationsmodell fordert, daß alle und nur diejenigen Gesetze rechtsverbindlich sind, die mit Zustimmung der Volksvertretung positiviert sind (Maus 1989, S. 335). Diese Zustimmung dürfe zudem – so Maus – keine kontrafaktische Idealisierung sein, sondern habe sich in der faktischen Beteiligung der potentiel- G. Mohr, Moral und Rechtskritik 8 len Normadressaten als Normautoren am staatlichen Rechtsetzungsprozeß zu konkretisieren. In diesen müsse eine demokratische Willensbildung aufgrund empirischer Willensäußerungen des Volkes eingehen (Maus 1989, S. 310, 332). Der Grundsatz der Rechtssicherheit artikuliere dementsprechend ein Mittel zum Zweck der Subsumtion der Staatsapparate unter den gesetzgebenden Volkswillen (Maus 1989, S. 290). Allein dieses Legitimationsmodell gewährleistet nach Maus, daß die gesellschaftliche Kontrollfunktion, die einerseits mit der demokratischen Erzeugungsprozedur von Gesetzen und andererseits auf dem Wege moralischer Kritik an der Rechtspraxis ausgeübt werden kann, nicht durch staatliche Entscheidungsinstanzen usurpiert wird. Der Übergriff des Rechts auf die Lebenswelt und der Schwund rechtsfreier Räume wären die Folge. Der faktischen demokratischen Legitimation als Prinzip der Genese von Gesetzen in Verbindung mit der Rechtssicherheit als Prinzip der Anwendung von Gesetzen gebühre daher stets der Vorrang vor moralischen Erwägungen (vgl. Maus 1989, S. 314). Einer gleichrangigen Bindung der Rechtsprechung an Recht und Moral, wie Dworkin sie vertrete, muß nach Maus energisch widersprochen werden (Maus 1989, S. 314). Die “Entdifferenzierung zwischen moralischer Begründung und demokratischer Legitimation” habe unausweichlich antidemokratische Konsequenzen (Maus 1989, S. 332). Maus räumt allerdings ein, daß das Verfahren des staatlichen Rechtsetzungsprozesses “auch durch gerechteste Strukturen niemals automatisch gerechte Ergebnisse garantieren” kann (Maus 1989, S. 336). Sie wendet diesen Punkt jedoch zu einem Argument zugunsten ihrer Trennungsthese. Die “Idee einer moralischen Begründung des Rechts” müsse als “selbständige Perspektive” hinzutreten und dem staatlichen Rechtsetzungsprozeß “entgegengesetzt” werden. Nur als “selbständige Perspektive” bilde diese Idee das notwendige “gesellschaftliche Widerstandspotential”. Die moralische “Endkontrolle”, so lautet das Ergebnis der Ausführungen von Ingeborg Maus, könne “in einem demokratischen System nicht wiederum bei einem Staatsapparat wie einem höchsten Gericht, sondern nur an der gesellschaftlichen Basis liegen, die sich gegen jede Verstaatlichung des moralischen Diskurses wehren muß. Insofern setzt die moralische Kritisierbarkeit demokratisch gesetzten Rechts die Trennung von Recht und Moral gerade voraus” (Maus 1989, S. 336). G. Mohr, Moral und Rechtskritik 9 Fünf Hinsichten des Verhältnisses von Recht und Moral Damit wären wir bei der These angelangt, daß moralische Argumente lediglich in der Rechtskritik, nicht jedoch im Recht selbst (sei es in der Rechtsetzung oder in der Rechtsanwendung) zulässig seien. Um zu dieser These sowie auch zu den durch sie attackierten Auffassungen angemessen Stellung beziehen zu können, schlage ich vor, die Fragestellung zu präzisieren, indem wir zwischen fünf Hinsichten des Verhältnisses von Recht und Moral unterscheiden. Ich meine, daß diese Konsens sind (oder es zumindest so klarerweise sein sollten, daß ich hier für sie nicht mehr argumentieren werde). 1. Recht ist unabhängig von Moral insofern, als Moralgeltung keine Rechtsgeltung begründet, d. h. weder deren notwendige noch hinreichende Bedingung ist. 2. Recht ist unabhängig von Moral insofern, als Moralerziehung nicht die Aufgabe des Rechts ist. 3. Recht ist abhängig von Moral insofern, als Gerechtigkeit eine Grundanforderung an Recht ist. 4. Recht ist abhängig von Moral insofern, als Grundrechte der Verfassung moralisch bestimmt sind. 5. Recht ist abhängig von Moral insofern, als die Genese der Norminhalte des Rechts moralisch imprägniert ist. Wenn die These von Ingeborg Maus nun im wesentlichen auf (1.) und (2.) rückführbar sein sollte, steht sie schlicht in Einklang mit der herrschenden Meinung der gegenwärtigen Rechtswissenschaft. Und auch ihre Auffassung, daß die von ihr herausgestellten Gefährdungen des demokratischen Rechtsstaats nicht wünschenswert sind, kann sicherlich auf breite Zustimmung rechnen. Anders verhält es sich mit ihrer Einschätzung, daß diese Gefährdungen schon dadurch abgewehrt würden, daß man die Moral positivistisch aus der Rechtsetzung und Rechtsanwendung zu eliminieren sucht und lediglich der Rechtskritik vorbehält. Diese Einschätzung ist aus mehreren Gründen unbefriedigend. Ich erläutere dies durch eigene Thesen, die an grundlegende Einsichten Dworkins anschließen. Zwei Dimensionen moralischer Argumentation Erstens: Maus verkennt vor allem, daß auch ein Prinzip wie das von ihr so akzentuierte Prinzip der demokratischen Legitimation letztlich eine moralische Forderung darstellt. Allerdings eine moralische Forderung besonderer Art. Um dies zu G. Mohr, Moral und Rechtskritik 10 sehen, müssen wir den Moralbegriff differenzieren und zwei Dimensionen moralischer Argumentation unterscheiden. Man muß unterscheiden zwischen: 1. konkreten moralischen Wertüberzeugungen, die wie Gesetze bestimmte Verhaltensweisen vorschreiben bzw. verbieten und die für die inhaltliche Ausgestaltung von Rechtsnormen relevant werden können; 2. übergreifenden Bewertungsmaßstäben für die Richtigkeit von Rechtsnormen, die lediglich festlegen, welchen normativen Gestaltungsspielraum es für die betreffende Rechtsordnung gibt; sie explizieren die Forderung der Legitimität und Gerechtigkeit von Normen und Rechtsordnungen als ganzen. Es ist die Unterscheidung zwischen einer “Moral erster Ordnung” – genauer: “Moralen erster Ordnung” – und einer “Moral zweiter Ordnung”. Die Trennung zwischen Recht und Moral, die Ingeborg Maus mit dem Rechtspositivismus fordert, muß auf den ersten Moralbegriff beschränkt werden. Die Entmoralisierung des Rechts in diesem Sinne erlaubt die Entlastung der Mitglieder einer Rechtsgemeinschaft von weltanschaulichen, moralischen und religiösen Bekenntnissen. Dies ist die Grundlage für die Ablehnung des Fundamentalismus. Das heißt aber nicht, daß Recht in einem moralischen Vakuum operierte. Es ist immer mit einer Pluralität von Moralen konfrontiert, sowohl innerhalb eines Staats als auch zwischenstaatlich. Zu diesem Pluralismus kann sich das Recht als Regelungsmedium verhalten, das die kooperative Anerkennung individueller Lebenspläne, sozialer Interessen und kultureller Identitäten gewährleistet. Zweitens: Eine Moral zweiter Ordnung ist ausschlaggebend nicht nur für die Rechtskritik, sondern auch für die Rechtsetzung und Rechtsanwendung. Sie ist ausschlaggebend für eine Rechtskultur im ganzen. Eine Rechtskultur ist der in einer Rechtsgemeinschaft sich manifestierende Inbegriff der normativen Grundorientierungen ihrer politisch-rechtlichen Vergesellschaftung. Diese stellen lediglich die Rahmenbedingungen der Institutionalisierung und der Verhaltensnormierung in der betreffenden Kultur dar. Dabei sind sie keine abstrakt-deduktiv gewonnenen Prinzipien, sondern Produkte historisch geronnener praktischer Vernunft. In sie gehen historische Erfahrungen ein, moralische Traditionen mit ihrem geistesgeschichtlichen Entwicklungszusammenhang, die Herausbildung von Errungenschaften sozialer Kämpfe um Anerkennung sowie auch philosophische bzw. philosophiehistorische Modelle eingehen. Sie treten auf in bestimmten historischen Konstellationen in bestimmten Gesellschaften bzw. Kulturräumen. Sie bilden dann einen historisch situierten Ausgangspunkt aller weiteren Begründungen (vgl. Larmore 1993, S. 327; vgl. auch Lüderssen 1996, Kap. I). Sie sind im G. Mohr, Moral und Rechtskritik 11 “Kontext bestimmter Weltdeutungen und Lebensformen” zu sehen (vgl. Habermas 1992, S. 376; zum Begriff der Rechtskultur, vgl. Mohr 1997a, 1998a und 1998b). Drittens: Aus der Verschränkung des Moralbegriffs zweiter Ordnung mit dem Recht zu einer Rechtskultur folgt als solcher noch keine antidemokratische Aushöhlung des Rechtsstaats. Viertens: Pauschal läßt sich darüberhinaus über Trennung oder NichtTrennung von Recht und Moral nicht befinden. Es muß wenigstens nach den oben eingeführten fünf Hinsichten differenziert und für jede dieser Hinsichten im einzelnen begründetermaßen festgestellt werden, wie sich Recht und Moral jeweils zueinander verhalten. Moral und Rechtskritik Auch in der Rechtskritik gilt im übrigen nicht jedwedes moralische Argument. Nur ein solches Argument kann Berücksichtigung beanspruchen, das kategorial auch für die Rechtsetzung und Rechtsanwendung relevant sein kann. Dworkin hat dieser Anforderung durch seine Theorie der Rechtsprinzipien wie auch durch seine Auffassung von Integrität im Recht (vgl. Dworkin 1986, Kap. 6 und 7) entsprochen. An Dworkin anknüpfend läßt sich feststellen, daß sich Kritik am Recht daher stets auf jene Grundsätze der Moral zweiter Ordnung beziehen muß, die von Haus aus ineins auch Grundsätze rechtlich verfaßter sozialer Beziehungen sind. Keinesfalls kann der Stellenwert moralischer Argumente darin bestehen, moralische Normen erster Ordnung gegen Rechtsnormen auszuspielen. Der begriffliche Sinn von Moral, allgemeingültig zu sein, spiegelt sich ja in der Regel nicht in einem faktischen Moralkonsens wider. Über die Geltung moralischer Normen gibt es faktisch immer Meinungsverschiedenheiten, die durchaus auch vernünftige Meinungsverschiedenheiten sein können, d. h. solche, die nicht auf bloßen Informationsmangel oder auf mangelnden Willen zur Einsicht in das beste Argument zurückzuführen sind. Auch innerhalb einer normativen Kultur kann es solche Meinungsverschiedenheiten und dementsprechend eine Pluralität von Moralen geben. Das Recht hingegen kann nur dasjenige juridisch von den Normadressaten fordern, was seinen normativen Rahmenbedingungen entsprechend faktisch allgemein zustimmungsfähig ist und den Willen der Normautoren als Autoren dieser Rechtsgemeinschaft repräsentiert. Zwar können materiale Wertvorstellungen qua Moral erster Ordnung aufgrund der tendenziellen (in Verfassungs- G. Mohr, Moral und Rechtskritik 12 grundnormen vom Staat geforderten) Weltanschauungsneutralität liberaler Verfassungs- und Rechtsstaaten nicht ausschlaggebend sein für die Rechtsetzung, eine strikte pauschale Trennung von Recht und Moral aber ist illusorisch und inadäquat. Literatur Creifelds, Carl (1990), Rechtswörterbuch, 10., neubearb. Aufl., München: Beck Dworkin, Ronald (1978), Taking Rights Seriously, Cambridge/Mass.: Harvard University Press, 1978; dt. Bürgerrechte ernstgenommen, übs. v. Ursula Wolf, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984; zitiert nach der dt. Übs. Dworkin, Ronald (1986), Law’s Empire, Cambridge, Mass.: Harvard University Press Habermas, Jürgen (1992), Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt/M.: Suhrkamp Koller, Peter (1996), “Grundlagen der Legitimation und Kritik staatlicher Herrschaft”, in: Grimm, Dieter (Hg.), Staatsaufgaben, Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 739–769 Larmore, Charles (1993), "Wurzeln radikaler Demokratie", in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41, S. 321–327 Lüderssen, Klaus (1996), Genesis und Geltung in der Jurisprudenz, Frankfurt/M.: Suhrkamp Maus, Ingeborg (1989), "Die Trennung von Recht und Moral als Begrenzung des Rechts", in: Rechtstheorie 20, S. 191ff.; wiederabgedruckt in und zitiert nach: dies., Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992, S. 308−336 Maus, Ingeborg (1996), "Zum Verhältnis von Recht und Moral aus demokratietheoretischer Sicht ", in: Politik und Ethik, hg. v. Kurt Bayertz, Stuttgart: Reclam, S. 194–227 Mohr, Georg (1996), “Rechtsphilosophie”, in: Philosophie. Problemfelder und Disziplinen, hg. v. Franz Gniffke und Norbert Herold, Münster: Lit, S. 35–59 Mohr, Georg (1997a), “Der Begriff der Rechtskultur als Grundbegriff einer pluralistischen Rechtsphilosophie”, in: Dialektik 1997/1, S. 135–140 Mohr, Georg (1997b), “Unrecht und Strafe (§§ 82–104, 214.218–220)”, in: G.W.F. Hegel – Grundlinien der Philosophie des Rechts, hg. v. Ludwig Siep, Berlin: Akademie Verlag Mohr, Georg (1998a), “Die Idee der Integrität einer Rechtskultur”, in: Dialektische Philosophie, Bd. 10: Geschichtsphilosophie und Ethik, hg. v. Domenico Losurdo, Bern/Frankfurt a. M.: Lang Mohr, Georg (1998b), “Gerechtigkeit als Angemessenheit”, in: Angemessenheit, hg. v. Barbara Merker, Georg Mohr und Ludwig Siep, Würzburg, S. 145−159 G. Mohr, Moral und Rechtskritik 13 Englisches Abstract In my paper I raise the question if and in how far we must presuppose moral arguments when we critizise the law. In modern societies every institution and especially the law has to legitimate its existence and its procedures. Hence, legislation and interpretation of law (the executive) are submitted to the demand of critique and legitimation which often turns out to be moral argumentation. This leads to the general question about the relation between law and morals, between positive and “transpositive” law. Dworkin has developped a theory of principles which can be understood as neither identical with legal positivism nor with natural rights theories. This theory has been critizised for abandoning the separation of law and morals which is said to be characteristic for modern democratic societies and to be a necessary condition of the democratic legitimation of the law without which a legal judgement would be simply arbitrary. I propose a differenciated view of the relation between law and morals which defends the Dworkian theory against this attack.