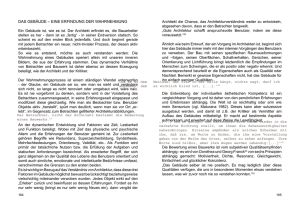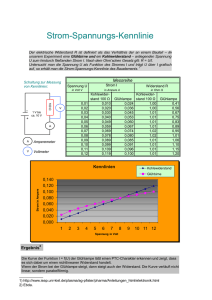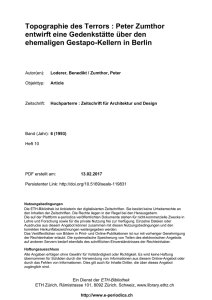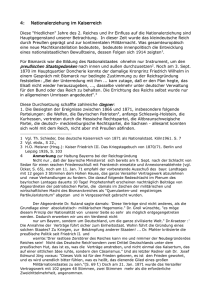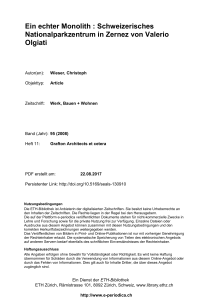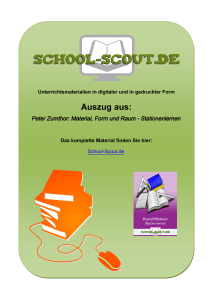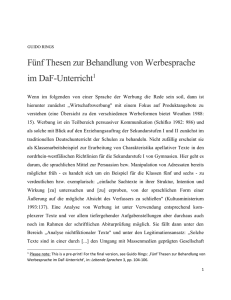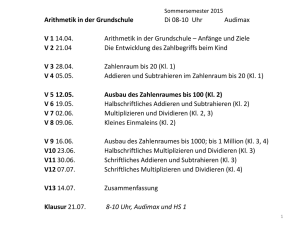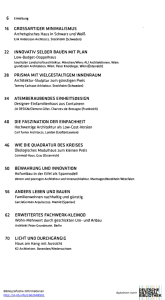region als konstrukt
Werbung

REGION ALS KONSTRUKT Weiterentwicklung des Individuums verhindern. Eine Region besteht aus seinen Individuen - aus einzelnen Orten, den Gebäuden, die den Ort bilden und den Menschen, die die Häuser bewohnen. Es sind keine Kennzeichen, es sind die besonderen Beziehungen, die eine Einheit erzeugen. In Graubünden ist es womöglich die Kommunikationsbereitschaft, die dazu führte, dass eine bestimmte Baukultur entstehen konnte, indem sie nicht verhindert wurde. Die Entwicklung der neuen Bündner Architektur wurzelt wahrscheinlich bei Rudolf Olgiati und Bruno Giacometti (dem Bruder des Bildhauers Alberto). Ähnlich der aktuellen Anti-Globalisierungsbewegung wollten damals beide der Anonymität der Moderne mit einem regional orientiertem Bauen begegnen. Das heißt, man bezog sich auf die Moderne und stellte damit die Verbindung zu einer „externen Welt“ her, gleichzeitig war man sich aber bewusst, dass Probleme nicht allgemein, sondern nur unter den gegebenen Bedingungen gelöst werden können, weil die Verwirklichung einer Idee immer von der Struktur in dem Moment abhängt. Die verlief nämlich prinzipiell anders - das „Bündner Haus“, als statisches und unveränderliches Modell, gab es nicht, wie Olgiati dokumentierte. Erstens waren die Bautypen von Tal zu Tal verschieden, zweitens haben sie sich ständig verändert. Die verschiedenen Einflüsse und Traditionen wurden auf nicht-triviale Weise im Prozess verarbeitet. So hat sich z.B. das Fehlen eines rechten Winkels wesentlich klarer als Merkmal des Engadinerhauses herauskristallisiert, als eine bestimmte Fassadengestaltung. Das Zusammenspiel von Topographie, Erschließung, Sicht zum Brunnen und zum Besitz haben einen rechten Winkel nie entstehen lassen. Die Fassade ist Summe der Nutzungsfunktionen - Sockel und Küche in Stein, Stube in Blockbau, die Scheune aus Rundhölzern. Dementsprechend haben sie in Material, Größe und Lage differenziert. Und als Folge davon mussten sie sich auch ändern, als zum Beispiel die Scheune verschwand. Das Individuum wurde also nicht der Spezies untergeordnet, sondern generierte sie erst. Man vergleiche hier die Statik von Definitionen mit der Statik von „Stil“. So wie der Stuhl sich über seine Funktion, seinen Gebrauch („wenn man darauf sitzen kann“) definiert und seine Form sich ständig ändern kann (er muss nicht zwingend ein Möbelstück mit vier Beinen sein), so ändert sich regionale Baukultur mit seiner Funktion. Das Festhalten an einem Stil ist nur Ausdruck eines Bedürfnisses nach einer statischen Ordnung, die es nicht gibt. Das ist das Problem der Neuerung - es ist für einen systeminternen Betrachter sehr schwer bis unmöglich, sich eine Welt außerhalb oder verschieden von der vorzustellen, die er sich aufgebaut hat (vgl. Berger, Luckmann, 1966). Olgiati suchte nach der dynamischen Stabilität der Dinge, statt sich auf starre Definitionen einzulassen. Was hätte es auch heute für einen Sinn, kleine Fensteröffnungen zur formalen Regel zu machen, wenn sie ursprünglich durch den hohen Fensterglaspreis und kalte Winter bedingt waren. Heute haben wir wärmetechnisch komplett neue Voraussetzungen und Licht und Sonne wurden durch einen veränderten Lebenswandel wichtiger - die Modifikation des Schemas wurde notwendig. Rudolf Olgiati wurde 1910 in Chur geboren, studierte Architektur in Zürich und zog nach Flims, einem bekannten Wintersportort mitten in Graubünden, wo er auch die meisten Arbeiten ausführte. Ähnlich wie Zumthor kam er nicht aus dem Ort, wo er arbeitete und den Großteil seines Lebens verbrachte. Olgiati, der bedeutende internationale Auszeichnungen für seine alpine Architektur bekam, kritisierte die Moderne dafür, traditionelle Bauweisen zu verdrängen, um die neue Architektur zu etablieren. Diese „Deformation“ der internationalen Moderne glich die Schweiz so aus, dass sich ein Heimat- und Landistil in mehreren Varianten bemerkbar machte. Auf der einen Seite waren diese Bezeichnungen positiv besetzt, da damit der Widerstand gegen die Verstädterung der Landschaft und die Industrialisierung des Lebensraumes, den Historismus und die Moderne gemeint war. Andererseits war es eine regressive, konservierende Bewegung, die sich in einer volkstümlichen Architektur niederschlug, die „typische Ausdrucksformen“ festzulegen versuchte. Und daraus entstanden Architekten wie Olgiati und Giacometti, die wiederum diesem Phänomen entgegenwirkten. Sie meinten, die sogenannten „typischen Stilmerkmale“ wären ähnlich dogmatisch wie die Moderne. Sie würden eine Spezies formen und damit die 142 Die tatsächliche Ausformung eines Baus ist jedoch nicht nur nach funktionellen und ökonomischen Gesichtspunkten ausgerichtet, sondern auch nach traditionellen. 143 So zeigte sich germanischer Einfluss bei der Verwendung von Holz oder bei der zerstreuten Siedelungsform und der romanische in der Steinarchitektur, sowie einer dichten Siedlungsstruktur. Im Norden entwickelte sich daher die Holzarchitektur, im Süden wurde der Steinbau bestimmend. Ich würde diese Beibehaltung aber weniger als Geschichtsbewusstsein bezeichnen, sondern als einfacheren Weg. Nachdem z.B. die Germanen diese Bauweise relativ gut entwickelt hatten, war es einfacher, Techniken von ihnen zu übernehmen, als alles selbst zu erfinden, und dort wo Veränderungen sinnvoll waren, passierten sie sowieso. Heute noch finden sich zentrale Prinzipien in Rudolf und Valerio Olgiatis, Bearth und Deplazes’ und vielleicht auch Zumthors Entwürfen. Es handelt sich dabei um folgende Gemeinsamkeiten: Das Engadinerhaus zeigt sich als Steinmasse, also nicht in einzelnen Wandflächen, sondern als gesamtes Volumen. Diese Wirkung unterstützen die schräg eingeschnittenen Festerleibungen, das geringe Dachgefälle und der schmale Dachvorsprung, um rein der obere Abschluss des Volumens zu sein, oder das Fehlen einer Fassadengliederung, um die Fassade nicht zu zerteilen und damit den Körper in seiner Gesamterscheinung zu stören. Rudolf Olgiati meint, „daß Architektur durch die Sinne, nicht durch den Intellekt wahrgenommen wird.“16 So wie nicht-triviale Maschinen, die auch nur synthetisch determiniert, bzw. beobachtet werden können, nicht aber analysiert. Dass er ein fantastischer „Synthetisierer“ war, zeigt seine Architektur. Die umgrenzenden Mauerschalen schützen die Bewohner im Inneren, die Volumina bleiben erkennbar. Durchgänge sind als Wölbungen beziehungsweise Bögen ausgeformt, um die Mauerschale nicht zu brechen und das Gebäude im Boden, im Ort zu verankern. Die Fenster sind meist annähernd quadratisch, um ja nicht die Schale zu zerschneiden, wie es Schlitze tun würden. Außerdem sind sie nicht regelmäßig angeordnet, um die Auflösung der Einheit in vertikale Säulen und horizontale Bänder zu verhindern. Entsprechend dem Engadinerhaus wird jede Öffnung getrennt, seiner Funktion entsprechend behandelt, und - auch ein wesentliches Merkmal aller weiterer Beispiele - seine Architektur ist von Gegensätzen geprägt. Harte, dunkle Dachflächen stehen im Kontrast zu den weißen Prismen, oder ruhige Flächen zu konzentrierten Öffnungen - alles mit dem Ziel 145 der Entspannung, Befreiung, Lösung - so Olgiati. Das Bedürfnis des Menschen nach gegensätzlichen Wahrnehmungen, dürfte in seiner eigenen Dualität liegen. Rudolf Olgiati hat damit scheinbar von den fertigen Gebäuden zurück zu den Bildern gefunden, also wie von den Sätzen wieder zu den Erfahrungen. Und er hat auch neue Sätze, oder fast eine Art neue Sprache entwickelt. Den Grundbau dieser Sprache akzeptiert er und baut daraus neue Bedeutungen. Gelbes Haus, Valerio Olgiati Flims, CH Ähnliches lässt sich am Gelben Haus in Flims verfolgen, das sein 1995-1999 Sohn Valerio Olgiati nach seinem Tod umbaute. Es ist das älteste Haus von Flims - aus den 1870er Jahren, das Rudolf Olgiati vor dem Abriss schützen wollte, aber nie eine Genehmigung für den Umbau bekam. In seinem Nachlass verfügte er, seine regional ausgerichtete kulturhistorische Sammlung der Gemeinde zu vermachen, wenn das Haus in seinem Sinne zu einem kulturellen Zentrum umgebaut und weiß gestrichen würde. Das passierte dann auch durch seinen Sohn, der ebenfalls in Zürich studiert hatte. An diesem Gebäude lässt sich direkt verfolgen, wie die Bestandteile einer Architektur durch neue Bedingungen differenzierte Interaktionen entwickeln mussten und sich selbst neu definierten. Die Grundmauern blieben stehen, aber man schlug den Putz von den Fassaden, bis nur mehr die rohen Mauerschalen übrig blieben. Diese wurden dann weiß gekalkt, wodurch sie Konstruktion, Risse, Wunden und Eingriffe erst recht freilegten. Olgiati entfernte auch Balkon, Giebel, Dach und Sprossenfenster– es blieb nur mehr das Grundgerüst, das in ein neues Satzgefüge eingepasst werden musste, um seine gewandelte Bedeutung zu bekommen. Die Fensterlaibungen der fast quadratischen Öffnungen wurden betoniert, das sehr flache Dach aus weiß gestrichenen Schieferplatten auf die betonierte Attika ohne Vorsprung gelegt. Es entstand der Eindruck eines blendend weißen Kubus, den Olgiati im Altbau „gefunden“ hat. Aber es ist nur scheinbar ein Würfel, so wie auch die Fenster nur beinahe quadratisch sind - der Grundriss ist trapezförmig, die Fenster 146 sind etwas höher als breit und die Dachkante ist geneigt. Die Wirkung des „ausgehöhlten Hauses“ verstärkte er, indem er die Innenmauern mit einer vorgesetzten Holzkonstruktion um zehn Zentimeter nach innen verlegte und die Fenster bündig anordnete. Das ganze Gebäude ist von „unperfekten“ Proportionen gekennzeichnet. Die Holzbalkendecken werden von einer exzentrisch angeordneten Stütze und der First von einer vertikal geknickten, ebenso exzentrischen Stütze getragen. Alles ist radikal weiß gestrichen, ganz dem Nachlass folgend, nur die Holzböden sind unbehandelt. Eigentlich ist der ganze Bau von extremer Radikalität geprägt, die ihn damit auch in einen größeren schweizerischen Kontext bringt. Die Fenster sind perfekt bündig, das Weiß schneeweiß, Fußleisten fehlen natürlich, Sockelbereich gibt es auch keinen, neue Bauteile sind aus Sichtbeton, die Mauern noch dicker als von Natur aus und alle Materialien so pur wie möglich eingesetzt. Das Verhältnis Alt-Neu wurde nicht nur in der eigenen Geschichte des Gebäudes neu hergestellt, sondern auch im örtlichen Umfeld. Das raue Mauerwerk verweist auf die Felsen im Hintergrund, und zusammen mit dem historistischen und dem Blockbau-Nachbarn bildet es eine einzigartige Einheit - alles (wie üblich bei neuer Bündner Architektur) genauestens reflektiert - und zwar in der umfassenden Bedeutung dieses Wortes (siehe Abb.) - so dass man an Zufälle kaum mehr glauben kann. Das Gelbe Haus stellt für sich ein autopoietisches System dar. War es zuerst eine Einheit, deren Zusammenhalt durch seine Bestandteile erzeugt wurde und damit auch diese in ihrer Bedeutung bestimmte, so wechselte mit den neuen Beziehungen, die die Bestandteile ermöglichten, deren Wahrnehmung. Man kann das System in einem größeren Kontext auch als allopoietisch, also von außen verursacht sehen. Die Deformationen, die das Gebäude von außen erfuhr, wie neue Funktionsanforderungen, Umwelteinflüsse, die den Verfall begünstigten, neue Anschauungen etc. musste es in inneren Prozessen, in denen der Architekt zum Bestandteil wurde, möglichst effektiv ausgleichen. Diese Gesamtveränderung des Gebäudesystems wirkte dialektisch zurück auf sein Umfeld und war damit an einem Wandel des Metasystems Ort beteiligt. Es ist unwahrscheinlich, dass mehr als 30 Bauten von Rudolf Olgiati und ein markantes Gebäude wie das Gelbe Haus (es heißt noch immer 149 so), das noch dazu an einem bedeutenden Platz der Durchzugsstraße ins Vorderrheintal, steht, keinen nachhaltigen Einfluss auf die zukünftige Architekturentwicklung haben soll. Besonders, da das strahlend weiße Haus genug öffentliche Diskussionen provoziert hat. Man könnte die Beschmierung der Rückseite („Nur ein gebildeter Idiot baut einen Betonklotz in die Gegend“) ja fast so auslegen, dass das Gebäude in eine direkt verbale Kommunikation tritt. Es wird nicht nur bemerkt, es löst auch Reaktionen aus. Dass das System aber nicht regressiv in diesem Dialog reagiert, zeigt die Auswahl des Wettbewerbentwurfs von Valerio Olgiati für ein neues Restaurant am Caumasee, einem türkisblauen Gebirgssee bei Flims. Es ist ebenso radikal, ebenso poetisch, ebenso pur und schärft wiedereinmal die Sinne - für den Wandel der Natur und der Jahreszeiten im Zusammenspiel mit der Architektur. Aber das tut es natürlich ganz anders - nur die Vorgangsweise ist ähnlich, die Verwirklichung muss eine radikal neue sein. Da in der Schweiz das Volk entscheidet, muss man in Flims von einer fundamentalen Bereitschaft ausgehen, Architektur als lebenden und nicht konservierenden Teil der Gesellschaft zu akzeptieren und sogar zu fördern. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal zurück in die Zeit gehen, als Olgiati und Giacometti bekannt wurden - es war auch die Zeit, als Peter Zumthor als Architekt der kantonalen Denkmalpflege seine Tätigkeit in Graubünden aufnahm. Seine ersten Entwürfe, wie ein Café-Ausbau in Vella, zeugen von Olgiatis Einfluss. Er knüpft damit erstens an die Geschichte an, zweitens - was noch viel wichtiger ist - startet er mit seiner Tätigkeit eine völlig neue. Dadurch, dass er für die Siedlungsin ventarisierung und Bauberatung der Dörfer zuständig war, legte er die Grundlagen für die heutigen Bedingungen, auf denen nicht nur er seinen Erfolg später aufbauen konnte, sondern auch seine jüngeren Kollegen. Und diese Verflechtungen reichen sogar noch weiter - die meisten der heute in Graubünden bauenden Architekten haben in seinem Büro „gelernt“. Es ist also nicht verwunderlich, dass Bearth und Deplazes’ Bauten Elemente Zumthors phänomenologischer Denkweise mit dem von Olgiati dokumentierten Engadinerhaus vereinen. 150 Schulhaus Vella, Valentin Bearth + Andrea Deplazes CH Zum Beispiel bei ihrer Schule in Vella - eine Gemeinde im ValVella, Lumnezia, 1994-1997 dem Tal des Lichts, das für seine außerordentlich hohe Anzahl an Sonnentagen (auch im Winter) bekannt ist. Es handelt sich dabei um einen Um- und Ausbau eines Schulhauses aus den 1950er Jahren. Erblickt man zum ersten Mal den Komplex, wirkt er durch seine strikte, einfache und glatte Form fremd und abweisend. Bei näherer Betrachtung fängt aber jede Detaillösung an, sich mit seiner Umgebung zu verweben. Statt den Ort von einem großen Volumen dominieren zu lassen, entschied man sich dafür, die Funktionen auf vier einzelne Gebäude aufzuteilen. Auf diese Weise ordnen sie sich den umgebenden Volumina unter, integrieren den Bestand und inszenieren gezielte Ausblicke aufs Tal. Die strahlend weiß gestrichenen, trichterförmigen Fensterlaibungen, die sich markant von der erdiggrauen Fassade abheben, stehen nicht nur formal in Zusammenhang mit der Plastizität des Engadinerhauses, sondern vor allem mit der Ausnützung der Sonnentage. Die Abschrägungen der großformatigen Fensteröffnungen nach Süden verlängern die Einstrahldauer und nützen im Winter zusammen mit den umgekehrt aufgehängten Lamellenstores, die die Strahlen auf die Decke umlenken, die passive Sonnenenergie. Dieses innovative Energiekonzept, das sich auf das simple Prinzip der Kombination von effektiver, außenliegender Wärmedämmung mit möglichst viel unverkleideter Masse im Inneren gründet, erspart eine Heizung. Gleichzeitig vereinigt es das traditionelle Sinnbild einer Decke - nämlich die Rippendecke der Bündner Stube - mit dem Baustoff Beton und erfüllt dadurch drei Funktionen - die Speicherfläche wird verdoppelt, die dazwischenliegenden Neonröhren bekommen einen Blendschutz und durch ihr asymmetrisches Profil kann auch der Nachhall geregelt werden. Jede Entscheidung ist mehrfach motiviert - unter diesem Aspekt muss auch die Sachlichkeit, mit der der Bau nach außen auftritt und die so oft Schweizer Architektur nachgesagt wird, betrachtet werden. Letztendlich ist es die konsequente Rückführung regionaler Merkmale auf deren Ursprung - die Erhaltung eines kompakten Volumens, das durch die Fenstereinschnitte, den nicht vorhandenen Dachvorsprung, Material und 153 Farbe unterstützt wird. Und da Bauen im Bündnerland Leidenschaft bedeutet, muss noch auf die feinen Extras verwiesen werden - die scheinbar geschlossene Hoffassade kann durch Flügeltüren die dahinterliegende Bühne in ein Freilufttheater verwandeln. Dasselbe macht das ganze Gebäude, indem es durch seine zurückhaltende Perfektion das Alpenpanorama zum Schauspiel macht. In der Beschränkung auf das Wesentliche besteht die eigentliche Poesie des Gebäudes. Die Verbindung zu und durch Zumthor ist immer wieder spürbar. In Vella wurde z.B. Valser Gneis als Bodenbelag verwendet - eine ökonomische Entscheidung, weil es der Restposten der Therme Vals war, gleichzeitig zeugt es aber vom Respekt Zumthors Können gegenüber. Auch Jürg Conzett entstammt Zumthors Büro. Er stellt eine zusätzliche Ebene des Bündner Netzwerks dar - das Ingenieurbüro Conzett, Bronzini + Gartmann ist an der Tragwerksplanung von einem Großteil der Bauvorhaben der letzten Jahre beteiligt. So hat Conzett z.B. an der Strickbauweise in Vrin und Duvin mit Gion Caminada mitgewirkt. Gesamtprojekt Vrin, Gion Caminada Vrin, CH Vrin gehört zu den am Besten erhaltenen und noch bewohnten Orten der 1991-... Alpen, da er einfach zu arm war, um sich weiterzuentwickeln. Das Dorf blieb vom Tourismus und der Moderne verschont. Auf einer Höhe von 1.445 Meter liegt Vrin am Ende einer engen, 25 Kilometer langen Zufahrt an einer schmalen Hangterrasse. Die Landwirtschaft ist nach wie vor die vorherrschende Beschäftigung, und das Ortsbild wird daher von Bauernhöfen dominiert. Ein Drittel der Bevölkerung arbeitet aber außerhalb Vrins. Aufgrund der Abwanderung, die mit dem Bauernsterben einsetzte, kämpfte der Ort wie alle Bergbauerndörfer ums Überleben. Mit nur mehr 260 Einwohnern unterschritt er weit die kritische Grenze. Durch das Zusammenspiel von glücklichen äußeren Umständen und zielführender, innerer Kommunikationsbereitschaft kann er aber heute mehr Geburten als Todesfälle verbuchen und wurde damit zum Ausflugsziel zahlreicher 154 Agrarspezialisten, Soziologen und Architekten. Oberhalb von Vrin befindet sich ein natürlicher Skulpturengarten, die Greina, der durch die Errichtung eines Staudamms in den 1980er Jahren zerstört worden wäre. Das konnte verhindert werden, dem Dorf, das durch den Verkauf reich geworden wäre, muss der Bund dafür jährlich Entschädigungen zahlen. Die ökonomische Autonomie, die Vrin dadurch erreichte, nahm es zum Anlass, eine Strategie zu entwickeln, den Ort zu retten. Das Zusammenwirken aller (Politiker, Wirtschafter, Bauern, Architekt) führte und führt zum Ziel, obwohl die Lage noch nicht völlig stabilisiert ist. Auf politischer Ebene legte man zunächst fest, Land billig an Bauwillige abzugeben, die sich im Gegenzug dazu verpflichten müssen, es 25 Jahre lang nicht zu verkaufen. Zusammen mit dem Ausbau der Schule führte das zum Zuzug junger Familien. Mit Hilfe eines Schweizer Agrarspezialisten wurde ein wirtschaftliches System des Direktmarketing ausgearbeitet. Das Vieh wird seitdem nicht mehr zu schlechten Preisen ins Tal verkauft, sondern direkt vor Ort zum Qualitätsprodukt Bündner Fleisch verarbeitet. Die Rinder werden in Vrin geschlachtet, das Fleisch gekühlt, getrocknet und selbst vermarktet. Auf diese Weise bleibt die Arbeit und die Wertschöpfung im Ort, was dazu führte, dass es auch den Bauern ideell und materiell nicht wegzog. Die Veränderung der Lebensbedingungen bewirkte auch religiöse Verschiebungen. Der Dialog zwischen säkularem und profanen Bereich wird immer bedeutender - eine Totenstube wurde gebaut. Die Architektur entstand im Schnittpunkt dieser geistigen und materiellen Ressourcen - es ging also nicht um Vorzeigebauten, sondern um die Entwicklung im Alltäglichen, im ganz Gewöhnlichen. Gion Caminada, „der Architekt“ des Dorfes und selbst Bauernsohn, begann eine Schreinerlehre im Ort, schloss die Kunstgewerbeschule ab und studierte danach Architektur als Nachdiplom auf der ETH Zürich, wo er heute als Professor lehrt. Die Totenstube ist ein von ihm initiiertes Projekt, das die Kluft zwischen alten Traditionen und modernem Wohnen überbrücken soll. Wurde früher der Tote drei Tage im Haus aufgebahrt und von allen verabschiedet, so ist dafür in den heutigen Wohnungen weder der Wille noch der Platz 157 vorhanden. Das Sterben wurde abstrakt und damit vor allem jüngere Generationen diesem Prozess entfremdet. Die Totenstube bringt den Toten aus dem privaten in einen öffentlichen Bereich. Es ermöglicht auf ähnliche Weise eine Verabschiedung, bei der der Tote noch Teil der Gesellschaft ist. Den Rest des Jahres ist das Gebäude für Lebende gedacht - ähnlich dem Ritual des Fensteröffnens nach der Trauerzeit, um das Leben wieder herein zu lassen. Ganz bewusst steht es direkt neben der Kirche, aber doch außerhalb der Friedhofsmauern. Dass Caminada als Architekt vor allem die Erhaltung und Weiterentwicklung Vrins verfolgt, beweist er, indem er für Einwohner bewusst Spezialpreise macht und auch die Beschaffung der Kredite besorgte. Der Schulum- und -ausbau ist eine weitere Maßnahme - sie ermöglicht, dass die Kinder nicht in die Stadt müssen und stellt eine wesentliche Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen dar. In einer Hanglange wie dieser könnte nirgends außer auf einem befestigten Sportplatz Fußball gespielt werden. Gleichzeitig wurde eine Strategie ausgearbeitet, auf die neuen landwirtschaftlichen Bedingungen zu reagieren und planlose Zersiedelung zu verhindern. Ausbauten sollten im Sinne einer Wiedervereinigung von Haus, Stall und Gemüsegarten erfolgen. Neubauten und Erweiterungen passieren am unmittelbaren Ortsrand, und anstatt großer landwirtschaftlicher Anlagen werden Abfolgen mehrerer kleiner Ställe geplant. Der Architekt als gesellschaftlicher Motor, der im Spannungsfeld von ökonomischen und ideellen Interessen arbeitet. Zum Beispiel das Schlachthaus. Für den Sockel- bzw. Erdgeschossbereich wurden die scheinbar unbrauchbaren Steine der unmittelbaren Umgebung verwendet, für das Obergeschoss Holz, das auch billig, abgabenfrei und reichlich in nächster Nähe vorhanden ist. Beide Materialien prägen das Ortsbild und integrieren dadurch das Gebäude, das sich am Ortsrand befindet. Das Material ist es auch, das die Bevölkerung einbezieht. Es wird durch das Wissen um den Gebrauch gewählt und doch frei von jeder überlieferten Bedeutung verwendet. 158 Für die neuen Ställe hat Caminada seit 1996 ein eigenes „StrickbauSystem“ entwickelt, basierend auf dem Prinzip der horizontalen Schichtung der traditionellen Blockbauweise. Es besteht aus dem Grundelement eines aus Holzbalken gefertigten Rahmens von 1,25 m auf bis zu 12 m. Diese werden übereinander geschichtet, an der Ecken verbunden, innen mit Spanplatten, die auch als Aussteifung dienen, und außen mit den üblichen rohen Brettern verkleidet. Die Bauern können Material und Konstruktion verstehen, die Handwerker damit umgehen, und die Arbeit bleibt im Ort. Die Motivation ist hoch Schreiner und Schlosser sind bemüht, möglichst alles selber zu machen. Und ein zusätzlicher Nutzen für den Architekten ergibt sich wie von selbst durch die Einbindung der ortsansässigen Arbeiter - der Bau wird schneller akzeptiert, sogar bei denen, die nicht direkt daran beteiligt „Für mich ist Architektur dann angemessen, wenn sie zur sind. Normalität wird, wenn sie versucht, die Bedürfnisse ihrer Zeit zu respektieren: eine Architektur, die alles umfasst, von sozialen und ökonomischen Aspekten bis zu ästhetischen Fragen.“17 Es ist der konkrete Ort mit seinen Bedingungen, der die Kriterien für die Qualität von Architektur vorgibt. Vrin z.B. verträgt nicht viele Veränderungen. Es geht um den Schutz einer Kulturlandschaft, die an lokalen Traditionen orientiert ist und gleichzeitig den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden muss, also frei von Sentimentalität ist. Ein Neubau soll sich als solcher zeigen, trotzdem aber mit seinem Umfeld eine Einheit formen. Diese Einheit wird immer wieder unter dem Begriff des Ortsbilds zusammengefasst. Es handelt sich dabei aber nicht um eine objektivierbare Tatsache, sondern stellt unter der interessensgesteuerten Wahrnehmung ein ständiges Konstrukt dar. Der Städter sucht die Ausblicke auf die Natur, die Weite und Ruhe, der Bauer Intimität, Nähe „Wenn der neue Stall funktioniert, hat der und Geschlossenheit. Bauer auch nichts gegen Ästhetik.“18 Zwei Schulbauten, Gion Caminada + Conradin Clavuot Duvin + St.Peter, CH Ähnlich wie in Vrin legte bei zwei weiteren Schulneubauten der Ort die 1994-1995 + 1994-1998 Ausgangsbedingungen fest. Beide Projekte entwickelten den Blockbau weiter, beide blieben unspektakulär, aber qualitativ anspruchsvoll, und beide gehen wieder auf eine Zusammenarbeit mit Conzett zurück. 160 In Duvin hat Caminada durch eine eigens entwickelte Holz-BetonVerbunddecke die Spannweiten des Strickbaus mit neun Metern ausgereizt. Dadurch konnte er neue Anforderungen wie große Fensteröffnungen in einer Konstruktion verwenden, die sich aus der Tradition entwickelte, ohne sie nachzuahmen. Daher vereint die Schule sich auch wie selbstverständlich mit dem benachbarten Gemeindehaus in Fachwerkbauweise und der Steinkirche zu einer neuen Einheit. Das Schulhaus in St. Peter von Conradin Clavuot fügt sich in ein ähnlich sensibles Gefüge ein. Das Gebäude erscheint wie die Abstraktion eines Blockhauses, dessen Reinheit durch die Perfektion der Details unterstrichen wird. Durch den geringen Aufwand in Material und Konstruktion (beides integrierte wieder die lokalen Ressourcen) konnte die schmale Budgetierung, die ebenso eine Gemeinsamkeit der neuen Bauten in Graubünden ist, eingehalten werden. Wenn Architektur autopoietisch organisiert ist und sich selbst durch seine Beziehungen herstellt, dann führte auch das dichte persönliche Netzwerk in Graubünden zur Entwicklung der Qualität. Obwohl es der größte Kanton der Schweiz ist, konnte man eine Kommunikation aufbauen, die so effektiv war oder ist, dass es möglich wurde, eine langfristige Wirkung allgemein und die Erneuerung der Dorfkultur speziell zu bewirken. Immerhin kennt man sich entweder aus Zumthors „Werkstätte“, über Olgiati, den gemeinsamen Statiker Conzett, hat zusammen in Zürich studiert oder lehrt heute miteinander an der Accademia di Architettura di Mendrisio. Dass sich daraus ein System der Kooperation statt der Konkurrenz entwickelte (zumindest scheint es aus der Außenperspektive so), war zwar nicht zwingend, offensichtlich aber zielführend. Region wird zum Konstrukt der Individuen, zur Erfindung seiner Subjekte. © Forenbacher, Marlies. Das Wahrnehmen wahrnehmen. Nicht-Triviale Maschinen in den Alpen. Diplomarbeit, Technische Universität Graz: 2004. 163 Berger/ Luckmann 1966, S.174. Ebda. S.44f. 3 Ebda S.114ff. 4 Gnaiger, Architektur Aktuell Nr.233/234 1999, S.83. 5 Ebda. S.89. 6 Berger/ Luckmann 1966, S.112. 7 Gnaiger, Architektur Aktuell Nr.233/234 1999, S.85. 8 Berger/ Luckmann 1966, S.142. 9 Gnaiger, Architektur Aktuell Nr.233/234 1999, S.85. 10 Berger/ Luckmann 1966, S.64. 11 Conzett, Baumeister Nr.9 2000, S.70. 12 Ebda. S.70. 13 de Weck, „Alles Geordnet, Total Radikal“, in: GEOspecial Nr.2 2002, S.28ff. 14 Gernhardt/ Bernstein/ Waechter, in: Watzlawick/ Krieg (Hg.) 1991, S.139. 15 Hubeli, „Austauschbare Bilder“. http://www.welt.de/daten/2002/07/23. 16 Boga 1977, S.13. 17 Originalzitat: “For me, an appropriate architecture is one that adjusts to normality, one that seeks to respect the needs of its time: an architecture that embraces everything, from the social and economic aspects through to the aesthetic issues.”, Caminada, 2G Nr. 14 2000, S.139. 18 Killmeyer, GEOspecial, Nr.2 2002, S.86. 19 in Anlehnung an von Foersters Zitat „Der Hörer, nicht der Sprecher bestimmt die Bedeutung einer Aussage.“, „2 x 2 = grün“. Audio CD 1, Titel 2. 20 Franck/ Franck, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.47. 21 Frisch 1964, S.203. 22 Ebda. S. 200f. 23 Franck/ Franck, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.42ff. 24 Zumthor 1999, S.18. 25 Franck/ Franck, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.44. 26 Ebda. S.44. 27 Holz, werk, bauen + wohnen Nr.7/8 2002, S.11. 28 Ebda. S.14. 29 Ebda. S.14. 30 Fromm, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.40 f. 31 Franck/ Franck, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.47. 32 Franck/ Franck, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.47. 33 Zumthor, DETAIL Nr.1 2001, S.20. 34 Conzett, http://www.nzz-x.ch/folio/archiv/2001/06/articles/interview.html. 35 Zumthor 1999, S.14. 36 Ebda. S.57. 37 von Foerster, „2 x 2 = grün“. Audio CD 2 Titel 2. 38 Zumthor 1999, S.57. 39 Zumthor 1999, S.38. 40 Zumthor, DETAIL Nr.1 2001, S.21. Zumthor 1999, S.43. Ebda. S. 8. 43 Zumthor, Daidalos Nr.68 1998, S.93. 44 Ebda. S.93. 45 Zumthor, DETAIL Nr.1 2001, S.23. 46 Ebda. S.30. 47 Ebda. S.36. 48 Ebda. S. 58. 49 Ebda. S.10. 50 Ebda. S.18. 51 Ebda. S.30. 52 Ebda. S.17. 53 Zumthor, in: Grönlund 1997, S.11. 54 Ebda. S.36. 55 Ebda. S.10. 56 Achleitner, Architektur Aktuell Nr. 202 1997, S.78. 57 Ebda. S.78. 58 Zumthor 1999, S.57. 59 Ebda. S.25. 60 Conzett, Baumeister Nr. 9 2000, S.71. 61 Conzett, Zuschnitt Nr.2, 2001, S. 20ff. 62 Conzett, Baumeister Nr. 9 2000, S.71. 63 Franck/ Franck, Der Architekt Nr.1/2 2002, S.47. 64 Ebda. S.44. 65 Maturana 1991, S.190. 66 Zumthor 1999, S.60. 67 Meili, Archithese Nr.1 2003, S.6. 68 von Foerster, in: Lynn 1986, S.2. 1 41 2 42 218 219