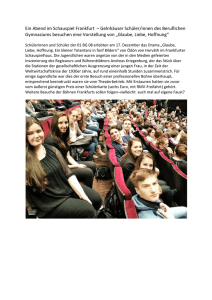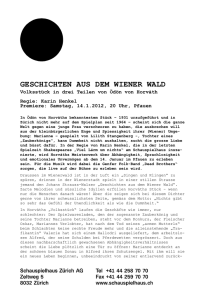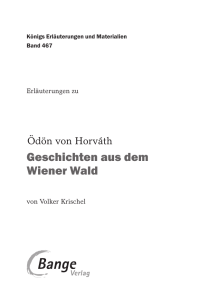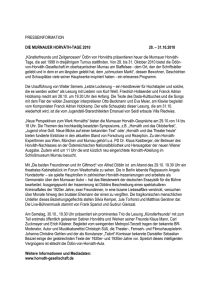Karl Müller, Salzburg „Die Jagd nach dem Glück“ – „Totenstille“. Zu
Werbung
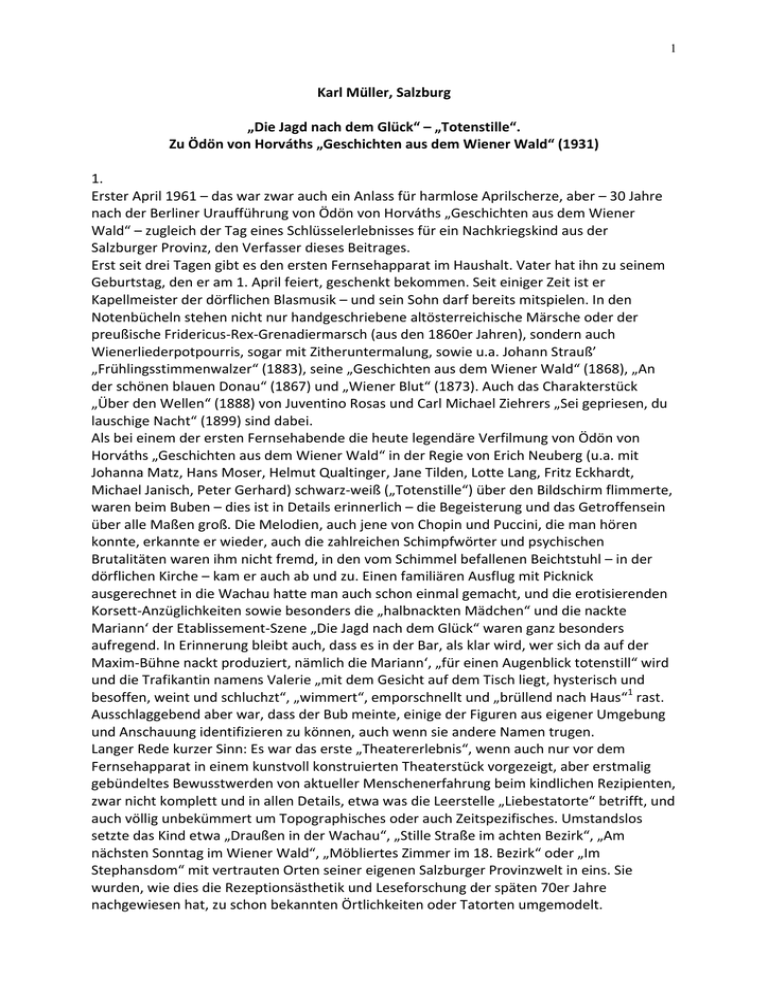
1 Karl Müller, Salzburg „Die Jagd nach dem Glück“ – „Totenstille“. Zu Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (1931) 1. Erster April 1961 – das war zwar auch ein Anlass für harmlose Aprilscherze, aber – 30 Jahre nach der Berliner Uraufführung von Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ – zugleich der Tag eines Schlüsselerlebnisses für ein Nachkriegskind aus der Salzburger Provinz, den Verfasser dieses Beitrages. Erst seit drei Tagen gibt es den ersten Fernsehapparat im Haushalt. Vater hat ihn zu seinem Geburtstag, den er am 1. April feiert, geschenkt bekommen. Seit einiger Zeit ist er Kapellmeister der dörflichen Blasmusik – und sein Sohn darf bereits mitspielen. In den Notenbücheln stehen nicht nur handgeschriebene altösterreichische Märsche oder der preußische Fridericus‐Rex‐Grenadiermarsch (aus den 1860er Jahren), sondern auch Wienerliederpotpourris, sogar mit Zitheruntermalung, sowie u.a. Johann Strauß’ „Frühlingsstimmenwalzer“ (1883), seine „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (1868), „An der schönen blauen Donau“ (1867) und „Wiener Blut“ (1873). Auch das Charakterstück „Über den Wellen“ (1888) von Juventino Rosas und Carl Michael Ziehrers „Sei gepriesen, du lauschige Nacht“ (1899) sind dabei. Als bei einem der ersten Fernsehabende die heute legendäre Verfilmung von Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in der Regie von Erich Neuberg (u.a. mit Johanna Matz, Hans Moser, Helmut Qualtinger, Jane Tilden, Lotte Lang, Fritz Eckhardt, Michael Janisch, Peter Gerhard) schwarz‐weiß („Totenstille“) über den Bildschirm flimmerte, waren beim Buben – dies ist in Details erinnerlich – die Begeisterung und das Getroffensein über alle Maßen groß. Die Melodien, auch jene von Chopin und Puccini, die man hören konnte, erkannte er wieder, auch die zahlreichen Schimpfwörter und psychischen Brutalitäten waren ihm nicht fremd, in den vom Schimmel befallenen Beichtstuhl – in der dörflichen Kirche – kam er auch ab und zu. Einen familiären Ausflug mit Picknick ausgerechnet in die Wachau hatte man auch schon einmal gemacht, und die erotisierenden Korsett‐Anzüglichkeiten sowie besonders die „halbnackten Mädchen“ und die nackte Mariann‘ der Etablissement‐Szene „Die Jagd nach dem Glück“ waren ganz besonders aufregend. In Erinnerung bleibt auch, dass es in der Bar, als klar wird, wer sich da auf der Maxim‐Bühne nackt produziert, nämlich die Mariann‘, „für einen Augenblick totenstill“ wird und die Trafikantin namens Valerie „mit dem Gesicht auf dem Tisch liegt, hysterisch und besoffen, weint und schluchzt“, „wimmert“, emporschnellt und „brüllend nach Haus“1 rast. Ausschlaggebend aber war, dass der Bub meinte, einige der Figuren aus eigener Umgebung und Anschauung identifizieren zu können, auch wenn sie andere Namen trugen. Langer Rede kurzer Sinn: Es war das erste „Theatererlebnis“, wenn auch nur vor dem Fernsehapparat in einem kunstvoll konstruierten Theaterstück vorgezeigt, aber erstmalig gebündeltes Bewusstwerden von aktueller Menschenerfahrung beim kindlichen Rezipienten, zwar nicht komplett und in allen Details, etwa was die Leerstelle „Liebestatorte“ betrifft, und auch völlig unbekümmert um Topographisches oder auch Zeitspezifisches. Umstandslos setzte das Kind etwa „Draußen in der Wachau“, „Stille Straße im achten Bezirk“, „Am nächsten Sonntag im Wiener Wald“, „Möbliertes Zimmer im 18. Bezirk“ oder „Im Stephansdom“ mit vertrauten Orten seiner eigenen Salzburger Provinzwelt in eins. Sie wurden, wie dies die Rezeptionsästhetik und Leseforschung der späten 70er Jahre nachgewiesen hat, zu schon bekannten Örtlichkeiten oder Tatorten umgemodelt. 2 Carl Zuckmayer, der Horváth 1931 die Zuerkennung des Kleist‐Preises verschaffte, erkannte, dass das Faszinosum, das von Horváths besten Stücken ausging, mit der überzeugenden „künstlerische[n] Umschmelzung seines Weltbildes“ zu tun hatte – mit der „Dichtigkeit der Atmosphäre, [der] Sicherheit knapper Profilierung, [der] lyrische[n] Eigenart des Dialogs“, mit Horváths „Kunst der Menschen‐ und Wortgestaltung“ – „sein Blick ist eigenwillig, ehrlich, rücksichtslos.“2 Aber davon wusste der Knabe damals natürlich gar nichts und hatte keine entsprechenden Worte für sein Fasziniertsein, geschweige denn, dass er irgendetwas über Horváth, jene „typisch alt‐österreichisch‐ungarische Mischung“3 in Erfahrung gebracht hätte, welche sich „unter allen Umständen zum deutschen Kulturkreis“4 zählte, sich aus Protest gegen die Zumutungen nationalistischer und sonstiger Borniertheiten seiner Zeit zugleich seiner inter‐ und über‐nationalen „Heimatlosigkeit“5 rühmte und der Auffassung war, dass seine Stücke eine „Bilder“‐Folge präsentieren, „die den Kampf des Bewusstseins gegen das Unterbewusstsein zeigen“ 6 sollen. Vater sollte jedenfalls 1961 in seinem Tagebuch anspielungsreich notieren: „K. fragt: Ist das wahr? Meine Oma hätte mich doch nicht umbringen wollen, oder?“ Im Tagebuch heißt es weiter: „Wegen dieser alten Zitherspielerin [die Großmutter] und des Metzgers [Oskar] mit dem Messer hat er sich gefürchtet, aber er kennt sie alle schon, sagt er, auch die Trafikantin [Valerie], den Liebhaber im weißen G’wand [Alfred] und den Pfarrer/Beichtvater. Beim letzten Schul‐Beichten sind auch einige Frauen angestanden, sagt er. Ich frage nicht wer. Ich hätte ihm die Geschichte vom Hias [Tubist in der Blaskapelle, Metzger und Bauer, wahrscheinlich KZ‐Aufseher] nicht erzählen sollen [Stiefeltritte auf Kinderköpfe im leeren Wasserkübel]. […] Im Programm steht, dass der Stückeschreiber 1938 von einem Baum erschlagen worden ist – in Paris. [37jährig, 1901‐1938] Damals war ich noch bei der HJ – dann auch in Frankreich – Feldzug 1940. Pariser Mädls.“ 2. Als Horváth in den Jahren zwischen 1929‐1932 mit seinen heute bekanntesten Stücken, alle aus der mittleren Phase seines Schaffens – „Italienische Nacht“ (Süddeutsche Kleinstadt um 1930), „Kasimir und Karoline“ (Münchener Oktoberfest in unserer Zeit), „Glaube Liebe Hoffnung“ (vor einem Anatomischen Institut, vor einem Wohlfahrtsamt, möbliertes Zimmer, Polizeirevier), aber ganz besonders mit seinen „Geschichten aus dem Wiener Wald“ – erste große Anerkennung und zugleich heftige Ablehnung erfuhr, bevor ihn das NS‐Regime seiner Arbeitsmöglichkeiten beraubte und ihn 1936 aufforderte, Bayern sofort zu verlassen, wo er seine Eltern in Possenhofen und München7 besuchen wollte, und bevor er schließlich am 13. März 1938 aus Österreich floh –, nahm er theoretisch über seine Sichtweisen, seine Anliegen, zu seinem Schreiben, zur „künstlerische[n] Umschmelzung seines Weltbildes“ (Carl Zuckmayer 1931) Stellung. Er tat dies allerdings ungern, denn weshalb sollte er auch erklären, was ohnehin auf der Hand lag: „Ich hatte mich bis heute immer heftig dagegen gesträubt, mich in irgendeiner Form über meine Stück zu äußern – – nämlich ich bin so naiv gewesen, und bildete es mir ein, dass man […] meine Stücke auch ohne Gebrauchsanweisung verstehen wird.“ 8 Er äußerte sich in einigen wenigen aufschlussreichen Reflexionen, etwa in einem „Interview“ im Bayerischen Rundfunk (mit Willy Cronauer vom 5.4.1932) oder eben in seiner „Gebrauchsanweisung“ (November 1932 nach der Uraufführung von „Kasimir und Karoline“), auch in seiner „Randbemerkung zu ‚Glaube Liebe Hoffnung’“ sowie einigen „Autobiographischen Notizen (auf Bestellung)“ (Programmheft der Uraufführung von „Revolte auf Cote 3018“ am 4.11.1927, Hamburger Kammerspiele. In: Der Freihafen. Blätter der Hamburger Kammerspiele 10, 1927, H. 3).9 3 Bei Horváth heißt es lapidar und erhellend: „Im Theater findet […] der Besucher zugleich das Ventil wie auch Befriedigung (durch das Erlebnis) seiner asozialen Triebe. […] Was geht denn da vor, wenn nicht ein durchs Miterleben mitgemachter Mord? Die Leute gehen aus dem Theater mit weniger asozialen Regungen heraus, wie hinein. (Unter asozial verstehe ich Triebe, die auf einer kriminellen Basis beruhen – – und nicht etwa Bewegungen, die gegen eine Gesellschaftsform gerichtet sind – – – ich betone das extra, so ängstlich bin ich schon geworden, durch die vielen Mißverständnisse). Dies ist die vornehme pädagogische Aufgabe des Theaters.“10 Horváth hatte es also in dieser Phase seines Schreibens nicht auf politische Revolutionierung abgesehen11, sondern nahm mit seinen analytischen Röntgenaugen hauptsächlich den Menschen, den sozial, psychisch und biologisch geprägten zeitgenössischen Anthropos in seinen „Lebens‐ und Todeskämpfen“ in Form von „Schlachtszenen“, wie man die „neuen Volksstücke“ in dieser Phase genannt hat, ins Visier, insbesondere den Spießer und seine sprachlichen Erscheinungsweisen, seine unbewussten Selbst‐Entblößungen und unbekümmert ausgelebten asozialen Triebe: „Demaskierung des Bewußtseins“12, wie sich Horváth ausdrückte. An anderer Stelle heißt es: „Wie in allen meinen Stücken versuche ich möglichst rücksichtslos gegen Dummheit und Lüge zu sein, denn diese Rücksichtslosigkeit dürfte wohl die vornehmste Aufgabe eines schöngeistigen Schriftstellers darstellen, der es sich manchmal einbildet, nur deshalb zu schreiben, damit die Leute sich selbst erkennen. Erkenne dich bitte selbst!“13 Aber großes Vertrauen hat er nicht, dass er dazu essentiell beitragen bzw. dass dies gelingen könnte. Es wird klar, dass Horváths Beobachtungs‐, Denk‐ und Schreib‐Kosmos auf dieses aufrecht gehende Menschentier als ein vulkanisches Treibhaus im Dauer‐Konflikt mit dem Ordnungs‐Bewusstsein, d.h. dem Gehörigen, dem Erlaubten, dem Sittlichen, konzentriert ist. Für den erst mit sechs Jahren Deutsch lernenden und mit hoher Sprachsensibilität ausgestatteten Horváth wird dies besonders anhand der gesprochenen, verräterischen Sprache „heutiger Menschen“ fassbar: „Und um einen heutigen Menschen realistisch schildern zu können, muß ich ihn also dementsprechend reden lassen.“14 Er habe aber – so Horváths prinzipiell skeptische Einstellung, die sich in seinen Stücken um 1930 widerspiegelt – ein gebrochenes Verhältnis zu etwaigen positiven Entwicklungspotentiale seiner „Gestalten“, die keine „sozialen Wesen“ werden könnten. Deswegen gebe er als „dramatischer Chronist“ in Form des „neuen“ Volksstückes immer eine „Synthese von Ernst und Ironie“15 – also: interessierte Zuneigung zu den Menschen und zugleich skeptische, aber keineswegs parodistische Distanz: „Die Parodie lehne ich als dramatische Form ab. Parodie hat meines Erachtens mit Dichtung gar nichts zu tun und ist ganz billiges Unterhaltungsmittel.“16 Horváth spricht von der „heroische[n] und feige]n] Art des Kampfes“, was ja „nur […] ein Formproblem der Bestialität“17 darstelle und seine literarischen Repräsentationen bestimmen. Er hat Sigmund Freud studiert und dessen Skeptizismus internalisiert. Dazu kommt, dass Horváth seine Beobachtungen exemplarisch an der neuen Klasse der „Angestellten“, des „neuen Mittelstandes“, der sich im Zuge der kapitalistischen Entwicklung zwangsläufig herausbilde, zeigt. Die Horváth‐Forschung hat deswegen wiederholt auf die geistige Nähe zu Siegfried Kracauers empirischer kultursoziologischer Studie „Die Angestellten“ (1930) aus dem „neuesten Deutschland“ hingewiesen.18 Horváths „neues Volksstück“ liefert gewissermaßen die theatrale Vergegenwärtigung und Versinnlichung von Kracauers Erkenntnissen, u.a. die beklemmende Dialektik zwischen sozioökonomischer 4 Depraviertheit und ideologischer Verblendung in der Klasse des neuen „Kleinbürgertums“ und dessen massenhafter Erscheinungsform in Form des zeitgemäßen Soziotypus des Spießers. Der erste „erbauliche Roman“ Horváths sollte denn auch den Titel „Der ewige Spießer“ (Propyläen‐Verlag/Ullstein‐Gruppe 1930) tragen und enge Bezüge zu seinen „Geschichten aus dem Wiener Wald“ aufweisen – also über diesen modernen, gerade im Werden befindlichen „hypochrondrischen Egoist[en]“, der danach trachtet, sich „überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet.“ (Vorwort) Dieser Soziotypus kristallisiere sich vor unseren Augen erst heraus, meinte Horváth, und der Schriftsteller sei verpflichtet, „Beiträge zur Biologie [ja geradezu zu dem „gesetzmäßigen Weltgeschehen“] dieses werdenden Spießers zu liefern.“ Es ist kein Zufall, dass Horváth außerdem ein Romanprojekt plante, das unter dem Arbeitstitel „Der Mittelstand“ überliefert ist. Dort treten eine Reihe von solchen Typen in Variation auf – männlich, weiblich, alt, jung und unterschiedlichen sozialen Herkommens. Aber bleiben wir bei seinen „Geschichten“ im engeren Sinn, jenen „aus dem Wiener Wald“. Der Versuch einer knappen Inhaltsangabe könnte so ausfallen: Marianne, ein Mädl aus der Vorstadt, die Tochter des „Zauberkönigs“, dem verwitweten Inhaber eines Spielwaren‐ und Zauberzubehörladens, wurde – gegen ihren Willen ‐ mit dem Metzger Oskar verlobt. Da erscheint der kleinkriminelle Hallodri, aber sich elegant gebende Alfred, der bisher mit Valerie, einer Kanzleiobersekretärswitwe und Trafikantin von nebenan liiert ist. Marianne ist sofort Feuer und Flamme für Alfred. Bei einem Picknick an der schönen blauen Donau löst sie die Verlobung mit Oskar, was für diesen und den Zauberkönig ein unerhörtes Vergehen gegen Moral und Sittlichkeit darstellt, was allerdings heuchlerisch selbstmitleidig hinzunehmen ist. Für ihren Vater, den Zauberkönig, ist sie gestorben. Oskar ist tief verletzt und weiß zugleich, dass sie ihm letztlich nicht „entgeht“. Valerie tröstet sich mit Erich, einem militaristischen deutschen Jura‐Studenten und Antisemiten aus Kassel, der beim Zauberkönig, seinem Onkel, auf Besuch in Wien ist. Marianne bekommt ein uneheliches Kind namens Leopold. Die Verbindung mit Alfred geht schief. Marianne muss sich ihren Unterhalt als Nackttänzerin in einem Nachtclub verdienen, das Kind kommt zu Alfreds Mutter und Großmutter in die heile Wachau. Marianne wird bei ihrer Arbeit im „Maxim“ als nackte allegorische Figur im Stück „Die Jagd nach dem Glück“ von einer Heurigen‐Gesellschaft (u.a. Valerie, Zauberkönig, Erich) erkannt. Ein „Mister“, ein aus den USA zurückgekehrter, reich gewordener Wiener, bemerkt, dass ihn Marianne bestohlen hat. Marianne wird inhaftiert. Der kleine Leopold wird von Alfreds Großmutter in der schönen Wachau absichtlich einem kalten Luftzug ausgesetzt, so dass er an einer Lungenentzündung stirbt. Als Marianne freikommt, heißt das allseits, besonders von Valerie und einem Rittmeister beschworene Motto „Hier wird jetzt versöhnt!“, ohne allerdings auf Marianne Rücksicht zu nehmen. Als sie schließlich in die Wachau kommt, um ihren kleinen Leopold zu besuchen, muss sie feststellen, dass ihr Sohn tot ist. Sie bricht zusammen, und Oskar kann jetzt sein „Versprechen“ einlösen: „Ich hab dir mal gesagt, Mariann, du wirst meiner Liebe nicht entgehen.“ Ein Blick auf die von Horváth konstruierten unterschiedlichen Abschluss‐Szenen der beiden Fassungen – „in sieben Bildern“ (Typoskript) bzw. die Buch‐ und Uraufführungsfassung „in drei Teilen (15 Bildern)“ – lassen tiefere Schichten von Horváths „Volksstück‐Konzept“ erkennen. Während die Fassung der Uraufführung den Schritt hin zum „neuen Volksstück“ geht, indem das für das herkömmliche Volksstück übliche happy ending radikal gebrochen wird – „Marianne: Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr – Oskar: Dann komm – er stützt sie, gibt ihr einen Kuß auf den Mund und langsam ab mit ihr“, als ob sie ein Stück geschlachtetes Vieh wäre, lässt er die Fassung „in sieben Bildern“ noch mit einer imaginären Hochzeit, dem Abglanz einer Art genre‐adäquater Versöhnung enden, so dass dem Publikum ironisch die kitschige Unwahrscheinlichkeit des Geschehens vermittelt werden kann. Wenn Horváth das Geschehen in dieser verworfenen Version noch mit einer großen Hochzeitsfeier enden lässt19, scheint das geläufige Volksstückgenre durch. Die Uraufführung des „Volksstücks in drei Teilen“ gibt dem Metzgermeister und Ehegatten Oskar und seinem 5 Opfer Marianne den letzten „Dialog“ – die Rückbindung an das Genre entfällt: Der neue Schluss rückt das Tödliche, das Totentanzähnliche des Stückes, das Vorzeigen der lebendig Toten Marianne20 ins Zentrum. Die Uraufführung der „Geschichten aus dem Wiener Wald“ fand am 2. November 1931 in Max Reinhardts Deutschem Theater in Berlin unter der Regie von Heinz Hilpert21 statt. Glaubt man den Medienberichten der Zeit, war es der einzige wirkliche Erfolg des damals 30jährigen Horváth. Während die konservative und die Nazi‐Presse kulturkämpferisch tobte und offenbar sofort wusste, dass ihr ideologisch ausbeutbares Volkskonzept destruiert war – „Unflat ersten Ranges“ (Rainer Schlösser22, VB 19.11.1931), „ungefähr das dümmste, was je mit dem Anspruch, Literatur zu sein, über die Bühne gegangen ist“, „dünn, blutlos, Volksstück ohne jede Beziehung zu dem, was Volk ist, dafür roh, taktlos“, „dichterisches Unvermögen“ (Paul Fechter, DAZ 4.11.1931)23 –, erkannte die rationale Kritik das Herausragende (über und neben den Werken etwa von Ludwig Thoma, Carl Zuckmayer, Georg Kaiser, Marieluise Fleißer u.a.m.24) und konnte die geistigen und poetologischen Fundamente, lange bevor sich je eine akademische Feder rührte, benennen. Dafür zeichneten u.a. Erich Kästner, Ulrich Becher, Alfred Polgar, Alfred Kerr, Kurt Pinthus oder Kurt Tucholsky verantwortlich. So hieß es etwa: „… etwas vom Geist und der Entlarvungskunst des ‘preußischen Daumier’ Grosz, nicht ins Wienerische transportiert, sondern auf dem Acker des Wiener Kleinbürgertums gewachsen […]; ein Stück von einem neuartigen bizarren Realismus, der Nestroy nicht vergessen hatte“ (Ulrich Becher), „ein Wiener Volksstück gegen das Wiener Volksstück … er zeigte die Vorder‐ und die Kehrseite … er führte das Theaterpublikum hinter die Fassade“ (Erich Kästner), „…über das Österreichische hinaus in das sogenannte allgemein Menschliche … Viennophobe mögen auch die Vermanschung von Rohheit und Gutmütigkeit im Inwendigen des vom Dichter beschäftigten komödischen Personals als echt lokalfarben ansehen. Zweifellos wienerisch an den Menschen des Spiels ist ihr, so böse wie gut gesehenes, Gegeneinander‐Miteinander, ihre Eintracht auf Basis boshafter Geringschätzung, ihre enge, liebevolle Verbundenheit durch den Kitt wechselseitiger Mißachtung. Was sich sonst im Stück begibt, konnte auch anderswo als im österreichischen Seelen‐Klima vorkommen, Geschlechts‐ und Geldgier sprechen in jeder Mundart ziemlich denselben Text, daß der Mensch aus Gemeinem gemacht ist, ist keine Besonderheit der wienerischen Küche, und im skurrilen Affentanz dreht sich das Leben nicht nur nach der Musik von Johann Strauß.“ (Alfred Polgar). 25 Horváth dürfte sich verstanden gefühlt haben in seiner Röntgenisierung und theatralen Versinnlichung alltäglicher „Schandtaten“26. Der „treue Chronist“ des „Kleinbürgertums“, dem man vorwarf, „zu ekelhaft, zu unheimlich, zu zynisch“ zu sein, und seine „Demaskierung des Bewusstseins“ durch die Entlarvung des sogenannten „Bildungsjargons“ im Gewand des „neuen Volksstücks“ hat in seiner „Gebrauchsanweisung“ (1932) auch einen „Todsünden“‐ bzw. Gebote‐Katalog für Theaterleute verfasst. Im Zentrum steht der Satz: „Alle meine Stücke sind Tragödien – – sie werden komisch, weil sie unheimlich sind. Das Unheimliche muss da sein.“27 In diesem Zusammenhang ist auch wichtig: „Es darf kein Wort Dialekt gesprochen werden! Jedes Wort muss hochdeutsch gesprochen werden, allerdings so, wie jemand, der sonst nur Dialekt spricht und sich nun zwingt, hochdeutsch zu reden. Sehr wichtig! Denn es gibt schon jedem Wort dadurch die Synthese zwischen Realismus und Ironie. Komik des Unterbewußten. […] Bei Ablehnung auch nur eines dieser Punkte durch die Regie, ziehe ich das Stück zurück, denn dann ist es verfälscht.“28 6 Diese Einheit von „Realismus und Ironie“ bezieht sich auf Horváths „Menschen“ – besser, die lebendigen Toten bzw. die toten Lebendigen – als einer Art menschlichen Bestiariums auf der unablässigen „Jagd nach dem Glück“, wie der allegorisch dargestellte Kern in seinen „Geschichten“ lautet. Dieses Glück wird zwar unentwegt imaginiert und beschworen, insbesondere dadurch, dass Horváth beharrlich kulturindustrielle Produkte wie etwa kitschige Lieder und Sprüche als ironisierenden, ja sarkastischen Kommentar herzitiert, es ist aber unerreichbar, weil dem Menschen in diesem Treibhaus Welt „asoziale Triebe“29 in Körper, Geist und Seele von Paradieseszeiten her eingeschrieben sind. Offenbar hatte das Erzbischöfliche Internat Rákócziánum in Budapest (1911‐1913), das der junge Horváth besuchte, prägende Arbeit geleistet: „Triebe“ in Form etwa des nicht‐altruistischen Geschlechtstriebes und des Mammon – im Dauerkampf mit dem sich religiös gebenden Moral‐ und Ordnungsfanatismus und dessen Arsenal an Züchtigungsinstrumenten zwecks Stabilisierung patriarchaler, „gottgegebener“ Ordnung. Sogenannte moralische Werte werden dauernd beschworen, aber sie unterliegen einer Art von Inflation. Solche Antriebskräfte sind es, die, variantenreich Männer wie Frauen, Junge und Alte mehr oder weniger beherrschen. Besonders eindrucksvoll konnte Horváth dies an den sogenannten kleinen Leuten seiner Zeit zeigen, denn diese kannte er aus unmittelbarer Anschauung und aufgrund seiner Menschenstudien. Viele Äußerungsformen von „Brutalität“ werden sichtbar: Egoismus, Bosheit, Erniedrigung, sadistische Lust, masochistische Selbstgeißelung, Täuschen und Lügen, Selbsttäuschung, Anpassungsterror, Ausbeutung, Hinrichtungs‐ und Ausrottungsgelüste, sittlich‐moralisch begründeter und lustvoll praktizierter hinterhältiger Mord u.a.m. – „Schandtaten“. Die „wesentliche Allgemeingültigkeit dieser Menschen“30 will Horváth betont sehen. Noch in einer Liebeserklärung steckt Mordlust: „Du wirst meiner Liebe nicht entgehen“. Und bild‐ und veredelbar ist dieses menschliche Tierarsenal nicht, höchstens auf bestimmte Dauer zu bannen, denn da ist die „Dummheit“ vor, die das „Gefühl der Unendlichkeit“ und der Unveränderbarkeit gibt: „Nun hab ich zu meinen Gestalten […] in puncto ihrer Möglichkeit, sich zu 100 % als soziale Wesen zu entwickeln und nicht nur zu etablieren, keine positive, eher eine skeptische Einstellung, und dies glaube ich damit am besten zu treffen, indem ich eine Synthese von Ernst und Ironie gebe.“31 Dies zeigt sich im Privaten, im Alltäglichen – im sogenannten nicht‐politischen Raum. Auswege gibt es, wie der Weg der Marianne zeigt, keine – und die als solche erscheinen, entpuppen sich ‐ gemäß Kafkas Maus‐Katze‐Gleichnis ‐ als Wege in die nächste Falle. „Die Jagd nach dem Glück“ – Horváth stellt die Glückversprechen wie in einem Schaufenster eines Warenhauses aus: Reichtum, Kinder, Ehe‐, Wettspiel‐ oder Erinnerungskitschglück – und thematisiert zugleich den „ manipulierenden Einfluss der Unterhaltungsindustrie […] auf das Bewusstsein der kleinbürgerlichen Massen. […] Illusionen schieben sich vor die Realität und bewirken ‚falsches’ oder ‚uneigentliches Bewußtsein’, indem die Wirklichkeit und die ‚synthetisch hergestellten Traumwelten’ sich für die Dramengestalten bis zur Ununterscheidbarkeit vermischen (Kurzenberger 1974, 130).“32 Zum Stichwort Unterhaltungs‐ bzw. Kulturindustrie: In unserem Falle handelt es sich hauptsächlich um den Wienerwald‐ und Wienerlieder‐Kitsch als Folie. Dies steht sogar im Titel des Stückes. Das sogenannte Kulturindustrielle, seine massenhafte Wirkungsmacht, seine bewusstseins‐ und gefühlsmäßige Verwertbarkeit und jederzeit aktualisierbare politisch‐ideologische Einsetzbarkeit für welche Zwecke auch immer – sind reiche Quellen 7 für Horváths Satire. Auch zum (analogen) bayerischen Syndrom hat Horváth seinen Beitrag geleistet. „Kasimir und Karoline“ oder auch seine Fräulein Pollinger‐Geschichten und Passagen aus dem Roman „Der ewige Spießer“ stehen dafür – nicht nur Gerhard Polt oder die Biermösl‐Blasn sind seine Erben nach 1945. Zu Horváths theatraler Welt gehört auch folgender Aspekt: Jene, die sich selbstmitleidig als Opfer deklarieren, entpuppen sich als Täter, und Täter sind in anderem Kontext Opfer. Dem Publikum wird eine Welt in der beklemmenden und zugleich verlachenswerten Spannung zwischen moralischem Anspruch und „krimineller“ Praxis vorgeführt, eine Spannung, die durch jeden einzelnen geht und zugleich etwas Kollektives ist. Wenn „Verbrechen“ schöngeredet werden und das Selbstmitleid der Täter die Oberhand gewinnen, herrscht oft Gefühlskitsch und weinerliche Sentimentalität – dann kann man auch die entsprechende Kitschmusik hören. Es gibt eben bloß „ein Formproblem der Bestialität.“33 Horváths „Geschichten“ kann man wie Carl von Linnés biologische und zoologische Taxonomie durchbuchstabieren. Horváth soll Linnés Schriften gut gekannt haben. Die „Geschichten aus dem Wiener Wald“ haben, so wie viele seiner Stücke, eine ausgeklügelte Systematik der variantenreichen Wiederholung von Anspielungen, Wörtern, Zeichen – poetisch „überstrukturiert“. Dies mag den immensen Erfolg mit verursacht haben – Kreisstruktur, Eindruck der Geschlossenheit, des Gerundeten. Zwar gibt es – selten genug – Augenblicke, „wo er [der Mensch] dasteht, ohne jede Lüge, aber das sind naturnotwendig nur ganz wenige Stellen“, heißt eine bekannte Stelle in der „Gebrauchsanweisung“ (1932): „Selbstverständlich müssen die Stücke stilisiert gespielt werden, Naturalismus und Realismus bringen sie um – denn dann werden es Milljöhbilder und keine Bilder, die den Kampf des Bewusstseins gegen das Unterbewusstsein zeigen – –. […] In dem so stilisierten Dialog, gibt es Ausnahmen – – einige Sätze, nur ein Satz manchmal, der plötzlich ganz realistisch, ganz naturalistisch gebracht werden muß.“34 Dies geschieht an jenen Stellen, wo einige Figuren sich selbst erkennen und meinen, keine Rücksicht mehr zu nehmen zu müssen: MARIANNE: Ich möchte jetzt nur noch was sagen. Es ist mir nämlich zu guter Letzt scheißwurscht – und das, was ich tu, tu ich nur wegen dem kleinen Leopold, der doch nichts dafür kann. (Geschichten aus dem Wiener Wald, GW 4, 202) KAROLINE: Aber ich müsst so tief unter mich hinunter, damit ich höher hinauf kann. (Kasimir und Karoline, GW 5, 135) ADA: Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. (Zur schönen Aussicht, GW 1, 200) Im Prinzip aber gilt: Keiner, keine ist dem anderen, der anderen Gefährtin, immer nur Wolf/Wölfin und Feind/Feindin, auch wenn er/sie als Schaf/ und Freund/Freundin auftritt. „Wir sind allein“. Das Glück ist und bleibt ein Phantom – es kann eben nur als Allegorie in einem blendend verkommenen Etablissement gezeigt, inszeniert werden. Horváths Figuren sind gleichsam „Sprachmaschinen“, die ein – von der Horváth‐Forschung bereits penibel aufgelistetes – Arsenal von verfügbaren Sentenzen und Floskeln, Welterklärungsformeln etwa aus biblischen, klassisch‐bildungsmäßigen, astrologischen, esoterischen, natur‐ und medizinwissenschaftlichen u.a.m. Herkünften herzitieren können. Sie dienen etwa einer im Augenblick gerade nötigen Rechtfertigung, dem Einlullen oder 8 Bannen von beklemmender Erfahrung, auch anmaßender Selbsterhöhung, selbstmitleidiger Beruhigung oder „Hinrichtung“ des anderen. Denn sie sind, so Kurt Bartsch, ständig darauf bedacht, „irrationalem, triebgesteuertem Handeln den Schein des Vernünftigen im Sinne des sozial Akzeptablen zu geben“, also im Sinne Freuds „Rationalisierung“ zu betreiben. „Mit Ingrid Haag […] kann das als Vorgang der Maskierung ‚dessen, was nicht gezeigt (gesagt) werden darf’, verstanden werden. Sie sieht [so Kurt Bartsch] Analogien zum ‚Grundmechanismus des Freudschen Traummodells’ [„Verdichtung und Verschiebung“]: ‚Die Bilder des Traums zeigen, indem sie verstellen.’ Daher gehe es auch ‚nicht in erster Linie’ um die ‚Demaskierung (falscher) Bewußtseinsinhalte’, sondern um ‚die prätendierte Autonomie des Bewußten’ […] Zweifellos zielt der ‚treue Chronist’ auf beides, auf die Bewusstmachung des Maskierungsvorgangs […] ebenso wie auf Inhalte.“35 Erlauben Sie mir noch zwei Anmerkungen – die eine zum Thema „Hochsprache“ und „Dialekt“, die andere zum späten Horváth nach seinen „Geschichten aus dem Wiener Wald“. Es ist ein prinzipielles Missverständnis, Horváth zu globalisieren, indem man meint, Horváths Hinweis auf die „wesentliche Allgemeingültigkeit dieser [seiner] Menschen“ als Freifahrtschein für die Entsorgung der sprachlich‐klanglichen Verortung im Süddeutschen verstehen zu dürfen. Das „Unheimliche“, das Dämonische wird von Horváth nicht zuletzt durch den Klang (Musik) der Sprache – das Nicht‐Diskursive – vermittelt. Da er sich im bayerischen und im Wiener Raum am besten auskannte, spielen seine besten Texte auch dort – München, Oktoberfest, Süddeutschland, Wien und nö. Umgebung. Ich könnte mir aber – dem Geiste Horváths verpflichtet – durchaus vorstellen, seine Dialoge in prinzipieller Adaption an die dämonischen Klänge von New York, Mailand, Leipzig, des Wörthersees oder des Innviertels anzupassen – dies wäre durchaus eine Herausforderung für jeden Regietheaterregisseur – und zugleich der Anspruch, Horváths Bestiarium auf das „Volk“ von heute auszudehnen. Ich habe es immer als einen weißen Fleck auf der Figuren‐Landkarte Horváths empfunden, dass er sein „Mittelstandskonzept“, sein Kleinbürgerkonzept so eng aufgefasst hat – warum sollten nicht auch die Herrschenden der globalen Wirtschaft und Politik auftauchen – es müssen ja nicht unbedingt die „Kleinbürger“ aus Parlament und Untersuchungsausschüssen – Vorgeladene und Vorladende – sein. Und schließlich: Es ist kein Zufall, dass Horváth nach der „Machtergreifung“ des Jahres 1933 in eine schwere, auch geistige und künstlerische Krise schlitterte. Seine gesamte Arbeit hatte sich als nutzlos erwiesen – die Oskars, Alfreds, Erichs, die Zauberkönige, Valeries und auch die psychisch toten Fräuleins hatten nun das politische Sagen. Bilder der Kälte, des Eingeschneitseins, des Erfrierens und Erstarrens stellen sich ein – und das Motiv der quälenden Gewissenserforschung zieht in seine literarische Welt ein. Es sei an sein Stück „Der jüngste Tag“ (1937) oder auch die Romane „Jugend ohne Gott“ (1937) und „Ein Kind unserer Zeit“ (1938) erinnert. Der „späte“ Horváth schreibt: „Warum mußt ich eigentlich weg von zuhaus? Wofür bin ich denn eingetreten? Ich hab nie politisiert. Ich trat ein für das Recht der Kreatur. Aber vielleicht wars meine Sünde, daß ich keinen Ausweg fand?“36 Wie hätte er er denn auch über Nacht die „skeptische Einstellung“ aufgeben können, dass sich diese „maßgebenden“, „heutigen Menschen […] zu 100 Prozent als soziale Wesen“ entwickeln könnten, wenn doch gerade seine Sichtweise auf die Menschen auf allen Linien bestätigt worden war? Horváths „Geschichten“ haben bis heute nichts an ihrer Treffsicherheit und Aktualität eingebüßt. 9 1 Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald. Erste Auflage. Frankfurt am Main 2001 (=Kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden. Hg. von Traugott Krischke unter Mitarbeit von Susanna Foral‐ Krischke, Band 4 = KWA). Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1986 (=suhrkamp taschenbuch 3336) [enthält zwei Fassungen: „Volksstück in sieben Bildern“ und „Volksstück in drei Teilen“]. Vgl. auch die folgenden Ausgaben: Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald. Volksstück. Hg. von Klaus Kastberger. Stuttgart: Reclam 2009; Ödön von von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald. Volksstück in drei Teilen. Mit einem Kommentar von Dieter Wöhrle. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 2001 (Suhrkamp BasisBibliothek 26), S. 182f. 2 Carl Zuckmayer: Zur Verleihung des Kleistpreises. In: Blätter des Deutschen Theaters in Göttingen. Spielzeit 1953/54, Heft 52. Nach: Materialien zu Ödön von Horváth. Hg. von Traugott Krischke. 2. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1977 (1970), S. 37. 3 Ödön von Horváth: Fiume, Belgrad, Budapest, Preßburg, Wien und München (1929). In: Ders.: Sportmärchen und andere Prosa (=KWA 11), S. 184. 4 Ödön von Horváth: [Interview]. In: Ebenda, S. 196f. (Interview zwischen Willy Cronauer und Horváth, das am 5.4.1932 im Bayrischen Rundfunk gesendet wurde.). 5 Ebenda, S. 184. 6 Ödön von Horváth: Gebrauchsanweisung (1932). In: Ebenda, S. 220. (Das Motto der „Gebrauchsanweisung“ lautet: „Das dramatische Grundmotiv aller meiner Stücke ist der ewige Kampf zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein.“) 7 Biographische Hinweise in Stichworten: Seit 1924 lebt die Familie Horváth in Murnau am Staffelsee (bis 1933). Oft ist Ödön dort zu Gast – dort entstehen z. B. die „Sportmärchen“, die Stücke „Revolte auf Côte 3018“ (Bau der Seilbahn auf die Zugspitze, später eine Überarbeitung: Volksstück „Die Bergbahn“ UA 1929 in Berlin), „Zur schönen Aussicht“, „Italienische Nacht“ UA 20. März 1931 in Berlin). Horváth etabliert sich, pendelnd zwischen München, Murnau, wo sich seine Eltern eine ansehnliche Villa bauen ließen, und Berlin als junger, moderner Schriftsteller in der Weimarer Republik. Das Leben in Murnau und Umgebung: High Life, Sport als modernes Massenphänomen („Sportmärchen“), erste Liebschaften – Horváth, der elegante Diplomatenspross aus geadeltem Hause, und der Bodenständige – der künstlerische Freundeskreis: Münchner und Berliner Bohéme in der bayrischen Provinz – Enttäuschte Einbürgerungsversuche in Murnau 1927/28. Sprachlicher Beobachtungsraum Murnau und Umgebung. Ausgiebige Dokumentations‐Tätigkeiten (z. B. Fememorde und Schwarze Reichswehr, politische Berufsverbote). Politische, soziologische Interessen (Gefühl der Bedrohung durch völkische und nationalistische Ideologien und Bewegungen; Auseinandersetzungen mit der NS‐ Bewegung), Weltwirtschaftskrise. Erste Prosa‐Studien, Novellen‐Band, Erzählungen, Prosaprojekte entstehen (ca. 30 Texte als Figuren‐ und Motiv‐Fundus), erste „politisierende“ Zeitstücke: Revolte auf Cote 3018, Sladek; Komödien („Zur schönen Aussicht“ als ein erster Generalentwurf über Menschen und Gesellschaft nach 1918); praktische und theoretische Entwicklung des „neuen Volksstückes“. 1927 erste Inszenierung eines Theaterstücks in Hamburg: Revolte auf Cote 3018; die Grundlagen für späteren Erfolg sind gelegt; Theatererfolge besonders in Berlin ab 1929; Inszenierungen in Berlin, Wien und Leipzig (Theater am Bülowplatz, Theater am Belvedere, Lessing‐Theater, Theater am Schiffbauerdamm, Deutsches Theater, Schauspielhaus Leipzig). Erweiterung des Freundes‐, Bekannten‐ und Unterstützerkreises (z. B. Heinz Hilpert, Francesco von Mendelssohn, Max Reinhardt, Carl Zuckmayer, Veit Harlan, Fritz Kortner, Ernst Josef Aufricht). Weitere Erfolge und Positionierungen: Vertrag mit dem Ullstein‐Verlag, Propyläen, Arcadia. Erfolge bei der deutschen Kritik, z. B. Julius Bab, Oscar Brie, Bernhard Diebold, Paul Goldmann, Erich Kästner, Alfred Kerr, Kurt Pinthus, Alfred Polgar, Franz Servaes. Reisen nach Spanien („Der ewige Spießer“). Erster Literaturpreis auf Vorschlag von Carl Zuckmayer und erster Höhepunkt in seinem jungen Schriftstellerleben: Kleistpreis 1931 (NS‐ Angriffe). Erwachendes Interesse für die modernen Medien – neue berufliche Kontakte: Tonfilm, Hörspiele. 8 Ödon von Horváth: Gebrauchsanweisung. In: KWA 11, S. 215. 9 Vgl. weiters: (1) Fiume, Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München … (In: Der Querschnitt 9, Februar 1929, H. 2, S. 136f) – (2) Flucht aus der Stille (konzipiert 11.1.1929, nach dem Vertragsabschluss mit dem Ullstein‐Verlag), Variante: Unlängst traf ich einen Bekannten … – – (3) Sie haben keine Seele [Entwurf] als Antwort auf eine Rezension von Heinrich Mann – (4) Über Gerhart Hauptmann (70. Geburtstag Hauptmanns am 15.11.1932, Festschrift der Blätter des Deutschen Theaters) – (5) Wenn sich jemand bei mir erkundigt [elfseitige Zusammenfassung des „Interviews“ 1932] – (6) Briefentwurf (Spätherbst 1935 an „Gruppe Ernst Lönner“ – Kleines Theater in der Praterstraße, Wien, will Kasimir und Karoline spielen, Gruppe Lönner hatte KuK am 4.2.1935 in der Wiener „Komödie“ erstaufgeführt) – (7) Was soll der Schriftsteller heutzutage schreiben (1936 oder 1937). In: KWA 11, S. 179‐228. 10 Ödön von Horváth: Gebrauchsanweisung (November 1932). In: KWA 11, S. 217. 10 11 Angesichts des Exils und des projektierten Romans „Adieu, Europa!“ (1938) notiert Horváth: „Warum mußt ich eigentlich weg von zuhaus? Wofür bin ich denn eingetreten? Ich hab nie politisiert. Ich trat ein für das Recht der Kreatur. Aber vielleicht wars meine Sünde, daß ich keinen Ausweg fand?“ (Ödön von Horváth: Adieu, Europa! 1938. In: Horváth‐Blätter 1, 11.) 12 Ebenda, S. 218. 13 Ödön von Horváth: Randbemerkungen zu „Glaube, Liebe, Hoffnung“ (1932). In: KWA 6. 14 Ödön von Horváth: Interview 5.4.1932. In: KWA 11, S. 201. 15 Ebenda, S. 201. 16 Ebenda, S. 203. 17 Ödön von Horváth: Randbemerkung [zu „Glaube Liebe Hoffnung“]. In: KWA 6, S. 12. 18 Siegfried Kracauer: Die Angestellten: aus dem neuesten Deutschland. Frankfurt a. M.: Societäts‐Verl. 1930. 19 Man könnte geradezu Lorenzo da Pontes/Mozarts Schlusstableau der „Cosi fan tutte“ zum Vorbild erklären. 20 In den ersten Versionen des Stückes hieß Marianne noch Mathilde, aber das ist nebensächlich. Denn es geht um mehr als das Marianne‐Individuum, es geht um kollektives Frauenschicksal, besser, es geht um das fein sezierte Patriarchat. 21 Besetzung: Carola Neher (Marianne), Peter Lorre (Alfred), Hans Moser (Zauberkönig), Paul Hörbiger (Rittmeister), Lucie Höflich (Valerie), Frida Richard (Großmutter), Lina Woiwode (Mutter), Heinrich Heilinger (Oskar), Felicitas Kobylanska (Ida), Josef Danegger (Havlitschek), Paul Dahlke (Erich), Elisabeth Neumann (gnädige Frau), Hermann Wlach (Beichtvater), Willy Trenk‐Trebitsch (Hierlinger Ferdinand). Der Regisseur Heinz Hilpert sagte später: „eine Wahrhaftigkeit und eine Unerbittlichkeit in der Darstellung der Beziehungslosigkeit der Menschen zueinander“, was den „Röntgenaugen“ des Autors zu verdanken sei (Heinz Hilpert: Statement aus dem Film von Traugott Krischke: Das Porträt: Ödön von Horváth. Westdeutscher Rundfunk, Köln 1966. In: Materialien zu Ödön von Horváth. Hg. Von Traugott Krischke. 2. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1977, S. 34 (=edition suhrkamp 436). 22 Rainer Schlösser (1899 Jena – 1945 verschollen in Berlin): Reichsdramaturg im Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda; 1935‐1938 Präsident der Reichstheaterkammer – Paul Fechter (1880‐1958): u.a. Verfasser von drei Literaturgeschichten aus 1932, 1941 und 1942. 23 Horváth nannte dies den „Sauherdenton“ (KWA 11, S. 213f.) – zu Lebzeiten unpubliziert, aus dem Nachlass. Solches sollte sich bei der Aufführung des Wiener Volkstheaters am 1.12.1948 im Zeichen des Kalten Krieges fortsetzen: „Diesen Gespensterreigen von Halbtrotteln und Verbrechern ein Volksstück zu nennen, ist eine Anmaßung.“ (Montags‐Ausgabe, Dezember 1948) – „Horvath nennt sein Stück ein Volksstück. Was aber haben diese innerlich durch und durch faulen Lemuren, diese Sumpfblüten, die in jeder Großstadt gedeihen können, mit dem Volk, mit dem Volk von Wien zu tun?“ (Wiener Tageszeitung, Dezember 1948) – „Das Dunkle, Abseitige und Hässliche im Menschen zu beleuchten, ist nicht neu und hat auch Dichter beschäftigt. Von ihnen bis zu Ödön Horváth ist ein Weg ohne Ende. Denn was Horváth zum Dichter fehlt, ist das menschliche Herz, das Fühlen. Diese Plakatschicksale, die nicht Geschichten aus dem Wienerwald, sondern Kolportage aus seinen Niederungen erzählen, haben vielleicht alle eine Entschuldigung, dass es so etwas auch im Leben gibt. Aber das Leben besteht Gott sei Dank nicht nur aus alternden Hysterikerinnen, jungen Zuhältern, gemeinen Großmüttern, dummen Fleischbauern und schwachen Geschöpfen. Sonst bliebe nur eines: sich aufzuhängen.“ (Peter Loos in Der Abend, 2. Dezember 1948) 24 z. B. Georg Kaiser: Nebeneinander. Volksstück 1923; Carl Zuckmayer: Der fröhliche Weinberg 1925, Marieluise Fleißer: Fegefeuer in Ingolstadt 1926, Pioniere in Ingolstadt 1929. 25 Vgl. Christine Schmidjell: Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2000, S. 84‐102 (=Erläuterungen und Dokumente Nr. 16016). 26 Ödön von Horváth: Gebrauchsanweisung (1932). In: KWA 11, S. 218. 27 Ebenda, S. 220. 28 Ebenda, S. 219f. 29 Ebenda, S. 217. 30 Ebenda, S. 221. 31 Ödön von Horváth: Interview. In: KWA 11, S. 201. 32 Kurt Bartsch: Ödön von Horváth. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 2000, S. 40. 33 Ödön von Horváth: Randbemerkung [zu „Glaube Liebe Hoffnung“]. In: KWA 6, S. 12. 34 Ödön von Horváth: Gebrauchsanweisung (1932). In: KWA 11, S. 220. 35 Kurt Bartsch: Ödön von Horváth 2000, S. 40. 36 Ödön von Horváth: Adieu, Europa! 1938. In: Horváth‐Blätter 1, 11.