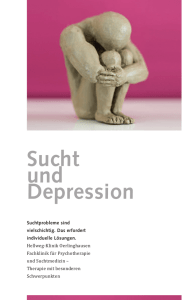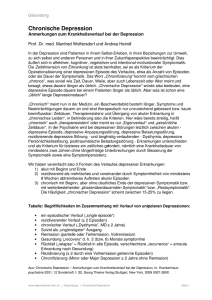Freie Beiträge
Werbung

Kindheit und Entwicklung 14 (3), 169 ± 180 Hogrefe Verlag, Göttingen 2005 Freie Beiträge Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer Institut für Psychologie der Universität Bern Zusammenfassung. Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen vom Einsetzen der Pubertät bis ins Heranwachsendenalter hinein dargestellt und mögliche Erklärungen für diese Unterschiede diskutiert. Exemplarisch werden zwei Formen von Problemverhalten dargestellt, deren Prävalenz sich in dieser Entwicklungsphase stark verändert: depressive Symptome und Störungsbilder, und externalisierendes Problemverhalten, im Speziellen Aggression und Delinquenz, sowie der Konsum verschiedener psychoaktiver Substanzen. Diese Störungen und die entsprechenden Geschlechtsunterschiede werden in Zusammenhang mit der Lösung von zentralen Entwicklungsaufgaben des Jugendalters gebracht. Abschlieûend werden Implikationen für die Prävention und die Forschung formuliert. Schlüsselwörter: Geschlechtsunterschiede, Problemverhalten, Adoleszenz, Depression, Aggression, Delinquenz, Konsum psychoaktiver Substanzen, Entwicklungsaufgaben Gender differences in the occurrence of mental and behavioral disorders during adolescence Abstract. In the present article, the most important gender differences in the occurrence of mental and behavioral disorders from the beginning of puberty to young adulthood are presented and possible explanations for these differences are discussed. Two types of problem behavior ± showing substantial change in prevalence during adolescence ± are addressed: depressive symptoms and disorders, and externalizing problem behavior, in particular aggression, delinquency, and use of psycho-active substances. These disorders and gender differences in their prevalence are discussed with regards to the completion of developmental tasks. Finally, implications for prevention and research are formulated. Key words: sex differences, problem behavior, adolescence, depression, aggression, delinquency, psycho active substances, developmental tasks Die Adoleszenz bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, die Einwirkungen auf die Selbstdefinition und das soziale Verhalten des heranwachsenden Menschen haben. Die vielen Veränderungen und Übergänge sind sowohl als Chancen als auch mögliche Belastungen bis hin zu Überforderungen zu betrachten; denn jede Neuorientierung birgt auch die Gefahr der Desorientierung. So gehört die Auseinandersetzung mit existierenden Normen und Werten zum Prozess der Identitätsfindung (Marcia, 1980), aber der Weg bis zur eigenen erarbeiteten Definition der Identität kann durch Phasen von risikoreichem oder ziellosem Experimentieren geprägt sein, oder sogar in Verzweiflung über sich und die Welt enden. Lange wurde die Adoleszenz auch als eine Phase der Verwirrung (Burns, 1979) oder der Krise und des Sturm und Drangs bezeichnet. Zwar ist diese Ansicht häufig aufgrund der Selektionskriterien früherer Studien (z. B. psychiatrische Anlaufstellen) kritisiert und seit den erDOI: 10.1026/0942-5403.14.3.169 sten breiteren Studien zur Selbstauffassung von Jugendlichen einer Normalpopulation Ende der 60er-Jahre (Offer, 1969; Offer, Ostrov & Howard, 1984) revidiert worden, jedoch scheint sie in Laienvorstellungen immer noch Gültigkeit zu haben. Dies wird zusätzlich durch die Medien verstärkt; Letzteres übrigens auch bereits in den 80er-Jahren (Falchikov, 1986). Die Diskrepanz zwischen dem ausgewogenen Bild der Adoleszenz, welches Ergebnisse von Surveystudien zeichnen und den alltagspsychologischen Beobachtungen von Laien lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass normabweichendes Verhalten leicht erkennbar ist und von jeder sozialen Gruppe (auch Gesellschaft oder Kultur) unmittelbar als Gefährdung der herrschenden Ordnung wahrgenommen wird. Das trifft ganz besonders auf die externalisierenden Formen von Problemverhalten zu, die meistens Probleme für andere bereiten und deren Prävalenz dadurch überbewertet wird. 170 FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer Die generalisierte Wahrnehmung der Adoleszenz als krisenhafte Periode hat zeitweise auch dazu geführt, dass Störungen in dieser Lebensphase bagatellisiert worden sind, da man davon ausging, dass es sich lediglich um vorübergehende Phänomene handelte (z. B. adolescence-limited delinquency; Moffitt, 1993) und die jugendliche Person aus der Störung hinauswachsen würde (Petersen, 1988). Längsschnittstudien zur Selbstabwertung (Alsaker & Olweus, 1992, 1993) oder zur Depression (Harrington, 1993; Merikangas & Angst, 1995; Rutter, 1986) in der Adoleszenz haben jedoch eindeutig gezeigt, dass solche Probleme, wenn sie auftreten, von stabiler Natur sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Distanzierung von den geltenden Normen Teil eines notwendigen Selbstdefinitionsprozesses ist und damit alleine noch keine Störung darstellen muss. Man dürfte in diesem Sinne behaupten, dass normabweichendes Verhalten während der Adoleszenz eher als normal und gar entwicklungsfördernd zu betrachten sei. So haben beispielsweise Shedler und Block (1990) den experimentierenden Drogenkonsum unter Berücksichtigung solcher Mechanismen analysiert. Wir wissen aber auch, dass die Adoleszenz eine zentrale Phase in der Entwicklung von verschiedenen Typen von sowohl internalisierendem Problemverhalten wie Depression (z. B. Harrington, 1993), als auch externalisierenden Problemen wie Delinquenz (z. B. Moffitt, 1993) ist. Darüber hinaus können sich diese Verhaltensweisen in dieser Phase auch zu stabilen Problemen entwickeln und die weitere Entwicklung dadurch sehr stark prägen (Alsaker, 2000; Cairns & Cairns, 1994; Nagin, Farrington & Moffitt, 1995). Es stellt sich deshalb die Frage nach der Grenzziehung zwischen normal abweichendem Verhalten und Problemverhalten (vgl. Waligora, 2003). Die Qualifizierung von Verhaltensweisen als Problemverhalten steht immer in Zusammenhang mit seinen Konsequenzen, aber auch mit Normen, Erwartungen und Entwicklungsaufgaben (vgl. Havighurst, 1956; Dreher & Dreher, 1985). Streng genommen bedeutet dies, dass man Problemverhalten stets in Abhängigkeit von Kultur, sozialem Umfeld, Geschlecht und Alter definieren müsste (Flammer & Alsaker, 2002). Nun ist es jedoch so, dass eine bestimmte Verhaltensweise durchaus in einem bestimmten Alter und in einer gegebenen (Sub-) Kultur angepasst oder normativ sein mag und dennoch für die weitere Entwicklung des Individuums als problematisch eingestuft werden muss. Beispielsweise wenn alle Mädchen im Alter von 16 Jahren extrem harte Diäten durchführen würden, könnte dieses Verhalten einer adoleszenten Norm zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einer bestimmten Kultur entsprechen und im Sinne der Normativität angemessen sein. Dennoch müsste dieses Verhalten für die weitere Entwicklung dieser Mädchen als problematisch eingestuft werden. Das heiût, ein Bezug zur Funktionalität des Verhaltens innerhalb verschiede- ner Entwicklungsbereiche ist immer nötig. Ein und dasselbe Verhalten kann in einem Bereich durchaus funktional und gleichzeitig in einem anderen Bereich dysfunktional sein. Im eben genannten Beispiel wäre das extreme Diätverhalten für die soziale Integration funktional, aber körperlich und gemessen an verschiedenen Entwicklungsaufgaben dysfunktional. Die Funktionalität muss auch im Zusammenhang mit dem Umfeld analysiert werden. Was für eine Person funktional sein kann, kann für andere im Umfeld problematisch sein (ein typisches Beispiel stellt instrumentelles aggressives Verhalten dar). Entsprechend diesen Ausführungen benutzen wir hier die Definition von Flammer und Alsaker (2002, S. 268) und betrachten Problemverhalten als ¹Verhalten, das eine Gefährdung für die eigene Entwicklung oder die Entwicklung anderer darstelltª. Sowohl normatives als auch abweichendes Verhalten können in diesem Sinne als Problemverhalten bezeichnet werden, wenn sie ein Risiko in Bezug auf die persönliche langfristige Entwicklung eines Individuums oder seiner Umgebung darstellen. Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten Geschlechtsunterschiede im Auftreten von Problemverhalten vom Einsetzen der Pubertät bis ins Heranwachsendenalter hinein dargestellt und mögliche Erklärungen für diese Unterschiede diskutiert. Wir gehen exemplarisch auf zwei Formen von Problemverhalten ein, deren Prävalenz sich in dieser Entwicklungsphase stark verändert, und versuchen diese in Zusammenhang mit der Lösung von zentralen Entwicklungsaufgaben zu bringen. Wir setzen uns einerseits mit depressiven Symptomen und Störungsbildern ± als internalisierendem Problemverhalten ± und andererseits mit einer Gruppe von externalisierenden Formen von Problemverhalten, welche häufig zusammen auftreten, auseinander. ± Auf biologische Faktoren dieser Entwicklungsverläufe gehen wir dabei nicht ein und verweisen auf frühere Ausgaben dieser Zeitschrift (vgl. Holtmann & Schmidt, 2004; Holtmann, Poustka & Schmidt, 2004). Depression Mehrere Autoren haben darauf hingewiesen, dass Jungen vor der Pubertät entweder gleich häufig oder sogar häufiger als Mädchen unter Depression leiden und sich dieses Verhältnis in der Pubertät umkehrt (vgl. Groen & Petermann, 2002; Harrington, 1993). Dies macht diese Störung von einer Geschlechterperspektive her gesehen besonders interessant. Bis vor ungefähr drei Jahrzehnten ging man davon aus, dass Depression ± so wie man sie unter diesem Begriff für Erwachsene bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts definiert hatte (Berrios, 1996) ± bei Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter Kindern und Jugendlichen nicht oder nur selten in Erscheinung tritt (Essau, 2002). Heute wird die diagnostische Klassifikation affektiver Störungen auch für Kinder und Jugendliche anerkannt und es herrscht Einigkeit darüber, dass Depression im Jugendalter von der Erscheinung her derjenigen im Erwachsenenalter sehr ähnlich ist. Der Begriff Depression wird in der Forschung allerdings nicht mehr nur als Bezeichnung der klinisch relevanten Störung (u. a. Major Depression), sondern auch für mildere Formen von depressiven Verstimmungen verwendet. Depression wird in der Forschung vermehrt als Kontinuum betrachtet. An dem einen Ende findet man normale Reaktionen auf negative Lebensereignisse und am anderen Ende extreme emotionale Zustände (z. B. tiefe Melancholie) bis hin zur suizidalen Gefährdung (vgl. Angold, 1988). Um Forschungsergebnisse diskutieren zu können, scheint es uns wichtig, vorab einige der meist verwendeten Begriffe darzustellen. Gemäû DSM-IV (Sass, Wittchen & Zaudig, 1996) kann entweder eine klinische Depression ± ¹Major Depressionª ± oder eine schwächere länger andauernde Depression ± ¹dysthyme Störungª ± diagnostiziert werden. Eine Major Depression erfordert das Vorkommen von mindestens fünf von neun Symptomen innerhalb von mindestens zwei Wochen, wobei entweder eine depressive oder eine reizbare Verstimmung (bei Kindern und Jugendlichen, vgl. Essau & Petermann, 2002) oder ein deutlich vermindertes Interesse an fast allen Aktivitäten vorkommen müssen. Andere Symptome betreffen ¾nderungen in folgenden Bereichen: Gewicht, Appetit, Schlaf, Psychomotorik, Energie, Selbstwert, Schuldgefühle, Konzentration und wiederkehrende Gedanken an den Tod (inkl. suizidale Gedanken). In der DSM-IVKlassifikation wird zwischen Major Depression mit einer einzelnen Episode und einer rezidivierenden Major Depression unterschieden. In der ICD-10-Klassifikation gibt es entsprechend die Bezeichnungen ¹Depressive Episodeª und ¹Rezidivierende Depressive Störungª (siehe Übersicht 1 in Essau & Petermann, 2002, S. 293). Eine dysthyme Störung ist weniger intensiv, dauert aber länger. Sie wird diagnostiziert, wenn der oder die Jugendliche über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr eine depressive oder reizbare Verstimmung aufweist. Während der depressiven Verstimmung bestehen mindestens zwei von sechs Symptomen betreffend Appetit, Schlaf, Energie, Selbstwert, Konzentration und Gefühlen der Hoffnungslosigkeit. Die entsprechende ICD10-Bezeichnung ist Dysthemia. Zusätzlich zu diesen klaren Störungsbildern ermöglichen beide Klassifikationssysteme die Bezeichnung ¹nicht näher bezeichnete depressive Störung/Episodeª. 171 Neben diesen anerkannten Klassifikationssystemen arbeiten Forscherinnen und Forscher mit weiteren Begriffen. Beispielsweise unterscheiden Petersen, Compas und Mitarbeitende (1993) zwischen drei Kategorien: l l l depressive Stimmung, depressives Syndrom und klinische Depression. Depressive Stimmung tritt oft zusammen mit anderen negativen Emotionen wie Furcht, Schuldgefühlen, ¾rger, oder Verachtung auf, jedoch nie zusammen mit Freude (Watson & Kendall, 1989). Das depressive Syndrom wird als eine Konstellation von Emotionen und Verhaltensweisen betrachtet, die durchweg gemeinsam miteinander auftreten (z. B. Weinen oder ein Gefühl der Einsamkeit, der Wertlosigkeit, der Schuld, des Misstrauens). Von einem depressiven Syndrom sprechen Petersen et al. (1993) nur dann, wenn die diagnostischen Kriterien einer klinischen Depression gemäû den Klassifikationssystemen psychischer Störungen der American Psychiatric Association (DSM-IV) oder der Weltgesundheitsorganisation WHO (ICD-10) nicht zutreffen. Prävalenzraten zu Depression in der Adoleszenz müssen aus sehr unterschiedlichen Studien und Stichproben abgeleitet werden. Die Schätzung der Prävalenz wird dadurch erschwert, dass sehr unterschiedliche Messinstrumente und Grenzwerte benutzt werden und dass nicht immer klar zwischen Depressivität, depressivem Syndrom und klinischer Depression differenziert wird. Aus diesem Grund variieren die Angaben aus verschiedenen Studien sehr stark. Merikangas und Angst (1995) berichten auf der Basis von acht verschiedenen epidemiologischen Erhebungen in Normalpopulationen Punktprävalenzraten einer Major Depression bei Jugendlichen zwischen 0.4 % und 5.7%. Auch Essau und Petermann (2002) berichten von entsprechenden Zahlen auf der Basis von neun Studien, welche zwischen 1993 und 1998 publiziert wurden (zwischen 0.7 % und 6 %). Die Lebenszeitprävalenz reichte in der Übersicht von Merikangas und Angst von 1.9% bis 18.4%, und in der Übersicht von Essau und Petermann (2002) von 9.3% bis 18.4% (Zahlen aus vier Studien). Weiter variieren die Zahlen auch je nachdem, ob die Einschätzung der Symptome von den Eltern oder den Jugendlichen selbst kommt: Eltern schätzen ihre jugendlichen Kinder seltener als depressiv ein (10 % bis 20%) im Vergleich zu deren Selbsteinschätzungen (20 % bis 40 %) (Petersen et al., 1993). Sowohl klinisch relevante Depressionen als auch depressive Verstimmungen scheinen von der Kindheit hin zur Jugendzeit zuzunehmen (Fleming & Offord, 1990; Rutter, 1986). Diese Zunahme betrifft Mädchen stärker als Jungen (z. B. Kandel & Davies, 1982; Kashani et al., 1987). Die Ergebnisse aus den 80er-Jahren lassen sich 172 FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer auch durch die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten, repräsentativen Gesundheitsbefragung von 16- bis 20jährigen Jugendlichen in der Schweiz (¹SMASH 2002ª) bestätigen: Während 10 % der Mädchen als depressiv eingestuft wurden, traf dies lediglich bei gut der Hälfte der Jungen (5.6 %) zu (Narring et al., 2004). Essau (2002) berichtet, dass Studien mit Jugendlichen zweibis dreimal höhere Depressionsraten bei Mädchen im Vergleich zu Jungen enthüllen. Während sich im Kindesalter kaum bedeutsame Geschlechtsunterschiede abzeichnen, sind diese im Jugendalter vergleichbar mit denjenigen bei Erwachsenen. Dieser eindeutige Geschlechtsunterschied scheint nicht auf Artefakte wie den Antwortstil oder die unterschiedliche Offenheit zurückzuführen zu sein (Nolen-Hoeksema, Girgus & Seligman, 1991). Die Zunahme der Depression in der Adoleszenz erklärt sich Harrington (1993) mit einer Abnahme der protektiven Faktoren in diesem Lebensabschnitt, durch welche die Jugendlichen möglicherweise vulnerabler werden. Sie verbringen weniger Zeit mit ihrer Familie (Larson & Richards, 1991) und die allgemeine Distanzierung von den Eltern kann dazu führen, dass sie weniger elterliche Unterstützung bekommen oder wahrnehmen. Eine alternative Erklärung dafür, warum Kinder seltener unter Depressionen leiden, ist die Tatsache, dass ihre Fähigkeiten zur Selbstreflexion noch wenig entwickelt sind und sie sich selbst oft überschätzen. Dieser Umstand mag Kinder vor negativen Kognitionen und somit auch vor Depression schützen. Warum werden aber Mädchen im Jugendalter anfälliger für Depression? Diese Anfälligkeit scheint mit einem geringeren Selbstwert und einem negativeren Körperbild der Mädchen zusammenzuhängen (Allgood-Merton, Lewinsohn & Hops, 1990). Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zeigt sich schon bei Mädchen ab einem Alter von neun Jahren (Davison, Markey & Birch, 2003). Der niedrigere Selbstwert der Mädchen ist durch zahlreiche Studien belegt worden (siehe Flammer & Alsaker, 2002); Erklärungen dafür (warum Mädchen einen niedrigeren Selbstwert haben), sind jedoch selten und es ist fraglich, inwiefern man den tiefen Selbstwert als Vorläufer bzw. Ursache oder eher als Symptom von Depression betrachten soll. Ein wichtiger Faktor in der Erklärung des Geschlechtsunterschieds bei Depression ist unserer Meinung nach die Verschiedenheit des Timings und der Bedeutung der Pubertät überhaupt. Es ist belegt, dass insbesondere körperlich früh entwickelte Mädchen ein höheres Risiko zur Entwicklung depressiver und anderer internalisierender Störungen aufweisen. Dies ist möglicherweise mitunter ein Resultat der gröûeren Unzufriedenheit mit ihrem Aussehen, welche wiederum mit unrealistischen weiblichen Körperidealen zusammenhängt (Alsaker, 1992, 1995; Stattin & Magnusson, 1990). Diese Konfrontation mit einem unerreichbaren Ideal könnte sowohl ihre höhere Tendenz zur Depressivität als auch ihren tieferen Selbstwert erklären. Darüber hinaus sind Mädchen während der Pubertät möglicherweise auch mit mehr Herausforderungen konfrontiert als Jungen. Bei ihnen fällt beispielsweise ein Schulwechsel (Übertritt in die Sekundarstufe) öfter mit äuûeren Anzeichen der Pubertätsentwicklung zusammen als bei Jungen (Petersen, Sarigiani & Kennedy, 1991). Das bedeutet, dass Mädchen häufiger mehrere wichtige Entwicklungsaufgaben gleichzeitig meistern müssen, was an sich als Stressfaktor betrachtet werden kann (Alsaker, 1996). Die Anhäufung von Entwicklungsaufgaben trifft die frühreifen Mädchen besonders stark. Während die Auseinandersetzung mit den pubertären körperlichen Veränderungen als normative Entwicklungsaufgabe betrachtet werden kann, da sie zum einen oder anderen Zeitpunkt von allen gelöst werden muss, werden früh und spät reifende Jugendliche zusätzlich auch mit timing-gebundenen, nicht normativen Aufgaben konfrontiert (Alsaker, 1996). Das heiût, dass sie eine Kumulation von normativen und nicht normativen Aufgaben erleben. Diese zusätzlichen nicht normativen Aufgaben sind für die Frühreifen und die Spätreifen auch sehr unterschiedlich: Während spätreife Mädchen sehr gut auf die kommenden Veränderungen und Reaktionen des Umfelds vorbereitet sind, werden die frühreifen Mädchen mit Aufgaben konfrontiert, mit welchen weder sie noch ihre Umgebung gerechnet hatten. Obwohl das Timing der körperlichen Veränderungen der Pubertät mit ein wichtiger Faktor ist, um Geschlechtsunterschiede in den Depressionsraten zu verstehen, so kann die höhere Depressionstendenz der frühreifen Mädchen jedoch nur zum Teil dadurch erklärt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Frühreife oft bereits existierende Probleme akzentuieren kann (Caspi & Moffitt, 1991). Dadurch, dass Mädchen generell früher pubertieren als Jungen (insbesondere was die äuûerlichen Anzeichen betrifft), werden Mädchen auch früher als Jungen mit der notwendigen Anpassung ihres Körperbilds und Selbstkonzepts an ihre erwachsenenähnliche Erscheinung konfrontiert und auch neuen Erwartungen Dritter ausgesetzt. Dies bedeutet für die Mädchen eine wesentlich frühere Auseinandersetzung mit den geltenden Geschlechtsrollen, der Bedeutung der sexuellen Reifung und Erwartungen an das jugendliche Alter als dies für Jungen der Fall ist. Durch die säkulare Akzeleration reifen Mädchen heute auch erheblich früher als vor 150 Jahren (Tanner, 1989). Die Konfrontation mit den oben erwähnten Entwicklungsaufgaben mag für sehr viele Mädchen zu früh sein, weil ihre Kindheit damit im Vergleich zu den Jungen verfrüht aufhört. Das heiût, dass sie möglicherweise auch viel zu früh einige der Privilegien und Schutzfaktoren der Kindheit verlieren (siehe oben). Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter Die pubertäre Reifung bringt weitere ¾nderungen mit sich, auf welche die Mädchen meistens nicht vorbereitet sind. Das eine ist die normale Gewichtszunahme, welche vor allem durch eine Fettzunahme bedingt ist. Viele Mädchen erleben als Folge eine Stagnation oder sogar einen leichten Rückgang ihrer Kraft. Dies kann mitentscheidend sein für die rückgängige Motivation vieler Mädchen, sich sportlich zu betätigen. Die SMASH 2002-Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Mädchen signifikant weniger physische Aktivität angaben als Jungen (Narring et al., 2004). Die Hälfte der Mädchen hatte sogar zu wenig physische Aktivität (WHO-Normen). Dies bedeutet, dass ein Teufelskreis entstehen kann und dass Mädchen schlussendlich weniger Möglichkeiten haben, ihren Körper als effizientes Instrument zu erleben. Dies passt sehr gut zu der Annahme, dass Mädchen sehr früh lernen, ihren Körper eher als Objekt aus einer Auûenperspektive zu betrachten (McKinley, 1998) als auf ihre körperliche Kompetenz zu achten; dies scheint bei Jungen umgekehrt zu sein. Mädchen und Jungen unterscheiden sich auch in ihrem Bewältigungsstil. Nolen-Hoeksema (1987) hat beispielsweise beschrieben, wie Frauen über entstehende Probleme ± inklusive depressive Stimmung ± grübeln und sie auf diese Weise sogar noch verstärken, während Männer sich eher abzulenken scheinen. Dies mag mit grundsätzlicheren Unterschieden zwischen Frauen und Männern verbunden sein, die heute noch zu wenig erforscht sind. Zum Beispiel weiû man, dass Mädchen in der frühen Kindheit den Jungen verbal überlegen sind, ihre Sprachfertigkeiten jedoch abhängig sind von ihren Gesprächspartnern und Modellen (z. B. Bornstein, Haynes, Painter & Genevro, 2000; Gleason & Ely, 2002; Ladegaard & Bleses, 2003). Die Rolle der weiblichen Hormone ist sehr umstritten und es fehlen klare Belege dafür, dass bei einer depressiven Episode eine biologische Fehlregulation der Hormone auftritt (Flammer & Alsaker, 2002). Ein Zusammenhang zwischen depressiver Verstimmung und hormonellen Schwankungen ist auch diskutiert worden. Besonders Befunde, welche zeigen, dass Phasen von geringerer Produktion von Östrogen ein gewisses Risiko für solche Verstimmungen bergen, sind in diesem Zusammenhang interessant (Harrington, 1993), jedoch bis heute nicht schlüssig bewiesen. Kognitive Faktoren können in der Entwicklung und Aufrechterhaltung depressiver Symptome eine wichtige Rolle spielen. Interessant wäre deshalb zu untersuchen, inwiefern Mädchen zu einem frühen Zeitpunkt dahin sozialisiert werden, spezifische dysfunktionale kognitive Muster zu entwickeln, welche unter anderem internale, globale und stabile Attributionen, negative Selbstbewertungen und einen geringen Glauben an persönliche Kontrolle beinhalten (vgl. Alsaker, 2000; Groen & Petermann, 2002). 173 Obwohl viele der Erklärungen für die Geschlechtsunterschiede bei Depression im Jugendalter immer noch hypothetischer Natur sind, kann zusammenfassend festgehalten werden, dass Mädchen, ganz besonders früh entwickelte, ein höheres Risiko aufweisen als Jungen, während der Adoleszenz eine depressive Störung zu entwickeln. Wissenschaftlich bestätigte Modelle, welche die zu beobachtende geschlechtsspezifische Verletzbarkeit erklären, liegen bisher noch nicht vor. Bestehende Erklärungsansätze, die oben teilweise besprochen wurden, deuten jedoch darauf hin, dass eine Kumulation von Stressoren und neuen teilweise non-normativen Entwicklungsaufgaben während der körperlichen Reifung besonders kritisch ist. Zu klären bleibt jedoch z. B. die Frage, ob Mädchen von der Abnahme protektiver Faktoren (Harrington, 1993) stärker betroffen sind als Jungen. Noch ungeklärt bleibt auch die Entwicklung von dysfunktionalen Schemata und Reaktionen in Problemsituationen (z. B. das Grübeln = sog. Rumination). Allgemein erscheint ein Fokus auf eine Stärkung des Selbstwerts und der Kompetenzerfahrungen von Mädchen in einem frühen Alter sinnvoll. Externalisierende Probleme Externalisierendes Problemverhalten umfasst eine Reihe von Handlungen, die von einem einfachen Normbruch bis hin zur groben physischen Gewalt reichen. Nachfolgend werden drei Formen von externalisierendem Problemverhalten dargestellt, welche einerseits stark miteinander korrelieren und andererseits interessante Unterschiede in den Geschlechterdifferenzen zeigen: Aggressives Verhalten gegen Personen, delinquentes Verhalten und Konsum von legalen und illegalen Substanzen. Antisoziales Verhalten: Aggression und Delinquenz Aggressives Verhalten kann sehr unterschiedliche Ausdrucksformen annehmen. Aggressive Handlungen sind nur in seltenen Fällen körperlicher Art. Verbale und äuûerst subtile Formen der Aggression kommen im Allgemeinen häufiger vor. Grundsätzlich geht es bei aggressivem Verhalten immer um ein Verhalten, welches zum Ziel hat, eine andere Person absichtlich zu verletzen. Um auch Formen der instrumentellen Aggression (Aggression ist ein Mittel zum Ziel) oder von eher habituellen Verhaltensweisen berücksichtigen zu können, muss die Absichtsdefinition umformuliert werden, d. h. dass ein Verhalten, welches mit dem Bewusstsein der verletzenden Wirkung ausgeübt wird, auch als aggressiv gekennzeichnet wird (Alsaker, 2003). Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen direkten und indirekten Formen der Aggression. Direkte Ag- 174 FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer gression ist unmittelbar und offensichtlich gegen eine Person (oder deren Eigentum) gerichtet. Täter und Opfer sind miteinander konfrontiert. Bei den indirekten Formen der Aggression findet keine solche Konfrontation statt. Indirekte Formen haben für die Täterin oder den Täter den eindeutigen Vorteil, dass sie den Anschein erwecken können, dass gar keine Absicht bestand, jemanden zu schädigen. Es können beispielsweise Mitschüler/ innen als Werkzeuge für den Angriff auf die Zielperson gebraucht werden. Obwohl die direkten Formen unmittelbar am dramatischsten sind und besonders in den Medien am meisten Aufmerksamkeit erlangen, nimmt ihr Anteil in der Adoleszenz ab, während der Anteil der indirekten Formen zunimmt. Ein Groûteil der Studien über die letzten 20 Jahre zeigt deutliche Unterschiede im aggressiven Verhalten von Mädchen und Jungen (z. B. Coie & Dodge, 1998; Maccoby & Jacklin, 1980; Parke & Slaby, 1983): Jungen sind häufiger unter den Aggressoren zu finden und Mädchen werden am häufigsten von Jungen aggressiv behandelt (z. B. Olweus, 1996). Problematisch an diesen Ergebnissen ist aber, dass vor allem direkte physische Formen der Aggression gemessen wurden. Auf dieses Problem ist man in den 90er-Jahren aufmerksam geworden und man hat in der Folge entsprechend vermehrt auch indirekte Aggressionsformen untersucht. Zusammengefasst zeigen die Befunde, dass Mädchen in der Anwendung indirekter Aggressionsformen den Jungen überlegen sind, während Letztere sich häufiger direkten Formen der Aggression bedienen (Björkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Crick, 1997; Cairns & Cairns, 1994). Interessanterweise verändert sich die bevorzugte Aggressionsform in gegengeschlechtlichen Auseinandersetzungen: Jungen verwenden weniger oft physische Aggression gegenüber Mädchen als gegenüber Jungen, während Mädchen gegenüber Jungen öfter physisch aggressiv sind als gegenüber Mädchen (Cairns & Cairns, 1994). Beobachtet man jedoch das Verhalten von hoch aggressiven Mädchen und Jungen, so scheinen die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich Häufigkeit und Intensität der Aggressionsausbrüche zu verschwinden; dies taten Cairns und Cairns (1994), indem sie das Verhalten von 40 Schülerinnen und Schülern untersuchten, welche im Voraus von Lehrpersonen als extrem aggressiv bezeichnet worden waren. Die Autoren erwähnen auûerdem, dass die üblichen Geschlechtsunterschiede in der Prävalenz von Gewaltakten in sehr gefährdeten Groûstadtquartieren der USA auch nicht zu finden sind. Es besteht heute kein Zweifel daran, dass aggressive Kinder ein erhöhtes Risiko für späteres aggressives Verhalten aufweisen. Aggressives Verhalten gehört zu den stabilsten Merkmalen in der Entwicklung (Olweus, 1979) und ist auch ein guter Prädiktor für delinquentes Verhalten. Mögliche Faktoren, die zur Erklärung der Geschlechtsunterschiede in aggressivem Verhalten in der Adoleszenz herangezogen werden können, werden deshalb zusammen mit den Unterschieden im delinquenten Verhalten diskutiert. Unter delinquenten Handlungen versteht man im Allgemeinen antisoziale Handlungen, die gegen das Strafrecht verstoûen; deswegen wird der Begriff meistens erst bei Jugendlichen verwendet. Betrachtet man ausschlieûlich Gerichtsurteile und polizeiliche Statistiken, läuft man Gefahr, das tatsächliche Vorkommen zu unterschätzen, da viele Delikte gar nicht erst angezeigt werden oder die Täterschaft unaufgeklärt bleibt (Flammer & Alsaker, 2002). Dadurch können beispielsweise auch Alterstrends verzerrt werden, weil delinquente Jugendliche mit der Zeit geschickter werden und nicht mehr so leicht ertappt werden (vgl. Rutter, Giller & Hagell, 1998). Gemäû verfügbaren Statistiken zeigt sich zuerst eine Zunahme der Anzahl Delikte, die von der jugendlichen Population ausgeübt wurden, bis ins junge Erwachsenenalter, gefolgt von einer Abnahme. Alle Statistiken zum antisozialen Verhalten zeigen deutliche Geschlechtsunterschiede zu Ungunsten der Jungen. Loeber (1990) stellt jedoch fest, dass diese Unterschiede in den 80er-Jahren etwas abgenommen haben. Dies als Folge davon, dass Mädchen insgesamt etwas mehr antisoziales Verhalten zeigen. Im Schulkontext lassen sich bereits erste Verhaltensprobleme feststellen, welche in klinischen Klassifikationen je nach Symptomen und Symptomkonstellation Störung des Sozialverhaltens oder Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten genannt werden (vgl. Scheithauer & Petermann, 2002). Kinder und junge Adoleszente, die ein solches Verhalten zeigen, haben häufig Schwierigkeiten mit ihren Gleichaltrigen. Viele von ihnen werden abgelehnt und eine kleine Gruppe wird auch regelrecht von anderen gemobbt (die so genannten Täter-Opfer oder aggressiven Opfer; Alsaker, 2003; Schwartz, Proctor & Chien, 2001). Es ist allerdings wichtig zu bemerken, dass wiederum andere aggressive Schüler und Schülerinnen sich sehr wohl in der sozialen Hierarchie geschickt durchzusetzen wissen (die so genannte Mobbing-Täter; Alsaker, 2003). Durch ihr gezielt eingesetztes, aggressives oder sonst aggressiv-dissoziales Verhalten erreichen sie das Ansehen anderer Mitschülerinnen und Mitschüler und sind eher als Anführer in der Klasse anzusehen. Es scheint heute eindeutig belegt zu sein, dass Kinder und Jugendliche mit antisozialem Problemverhalten, ob sie nun abgelehnt oder eher bewundert werden, sich sehr früh Gleichgesinnte suchen (Alsaker, 2003; Cairns, Cairns, Neckermann, Gest & Gariepy, 1988; Patterson, Capaldi & Bank, 1991) und dass ihr antisoziales Verhalten sich allmählich zur Delinquenz entwickelt (Loeber, 1990). Solche jugendlichen Delinquenten bezeichnet Moffitt (1993) als die anhaltend-aggressiven (¹lifecourse persistentª) im Vergleich zu den Jugendlichen, die lediglich während der Adoleszenz delinquent werden (¹adolescence limitedª). Diese Begriffe finden wir als zwei Subtypen der Störung des Sozialverhaltens im Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter DSM-IV (vgl. Scheithauer & Petermann, 2002). Jugendliche, welche erst in der Adoleszenz antisoziales Verhalten zeigen, sind laut Moffitt durch vorübergehendes Problemverhalten gekennzeichnet, welches sich im frühen Erwachsenenleben, mit Einsetzen von Familienund Arbeitspflichten einstellt. Die Analyse eines späteren Follow-ups stellte diese Interpretation jedoch etwas infrage (Nagin et al., 1995): Interessant ist vor allem, dass die so genannten auf die Adoleszenz begrenzten Delinquenten mit 32 Jahren im Gegensatz zu den anhaltend Aggressiv-Dissozialen keine Strafurteile mehr aufwiesen, jedoch selbst immer noch delinquente Taten angaben (Diebstahl, Einbrüche und Fahren unter Einfluss von Alkohol). Diese jungen Erwachsenen hatten ihre delinquenten Aktivitäten auf Taten eingeschränkt, die seltener entdeckt oder gemeldet werden. Warum einige Jugendliche überhaupt mit delinquenten Aktivitäten anfangen, hat Moffitt (1993) mit der so genannten Reifelücke (maturity gap)-Hypothese zu erklären versucht. Die Hypothese besagt, dass Delinquenz ein Mittel ist, um sich zu einem Erwachsenenstatus zu verhelfen, weil Adoleszente heute körperlich reifen, lange bevor sie Zugang zu Ressourcen und Statussymbolen der Erwachsenenwelt erhalten. Es stellt sich dann die Frage, weshalb nicht Mädchen häufiger delinquentes Verhalten zeigen, da sie diese Reifelücke noch früher und eindeutiger erleben. Weiter kann man sich fragen, ob die Situation der Jugendlichen Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wirklich besser war. Diese Jugendlichen mussten bereits in die Erwachsenenwelt (oft Arbeitswelt) eintreten als sie noch Kinder waren oder wie solche aussahen (Alsaker, 1995). Man dürfte annehmen, dass der soziale Druck, sich wie Erwachsene zu benehmen ± und dabei altersinadäquates Verhalten zu zeigen ±, damals noch gröûer war. Bei den Mädchen und Frauen kommt der anhaltendaggressive Lebensstil selten vor, ungefähr 10-mal seltener als bei den Jungen (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001). Das heiût, dass praktisch alle Mädchen, die in irgendeiner Form antisozial werden, damit erst in der Adoleszenz beginnen oder es nur vorübergehend in der Adoleszenz sind. Der Geschlechtsunterschied in der Prävalenz von antisozialem Verhalten ist in der Adoleszenz dann auch bedeutend geringer, das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen beträgt nämlich 1.5 : 1 (Moffitt et al., 2001). Interessanterweise gibt es hinsichtlich aggressiv-dissozialem Verhalten bei Jugendlichen nicht nur Geschlechtsdifferenzen, sondern auch einige ¾hnlichkeiten und dies besonders in der mittleren Adoleszenz (um das Alter von 15 Jahren). Dies erklären sich Moffitt et al. (2001) damit, dass zu diesem Zeitpunkt der gröûte Teil der Mädchen körperlich reif ist, während dies bei der Mehrheit der Jungen noch nicht der Fall ist. Die Autoren erklären dies dadurch, dass die Reifelücke in dieser Phase für die Mädchen bereits spürbar ist und sie sich 175 darum ± zu einem gröûeren Teil als ihre gleichaltrigen Kollegen ± älteren Jugendlichen anschlieûen und versuchen, sich die Privilegien des Erwachsenenstatus u. a. mit externalisierendem Problemverhalten zu verschaffen. Diese Tendenz, sich älteren Jugendlichen anzuschlieûen, haben andere Forscherteams bezüglich der frühreifen Mädchen gezeigt (Stattin & Magnusson, 1990; Silbereisen, Petersen, Albrecht & Kracke, 1989). Hier muss man sich deshalb fragen, ob dies auf ein Bedürfnis der frühreifenden Mädchen (Reifelücke) oder eher der älteren Jungen zurückzuführen ist. Die Forschungsgruppen um Magnusson und Silbereisen haben nämlich gezeigt, dass diese älteren Freunde häufiger in der Arbeitswelt waren und häufiger deviantes Verhalten zeigten. Für diese sehr reifen oder normbrechenden Jugendlichen waren möglicherweise zum Zeitpunkt der zwei Studien ± Ende der 60er bis Mitte der 80er-Jahre ± junge unerfahrene, aber schon körperlich reife Mädchen besonders attraktiv. Henneberger und Deister (1996) haben auch gezeigt, dass frühreife Mädchen, die in einem sozialen Umfeld lebten, in denen sie vor älteren Jugendlichen ¹geschütztª waren, nicht mehr normbrechendes Verhalten zeigten als später entwickelte Mädchen. Es steht noch aus zu prüfen, welche der beiden Hypothesen ± erlebte Reifelücke der Mädchen oder erleichterter Zugang zu sexuellen Partnerinnen für die Jungen ± die erhöhte Delinquenztendenz der frühreifen Mädchen am besten erklärt. Wir dürfen in diesem Zusammenhang die Akzentuierungshypothese jedoch nicht vergessen (Caspi & Moffitt, 1991). Es könnte nämlich auch sein, dass externalisierende Probleme bei Mädchen (wegen ihrem eher indirekten Charakter) in der Kindheit bagatellisiert oder übersehen werden, und dass die Pubertät und insbesondere die Frühreife diese akzentuiert und in diesem Alter auch sichtbar macht. Risikofaktoren für aggressiv-dissoziales Verhalten und mögliche Erklärungen der Geschlechtsunterschiede Verschiedene und interagierende Risikofaktoren tragen dazu bei, dass ein Mensch delinquent wird. Je nach dem, ob individuelle Unterschiede oder Unterschiede zwischen Gruppen erklärt werden sollen, müssen individuelle und/oder gesellschaftliche Faktoren in Betracht gezogen werden. Gemäû Hartup und van Lieshout (1995) gibt es wenig Evidenz für eine genetische Erklärung des aggressiven oder aggressiv-dissozialen Verhaltens. Neuere Studien weisen eher auf indirekte genetische Einflüsse über Dispositionen zu impulsivem Verhalten oder über neuropsychologische Störungen (siehe Scheithauer & Petermann, 2002). Groûe Anteile der Stabilität dieses Problemver- 176 FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer haltens können durch die Stabilität wichtiger Risikofaktoren im sozialen Kontext erklärt werden, z. B. Armut, öffentliche Gewalt, Probleme in der Familie. Wenn Geschlechtsunterschiede erklärt werden sollen, müssen insbesondere Geschlechtsunterschiede hinsichtlich dem anhaltend-aggressiven Verhalten erklärt werden. Moffitt et al. (2001) finden in ihrer Dunedin-Längsschnitt-Studie Bestätigung für die Hypothese, dass Männer mit gröûerer Wahrscheinlichkeit antisozial werden als Frauen, weil sie von geschlechterunspezifischen individuellen und sozialen Risikofaktoren in einem höheren Ausmaû betroffen sind. Dies gilt insbesondere für neurokognitive Defizite, Hyperaktivität und problematische Gleichaltrigenbeziehungen. Dies sind Risiko- und Ursachenfaktoren, die allerdings nicht in der Adoleszenz, sondern in der frühen Kindheit zu orten sind, und auch die Entwicklung dieser problematischen Verhaltensweisen in dieser frühen Lebensphase beeinflussen und deshalb in diesem Artikel nicht weiter ausgeführt werden. Konsum von legalen und illegalen Drogen Im Sinne der Reifelücke, ist es wichtig zu bemerken, dass der frühe Konsum von legalen Substanzen, die den Erwachsenen vorbehalten sind, eine Annäherung an die angestrebte Erwachsenenrolle darstellen kann (Flammer & Alsaker, 2002). Deshalb interessiert uns der Konsum von Tabak und Alkohol sehr. Sowohl der Konsum von legalen als auch illegalen (harten und weichen) Drogen stellt ein Risiko für die Entwicklung der Jugendlichen dar. Während die Gefahren der Einnahme von harten Drogen (u. a. Persönlichkeitsveränderungen und körperliche und psychische Abhängigkeit) eindeutig und allgemein bekannt sind, wird den Risiken der legalen Drogen weniger Aufmerksamkeit geschenkt und sie werden auûerdem häufig kontrovers behandelt (Flammer & Alsaker, 2002). Da die Adoleszenz generell als Zeit des Ausprobierens gilt, erstaunt es nicht, dass auch im Bereich Konsum illegaler und legaler Substanzen experimentiert wird. Verschiedene Ziele ± welche zu den Entwicklungsaufgaben dieser Altersgruppe gehören ± können damit verfolgt werden: Identitätssuche, Erhöhung des Selbstwerts, Findung einer Rolle in einem sozialen Kontext, Befriedigung der Neugier oder Freude am Unbekannten. Wichtige Faktoren für den Ausgang des Experimentierens scheinen allerdings das Alter beim ersten Konsum, die gesamte Konsummenge und eine gute soziale und familiäre Einbettung zu sein (Flammer & Alsaker, 2002). Studien zum Übergang von weichen zu harten Drogen und zum früh einsetzenden Alkoholmissbrauch deuten weiter darauf hin, dass viele der Risikofaktoren, die eine delinquente Laufbahn voraussagen können (vgl. oben), auch für Missbrauch von Alkohol und illegalen Substanzen zentral sind. Das heiût, dass generell höhere Prävalenzraten bei Jungen als Mädchen zu erwarten ist. Tabak Tabak gehört zwar zu den eindeutigsten gesundheitsgefährdenden Substanzen, aber es ist in vielen Ländern noch erlaubt, für diese Substanz Werbung zu machen, die häufig gerade sehr jugendlich gebliebene, junge und erfolgreiche Erwachsene darstellt und somit eindeutig Jugendliche anspricht, die sich lieber mit dieser Altersklasse als mit älteren Erwachsenen identifizieren. Gemäû der bereits erwähnten Gesundheitsbefragung SMASH 2002 scheint die Zahl der regelmäûig Rauchenden im Alter zwischen 16 und 20 Jahren zuzunehmen. Während es im Alter von 13 bis 14 Jahren 4 % der Mädchen und 6 % der Jungen sind (Schmid, 2003), sind es mit 15 Jahren bereits 19% und 18 % und schlieûlich mit 20 Jahren 30 % respektive 40 % (Narring et al., 2004). Es gibt einige Hinweise dafür, dass der Tabakkonsum bei Jugendlichen zugenommen hat, und dies insbesondere bei Mädchen. Dies berichten auch Richter und Settertobulte (2003) von den Ergebnissen der aktuellsten, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützten, HBSC-Schüler/innen-Befragung (11- bis 15-Jährige) aus Deutschland: Ursprünglich festzustellende Geschlechtsunterschiede sind ± bei seit den 90er-Jahren steigendem Konsum ± heute nivelliert oder sogar umgekehrt, jedoch ausschlieûlich bei den gemäûigten Konsummustern. Der Anstieg des Zigarettenkonsums bei jugendlichen Mädchen mag mit einer Identifikation mit einer neuen Geschlechterrolle verbunden sein. Mädchen heute haben vielleicht immer noch das Bedürfnis, der Öffentlichkeit und den Erwachsenen zu zeigen, dass sie sich frühere Männerrechte angeeignet haben. Ein weiterer Grund für den steigenden Konsum kann auch ± in einer Phase, in der sie laut biologischem Programm zunehmen sollen ± mit einem ganz anderen Bedürfnis im Zusammenhang stehen, nämlich ihr Gewicht zu kontrollieren. Beide Hypothesen sind allerdings noch nicht empirisch geprüft. Alkohol Die Substanz, mit welcher Jugendliche meistens ihre ersten Erfahrungen machen, ist der Alkohol. Eine mit dem Tabakkonsum vergleichbare Zunahme zeigt sich in der Studie SMASH 2002 auch in Bezug auf den Alkoholkonsum. Während in der Studie von 1993 28% der Mädchen angaben, ein- oder mehrmals pro Woche Alkohol zu konsumieren, waren es 2002 bereits 42 %. Auûerdem berich- Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter teten 30 % der Mädchen und 52 % der Jungen, in den 30 Tagen vor der Befragung mindestens einmal richtig betrunken gewesen zu sein. Trotz der stärkeren Zunahme bei den Mädchen, sind nach wie vor groûe Geschlechtsunterschiede erkennbar; dies bestätigen auch die Ergebnisse der deutschen Stichprobe der HBSC-Studie (Richter & Settertobulte, 2003). Cannabis Nebst Alkohol ist Cannabis die von den Jugendlichen am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz und in der Regel die erste konsumierte illegale Substanz. Das durchschnittliche Einstiegsalter ist in der deutschen Stichprobe der HBSC-Studie 16.4 Jahre (Richter & Settertobulte, 2003). Den frühen Erstkonsum von Cannabis bestätigen auch die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung SMASH 2002: 48% der 16-jährigen Mädchen und 53 % der 16-jährigen Jungen gaben an, sie hätten bereits einmal Cannabis konsumiert. Auûerdem berichteten 4% der Mädchen und 13 % der Jungen zwischen 16 und 20 Jahren einen täglichen Konsum. Im Zusammenhang mit dem Cannabis-Konsum gaben auch ungefähr 40%, der weiblichen und männlichen Jugendlichen, welche mindestens 10-mal im Monat konsumierten, an, in der Schule oder auf der Arbeit diesbezüglich bereits Probleme gehabt zu haben (Tschumper & Diserens, 2004). Synthetische Drogen Synthetische Drogen, die auch Technodrogen oder Designerdrogen oder Life-Style-Drogen genannt werden, können bereits bei geringeren Mengen starke Wirkung erbringen, meist ist es eine Mischung von ¹GedankenBeschleunigungª und halluzinogenen Effekten (Schmiedbauer, 1997). Leider sind Ausmaû und Effekt des Konsums noch nicht vollständig erforscht. Jedoch gibt es aus der psychiatrischen Praxis Anzeichen dafür, dass einige Konsumierende von Designerdrogen massive Angstsymptome entwickeln. Während der Cannabis-Konsum im Alter von 16 Jahren schon recht stark verbreitet ist, trifft dies nicht im gleichen Ausmaû auf den Konsum von synthetischen Drogen zu. Ergebnisse der Studie SMASH 2002 zeigen, dass allerdings bereits 5 % der 16-Jährigen schon einmal in ihrem Leben eine solche Substanz konsumiert haben, und dass ungefähr 15 % bei den 20-Jährigen solche Erfahrungen haben, wobei männliche Jugendliche fast doppelt so häufig vertreten sind wie Mädchen. Es gibt aber Hinweise dafür, dass die Mehrheit der Konsument/innen eher einen Gelegenheits- und Genusskonsum betreiben (Narring et al., 2004). 177 Mögliche Erklärungen von Geschlechtsdifferenzen Gemäû Reese und Silbereisen (2001, zit. nach Richter & Settertobulte, 2003) weist die Tatsache, dass der Konsum einiger psychoaktiver Substanzen im Jugendalter beginnt und/oder in dieser Phase häufig oder intensiv auftritt, auf mögliche Funktionen dieser Verhaltensweisen hin. Richter und Settertobulte (2003) sind der Auffassung, dass der Konsum eng mit der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (Identitätsentwicklung, Aufbau von Freundschaften, Ablösung von den Eltern etc.) zusammenhängt und als Bewältigungsverhalten verantwortungsvoll eingesetzt durchaus adaptiv sein kann. Diese Sichtweise hängt eng zusammen mit der kontroversen Diskussion rund um das Experimentieren mit psychoaktiven Substanzen. Wie wir auch am Anfang des Artikels ausgeführt haben, kann normabweichendes Verhalten Teil der Identitätssuche sein, kann aber auch die eigene Entwicklung oder die Entwicklung anderer gefährden. Deswegen kann solches Verhalten erst als problematisch gekennzeichnet werden, wenn es die punktuelle Funktion nicht erfüllt oder die weitere Entwicklung hemmt. Dies ist auch die Sicht von Richter und Settertobulte (2003). Sie betrachten den ¹Substanzkonsum [¼] vor allem dann problematisch, wenn er sehr früh oder exzessiv einsetzt oder wenn er in Kombination mit anderen problematischen Verhaltensweisen auftritt und daraus eine instrumentelle Gewohnheit wird, die zu einer frühen Einschränkung des Verhaltensrepertoires bei Problemen und Anforderungen führtª (Richter & Settertobulte, 2003, S. 103). Von daher zu behaupten, dass das Experimentieren oder überhaupt der Konsum von psychoaktiven Substanzen in der Adoleszenz ¹gesundª ist, ist unserer Meinung nach nicht angebracht. Unsere Auffassung ist, dass man solchen Konsum nicht unbedingt als Problemverhalten abstempeln, jedoch als Fachperson sehr achtsam sein sollte, potenziell gefährdendes Verhalten als harmlos zu propagieren. Immerhin berichten 10 % aller SMASH 2002-Jugendlichen (9 % der Mädchen und 12 % der Jungen) ± und 40% der häufiger konsumierenden Jugendlichen (siehe oben), dass sie wegen ihrem Drogenkonsum bereits Leistungsprobleme in der Schule oder am Arbeitsplatz hatten, oder auch wegblieben (Narring et al., 2004). Warum konsumieren im Allgemeinen mehr Jungen als Mädchen psychoaktive Substanzen? Wenn der Substanzkonsum ein Bewältigungsverhalten darstellen sollte, wäre der Mehrverbrauch der Jungen ein Anzeichen von einem klaren Mangel an anderen Coping-Strategien, d. h. eigentlich der Unfähigkeit mit effizienten Bewältigungsstrategien Substanzkonsum umzugehen. Es könnte auch ein Indikator von erhöhter Belastung im Vergleich zu den Mädchen sein. Während Mädchen (wie bereits diskutiert) möglicherweise am Anfang der Pubertät mit vielen gleichzeitigen Belastungen konfrontiert 178 FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer werden, kann es sein, dass Jungen in einer späteren Phase der Adoleszenz stärker dem allgemeinen gesellschaftlichen (und elterlichen) Leistungsdruck ausgesetzt werden. Ein ähnliches Argument brauchen Richter und Settertobulte (2003) auch, um den höheren Alkoholkonsum bei Jugendlichen in höheren Wohlstandsschichten zu erklären. Die geltenden Geschlechterrollen sind in dieser Konsumdiskussion auch sehr wichtig: Frauen trinken traditionell nicht, Männer schon. Das bedeutet, dass der Konsum von Alkohol für männliche Jugendliche als Mittel zum Erlangen des Erwachsenenstatus wahrgenommen werden kann, dass dies aber nicht unbedingt für Frauen gilt. Der klare Konsumanstieg bei den weiblichen Jugendlichen könnte deshalb auch ein Indikator einer Wende in der geltenden Frauenrolle sein, wie es auch für den Tabakkonsum der Fall sein kann. Ein weiterer Grund für den genannten Anstieg ist allerdings viel konkreterer Art: Der Anstieg des Alkoholkonsums überhaupt zwischen 1992 und 2002 scheint vor allem auf den Konsum von gesüûten modischen Alkoholgetränken (Alkopops) zurückzuführen zu sein (Narring et al., 2004). Diese Getränke sind für junge Mädchen besonders attraktiv, weil die vielen Zusätze den Alkoholgeschmack maskieren. Ein weiterer Faktor, der Konsumunterschiede zwischen weiblichen und männlichen Jugendlichen erklären kann, betrifft die unterschiedlichen sozialen Umgangsformen mit Peers. Jungen bewegen sich bekanntlich in gröûeren Gruppen von Gleichaltrigen und das Zusammensein mit den gleichgeschlechtlichen Peers gestaltet sich anders als bei Mädchen, die sich eher zu zweit oder in kleinen Gruppen treffen. Und während Mädchen sehr gerne miteinander reden, bevorzugen die Jungen zusammen etwas zu tun. Youniss und Smollar (1985) fanden bereits in den 80er-Jahren, dass Jungen sich häufig zu Aktivitäten in Verbindung mit Alkohol oder anderen Drogen trafen. Jungen gelangen wahrscheinlich leichter in ¹Trinkgesellschaftenª, haben einen erleichterten Zugang zu Alkohol und anderen Drogen und stehen gleichzeitig unter einem stärkeren sozialen Druck (¹wenn man nicht trinken kann, ist man ein Schwächlingª). Der problematische Drogenkonsum ist allerdings häufig mit anderen normbrechenden Aktivitäten verbunden und so wird auch ein gewisser Anteil der Geschlechtsunterschiede durch die häufigeren anhaltenden Verhaltensprobleme der Jungen erklärt. Die Geschlechtsunterschiede entsprechen in vielen Aspekten den geltenden Geschlechterstereotypen: Frauen achten auf ihre Linie, sind mit sich selber unzufrieden und ziehen sich in sich selbst zurück, wenn die Belastungen zu groû werden; Männer sind eher ausagierend und konsumieren häufiger Drogen. Die eine Form ist keineswegs der anderen überlegen, alle Typen von Verhalten, die wir als problematisch bezeichnet haben, sind für die Entwicklung der betroffenen Jugendlichen kritisch, auch wenn sie statistisch gesehen eine sehr groûe Anzahl Jugendlicher betreffen (und somit beinahe als normativ gelten könnten). Es ist aus den Diskussionen der Unterschiede und den Erklärungsversuchen auch ersichtlich geworden, dass konkrete präventive Maûnahmen nötig sind, die den jeweiligen Bedürfnissen der beiden Geschlechter angepasst sein müssen (vgl. auch Brezinka, 2003). Auf einer etwas abstrakteren Ebene sind jedoch auch klare ¾hnlichkeiten in den Präventionsbedürfnissen deutlich herauszusehen. l l l Erstens scheint eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle für die Lösung der aufkommenden Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz von groûer Bedeutung zu sein. Zweitens ist der Umgang mit dem sozialen Druck bei Jugendlichen beider Geschlechter zentral. Drittens wurde auch bei allen genannten psychischen oder behavioralen Problemen ein eindeutiges Bedürfnis ersichtlich, gefährdete Jugendliche mit besseren Bewältigungsstrategien auszurüsten. Für beide Geschlechter gilt auûerdem, dass Prävention oder gegebenenfalls Interventionen so früh wie möglich angeboten werden sollten, da die Gefahr der Zementierung von problematischen Verhaltensweisen in diesem Alter eindeutig besteht. Da viele der genannten Probleme ihren Ursprung (vor allem Gewalt) oder mindestens gewisse Vorläufer in früheren Entwicklungsphasen haben (vgl. Caspi & Moffitt, 1991), ist es unerlässlich, die Geschlechtsunterschiede, die in der Adoleszenz zum Vorschein kommen, mit möglichen geschlechtsspezifischen Verursachern in der Kindheit in Verbindung zu setzen. Dies bedeutet konkret, dass wir auch vermehrt Längsschnittstudien brauchen, die auf den Übergang von der Kindheit zur Adoleszenz fokussieren. Literatur Allgood-Merton, B., Lewinsohn, P. M. & Hops, H. (1990). Sex differences and adolescent depression. Journal of Abnormal Psychology, 99, 55 ± 63. Alsaker, F. D. (1992). Pubertal timing, overweight, and psychological adjustment. Journal of Early Adolescence, 12, 396 ± 419. Alsaker, F. D. (1995). Timing of puberty and reactions to pubertal changes. In M. Rutter (Ed.), Psychosocial disturbances in young people: Challenges for prevention (pp. 39 ± 82). New York: Cambridge University Press. Alsaker, F. D. (1996). Annotation: the impact of puberty. Journal of Psychology and Psychiatry, 37, 249 ± 258. Alsaker, F. D. (2000). The development of a depressive personality orientation: The role of the individual. In W. J. Perrig & A. Grob (Eds.), Control of human behaviour, mental processes and conciousness (pp. 345 ± 359). Hillsdale: Erlbaum. Alsaker, F. D. (2003). Quälgeister und ihre Opfer. Bern: Huber. Geschlechtsunterschiede im Auftreten von psychischen und Verhaltensstörungen im Jugendalter Alsaker, F. D. & Olweus, D. (1992). Stability of global self-evaluations in early adolescence. A cohort longitudinal study. Journal of Research on Adolescence, 2, 123 ± 145. Alsaker, F. D. & Olweus, D. (1993). Global self-evaluations and perceived instability of self in early adolescence: A cohort longitudinal study. Scandinavian Journal of Psychology, 34, 47 ± 63. Angold, A. (1988). Childhood and adolescent depression: 1. Epidemiological and aetiological aspects. British Journal of Psychiatry, 152, 601 ± 617. Berrios, G. E. (1996). The history of mental symptoms. Cambridge: Cambridge University Press. Björkqvist, K., Lagerspetz, K. M. & Kaukiainen, A. (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. Aggressive Behavior, 18, 117 ± 127. Bornstein, M. H., Haynes, O. M., Painter, K. M. & Genevro, J. L. (2000). Child language with mother and with stranger at home and in the laboratory: A methodological study. Journal of Child Language, 27, 407 ± 420. Brezinka, V. (2003). Zur Evaluation von Präventionsinterventionen für Kinder mit Verhaltensstörungen. Kindheit und Entwicklung, 12, 71 ± 83. Burns, R. B. (1979). The self-concept. Theory, measurement, development and behavior. London: Longman. Cairns, R. B. & Cairns, B. D. (1994). Lifelines and risks. Pathways of youth in our time. New York: Harvester Wheatsheaf. Cairns, R. B., Cairns, B. D., Neckerman, H. J., Gest, S. D. & GariØpy, J. (1988). Social networks and aggressive behavior: Peer support or peer rejection? Developmental Psychology, 24, 815 ± 823. Caspi, A. & Moffitt, T. E. (1991). Individual differences are accentuated during periods of social change: The sample case of girls at puberty. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 157 ± 168. Coie, J. D. & Dodge, K. A. (1998). Aggression and antisocial behavior. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (5th Ed., pp. 779 ± 862). New York: Wiley. Crick, N. R. (1997). Engagement in gender normative versus nonnormative forms of aggression: Links to social-psychological adjustment. Developmental Psychology, 33, 610 ± 617. Davison, K. K., Markey, C. N. & Birch, L. L. (2003). A longitudinal examination of patterns in girls weight concerns and body dissatisfaction form ages 5 to 9 years. International Journal of Eating Disorders, 33, 320 ± 332. Dreher, E. & Dreher, M. (1985). ¹Entwicklungsaufgabeª ± Theoretisches Konzept und Forschungsprogramm. In R. Oerter (Hrsg.), Lebensbewältigung im Jugendalter (S. 30 ± 61). Weinheim: Edition Psychologie. Essau, C. A. (2002). Depression bei Kindern und Jugendlichen. München: Reinhardt. Essau, C. A. & Petermann, U. (2002). Depression. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und -psychotherapie (5., korr. Aufl., S. 291 ± 322). Göttingen: Hogrefe. Falchikov, N. (1986). Images of adolescence: An investigation into the accuracy of the image of adolescence constructed by British newspapers. Journal of Adolescence, 9, 167 ± 180. Flammer, A. & Alsaker, F. D. (2002). Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Die Erschlieûung innerer und äuûerer Welten. Bern: Huber. 179 Fleming, J. E. & Offord, D. R. (1990). Epidemiology of childhood depressive disorders: a critical review. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 29, 571 ± 580. Gleason, J. B. & Ely, R. (2002). Gender differences in language development. In A. McGillicuddy-De Lisi & R. De Lisi (Eds.), Biology, society, and behavior: The development of sex differences in cognition. Advances in applied developmental psychology (pp. 127 ± 154). Westport: Ablex Publishing. Groen, G. & Petermann, F. (2002). Depressive Kinder und Jugendliche. Göttingen: Hogrefe. Harrington, R. (1993). Depressive disorder in childhood and adolescence. Chichester: Wiley. Hartup, W. W. & Lieshout, C. F. van (1995). Personality development in social context. Annual Review of Psychology, 46, 655 ± 687. Havighurst, R. J. (1956). Research on the developmental-task concept. The School Review, 64, 215 ± 223. Henneberger, A. & Deister, B. (1996). Jugendliche wählen ihre Umwelt. Die Bedeutung von Entwicklungsaufgaben im Lebenskontext. In R. Schumann-Hengsteler & H. M. Trautner (Hrsg.), Entwicklung im Jugendalter (S. 19 ± 40). Göttingen: Hogrefe. Holtmann, M. & Schmidt, M. H. (2004). Resilienz im Kindesund Jugendalter. Kindheit und Entwicklung, 13, 195 ± 200. Holtmann, M., Poustka, F. & Schmidt, M. H. (2004). Biologische Korrelate der Resilienz im Kindes- und Jugendalter. Kindheit und Entwicklung, 13, 201 ± 211. Kandel, D. B. & Davies, M. (1982). Epidemiology of depressive mood in adolescents. Archives of General Psychiatry, 39, 1205 ± 1212. Kashani, J. H., Carlson, G. A., Beck, N. C., Hoeper, E. W., Corcoran, C. M., McAllister, J. A., Fallahi, C., Rosenberg, T. K. & Reid, J. C. (1987). Depression, depressive symptoms, and depressed mood among a community sample of adolescents. American Journal of Psychiatry, 147, 313 ± 318. Ladegaard, H. J. & Bleses, D. (2003). Gender differences in young childrens speech: The acquisition of sociolinguistic competence. International Journal of Applied Linguistics, 13, 222 ± 233. Larson, R. & Richards, M. H. (1991). Daily companionship in late childhood and early adolescence: Changing developmental contexts. Child Development, 62, 284 ± 300. Loeber, R. (1990). Development and risk factors of juvenile antisocial behavior and delinquency. Clinical Psychology Review, 10, 1 ± 41. Maccoby, E. E. & Jacklin, C. N. (1980). Sex differences in aggression: A rejoinder and reprise. Child Development, 51, 964 ± 980. Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of adolescent psychology (pp. 159 ± 187). New York: Wiley. McKinley, N. M. (1998). Gender differences in undergraduates body esteem: The mediating effect of objectified body consciousness and actual/ideal weight discrepancy. Sex Roles, 39 (1/2), 113 ± 123. Merikangas, K. R. & Angst, J. (1995). The challenge of depressive disorders in adolescence. In M. Rutter (Ed.), Psychosocial disturbances in young people: Challenges for prevention (pp. 131 ± 165). New York: Cambridge University Press. Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674 ± 701. 180 FrancËoise D. Alsaker und Andrea Bütikofer Moffitt, T. E., Caspi, A., Rutter, M. & Silva, P. A. (2001). Sex differences in antisocial behaviour: Conduct disorder, delinquency and violence in the Dunedin Longitudinal Study. Cambridge: Cambridge University Press. Nagin, D. S., Farrington, D. P. & Moffitt, T. E. (1995). Lifecourse trajectories of different types of offenders. Criminology, 33, 111 ± 139. Narring, F., Tschumper, A., Inderwildi Bonivento, L., Jeannin, A., Addor, V., Bütikofer, A., Suris, J.-C., Diserens, C., Alsaker, F. D. & Michaud, P.-A. (2004). Gesundheit und Lebensstil 16- bis 20-Jähriger in der Schweiz. SMASH 2002: Swiss multicenter adolescent survey on health 2002. Lausanne: Institut universitaire de mØdecine sociale et prØventive (www.umsa.ch). Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex differences in unipolar depression: Evidence and theory. Psychological Bulletin, 101, 259 ± 282. Nolen-Hoeksema, S., Girgus, J. S. & Seligman, M. E. P. (1991). Sex differences in depression and explanatory style in children. Journal of Youth and Adolescence, 20, 233 ± 246. Offer, D. (1969). The psychological world of the teenager. New York: Basic Books. Offer, D., Ostrov, E. & Howard, K. I. (1984). The self-image of normal adolescents. New Directions for Mental Health Services, 22, 5 ± 17. Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reaction patterns in males: A review. Psychological Bulletin, 86, 852 ± 875. Olweus, D. (1996). Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten ± und tun können. Bern: Huber. Parke, R. D. & Slaby, R. G. (1983). The development of aggression. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology (Vol. 4, pp. 548 ± 641). New York: John Wiley & Sons. Patterson, G. R., Capaldi, D. M. & Bank, L. (1991). An early starter model for predicting delinquency. In D. Pepler & K. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhood aggression (pp. 139 ± 168). Hillsdale: Erlbaum. Patton, G. C. (1988). The spectrum of eating disorders in adolescence. 31st Annual Conference of the Society for Psychosomatic Research (1987, London, England). Journal of Psychosomatic Research, 32, 579 ± 584. Petersen, A. C. (1988). Adolescent development. Annual Review of Psychology, 39, 583 ± 607. Petersen, A. C., Compas, B. E., Brooks-Gunn, J., Stemmler, M., Ey, S. & Grant, K. E. (1993). Depression in adolescence. American Psychologist, 48, 155 ± 168. Petersen, A. C., Sarigiani, P. A. & Kennedy, R. E. (1991). Adolescent depression: Why more girls? Journal of Youth and Adolescence, 20, 247 ± 271. Reese, A. & Silbereisen, R. K. (2001). Allgemeine versus spezifische Primärprävention von jugendlichem Risikoverhalten. In T. Freund & W. Lindner (Hrsg.), Prävention ± Zur kritischen Bewertung von Präventionsansätzen in der Jugendarbeit (S. 139 ± 162). Opladen: Leske & Budrich. Richter, M. & Settertobulte, W. (2003). Gesundheits- und Freizeitverhalten von Jugendlichen. In K. Hurrelmann, A. Klocke, W. Melzer & U. Ravens-Sieberer (Hrsg.), Jugendgesundheitssurvey. Internationale Vergleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO (S. 99 ± 157). Weinheim: Juventa. Rutter, M. (1986). The developmental psychopathology of depression: Issues and perspectives. In M. Rutter, C. E. Izard & P. B. Read (Eds.), Depression in young people. Developmental and clinical perspectives (pp. 3 ± 30). New York: Guilford. Rutter, M., Giller, H. & Hagell, A. (1998). Antisocial behavior by young people. New York: Cambridge University Press. Sass, H., Wittchen, H. U. & Zaudig, M. (1996). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV. Göttingen: Hogrefe. Scheithauer, H. & Petermann, F. (2002). Aggression. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und -psychotherapie (5., korr. Aufl., S. 187 ± 226). Göttingen: Hogrefe. Schmid, H. A. (2003). Evolution de la consommation de substances psychotropes chez les Øcolires et les Øcoliers en Suisse. Lausanne: Institut suisse de prØvention de lalcoolisme et autres toxicomanies. Schmiedbauer, W. (1997). Handbuch der Rauschdrogen. München: Nymphenburger. Schwartz, D., Proctor, L. J. & Chien, D. H. (2001). The aggressive victim of bullying: emotional and behavioral dysregulation as a pathway to victimization by peers. In J. Juvonen & S. Graham (Eds.), Peer harassment in school: the plight of the vulnerable and victimized (pp. 147 ± 174). New York: Guilford Press. Shedler, J. & Block, J. (1990). Adolescent drug use and psychological health. A longitudinal inquiry. American Psychologist, 45, 612 ± 630. Silbereisen, R. K., Petersen, A. C., Albrecht, H. T. & Kracke, B. (1989). Maturational timing and the development of problem behavior: Longitudinal studies in adolescence. Journal of Early Adolescence, 9, 247 ± 268. Stattin, H. & Magnusson, D. (1990). Pubertal maturation in female development. Hillsdale: Erlbaum. Tanner, J. M. (1989). Foetus into man: physical growth from conception to maturity (2nd. ed.). Wale: Castlemead Publications. Tschumper, A. & Diserens, C. (2004). Die Gesundheit der Jugendlichen als Spiegel der Gesellschaft (Broschüre). Bern: Universität Bern, Institut für Psychologie. Waligora, K. (2003). Normbrechendes Verhalten, Körperbeschwerden und depressive Symptombelastung bei Schülerinnen und Schüler ± Welche Rolle spielt die soziale Unterstützung? Kindheit und Entwicklung, 12, 145 ± 153. Watson, D. & Kendall, P. C. (1989). Common and differentiating features of anxiety and depression: Current findings and future directions. In P. C. Kendall & D. Watson (Eds.), Anxiety and depression: Distinctive and overlapping features (pp. 493 ± 508). San Diego: Academic Press. Youniss, J. & Smollar, J. (1985). Adolescent relations with mothers, fathers, and friends. Chicago: University of Chicago Press. Prof. Dr. FrancËoise D. Alsaker Dipl.-Psych. Andrea Bütikofer Institut für Psychologie der Universität Bern Muesmattstraûe 45 3000 Bern 9 Schweiz