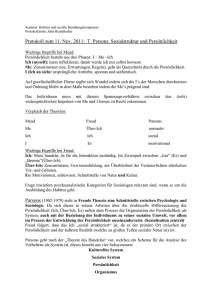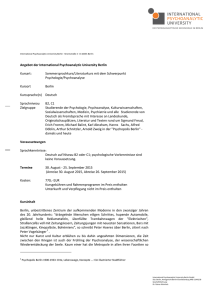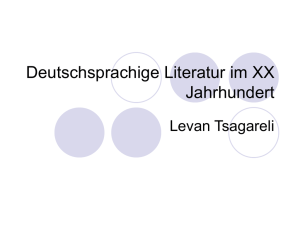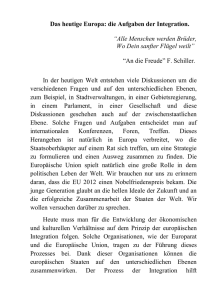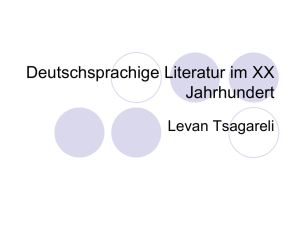VO Persoenlichkeitsforschung_Teil1_ WS_2015_16
Werbung

Einführung in die Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung für angehende PsychotherapeutInnen und PsychotherapiewissenschaftlerInnen Vortragende: MMag. Dr. Nina Petrik T: 0660 7389932 M: [email protected] W: www.kbt-wien.at W: www.sportpsychologie.or.at Der Begriff „Persönlichkeit“ in Abgrenzung zu den Begriffen „Identität“ und „Selbst“ und seine Bedeutung in der psychotherapeutischen Praxis. Definition von Psychotherapie im Psychotherapiegesetz §1: "Psychotherapie ist eine Interaktion zwischen einem oder mehreren Patienten und einem oder mehreren Therapeuten (auf Grund einer standardisierten Ausbildung), zum Zwecke der Behandlung von Verhaltensstörungen oder Leidenszuständen (vorwiegend psychosozialer Verursachung) mit psychologischen Mitteln (oder vielleicht besser durch Kommunikation, vorwiegend verbal oder auch averbal), mit einer lehrbaren Technik, einem definierten Ziel und auf der Basis einer Theorie des normalen und abnormen Verhaltens." "Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern". Aber auch hinsichtlich der Ziele von Psychotherapie werden divergente Auffassungen vertreten: Auf der einen Seite gibt es die am Vorbild der modernen Medizin orientierte Ausrichtung auf Beseitigung von Symptomen und Störungen, denen – zu klären wäre, von wem – 'Krankheitswert' zugeschrieben wird. Am anderen Ende des Spektrums finden sich Ziele des seelischen Wachstums wie Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsreifung und Lebensführungskompetenz, bei denen also nicht die Beseitigung von unerwünschten, sondern der Zugewinn erwünschter Subjektqualitäten im Mittelpunkt steht. (29.9.15; http://www.propaedeutikum-graz.at) @ “auf der Basis einer Theorie des normalen und abnormen Verhaltens“ Persönlichkeitstheorien beschäftigen sich mit der Frage nach der Norm und ihrer Varianz (=Maß für die Streuung einer Zufallsvariable). „Nature – Nurture“: Biologische Psychologie, Neuroplastizitätsforschung, Evolutionspsychologie, Vergleichende Verhaltensforschung,… Psychodynamische Ansätze: Bindungsforschung,…. Entwicklungspsychologie, tiefenpsychologische Ansätze, Sozialisationstheoretische/Lerntheoretische Ansätze: Sozialpsychologie, Systemische Theorien, Ethnopsychologie,… Humanistische/philosophische sinnorientierte Ansätze,… Ansätze: Verhaltenspsychologie, Religionspsychologie, existenzielle Diagnostische Konzepte: Testtheorie, Statistik, qualitative & quantitative Verfahren,… & Es gibt immer wieder Versuche, die verschiedenen Theorien, Ansätze und Modelle in einer Metatheorie zu vereinen. Interessante neuere Entwicklungen zeigen, dass es mittlerweile gut erforschte Erklärungsmodelle für die Entstehung (und auch die Störung) von Persönlichkeit gibt, die dahinterstehenden Grundüberzeugungen (~ Haltungen) sowie die Techniken der Behandlung sich aber je nach Therapieschule unterscheiden. Fast alle Pioniere der Persönlichkeitsforschung waren Kliniker und gingen von ihren Beobachtungen in der psychologischen/psychiatrischen/neurologischen und psychotherapeutischen Praxis aus. Sie stellten und stelle sich immer noch die Fragen: Wie entwickelt sich Persönlichkeit? (und allgemeiner: Was ist die „Natur“ des Menschen?) Wie definiert sich Persönlichkeit (was gehört dazu, was nicht, gibt es eine genetische Basis,..) Was ist eine Störung der Persönlichkeit? Was ist abnormes Verhalten im Sinne eines behandlungswürdigen, krankheitswertigen Zustands? Wie entsteht eine Störung in der Persönlichkeit? Gesellschaftspolitisch: Was wird überhaupt als „Störung“ definiert? ICD-10: F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen Beschreiben eine Reihe von klinisch wichtigen, meist länger anhaltenden Zustandsbildern und Verhaltensmustern. Sie sind Ausdruck des charakteristischen, individuellen Lebensstils, des Verhältnisses zur eigenen Person und zu anderen Menschen. Einige dieser Zustandsbilder und Verhaltensmuster entstehen als Folge konstitutioneller Faktoren und sozialer Erfahrungen schon früh im Verlauf der individuellen Entwicklung, während andere erst später im Leben erworben werden. Die spezifischen Persönlichkeitsstörungen (F60.-), die kombinierten und anderen Persönlichkeitsstörungen (F61) und die Persönlichkeitsänderungen (F62.-) sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktionen. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Psychische Gesundheit ist? Die etymologischen Wurzeln für unser heutiges Wort gesund finden sich im germanischen [ga]sunda, lateinischer (sanare = sanieren und sogar sanctus = heilig) und griechischer (holos = ganz, heil) Wortverwandtschaften so viel wie stark, kräftig, heil, ganz bedeutet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „Zustand des Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen“. Laut WHO ist die psychische Gesundheit für den einzelnen Bürger eine Voraussetzung dafür, dass er sein intellektuelles und emotionales Potenzial verwirklichen und seine Rolle in der Gesellschaft, in der Ausbildung und im Arbeitsleben finden und erfüllen kann. Auf gesellschaftlicher Ebene trägt die psychische Gesundheit zum wirtschaftlichen Wohlstand, zur Solidarität und zur sozialen Gerechtigkeit bei. (Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit, Information der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde DGPPN, 2015) Ein Modell, das mehr in die Tiefe geht, ist das von Aaron Antonovsky (1923-1994). Sein Modell der Salutogenese ist ein bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell. Er stellte die Fragen: Warum bleiben Menschen trotz widriger Umstände gesund? Wie schaffen sie es, sich von Erkrankungen wieder zu erholen. Was zeichnet Menschen aus, die trotz Belastungen gesund bleiben? Sein Ansatz ist so aktuell wie noch nie! Er fragte nach der Resilienz, der Widerstandskraft von Menschen. Seine Studien identifizierten verschiedene Resilienzfaktoren, von denen das Kohärenzgefühl, das wichtigste zu sein scheint. Herausragend an Antonovskys Modell ist, dass er Gesundheit und Krankheit als Endpunkt eines Kontinuums darstellt, auf dem sich der Mensch hin und her bewegt. Man kann also mehr oder weniger gesund/krank sein. Das Kohärenzgefühl besteht aus folgenden drei Aspekten: Die Fähigkeit, dass man die Zusammenhänge des Lebens versteht. Das Gefühl der Verstehbarkeit. Die Überzeugung, dass man das eigene Leben gestalten kann. Das Gefühl der Handhabbarkeit. Der Glaube, dass das Leben einen Sinn hat. Das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Oft wird - in Verbindung mit Gesundheit und Krankheit – der Begriff „Normalität“ verwendet. Die Frage „Was ist normal?“, ist in der Psychologie /Psychotherapie eine schwierige. Was normal und was pathologisch oder sogar kriminell ist, ist oft mehr eine Bestimmung, die auf Basis gesellschaftlicher, politischer oder kultureller „Glaubenssätze“ getroffen wird auf Basis objektiver Forschung. Nehmen wir als Beispiel Homosexualität. Homosexuell zu sein war verboten und Ausdruck eines schlechten ausschweifenden Charakters. Bis zum 18 Jahrhundert standen homosexuelle Handlungen unter Todesstrafe. Nach dem Strafgesetz von 1852 waren homosexuelle Beziehungen als „Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts“ zur Gänze verboten und wurden mit schwerem Kerker von einem bis zu 5 Jahren bestraft. Später war es nicht mehr der Ausdruck eines kriminellen Verhaltens, sondern einer Krankheit, die es zu behandeln galt. Bis 1974 war Homosexualität im Statistischen Manual für Erkrankungen (DSM) als Krankheit angeführt. 1992 wurde Homosexualität als psychische Störung aus dem ICD-10 gestrichen. Dennoch spielt der Begriff „Normalität“ in der Psychotherapie eine Rolle, da er von KlientInnen eingebracht wird. Die Frage „Bin ich normal?“ oder „Ist das normal?“ hört man öfter. Definitionen: Persönlichkeit Viele Fachbegriffe fließen in die Alltagssprache ein und werden dadurch unscharf („Laiendefinition“ „Alltagspsychologie“). Eine Laiendefinition von Persönlichkeit beinhaltet z. B. oft Werturteile in Bezug auf die soziale Attraktivität eines Menschen sowie eine Bewertung zu seinem sozialen Stil. (z. B.: Richard ist groß, schlank, er redet aber nicht viel und braucht ein bisschen bis er auftaut.“) Solche Bewertungen sind oft von kulturellen Klischees und Vorurteilen geprägt. (Z. B.: Dicke Menschen sind fröhlich. Schöne Menschen sind klug.…) Ausgangpunkt für die Erforschung der Persönlichkeit sind Überlegungen, die wir der Alltagspsychologie zuordnen. Unter Alltagspsychologie verstehen wir die von den Mitgliedern einer Kultur geteilten Annahmen über das Erleben und Verhalten von Menschen. Die Annahmen werden als „implizite Persönlichkeitstheorien“ bezeichnet. Eine implizite Persönlichkeitstheorie ist eine intuitiv begründete Theorie über das menschliche Verhalten, die wir alle aufstellen, um uns selbst und andere Menschen besser zu verstehen. Die Problematik dieser impliziten Persönlichkeitstheorien ist, dass wir sie nicht „wissenschaftlich“ überprüfen. Sie beruhen auf sehr einseitigen Beobachtungen und auf subjektiven Urteilen. Wir beurteilen z.B. eine Person darin, wie freundlich sie uns gegenüber ist. (Diese Beobachtung sagt nichts darüber aus, ob sie wirklich immer freundlich ist, und ob unser Empfinden von dem, was wir als „freundlich“ bezeichnen, auch tatsächlich von Anderen so empfunden wird.) Die wissenschaftliche Erforschung der Persönlichkeit muss daher bestimmen Anforderungen genügen, damit diese „Fehler“ nicht passieren. Wissenschaftliche Definition von Persönlichkeit: Definition der Persönlichkeit eines Menschen erfolgt anhand von Eigenschaften, d.h. für die Person typischen Merkmalen, die mittels wissenschaftlicher Methoden beschrieben werden. Eigenschaften sind Dispositionen: Eine Disposition ist ein Merkmal einer Person, das eine mittelfristige, zeitliche Stabilität aufweist. Es lässt eine Person in bestimmten Situationen ein bestimmtes Verhalten zeigen. Die Dispositionen einer Person müssen streng von ihrem Verhalten unterschieden werden. Verhalten fluktuiert von Sekunde zu Sekunde und ist direkt beobachtbar. Dispositionen sind zeitlich stabiler und nicht direkt beobachtbar, sondern nur aus den beobachtbaren Verhaltensregelmäßigkeiten (nicht Verhalten!) einer Person erschließbar. Gordon Allport (1961): „Persönlichkeit ist die dynamische Ordnung derjenigen psycho-physischen Systeme im Individuum, die sein Verhalten und Denken determinieren.“ „Dynamische Ordnung im Individuum“: Bezeichnet einen Prozess, der ständigen Aktualisierungen unterworfen ist, um Anpassungen an Veränderungen in unserem Leben zu ermöglichen. (Maltby, 2011) Persönlichkeit ist aktiv und reaktiv, und in einer internen Struktur organisiert. „Psycho-physisches Systeme“: Beziehen sich auf die Integration von Psyche und Körper in das, was wir „Persönlichkeit“ nennen. (René Descartes, 1596 – 1650, argumentierte, dass Seele und Verstand zwei unterschiedliche Dinge sind. Der Verstand sei materiell und folge den Gesetzen der Physik. Die Seele sei immateriell und folge den Gesetzen der Vernunft und der Begierde. Die Idee Körper und Seele seinen grundverschieden und voneinander unabhängig zu betrachten, hielt sich mehrere hundert Jahre.) Heute weiß man, dass Körper und Seele / Psyche eine untrennbare Einheit bilden (= körperpsychotherapeutische Ansätze, z. B.: KBT - Konzentrative Bewegungstherapie, Focusing, EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Autogenes Training, PME - Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, …). „Determinieren“ bedeutet, dass das Muster, das hervorgebracht wird, zeitlich so stabil ist, das es für ein Individuum als typisch betrachtet werden kann. Der Begriff „Persönlichkeit“, eingeführt von Gordon Allport (1937), ersetzte die bis dahin gebräuchlicheren Begriffe „Charakter“ oder „Temperament“. Definition „Charakter“: „Charakter“ ist ein griechisches Wort und bezeichnet den Prägestempel für Münzen, sowie den Prägevorgang selbst. Auf die Psychologie übertragen bezeichnet der Charakter eines Menschen, seine individuelle Prägung aber auch seine moralische Ausrichtung. Nach Kant (1798) hat ein Mensch dann Charakter, wenn er sich von seinem Willen und nicht von seinen Instinkten leiten lässt. Definition „Temperament“: Temperament bezeichnet jene Persönlichkeitsmerkmale, die seit Geburt vorhanden und relativ konstant sind. Bei ihnen kann man eine genetische Verankerung vermuten. Es beschreibt zudem die Art und Weise, wie ein Lebewesen agiert und reagiert, also seinen Verhaltensstil. Dieser ist tief verankert und setzt sich aus emotionalen, motorischen, aufmerksamkeitsbezogenen Reaktionen und der Selbstregulierung zusammen. Etymologisch wurde das Wort „temperamentum“ im 16. Jahrhundert im Sinne von „ausgeglichenes Mischungsverhältnis“ in der Pharmazie verwendet, beschrieb dann das „Mischungsverhältnis der Körpersäfte“ (siehe Humoralpathologie/vier Säftelehre) und erhielt im 18. Jahrhundert die heutige Bedeutung. Zwei weitere Definitionen von Persönlichkeit: Eysenck und Eysenck (1987): Persönlichkeit ist „die mehr oder weniger stabile und dauerhafte Organisation des Charakters, Temperaments, Intellekts und Körperbaus eines Menschen, die seine einzigartige Anpassung an die Umwelt bestimmt. Der Charakter eines Menschen bezeichnet das mehr oder weniger stabile und dauerhafte System seines konativen Verhaltens (des Willens), sein Temperament das mehr oder wenig stabile und dauerhafte System seines affektiven Verhaltens (der Emotion und des Gefühls), sein Intellekt das mehr oder weniger stabile und dauerhafte System seines kognitiven Verhaltens (der Intelligenz), sein Körperbau das mehr oder weniger stabile und dauerhafte System seiner physischen Gestalt und neuroendokrinen (hormonalen) Ausstattung“. Pervin, Cervone und John (2005): „Bei Persönlichkeit geht es um jene Charakteristika oder Merkmale des Menschen, die konstante Muster des Fühlens, Denkens und Verhaltens ausmachen“. Es gibt unzählige Definitionen von Persönlichkeit in der Literatur. In der Persönlichkeitsforschung ist es bis jetzt nicht gelungen, eine universell gültige Definition zu schaffen. Einig ist man sich nur darüber, dass Persönlichkeit ein psychologisches bzw. hypothetisches Konstrukt (= mentales Konzept) ist, das das Verhalten auf dem Weg einer PsycheKörper-Interaktion beeinflusst. (Maltby, 2011). Ein psychologisches Konstrukt beschreibt eine Idee, eine Annahme, die nicht direkt beobachtbar ist, aber von der angenommen wird, dass sie sichtbares = beobachtbares Verhalten beeinflussen und erklären kann. !! Persönlichkeit kann nicht direkt beobachtet werden!! Wie nehmen aber an, dass sie unser Verhalten beeinflusst. Das bedeutet, dass wir Verhalten beobachten und daraus Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen. Damit dieses Konstrukt nicht nur eine zufällige „Erfindung“ des Beobachters ist, sondern tatsächlich Aussagekraft besitzt, muss es bestimmte wissenschaftliche Kriterien erfüllen (Objektivität, Reliabilität, Validität). Die Persönlichkeitsforschung und Differentielle Psychologie stellt sich folgende Fragen: (1) Was ist die motivationale Basis von Verhalten. Was treibt uns an? Haben wir einen freien Willen? Was ist die grundlegende Natur des Menschen? Die Frage, wie ist die Natur des Menschen? Ist der Mensch gut oder böse? Diese Fragen sind immer noch nicht geklärt. Je nachdem ob man – Freud (der Mensch ist selbstzerstörerisch und aggressiv) oder Rogers (der Mensch ist gut) folgt, wird man zu einer anderen Antwort kommen. (2) Sie beschäftigen sich aber auch mit Beschreibungen/Kategorisierungen der Art und Weise des Verhaltens von Individuen, mit dem Ziel, diese besser zu verstehen. In der Annahme, dass Individuen mit ähnlichen Verhaltensweisen auch ähnliche Persönlichkeitseigenschaften teilen, führt die Zusammenfassung dieser Individuen zu sogenannten Typen. Die Klassifikation von Persönlichkeitstypen hat in der Messung der Persönlichkeit ihren Wert und Nutzen. (3) Mit der Beschreibung der Persönlichkeit geht auch immer die Frage einher, wie ist diese Persönlichkeit entstanden (Entwicklungstheorien)? Gibt es ein bestimmtes Alter, ab da der Prozess abgeschlossen ist? Kann Persönlichkeit verändert werden? (4) Sehr viele Forscher und Theoretiker, die sich mit der Entstehung und Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften beschäftigen, kommen aus dem klinischen Bereich. Das darüber liegende Ziel ist dann sehr oft die Entwicklung von therapeutischen Interventionen. Mit der Entwicklungsfrage verknüpft ist auch die Frage, ob Persönlichkeitseigenschaften vererbt werden können oder rein auf Umweltbedingungen zurück zu führen sind. Je nach Theorie wird dem Faktor „Vererbung/Genetik“ eine große bis gar keine Bedeutung beigemessen. Eine psychotherapeutische Persönlichkeitsforschung ist am entstehen. Sie stellt Fragen nach der Entstehung/Entwicklung und Diagnostik von gesunden und pathogenen Persönlichkeitsstrukturen, Risikound Resilienzfaktoren sowie die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Behandlungsmethoden mehr in den Fokus. Persönlichkeit in Abgrenzung zu Identität und Selbst. Der Ursprung des Begriffs Persönlichkeit leitet sich vom lateinischen „persona“ ab und bezeichnete die im antiken Theater verwendeten Masken. Diese typisierten die jeweilige Rolle, die die Schauspieler innehatten. Diese Masken dienten auch der Schallverstärkung („personare“ lat. hindurch strömen, widerhallen). Die Maske war etwas, das man der Öffentlichkeit zeigt. Ebenso versteht man Persönlichkeit als das Bild des Menschen, das der Öffentlichkeit, der Außenwelt dargeboten wird. Die Persönlichkeit repräsentiert damit jene Eigenschaften, die von Anderen wahrgenommen werden können. Zusätzlich existieren aber auch Eigenschaften, die sich nicht so leicht erschließen, die sozusagen im Verborgenen [~Unbewussten] wirken. Auch diese sind Gegenstand der Persönlichkeitspsychologie. Birgit Schneider schreibt in ihrem Buch Narrative Kunsttherapie Identitätsarbeit durch BildGeschichten. Ein neuer Weg in der Psychotherapie (2008): „Identität als Begriff, als Thema, als Phänomen besitzt heute eine Aktualität, die sich aus gesellschaftlichen Entwicklungen erklärt und offenbar kein selbstverständlicher Bestandteil der individuellen Persönlichkeit mehr ist.“ (S. 31) Identität ist also ein Teil der Persönlichkeit, sie ist „Begriff“ und „Phänomen“ (S. 34) Identität leitet sich vom lateinischen „ideos“ = derselbe ab und wird „interpretiert“ als „die in sich und in der Zeit als beständig erlebte Person, das Selbst“, „Die in sich und in der Zeit als beständig erlebte Kontinuität und Gleichheit des Ich“. „Identität ist in der Grundbedeutung die Fähigkeit zur Selbstkonstanz. Unabhängig von Veränderungen und Entwicklung, von Widersprüchen und Ambivalenzen hält sich das Gefühl von Identität.“ (e.d.) Hohl (2000) definierte die wesentlichen Kriterien für Identität: 1. Die Grenzerfahrung über Ich und Du (Ich weiß wo ich aufhöre und der andere anfängt, ich weiß, was meine Gefühle, Wünsche, Gedanken sind und kann sie von deinen klar unterscheiden, mein Körper ist nicht dein Körper.) Psychische Störungen treten auf, wenn diese Grenzen durchlässig sind. 2. Das Gefühl von Kohärenz (Ich erlebe mich als zusammengehörendes Ganzes, auch wenn ich Veränderungen erfahre, auch wenn ich Teile von mir als nicht passenden erlebe, auch wenn ich mich in einigen sozialen Situationen noch nicht ganz in „meiner Haut“ fühle. Ich weiß, dass diese Teile – trotzt Widersprüchlichkeit – zu mir gehören) Erik Erikson (1973): „Das Grundgefühl der Ich-Identität ist […] das angesammelte Vertrauen darauf, dass der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen der anderen hat, eine Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität aufrechtzuerhalten“ Hohl (2000) leitet daraus ab, dass man psychische Gesundheit definieren kann „als das Ausmaß, indem es dem Ego gelingt, mit seinen widersprüchlichen Regungen im Alltag umzugehen und trotz dieser Widersprüche ein halbwegs zufriedenes Leben zu führen. Die Neurose wäre dann der zum Scheitern verurteilte Versuch des geschwächten Ego, sich von seinen Widersprüchen über Abwehrmechanismen und Konversionen zu befreien.“ (Schneider, 2008,S. 37) Identität ist ein Teil des psychologischen Konstrukts „Persönlichkeit“. Sie bedarf der sozialen Bestätigung, sie wird daher auch als soziologischer Begriff verstanden. Keupp (2000) unterscheidet von der Identität das Selbst. Die Identität umfasst für ihn die Fähigkeit zur Selbstkonstanz und das Selbst, die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Beide Begriffe setzen entwicklungspsychologisch ein Ich voraus. Ein Ich bedingt aber umgekehrt nicht die Entwicklung eines Selbst und einer Identität. Diese brauchen ein bewusstes Ich. Neuere Strömungen der Neurowissenschaften zeichnen ein Selbst, das durch das Zusammenwirken von Gehirnsubstrat, Hormonen, Neurotransmitter entsteht. Suchte Descartes noch nach dem IchZentrum im Gehirn als definierten Ort, ist man heute der Überzeugung, (Selbst-)Bewusstsein sei auch „nur“ ein weiterer Informationsverarbeitungsprozess. Der Neurophilosoph Metzinger schreibt sogar, „Wir sind mentale Selbstmodelle informationsverarbeitender Biosysteme… Werden wir nicht errechnet, so gibt es uns nicht.“ (1999) Historische Entwicklung der Persönlichkeitsforschung Aus Johann Caspar Lavater: „Von der Physiognomik“ (Leipzig, 1772) Vorläufer der Persönlichkeitspsychologie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Temperamentslehre von Hippokrates (460 – 370 v. Chr.) Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) Theophrastus (371 – 287 v. Chr.) Epiktet (50 – 125 n. Chr.) Temperamentslehre von Galen (129 – 216 n. Chr.) Temperamentslehre von Immanuel Kant (1724 – 1804) Temperamentslehre von Wilhelm Wundt (1832 – 1920) Physiognomik Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) Pastor Johann Caspar Lavater (1741 – 1801) Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) Phrenologie Franz Josef Gall (1758 – 1828) Grafologie Jean Hippolyte Michan (1806 – 1881) Konstitutionspsychologie Ernst Kretschmer (1888 – 1964) Religion als Vorläufer der Persönlichkeitsforschung Ad 1. Temperamentslehre von Hippokrates (460 – 370 v. Chr.) Die Grundannahme der Zeit war, dass sich alles im Universum auf nur wenige Elemente zurückführen ließe (heutiges Periodensystem!). Die Grundelemente der Zeit waren Erde, Wasser, Luft und Feuer. Der Arzt Hippokrates ging von der Annahme aus, dass es vier Körpersäfte gibt, die mit jeweils einem unterschiedlichen Temperament korrelieren. Diese vier Körpersäfte wären die physiologische Entsprechung von Erde, Wasser, Feuer und Luft. Hippokrates ging davon aus, dass ein Überfluss bzw. ein Mangel bei den vier Körpersäften Einfluss habe auf die Entstehung von Krankheiten, die Lebensgeschichte eines Menschen, das Verhalten und die Persönlichkeit. Gelbe Galle: o o o Diagnose anhand gelben Schleims (Erbrochenem, Durchfall, ...) Ein Übermaß wurde mit Gelbsucht in Verbindung gebracht Temperamentstyp: CHOLERIKER (jähzornig) Schwarze Galle: o o o Diagnose aufgrund von Ablagerungen im Blut oder Farbveränderungen der Haut. Wurde mit Cholera, Ruhr und Darmerkrankungen in Verbindung gebracht Überwiegen von schwarzer Galle deutet auf den MELANCHOLIKER hin Kennzeichen: Traurigkeit Schleim: o o Ausgehusteter Schleim wurde als Ursache für Erkrankungen der Atemwege, wie z. B. Lungenentzündungen betrachtet Das Überwiegen von Schleim charakterisiert den PHLEGMATIKER, der als teilnahmslos beschrieben wird Blut: o o o Ein Mangel an Blut (Anämie) Ein Übermaß an Blut beschreibt den SANGUINIKER Er ist hoffnungsvoll und sorglos Diese sogenannte Humoralpathologie ist eine medizinische Theorie, Hippocraticum (z. B. in „Über die Natur des Menschen“, um 400 v. Chr.) Körpervorgänge und als Krankheitskonzept entwickelt wurde und Zellularpathologie durch Rudolf Virchow im 19. Jahrhundert Naturwissenschaften und auch die damalige (westliche) Medizin blieb. die erstmals im Corpus zur Erklärung allgemeiner bis zur Einführung der dominierend für die o Heute finden diese Konzepte noch Anwendung in z. B. der TCM (traditionelle chinesische Medizin), im Ayurveda, … o Und natürlich in unserer Sprache! Ad 2) Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) Aristoteles schlug vor Persönlichkeitseigenschaften wie Eitelkeit, Bescheidenheit, Feigheit heranzuziehen um eine Bewertung der moralischen Integrität („Tugendhaftigkeit“) eines Individuums durchzuführen. Aristoteles unterschied im Weiteren zum einen die Verstandestugenden (Klugheit, Kunstfertigkeit, Vernunft, Weisheit, Wissenschaftlichkeit) und zum anderen die Charaktertugenden (ethischen Tugenden). Mit den übergeordneten Verstandestugenden orientiert der Mensch sich an der praktischen Vernunft, um die richtigen Mittel und Wege für sein Handeln zu finden und um in den konkreten Situationen, in denen sein Handeln gefordert ist, das Richtige zu wählen. Die Einübung der ethischen Tugenden verhilft zur Beherrschung der Triebe und Affekte und macht den so Handelnden unabhängiger von einer nur auf Befriedigung der Lust und Vermeidung von Schmerz ausgerichteten Verhaltensweise. Um ethisches Verhalten auf das Gute auszurichten, bedarf es der Erziehung, die unsere moralische Sensibilität erhöht und damit Einfluss auf die Qualität unserer Handlungen nimmt. Was eine Tugend ist, hängt von den Umständen, auch den historischen und gesellschaftlichen, ab. Unser Streben sollte, nach Aristoteles, danach trachten, dass wir unsere menschliche Natur gemäß unseren Anlagen und zum Zweck der Harmonie der Natur mit uns selbst vervollkommnen. Wichtige Tugenden nach Aristoteles sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung, Freigebigkeit, Hilfsbereitschaft, Seelengröße, Sanftmut, Wahrhaftigkeit, Höflichkeit und Einfühlsamkeit. Die höchste Glückseligkeit erreicht man nach Aristoteles durch die Tugend der Weisheit (griechisch: Sophia). Bei Aristoteles ist bereits das Konzept des „gesunden, seine Anlagen entwickelnden Menschen vorhanden“. Das Ergebnis der „Vervollkommnung durch Erziehung“ ist Harmonie. Wenn man nun Erziehung durch Psychotherapie ersetzt, hat sich an den Vorstellungen seit 384 vor Christus nicht viel verändert. Ad 3) Theophrastus (371 – 287 v. Chr.) War ein Schüler Aristoteles, der 30 verschiedene Persönlichkeitstypen beschrieb: z. B.: der Verlogene, der Skrupellose, der Dünkelhafte, der Geizige, der Redselige, der Nörgler, der Gefallsüchtige, … Ad 4) Epiktet (50 – 125 n. Chr.) War ein Visionär. Er suchte nach jenen Eigenschaften, die einem Menschen zu einem glücklichen Leben verhelfen. Z. B. die Eigenschaft Gelassenheit zu haben oder durch Tugend statt durch Laster motiviert zu sein. Von ihm stammt der immer noch gültige Schluss: “Es sind nicht die Dinge, die die Meinungen, die wir von den Dingen haben.“ uns beunruhigen, sondern Ad 5) Temperamentslehre von Galen (129 – 216 n. Chr.) Die Temperamentslehre von Galen von Pergamon ist eine Weiterentwicklung der hippokratischen Lehre. Er fasste das gesamte medizinische Wissen seiner Zeit zusammen und folgte den Vorstellungen der Hippokratiker, schrieb die Lehre der Humoralpathologie in einer systematischen Form nieder und verband die vier Säfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim u.a. mit den vier Lebensphasen und den vier Elementen. Die Ausgewogenheit der Säfte (Eukrasie) ist gleichbedeutend mit der Gesundheit des Menschen. [Ursprüngliche Bedeutung von Temperament: lateinisch „temperare“: ins richtige Verhältnis setzen, das rechte Maß halten.] Krankheiten entstanden Galens Humoralpathologie zufolge durch Störungen (Dyskrasie) dieser Ausgewogenheit. Eine Dyskrasie kann entstehen durch ein Fehlen, ein Zuviel oder ein Verderben eines oder mehrerer Säfte. Sie wird durch Zufuhr des Gegenelements behandelt: So löscht Wasser Feuer und Erde stoppt Wind also Luft. Galen betonte, dass es die Aufgabe des Arztes sei, ein Ungleichgewicht der Säfte durch Diätetik, Arzneimittel oder auch chirurgische Maßnahmen wieder aufzuheben. Die vier Körpersäfte sind BIOLOGISCHE Grundlagen für die Persönlichkeit. Im Mittelalter und der Renaissance wurde das Viererschema der Säfte durch weitere Elemente, z. B. Himmelsrichtungen, Evangelisten, Paradiesflüsse und Tonarten, erweitert. Die von Galen vertretenen Theorien bildeten die Grundlage der Medizin der Hildegard von Bingen, der Physiognomik eines Johann Caspar Lavater´s und der Ernährungslehre. Im Übrigen bezog sich auch Sebastian Kneipp bei seiner Wasserkur auf die Erkenntnisse Galens, nach denen überflüssige oder verdorbene Säfte aus dem Körper abgeleitet werden müssten. Ad 6) Temperamentslehre von Immanuel Kant (1724 – 1804) Im 18. Jahrhundert griff Kant das Konzept der vier antiken Temperamentstypen auf und entwickelte es weiter. Kant bezog sich dabei explizit auf die psychologischen Temperamente, die er von den physiologischen (körperliche Konstitution und Komplexion) abgrenzte. Er teilte die Temperamente ein in 1) Temperamente des Gefühls 2) Temperamente der Tätigkeit Diese Temperamentsarten wurden weiter unterteilt darin, ob sie mit einer Anspannung/Erregbarkeit der Lebenskraft oder mit einer Abspannung/Erschlaffung der Lebenskraft verbunden sind. Kant postulierte vier reine Temperamenttypen und schloss Mischtypen aus. Die vier klassischen Temperamentstypen nach Kant: (1) SANGUINIKER: „Ist sorglos und von guter Hoffnung; gibt jedem Ding für den Augenblick eine große Wichtigkeit, und den folgenden mag er daran nicht weiter denken, er verspricht ehrlicherweise, aber hält nicht Wort, weil er nicht vorher tief genug nachdacht hat, ob er es auch zu halten vermögend sein werde.“ (2) MELANCHOLIKER: „Gibt allen Dingen, die ihn selbst angehen, eine große Wichtigkeit, findet allerwärts Ursachen zu Besorgnissen und richtet seine Aufmerksamkeit zuerst auf die Schwierigkeiten, …“ (3) CHOLERIKER: „Ist hitzig, brennt schnell auf wie Strohfeuer, lässt sich durch Nachgeben des Anderen bald besänftigen, zürnt alsdann, ohne zu hassen, und liebt wohl gar den noch desto mehr, der ihm bald nachgegen hat“ (4) PHLEGMATIKER: „Gerät nicht leicht in Zorn, sondern bedenkt sich erst, ob er nicht zürnen solle… Phlegma bedeutet Affektlosigkeit, nicht Trägheit (Leblosigkeit), und man darf den Mann, der viel Phlegma hat, darum nicht sofort phlegmatisch nennen“ (Kant, 1798, s. S. 214 – 217) Ad 7) Temperamentslehre von Wilhelm Wundt (1832 – 1920) Wilhelm Wundt hat die Psychologie als eigene Wissenschaft begründet und sich gleichzeitig von der klassischen physiologischen Temperamentslehre verabschiedet. Sein Beschreibungssystem der Persönlichkeit ist zweidimensional.Er unterscheidet die a) Stärke des Affekts und die b) Schnelligkeit des Wechsels des Affekts Die vier Temperamentstypen ordnet er diesen zwei Dimensionen unter: Stärke des Affekts Schnelligkeit des Affekts niedrig hoch niedrig Phlegmatiker Sanguiniker hoch Melancholiker Choleriker Zwei Aspekte der Wundt´schen Persönlichkeitsforschung sind bemerkenswert und heute immer noch gültig: 1. Diese grundlegende Beschreibung von Temperamenten findet man heute noch in den Konzepten NEUROTIZISMUS (Emotionalität) und EXTRAVERSION wieder (beispielsweise bei Eysenck und Eysenck). 2. Die Abkehr von einer rein biologischen Begründung von Temperament. (In aktuellen Ansätzen wird die genetische Determiniertheit von Persönlichkeit wieder mehr diskutiert.) Ad 8) Pastor John Caspar Lavater (1741 – 1801) „Am Kinn erkennt man den Mann!“ Lavater erforschte die Zusammenhänge zwischen körperlichen Charaktereigenschaften und nannte diese Forschung „Physiognomik“. Merkmalen und „Physiognomik ist die Wissenschaft, den Charakter (nicht die zufälligen Schicksale) des Menschen im weitläuftigsten Verstande aus seinem Aeußerlichen zu erkennen; Physiognomie im weitläuftigen Verstande wäre also alles Aeußerliche an dem Körper des Menschen und den Bewegungen desselben, in sofern sich daraus etwas von dem Charakter des Menschen erkennen läßt. So viele charaktere der Mensch zugklaich haben kann, das ist, aus so vielen Gesichtspunkten der Mensch betrachtet werden kann, so vielerely Arten von Physiognomien hat ein und eben erselbe Mensch. Daher begreift die Physiognomik alle Charaktere des emnschen, die zusammen einen completen Totalcharakter ausmachen, in sich. Sie beurtheilt den physiologtischen, den Temperamentscharakter, den medicinischen, den physischen, den intellektuellen, den moralischen, den habituellen, den Geschicklichkeitscharakter, den gesellschaftlichen oder umgänglichen, u.s.w. Den eigentlichen, einfachen oder zusammengesetzten, Ausdruck eines jeden dieser Charakteren im Körper, oder überhaupt im Aeußerlichen des Menschen, findet die Physiognomik. In sofern sie blos den Charakter aus dem ihm entsprechenden Ausdruck erkennen kann, sollte man sie die empyrische, und in sofern sie die Ursachen, den Grund davon angeben, und den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und dem Charakter selbst zeigen könnte, die theoretische oder transcendente Physiognomik nennen.“ Ad 9) Phrenologie Franz Josef Gall (1758 – 1828) Der Wiener Arzt Franz Josef Gall war überzeugt davon, dass das Gehirn das Zentrum für alle mentalen Funktionen sei. Er griff Lavater´s Physiognomik auf, entwickelte sie weiter und kam zu dem Schluss, dass der menschliche Schädel Aufschluss über die charakterlichen Eigenschaften des Menschen gäbe. Zu seinen Untersuchungen sammelte Gall in Wien eine große Zahl von Schädeln, „meist von Irrsinnigen oder Verbrechern“, sowie viele nach der Natur geformten Gipsbüsten bekannter Personen oder von Menschen „mit besonderen Schädelbildungen“. „Als jüngsthin Dr. Gall das hiesige Narrenhaus, Bisetre besuchte, begleitete ihn ein Wahnsinniger, bey dem er keine Kennzeichen des Wahnsinns weder in seinen Reden, noch an seinem Schädel entdecken konnte. Er sagte es ihm. Der Wahnsinnige antwortete: Wundern Sie sich nicht, daß sie an dem Kopfe, der jetzt auf meinen Schultern sitzt, keine Kennzeichen des Wahnsinns antreffen. Es ist ein fremder Kopf, den man mir aufgesetzt hat, nachdem der meinige in der Revolutionszeit durch die Guillotine abgeschlagen worden war. (Vgl. Augsburgische Ordinari Postzeitung, No. 175, Freytag, den 22. Jul., Anno 1808, S. 1, als Digitalisat.) Ad 10) Sir Francis Galton (1822 – 1911) Galton gilt als Begründer der Differentiellen Psychologie. Er entwickelte statistische Verfahren und maß als erster mittels Statistik Intelligenz, Begabungen und Einstellungen. Er erstellte dazu Fragebögen und überprüfte sich anhand großer Stichproben aus der Bevölkerung und gab als Erster standardisierte Normwerte heraus. Ad 11) Konstitutionspsychologie Ernst Kretschmer (1888 – 1964) Ausgehend von Kraepelins (1899) Unterscheidung von zwei Formen der endogenen Erkrankung, fiel Kretschmer die unterschiedliche Verteilung der Körperbauformen dieser beiden Krankheitsgruppen auf. Viele seiner schizophrenen Patienten waren schmal und hoch gewachsen, während sich unter den manisch-depressiven Patienten relativ viele rundlich-breitwüchsige Personen befanden. Davon abgeleitet entwickelte Kretschmer seine Konstitutionslehre. Er identifizierte drei – später vier – Körperbautypen, denen er jeweils ein spezifisches Temperament und einen spezifischen Charakter zuordnete (~ 1921). Die Körperbautypen sind: 1. Leptosom: geringes Dickenwachstum bei relativ großem Längenwachstum. Leptosome sind schmal, groß, mager, haben wenig Muskeln und einen flachen Brustkorb 2. Pyknisch: starke Umfangentwicklung um Bauch, Brustkorb, Kopf, Tendenz zum Fettansatz am Bauch, gedrungene Gestalt, weiches, breites Gesicht, kurzer eingezogener Halt 3. Athletisch: mittel bis hochgewachsene, breite Schultern, Brustkorb ist ausgeprägt, wird nach unten zu schmaler, hat eine auffallende Entwicklung der Muskulatur und des Skeletts 4. Dysplastisch: ist ein Spezialtyp, der mehr oder weniger von den drei erstgenannten Haupttypen abweicht. Dieser Typ hat teilweise angeborene, teilweise erworbene Formstörungen, wie eine Unter- oder Überentwicklung einzelner Körperregionen. Dazu zählen Riesen- und Zwergwuchs, abnormer Fettansatz, überdurchschnittliche Ausprägung der Extremitäten, … Unter Kretschmers Patienten befanden sich so viele Leptosome, dass er glaubte einen statistischen Zusammenhang gefunden zu haben. Selbst eine nachträglich durchgeführte statistische Analyse zur Überprüfung Kretschmers Aussagen bestätigten den Zusammenhang. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schizophrener leptosom ist lag bei r= .46, und ein Manisch-Depressiver pyknisch lag bei r=.78. Kretschmer ordnete den Typen bestimmte Temperamente (er verstand Temperament als umweltstabiles Persönlichkeitsmerkmal) zu, die er durch die Analyse der prämorbiden Persönlichkeit seiner Patienten erschloss. Der schizothyme Temperamentstyp ist feinfühlig, empfindlich, eigenwillig, ungesellig und still (leptosom) Der zyklothyme Temperamentstyp ist gesellig, freundlich, heiter, gutherzig, gemütlich, humoristisch, lebhaft, hitzig, still, ruhig und schwernehmend (pyknisch) Der bradykinetische Temperamentstyp wird als ruhig, ernsthaft, langsam und bedächtig beschrieben und zeichnet sich durch eine geringe Reizempfindlichkeit, eine starke Beharrungstendenz sowie eine schwer bewegliche Affektivität aus. Früher nannte man diese Temperament auch viskös (athletisch) Kritik zu Kretschmers Ansatz: Positiv ist, dass er zu einer Zeit, in der der Behaviorismus und die Lerntheorie dominierten, den Blick wieder auf die Anlage von Verhalten – also die biologischen Grundlagen – gelenkt hat. Beanstandet wurde sein Ansatz, weil seine Typen „reine“ Typen sind und die vielen Mischtypen nicht zugeordnet werden können. Außerdem wurde er wegen der Nichtberücksichtigung des Problems der Alterskonfundierung kritisiert. Schizophrenie tritt meist in einem jüngeren Alter auf als eine Bipolare Störung. Der Zusammenhang zwischen Dickleibigkeit und einer manisch-depressiven Erkrankung könnte also auch rein auf das Alter der Erstmanifestation zurück zu führen sein. Wegweisend ist Kretschmers Forschung allemal, da sie in zwei entgegengesetzte Richtungen weist. Zum einen in die Richtung der Erforschung der biologischen Basis von Persönlichkeitseigenschaften. Zum anderen, in die Richtung der sozialen Bedingtheit von Eigenschaft (im Sinne der Lerntheorie, z. B.: Zusammenhang von Armut, Dickleibigkeit und Depression.) Ad 12) Religion als Vorläufer der Persönlichkeitsforschung Im christlich-jüdischen Bild vom Menschen ist der Kampf gegen die Versuchungen des Bösen integriert. Der Mensch wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und kämpft für das Gute und gegen das Böse. Da die Natur des Menschen spirituell ist, ist sie nicht von dieser Welt sondern Teil der göttlichen Ordnung und daher der Wissenschaft auch nicht zugänglich. Selbst Lavater quälte sich mit der Frage, ob es ethisch richtig ist, Menschen, die Gott in ihrer Vielfältigkeit geschaffen hat, so zu analysieren. Ist das Wissen, das man mit der Erforschung der Persönlichkeit erlangt, nicht schädlich und öffnet es nicht dem Missbrauch Tür und Tor? In der östlichen Tradition wird Spiritualität anders gelebt. Der Geist ist durch bestimmte Techniken formbar (Meditation). Die Interessen an Bewusstheit, Selbsterfüllung und dem menschlichen Geist spielen eine große Rolle und finden sich in den existenzanalythischen Ansätzen von Maslow, in der Persönlichkeitspsychologie von C. G. Jung und in heutiger Zeit, in den achtsamkeitsbasierten Techniken und Ansätze verschiedenster Psychotherapierichtungen (z. B. Verhaltenstherapie, KBT, Personenzentrierter Psychotherapie, ...) wieder. Die Schwächung des Einflusses von Religion auf die Erforschung der menschlichen Natur begann im 17. Jahrhundert in der Renaissance. Philosophen wie Descartes, Spinoza und Leibniz beschäftigten sich mit Emotionen, Körper, Verstand, Motivation, Wahrnehmung und Bewusstsein. Wo wir heute noch einen „Hauch“ der Religion spüren, ist z. B. die Diskussion, ob Homosexualität moralisch vertretbar ist, ob die Familie schützenswert ist in dem Sinn, ob z. B. homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, ob die Erziehung durch homosexuelle Eltern dem Kind einen Schaden an der Persönlichkeit zufüge, ...etc. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich die Biowissenschaften rasant weiter. Darwins Evolutionstheorie verdrängte den Gedanken der göttlichen Lenkung und Gestaltung unserer Persönlichkeit. Das menschliche Verhalten unterlag nun den Naturgesetzen und wurde systematisch wissenschaftlich untersucht. Die Weiterentwicklung von Medizin, Technik, der zunehmenden Säkularisierung veränderte sich unserer Kultur und damit auch die Methoden und Themen der Forschung. Der kulturelle Kontext von Persönlichkeitstheorien: Kulturen unterscheiden sich nicht nur dahingehend, welche Eigenschaften sich zu Persönlichkeitstypen verdichten (Vergleiche der z. B. östlichen Kultur mit der westlichen zeigten, dass es Unterschiede im Stellenwert des Individuums gab und gibt. Werden im Westen eher Eigenschaften beton, die der Entwicklung des Einzelnen dienen, werden in kollektivistischen Kulturen solche geschätzt, die der Gemeinschaft dienen.) Wichtig ist im Kopf zu behalten, dass sich diese Unterschiede nicht nur auf die Wahl und den Blick auf den „Untersuchungsgegenstand“ zeigen, sondern auch im Forschenden selbst. Dies geht so weit, dass die kulturellen Gegebenheiten unsere Wahrnehmung (als Wissenschaftler) formen, wie ein Beispiel zur Neuroplastizität von Nisbett und Masuda zeigte: MICHIGAN FISH-EXPERIMENT Nisbett und Masuda verglichen japanische und amerikanische Studenten in Bezug auf ihre Wahrnehmungsfähigkeit. Ausgangspunkt war die Annahme, dass die westliche Herangehensweise an Probleme eher analytisch, die östliche eher ganzheitlich/holistisch ist. Als Grundlage wurde die Erkenntnis herangezogen, dass die analytische Verarbeitung von Informationen linkshemisphärisch, die holistische Verarbeitung rechtshemisphärisch erfolgt. Als Ergebnis dieser Annahme müssten Ost- und West-Menschen bei ein und derselben Situation unterschiedliche Dinge wahrnehmen. (Ob es sich so verhalten würde, wusste man bis dahin nicht, da immer nur westliche Wissenschaftler westliche Studenten untersucht hatten.) Nisbett und Masuda zeigten zwei Versuchsgruppen (amerikanischen und japanischen Studenten) farbige Animationen von Fischen, die unter Wasser schwammen. Jede Animation hatte einen „Fokus-Fisch“. Das heißt, dieser Fischer unterschied sich von den anderen in dem er entweder größer war, schneller schwamm, etc. Nachdem die Studenten diese Animationen gesehen hatten, wurden sie befragt, woran sie sich erinnerten. Die japanische Gruppe schilderte zu 70 % mehr Details aus dem „Hintergrund“ im Vergleich zu den amerikanischen Studenten (diese beschrieben hauptsächlich den Fokus-Fisch). Im Wiederkennen von Details aus den Animationen gab es ebenfalls Unterschiede. Amerikanische Studenten erkannten die Objekte unabhängig von ihrem Hintergrund gleich gut. Japanische Studenten erkannten die Objekte besser, wenn sie in der Originalszenerie dargeboten wurden. Sie waren gleichsam mit dem Hintergrund verbunden. Nisbett und Masuda fanden auch heraus, dass sich die Art der Wahrnehmung verändern kann. Japanische Studenten, die mehrere Jahre in den USA lebten, zeigten bei diesem Test dieselben Ergebnisse wie ihre amerikanischen Kollegen. „Culture can influence the development of perceptual learning because perception is not (as many assume) a passive, „bottom up“ process that begins when energy in the outside world strikes the sense receptors, then passes signals to the „higher“ perceptual centers in the brain. The perceiving brain is active and always adjusting itself.“ (Norman Doidge, The Brain that Changes Itself, Penquin Verlag, 2007) Kultur kann die Wahrnehmungsbildung beeinflussen, da Perzeption keine Einbahnstraße ist, auf der Sinneseindrücke von außen auf die Sinnesorgane treffen und von dort in die Wahrnehmungszentren des Gehirns geleitet werden. Das wahrnehmende Gehirn ist vielmehr aktiv und passt sich fortwährend an. Die Entwicklung von Persönlichkeit Psychoanalyse – Behaviorismus & kognitive Ansätze – Humanistische Ansätze – Biologische Psychologie Um zu verstehen, wieso es so unterschiedliche Konzepte wie Psychoanalyse und Behaviorismus gibt, ist es wichtig, die gesellschaftliche Entwicklung zu der Zeit, in der diese Theorien entstanden sind, im Kopf zu behalten. Dazu gehören z.B. das Verständnis von Gesundheit und Krankheit zu jener Zeit, sowie die Konzepte zu „psychisch krank“ vs. „moralisch verwerflich. Viele schwere Krankheiten wie Schizophrenie, Autismus, Depressionen, Manien, Zwänge, Persönlichkeitsstörungen/Hysterie waren nicht behandelbar. Der Umgang mit psychischen Kranken war oft roh und hilflos – aus heutiger Sicht ethisch nicht mehr vertretbar. Psychopharmaka, so wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit den 60-er Jahren. Sie hatten damals extreme Nebenwirkungen, veränderten nicht nur das Befinden der Betroffenen, sondern auch das Denken der Wissenschaftler und Ärzte über psychischen Erkrankungen und deren Behandlung. Psychoanalyse: Schultz-Venrath schreibt (2013): „Neurowissenschaftler, biologisch orientierte Psychiater und kognitiv orientierte Verhaltenstherapeuten kommen inzwischen nicht mehr umhin, sich mit psychoanalytischen und psychodynamischen Überlegungen auseinanderzusetzen. Sie akzeptieren, dass ein großer Teil der Emotionen nicht bewusst ist und >>nur einige dieser Vorgänge in ihrer Endstrecke als Gefühle – und zumeist auch nur für eine kurze Zeit – bewusst werden<< (Mertens 2011b, S51). Sie bedienen sich aber der Psychoanalyse häufig im Sinne eines Steinbruchs, ohne die psychoanalytische Herkunft ihrer Überlegungen anzuerkennen, wobei sie die Psychoanalyse als Grundlagenwissenschaft häufig noch entwerten.“ (S.14) Die Psychoanalyse ist aktuell wie noch nie – auch bei Nicht-Analytikern. Was sie so aktuell macht, ist ihre Offenheit für neuro-biologische Forschung. Dies mag mit dem Gründervater, Sigmund Freud, der selbst Neurologe war, zu tun haben. Bemerkenswert ist, dass gerade in der Erforschung von Therapiewirksamkeit, Persönlichkeitsveränderung, Neuroplastizität, die Psychoanalyse eine dominante Rolle einnimmt. Doch zunächst zu den Ursprüngen, zu Sigmund Freud: Sigmund Freud war einer der bedeutendsten Denker seiner Zeit. Er schuf mit seiner Psychoanalyse eine fundamental andere Herangehensweise an menschliches Leid. Auch wenn vieles von dem, was Freud entdeckte, nicht mehr uneingeschränkt gültig ist, hat er dennoch Meilensteine gesetzt, an denen noch heute niemand rüttelt. Seine Methode der freien Assoziation war und ist immer noch wegweisend. Moderne Neuroplastizitätsforscher beschäftigen sich mit ihr im Rahmen der „Neuropsychoanalyse“. Doch was ist das Fundamentale, das wir Freuds Scharfsinn zu verdanken haben? Freud, der Begründer der Psychoanalyse, stellte zwei verschiedene und nicht ganz deckungsgleiche Modelle des psychischen Apparats auf: Das topographisches Modell = „Bewusstes/Vorbewusstes/Unbewusstes“ Das Strukturmodell = „Ich/Es/Über-Ich“ Freud formulierte als erster die Idee, dass unser Verhalten größtenteils durch, für uns nicht bewusst zugängliche, Motive gesteuert wird. Diese Motive sind eigentlich unbewusste, intrapsychische Triebkräfte. Sie bewirken, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten (und dieses Verhalten auch nicht wirklich gut erklären können). Bis zu Freuds „Entdeckung“ hielt man den Menschen für ein rationales, vom Willen in Richtung Ziele gesteuertes Lebewesen. Freud lehnte sich gegen diese Sichtweise auf. Der Mensch ist kein rational handelndes Lebewesen. Er entwickelte darauf hin sein topografisches Modell (auch topologische Modell), in dem er unterschiedliche Grade an Bewusstheit psychischer Inhalte postulierte: Bewusstsein bezog sich in diesem Modell auf jene Geistesinhalte, die wir kennen und derer wir uns gewahr sind. Vorbewusstsein beinhaltet Gedächtnisinhalte, die uns gerade nicht im Gedächtnis sind, die wir aber leicht abrufen können (z .B. Jemand erzählt eine Geschichte und uns fällt dazu eine ähnliche Geschichte aus unserer Vergangenheit ein). Unbewusstsein besteht aus Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Wünschen („Triebrepräsentanzen“) oder Fantasien. Sie wären laut Freud für uns nicht akzeptabel. Daher werden sie verdrängt und dürfen uns nicht bewusst werden. Der Mechanismus der Verdrängung ist ständig aktiv (außer im Schlaf und bei den Fehlleistungen, den „Freud’schen Versprecher“, bei psychosomatischen Beschwerden, ...). Freud ging nicht von einer klaren Trennung aus, sondern nahm Überlagerungen der Systeme an. Jedes System hätte seine eigene Art zu Denken. Nach Freud ist der Traum der Königsweg zum Unbewussten. Er besteht aus zwei Arten von Inhalten: (1) Der manifeste Trauminhalt ist das, was dem Träumenden nach dem Erwachen in Erinnerung bleibt. Dieser erinnerbare Trauminhalt ist jedoch ein akkurates Bild von unserem Unbewussten, es ist symbolisch und verschlüsselt/zensiert, um bedrohliche Inhalte vom Bewusstsein fernzuhalten. (2) Der latente Trauminhalt beschreibt die „wahre Bedeutung“ des Traumens und wird in der Psychoanalyse erschlossen. Freud ging davon aus, dass viele der zensurierten Inhalte sexueller Natur sind. Das, was im Traum passiert, nennt Freud „Primärprozess“. Dies ist eine nicht-logische Form des Denkens, in der Zeit und Raum keine Rolle spielen. Was im Wachbewusstsein logisch nicht möglich ist, ist im Traum kein Problem. Der Sekundärprozess beschreibt das rationale Denken. Es folgt dem Realitätsprinzip. Das bedeutet, dass wir im Einklang mit den tatsächlichen Gegebenheiten der realen Welt und den Fakten, wie wir sie wahrnehmen, agieren. Sekundärprozesshaftes Denken steht für das Bewusste und Vorbewusste. Tagträume, kreative Prozesse und emotionales Denken seien – nach Freud – eine Mischung aus primär- und sekundärprozesshaftem Denken. Primärprozess Sekundärprozess Lustprinzip – Lustgewinn Bildhafte Darstellung Mehrdeutigkeit (Verdichtung) Entladung, Befriedigung Kein Bezug zur Zeit Keine Verneinung Worte als Ding Keine Verbindungen Realitätsprinzip Logisches Denken, Kausalität Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit Wissen um die externe Realität Bewusstsein der Zeit Verneinung Verbale Symbole Verbindung mit anderen Ideen Was kann uns Freud zur grundlegenden Natur des Menschen sagen? Für Freud liegt die Antwort zur Frage über die Natur des Menschen darin, wie die Persönlichkeit strukturiert ist und wie sie sich entwickelt. Bis zu Freud war das Bild des Darwinismus vorherrschend. Ein Säugling stünde demnach irgendwo zwischen Primaten und Erwachsen. Mit den Tieren hat er die grundlegenden Triebe gemeinsam, diese kreisen um Nahrungsaufnahme und Sexualität. Freud geht davon aus, dass es eine spezifische Triebenergie gibt, die er als Libido bezeichnete. Die Libido ist angeboren und formt sich im Laufe der menschlichen Entwicklung zur Grundlage der erwachsenen Sexualität. Das heißt, das biologische Erbe (= Libido) verändert sich durch Erziehung und Umweltfaktoren. Nach Freud wird jedes Verhalten durch Triebe energetisiert. Freud definierte anfangs zwei Arten von Triebe: a) Sexualtrieb, b) Selbsterhaltungstrieb (Nahrungstrieb, Schmerzvermeidung, ...) Beide wirken positiv und lebensverlängernd. Später änderte er sein Konzept und fügte den „Thanatos“, den Todestrieb hinzu. Er ist ein aggressiver Trieb, der sich gegen sich selbst richtet und auf die Auslöschung der eigenen Existenz abzielt. Die Veränderung seiner Theorie geht Hand in Hand mit den Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg. Nach Freud befindet sich der Mensch im ständigen Kampf darum, seine Triebe zu befriedigen, wobei sich die Art der Triebbefriedigung im Laufen des menschlichen Lebens ändern kann. Das topische Modell (= Strukturmodell) der Psyche: 1923 entwickelte Freud sein zweites topisches Modell des Seelischen, das Strukturmodell der Psyche. Er unterschied 3 Grundstrukturen: das „Es“, das „Ich“ und das „Über-Ich“ „ES“ Das „Es“ - nach Freud - ist der Hort der rohen, ungehemmten Triebenergie. Es ist der Sitz aller Impulse und der mentalen Energie, es steuert die Selbsterhaltung im Sinne der Nahrungsaufnahme, Bedürfnis nach Wärme, Sicherheit, Sexualität, Aggression, Dominanz und Selbstzerstörung. Freud nahm an, dass bei einem Neugeborenen nur das „Es“ vorherrsche. Das „Es" arbeite ausschließlich nach dem Lustprinzip und nach dem primärprozesshaften Denken. Säuglinge schreien, wenn sie sich unwohl fühlen, sie sind nicht zu Bedürfnisaufschub fähig (= Selbstkontrolle / Psychoregulation, die es uns möglich macht, Bedürfnisse aufzuschieben um ihre Erfüllung zu garantieren). Diesen muss das Baby lernen. Durch Sozialisation lernt das Kind die triebhaften Bedürfnisse so zu steuern, dass sie sozial erwünscht vorgebracht und (ohne in Konflikte mit der Umwelt zu geraten) erfüllt werden können. Z. B.: Sie wollen den super-schnellen, schönen Sportwagen, der vor Ihnen in der Auslage steht. a) Kein Bedürfnisaufschub: Sie schlagen die Scheibe ein, brechen das Auto auf und stehlen es. b) Geringer Bedürfnisaufschub: Sie nehmen einen Kredit auf, damit Sie den Wagen schon nächste Woche haben können. c) Großer Bedürfnisaufschub: Sie lesen den Preis, suchen sich einen Zweitjob und arbeiten bis Sie das Geld haben. Nicht alle erwähnten Möglichkeiten des Bedürfnisaufschubes sind (losgelöst, von der Frage, ob sie mit Ihrem Gewissen zu vereinbaren wären) strafrechtlich einwandfrei. Im Zuge der Entwicklung lernt das Kind die libidinöse Energie aus dem „Es“ zu verlagern. Es entwickelt sich das „Ich“. „ICH“ Das „Ich“ bezeichnet den Teil der Psyche, der den exekutiven Teil der Persönlichkeit darstellt. Es ist der planende, denkende und organisierende Teil des Seelischen. Das „Ich“, das nach dem Realitätsprinzip und dem damit verbundenen Sekundärprozess-Denken arbeitet, wird zum Mediator zwischen dem Kind und der Außenwelt. Das Kind bezieht jetzt bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse die soziale Realität mit ein. Ein „reifes Ich“ ist Träger des Bewusstseins, Vermittler zwischen den aus dem „Es“ andrängenden Triebregungen und den im „Über-Ich“ lokalisierten Geboten und Verboten. Es ist außerdem Überprüfungs- und Entscheidungsinstanz, die die Probleme und Konflikte, wie sie oft angesichts widersprechender Anforderungen entstehen, prüft, Problemlösungen erprobt, bejaht oder verwirft. Die Erfüllung der Wünsche kann sofort erfolgen oder aufgeschoben werden. Es kann zu Kompromissen kommen, zur Sublimierung oder zum Verzicht. Dem „Ich“ stehen die Potenziale des „Es“ voll zur Verfügung: Erotik, Sinnlichkeit oder Leidenschaftlichkeit ist integriert. Hinsichtlich des „Über-Ichs“ kann das reife „Ich“ entscheiden, ob ein Gebot Sinn macht, oder ob eine Ausnahme besser ist. Es prüft kritisch Vorurteile, hinterfragt und wandelt diese in ein bewusstes Urteil um. „ÜBER-ICH“ Das „Über-Ich“, ist die dritte Struktur, die das sogenannte „Gewissen“ darstellt. Es hilft dem Kind und später dem Erwachsenen dabei Entscheidungen, in Bezug auf richtig und falsch, zu treffen, sowie einzuschätzen, welche Verhaltensweisen zulässig sind. Der Ursprung des „Über-Ichs“ liegt in den Werten und Normen der Eltern/Erziehungspersonen. Das „Über-Ich“ ist der Gegenspieler des „Es“ und unterstützt das „Ich“ dabei unangebrachte Triebimpulse des „Es“ abzuwehren. Die Ideale unserer Persönlichkeit liegen ebenfalls im „Über-Ich“ und stellen eine eigene Instanz dar. Bei einem reifen „Ich“ steht das „Über-Ich“ nicht mehr über dem „Ich“ sondern auf gleicher Ebene. Ideale werden geprüft und angepasst. Der „Ich“-Begriff ist in der Psychoanalyse mit dem Persönlichkeitsbegriff identisch. Das „Ich“ ist die Vorstellung einer zusammenhängenden Organisation der seelischen Vorgänge in einer Person. Reiter-Bild: Das „Ich“ ist der Reiter, der – wenn er das Reiten gut beherrscht - das Pferd (=„Es“) lenkt und mit dem Pferd in Kooperation über sich hinaus wächst. Er wird durch das Pferd stärker, mobiler, wendiger, etc. Das „Ich“ ist eine starke Instanz, die autonom denkt, fühlt und handelt. Es hat sich von störenden, hinderlichen Abhängigkeiten, das heißt von den Ansprüchen der Triebe, der „Ich“-Ideale und des „Über-Ichs“ befreit. Ist der Reiter nicht in der Lage das Pferd zu reiten, wird es mit ihm durchgehen. Das „Ich“ fühlt sich dem Willen des „Es“ völlig ausgeliefert. Alle drei Strukturen stehen im intrapsychischen Konflikt zueinander. Die Zensur versucht den unbewussten Wunsch zu verdrängen. Wenn das nicht gelingt, entsteht Angst und in der Folge neurotische Symptome. Da selbst Freud feststellte, dass sein Modell „etwas hinkt“, folgte später die Ergänzung durch das Strukturmodell. In diesem steht dem „Ich“ eine ganze Reihe an Abwehrmechanismen zur Verfügung um zwischen Triebregung und Außenwelt zu vermitteln. Diese Abwehrmechanismen entstehen während verschiedener Entwicklungsphasen des Seelenlebens. Heute unterscheidet man zwischen frühen und späteren Abwehrmechanismen. Sie sind nicht nur dazu da, der äußeren Realität gerecht zu werden, sondern sie verarbeiten vor allem Angst. Freud unterschied verschieden Formen der Angst, die entwicklungsgeschichtlich aufeinander folgen. Diese verband er mit spezifischen Entwicklungsphasen. Angst ist nicht mehr das Ergebnis einer missglückten Abwehr (topografisches Modell) sondern die Angst mobilisiert die Abwehrformationen. Die oberste Aufgabe des „Ichs“ ist nach dem Strukturmodell die Reduzierung der Angst und Selbsterhaltung. Die primären, konfliktfreien, unabhängigen, autonomen „Ich“-Apparate, wie Wahrnehmung, Motorik, Intelligenz können sekundär durch neurotische, psychosomatische oder psychotische Konflikte beeinträchtigt werden (=> Intelligenztest!). Seelische Struktur und Objektbeziehung: Freud betonte in verschiedenen Schriften, die Bedeutung des Objekts für die psychische Entwicklung des Säuglings. Er erkannte, dass das „Objekt“ für die seelische Strukturbildung entscheidend ist. Dies ist mittlerweile von allen tiefenpsychologisch orientierten psychotherapeutischen Schulen anerkannt. Der Säugling braucht die zwischen ihm und seiner Mutter / Bezugsperson stattfindenden Austauschprozesse – positive durch die Befriedigung des Bedürfnisses oder negative durch das Versagen des Bedürfnisses – um diese Struktur zu bilden. Das Objekt hat in der psychoanalytischen Theorie nicht nur für die Strukturbildung große Bedeutung, sondern auch für die kognitive und affektive Entwicklung, und ganz besonders für die Symbolisierung, hier verstanden als das bewusste, reflexive und das unbewusste Denken. Freud unterschied fünf abgegrenzte Phasen der Persönlichkeitsentwicklung, die er aufgrund der zentralen Bedeutung der Sexualtriebe in seiner Theorie als psychosexuelle Entwicklung bezeichnet. Die Libido konzentriert sich in jeder Phase auf eine andere Körperregion‚ (=„erogene Zone“ / Lustzentrum). Diese Körperregion ist in der jeweiligen Entwicklungsphase sehr sensibel. Die Entwicklung ist biologisch vorprogrammiert, Störungen sind „sozialer Natur“ und entstehen durch ein nicht adäquates Reagieren der Bezugspersonen. Dieses Modell gilt mittlerweile als überholt. Abwehrmechanismen: Diese entwickeln sich in der Latenzphase. Sie wehren Impulse des „Es“ ab. Sie haben die Aufgabe uns vor psychischen Verletzungen zu bewahren und unser Selbstwertgefühl zu schützen. Freud postulierte, dass jeder Mensch, je nachdem unterschiedliche Abwehrmechanismen anwendet und dass das so auch gut sei. Abwehr ist ein normalpsychologisches Phänomen. Krankhaft wird es erst, wenn die Abwehr nicht mehr angemessen ist. Die Abwehr gehört im psychoanalytischen Modell zu den „Ich“-Funktionen. Abwehrmechanismen werden in reifere (z. B. Verdrängung) und unreifere (z. B. Spaltung) unterteilt und sind die Voraussetzung zur Bewältigung unbewusster, psychischer Konflikte und damit Grundlage der Fähigkeit zur Selbststeuerung. Diese Auflistung folgt Anna Freud und der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (kurz: OPD, Wikipedia) und enthält eine Auswahl an Abwehrmechanismen: 1. Verdrängung: Ist ein Abwehrmechanismus, der vor allem die Aufgabe hat, das „Ich“ vor einem bedrohlichen Einfluss zu schützen. Unerwünschte „Es“-Impulse, die ein Gefühl von Schuld, Scham oder das Herabsetzen des Selbstwertgefühls hervorrufen, werden durch „Ich“ und „Über-Ich“ in das Unbewusste verdrängt. Von dort aus können sie allerdings in Träumen, Fehlleistungen und Ersatzhandlungen wieder zutage treten. Freuds Begriff der Verdrängung muss von einer willentlich-bewussten Unterdrückung unterschieden werden. Verdrängung ist ein unbewusster Automatismus, der bewusste Zugang zum verdrängten Inhalt (ohne psychoanalytische Unterstützung) ist nicht möglich. BSP: Klient Z (73a) mit chronischer Verstopfung/medizinisch o.B.: „Da unten geht nichts weit. Das ist alles tot!“ 2. Reaktionsbildung: Gefühle oder Motive werden durch entgegengesetzte Gefühle/Motive niedergehalten (z. B. Mitleid statt aggressiver Impulse oder Hassgefühle, wenn Liebesgefühle gefährlich erscheinen). Dies muss abgegrenzt werden von einer bewusst ablaufenden Unterdrückung (z. B. wenn ein Arzt eine attraktive Patientin körperlich untersucht). BSP: ehemalige Raucher die zu fundamentalistische Nichtrauchern wurden 3. Regression: Es erfolgt ein überwiegend unbewusster Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe der „Ich“-Funktion, in der ein niedrigeres, organisiertes Verhalten noch funktioniert hat (Trotzverhalten, Fresslust, Suche nach Versorgung). 4. Progression: Ist das Gegenstück zur Regression. In einer gefährlichen Situation verhält sich jemand in einer erwachsenen Weise. Es findet eine Flucht in spätere Entwicklungsstadien statt. Zum Beispiel wenn die Mutter einer Zehnjährigen nicht mehr da ist, kümmert diese sich um jüngere Geschwister und wird zum Mutterersatz. Wenn die Belastung vorüber ist, kann es zu einer Regression über das Ausgangsniveau hinweg kommen. 5. Verleugnung: Im Unterschied zur Verdrängung wird nicht ein konfliktreicher, innerer Wunsch abgewehrt, sondern ein äußerer Realitätsausschnitt verleugnet, also in seiner Bedeutung nicht anerkannt. Beispielsweise werden Veränderungen in der Umgebung zwar wahrgenommen, aber ihre reale Bedeutung wird emotional nicht erlebt und rational nicht anerkannt. Z. B.: Komplexe Trauer – manche Menschen handeln so als wäre der verlorene Partner noch da. 6. Vermeidung: Triebregungen werden umgangen, indem Schlüsselreize vermieden werden. 7. Verschiebung: Phantasien und Impulse werden von einer Person, der sie ursprünglich gelten, auf eine Andere verschoben, so dass die ursprünglich gemeinte Person unberührt bleibt. Z. B.: Aggression gegen eine tadelnde Autoritätsperson wird in Form von Beschimpfungen oder Tritten als Aggressionsverschiebung an einem Hund ausgelassen. 8. Spaltung: Inkompatible Inhalte werden auf mehrere Objekte verteilt. Sowohl die Objekte als auch das Selbst werden in „gut“ und „böse“ oder „schlecht“ aufgeteilt. „Gute“ Anteile werden idealisiert, „böse“ oder „schlechte“ werden entwertet bzw. abgewertet, verdammt oder dämonisiert (Vgl. Entwertung). 9. Verneinung: Negierung eines Sachverhalts. Im Gegensatz zur Reaktionsbildung wird ein Gefühl oder eine Einstellung nicht durch deren Gegenteil ersetzt, sondern nur deren Vorhandensein verneint („Ich empfinde überhaupt nichts für XXX“). 10. Ungeschehen machen: Einsatz faktisch unwirksamer Handlungen und Rituale, denen eine symbolische Kraft zugeschrieben wird, mit dem Ziel, Strafe bei Verbots- und Gebotsübertretungen abzuwenden. BSP: Patient Z (73a.) chronische Verstopfung/medizinisch o.B.: führen von Excel-Tabellen über seine Stuhlabgaben, inkl. phänomenologischer Beschreibung derselben,… 11. Projektion: Eigene psychische Inhalte und Selbstanteile (vor allem Affekte, Stimmungen, Absichten und Bewertungen) werden anderen Personen zugeschrieben. Der Triebimpuls bzw. das Motiv wird auf ein Objekt projiziert wie bei einer optischen Projektion. 12. Projektive Identifizierung: Kombination von innerpsychischen und interpersonellen Vorgängen, bei dem das Gegenüber (unbewusst) so beeinflusst wird, dass es bestimmte Erwartungen erfüllt. Im subjektiven Sinne „negative“ Selbstanteile (in der Regel Aggressionen) werden erst abgespalten, dann auf das Gegenüber projiziert – wenn das Gegenüber sich unbewusst mit den abgespaltenen, projizierten Anteilen identifiziert und so handelt, wie es der Erwartung entspricht (z. B. aggressiv) werden durch diese Externalisierung unangenehmer oder unerträglicher Selbstanteile so innere Konflikte in der Außenwelt inszeniert, um das innerpsychische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, was jedoch die Beziehungen zu anderen stark belasten kann. Es handelt sich um einen für sogenannte Borderline-Störungen typischen Abwehrmechanismus, der die Schwierigkeiten, sich der Psychodynamik der Betroffenen gegenüber abzugrenzen, besser verständlich macht. 13. Introjektion und Identifikation: Wehrt Angst vor Bedrohungen von außen ab durch das Einverleiben äußerer Einflüsse wie z. B. bestimmtes Verhalten, Anschauungen, Normen oder Werte einer anderen Person in die „Ich“-Struktur, sodass das Individuum sie nicht mehr als Bedrohungen von außen erleben muss. BSP: aggressiver abwertender Vater macht sein Kind ständig herunter – Kind wird erwachsen und gelangt zur Überzeugung nichts wert zu sein. 14. Identifikation mit dem Aggressor: Bei einem gewaltsamen Übergriff bzw. einer psychischen Grenzüberschreitung wird die Verantwortung für das Geschehen sich selbst zugeschrieben und/oder die Einstellung oder das Verhalten eines Angreifers übernommen. Beides dient der Abwehr unerträglicher Angst- und Hilflosigkeitsgefühle und einer symbolischen Rückerlangung von Kontrolle. 15. Intellektualisierung: Entfernung vom unmittelbaren, konfliktauslösen Erleben durch Abstraktionsbildung und theoretisches Analysieren (z. B. abstrakte Gespräche über das Wesen der Liebe; Fachsimpeln unter Ärzten oder Therapeuten über schwierige Klienten oder solche, die in ihrem Leid als psychische Belastung erlebt werden), Philosophieren über Dinge, die eine verborgene emotionale Bedeutung für die Person haben. 16. Rationalisierung: Rational-logische Handlungsmotive werden als alleinige Beweggründe für Handlungen angegeben oder vorgeschoben. Gefühlshafte Anteile an Entscheidungen werden ignoriert oder unterbewertet. 17. Sublimierung oder Sublimation: Nicht erfüllte Triebwünsche werden durch gesellschaftlich höher bewertete Ersatzhandlungen ersetzt und damit befriedigt (Kunst, Wissenschaft, Musik, Sport, exzessive Arbeit). Typischerweise eignen sich für bestimmte Wünsche bestimmte Sublimationstechniken besonders gut. So werden aggressive Triebe oft durch Sport sublimiert, sexuelle Wünsche durch Beschäftigung mit schönen Künsten oder kindliche Neugierde durch wissenschaftliche Forschertätigkeit. Sublimierungen erfüllen die Befriedigung der Triebwünsche oft gut und werden dann nicht als psychopathologisch angesehen. Nach Freud ist die Sublimierung ein wichtiger Motor für die Kulturentwicklung. 18. Somatisierung: Nicht-Wahrnehmen eines Konflikts in seiner eigentlichen Gestalt, sondern in Form körperlicher Beschwerden. Diese haben jedoch keine symbolische Beziehung zum Konflikt. 19. Konversion: Umlagern eines psychischen Konflikts auf somatische Symptome, die eine symbolische Beziehung zum Konflikt haben. Entspricht dem früheren Hysteriebegriff (hysterische Blindheit, Lähmung). 20. Affektualisierung: Ein Ereignis oder Verhalten wird dramatisiert. 21. Entwertung/Idealisierung: Objekte werden unbewusst entwertet oder überhöht. 22. Affektisolierung: Fehlen oder Dämpfung eines normalerweise spontan auftretenden Gefühls in einer bestimmten Situation. Der Nachweis eines isolierten Affektes dient therapeutisch auch der Bewusstmachung und rationalen Betrachtung bestimmter gefühlsintensiver Reaktionen. 23. Autoaggression: Aggressive Impulse werden gegen die eigene Person gerichtet und treffen so nicht die Person, der sie ursprünglich galten, um die Beziehung zu dieser Person nicht zu gefährden. Das interpersonelle Feld wird so von Störungen freigehalten, ein interpersoneller Konflikt wird zulasten eines intrapsychischen Konflikts vermieden. 24. Isolierung: Ein unerfüllbarer Wunsch wird dadurch bewältigt, dass er in entstellter Form befriedigt wird, wobei er als fremd, nicht der eigenen Person zugehörig, erlebt wird. Isolierung tritt häufig bei Zwangsneurosen auf, wo zum Beispiel die Zwangsvorstellung, andere Leute könnten auf der Straße tot umfallen, an die Stelle eines vom „Ich“ nicht annehmbaren Todeswunsches gegen den Vater tritt. 25. Gefühlsblockaden als Reaktion auf Gefahr: Unter dem Einfluss eines traumatischen Ereignisses, zum Beispiel wenn jemand einen nahen Angehörigen verliert, kann es zu einer Blockierung aller Affekte und Stimmungen kommen, also zu einer Extremform der Isolierung vom Affekt. 26. Objektneutralisierung: Objekte werden für unwesentlich, unattraktiv und unwichtig gehalten. Damit wird vermieden, dass es im interpersonellen Feld zu intensiven Beziehungen kommt, deren Auswirkungen unangenehm sein könnten (z. B. wenn man bedroht würde, verletzt oder gekränkt zu werden). 27. Selbstneutralisierung: In einer gefährlichen Situation hat die Person das Gefühl, selbst unwichtig zu sein. Wichtig sind nur die zu erreichenden Ziele. Bei Depressiven kann die Selbstneutralisierung vor Selbstvorwürfen schützen (wer sich selbst nicht wichtig nimmt, braucht sich keine Vorwürfe zu machen). 28. Depersonalisation/Derealisation: Treten bei Gefahr auf und haben einen Bezug zu den Frühstörungen. a. Depersonalisation: Es kommt zur Veränderung der Körperwahrnehmung (z. B. Teile des Körpers werden in der Größe oder, wie bei Magersüchtigen, die gesamten Körpermaße werden verändert wahrgenommen). Hat oft das Ziel, ein Umsetzen von (in der Regel aggressiven) Impulsen in motorisches Handeln zu erschweren. b. Derealisation: Die Umwelt wird verändert erlebt. Die Art, wie sich die Umwelt verändert, kann Symbolgehalt haben. Manchmal wird die Umwelt als bedrohlich erlebt, wobei aggressive Impulse in die Umgebung projiziert werden. Freud wird als starrsinniger Mensch beschrieben. Im Vertreten seiner Theorie zur psychosexuellen Entwicklung war er unnachgiebig. Seine Behandlung konzentrierte sich stark auf das Aufspüren der Fixierungen. Er ermutigte seine Klienten zur Katharsis („Reinigung“), dem Ausleben ihrer Emotionen. Diese Form der Abreaktion war für Freud das Element, das heilt. Später fügte er noch hinzu, dass das Verstehen des Konflikts für die Heilung ebenso bedeutsam sei. Seine Behandlungsmethode war die der freien Assoziation, der drei zentrale Annahmen zugrunde liegen: 1. Die von den Klienten frei geäußerten Gedanken leiten den Psychoanalytiker zum Unbewussten. 2. Das Setting „Psychoanalyse“ würde den Klienten in Richtung bedeutsamer Inhalte lenken. 3. Widerstand würde durch Entspannung minimiert und durch Konzentration maximiert. Er dient dazu, die vom Analytiker offen gelegten Aspekte der Psyche, abzuwehren (im Gegensatz zu den Abwehrmechanismen, die Hinweise auf das Unbewusste enthalten). Ein weiterer wichtiger Aspekt der Therapie ist der der Übertragung und Gegenübertragung. Bei der Übertragung verlagert der Klient die durch andere Personen ausgelösten Gefühle auf den Therapeuten. Diese Übertragung wird analysiert, das heißt die Beziehung zwischen Klient und Therapeut ist zentraler Gegenstand der Psychoanalyse. In der Gegenübertragung überträgt der Analytiker selbst einen Teil seiner eigenen emotionalen Reaktion auf den Klienten. Sie ist – gut geschult – ein wichtiges Instrument in der Therapie, das hilft, den Klienten besser zu verstehen. Zu Freuds Theorie: In letzter Zeit wird versucht, die Psychoanalyse mittels bildgebender Verfahren zu evaluieren. Große Bereiche Freuds Theorie sind aber bis jetzt unbestätigt. Viele aktuelle tiefenpsychologischen Forscher sind sogar überzeugt, dass große Teile einfach verworfen werden müssen/können. Freuds Theorie, dass psychische Energie in Form von aggressiven oder sexuellen Triebe unser Verhalten oder Erleben beeinflussen, ist nicht mehr „state of the art“. Wir wissen gesichert, dass das Gehirn über neurophysiologische Erregungsmuster arbeitet, nicht auf Basis dieser Triebenergie. Das Verhalten eines Neugeborenen ist nicht durch den Wunsch nach Triebbefriedigung sondern durch den Wunsch nach Beziehung motiviert. Durch die moderne Forschung konnte herausgefunden werden, dass der Säugling schon sehr früh die Fähigkeiten besitzt sich mit seiner Umwelt auszutauschen. Der Säugling ist schon früh in der Lage zwischen seinen Handlungen und den Handlungen anderer zu unterscheiden. Auch ist er keineswegs undifferenziert und passiv in der symbiotischen Beziehung. Er nimmt ebenfalls den Kontakt mit der Bezugsperson auf, und kann diese regulieren. Wegweisend für seine Zeit war Freud allemal: Er legte den Grundstein für eine humanere Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen. Er bewirkte, dass man diesen Menschen Aufmerksamkeit schenkte und zuzuhören begann. In der modernen, psychodynamischen Psychotherapie finden sich viele seiner Ideen – die evaluiert und zum Teil weiter entwickelt werden konnten - wieder. Freud überwarf sich mit vielen seiner Kollegen und Gefolgsleuten. Diese gründeten darauf hin eigene Schulen und entwickelten bestimmte Aspekte Freuds Theorie weiter. Zwei der berühmtesten ehemaligen Freud-Schüler waren Alfred Adler und Carl Gustav Jung. Alfred Adler gründete nach dem Zerwürfnis mit Freud 1911 den „Verein für Freie Psychoanalytische Forschung“, den er 1913 in „Verein für Individualpsychologie“ umbenannte. Der Kern des Zerwürfnisses war, dass Adler Freuds negative Sicht der menschlichen Motivation nicht teilen wollte. Anders als Freud glaubte er nicht an die Existenz von Strukturen, die miteinander in Konflikt geraten sind. Für ihn stellte sich die Persönlichkeit als Einheit dar. Im Verhalten eines Menschen gibt es Konsistenz und der Mensch strebt danach diese Konsistenz aufrecht zu erhalten. Adler wollte ein wissenschaftliches Verständnis des Menschen entwickeln, das für alle Menschen gilt, für alle Menschen verständlich ist und auch Behandlungsrichtlinien enthält. Für ihn sind sich Menschen ihres Charakters bewusst und handeln dem entsprechend. Der Name „Individualpsychologie“ sollte diesem Einheitsgedanken Rechnung tragen. Der soziale Kontext spielt dabei eine zentrale Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung und das Funktionieren des Individuums. Unsere Umwelt hat entscheidenden Einfluss darauf, zu welchen Menschen wir werden und welche Probleme wir bewältigen müssen. Kausalität – Finalität Angenommen, ein Schüler stört den Unterricht, so drängen sich zwei mögliche Fragen auf: Was ist die Ursache des störenden Verhaltens? (kausale Betrachtung) Was ist der Zweck des störenden Verhaltens? (finale Betrachtung) Im ersten Fall blicke ich in die Vergangenheit des Schülers und stelle möglicherweise fest, dass er eine belastende frühe Kindheit hatte und jetzt als Schlüsselkind bei der berufstätigen Mutter lebt. Im zweiten Fall habe ich die Zukunftsbezogenheit des Schülers im Auge und stelle möglicherweise fest, dass er stets die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, um im Zentrum stehen zu können. Die meisten Psychologen legten zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Schwergewicht auf die ursächliche (kausale) Betrachtungsweise. Freud z.B. verstand das Verhalten des Menschen vorwiegend als Wirkung frühkindlicher Erfahrungen, und die meisten Verhaltenspsychologen (Behavioristen) betrachteten alle Äußerungen des Menschen als Reaktionen auf vorausgehende Reize. Adler setzte hier mit seiner Kritik ein: Er wies darauf hin, dass alles Lebendige einem Ziel bzw. Zweck entgegen strebt und dass menschliches Verhalten in seinem Wesen nur verstehbar ist, wenn man es als ziel- und zweckgerichtet betrachtet. Die Beweggründe für unser Verhalten liegen somit nicht einfach in der Vergangenheit, sondern wesentlich in der Zukunft. Adler war der Ansicht, dass vorausgehende Ursachen zu den verschiedensten Verhaltensweisen führen können, die unter sich kaum einen sinnvollen Zusammenhang haben, und dass es nur die in der Zukunft liegenden Zwecke sind, die bewirken, dass in unserem Verhalten Konsequenz und Einheitlichkeit zu erkennen sind. Er war überzeugt: Wer einen Menschen oder eine einzelne Verhaltensweise eines Menschen verstehen will, muss nach dessen Zielen und Zwecken forschen. Ein zentrales Element seiner Theorie ist das des Minderwertigkeitskomplexes: Ähnlich wie Freud, ging Adler davon aus, dass ein Säugling als tabula rasa auf die Welt kam. Vererbung oder gar die Präexistenz einer Seele lehnte er ab. Dennoch anerkannte er, dass selbst Kinder, die in derselben Familie aufgewachsen sind, unterschiedlich sind. Um diese Unterschiede zu erkläre, griff er auf den Begriff der Organminderheit zurück, der aus der Darwin’schen Evolutionstheorie stammte. Unter Minderwertigkeit verstand Adler zunächst ein physisches „Defizit“ (Behinderung). Adler beobachtete sehr oft, dass Menschen, die eine Behinderung haben, große kompensatorische Kräfte entwickeln konnten. So hat ein einarmiger Mensch oft große Muskelkraft (Organwachstum) im verbleibenden Arm, Blinde oft einen herausragenden Hör- und Tastsinn (Organspezialisierung; heute über Neuroplastizität erklärbar). Er stellt aber auch fest, dass für diese Art des Ausgleichs harte Arbeit notwendig war. Das zentrale Nervensystem unterstützt das Individuum in dem es Organwachstum oder Spezialisierung in der Funktion anregt. Zu Beginn interessierte sich Adler für biologische Minderwertigkeiten. Im Rahmen späterer Studien an Kindern rückte die „eingebildete“ Minderwertigkeit, aufgrund sozialer Konventionen, immer mehr in das Zentrum seines Interesses. Geist und Körper waren eine untrennbare Einheit. Die sozial festgelegten Minderwertigkeiten würden das Bedürfnis nach Kompensation hervorbringen. Später erweiterte er das Konzept noch einmal und meinte, dass es eine biologische Unvollkommenheit bei der Geburt gäbe die automatisch bei jedem Menschen Minderwertigkeitsgefühle hervor riefe (alle anderen, z. B.: Geschwister, Eltern, Verwandte, können schon mehr als der Säugling). Dieses Minderwertigkeitsgefühl begleite uns Menschen ein Leben lang. Daraus erwachse beim Menschen ein Machtstreben, um die gefühlte Minderwertigkeit zu kompensieren. Zwei Möglichkeiten des Ausgleichs Der Mensch ist grundsätzlich ein soziales Wesen. Er kann als Einzelner nicht Mensch werden und im Allgemeinen auch nicht überleben. Adler ist davon überzeugt, dass dem Menschen ein Gefühl für sein Hingeordnetsein auf die Gemeinschaft angeboren ist. Er nennt es „Gemeinschaftsgefühl“. Ist dieses Gefühl genügend entwickelt, so kommt der Mensch zur Erkenntnis, dass er seine gefühlte und auch objektiv bestehende Minderwertigkeit nur dadurch auf eine menschenwürdige Weise ausgleichen kann, dass er mit andern zusammenarbeitet und die Lebensaufgaben gemeinsam löst. Minderwertigkeit kann also durch Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls ausgeglichen werden. Fatalerweise legen nun aber nach Adler die gegebenen sozialen Strukturen (Kapitalismus) und der Zeitgeist (Konkurrenz-Denken) dem Kinde, das seine Minderwertigkeit erlebt, die Fiktion nahe, es könnte einen Ausgleich durch individuelles Höherstreben erreichen. Mit diesem ichbezogenen vertikalen Streben versucht der Einzelne, sich Anerkennung und Geltung zu verschaffen, Überlegenheit über andere zu gewinnen oder Macht auf sie auszuüben. Nach Adler bringen die Erfahrungen in der frühen Kindheit das Kind dazu, dieses Höherstreben (Kompensieren) mit bestimmten, sich stets wiederholenden Verhaltensmustern zu realisieren. Mit andern Worten: Das Kind legt sich schon früh einen persönlichen Lebensstil zurecht, von dem es annimmt, dass er ihm das Erreichen der erwähnten Ziele (Anerkennung und Geltung, vielleicht auch Überlegenheit und Macht) garantiert. Adler spricht in diesem Zusammenhang von einem „geheimen Lebensplan“ und drückt damit aus, dass diese Zusammenhänge dem Kind selbstverständlich unbewusst sind. Adler verwendet für die individuellen Verhaltensmuster, mit denen Minderwertigkeitsgefühle kompensiert werden, gelegentlich den Ausdruck „Lebensschablone“, meistens jedoch den Begriff „Leitlinie“. Leitlinien können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Je grösser die Minderwertigkeitsgefühle sind, desto tyrannischer ist die Leitlinie und desto mehr wird sie auch vom Individuum als innerer Zwang erlebt. Dieses Zwanghafte der Leitlinien kommt in den Formulierungen durch das „Ich muss ...“ zum Ausdruck. Beispiele: "Ich muss stets der Erste sein, wenn ich angenommen sein will." "Ich muss durch Clownerie, durch Witz, durch Charme usf. im Zentrum stehen." "Ich muss mich selbst aufgeben und mich ganz für andere aufopfern." "Ich darf nicht auffallen und muss mir meinen Platz durch zurückhaltendes Wesen und durch Schweigen sichern." "Ich muss stets dagegen sein." "Ich muss mich stets anpassen und unterziehen." "Ich muss immer angreifen und darf mich nie in die Defensive drängen lassen." "Ich muss Besitztümer anhäufen und vorzeigen können." "Ich muss mich stets klein machen und meine Schwächen hervorstreichen." "Ich darf mir niemals eine Blösse geben." "Ich muss leiden." "Ich muss mich pflegen lassen." "Ich muss mich in jeder Situation in der Gewalt haben." "Ich muss immer die Verantwortung tragen." "Ich muss stören." Adler hält dieses Streben nach Anerkennung, Geltung, Überlegenheit und Macht als Kompensation des allgegenwärtigen Minderwertigkeitsgefühls zwar auf der einen Seite für eine verfehlte Antwort auf die objektiv gegebene Minderwertigkeit, auf der andern Seite aber für den Motor für die allermeisten menschlichen Verhaltensweisen. (Ein christlicher Theologe könnte versucht sein, in diesem Adlerschen Gedankengang eine psychologische Entsprechung zur traditionellen Vorstellung des Christentums von der Gefallenheit des Menschen zu erkennen.) Die Aufgabe des Menschen (und damit auch der Erziehung sowie der psychotherapeutischen Arbeit) ist es nun, das vertikale Streben bewusst abzubauen zugunsten der Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls (horizontales Streben). Nicht die Existenz des Minderwertigkeitsgefühls ist entscheidend, sondern unsere Haltung und die Haltung der wichtigen Bezugspersonen dazu, sind fundamental. Wer die eigene Minderwertigkeit anerkennt, kann um Hilfe bitte und gemeinsam mit seinem Umfeld wachsen. Wer sie nicht akzeptiert, kann einen Minderwertigkeitskomplex entwickeln. Menschen mit einem Minderwertigkeitskomplex überspielen ihre Minderwertigkeit. Die ganze seelische Energie wird dadurch absorbiert, sie haben kein Vertrauen in andere Menschen, gehen keine Risiken ein, da sie übergroße Angst vor dem Versagen haben. Bei der Überkompensation – ebenfalls eine ungünstige Art mit der eigenen Minderwertigkeit umzugehen – entsteht ein Überlegenheitskomplex. Adler war überzeugt davon, dass jeder Mensch ein Machtstreben aufweist, mittels dessen er sein Potenzial zu maximieren sucht. Es gilt drei verwandte Begriffe auseinanderzuhalten: objektive Minderwertigkeit Minderwertigkeitsgefühl Minderwertigkeitskomplex Mit objektiver Minderwertigkeit meint die Individualpsychologie den Tatbestand, dass entweder ein Mensch durch geschädigte Organe behindert ist ( =Organminderwertigkeit), oder dann ganz einfach die Tatsache, dass der Säugling hinsichtlich seinen spezifisch menschlichen Möglichkeiten dem weiterentwickelten Kinde oder dem Erwachsenen unterlegen ist. Das Minderwertigkeitsgefühl ist das subjektive Erleben dieses objektiv gegebenen Sachverhalts. Der Grad seiner Ausprägung ist indessen nicht nur von der objektiven Minderwertigkeit abhängig, sondern insbesondere von der Art und Weise, wie ein Mensch als Kleinkind von seinen Bezugspersonen akzeptiert und ermutigt wurde und wie er von seinen Mitmenschen angenommen wird. Das Minderwertigkeitsgefühl darf also, obwohl bei jedem Menschen vorhanden, nicht als eine fixe Größe betrachtet werden. Von einem Minderwertigkeitskomplex spricht Adler dann, wenn ein Individuum seine Minderwertigkeit zur Schau stellt, sie ausspielt, um damit Anerkennung, Überlegenheit, Geltung und/oder Macht zu erlangen. So kann z.B. jemand seinen Mitmenschen dauernd besondere Rücksichtnahme und Zuwendung abnötigen durch mimosenhafte Verletzlichkeit oder dadurch, dass er ständig wiederholt, es wäre ihm wohl bewusst, dass man ihn nicht achte, dass er zu nichts tauge, dass er weniger wert sei als die andern usf. Oder jemand kann sich durch ein zur Schau gestelltes schlechtes Gedächtnis oder durch allerhand Angstzustände seine Mitmenschen „hörig und untertan“ machen. Der Minderwertigkeitskomplex ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass ein Mensch an einer Neurose leidet. Die Neurose Adlers Hauptwerk heißt „Über den nervösen Charakter“. Er beschreibt darin die Existenzweise des Neurotikers. Dieser bewegt sich – insoweit er neurotisch ist – auf der „unnützlichen Seite“ des Lebens, sein vertikales Streben ist stark ausgeprägt, und seine Sicherungstendenz ist hochgradig übersteigert. Dadurch wird der neurotische Mensch ein Sklave seiner eigenen Zwänge, er ist unfrei und verschließt sich den Menschen und dem Reichtum der Welt. Der Neurotiker ist nur in eingeschränktem Maße beziehungs- und liebesfähig. Er befragt unbewusst jede Situation unter dem Gesichtspunkt: "Was trägt sie mir ein?", statt: "Was kann ich beitragen?" Selbst wenn er vordergründig etwas Nützliches beiträgt, geht es ihm zutiefst nicht um die Sache, sondern um seine Geltung und Selbsterhöhung. In der Psychotherapie geht es darum, dass der neurotische Mensch vorerst Einsicht gewinnt in seine verhängnisvolle Leitlinie. Das allein bewirkt aber noch keine Heilung. Wesentlich ist, dass der psychisch leidende Mensch seinen Therapeuten als wohlwollenden, annehmenden Menschen erfährt und dass er im Rahmen dieser zwischenmenschlichen Beziehung allmählich lernt, neue Verhaltensmuster aufzubauen. Das Verhältnis zwischen vertikalem und horizontalem Streben Im Hinblick auf die Tatsache, dass jedes Kind – gleichgültig, in welchen sozialen Verhältnissen es lebt – seine objektive Minderwertigkeit gefühlsmäßig erlebt und dadurch Minderwertigkeitsgefühle ausbildet, ist nicht anzunehmen, dass es Menschen gibt, deren Verhalten keinerlei kompensatorischen Charakter hat. Jeder Mensch hat also in seinem Seelenleben neurotische Züge. Trotzdem ist der Anteil an Kompensation im Verhalten der einzelnen Menschen sehr unterschiedlich: Während bei den einen das Gemeinschaftsgefühl stark ausgebildet ist, dominiert bei andern das Überlegenheits- und Machtstreben. Theoretisch kann man davon ausgehen, dass sich das Machtstreben umgekehrt proportional (komplementär) zum Gemeinschaftsgefühl verhält: Je mehr vom einen, desto weniger vom andern. In der folgenden Auflistung finden sich komplementäre Haltungen und Verhaltensmöglichkeiten, die der vertikalen bzw. horizontalen Linie entsprechen. Sie können auch als ein Ausdruck dessen verstanden werden, was die neuere Philosophie als „Haben“ oder als „,Sein“ zu charakterisieren pflegt (Adler selbst verwendet diese Begriffe nicht): Vertikale Linie: Horizontale Linie: Machtstreben Liebesmöglichkeit Minderwertigkeitsgefühl Selbstwertgefühl Geltungsstreben Sachbezogenheit Sicherungstendenz, Absicherung Risikobereitschaft Angst Sicherheit Selbst-Ablehnung Selbst-Annahme Eigenliebe, Selbsthass Selbstliebe Verschlossenheit Offenheit Maske, Rolle Echtheit Misstrauen Vertrauen Zwanghaftigkeit Freiheit Heteronomie (wichtig ist, was Autonomie (Eigenständigkeit) man tut) Entspricht der Modalität ,Haben’ Entspricht der Modalität ,Sein’ Regeln: 1. Die Haltungen und Verhaltensmöglichkeiten in derselben Kolonne verhalten sich zueinander proportional. Beispiele: Je grösser das Geltungsstreben, desto grösser das Bedürfnis, eine Maske zu zeigen und eine unwahre Rolle zu spielen. / Je mehr ein Mensch sich selbst wirklich annimmt, desto echter kann er sein. 2. Die Haltungen und Verhaltensmöglichkeiten der linken Kolonne verhalten sich zu denjenigen in der rechten Kolonne umgekehrt proportional (komplementär). Beispiele: Je eigenständiger ein Mensch ist, desto weniger ist er von den Meinungen anderer Leute abhängig. / Je mehr ein Mensch auf Ansehen und Geltung ausgeht, desto weniger kann er eine Aufgabe sachlich lösen. 3. Demgemäß können die einzelnen Haltungen und Verhaltensmöglichkeiten zueinander beliebig proportional oder komplementär in Beziehung gesetzt werden. Beispiele: Je grösser die Angst bei einem Menschen ist, desto kleiner ist seine Liebesmöglichkeit. / Je mehr ein Mensch seine persönliche Macht sucht, desto weniger kann er echte Risiken eingehen. 4. Beide Seiten gehören zum Menschen. Die Vorstellung, es ließe sich ein Menschsein ohne das Schattenhafte verwirklichen, ist irreal. 5. Psychische Gesundheit ist demgemäß etwas Relatives: Je selbstverständlicher einem Menschen die Seins-Modalität zur Verfügung steht, desto gesunder ist er. Krank (neurotisch) sind Menschen, die in hohem Masse an die Haben-Modalität fixiert sind und wenig Spielraum in Richtung auf die Seins-Modalität mehr haben. 6. Wie groß jeweils die Anteile der beiden Seiten sind, hängt von a. der generellen psychischen Gesundheit des Individuums und b. der jeweiligen Situation ab. Die Lebensaufgabe Aufgrund all des Dargelegten wird deutlich, dass es die Aufgabe des Menschen ist, in sich das Gemeinschaftsgefühl und all jene Haltungen und Verhaltensmöglichkeiten auszubilden, die oben unter der „Modalität Sein“ zusammengefasst wurden. Dabei muss ihm bewusst bleiben, dass auch das Schattenhafte (vertikales Streben, Kompensation, Haben-Modalität) ein Teil seines Wesens ist. Sich selbst akzeptieren bedeutet somit, auch diese belastenden Seiten der Persönlichkeit anzunehmen, ohne die ständige Arbeit daran aus dem Auge zu verlieren. Diese Haltung lässt sich als „Gelassenheit“ bezeichnen, was heißt, beharrlich nach der Seins-Modalität zu streben, das Schattenhafte in wahrer Selbsterkenntnis zu entdecken und sich darüber nicht (zu sehr) zu ärgern. Diese Arbeit an sich selbst ist untrennbar verbunden mit den sozialen Lebensaufgaben. Adler vertritt die Ansicht, dass jeder Mensch drei grundlegende Lebensaufgaben zu lösen habe, die alle sozialer Natur sind: das Sich-Bewähren in der Gemeinschaft/Gesellschaft (allgemeine Beziehungsfähigkeit, Fähigkeit des geselligen Umgangs, öffentliche Aufgaben) das Sich-Bewähren in der Ehe (auf Wahl beruhende Partnerbeziehung, erotische Liebe, Sexualität) das Sich-Bewähren im Beruf (durch die Arbeit leistet der Einzelne seinen Beitrag an die gemeinschaftliche Bedürfnisbefriedigung und hilft so mit, die objektiv gegebene Schwäche des menschlichen Individuums durch einen sachlichen, gemeinschaftlichen Beitrag auszugleichen) Carl Gustav Jung C.G. Jung war ein Einzelkind. Als er noch sehr klein war, musste seine Mutter für mehrere Monate ins Spital. Diese Trennung hinterließ bei ihm tiefe Spuren. In der Schule „drückte“ er sich durch das Vortäuschen von Ohnmachtsanfällen vor dem Lernen bis er eines Tages seinen Vater belauschte, als dieser seine Sorgen über ihn ausdrückte, dass er es im Leben zu nichts bringen würde. Danach lernte er, wurde Psychiater und heiratete. Seine Frau wurde ebenfalls jungianische Therapeutin. Neben seiner Frau hatte Jung eine außereheliche Beziehung. 1906 traf er auf Freud, der ihn als seinen Nachfolger sah. Jung konnte aber mit Freuds Konzept des Ödipuskomplexes und dem Konzept der psychosexuellen Entwicklung nicht konform gehen. Die beiden überwarfen sich. Jung war tief verletzt von diesem Streit und zog sich zur Selbstanalyse zurück. Er entwickelte dabei viele Techniken zur Behandlung wie z. B. die Methode der aktiven Imagination, bei der Träume wach weiterentwickelt werden konnten. Nach der Aussöhnung mit Freud widmete er sich der Erforschung der Wirkung der Kultur auf das Seelenleben. Herausragend an Jung´s Persönlichkeitstheorie ist die Breite der Betrachtung. Jung setzt Persönlichkeit mit Psyche gleich. Die Libido ist für ihn die Lebensenergie, die viel umfassender ist als rein sexuelle oder aggressive Triebe. Es gibt eine unendliche Anzahl an möglichen Konflikten zwischen den unterschiedlichen Strebungen der Struktur. Aus diesen Konflikten erwachse die Lebensenergie. Dies nennt Jung das Prinzip der Gegensätze. Das Bewusste und das Unbewusste befinden sich in ständigen Widerstreit, wodurch Energie entsteht. Liebe und Hass koexistieren in der Psyche einer Person. Nach Jung ist jedes lebendige Sein, so auch psychisches Sein, nur als Bewegung verstehbar. Diese Bewegung ereignet sich aber nicht eingleisig-linear, von einem Ausgangspunkt in ein unendlich Fernes, sondern stets im Spannungsfeld zweier Pole. Leben kann nach ihm nur verstanden werden als energetischer Prozess. „Energie aber beruht notwendigerweise auf einem vorausgehenden Gegensatz, ohne welche es gar keine Energie geben kann. Immer muss Hoch und Tief, Heiss und Kalt usw. vorhanden sein, damit der Ausgleichsprozess, welcher eben Energie ist, stattfinden kann." Deshalb seine Überzeugung: „Nur am Gegensatz entzündet sich das Leben." (D S. 58) Das Aufeinander bezogen sein zweier gegensätzlicher Prinzipien gilt ihm als Bedingung der Möglichkeit des Lebens überhaupt. Polarität liegt daher jedem System, das auf Selbstregulierung angewiesen ist (der Natur, dem Menschen, der Psyche, der Gesellschaft, der Kultur usf.), zu Grunde. „Es gibt kein Gleichgewicht und kein System mit Selbstregulierung, ohne Gegensatz. Die Psyche aber ist ein System mit Selbstregulierung." Polarität ist indessen eine rein formale Bedingung dynamischen Seins, die beliebig viele inhaltliche Füllungen gestattet und keinesfalls die Beschränkung auf ein grundlegendes Gegensatzpaar erfordert, worauf alle andern zurückzuführen wären. Es ist bezeichnend für Jung, dass er dieser naheliegenden Versuchung nicht erlegen ist. Wir treffen bei ihm die Gegensatzpaare in reicher Fülle: männlich – weiblich, bewusst – unbewusst, Individualexistenz – Sozialexistenz, Psyche – Materie, Idealismus – Materialismus bzw. Nominalismus – Realismus, innen – außen, Gestaltung – Zerstörung, Eros – Macht usf. Dadurch unterscheidet er sich prinzipiell von Freud und Adler, die beide die Dynamik des Lebens auf ein duales Prinzip reduzieren: Lusttrieb – Todestrieb, Minderwertigkeit – Geltung/Macht. Herausragend war weiter, dass Jung von einer lebenslangen Entwicklung der Persönlichkeit ausging. Das Verhalten eines Menschen ergibt sich nicht nur aus vergangenen Erfahrungen sondern auch aus seinen Zielen für die Zukunft (=> teleologische Sicht). Das große, übergeordnete Ziel ist das der Selbstverwirklichung. Der Mensch möchte sein Potenzial verwirklichen und lernen, sich selbst zu akzeptieren. Dabei werden abgespaltene Persönlichkeitsanteile, in das Selbst integriert. Mit dem Gefühl der Akzeptanz von sich selbst und dem Wissen, seinen Frieden mit sich gemacht zu haben, ist die Entwicklung abgeschlossen. Die psychische Energie kann sich innerhalb der Psyche in alle Richtungen bewegen und teilweise bizarre Formen annehmen (z. B. Halluzinationen). Prinzip der Äquivalenz: Die erhöhte Aktivität in einem Bereich, bewirkt die verminderte Aktivität in einem anderen (z. B.: Wenn sie sich auf Karriere konzentrieren, vernachlässigen sie eventuell die Familie). Im Prinzip der Entropie behauptet Jung, dass es eine Tendenz in der Psyche gäbe, die ungünstige Verteilungen der Energie in der Psyche auszugleichen versucht (z. B.: Wer sich nur mit oberflächlichen Dingen beschäftigt, bekommt irgendwann Lust auf Tätigkeiten mit Tiefgang). Jung war überzeugt davon, dass unsere Psyche/Persönlichkeit sich im Gleichgewicht entwickeln will. Einseitigkeit sei ungesund. Auch Jung entwickelte ein Strukturmodell: Das ICH: Ist die vereinigte Kraft in der Psyche, im Zentrum des Bewusstseins (später auch „Selbst“ genannt). Es enthält alle bewussten Gedanken und Gefühle in Bezug auf unser Verhalten, unsere eigenen Gefühle sowie Erinnerungen an unserer früheren Erfahrungen. Es vermittelt uns das Gefühl von Identität (über die Zeit) und Fortbestand. Wir wissen, dass wir als Kind anders sind als Erwachsene und wir werden anders sein als Greise. Damit ist Jung ein Vordenker gewesen. Heute werden Identitätskonzepte auch in Hinblick auf ihre Veränderbarkeit diskutiert. Das PERSÖNLICH UNBEWUSSTE: Das persönlich Unbewusste existiert neben dem Ich und besteht aus allen persönlichen Erfahrungen, die aus dem Bewusstsein hinausgedrängt wurden, da sie auf irgendeine Weise inakzeptabel sind. Dieses Konzept des Unbewussten als Hort verdrängter Geistesinhalte, die durch Psychoanalyse oder Hypnose ins Bewusstsein gerufen werden können, entspricht auch dem Begriff des „Unbewussten“ von Freud. Das KOLLEKTIVE UNBEWUSSTE: Das kollektive Unbewusste befindet sich tiefer in unserer Psyche verborgen. Jung beobachtete, dass sich Wahnvorstellungen, Träume, Halluzinationen von schizophrenen Klienten ähneln. Außerdem gab es Ähnlichkeiten zu Mythen und Geschichten aller Kulturen in allen Zeiten. Sie beinhalten alle menschlichen Lebensthemen (Furcht, Gut gegen Böse, ...). Jung nimmt an, dass dieses kollektive Unbewusste seinen Ursprung in der menschlichen Entwicklungsgeschichte hat, es ist angeboren, es ist der Hort der Instinkte und dessen, was er als Archetypen oder auch universelle Symbole jenseits der persönlichen Erfahrung bezeichnete. Das kollektive Unbewusste ist das Erbe unserer menschlichen und tierischen Vorfahren, wir haben es – trotz aller individuellen Unterschiede - gemeinsam. Archetypen sind die Ideen, die im kollektiven Unbewussten ihre Wurzeln haben und die uns Menschen dazu bringt, die Umwelt in einer bestimmten Weise zu gestalten, und das, unabhängig von dem Ort, wo, und der Kultur, in der wir leben. Die ARCHETPYEN: Archetypen sind universelle Urbilder oder Symbole, die sich innerhalb des kollektiven Unbewussten in der Psyche befinden und unter bestimmten Bedingungen auf unsere bewusste Erfahrung projiziert werden können. Z. B. Archetyp „Gott“: In jeder Kultur wenden sich Menschen an eine allmächtige höhere Gottheit, wenn sie in starker Bedrängnis sind. „Der Gottesbegriff ist eine schlechthin notwendige psychologische Funktion irrationaler Natur, die mit der Frage nach der Existenz Gottes überhaupt nichts zu tun hat. Denn diese letzte Frage kann der menschliche Intellekt niemals beantworten, noch weniger kann es irgendeinen Gottesbeweis geben. Überdies ist ein solcher auch gänzlich überflüssig, den die Idee eines übermächtigen göttlichen Wesens ist überall vorhanden, wenn nicht bewusst, so doch unbewusst, denn sie ist ein Archetypus!“ (C.G. Jung, 1926, s. S. 226) Archetypen wirken nicht nur in Träumen und Phantasien, sondern auch im wirklichen Leben. Die Archetypen wirken z. B. in dem wir in unserem Partner die Anima, bzw. den Animus suchen. Wir denken über Situationen in vorbestimmter Weise und gehen mit den Fakten in einer bestimmten Weise um. Das Selbst ist nach Jung der Zustand der Selbstverwirklichung und erst in einem späteren Lebensalter erreichbar. Z. B.: Ein junger Mann der seine Freundin idealisiert. Er erkennt, dass er dies tut und kann daraufhin seine Beziehung wirklicher gestalten. Er versteht sie besser und kann Konflikte besser bearbeiten. Seine Psyche ist ausgeglichener und die Individuation (Selbstverwirklichung) ist einen Schritt vorangegangen. Aus der Erkenntnis, dass Menschen ihre Selbstverwirklichung je nach Lebensgeschichte sehr unterschiedlich angehen, entwickelte Jung verschiedenen Persönlichkeitstypen. Jung tat etwas sehr spannendes, um seine Persönlichkeitstypen zu identifizieren. Er litt sehr unter dem Streit zwischen ihm und Freud und er hoffte auf Antworten in dem er den Konflikt zwischen Adler und Freud untersuchte. Er nahm einen Fall und analysierte ihn einmal nach der Theorie Freud´s, einmal nach der Theorie Adler´s. Nach beiden Systemen bekam er schlüssige Antworten. Die Neurose konnte also auf zwei gänzlich unterschiedliche, schlüssige, aber einander widersprechenden Arten verstanden werden. Also suchte Jung in den Persönlichkeiten der „Erfinder“. Freud und Adler nahmen die Welt sehr unterschiedlich wahr. Daraus schloss Jung, dass es zumindest zwei unterschiedliche Persönlichkeitstypen geben muss, den Extrovertierten und den Introvertierten. Der extrovertierte Typ orientiere sich mehr an der äußeren Welt (Freud) und der Introvertierte eher an der Inneren (Adler). Da Jung sich selbst für introvertiert hielt, sich aber seiner Meinung nach gänzlich von Adler unterschied, schloss er daraus, dass es noch eine weitere Differenzierung geben müsste. Extrovertierte sind weltoffen, kontaktfreudig, offenherzig und verträglich. Sie passen sich schnell an neue Gegebenheiten an uns knüpfen schnell neue Beziehungen. Introvertierte Menschen sind eher zögerlich, nachdenklich und scheu. Sie schrecken vor Hindernissen zurück und sind in der Betrachtung der Umwelt eher misstrauisch. Jeder Mensch vereine beide Aspekte in sich. Der dominante Typ sei im Bewusstsein, der unterlegene Typ dabei im Unterbewusstsein. Beide Persönlichkeitstypen sind gleichberechtigt. Um seine Typologie weiter voran zu treiben entwickelte er vier Funktionen, wie Menschen mit ihrer Umwelt umgehen: (1) Empfinden: Wir empfinden Reize ohne zu bewerten (Achtsamkeit!), (2) Denken: Wir interpretieren die Reizempfindungen mittels Vernunft und Logik um ein inhaltliches Verständnis zu entwickeln, (3) Fühlen: durch das Fühlen bewerten wir das Ergebnis des Denkens ob etwas wünschenswert ist oder nicht, (4) Intuition: mittels Intuition agieren wir mit der Welt. „Empfinden ist das Gefühl, dass etwa existiert, das Denken teilt mit, was es ist, das Fühlen weiß, ob es angenehm ist oder nicht und die Intuition vermittelt, woher es kommt und wohin es geht.“ Denken und Fühlen sind Gegensätze, es sind aber beides rationale Funktionen, die für das Schlussfolgern und die Urteilsbildung verantwortlich sind. Jung unterscheidet den fühlenden (zieht Werte, Einstellungen und Überzeugungen zur Urteilsbildung heran) und den denkenden Typ (zieht Logik und Analyse heran). Jung unterscheidet zusätzlich zwei weitere Typen, den empfindenden, der eher spontan auf Situationen reagiert und den intuitiven Typ, der vorangegangene Erfahrungen nützt. Aus den zwei Grundhaltungen – Introversion, Extroversion – sowie den vier Funktionen – Empfinden, Denken, Fühlen, Intuition – entwickelte Jung 16 Persönlichkeitstypen, wovon acht bedeutend sind: Die Ergebnisse wurden im Myers-Briggs-Type-Indicator umgesetzt, ein Persönlichkeitstest, der in berufsbezogenen Fragestellungen angewendet wird. Störungskonzept nach Jung: Jung sah psychische Störungen als Ungleichgewicht bzw. als Ergebnis einer einseitigen Entwicklung der Psyche. Seine Behandlungsmethoden umfassen Traumanalyse und Wortassoziationen, mit denen er das Unbewusste der Klienten erkundete. Bei seiner Traumanalyse unterschied er sich von Freud dahingehend, dass er im Traum sowohl unbewusste, als auch kollektiv unbewusste Inhalte deutete. Träume wären auch der Versuch Probleme zu lösen und eine psychologisch gesunde Lösung zu finden. Träume wäre zudem auch kompensatorischer Natur. Jung analysierte viele Träume und unterschied sie in archetypische und alltägliche Träume. Besonders die archetypischen, immer wieder kehrenden, sehr intensiven Träume, die voller Symbolik sind, führen zu einem tiefen Verständnis der Ängste eines Klienten. Außerdem ließ Jung seine Klienten Bilder malen. Dies sah er als Weg zu unbewussten Gedanken und Gefühlen. Diese Bilder interpretierte er dann gemeinsam mit den Klienten. Somit gilt Jung auch als „Erfinder“ der Kunsttherapie. Jung unterschied vier Phase der Therapie: 1. Eingeständnis (der Klient gesteht sich ein, dass er ein Problem hat), 2. Darlegung (gemeinsam mit dem Therapeuten entwickelt er ein Verständnis seines Problems), 3. Aufklärung (der Therapeut erklärt ihm die Natur seines Problems und entwickelt Perspektiven), 4. Transformation (der Klient stellt ein Gleichgewicht zwischen den gegensätzlichen Kräften seiner Psyche her und kann Selbstverwirklichung erreichen). Kritik: Jungs Theorie ist sehr komplex und verwirrend. Viele Annahmen sind nicht ausgearbeitet und konnten daher auch kaum evaluiert werden. Jungs Konzept von Intro- und Extroversion wurde von Eysenck übernommen und ist heute so aktuell wie eh und je. Aktuelle psychodynamische Theorien zur Struktur/strukturbezogene Psychotherapie: Weiterentwicklung des Strukturmodells: Wichtige Aspekte der Ich-Psychologie wurden von Heinz Hartmann eingeführt. Dieser ergänzte das Strukturmodell der Psyche von Freud und führte den Terminus „Selbst“ als Instanz in die Psychoanalyse ein, welches er als einen Teil des Ichs auffasst. Damit konnten, als Ergänzung des Ichs, auch Aspekte des Selbsterlebens beschrieben werden. Die Selbst-Instanz ist bei Hartmann ein weiteres übergreifendes psychisches System neben dem Es und dem Über-Ich. Es kann im Vergleich zu den Objekten der Außenwelt ebenso mit libidinöser Energie besetzt werden. Dadurch ist es möglich, zwischen der Besetzung von Objekten der Außenwelt und der Besetzung der eigenen Person zu unterscheiden. Dieser theoretische Schritt hatte großen Einfluss auf die Objektbeziehungstheorie und die Selbstpsychologie von Heinz Kohut. Des Weiteren beschrieb Hartmann die gesunden Ich-Funktionen durch angeborene Potentiale des Ichs, die sich in einer „konfliktfreien Ich-Sphäre“ entwickeln können. Damit schuf Hartmann eine weitere wichtige Neuerung. Vor der Einführung der konfliktfreien Ich-Sphäre, konnte die Entwicklung der Persönlichkeit und die Entstehung einer Neurose lediglich aufgrund von Konflikten und Fixierungen erklärt werden, die auf der Triebtheorie beruhen und sich in den verschiedenen psychosexuellen Entwicklungsphasen manifestieren. Durch die Einführung einer spezifischeren Theorie der Entwicklung des Ichs, welche frei von jeglichen Konflikten vonstattengeht, konnte die Aufmerksamkeit der Psychoanalyse weg von der reinen Triebpsychologie hin zu einer Psychologie der Entwicklungsstörungen gelenkt werden. Hartmanns Theorien schufen die Voraussetzungen, die zur Entwicklung der Objektbeziehungstheorie und der Selbstpsychologie notwendig waren. Die These, dass angeborene Ich-F unktionen existieren, die schon im Säuglingsalter vorhanden sind, schuf die Voraussetzung für die Kleinkindbeobachtung von René A. Spitz oder Margaret Mahler. Nach Hartmann kann das Ich als System von Funktionen betrachtet werden. Das Ich existiert demnach, da es ja nur eine konstruierte Instanz ist, die der Vereinfachung der Erklärung der Psyche dient, nur wenn es funktioniert. Dabei ist die wichtigste Funktion, sich selbst zu organisieren, d. h. die Funktionen werden differenzierter und genauer durch die Erfahrungen im Laufe der Entwicklung. Folgende Ich-Funktionen gibt es nach Heinz Hartmann Kognitive Funktionen: Hierbei sind die wichtigsten die Wahrnehmung, das Denken, das Urteilen, das Beurteilen, das Erinnern, das Überprüfen der Realität und das Aufrechterhalten der Realitätswahrnehmung. Vermittelnde Funktionen: Hierbei vermittelt das Ich zwischen dem Es und dem Über-Ich sowie der äußeren Realität. Es passt also die Triebwünsche und Triebansprüche an die gesellschaftlichen Normen und Werte, Gebräuche und Rituale an. Auch die verinnerlichten Normen und Werte des Über-Ichs sind in dem Vermittlungsprozess einbegriffen. Angstentwicklung: Hierbei entwickelt das Ich eine Sensibilität für beängstigende Signale. Diese Signalangst entsteht, wenn Triebimpulse zu heftig werden, und negative Auswirkungen auf das Individuum haben können. Auch Über-Ich Impulse können eine solche Angst auslösen, wenn das Über-Ich zu streng entwickelt ist und von ihm strafende Impulse ausgehen. In solchen Fällen werden Schutzmechanismen aktiviert. Schutzfunktionen - Abwehrmechanismen: Diese Funktionen dienen der innerpsychischen Steuerung. Sie helfen unerträgliche Affekte, die mit Angst, Scham, Schuld oder Minderwertigkeitsgefühlen gekoppelt sind, zu vermeiden. Diese Schutzfunktionen sind bei allen Menschen vorzufinden, und dienen der Aufrechterhaltung des psychischen Funktionsniveaus. Entwicklung der Persönlichkeit: „Eine besondere Rolle in der psychoanalytischen Theoriebildung spielt die psychoanalytische Entwicklungstheorie. Die Psychoanalyse hat immer den Anspruch erhoben, sowohl eine psychogenetische Theorie der allgemeinen, seelischen, menschlichen Entwicklung wie auch der Psychopathologie zu liefern, ja man kann sagen, dass der theoretische Ansatz, normalpsychologische wie psychopathologische Phänomene in der frühen und frühesten Lebensgeschichte des Menschen zu verorten, von konstitutiver Bedeutung für die Psychoanalyse ist. Insofern sind Persönlichkeitstheorie oder Krankheitstheorie in der Psychoanalyse immer auch Entwicklungstheorie. (aus Kutter, Müller: „Psychoanalyse. Eine Einführung in die Psychologie unbewusster Prozesse“, Klett-Cotta Stuttgart, 2008) Die Quellen für die Erforschung der Persönlichkeit entspringen der Analyse erwachsener Patienten und der dort stattfindenden Rekonstruktionen ihrer Kindheit, der direkten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, zunehmend auch der Säuglingsforschung. Ein ganz neuer Zweig ist die NeuroPsychoanalyse (Solms), die mit bildgebenden Verfahren, den psychoanalytischen Prozess sichtbar zu machen versucht. Einer der wichtigsten zeitgenössischen Namen bei der Erforschung der psychischen Struktur ist Otto Kernberg und die Forschergruppen rund um die Entwicklung der OPD, der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik: Markus Burgmer, Manfred Cierpka, Reiner W. Dahlbender, Stephan Doering, Matthias Franz, Harald J. Freyberger, Tilman Grande, Karsten Hake, Gereon Heuft, Sven Olaf Hoffmann, Thorsten Jakobsen, Paul L. Janssen, Marianne Junghan, Joachim Küchenhoff, Reinholde Kriebel, Elmar Mans, Claudia Oberbracht, Doris Pouget-Schors, Gerd Rudolf, Henning Schauenburg, Gudrun Schneider, Wolfgang Schneider, Gerhard Schüßler, Michael Stasch, Matthias von der Tann. Die OPD wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt und ist ein diagnostisches Manual, das speziell für Psychotherapeuten ein wichtiges Instrument darstellt, da sie auch Instrumente zur Psychotherapieplanung zur Verfügung stellt. Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) ist ein psychodynamisches Diagnosesystem, welches vorwiegend für psychoanalytisch und tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeuten konzipiert ist. Es handelt sich dabei um ein halbstrukturiertes Interview mit einem wissenschaftlich fundierten diagnostischen Rahmen im Hintergrund. Strukturbezogene Psychotherapie ist die modifizierte/aktuelle Form psychodynamischer (d.h. psychoanalytisch fundierter) Therapie. Als Struktur und strukturelle Funktionen gelten im psychodynamischen Sinn die Struktur des Selbst und ihre Beziehung zu den Objekten. Therapiegegenstand sind die zu bearbeitenden Dysfunktionen d.h. jene eingeschränkt verfügbaren strukturellen Funktionen, die dem Individuum nicht oder nur mangelhaft zur Verfügung stehen. Das ätiologische Verständnis struktureller Störungen bezieht sich auf die Grundlagen der empirischen Entwicklungspsychologie, Säuglings- und Kleinkindforschung. Freud hat mit der psychosexuellen Entwicklungstheorie des Säuglings und Kindes starke Irritationen in der Gesellschaft hervorgerufen. So neu und bis dahin undenkbar war sein Konzept. Seine Tochter, Anna Freud (1965), löste sich später von dieser Theorie und begann systematisch KindBezugspersonen-Interaktionen zu beobachten. Das Bindungsbedürfnis rückte mit Beginn der 70er Jahre in den Fokus der Wissenschaft und drängte die Triebbefriedigung zurück. Doch erst in den letzten 20 Jahren wurde die Bindungstheorie in allen Psychotherapieschule sowie der akademischen und klinischen Psychologie akzeptiert. Grossmann (2003) untersuchte das menschliche Bindungsverhalten und verwies auf das genetisch vorgegeben, evolutionsbedingte Bindungsbedürfnis des Menschen. Ein Säugling ist biologisch und psychisch abhängig von Bezugspersonen, die mehr oder weniger fähig sind, sensibel auf seine Bedürfnisse zu reagieren. Die Art und Weise, wie dieser frühe Prozess stattfindet, verankert sich im Gedächtnis und prägt das spätere Bindungsverhalten. Man unterscheidet in der Bindungstheorie sicher gebundene Kinder und unsicher gebundene, diese teilen sich weiter ein in unsicherambivalent, unsicher-vermeidend und unsicher-desorientiert. Warum geht es in der Bindungsforschung? Der Kern dieser Forschung kreist um den Aufbau der inneren Erfahrungsstruktur, welche beim Kind angelegt wird und in grundsätzlich erhaltener Form beim Erwachsenen die Beziehungsbereitschaften bedingt. Dazu gehören die Affektregulierung, die Mentalisierungsfähigkeit und die Ausgestaltung der Selbststruktur. Die Mentalisierungsfähigkeit wird zum Kern des sozialen Funktionierens, in dem Bindung nicht als Selbstzweck gesehen wird, sondern den Umgang miteinander mit dem Ziel des körperlichen und seelischen Überlebens strukturiert. „Wenn das Kind im Rahmen seiner Entwicklung die Fähigkeit zur Mentalisierung entfaltet, kann es nicht nur auf das Verhalten anderer Personen reagieren, sondern auch auf sein eigenes Bild anderer, d.h. auf deren Gefühle, Wissen, scheinbare und wirkliche Absichten, usw. Indem das Kind anderen Personen mentale Verfassungen zuschreibt, gibt es deren Verhalten Bedeutung und macht es vorhersagbar.“ (Fonagy und Target, 2002) (=> mehr zum Mentalisieren, später) Winnicott zeigte, dass beim elterlichen Affectmirroring die Gefühlsäußerungen des Säuglings durch die Mutter gespiegelt und vom Kind wieder aufgenommen werden. Diese gespiegelten Affekte werden zur Grundlage des emotionalen Selbstverständnisses (der Affektregulierung) des Säuglings. Es handelt sich um ein hochkomplexes Zusammenspiel zwischen äußerer und innerer Welt des kleinen Kindes. Die Reaktion im Außen bestimmt seine inneren Überzeugungen, aus denen heraus es wieder bestimmte äußere Erfahrungen macht, welche seine inneren Überzeugungen bestätigen. Freud glaubte noch, dass das erste Interesse des Babies triebgesteuert ist, es wollte die Mutterbrust. Heute weiß man, dass ein Baby erstens von Beginn an aktiv kommuniziert und zweitens sein erstes Interesse dem Gesicht der Mutter und den Möglichkeiten der Kommunikation über Mimik und Körper gilt. Dabei entsteht langsam ein System an körperlicher Nähe und wechselseitiger Bezogenheit, das die Grundlage positiver Emotionen schafft: Mit den anderen sein können und sich wohlfühlen dürfen. Kind und Mutter bilden miteinander ein Ganzes, ein Beziehungssystem, in welchem der eine (das Baby) körperlich und präverbal Äußerungen von Lust-Unlustqualität tut, während der Andere (die Mutter) diese Signale auf ihre bedürfnishaften und emotionalen Qualitäten hin entschlüsselt , sie in Sprache fasst und nach ihren Möglichkeiten handelnd darauf eingeht. Das Kind lernt durch permanente Widerspiegelung sich selbst und seine eigene körperliche und emotionale Verfassung kennen, die im Lauf der Entwicklung zu einem individuellen kohärenten Selbst heranwächst. Das frühe Beziehungssystem geht nahtlos in ein Bindungssystem über. Die wichtigsten Bezugspersonen hinterlassen deutliche Erinnerungsspuren, die sich zu inneren Repräsentanzen der Bezugspersonen verdichten. Es entsteht das Bild eines guten „Objekts“, d.h. einer guten und erfreulichen Person. Die ersten zwischenmenschlichen Emotionen werden angelegt und beginnen sich zu differenzieren. Gelingt dieses Affektmirroring nicht perfekt, löst dies im Säugling Suchprozesse aus. Der Säugling lernt, Situationen zu verändern. Gelingt das Affektmirroring nur schlecht bis gar nicht (= desorganisiert), dann steigt die Spannung im Säugling über das erträglich Maß und er kann die Situation nur mehr behelfsmäßig überstehen (z.B. durch emotionales Abschalten) Das emotionale Erleben des Kindes und das emotionale Handeln der Erwachsenen hängen in dieser Phase fast vollständig von einander ab. Im günstigen Fall bauen sich die Fähigkeiten der Selbstwirksamkeit und der Beziehungsregulierung sukzessive auf. Eltern, die selbst keine sichere Bindung erfahren haben, reagieren oft desorganisiert auf ihr Baby. Sie können es nicht beruhigen und das Baby verwehrt ihnen durch seine Reaktion (z.B. Schreien oder Weinen) die Bestätigung, dass sie gute Eltern sind. Die Beziehungsstörung eskaliert. In der strukturellen Psychotherapie wird die Entwicklung der kindlichen Psyche um vier zentrale Entwicklungsthemen herum organisiert – das sich entwickelnde Selbst wird nicht mehr unter triebpsychologischen Aspekten sondern unter dem Aspekt der Entwicklung, gesehen. Die vier Entwicklungsthemen sind: 0-4 Monate: Entwicklung des Systems der Nähe und Kommunikation Erfahrungen des Kindes mit seinen Objekten Die vom Kind geäußerten Emotionen werden von ausreichend feinfühligen Objekten adäquat beantwortet durch Füttern, Versorgen, Tragen, Ansprechen…. Das Kind lässt sich von anwesenden Objekten anregen und richtet seine emotionale Aufmerksamkeit auf sie Betreuungsperson regt Kind zu gemeinsamer Aufmerksamkeit an und schafft gemeinsame Erfahrung des In-Kontakt-Seins Es bildet sich zwischen den Interaktionspartnern eine frühe Form des Dialogs aus (Spiel) Beziehungsregulation des Kindes durch Kontaktaufnahme oder Abwenden Reifende strukturelle Fähigkeiten Basale Erfahrung des angemessenen Versorgtwerdens als Voraussetzung für die spätere Internalisierung guter Objekte. Basale Erfahrung der gelungene Emotionsregulierung durch die Objekte als Voraussetzung für spätere Selbstregulierung. Fähigkeit des Sich-Ausrichten-Können auf Andere (Intentionalität) Fähigkeit zur gemeinsamen Aufmerksamkeit, Fähigkeit des Naheseins Fähigkeit sich in einen Dialog einschwingen zu können und dialogisch reziprok zu handeln, Fähigkeit des präverbalen emotionalen Austauschs. Fähigkeit zur Nähe-Distanz-Regulierung 4 Monate – Ende 2. Lebensjahr: Entwicklung des Bindungssystems Erfahrungen des Kindes mit seinen Objekten Durch vermehrte Interaktionserfahrungen lernt das Kind zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden Einüben der emotionalen Beziehung zu den wichtigsten Objekten, intensivere Emotionsäußerungen werden an bestimmte Objekte gerichtet und durch sie mehr oder weniger befriedigend beantwortet Reifende strukturelle Fähigkeiten Fähigkeit zur Selbst-Objekt-Differenzierung Fähigkeit zur Internalisierung von Erfahrungen Aus Beziehungserfahrungen, versorgt, beruhigt, beachtet,… zu werden, entsteht die Fähigkeit zur Selbstberuhigung und Selbstfürsorge Das Kind lernt mehr und mehr seine Emotionsäußerungen auf die vom Objekt vorgegebenen Themen zu richten Versorgende und spielerische Interaktion mit dem wichtigen Objekt belebt die Erfahrung des eigenen Körpers Aus der Erfahrung gemeinsamer Regulierung von Unlustaffekten entsteht die Fähigkeit Situationen emotional zu bewerten und die Affekte eigenständig zu regulieren Aus der Erfahrung des emotionalen Gehalten- und Verstandenwerdens resultiert die Fähigkeit zur Introspektion und die Fähigkeit Körpervorgänge emotional zu verstehen. Basale Erfahrung des sich Ausdrückens und Sich –Mitteilen-Könnens , Fähigkeit sich emotional berühren zu lassen und in emotionalen/verbalen Austausch zu treten (Wir-Bildung) Beginnende Selbstreflexion von innerer Realität Fähigkeit, Körpererleben mit Emotionen zu verknüpfen, Lebendiges Körperselbst. 3.-4. Lebensjahr: Entwicklung des Autonomiesystems Erfahrungen des Kindes mit seinen Objekten Zunehmende Verinnerlichung der Beziehungserfahrungen macht unabhängiger von der realen Anwesenheit der Objekte. Das Selbst erprobt die Durchsetzung eigener Impulse gegen Widerstand der Objektwelt und erlebt dabei heftige Emotionen Bei der Regulierung eigener Handlungsimpulse und Bedürfnisse werden soziale Erwartungen und Einschränkungen berücksichtigt Regulierung der eigenen Impulswelt und Binnenwahrnehmung erfolgt mehr und mehr unter Zuhilfenahme von Abwehrvorgängen Vorhersehbarkeit von Ereignissen und sozialen Situationen wird besser Bewertung durch andere findet ihren Niederschlag in der Selbstbewertung Kind lernt die Perspektive anderer zu übernehmen Affektäußerungen der Objekte können immer besser entschlüsselt werden Reifende strukturelle Fähigkeiten Fähigkeit über ein abgegrenztes autonomes Selbst zu verfügen Fähigkeit zu gezieltem Einsatz von Affektäußerungen und zur Affektregulierung Fähigkeit zur Impulssteuerung unter Berücksichtigung sozialer Normen Fähigkeit zur Verwendung von flexiblen und leistungsfähigen Abwehrmustern Fähigkeit zur Antizipation Fähigkeit zur Selbstwertregulierung Fähigkeit zur Empathie Fähigkeit zum Verständnis fremder Affekte 4.-6. Lebensjahr: Entwicklung des Identitätssystems Erfahrungen des Kindes mit seinen Objekten Realitätsangemessene Selbst und Objektwahrnehmung und die Berücksichtigung der sozialen Realität werden möglich Begrenzungen und Widersprüche aber auch Kohärenz werden deutlich Reifende strukturelle Fähigkeiten Fähigkeit zu ganzheitlicher Objektwahrnehmung Fähigkeit ein realistisches Selbstbild und lebendiges Körperbild zu gewinnen Bedeutsame Themen wie Beruft, Tod Liebe und Sexualität werden kognitiv und emotional aufgegriffen. Zu unterschiedlichen Objekten werden unterschiedliche Beziehungen hergestellt Fähigkeit Begrenzungen zu erleben und das Sein oder Nicht-Sein des Selbst und der Objekte zu denken, erlaubt es, den psychischen Vorgang des Abschieds und Trauerns zu vollziehen Fähigkeit, sich zielgerichtet adaptiv zu verhalten, schließt die Fähigkeit, eigene Impulse zurück zu stellen, eigene Affekte zu modifizieren bis hin zu der Fähigkeit, sich zu verstellen, eine Rolle zu spielen. Fähigkeit zum Erleben von Identität Fähigkeit zur Orientierung in der Welt. Fähigkeit variable Bindungen aufzubauen Fähigkeit zur Loslösung von den Objekten Fähigkeit zur Rollenübernahme Die strukturellen Funktionen, um deren Entwicklung oder Fehlentwicklung es hier geht, haben grundsätzlich drei Ziele: 1. Sie differenzieren, indem sie die Ganzheit auf Unterschiedlichkeit hin kognitiv untersuchen (Affektdifferenzierung, Selbst-Objekt-Differenzierung, variable Bindungen, Loslösung) 2. Sie integrieren, in dem sie Teilaspekte zu jeweils neuen Gesamtgefügen verknüpfen, dadurch Kohärenz und Sinnstrukturen schafften (ganzheitliche Objektwahrnehmung, Gewinnung von Selbstbildung, Identität, Internalisierung von Beziehungserfahrungen) 3. Sie regulieren in dem sie ein Systemgleichgewicht herstellen oder wiederherstellen (z.B. Selbstwertregulierung, Impulssteuerung, Affekttoleranz) Die strukturelle Entwicklung betrifft daher stets zugleich das reifende Selbst und die sich differenzierenden Beziehungen. Psychopathologie aus strukturpsychologischer Sicht: z.B. Die Erfahrung sich ausdrücken zu können und sein wichtiges Objekt damit zu erreichen Menschen mit Depressionen haben dieses Gewissheit verloren (sie fühlen sich nicht selbstwirksam) Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben diese Gewissheit nie besessen! Strukturelle Störungen als Folge schwerwiegender defizitärer Erfahrungen drücken sich vor allem in Störungen des emotionalen Erlebens, des emotionalen Selbstverständnisses und des emotionalen Austausches als eine spezifische Form der Sprachlosigkeit aus. Menschen mit strukturellen Störungen können nur sehr schwer zwischen Ich und Nicht-Ich unterscheiden. Es ist eine Sehnsucht nach einer unverbrüchlichen Beziehung, einem NichtGetrenntsein da, die unrealistisch ist. Die pathogenen Bedingungen, welche zu strukturellen Störungen führen. Strukturelle Fehlentwicklungen resultieren aus der fehlenden Passung zwischen den Grundbedürfnissen eines Säuglings/Kindes und den Bezugspersonen. Dazu kommen jene genetisch verankerten Anlagen des Kindes, welche als Variationen des Temperaments, d.h. der motorischen, emotionalen, sensorischen und kognitiven Stile Risikofaktoren für eine durchschnittliche Entwicklung darstellen. Es ist allerdings schwer zu unterscheiden, welche Merkmale früh erworben oder genetisch determiniert sind. Bewiesen ist z.B., dass Rauchen während der Schwangerschaft bereits Einfluss auf das Spannungsniveau des Fötus hat. Die Frage nach intrauterinen Einflüssen ist aber bei weiten noch nicht geklärt. Gesichert gilt, dass – wenn die Mutter schon während der Schwangerschaft psychische Auffälligkeiten zeigt – die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie auch später diese Auffälligkeiten zeigt und damit weniger effektiv ist, wie eine psychisch stabile Mutter. Als Voraussetzung für die Regulation von kindlichen Bedürfnissen und Emotionen und den Aufbau der Selbstregulierung beim Kind gelten sind mittlerweile wissenschaftlich gut belegt: Fähigkeit, die Körpersprache des Kindes und seinen emotionalen Ausdruck zu verstehen Fähigkeit, sich dem Kind altersadäquat zuzuwenden Fähigkeit, für das Kind instinktiv unbewusst verfügbar zu sein Fähigkeit, das Kind innerlich dauerhaft und situativ vorauslaufend zu repräsentieren (Antizipation). Störungen können sein: Alle Arten von situativen und strukturellen Belastungen (psychische Erkrankung der Eltern, Sucht, Trauma, Scheidung, Tod…) Diese Belastungen führen beim Kind zu... o Vernachlässigung der körperlichen Versorgung o Emotionale Vernachlässigung, Alleine lassen o Schmerzhafter Behandlung, Misshandlung Symptomwertige Folgen beim Kind sind… o Emotionale Dauerspannung, Schreien o Motorische Überaktivität oder motorische Erstarrung o Starker Reizhunger, Schlafstörungen o Fütterungsstörungen Eine Störung durch diese Bedingungen reicht aber meistens nicht aus, um strukturelle Störungen bei Menschen zu erklären. Es müssen die familiären Entwicklungsbedingungen für das Kind in massiver Weiser eingeschränkt sein. Eltern müssen in Notlagen sein, es geht um Dauerkrisen. Unter dem Einfluss überflutender Belastungserfahrungen wird die Entwicklung der reifenden strukturellen Fähigkeiten beeinträchtigt. Risikofaktoren: Genetik: Anlage und „Werkzeugstörungen“ (Rudolf, 2005) d.s. motorische Impulsivität, sensorische Über/Unterempfindlichkeit, spezifische Wahrnehmungsstörungen, Leistungsschwächen= Belastungen, Traumatisierungen durch emotional überfordernde Ereignisse (sexuelle und aggressive Handlungen, Hospitation, Vernachlässigung,..) Defizitäre soziale Lernerfahrungen in destabilisierten und unstrukturierten Familien (Unfähigkeit Nähe herzustellen, Unfähigkeit Entscheidungen über Aktivität/Passivität, Mittteilungen/Verständigung oder Konfliktlösungen herzustellen.) Fehlende Befriedigung von basalen Bedürfnissen (Möglichkeiten zur Beruhigung, Tröstung, Zärtlichkeit, zur Erfahrung von Sicherheit.. ) Fehlende Befriedigung von körperlichen Bedürfnissen (gefüttert werden, gepflegt werden, in Ruhe gelassen werden,..) Der Begriff des Emotionalen und sein Bezug zur Struktur (Gerd Rudolf) Scherer (1993): „There are as many alternative definitions of emotion as there are theorists. Emotions are variously defined as changes in arousal, as innate neural programmes, as responses to discrepancy, as social construction, as cognitive schemata or prototypes, as action tendencies, as interrupt mechanisms, as epiphenomena, etc.” Emotionen sind Reaktionsmuster, die durch die Wahrnehmung spezifischer, für die Adaptation bedeutsamer Reize ausgelöst und subjektiv als Gefühl erlebt werden. In der Regel werden Gefühle von physiologischer Aktivierung, Ausdrucksbewegungen und Handlungsimpulsen begleitet. Stimmungen sind – im Gegensatz zum episodischen Charakter einer Emotion – weniger an spezifische Auslösemomente gebunden und dauern länger an. Emotionen und Stimmungen sind die beiden zentralen Spielarten des menschlichen Affektes. Emotionen können als ein zentrales Subsystem der Persönlichkeit verstanden werden. Interindividuelle Unterschiede in der Neigung zum Erleben positiver und negativer Emotionen und Stimmungen sind ein wesentlicher Bestandteil von Persönlichkeitsmerkmalen. Es zeigen sich außerdem stabile und konsistente, interindividuelle Unterschiede in der Art und Weise, wie Menschen Emotionen zum Ausdruck bringen und Emotionen regulieren. Emotionale Vorgänge im interpersonellen Austausch zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen sind von fundamentaler Bedeutung und für das Selbstverständnisses und der Beziehungsgestaltung für das Kind unverzichtbar. Emotionen sind nicht nur Kommunikationsmittel für den, der sie erlebt, sondern auch eine Herausforderung, er muss sich zu ihnen einstellen, mit ihnen umgehen, sie ausdrücken, sie erstragen und steuern lernen und er muss dabei die Verhaltensregeln einer Kultur mit einbeziehen. „Emotion“ kommt aus dem Lateinischen „emovere“ und bedeutet hinausbewegen. Affekte, Gefühle, Stimmungen sind Ausdrucksformen von Emotionalität. Emotionen sind ein Grundbaustein unseres psychischen Lebens und doch immens schwer wissenschaftlich zu erforschen. H Schmitz (2000) schreibt dazu (in Rudolf, 2005) „Gefühle sind räumliche, ortlos ergossene, leiblich ergreifende Atmosphären, vergleichbar dem Wetter und der reißenden Schwere, wenn man ausgeglitten ist und entweder schon stürzt oder sich gerade noch fängt: Also solchen, in den spürbaren Leib eingreifenden Mächten, die nicht selbst leibliche Regungen sind, ab nur am eigenen Leib, wenn auch manchmal als Widersacher gespürt werden. Ebenso werden Gefühle nur im eigenen leiblichen Spüren als ergreifende Mächte wirksam, aber allerdings kann man sie als Atmosphären darüber hinaus oft auch in er Umgebung wahrnehmen.“ Emotionen sind ein psycho-somatisches Geschehen. Das heutige Verständnis davon geht auf Descartes (1596 – 1650; „Ich denke, also bin ich“) zurück. Ein Jahr vor seinem Tod schrieb Descartes, „Man muss wissen, dass die Seele tatsächlich mit dem ganzen Körper verbunden ist und dass man genau genommen nicht sagen kann, sie sei in bestimmten Teilen des Körpers mit Ausschluss der anderen.“ Satre (1943) formulierte „Es gibt nichts hinter dem Leib, sondern der Leib ist ganz und gar seelisch…. Der Leib ist Für-sich-sein, ebenso wie Für-andere-sein“ Und damit sind schon die wichtigsten Qualitäten von Emotionen angesprochen: Emotionen sind ein nach innen und außen gleichermaßen bedeutsames körperliches und psychische Phänomen. Emotionen sind Prozesse, die aus verschiedenen Komponenten bestehen, einer kognitiven, einer (neuro-)physiologischen, einer motivationalen, einer Gefühls- und einer Verhaltens- bzw. Ausdruckskomponente Die physiologische Seite: Aktivierung zentralnervöser Zentren Vegetative Körperreaktionen Motorische Muster der Skelettmuskulatur (Körperhaltung) Innervation der mimischen Muskulatur in typischen Mustern Neben der physiologischen Seite spielt die mimisch/gestische Seite eine bedeutsame Rolle in der Beziehungsgestaltung und somit in der Kommunikation. Emotionaler Ausdruck wird seit Darwin als Anpassungsvorteil bei der natürlichen Selektion gesehen. Dieser Ausdruck ist universell, über alle Kulturen gleich und ist ein zentraler Bestandteil von Emotionen: Ohne Ausdruck keine Emotion. Ekman (1993) untersuchten in den 70er Jahren mimische „action units“, das sind kulturübergreifende mimische Mikroausdrücke, die sich zu bestimmten Mustern formieren, an denen primäre Affekte erkannt werden können. Diese sind Glück, Überraschung, Trauer, Wut, Ekel, Angst (Allerdings schränkte Ekman später ein, dass wir bewusst, den Ausdruck unterdrücken können bzw. den Ausdruck auch vortäuschen können, ohne die Emotionen zu spüren). Der spontane mimische und körperliche Ausdruck Erfolgt überwiegend nicht bewusst Bringt den eigenen emotionalen Zustand zum Ausdruck Ist nicht immer identisch mit dem bewusst erlebten Gefühl Hat eine Signal- Appellfunktion für das Gegenüber Schafft die Basis für eine gelingende sprachlich-symbolische Verständigung Kann durch soziale Signale (z.B. lächeln) überblendet werden Kann zu Teilen unterdrückt werden (Pokerface) Die psychologische Seite umfasst Die Fähigkeit sich in die Gefühle eines anderen hinein versetzen zu können (Mentalisierung) und sie auch zu verstehen (Empathie) Sie umfasst die Fähigkeit zu einem Gespräch, zur inhaltlichen Ausrichtung auf ein Thema Sie ermöglicht es, Situationen zu verstehen (z.B. eine bedrohliche Situation zu erkennen und angepasst – in Übereinstimmung mit den Erfahrungen und den Gefühlen - zu reagieren.) Emotionen und Denken bilden eine Einheit. Das Denken erhält eine Zielrichtung und einen Kontext, der die Komplexität reduzieren kann. (Bei strukturellen Störungen, bei denen die Beziehungsgestaltung gestört ist, bewirken umgekehrt überflutende Emotionen eine Störung des Denkens) Man kann über das Denken auch Einfluss auf die Emotionen nehmen (=> Affektregulierung) Geht man nun zur strukturellen Entwicklung des Menschen zurück, so werden von den Entwicklungsstufen abhängigen Bedürfnissen unterschiedliche Emotionen aktiviert. 1. Grundbedürfnis der Beziehung und Kommunikation Kontaktaustausch und Wechselseitigkeit) Befriedigung: spielerische Lebendigkeit Entbehrung: Leere, Erstarrung (Basales Bedürfnis nach 2. Grundbedürfnis der Bindung (Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit, Versorgt werden durch verfügbare Andere) Befriedigung: Körperliches Behagen, Sicherheit, Zufriedenheit Entbehrung: Erregung, Verzweiflung, Schmerz, Ekel 3. Grundbedürfnis der Autonomie (Bedürfnis nach Selbstbestimmtem Handeln, Durchsetzung eigener Interessen) Befriedigung: Überraschung, Stolz, Selbstbewusstsein im Tun, Triumph Entbehrung: Wut, Ärger, Scham 4. Grundbedürfnis der Identität (Bedürfnis nach psychosexueller und sozialer Eindeutigkeit) Befriedigung: Erfüllung, Stolz, Selbstbewusstsein im Sein Entbehrung: Scham, Schuld, Angst Die Versagung von frühen Bedürfnissen führt zu mehr körpernahmen Emotionen (und zu strukturellen Störungen). Die Versagung biographisch späterer Bedürfnisse mehr zu psychologischen Emotionen (und zu konflikthaften Störungen). Emotionales Erleben als Prozess – Die Affektkaskade Affektzustände wirken nach innen und nach außen, sie sind miteinander verwoben. Dabei hat die emotionale Erregung zur Beseitigung ihres verursachenden Anlasses bei und klingt nach einer Zeit wieder ab. In diesem Prozessgeschehen lassen sich folgende Stufen unterscheiden: 1. Affektgenerierung: Der Affekt wird erlebt 2. Affekttoleranz: Der erlebte Affekt muss ertragen werden. Er wird gleichzeitig äußerlich sichtbar. Dieses Sichtbarwerden verläuft spontan durch mimisch-gestisch-körperliche Zeichen. Die Person, die den Affekt zeigt, muss sich dessen nicht unbedingt bewusst sein. Der Ausdruck hat Appellcharakter und kann bei Erfolglosigkeit des Appells eskalieren und zu einer Handlung(sbereitschaft) führen, wenn nicht Mechanismen der Affektregulierung einsetzen. 3. Affektdifferenzierung: Der erlebte Affekt wird differenziert wahrgenommen. Die zunächst an ein Objekt gerichtete nonverbale Kommunikation wird verbalisiert. 4. Affektives Selbstverständnis: Die erlebten Affekte werden zum psychischen und körperlichen Selbstverständnis herangezogen. Die Körpersignale werden dechiffriert und in Sprache verpackt (gelingt dies nicht, werden Körperaffekt mit Körpersymptomen verwechselt, das passiert vor allem bei somatoformen Störungen) 5. Affektives Situationsverständnis: Es wird versucht über die Affekte die Situation zu analysieren und zu verstehen. Welche Situation ist hier entstanden, wie verhalten sich die Objekte zu mir, welche Rolle spiele ich in dieser Situation? Das selbstreflexive Verständnis ist sehr subjektiv gefärbt. Bei neurotischen Störungen werden pathogene Überzeugungen wirksam ( z.B. keiner liebt mich!) , bei strukturellen Störungen herrscht generell Verwirrung vor, so dass der eigene Anteil gar nicht gesehen werden kann, der Anteil der anderen oft als bedrohlich erlebt wird. 6. Affektregulierung: Die Affektregulierung beinhaltet zwei wichtige Aspekte der Selbstreflexion: a) was vermag ich? (Welche Kompetenzen, welchen Selbstwert habe ich?) und b) Was brauche ich? (Was sind meine Bedürfnisse?) Werde ich bedroht, dann kann ich mich unterlegen fühlen (Selbstwert) und mein Bedürfnis ist das nach Schutz. Diese Selbstbewertung aus der Situation heraus wird von vergangenen Erfahrungen (auch den unbewussten) geprägt. Die Fähigkeit zur Regulation von Emotionen rückt immer mehr in den Forschungsmittelpunkt und bezieht sich auf alle kognitiven, expressiven und verhaltensbezogenen Vorgänge, die das Erleben und den Ausdruck einer Emotion beeinflussen. Es wird angenommen, dass Emotionsregulation sowohl bewusst als auch automatisiert, d. h. ohne bewusstes Eingreifen erfolgt. Formen der Emotionsregulation können nach unterschiedlichen Dimensionen differenziert werden, z. B. ob sie kognitiv oder verhaltensbezogen sind. Gross schlägt vor, Formen der Regulation dahingehend zu unterscheiden an welchen Phasen des Prozesses ihrer Entstehung und des Verlaufs sie zuzuordnen sind. Sie unterscheiden grob zwischen Formen der Emotionsregulation, die im Vorfeld der Emotionsentstehung wirksam werden (antecedent-focused) und solchen, die auf die Emotion einwirken, wenn sie erst mal entstanden ist (response-focused). Daraus ergeben sich im Vorfeld der Emotionsentstehung vier Möglichkeiten der Emotionsregulation (antecedent-focused): a. Selektion: Eine Situation, die eine bestimmte nicht erwünschte Emotion auslösen könnte, wird von vornherein vermieden (z. B. keine Referate halten vor vielen Zuhörern) b. Modifikation: Wenn eine Situation dennoch aufgesucht wird, kann sie so gestaltet werden, dass die Emotionen verändert werden (z. B. gemeinsam mit jemanden anderen das Referat halten) c. Aufmerksamkeitslenkung: Die Aufmerksamkeit in der Situation wird auf solche Aspekte gelenkt, die weniger angstauslösend sind (z. B. man konzentriert sich im Hörsaal auf liebe Mitstudenten) d. Kognitive Veränderung: Die Wahrnehmung und Interpretation der Situation wird so verändert, dass keine oder weniger intensive Emotionen ausgelöst werden (z. B. man stellt sich die Zuhörer nackt vor) Ist eine Emotion erst einmal entstanden, können Prozesse der „Reaktionsmodulation“ einsetzen. Sie beinhalten Bemühungen, subjektiv erlebte Gefühle, physiologische Erregung und Handlungsimpulse zu beeinflussen z. B. durch Unterdrückung oder durch eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das emotionale Ereignis. Die Regulation von Emotionen wird durch die Ziele geleitet, die eine Person bewusst oder unbewusst verfolgt. Die Herabregulierung einer negativen Emotion ist sicherlich das prototypische Ziel der Emotionsregulation. Allerdings kann das Ziel auch - je nach Kontext darin liegen, eine Emotion zu steigern. Dies gilt für positive wie auch für negative Emotionen! (z. B. Leistungssport und Aggression: Das bewusste sich selbst aggressiv machen um die Leistung zu steigern.) Gross und Levenson (1997) postulieren, dass die Strategie der Unterdrückung die Verhaltensebene einer negativen emotionalen Reaktion beeinflusst, nicht aber das Erleben negativer Emotionen, d. h. die Strategie der Unterdrückung führt zwar zu weniger nach außen sichtbaren Reaktionen, die negativen Emotionen werden aber genauso intensiv erlebt. Richard und Gross (2000) betonen, dass die Anwendung der Strategie Umbewertung günstigeren Einfluss auf die Gesundheit ausübt, weil durch diese Strategie negative Emotionen auch im Erleben abgeschwächt werden. Resultate empirischer Forschung lassen den Schluss zu, dass eine effiziente Emotionsregulation für die psychische Gesundheit bedeutsam ist. Psychische Gesundheit hängt mit der Fähigkeit zusammen, die Emotionsregulation den persönlichen und den situativen Erfordernissen flexibel anpassen zu können (Znoj et al., 2004). 7. Affektausdruck (Expressivität): Nachdem über den Affekt die Verletzung eigener Interessen deutlich spürbar wurde muss nun eine explizite Forderung erhoben werden. Diese kann durch z.B. Freundlichkeitssignale gepuffert werden. Expressivität meint den Ausdruck von Emotionen. Es gibt verschiedene Konstrukte, die die interindividuellen Unterschiede beim Ausdruck von Emotionen beschreiben. Gross und John (1998) haben auf Grundlage einer Faktorenanalyse von sechs solchen Verfahren fünf Facetten identifiziert und in ein hierarchisches Modell der Expressivität eingeordnet. In diesem Modell sind auf der untersten Ebene die Facetten abgebildet, die die Kernexpressivität ausmachen (core emotional expressivity). Diese sind der Ausdruck positiver, negativer Emotionen sowie die allgemeine Stärke im Erleben und Ausdruck von Gefühlen. Der Ausdruck von positiven Emotionen hängt mit Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Sozialverträglichkeit, positiver Affektivität und BAS, sowie mit hohen Sympathiewerten zusammen. Negative Emotionen hängen mit höheren Werten in Neurotizismus, negativer Affektivität und niedrigen Sympathiewerten zusammen. Auf der zweiten Ebene der Ausdruckshierarchie kommen zwei Facetten hinzu, die weitgehend voneinander unabhängig sind. Die erste ist die Ausdruckssicherheit, die das Wissen um die eigene Kompetenz im emotionalen Ausdruck vor allem in sozialen und öffentlichen Situationen beinhaltet. Die Ausdruckssicherheit ist verbunden mit der Neigung zum Erleben positiver Emotionen sowie mit der Fähigkeit, positive Emotionen auf entsprechende Aufforderung hin darzustellen. Die zweite Facette ist die Maskierung. Diese beinhaltet das Bemühen, in öffentlichen Situationen den Ausdruck erlebter Emotionen im Hinblick auf eine gewünschte Selbstdarstellung zu regulieren. 8. Verstehen fremder Affekte: Wird der eigene Affekt von einem Objekt beantwortet, dann muss das Subjekt diesen Affekt entschlüsseln und für sich bewerten. Tendenziell neigen Menschen dazu, sich selbst eher als reagierend als als agierend zu sehen. Konflikte Verarbeitungsmechanismen führen zu Verzerrungen ebenso wie strukturelle Störungen. 9. Empathie: sich in die Affekte der anderen hinein fühlen können 10. Positive objektbezogene Affekte bewahren Interindividuelle Unterschiede in der Emotionsregulation: Die interindividuellen Unterschiede zeigen sich in der Präferenz für spezifische Strategien. Methoden sind z. B. kognitive Umdeutung, Rumination, Selbstbeschuldigung, Katastrophisieren, Akzeptanz, positive Gedanken, Planung, positive Umdeutung, Relativieren, Fremdbeschuldigen. BSP: Die Regulation von Angst: Ängstlichkeit beschreibt die Neigung, Situationen als bedrohlich wahrzunehmen und auf diese Wahrnehmung hin mit einem erhöhten Angstzustand zu reagieren. Angstregulationsmethoden werden unterschieden, ob Personen bei Bedrohung eher dazu neigen, sich von der Bedrohung abzuwenden oder sich der Bedrohung verstärkt zuzuwenden (attention versus rejection). Modell der Angstregulation (Krohne et al., 2003): Die Forscher gehen von zwei grundlegenden Dimensionen aus: 1. Kognitive Vermeidung steht für die Tendenz, die Aufmerksamkeit abzuwenden 2. Vigilanz ist die Neigung, sich den bedrohlichen Aspekten verstärkt zuzuwenden. Kognitive Vermeidung steht mit einer erhöhten Vulnerabilität und Intoleranz gegenüber der mit Angst und Bedrohung verbundenen emotionalen Erregung einher. Diese kann durch Vermeidung reduziert werden. Personen mit hoher Vigilanzneigung sind in höherem Maß intolerant gegenüber der Unsicherheit, die sich mit Bedrohung verbindet. Da sie Unsicherheit nicht ertragen können, suchen sie verstärkt nach Informationen, welche die Unsicherheit reduzieren können. Kognitive Vermeidung und Vigilanz sind als unabhängige Dimensionen konzipiert. Aus deren Kombination ergeben sich vier Bewältigungsmodi: a. Personen mit hoher Neigung zu Vigilanz und Vermeidung: fühlen sich sowohl durch Unsicherheit als auch hohe Erregung bedroht, sind daher hochängstlich. Sie sind erfolglose Bewältiger, da sich beide Reaktionen im Weg stehen. b. Personen mit niedriger Ausprägung in beiden Dimensionen: können sowohl Unsicherheit als auch Erregung ertragen und sind in der Lage, Strategien situationsangemessen einzusetzen. Dies führt zu einer erfolgreichen Bewältigung. c. Personen mit hoher kognitiver Vermeidung und niedriger Vigilanz. Sie wollen Erregung vermeiden, sie gelten als Represser. d. Personen mit niedriger kognitiver Vermeidung und hoher Vigilanz: Sie versuchen Unsicherheit zu vermeiden und gelten als Sensitizer. Das Konzept der kognitiven Vermeidung wurde in jüngster Zeit noch weiter ausdifferenziert. Es zeigte sich, dass Menschen mit hoher Ausprägung in Vermeidung in neuen Situationen auf gefährliche Reize mit erhöhter Aufmerksamkeit reagieren. Die Vermeidung setzt erst in der Folge ein. Die Vermeidung könnte somit ein Versuch sein, nicht von der die Bedrohung begleitenden Angst überwältigt zu werden. Behavioral Inhibition System (BIS) und Behavioral Activation System (BAS) Die aus der Tierforschung stammende Reinforcement Sensitivity Theorie von Gray (2000) beschreibt die interindividuellen Unterschiede im Annäherungs-Vermeidungsverhalten. Dazu gibt es drei neurobiologisch definierte Systeme (= spezifische Aktivierungszentren) der Verhaltenssteuerung, die im Gehirn lokalisiert sind. Alle drei Systeme kennzeichnen sich durch eine unterschiedliche Reaktionsbereitschaft auf positive und negative Reize und damit assoziierten Emotionen aus. (1) Fight-Flight-Freeze System (FFFS) steuert die Reaktion auf alle aversiven Reize und aktiviert Flucht und Vermeidungsverhalten, die über Furcht ermittelt werden. (2) Behavioral Approach System (BAS) ist gekennzeichnet durch eine erhöhte Ansprechbarkeit auf appetitive Reize, die Belohnung anzeigen. Es initiiert Annäherungsverhalten und ist verbunden mit positiven Affekten wie z. B. Hoffnung und antizipatorischem Genuss. (3) Behavioral Inhibition System (BIS) steuert potenzielle Zielkonflikte, die sich beispielsweise aus einer BAS aktivierten Annäherung und einer FFFS gesteuerten Vermeidung ergeben. Ihm wird die Funktion zugeschrieben, den für das Überleben wichtigen Konflikt zwischen Risiko eingehen (BAS) und Risiko vermeiden (FFFS) zu lösen. Diesem Prozess ist die Emotion Angst zugeordnet. Es wird angenommen, dass es zwischen Menschen stabile, interindividuell Unterschiede in der Stärke der drei Systeme gibt, aus denen unterschiedliche Reaktionsbereitschaften und damit assoziierte emotionale Reaktionen resultieren. Eine stärkere BAS-Ausprägung verbindet sich mit einer stärkeren Ansprechbarkeit auf appetitive Reize und mit Optimismus, Belohnungs-Orientierung und Impulsivität. Eine höhere FFFS Ausprägung verbindet sich mit erhöhter Furchtsamkeit, Scheu und Vermeidung. Eine starke BIS-Ausprägung verbindet sich mit erhöhter Ängstlichkeit. Beispiel Alexithymie: Alexithymie ist ein Kunstwort, gebildet aus den griechischen Wortstämmen α- (a-) „nicht“, ἡ λέξις (he léxis) „Rede/Wort“ und ὁ θυμός (ho thymós) „Gemüt“; Alexithymie ließe sich also übersetzen mit: „Unfähigkeit, Gefühle zu 'lesen' und auszudrücken“. Der Begriff wurde 1973 von den US-amerikanischen Psychiatern John Case Nemiah (1918–2009) und Peter Emanuel Sifneos (1920–2008) geschaffen. Alexithymie ist nicht im ICD-10 oder DSM-IV klassifiziert. Die Prävalenz für Alexithymie in der deutschen Bevölkerung liegt bei 10%. Alexithymie wird heute als ein normalverteiltes Persönlichkeitsmerkmal aufgefasst (Franz, Popp, Schäfer, Sitte, Schneider, & Hardt et al., 2008). Alexithymie ist eine Störung, die es Betroffenen schwer bis unmöglich macht Gefühle und die mit emotionalen Erregungen verbunden körperlichen Symptome wahrzunehmen, zwischen unterschiedlichen Gefühlen zu differenzieren und Gefühle zu beschreiben. Betroffene wirken oft phantasiearm und funktional, halten ihre Beschwerden für rein körperlich bedingt und können zwischen den Symptomen und seelischen Konditionen keinen Zusammenhang herstellen. Alexithymie wurde zuerst von der Psychosomatik erkannt und beschrieben. Dort wurde sie als inadäquate Reaktion auf belastende Ereignisse bei Personen mit geringer emotionaler Intelligenz beschrieben; beispielsweise werden Übelkeit und Herzklopfen nicht als Ausdruck von Angst erkannt, sondern rein körperlich gedeutet. Sie wird mittels Fragebögen wie z. B. die Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) gemessen: 1. Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren: Wenn ich durcheinander bin, weiß ich nicht, ob ich traurig, verängstigt oder ärgerlich bin. 2. Schwierigkeiten, Gefühle zu beschreiben: Es ist schwierig für mich, die passenden Worte für meine Gefühle zu finden. 3. Extern orientiertes Denken: Ich ziehe es vor, mit anderen Leuten über ihre alltäglichen Aktivitäten zu sprechen statt über ihre Gefühle. Mittlerweile gibt es Studien, die diese TAS-20 in Frage stellen. Mittels Analyse von Videoaufnahmen bei Interviews konnten bei Menschen mit hohen Werten in der TAS-20 trotzdem eine gute Darstellung emotionalen Erlebens und eine ausreichende Beschreibung von Gefühlen gefunden werden. Die aktuelle Alexithymie-Forschung versucht neurobiologische Korrelate für diese Art der Gefühlsblindheit zu finden. Alexithymie kann in diesem Zusammenhang als repressiver Bewältigungsstil, einer Überbetonung von Rationalität und Unterdrückung von Emotionalität gesehen werden. Die Problematik der Emotionsregulation (bei somatoformen Störungen und im Bereich anderer klinischer Störungen) wird auch mit dem Konzept der „Alexithymie“ („keine Worte für Gefühle“) beschrieben und erfasst (Morschitzky, 2007, S. 236). Fava, Mangelli und Chiara (2001) haben einige Kriterien ausgearbeitet, von denen mindestens drei erfüllt sein müssen, um eine klinisch relevante Alexithymie diagnostizieren zu können: 1. 2. 3. 4. 5. Unfähigkeit Gefühle verbalisieren zu können Neigung Details eines Ereignisses zu beschreiben anstelle von Gefühlen Mangel an Phantasie der Denkinhalt wird eher von äußeren Ereignissen als von Gefühlen bestimmt bei Vorhandensein von somatischen Symptomen werden diese nicht in Verbindung mit dem Gefühlserleben gebracht 6. gehäuftes Auftreten von inadäquaten affektiven Ausbrüchen Diese Kriterien werden als die Ergänzung zu herkömmlichen Klassifikationssystemen verwendet (ICD10 und DSM-IV), um klinisch relevante Alexithymie bei Patienten diagnostizieren zu können (Grabe & Rufer, 2009, S. 26). Alexithymie und Mentalisierungsfähigkeit Die Fähigkeit zur emotionalen Kommunikation stellt eine Schlüsselkompetenz zur Bewältigung von psychosozialen Belastungen dar. Bei Personen mit klinisch relevanter Alexithymie-Ausprägung fehlt entweder die Fähigkeit, Gefühle verbalisieren zu können oder sie ist eingeschränkt. Gefühle werden zwar wahrgenommen, aber nicht richtig identifiziert (z. B. wird Wut als Angst identifiziert). Somit besteht bei diesen Personen ein Mangel an Bewältigungsstrategien, um die auftretenden belastenden Emotionen regulieren zu können. Das Mentalisierungskonzept bietet eine Erklärung für die gestörte Differenzierungsfähigkeit alexithymer Personen. Mentalisierung ist beim heranwachsenden Kind die zunehmende Fähigkeit zu begreifen, dass es selbst und andere Personen ein Wesen mit mentalen Zuständen (Denken, Fühlen und Wollen) ist (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2004). Diese Fähigkeit entwickelt sich im Zuge von Interaktionen in Bindungsbeziehungen und beeinflusst die Wahrnehmung dieser Beziehungserfahrungen sowie der eigenen Affekte und Gedanken (Dornes 2010, 166). Somit hängt die Mentalisierung „unauflöslich mit der Entwicklung des Selbst zusammen, mit seiner zunehmend differenzierteren, inneren Organisation und seiner Teilnahme an der menschlichen Gesellschaft, einem Netzwerk von Beziehungen zu anderen, die diese einzigartige Fähigkeit ebenfalls besitzen.“ (Fonagy u.a. 2008, 11). Mentalisierung bezeichnet jedoch nicht nur die Fähigkeit, hinter dem Verhalten einer Person eine seelische Komponente zu vermuten, sondern den vermuteten seelischen Zustand auch zum Gegenstand des eigenen Nachdenkens zu machen. Die Mentalisierungsfähigkeit ermöglicht einer Person eine empathische Zugangsweise zu sich und anderen Personen und hat somit eine verhaltensund emotionsregulierende Funktion (Dornes, 2004). Allen, Fonagy, Bateman (2011, 45) definieren die Mentalisierungsfähigkeit folgendermaßen: „Mentalisieren bedeutet, mentale Zustände in sich selbst und anderen wahrzunehmen und implizit oder explizit anzuerkennen, dass diese mentalen Zustände die Realität unter einem von zahlreichen möglichen Blickwinkeln repräsentieren.“ (ebd.; Herv. i. Orig.). Innerhalb der Definition werden die Differenzierungen „explizit vs. implizit“ (ebd., 50) und „selbst vs. anderer“ (ebd., 53) als zentral für das Mentalisierungskonzept verstanden. Das explizite Mentalisieren ist „ein relativ bewusster, vorsätzlicher und reflexiver Vorgang“ (Allen, Fonagy, Bateman 2011, 50f) und „betrifft alles, was in symbolischer Form erklärt werden kann.“ (ebd., 51). Es ist daher meist an das Medium der Sprache gebunden und geschieht etwa dann, wenn ein Mensch einem anderen von seinen eigenen psychischen Inhalten berichtet oder sich Gedanken über die Hintergründe des Handelns einer anderen Person macht (ebd.). „Im günstigsten Fall ist explizites Mentalisieren durch eine Kombination aus Exaktheit, Reichhaltigkeit und Flexibilität charakterisiert.“ (ebd., 53) Das implizite Mentalisieren geschieht im Gegensatz dazu generell „automatisch und nicht-reflexiv“. Dennoch handelt es sich dabei um einen bewussten Prozess, der jedoch meist nur auf einer Ebene des basalen Gewahrseins abläuft. So ist etwa die nichtbewusste Spiegelung der Mimik und Gestik des Gegenübers eine Form des impliziten Mentalisierens. Aber auch das automatische Einnehmen der Perspektive des anderen und Phänomene, die als „Intuition“ benannt werden, beruhen auf dieser Fähigkeit. Dornes (2010, 168) formuliert folgenden Zusatz: „Unter Mentalisierung wird indes nicht nur die Fähigkeit verstanden, hinter Verhalten seelische Zustände zu vermuten, sondern auch die weitergehende Fähigkeit, die vermuteten mentalen Zustände selbst wieder zum Gegenstand des (Nach-)Denkens zu machen.“ Fonagy et al. (2004) gehen davon aus, das sich die Mentalisierungsfähigkeit durch eine empathische Regulation und Modulation kindlicher, affektiver Spannungszustände durch die Bezugspersonen entwickelt. Bei gestörten empathischen elterlichen Funktionen kommt es zur Störung der Stressregulation des Kleinkindes. Diese affektivregulativen Kompetenzen der Bezugspersonen werden vom Kind im weiteren Verlauf verinnerlicht und tragen zur Entwicklung ausgeprägter emotionaler bzw. alexithymer Störungen bei (Grabe & Rufer, 2009, S. 154). Bateman und Fonagy haben auf Basis ihrer Erkenntnisse ein Therapiekonzept entwickelt, das die gezielte Förderung der Mentalisierungsfähigkeit der Klienten zum Ziel hat. Die sogenannte Mentalisierungsgestützte Therapie (Mentalization Based Treatment MBT). Das Konzept des Mentalisierens lehnt sich an verschiedene andere theoretische Konzepte an. Z. B.: a) Das Konzept der Theory of Mind (ToM): Die Theory of Mind wird von Kindern ungefähr im Alter von 4 Jahren erworben und verhilft ihnen dazu, „Gedanken als Repräsentationen, nicht mehr als Abbilder von Realität zu verstehen.“ Bis sie diese Fähigkeit entwickelt haben, betrachten Kinder Gedanken als exakte Spiegelung der Realität und können sich daher auch nicht vorstellen, dass sie selbst oder eine andere Person einer falschen Überzeugung unterliegen können. Allen, Fonagy, Bateman (2011, 78) fassen die Beziehung der beiden Konzepte folgendermaßen zusammen: „die Aktivität des Mentalisierens bedient sich unserer Theory of Mind und trägt gleichzeitig zu deren Weiterentwicklung und Verfeinerung bei.“ (ebd.; Herv. i. Orig.). b) Das Konzept der Geistesblindheit und des Gedankenlesens (von Baron-Cohen): „die Geistesblindheit als Unfähigkeit, Gedanken zu lesen“ definiert und wurde ursprünglich als das Charakteristikum des Autismus angesehen. Das Gedankenlesen ist jedoch im Gegensatz zum Mentalisieren nur auf andere Menschen gerichtet und bezieht sich nicht auf den Bereich der Emotionen. c) Das Konzept der Metakognition: Metakognitionen bezeichnen die Fähigkeit über das Denken nachzudenken. d) Das Konzept der Achtsamkeit: „Achtsamkeit“ entstammt ursprünglich der buddhistischen Lehre. Den Zusammenhang mit dem Mentalisierungskonzept sehen Allen, Fonagy, Bateman (2011, 84ff) in der Betonung einer offenen und empfänglichen Aufmerksamkeit, die beim Mentalisieren auf die Psyche gerichtet ist. Im Gegensatz zur Mentalisierung ist der Begriff Achtsamkeit jedoch nur auf die Gegenwart, in der sich das Individuum befindet, anwendbar und ist nicht spezifisch auf mentale Zustände gerichtet. e) Das Konzept der Empathie: Diese Konzept gilt auch nur eingeschränkt, da sich die empathische Einfühlung lediglich auf das Gegenüber und nicht auf das Selbst bezieht. Zusätzlich beinhaltet Empathie eine adäquate emotionale Reaktion auf die wahrgenommene Emotion des/der anderen, was im Konzept des Mentalisierens nicht mit einbezogen wird. f) Das Konzept der Emotionalen Intelligenz: Die Verwandtschaft zum Mentalisieren liegt darin, dass die emotionale Intelligenz auch emotionale Kompetenz im Umgang mit sich selbst und anderen verlangt. Somit kommt die emotionale Intelligenz dem Mentalisieren zwar näher, bleibt aber auf emotionale, mentale Zustände beschränkt, während das Mentalisieren die gesamte Bandbreite mentaler Zustände betrifft.“ g) Das Konzept der Begriff der „Reflexionsfunktion“: In der Literatur wird der Begriff der Reflexionsfunktion oder auch der reflexiven Kompetenz häufig als Synonym für die Mentalisierung verwendet. Sie beschreibt das Ausmaß der Reflexivität eines Menschen (des Nachdenkens über sich und andere). Alexithymie und psychische Störungen Das Alexithymie-Konzept wurde ursprünglich mit psychosomatischen Störungen in Verbindung gebracht. So bestehen auch korrelative Zusammenhänge zwischen Alexithymie und dem Vorliegen somatoformer Störungen (Mortschitzky, 2007, S. 236). Patienten mit somatoformen Störungen weisen im Vergleich mit Patienten mit chronischen, organischen Erkrankungen signifikant höhere Alexithymie-Werte auf (Bach & Bach, 1996). Umgekehrt scheinen Alexithyme Personen auch in konflikthaften Situationen, statt mit einer angemessenen affektiven und kognitiven Verarbeitung, vermehrt mit körperlichen Symptomen zu reagieren (ebd.). Patienten mit somatoformer Störung weisen ebenso eine höhere AlexithymieAusprägung auf als Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom (Wood & Wesely, 1999). Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigten jedoch, dass nicht nur psychosomatische Erkrankungen, sondern auch andere psychische Störungen mit Alexithymie einhergehen können bzw. sogar in stärkerem Ausmaß davon betroffen sind. Nach einer Studie des Universitätsklinikums Giessen haben Patienten mit Angststörungen und Depressionen die höchsten Alexithymie-Werte, während Patienten mit somatoformen Störungen die niedrigsten Ausprägungen aufweisen, auch gegenüber noch anderen Störungsbildern (Grabe & Rufer, 2009, S. 128). Vergleichbare Ergebnisse erbrachte eine Studie von Subic-Wrana, Bruder, Thomas, Lane, & Kohle (2005). Eine metaanalytische Untersuchung von De Gucht und Heisser (2003) ergab, dass zwischen der Alexithymie-Ausprägung und der Anzahl somatoformer körperlicher Beschwerden nur eine eher schwach positive Korrelation besteht (r = .21). Dieser Zusammenhang besteht zudem nur mit der Schwierigkeit in der Identifikation von Gefühlen (Faktor 1 des TAS-26) und nicht mit den anderen Aspekten des Alexithymiekonzeptes. Mattila et al. (2010) beobachteten in einer größeren epidemiologischen Studie, dass Alexithymie nicht als kategoriales Merkmal, sondern als dimensionales Konstrukt zu verstehen ist und nicht ausschließlich psychosomatischen Störungen zugeordnet werden sollte. Das Vorliegen einer klinisch relevanten Alexithymie ist somit keineswegs auf Patienten mit somatoformen Störungen beschränkt. Alexithymie wird deshalb heute mehr als Vulnerabilitätsfaktor angesehen, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine psychische Erkrankung im Laufe des Lebens zu entwickeln (Grabe & Rufer, S. 141). Alexithymie und Psychotherapie Sifneos (1973) stellte die These auf, dass die klinisch relevante Alexithymie-Ausprägung die psychotherapeutische Behandlung von Patienten verhindere. Generell wird Alexithymie als ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal angesehen (Gündel et al., 2000, oder Taylor et al., 1991). Die Schwierigkeit der Identifikation und der Verbalisierung von Gefühlen durch die Patienten stellt zudem ein Problem für einsichtsorientierte, psychotherapeutische Behandlungsmethoden dar (Grabe & Rufer, 2009). Empirische Befunde, die diese Ansicht stützen, stammen z. B. von Stingl, Bausch, Walter, Kagerer, Leichsenring und Leweke, 2008: Bei Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen blieb die Alexithymie-Ausprägung durch eine psychodynamische Psychotherapie relativ ohne Veränderung bestehen. Ebenso zeigten sich in stationärer Psychotherapie keine relevanten Veränderungen der Alexithymie (z. B. Grabe et al., 2008; Simon, Martin, Schafer, Franz, & Janssen, 2006), jedoch eine Verminderung des Therapieerfolges durch das Vorliegen einer klinisch relevanten Alexithymie (Grabe & Rufer, 2009). Grabe und Rufer (2009) weisen darauf hin, dass das therapeutische Vorgehen bei alexithymen Patienten nicht primär auf einem einsichtorientierten Therapieangebot aufbauen sollte. Alexithyme Patienten der Studie von Grabe et al. (2008) gaben dementsprechend auch an, dass bei ihnen insbesondere die Körper- und Bewegungstherapie zum Therapieerfolg beigetragen hat. Es erscheint daher plausibel, dass alexithyme Patienten gerade durch körperfokussierte Erfahrungen (wie Bewegung, Berührung, körperlicher Kontakt) und anschließender Aufarbeitung des Erlebten einen besseren kognitiven Zugang zu ihren Gefühlen entwickeln können. Inwieweit und ob eine psychotherapeutische Behandlung eine klinisch relevante Alexithymie vermindern kann, ist aufgrund der empirischen Untersuchungen nicht klar. Es bedarf kontrollierter Studien, die diese Fragestellung bei unterschiedlichen Störungsbildern untersuchen (Grabe & Rufer, 2009, S. 198). Selbstkontrolle und Selbstregulation: Selbstkontrolle beinhaltet die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Verhalten im Hinblick auf die Erreichung persönlicher Ziele und soziale Verhaltensstandards zu beeinflussen und zu kontrollieren. Selbstkontrolle ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Lebensführung, positive, soziale Beziehungen und psychische Gesundheit. (Tangnes, Baumeister & Boone, 2004). Der Begriff der Selbstregulation wird häufig synonym verwendet, bisweilen aber auch in umfassenderer Weise auf alle Prozesse bezogen, bei denen unter Einsatz von Selbstkontrolle Ziele und Standards erreicht werden sollen. Mit Selbstkontrolle und Selbstregulation beschäftigen sich eine Reihe von Teildisziplinen der Psychologie (allgemeine, Sozialpsychologie, klinische Psychologie und Entwicklungspsychologie). Die Differentielle Psychologie widmet sich den Themen auf drei Arten: 1. Ansätze, die interindividuelle Unterschiede in Strategien und Mechanismen der Selbstkontrolle untersuchen 2. Die Konzeption von Persönlichkeitsmerkmalen, die Unterschiede im globalen Ausmaß an Selbstkontrolle beinhalten und 3. Den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf Prozesse der Selbstregulation. Interindivdiuelle Unterschiede in Strategien und Mechanismen der Selbstkontrolle: Selbstkontrolle beinhaltet im Kern die Fähigkeit, Impulsen nicht nachzugeben und automatische Handlungstendenzen zu hemmen, wenn diese im Hinblick auf die Erreichung persönlicher Ziele oder sozialer Verhaltensstandards als unerwünscht erachtet werden. Strategien für den Belohnungsaufschub: Walter Mischl und Kollegen haben in den 60er Jahren zum Belohnungsaufschub geforscht (Delay of Gratification). Kinder wurden im Labor mit zwei Verlockungen konfrontiert, die sich in ihrer Menge unterschieden, z. B. ein Marshmallow gegenüber zwei Marshmallows. Wartet ein Kind solange, bis die Versuchsleiterin, die unter einem Vorwand das Labor verlässt und ankündigt, später wiederzukommen, zurückkehrt, erhält es die größere Menge, also zwei Marshmallows. Wenn das Kind nicht warten will, kann es die Versuchsleiterin mit einer Glocke sofort zurückholen, bekommt dann aber nur einen Marshmallow. Selbstkontrolle im Sinne des Belohnungsaufschubs erfolgt, wenn das Kind länger auf die Belohnung warten kann. Mischl interessierte sich vor allem für die Strategien, die Selbstkontrolle ermöglichen. Diese sind z. B. dass die Aufmerksamkeit gegenüber dem Objekt der Begierde verändert wird. Sie beinhalten eine Abwendung von den „heißen“ begehrenswerten Qualitäten des Objekts, die spontanes, impulsives und von Umweltreizen gesteuerte Verhalten aktivieren. Sie bewirken eine „Abkühlung“, indem eine Distanz zum begehrten Objekt hergestellt wird, die den Belohnungsaufschub ermöglicht oder erleichtert und damit die Grundlage für reflexives Verhalten liefert. Mischl unterscheidet drei Arten des Coolings: 1. Nichtwahrnehmung des begehrten Objekts (z. B. durch Abwenden) 2. Ablenkung, die Gedanken werden auf etwas anderes fokussiert 3. Kognitive Umdeutung: das Objekt wird nicht mehr durch seine begehrenswerten Eigenschaften wahrgenommen sondern durch seine kühleren, z. B. man sieht nur mehr die Form des Marshmallows (und denkt nicht mehr an den guten Geschmack = heiße Eigenschaft) Kinder die im Altern von 4-5 Jahren einen guten Belohnungsaufschub zeigten, waren zehn Jahre später leistungsfähiger und konnten mit Belastungen besser umgehen. Damit ist Belohnungsaufschub nicht nur ein guter Prädiktor für Erfolg sondern auch ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Belohnungsaufschub besteht aus verschiedenen Komponenten – Flexibilität, Aufmerksamkeitslenkung, metakognitives Wissen um die Wirksamkeit der Strategien – die ein grundlegender Bestandteil intellektueller Fähigkeiten - Fähigkeiten zur Problemlösung und Belastungsbewältigung - sind. Nach Fuijta et al (2006) beinhaltet Selbstkontrolle in einer kritischen Situation z. B. die Situation auf einem höherem Abstraktionsniveau zu konstruieren, den sich aus dieser Konstruktion ergebenden Handlungstendenzen zu folgen und so im Einklang mit den langfristigen Zielen zu handeln. Die „höherrangige Konstruktion“ ergibt sich aus den langfristigen Zielen einer Person. Vigilante Überwachung: Strategien der Ablenkung und Umdeutung erweisen sich als hilfreich, um spontane Versuchungen oder Verlockungen zugunsten langfristiger Ziele zu widerstehen. Wenn es um die Durchbrechung schlechter Gewohnheiten geht, sind diese Strategien wenig hilfreich. Hier geht es gerade um die gezielte Aufmerksamkeit. Quinn, Pascoe, Wood und Neal (2010) haben Versuchspersonen nach ihren Umgang mit täglichen Versuchungssituationen (z. B. Computerspielen) und schlechten Angewohnheiten (z. B. Nägelkauen) befragt. Es gab drei Wahlmöglichkeiten 1. Vigilante Überwachung bei der das Verhalten beobachtet und gezielt unterbunden wird 2. Ablenkung 3. Varianten der Stimuluskontrolle (z. B. sich aus der Situation begeben oder Möglichkeiten das unerwünschte Verhalten auszuführen zu unterbinden) Am effizientesten war die vigilante Überwachung bei schlechten Gewohnheiten. Beim Widerstehen von Versuchungen half Stimuluskontrolle am besten. Exekutive Funktionen: Exekutive Funktionen umfassen Fähigkeiten, die Grundlage einer kontrollierten Steuerung und Überwachung von Verhalten sind. Das sind z. B: Fähigkeiten wie die Setzung von Zielen, Planung, die Ausführung zielgerichteter Handlungen, Aufmerksamkeitskontrolle, kognitive Flexibilität, Impulskontrolle und Inhibition. Der präfrontale Kortex wird als neurologisches Substrat dieser exekutiven Funktionen angesehen (ob es weitere Verbindungen im Gehirn gibt, ist noch offen). Da es viele solcher exekutiver Fähigkeiten gibt, stellt sich die Frage, ob es eine zugrundeliegende Dimension gibt, das könnte die allgemeine Intelligenz oder das Arbeitsgedächtnis sein. Hier ist ebenfalls noch Forschung notwendig. Effortful Controll Effortful Controll beschreibt die Fähigkeit, eine dominante Reaktion zugunsten einer weniger dominanten Reaktion zu inhibieren. Diese Fähigkeit - die Steuerung der Aufmerksamkeit und des Verhaltens – ist Teil des Temperaments. Die neurobiologische Grundlage dazu liegt in den Strukturen des präfrontalen und parietalen Kortex. Er entwickelt sich im Alter zwischen vier und sieben Jahren und führt zur Herausbildung der Kontrollfähigkeit. Der Zentrale Mechanismus der Kontrolle ist die willkürliche Steuerung der Aufmerksamkeit. Dazu gehört a. Fähigkeit die Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize zu fokussieren b. die eigenen Gedanken zu kontrollieren c. die Aufmerksamkeit von einem Reiz auf einen anderen zu legen Diese der Effortful Contoll zu Grunde liegenden Fähigkeiten entwickeln sich früher, zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr. Zur Messung dieser Fähigkeiten beim Erwachsenen haben Derryberry und Reed (2002) die Attention Control Scale (Fragebogen) entwickelt. Interindividuelle Unterschiede in der Selbstkontrollstärke: Die Grundlage der Selbstkontrolle ist eine Energie, die sich durch das Ausüben von Selbstkontrolle verbraucht. Den Zustand der erschöpfen Selbstkontrolle nennt Baumeister „ego-depletion“. Die Forschergruppe um Baumeister (2000) postulierte, dass alle Kontrollleistungen derselben Kraft unterliegen und dass diese Kraft begrenzt ist, wobei sich Personen habituell im Ausmaß ihrer Selbstkontrollstärke unterscheiden. Experiment: Testpersonen, die im Rahmen einer ersten Aufgabe Selbstkontrolle ausüben mussten, (sie wurden – während sie eine Aufgabe bewältigen mussten, Stress durch Lärm ausgesetzt, außerdem mussten sie Versuchungen widerstehen und Impulse kontrollieren), schnitten bei anschließenden Aufgaben, deren Bearbeitung erneut Selbstkontrolle forderten, schlechter ab. Block und Block (1980) gingen davon aus, dass ein mehr an Selbstkontrolle nicht immer besser ist. Sowohl ein Zuviel (overcontrolled) als auch ein Zuwenig (undercontrolled) kann mit positiven und negativen Konsequenzen verbunden sein. So wurden Menschen, die „undercontrolled“ sind, als lebhaft, ausdrucksfähig, sozial-kompetent und charmant, aber auch als unzuverlässig und „selfdramatizing“ beschrieben. Nach Block und Block ist adaptives Verhalten dadurch gekennzeichnet, dass das Ausmaß an Selbstkontrolle dem Kontext angepasst werden kann. Die Fähigkeit zu einem flexiblen Ausmaß an Selbstkontrolle bezeichnen sie als „ego-resilience“. Kontrolle impulsiv-aggressiver Reaktionen: Wilkowski und Robinson (2008) entwickelten ein kognitives Modell der habituellen Ärgerneigung. Sie unterscheiden drei Prozesse, die das Ausmaß an Ärger und reaktiver Aggression verstärken können. 1. Prozess: Neigung, mehrdeutige Situationen als feindselig zu interpretieren, wobei dies weitestgehend automatisch erfolgt. (Z. B. Jemand lächelt weil es ihm gut geht und ein anderer fühlt sich ausgelacht.) 2. Prozess: Andauernde, feindselig getönte Fokussierung der Aufmerksamkeit (Rumination) auf das als feindselig interpretierte Geschehen. (Man zieht frühere negative Erfahrungen als Beweise für die eigene Interpretation hinzu: Sie hat mich vorher schon mal verspottet,…) 3. Prozess: Bezogen auf die Kontrolle, Personen mit geringer Ärgerneigung sind im Unterschied zu Personen mit hoher Ärgerneigung in der Lage, ihre feindseligen Interpretationen zu unterbinden. Sie benützen dafür drei kognitive Kontrollmechanismen: a. Mildernde Umdeutung des anfänglich als feindselig interpretierten Verhaltens b. Ablenkung statt Aufmerksamkeitsfokussierung c. Unterdrückung von impulsiv-aggressiven Reaktionen. Ad 3. Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf Prozesse der Selbstregulation: Die hier vorgestellten zwei Theorien beschäftigen sich mit dem Einfluss, den bestimmte Persönlichkeitsvariablen auf die Selbstregulation haben. 1. Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit 2. Theorie des Regulativen Fokus Ad Theorie der Objektiven Selbstaufmerksamkeit (Duval und Wicklund): Die Aufmerksamkeit einer Person kann zu einem Zeitpunkt entweder auf die Umwelt oder sich selbst gerichtet sein. Selbstaufmerksamkeit beschreit den Zustand, in dem die Person die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenkt und eine Bewertung vornimmt zwischen dem gegenwärtigen Zustand und der idealen Selbstrepräsentation. Dieser Vergleich führt zu einer Wahrnehmung der Diskrepanz, der meist von negativen Gefühlen begleitet wird. Die Person reagiert nun entweder damit, die Diskrepanz zu verringern indem sie Verhaltensweisen zeigt, die sich dem Ideal annähern, oder indem sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Umwelt lenkt. Personen unterscheiden sich in dem Ausmaß, wie sie zur Selbstaufmerksamkeit neigen. Duval und Wicklund unterscheiden eine private (Aspekte, die nur mir ersichtlich sind) und eine öffentliche (Aspekte, die von anderen wahrnehmbar sind) Selbstaufmerksamkeit. Hohe Selbstaufmerksamkeit bewirkt eine höhere Sensibilität für Verhaltensstandards und macht damit auch eine höhere Selbstkontrolle wahrscheinlicher. Ad Theorie des Regulativen Fokus (Higgins): Higgins verbindet die Selbstregulation mit interindividuellen Unterschieden in der Motivation, in Emotionen und Verhaltenspräferenzen. Er unterscheidet zwei motivationale Richtungen, die Prozesse der Selbstregulation beeinflussen: 1- Promotion-Focus: Personen sind bestrebt, ihre Erfahrungen zu erweitern, persönliches Wachstum zu erreichen und sich ihren Idealen und Wünsche anzunähern. Sie sind sensibel gegenüber positiven Ereignissen und zeigen eine eifrig-begeisterte Zielverfolgung. Regulative Passung („regulatory-fit“): Diese Personen haben das Gefühl einer subjektiven Richtigkeit oder Stimmigkeit ihrer Erfahrungen. 2- Prevention Focus: Diese Menschen versuchen Sicherheit zu erlangen und zu bewahren, Verluste zu vermeiden und soziale Normen und Verpflichtungen einzuhalten. Sie sind sensibler für negative Ereignisse und ihre Vermeidung: das Verhalten ist wachsamvermeidend und Risiken abgeneigt. Higgins nimmt an, dass sich Menschen habituell darin unterscheiden ob sie eher einen „promotions-„ und „prevention-focus“ aufweisen. Werden Personen auf eine, ihrem regulativen Fokus gemäße Art und Weise angesprochen, sind sie eher bereit, ihr Verhalten zu ändern. Regulative Passung erhöht die Überzeugungskraft einer Botschaft. Das Behavioristische Paradigma Eine ganz neue Strömung in der Psychologie/Psychotherapie kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Behaviorismus. Er war in seinem Denken radikal und entsprach der Zeit, in der plötzlich alles machbar erschien, sogar die Landung auf dem Mond. Der Behaviorismus ist eine extreme Position, die in ihrer Radikaliät keine Gültigkeit mehr hat, dennoch sehr einflussreich auf unser Verständnis von Persönlichkeit war und auch immer noch ist. Die philosophische Grundlage dazu ist beim John Locke (1632 – 1704) zu finden. Locke betrachtet den Säugling als „tabula rasa", als leeres Blatt Papier, auf das die Lebensgeschichte geschrieben wird. Wir sind, was wir sind, aufgrund dessen, was wir erlebt haben. Dieses Wissenschaftsparadigma versucht menschliches Verhalten zu erklären, ohne dabei Konzepte wie Motivation, Triebe, Emotionen, etc. zu verwenden. In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Blackbox“ verwendet. Individuelle Unterschiede sind das Ergebnis unterschiedlicher Lernerfahrungen, bei denen das Individuum Belohnung oder Bestrafung erlebt hat. Zum Beispiel wäre die Fähigkeit, vor vielen Menschen reden zu können, nicht Teil ihrer extrovertierten Persönlichkeit, sondern das Ergebnis, dass diese Person viele positive Erfahrungen damit gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie schon in der Schule gutes Feedback für Referate bekommen, ihre Eltern haben ihr geduldig zu gehört und sie ernst genommen, etc. Eine Person, die Angst vor dem „öffentlichen Reden“ hat, hätte der Theorie nach, viele negative Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt. (z. B. Auslachen, negatives, unsachliches Feedback durch Lehrer, ...) Der Ausgangspunkt für die Entwicklung der behavioristischen Lerntheorien waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Der erste, der sich damit wissenschaftlich auseinander gesetzt hat, war allerdings ein Russe, Iwan Petrowitsch Pawlow. Die Klassische Konditionierung Iwan Petrowitsch Pawlow (1849 – 1936) entdeckte die Prinzipien der Konditionierung und wurde damit der Gründervater der lerntheoretischen Forschung. Mehr zufällig entdeckte er – er war Physiologe und wollte die Verdauungsprozesse von Hunden studieren - dass, jedes Mal wenn im Labor die Glocke läutete und das Futter gebracht wurde, die Hunde zu sabbern begannen. Nach einiger Zeit löste die Glocke alleine das Sabbern aus ohne dass die Hunde das Futter sehen oder riechen konnten. Dieses Phänomen nannte Pawlow „Klassische Konditionierung“: Das Futter ist dabei der unkonditionierte Stimulus, das bedeutet, dass man den Reiz/Stimulus nicht lernen muss, sondern, dass die Hunde natürlich darauf mit Speichelfluss reagieren. Die Glocke ist ein neutraler Reiz. Er hat für die Hunde keine Bedeutung. Das gleichzeitige Präsentieren von neutralem Reiz und unkonditioniertem Stimulus führt dazu, dass diese beiden gekoppelt werden und der neutrale Reiz (Glockenklang) den Speichelfluss auslösen kann. Er wurde zum konditionierten (= gelernten) Stimulus. Die Hunde haben diese Assoziation gelernt. Klassische Konditionierung ist auch bei Menschen durchführ- und beobachtbar. Ein weiteres wichtiges Phänomen war das der Generalisierung. Pawlow fand heraus, dass ähnliche Reize die Reaktion „Speichelfluss“ auslösen können. Waren die Reize zu unterschiedlich dann blieb die Reaktion aus („Differenzierungslernen“). Eine Löschung dieser gelernten Verbindung passierte dann, wenn z. B. die Glocke über längere Zeit immer wieder läutete und darauf kein Futter folgte („Extinktion“). Z. B.: Ein Bub wird von einer Biene gestochen. Er reagiert fortan immer panisch auf Insektensummen (Generalisierung). Als er älter wird lernt er Bienen, Moskitos, Fliegen, Mücken zu unterscheiden. Zunehmend reagiert er nur mehr auf Bienen panisch (Diskriminierung). Die Kernaussage der Behavioristen ist nun, dass unser Verhalten und die Häufigkeit, mit der es auftritt, von den Konsequenzen, die darauf folgen, abhängen. https://www.youtube.com/watch?v=5QelaIPLPDk Der Behaviorismus stellt die Grundlage der (kognitiven) Verhaltenstherapie dar und wird von einem bestimmten Menschenbild getragen. Die Theorie zu neurotischem Verhalten ist laut den Behavioristen eine Lerntheorie. Pawlow machte dazu folgendes Experiment: Er konditionierte Hunde bei der Darbietung eines Kreises, gekoppelt mit Futter, mit Speichelfluss zu reagieren. Bei der Darbietung einer Ellipse gab es kein Futter. Dann änderte er den Kreis langsam ab zu einer Ellipse. Ab einen bestimmten Punkt konnten die Hunde nicht mehr unterscheiden, ob es sich um einen Kreis oder den zu einer Ellipse veränderten Kreis handelt. Sie zeigten neurotisches Verhalten. Dies sahen die Behavioristen als Beleg dafür an, dass neurotisches Verhalten „erlernbar“ ist. Es wird durch Umgebungsbedingungen gefördert, in denen das Individuum Entscheidungen treffen muss, obwohl ein Urteil unter diesen Bedingungen gar nicht möglich ist. Kinder, die instabile Eltern haben, können kaum voraussagen, ob auf ihr Verhalten Belohnung oder Bestrafung folgt. Dies führt zu Frustration, Angst, Despression. Dies wurde in der Sozialpsychologie unter der Theorie der gelernten Hilflosigkeit zusammengefasst. Die Theorie der gelernten Hilflosigkeit bezeichnet ein psychologisches Konzept zur Erklärung von Depressionen. Sie beschreibt die Erwartung eines Individuums, bestimmte Situationen oder Sachverhalte nicht kontrollieren und beeinflussen zu können und persönliche Entscheidungen als irrelevant wahrzunehmen. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass Menschen bei unangenehmen Erlebnissen die Frage nach der Ursache stellen. Die Antwort, die sie auf diese Frage finden, hängt vom Attributionsstil (= Stil der Zuschreibung von Ursache und Wirkung) ab. • Depressionsauslösend wäre ein pessimistischer Attributionsstil, auf Grund dessen die Ursache für ein negatives Ereignis folgendermaßen eingeschätzt wird: – intern (persönlich): Sie sehen in sich selbst das Problem und nicht in den äußeren Umständen. – global (generell): Sie sehen das Problem als allgegenwärtig und nicht auf bestimmte Situationen begrenzt. – stabil (permanent): Sie sehen das Problem als unveränderlich und nicht als vorübergehend. Pawlow zeigte mit seinen Experimenten, dass Angst (=Emotion) erlernt und auch wieder verlernt werden kann. Somit galt es für ihn und die Vertreter der behavioralen Richtung als erwiesen, dass Angst nicht Teil der Persönlichkeit ist sondern ein erlerntes Verhalten, das genauso gut wieder verlernt/gelöscht werden kann. In der weiteren Forschung fand man heraus, dass die Konditionierung weit komplexer ist, als Pawlow ursprünglich annahm. So kann z. B. Höhenangst unter Laborbedingungen weit leichter ausgelöst werden als z. B. Angst vor Autos. Die Begründung dafür ist, dass wir biologisch vorprogrammiert für bestimmte Ängste sind. Diese konditionierten Ängste sind auch löschungsresistenter als andere „Labor-Ängste“. Bis zu Pawlows Entdeckung basierte psychologische Forschung auf der Beobachtung und Introspektion (=> siehe Psychoanalyse). Das bedeutet, Menschen wurden gebeten, ihre Wahrnehmungen und Assoziationen mitzuteilen. Diese äußerst subjektive Methode wird von den Behavioristen abgelehnt. John B. Watson gilt als der Begründer des Behaviorismus. Er wollte eine präzise Wissenschaft begründen (~1908 – 1919, John Hopkins Universität). Watson studierte Philosophie, Psychologie, Physiologie, Zoologie und Neurologie, wandte sich von der Erforschung menschlichen Verhaltens ab, bevorzugte das Studium der Fauna und war überzeugt, dass er gleiche Verhaltensweisen bei Menschen finden und studieren könnte. In den 20-er Jahren führte Watson sein berühmtes Experiment zur klassischen Konditionierung am Menschen durch. Berühmt nicht nur, weil es funktionierte, sondern auch, weil es heutigen ethischen Standards nicht standhält. Das Experiment ging in die Geschichte unter dem Titel „Little Albert“ ein. Watson und Rayner konditionierten einen 11 Monate alten Jungen, Albert, so, dass er eine Tierphobie entwickelte. Sie koppelten den Anblick einer Ratte mit einem lauten Knall. Jedes Mal wenn der kleine Albert nach der Ratte griff, wurde er erschreckt. Bald fing Albert zu weinen an, wenn er nur die Ratte sah. Diese konditionierte Reaktion generalisierte er bald auf alle felltragenden Tiere bis dahin, dass Albert sogar Angst vor dem Bart des Weihnachtsmannes entwickelte. Daraus ergaben sich für die zwei Wissenschaftler zwei Erkenntnisse: 1. Jeder Stimulus kann konditioniert und mit emotionalen Reaktionen verknüpft werden 2. Annahme: ein Großteil gebildet/konditioniert. der Persönlichkeit würde auf diese Art und Weise Mary Cover Jones (1924) machte mit einem Jungen namens Peter ein ähnliches Experiment, indem er ihm die Angst vor Ratten und Felligem nahm. Es bestätigte die Möglichkeit, dass auch bei Menschen Verhalten gelöscht werden kann und erfand damit die systematische Desensibilisierung (geht auf Wolpe zurück). Seine Persönlichkeit wurde verändert, da er jetzt keine Angst mehr vor felligen Tieren hatte. Die systematische Desensibilisierung ist eine gängige Methode der Verhaltenstherapie. Hoch emotionale Aspekte der Persönlichkeit können gelöscht werden (Phobien, Zwänge, ...). Neuere Methoden wie z. B. virtuelle Realitäten ermöglichen es sogar eine „in-vivo-Exposition“ in der eigenen Praxis durchzuführen. Der behavioristische Ansatz hat einen starken Fokus auf die Veränderung von Verhalten. Anders als die Ansätze, die in den nächsten Kapitel folgen, machen Behavioristen keine Aussagen über die in der Person liegenden Ursachen von Verhalten: Alles ist erlernt und alles kann – unter den richtigen Voraussetzungen – wieder verlernt werden. Die Vorstellung beobachtbares Verhalten durch nicht beobachtbare, innere, mentale Prozessen zu erklären, wird abgelehnt. Psychopathologie ist das Ergebnis erlernter, maladaptiver Reaktionen auf eine bestimmte Situation, die dann auf andere Situationen oder ähnlich Reize generalisiert wurde und aufgrund ihrer Beschaffenheit auch wieder umgelernt werden könne. Neben der Methode der systematischen Desensibilisierung entstammt auch die Aversionstherapie dieser Denkweise. Systematische Desensibilisierung: Ein angstauslösender Reiz wird – in Abstufungen – dargeboten und zwar so lange, bis die Angst abgeklungen ist und durch eine Entspannungsreaktion ersetzt werden konnte. Es erfolgt die Löschung der Angst in Gegenwart des Reizes (z. B.: Höhenangst) Aversionstherapie: Diese wird z. B. in der Suchttherapie angewendet. Hier wird der Reiz, der ein starkes Verlangen auslöst, mit negativen Bildern gekoppelt. Die extremste Form wurde in den 60er Jahren von S. G. Laverty durchgeführt. Er wollte alkoholkranke Menschen heilen, in dem er sie am Getränk riechen ließ und ihnen gleichzeitig eine Substanz spritze, die die Muskeln inklusive der Atemmuskulatur lähmte. Wenn nach einer Minute die Atmung nicht wieder einsetzte, wurden die Versuchspersonen künstlich beatmet. Viele sagten, sie dachten, sie müssten sterben. Die Alkoholsucht konnte mit dieser extremen Behandlung allerdings nicht nachhaltig geheilt werden. B. F. Skinner und der radikale Behaviorismus: Skinner lehnte zwar die Existenz eines Unbewussten nicht gänzlich ab, er hielt sie aber – ganz der Tradition der Behavioristen folgend – um Verhalten zu erklären für überflüssig. Dasselbe dachte er über Gedanken und Vorstellungen. Skinner nahm an, dass es – im Sinne der Darwin’schen Selektion – menschliche Eigenschaften gäbe, die sich durch die Anpassung an Umweltfaktoren heraus gebildet hätten. Es gäbe also genetisch basierte individuelle Unterschiede, die für das Individuum einen Überlebensvorteil bedeuten. Durch die „Anwendung“ dieser Vorteile, hätte das Individuum Verstärkung erfahren und gelernt. Sein wesentlicher Beitrag war, dass er beweisen konnte, dass die Konsequenzen, die auf ein Verhalten folgen, dessen Auftrittswahrscheinlichkeit verändern können. Diesen Lernprozess nannte Skinner „Operante Konditionierung“. Danach unterscheidet er: a) die positive Verstärkung = Belohnung: auf das Verhalten folgt eine positive Verhaltenskonsequenz (z. B. Schokolade) oder der Wegfall einer negativen Verhaltenskonsequenz (z. B. Vermeidung von Flugzeugen bei Flugangst) und b) die negative Verstärkung = Bestrafung: durch hinzufügen eines negativ empfundenen Reizes (z. B. Schlag) oder durch Wegnahme eines positiven Reizes (z. B. Verlust an Freiheit). Skinner experimentierte viel mit Tieren. Wenn die Tiere in einer bestimmten Versuchsanordnung einen Hebel drückten, wurde sie mit Futter belohnt. Er konnte zeigen, dass das Verhalten sich veränderte, je nachdem wie sich die Belohnung veränderte. c) Intermittierende Verstärkung = ist die zufällige Gabe von Belohnung unabhängig vom Verhalten. Skinner konnte zeigen, dass Verhalten, das willkürlich belohnt wurde, am löschungsresistentesten ist. Bekam die Ratte auf ihr Verhalten einmal Belohnung und einmal nicht, dann führte sie das Verhalten besonders oft durch. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der des „Shapings“. Skinner formte die Verhaltensweisen seiner Labortiere, in dem er zuerst dem Zielverhalten ähnliche Verhaltensweisen verstärkte und sobald diese beherrscht wurden, stufenweise die Verstärkungen zurück nahm und nur mehr das eigentliche Zielverhalten verstärkte. Die Ratten und Tauben wurden zum richtigen Verhalten hingeführt (z. B.: Spracherwerb bei Kindern). Dollard und Millers Reiz-Reaktions-Modell (Stimulus-Responese-Modell = S-R-Modell) In diesem Modell besteht die Persönlichkeit eines Menschen hauptsächlich aus erlernten Gewohnheiten (den Begriff „Gewohnheit“ entliehen Dollard und Miller von Hull, einem weiteren amerikanischen Behavioristen). Allerdings gingen die beiden davon aus, dass ein Kind mit einem angeborenen Set an Trieben zur Welt kommt. Diese Triebe sicherten das Überleben des Organismus (Hunger, Durst, Schlaf, ...) und dienen als Verstärker. Die Verstärkung ist dabei umso wirkungsvoller, je unmittelbarer sie auf die Reaktion folgt. Doch Menschen hätten auch sekundäre Triebe. Sie werden erlernt um uns bei der Befriedigung der primären Triebe zu unterstützen. Sekundäre Triebe werden durch sekundäre Verstärker bekräftigt. Zum Beispiel: Geld (=sekundärer Verstärker) ermöglicht uns Essen zu kaufen, damit wir unseren Hunger (=primärer Trieb) befriedigen können. Dollard und Miller beschrieben vier Komponenten des Erlernens von Gewohnheiten: 1. Ursprünglicher Trieb (Hunger) 2. Hinweisreiz für die Handlung (Suche nach Restaurant, Supermarkt, ...) 3. Reaktion (Essen) 4. Verstärkung der Reaktion (sich gesättigt fühlen). Was wäre, wenn die Verstärkung aus bleibt, das Essen schlecht geschmeckt hat oder zu wenig war? Wahrscheinlich würde man nicht mehr in dieses Restaurant gehen, dieses Nahrungsmittel kaufen, … Übersetzt in die Modell-Sprache bedeutet dies, der Trieb wird nicht befriedigt (= frustriert), daher wird das Verhalten (mit dem man glaubte, den Trieb befriedigen zu können) gelöscht. Dollard und Miller beschrieben vier Möglichkeiten, wie Frust durch einen unbefriedigten Trieb entstehen kann. Vier Konflikttypen: 1. Annäherungs-Annäherungskonflikt: Zwei Ziele sind gleich wünschenswert, man kann aber nur eines der beiden realisieren (Eis essen schlank bleiben) 2. Vermeidungs-Vermeidungskonflikt: Beide Ziele sind gleich unerwünscht: z. B. das Studium fortsetzen (Eltern sind glücklich) Eltern enttäuschen und abbrechen (Sie sind glücklich) 3. Annäherungs-Vermeidungskonflikt: Das Ziel hat wünschenswerte und negative Aspekte: z. B. Sie finden einen Traumjob, allerdings im Ausland. 4. Doppelter Annäherungs-Vermeidungskonflikt: Das Ziel hat viele wünschenswerte und unerwünschte Aspekte: z. B. der neue Job ist inhaltlich toll, aber schlecht bezahlt, die Kollegen sind nett, der Chef ein Graus, der Weg ist weit, das Büro ist schön, … Unser Verhalten ist vom Wunsch der Triebreduktion gesteuert. Konsequenzen formen unser Verhalten. Obwohl dieses Modell sehr behavioristisch wirkt, bezieht es doch schon so etwas wie kognitive Faktoren mit ein. Die Behandlung einer Psychopathie würde bedeutet, ineffiziente Gewohnheiten durch effiziente zu ersetzen. Der Ablauf so einer Behandlung erfolgt in zwei Phasen: Der Gesprächs-Phase, in der die Gewohnheiten identifiziert und erkundet werden, und eine Trainings-Phase, in der die Klienten lernen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Laut Dollard und Miller müssen frühere emotionale Probleme in der Therapie nicht noch einmal durchlebt werden, um sie zu bewältigen. Vielmehr sei die Vergangenheit lediglich hilfreich dafür, Patienten das Verständnis ihrer Probleme zu erleichtern. Der Therapieschwerpunkt liegt also auf aktuellen Problemen im Leben und zukünftigen Strategien. Aufgenommen wurden diese Gedanken z.B. in dem sehr aktuellen und wissenschaftlich in seiner Wirksamkeit sehr gut belegten Ansatz zur Behandlung chronischer Depressionen namens CBASP. Unter dem schwer einzuprägenden Begriff „Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy” (CBASP) verbirgt sich eine der interessantesten Entwicklungen der kognitiven Verhaltenstherapie der letzten Jahre. (http://www.cbasp.awp-depression.de/CBASP/) Der Ansatz integriert in innovativer Weise behaviorale, kognitive, psychodynamische sowie interpersonelle Strategien. Das CBASP setzt direkt an der spezifischen Psychopathologie chronisch Depressiver an, worunter McCullough ein präoperatorisches Denken und eine Entkoppelung der Wahrnehmung des Betroffenen von seiner Umwelt versteht. Als Ziele werden daher 1) 2) 3) 4) das Erkennen der Konsequenzen des eigenen Verhaltens, der Erwerb von authentischer Empathie, das Erlernen von sozialen Problemlöse-Fertigkeiten und Bewältigungsstrategien und ein interpersoneller Heilungsprozess bzgl. früherer Traumata definiert. Die Schwerpunkte der CBASP-Therapie liegen zum einen in einer spezifischen Strategie, der Situationsanalyse und einem sich daran anschließenden Verhaltenstraining, zum anderen in interpersonellen Strategien zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Anhand der Situationsanalyse lernt der Patient eine kausale Beziehung zwischen seinen Verhaltens- und Denkmustern und den jeweiligen Konsequenzen herzustellen. Die interpersonellen Strategien ermöglichen eine auf die Bedürfnisse chronisch Depressiver adaptierte Rolle des Therapeuten. Dazu gehört, dem Patienten zu helfen zwischen altvertrauten disfunktionalen Beziehungsmustern und dem Verhalten des Therapeuten oder anderer Personen zu unterscheiden. Darüber hinaus wird der Therapeut angeleitet, sich in einer bewussten Weise ganz persönlich beim Patienten einzubringen, damit der Patient seine eigene destruktive Entwicklungsgeschichte erkennen und revidieren kann. Das CBASP beinhaltet 8 Merkmale, die es von anderen Formen der Psychotherapie unterscheidet: 1. Es ist das einzige Psychotherapieprogramm, das spezifisch für die Behandlung chronischer Depressionen entwickelt wurde. 2. Zum Stillstand gekommene Reifungsprozesse werden als ätiologische Basis für chronische Depressionen angesehen. 3. Das CBASP konzeptualisiert die Depression in Form einer „Person x Umwelt“-Perspektive und leitet die Patienten dazu an, zu berücksichtigen, was sie bei anderen auslösen. 4. Zu den Behandlungszielen gehört die Förderung der Fähigkeit, formale Operationen im Sinne Piagets zur Lösung sozialer Probleme einzusetzen und sich in sozialen Beziehungen empathisch aufgeschlossen zu verhalten. 5. Therapeuten werden ermutigt, sich auf ihre Patienten in einer kontrollierten Weise persönlich einzulassen, um damit deren Verhalten zu modifizieren und zu beeinflussen. 6. Übertragungsthemen werden konzeptualisiert, indem die Technik einer Hypothesengenerierung verfolgt wird und die Übertragungsprozesse während des Therapieprozesses proaktiv hinterfragt werden. 7. Eine Therapietechnik, die Situationsanalyse, dient dazu, die Psychopathologie des Patienten innerhalb der Therapiesitzung deutlicher hervortreten zu lassen, um dann gezielt daran zu arbeiten. 8. Negative Verstärkungsmethoden werden als wesentliche Motivationsstrategie genutzt, um Verhaltensänderungen zu ermöglichen. In den USA wird CBASP aufgrund des bereits erfolgten Wirksamkeitsnachweises große Bedeutung in der Behandlung chronisch depressiver Patienten zugeschrieben. Auch im deutschsprachigen Raum gewinnt diese spezifische integrative Therapie zunehmend an Aufmerksamkeit. Theorie des sozialen Lernens nach Albert Bandura (~1978) Bandura widmete sich der zentralen Frage, ob unsere Persönlichkeit mehr durch äußere oder innere (oder beide) Faktoren bestimmt ist. Bandura arbeitete mit Experimenten, legten aber besonders viel Wert darauf, dass sie so nahe wie möglich an reale Erfahrungen der Versuchspersonen heran kamen. Das Individuum ist ein aktives Wesen, das sowohl auf innere Reize als auch auf äußere Umweltfaktoren reagiert. Es bewegt sich in einem dynamischen System und hat selbst Einfluss auf seine Motivation, seine Entwicklung und sein Verhalten. Bandura nennt dies „reziproken Determinismus“. Das Individuum ist durch Personen-, Verhaltens- und Umweltfaktoren beeinflusst, alle drei Faktoren interagieren miteinander. Personenbezogene Faktoren: Enthalten die Kognitionen, Emotionen sowie biologische Variablen, die zum inneren Zustand des Individuums beitragen. Diese personenbezogenen Faktoren können sich auf das Verhalten und die Umwelt auswirken (z. B.: negative Gedanken über den Ausgang einer Prüfung haben Auswirkungen wie die Prüfung tatsächlich ausgeht. Die Kognition beeinflusst das Verhalten und die Umwelt). Verhaltensbezogene Faktoren: Können die Gefühle und Kognitionen eines Individuums beeinflussen (z. B.: Sie stellen sich einer neuen Situation, dem Präsentieren vor vielen Menschen. Ist Ihre Erfahrung positiv, dann verbuchen Sie sie unter „das kann ich gut, hat Spaß gemacht …“, Ihre Einstellungen gegenüber Präsentation wird sich ändern. Sind Ihre Erfahrungen negativ, dann werden Sie in Zukunft eventuell Angst davor haben und entweder solche Situationen meiden (=Verhalten) oder schlechter meistern (= Angst blockiert). Es bilden sich in allen drei Fällen Muster aus). Umweltfaktoren: Bestimmen unser Verhalten dahingehend, dass wir uns nach ihnen richten. So kann z. B. das Ozonloch uns dazu bewegen, weniger Sonnenbäder zu nehmen oder stärkere Sonnencreme zu kaufen, etc. Professoren, die auf Fragen der Studenten in einer demütigenden Art reagieren, werden unser Verhalten (z. B. keine Fragen mehr stellen), unser Gefühl diesbezüglich (Angst vor der Demütigung) und unser Denken über Erfolg von Fragen verändern. Bandura ist überzeugt, dass der Mensch einen eigenen Willen hat also nicht Spielball der biologischen Anlagen und Verstärkerplänen der Umwelt ist. Unsere kognitiven Prozesse erlauben uns Kontrolle über die Auswahl an Situationen, in denen wir uns bewegen, indem wir sie verändern oder verlassen können, wenn sie uns nicht zusagen (z. B.: Jobwechsel). Er nennt die Überzeugung, für sich etwas verändern zu können „Kompetenzerleben“. Später unterschied er noch zwischen „stellvertretenden Kompetenzerleben“, das Menschen auch andere um Hilfe bitten können (er sieht das aber nicht nur positiv, sondern auch negativ, im Sinne von jemand Macht über sein Leben geben) und dem „kollektiven Kompetenzerleben“, das den Zusammenschluss von Menschen zur Verbesserung ihrer Situation bezeichnet. Banduras Lernmodell: Damit Lernprozesse effektiv sind, muss sich das Individuum der Konsequenzen seines Handelns bewusst werden. Wir nehmen „alte Erfahrungen“ und projizieren sie in die Zukunft, wir denken voraus. Bewusstwerdung der Konsequenzen und Vorausdenken sind genuin menschliche Fähigkeiten (es wird uns möglich durch die Verfügbarkeit von Sprache und abstraktem Denken). Modelllernen meint das Lernen durch Nachahmung (auch stellvertretendes Lernen, Imitationslernen, soziales Lernen, ...) Es tritt öfter auf, als Lernen durch Konditionierung. Den Vorgang des Modelllernens nennt Bandura „Modellierung“. Bei der Modellierung spielen kognitive Prozesse eine große Rolle. Experiment mit der Puppe „Bobo“: Bobo ist eine Affenpuppe. Kinder wurden in zwei Versuchsgruppen und eine Kontrollgruppe geteilt. Die zwei Versuchsgruppen sahen a) wie ein Erwachsener die Puppe Bobo misshandelte, b) einen Film mit aggressivem Inhalt. Die Kontrollgruppe c) sah nichts davon. Dann durften die Kinder mit der Puppe spielen. Die beiden Versuchsgruppenkinder zeigten deutlich mehr aggressives Verhalten. Daraus schloss Bandura, dass für das Modelllernen drei Faktoren wichtig sind: 1. Modelleigenschaften (diese entscheiden, ob wir das Modell nachahmen wollen. Je ähnlicher ein Modell uns ist, desto eher werden wir es imitieren. Das nach-zuahmende Verhalten wird umso eher imitiert, je einfacher die Verhaltensweise ist) 2. Beobachtereigenschaften (Menschen mit geringem Selbstwert und solche, die sich überfordert fühlen, ahmen Verhalten weniger nach. Menschen, die für konformes Verhalten belohnt wurden und die einen hohen Grad an Abhängigkeit zeigen, imitieren eher) 3. Konsequenzen der Modellierung (wenn das Individuum glaubt, dass die Nachahmung positive Konsequenzen nach sich zieht, steigt die Wahrscheinlichkeit der Imitation) Bandura betont, das Modelllernen mehr als Imitation ist. Es ist ein aktiver Lernprozess durch Beobachtung, in dem der Beobachter Urteile und symbolische Repräsentationen der beobachteten Verhaltensweisen bildet. Diese symbolischen Repräsentationen können in verbalen Beschreibungen und Vorstellungsbildern bestehen, und sie werden dazu herangezogen, das zukünftige Verhalten des Individuums in ähnlichen Situationen anzuleiten. Der Beobachter unterzieht das Gelernte einer Prüfung und verwirft Teile des Verhaltens, wenn dieses für ihn unbrauchbar ist. Weiter unterscheidet der Beobachter zwischen dem Gelernten (= in der Aneignungsphase erworbenes Wissen) und der Ausführung. Die Ausführung ist ein Prozess mit Versuch und Irrtum in dem das Verhalten weiter geformt wird. Selbstverstärkung: Wir bewerten unser Verhalten und verwerfen Dinge, die für uns nicht „gewinnbringend“ sind (d.h. die uns kein Vergnügen bereiten). Lernmotivation: Wichtig für das Lernen ist der Anreiz dazu. Indem wir vorausdenken, können wir Belohnungen antizipieren. Die Antizipation der Belohnung mündet in der Motivation zu lernen. Motivation und Verstärkung bilden hochkomplexe dynamische Prozesse. Persönlichkeitsentwicklung in der Theorie Banduras: Bei der Entwicklung eines Kindes spielen soziale Lernprozesse eine vorherrschende Rolle. Eltern, Freunde, Geschwister, Teletubbies, etc. bilden Rollenmodelle, von denen sich das Kind durch Beobachtung und Belohnung Verhaltensweisen aneignet. Die jeweilige Kultur stellt ebenfalls ein bestimmtes Set an Rollenbilder zur Verfügung. Die Identifikation von Zielen sowie die Rückmeldung/Belohnung durch die Umwelt sind wichtige Bestandteile des Lernens. Die Erreichung von Zielen hängt von selbstregulatorischen Prozessen ab. Diese enthalten Selbstkritik, Selbstlob, Bewertung eigener Standards, Neubewertung eigener Standards, Selbstüberzeugung, Bewertung eigener Leistungen, Akzeptanz von Veränderungen. Das alles mündete in Banduras Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwirksamkeitserwartung ist hier definiert als „Überzeugung, aufgrund eigener Fähigkeiten mittels bestimmter Handlungen zu einem gewünschten positiven Ergebnis“ zu gelangen (Maltby 2011). Die Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung ist aktuell. Sie fließt z. B. in die Erforschung von Gesundheitsverhalten (z. B.: Warum gelingt manchen Menschen der Nikotinentzug, warum anderen nicht?) ein. Bandura (1997) konnte zeigen, dass eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung die Erfolgschance signifikant verbessert. Die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst nicht nur, a) ob eine Aufgabe überhaupt in Angriff genommen wird, sondern auch b) wie viel Energie und Anstrengung in die Zielerreichung gesteckt wird (z. B. korreliert eine niedere Selbstwirksamkeitserwartung mit einer hohen Rückfallsrate bei der Rauchentwöhnung). Giles, Turk & Fresco (2006) Fanden heraus, dass Studenten, die in sozialen Situation mehr Alkohol konsumierten, eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf das Vermeiden von Alkohol haben. Sie glaubten nicht, dass sie solche Situationen ohne Alkohol schaffen würden und sie zeigten die Überzeugung, dass Alkohol solche (angstauslösenden) sozialen Situationen erleichtern würde. Halkitis, Kutnik und Slater (2005) Fanden heraus, dass Männer sich mehr an die Vorgaben der antiretroviralen HIV-Therapie hielten, wenn ihre Selbstwirksamkeitserwartung hoch war. Selbstwirksamkeit ist also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in einer Sache erfolgreich sein zu können. Bandura (1997) hat sich auch damit beschäftigt, wie man die Selbstwirksamkeitserwartung steigern kann (Psychotherapie, Sportpsychologie): Der erste Schritt beim Aufbau der Selbstwirksamkeitserwartung ist, dass man sich überhaupt einer Aufgabe stellt (mit Unterstützung). Dann wird sukzessive am Aufbau weitergearbeitet, wobei weitere selbstregulatorische Prozesse mit einbezogen werden. („Der Begriff „Selbstregulation“ bezeichnet auf Selbstreflexion beruhende Fähigkeiten, die notwendig sind, eigene Gedanken, Gefühle, Motive und Handlungen zielgerichtet zu beeinflussen.“ Wikipedia, 2014) Auch stellvertretende Erfahrung hat Auswirkungen: Wenn ein Individuum jemanden beobachtet, der sich erfolgreich einer Situation stellt, die sowohl dem Beobachter, als auch dem Beobachteten Angst macht, dann hat das positive Effekte dahingehend, dass dieses Individuum sich danach eher zutraut, die Situation selbst erfolgreich zu meistern. Das Beobachten des Erfolges hat positive Effekte auf die Kognitionen, sie werden positiver („Wenn derjenige es schafft, dann schaffe ich es auch!“). „Teilnehmende Modellierung“: Ist eine Art „Mentaltraining“. Dabei ahmt eine Person eine andere, erfolgreiche Person in der Phantasie nach. Dieses Mentaltraining hat positive Effekte auf die später Ausführung und die Selbstwirksamkeitserwartung. Z. B. Prüfungsangst: Beobachten, wie sich andere auf Prüfungen vorbereiten. Eventuell das Gespräch mit erfolgreichen Studenten suchen, um zu lernen, wie diese sich vorbereiten, sich mit mutigeren Studenten zusammen tun und Schritt für Schritt mit verfolgen, was sie tun. Über (Selbst-)Reflexion können dann eigene Ängste abgebaut werden, die Aufgabe scheint bewältigbar. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und eine gute Selbstregulation wirken positiv auf die Motivation. Man lässt sich dann auch nicht von Rückschlägen so leicht beeinflussen. (Resilienz: Widerstandskraft, Unbeirrbarkeit, wichtiges Schlagwort der Gegenwart. Resilienz als gesunderhaltender, salutogener Faktor ist immer mehr im Fokus der Arbeitspsychologie.) Benight und Bandura (2004) veröffentlichten eine Studie zu Selbstwirksamkeitserwartung bei der Bewältigung von Traumata (Naturkatastrophen, Kriegstraumata, terroristische Angriffe, Verlust des Lebenspartners) Teilnehmer dieser Studien mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung zeigten eine durchgängig bessere Genesung von diesen Traumata. Messung der Selbstwirksamkeitserwartung: Es gibt verschiedene Tests zur Messung der Selbstwirksamkeitserwartung, zum Beispiel: die General Self-Efficiancy Scale (Sherer et al. 1982) Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (Schwarzer & Jerusalem 1999) Etc. Bandura selbst sieht die Messung mittels Tests skeptisch. Er ist überzeugt davon, dass wir Menschen in unterschiedlichen Situationen uns unterschiedlich selbstwirksam fühlen. Daher kann eine generelle Selbstwirksamkeit nicht gemessen werden, sondern immer nur die aktuelle, aufgabengezogene. Bandura (2006) schlägt vor, für jeden Lebensbereich eine eigene Skala zu entwickeln z. B. Skala zur Messung der Selbstwirksamkeit von Kindern, von Lehrern, von Eltern, … Darin enthalten sind Items wie: 1. Wenn ich eine Aufgabe nicht sofort bewältigen kann, dann probiere ich es so lange, bis ich es schaffe. 2. Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen. 3. Ich werde die allermeisten der Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, erreichen. Julian Rotter (1966) und das Konzept der Kontrollüberzeugung Rotter wollte ursprünglich Verfahren entwickeln, mit denen sich Verhalten vorhersagen lässt. Rotter erforschte das Verhaltenspotenzial, die Wahrscheinlichkeit mit der ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation auftritt. Z. B.: Wir schreiben das Jahr 1750: Jemand beleidigt Sie. Sie haben verschiedene Verhaltensmöglichkeiten (weggehen, zurück beleidigen, höflich Grenzen setzten, Duell, …). Das Verhalten, das Sie wählen, ist das mit dem höchsten Verhaltenspotenzial in dieser Situation. Rotter wollte diese Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten x in Situation y auftritt, berechnen und stellte folgende Formel auf: Verhaltenspotenzial = Verstärkungswert X Erwartung Die Erwartung ist unsere subjektive Einschätzung, wie sich ein bestimmtes Verhalten auswirken wird. (Zum Beispiel: Sie reagieren auf die Beleidigung in dem Sie die Zurücknahme fordern. Sie glauben, dass Sie ihrem Gegner im Duell überlegen sind und rechnen sich gute Chancen auf Erfolg aus.) Diese Einschätzung beruht auf Erfahrungen in ähnlichen Situationen (am Schießplatz, in anderen Duellen, …) Das bedeutet, unser Verhalten wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals positiv verstärkt (wir haben überlebt, den Gegner besiegt). Mit jeder Option, die Sie als Antwort auf die „Beleidigung“ haben, sind andere Konsequenzen verknüpft (nicht reagieren > Schande, nicht siegen > schwere Verletzung, Tod, Sieg > Anerkennung im Adelskreis, …). Die Konsequenz nennt Rotter Verstärkungswert. Der Verstärkungswert beschreibt die persönliche Präferenz bezüglich der verfügbaren möglichen Verstärker (Ansehen ist wichtiger als Überleben). Zum Beispiel Beleidigung: Verhaltensoption: Mögliche Folge: Ignorieren: Einschätzung Verstärkungswert Verhaltenspotenzial der Erwartung der Folge für das (Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Individuum: des Eintreffens der Folgen: betreffenden Option): Meine Ehre ist hoch (d. h. verletzt, ich Konsequenz verliere mein trifft sicher ein) Ansehen niedrig (ist eine niedrig sehr unangenehme Konsequenz) Um Satisfaktion Ansehen im Adel hoch bitten: ist hoch, guter Ruf hoch hoch Mit reagieren: niedrig niedrig Spott Ansehen im Adel hoch ist schlecht, ich bin ein Feigling In neuen Situationen, in denen wir noch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, greifen wir auf Rotters allgemeine Erwartung zurück. Diese unterteilt sich in interne und externe Kontrollüberzeugung. Personen, die überzeugt davon sind, dass zwischen den Konsequenzen ihres Handelns und der Handlung selbst eine Beziehung besteht, sprich sie selbst dafür verantwortlich sind, nennt Rotter internalisierende Typen. Sie besitzen eine interne Kontrollüberzeugung. Externalisierende Typen erleben die Konsequenzen auf ihre Handlungen als von außen gesteuert, z. B. zufallsbedingt, glück-bedingt, weil mich der Lehrer mag, etc. Sie haben eine externe Kontrollüberzeugung. Rotter konnte zeigen, dass die Kontrollüberzeugung eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft ist und entwickelte eine Skala zu ihrer Messung (Internalitäts-Externalitäts-Skala, kurz „I-E-Skala“). Der Proband muss zwischen zwei Alternativen wählen. Beispiele für Items: Item 2: Das eigene Missgeschick ist immer die Folge eigener Fehler (interne Kontrollüberzeugung) Wenn jemand etwas Schlimmes passiert ist der Grund dafür meistens einfach nur Pech (externe Kontrollüberzeugung) Item 9: Es war immer besser für mich, meine Interessen zielstrebig zu verfolgen, anstatt mich einfach treiben zu lassen (interne Kontrollüberzeugung) Ich habe oft festgestellt, dass viele Dinge einfach passieren, weil sie vorherbestimmt sind (externe Kontrollüberzeugung) Item 29: Ich kann mein Schicksal selbst gestalten (interne Kontrollüberzeugung) Manchmal glaub ich, dass ich keine Einfluss darauf habe, wie mein Leben sich entwickelt (externe Kontrollüberzeugung) Im Laufe des Lebens entwickeln Menschen eine höhere interne Kontrollüberzeugung (Kinder haben meist eine Geringere). Externe Kontrollüberzeugung korreliert mit Angst, Depression, suizidalem Verhalten, des Weiteren korreliert sie mit einem eher passiven Patiententypus, mit niedrigeren Bildungsabschlüssen und mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit des Arbeitsplatzwechsels bei Unzufriedenheit. Die Kausalattribution (= „Zuschreibung“) von Misserfolg auf externe Faktoren kann auch als Schutz des Selbstwerts interpretiert werden. (Andermann und Midgley, 1997) Walter Mischels (1968) sozial-kognitiver Ansatz Hat Wesentliches zur Erforschung der Persönlichkeit beigetragen, in dem er die Stabilität von Persönlichkeitsfaktoren über Situationen hinweg hinterfragte. Er leitete damit die Person-Situations-Debatte ein (auch bekannt als „Konsistenzparadoxon“) Mischel wollte wissen, ob personenbezogene oder situationsbezogene Faktoren für das beobachtete Verhalten verantwortlich sind. Ausgangspunkt seiner Überlegungen: Studie von Newcombe (1929) Beobachtete 51 Jungen in einem Ferienlager, die zuvor auf Introversion / Extraversion getestet wurden. Die Übereinstimmung zwischen Beobachtungen und Testergebnis lagen bei 0,14 (unter 10%!) Mischel untersuchte in der Folge (1968) die Korrelationen zwischen den, durch Selbstbeurteilung erhobenen Persönlichkeitseigenschaften und dem tatsächlich beobachteten Verhalten und stellte fest, dass diese zwischen 0,2 und 0,3 liegen. Das bedeutet, dass weniger als 10 % des beobachteten Verhaltens durch Persönlichkeitseigenschaften erklärt werden können. Diese Korrelationen nannte Mischel „Persönlichkeitskoeffizient“. In der Folge fand man heraus, dass die Kenntnis von Persönlichkeitseigenschaften und Situationseigenschaften die Vorhersage von Verhalten viel treffsicherer machte, als wenn man nur eine der beiden kannte. (Allerdings ist es nicht möglich wirklich alle Situationseigenschaften zu kennen!) Diese Ergebnisse führten dazu, dass die Persönlichkeitsforschung zurück ging und die Sozialpsychologie Aufwind erhielt, da diese den Blick mehr auf Zwischenmenschliches und Situationen legte, als auf das Individuum. Mischel versuchte auf seine Weise, die Lücke zu schließen. Er betonte jene psychologischen Prozesse, die Aufschluss darüber geben können, wie Individuen die Welt interpretieren und wie bestimmte Situationen das jeweilige, für die Person charakteristische Verhalten hervorrufen. Mischel dokumentierte damit als erster, dass es spezifische, sehr individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung von Situationen gibt und begab sich auf die Suche nach den zugrunde liegenden Strukturen. Er entwickelte ein dynamisches Modell der Persönlichkeit, das relevante Entwicklungen auf den Gebieten der Kognitionswissenschaft und Genetik mit einbezog. Dieses Modell ging über die bloße Beschreibung der Persönlichkeit hinaus und lieferte Informationen darüber, wie der individuelle Geist funktioniert und die Persönlichkeit organisiert ist. Mentale und emotionale Prozesse sind ein entscheidender Bestandteil seines Persönlichkeitsmodells. Die für eine Person charakteristischen Verhaltensweisen nennt Mischel „Verhaltenssignatur“. Die wichtigste Weiterentwicklung ist, dass für Mischel Kognitionen, Erinnerungen, Gedanken, Wahrnehmungsprozesse, genetische Einflüsse, regulatorische Systeme eine Rolle bei der Entstehung individueller Unterschiede spielen. Es fand also eine Weiterentwicklung des radikalen Behaviorismus statt. Er wurde offener für andere Konzepte. Kognitive Persönlichkeitstheorien: Bei den kognitiven Persönlichkeitstheorien spielt das Individuum eine aktive und kreative Rolle bei der Gestaltung der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Verhaltens. Die Art und Weise, wie Menschen ihre Umgebung interpretieren, wird als zentraler Bestandteil ihrer Menschlichkeit betrachtet. Wogegen die Art, auf die sich Menschen dabei voneinander unterscheiden, als zentraler Bestandteil ihrer Individualität gesehen wird. Obwohl sich Philosophen immer schon mit der Natur des menschlichen Geistes beschäftigten, fand dieses Gedankengut erst nachdem Charles Darwin die Evolutionstheorie begründet hatte, in der Psychologie Anwendung. Der Geist ist biologisch (und nicht von Gott geschaffen)! Damit wandten sich die Wissenschaftler der Entwicklung des Geistes und des Denkens über die Lebensspanne, der Einflussfaktoren von Kultur und dem Vergleich von Menschen und ihren Fähigkeiten zu. Für die kognitive Wende im Denken gibt es mehrere Wurzeln. Die Gestaltpsychologie – eine Bewegung, die um 1900 in Deutschland ihren Anfang fand und ca. 30 Jahre später in Amerika den Durchbruch hatte - formulierte drei Grundsätze des Wahrnehmens: (1) die Menschen suchen in ihrer Umgebung eine Bedeutung, (2) wir bauen aus den Empfindungen, die wir aus unserer Umgebung erhalten, bedeutungsvolle Wahrnehmungen auf, (3) komplexe Stimuli können nicht auf die Summe ihrer Teile reduziert werden (1+1 = 3). „Gestalt“ bedeutet in diesem Zusammenhang Muster oder Struktur. Diese Gestalt macht das Wesen eines Reizes aus (nicht die nackten physikalischen Gegebenheiten). Es ist nicht möglich die Bestandteile eines Reizes zusammen zu bauen um das Original zu erhalten. Das Wesen des Originals besteht in komplexen Beziehungen und in seiner Gesamtstruktur, die verloren gehen, wenn die einzelnen Komponenten getrennt voneinander analysiert werden. Dieses ist ein klassisches Beispiel für die Gestalttheorie. Wir sehen ein weißes Dreieck, obwohl es „eigentlich“ nicht da ist. Es wird durch den Betrachter „konstruiert“. Die Gestalttheorie postuliert, dass die Wahrnehmung die Suche nach einer Bedeutung umfasst und dass diese Bedeutung eine Eigenschaft sein kann, die sich aus den Elementen entwickelt, aber in keinem der einzelnen Elemente erscheint. In diesem Beispiel „entwickelt“ sich das von den meisten Menschen wahrgenommene Dreieck aus der Anordnung unvollständiger Kreise, sowie eines unvollständigen, auf den Kopf stehenden Dreiecks. Es existiert nur im Geist des Wahrnehmers, aber nicht im Bild selbst. Der Gestaltansatz und Kurt Lewins Feldtheorie haben die Persönlichkeitsforschung sehr beeinflusst. Lewins Feldtheorie Lewin formulierte seine Feldtheorie 1935. Als „Feld“ bezeichnete er sowohl ein Feld im Sinne von Vektorkräften als auch ein „Spielfeld“ (= soziales Feld). (Mit seiner Theorie gilt Lewin als Begründer der Gruppendynamik. Die Gruppe besteht aus einem Kräftefeld, das sich aus den Interaktionen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern erkennen lässt.) Dieses soziale Spielfeld wird durch innere und äußere Kräfte definiert, die auf das Individuum einwirken und den strukturellen Beziehungen zwischen Individuum und Umwelt. Dabei stellte Lewin fest, dass bei manchen Menschen die verschiedenen „Bereiche“ mehr getrennt sind, als bei anderen (engl. „border“: Grenze). Bei manchen Menschen sind diese Bereich offener. Feldabhängigkeit – eine stabile Persönlichkeitseigenschaft von Menschen – beschreibt einen kognitiven Stil des Umgangs mit Wahrnehmung, Problemlösung und Entscheidungsfindung. Kognitive Stile bezeichnen den Unterschied, ob Menschen z. B. eher auf Farben oder Formen reagieren, ob sie im Allgemeinen aufmerksam oder unaufmerksam sind, ob sie analytisch oder synthetisch vorgehen, ob sie bewerten oder nicht bewerten und ob für sie die Welt komplex oder einfach ist. Feldabhängigkeit ist eine solche Variable des kognitiven Stils. Man erkennt Feldabhängigkeit dadurch, ob eine Person sich bei Problemlösungen mehr von Umweltreizen (= Aspekte des Kontexts, des Feldes) oder von inneren Maßstäben leiten lässt. Lewin nimmt also an, dass das Verhalten V eine Funktion der Person P und der Umwelt U darstellt: und dass P und U in dieser Formel wechselseitig abhängige Größen sind. Die Feldabhängigkeit kann in verschiedenen Tests gemessen werden, z. B. wenn man Menschen bittet, einen Stab so zu positionieren, dass er vollkommen senkrecht ist. Stab-Rahmen- Test Ist eine von H. A. Witkin entwickelte Raumorientierungsaufgabe, Verfahren zur Messung von “feldabhängigen” bzw. “feldunabhängigen” kognitiven Stilen (Feldabhängigkeit). In einem abgedunkelten Raum erscheinen an der Wand ein erleuchteter rechteckiger Rahmen mit einem Stab darin, beide schief hängend. Die Versuchsperson sitzt auf einem Stuhl, der ebenfalls – in Relation zum Fußboden – in die schiefe Ebene geneigt ist und außerdem eine eigene Fußleiste hat, so dass die Versuchsperson keinen Kontakt zum Fußboden hat. Die Aufgabe besteht darin, den Stab in eine senkrechte Position zum Fußboden zu bringen. Wer dies relativ mühelos schafft, gilt als “feldunabhängig”. Ausschlaggebend dafür ist die propriozeptive Wahrnehmung, d.h. die Orientierung an Impulsen aus dem Körperinneren. Menschen sind normal nicht nur feldabhängig oder feldunabhängig, sondern bewegen sich auf einem Kontinuum zwischen diesen Extremen. Der feldunabhängige Stil ist analytischer und gestattet bei der Problemlösung komplexere Ebenen der Umstrukturierung. Diese Menschen werden in ihrem Verhalten stärker durch internalisierte Aspekte der Problemlösungssituation beeinflusst. Feldabhängige Personen weisen andererseits eine größere Sensibilität gegenüber dem Kontext eines Problems auf und tendieren dazu, bei der Problemlösung holistischer und intuitiver vorzugehen. Darüber hinaus weisen feldabhängige Menschen auch eine größere Sensibilität gegenüber sozialen und zwischenmenschlichen Kontexten auf. Beispiele der Persönlichkeitsforschung: Feldunabhängige Personen bevorzugen technische Berufe, als Kind bevorzugen sie das Spielen alleine, sie sind von Autoritäten unabhängiger, sitzen weiter von ihren Gesprächspartnern entfernt und halten weniger häufig und lange Blickkontakt. Weiter Einflüsse der kognitiven Wissenschaft auf die Persönlichkeitsforschung sind z. B. Untersuchungen der Auswirkungen der Hemisphärendominanz. Kognitive Komplexität ist eine weitere Variable des kognitiven Stils und beschreibt die Fähigkeit eines Menschen mit einer großen Anzahl an Unterschieden bzw. einzelne Elementen umzugehen, bzw. sie zu verstehen, zu nutzen, mit den Beziehungen dieser Elemente umzugehen, diese Beziehungen aufzufinden, .... Menschen mit einer niederen kognitiven Komplexität sehen die Welt in absoluten und einfachen Begriffen und bevorzugen klare und unmissverständliche Lösungen. Sie suchen Sicherheit. Menschen mit einer hohen kognitiven Komplexität können mit großen Unsicherheiten umgehen. Ein weiteres Merkmal der menschlichen Informationsverarbeitung ist das der Kategorisierung: Wir organisieren unsere Erfahrungen automatisch. So können wir z. B. Stimmungen an anderen Menschen wahrnehmen ohne wirklich erklären zu können, was wir wahrgenommen haben (z. B. einzelne Muskelbewegungen im Gesicht, Körperhaltung, Stimme, ...). Kategorisierung ist ein müheloser, automatischer und unbewusster Prozess. Jede Person hat ein eigenes Muster an Kategorien. Kategorien liefern Erwartungen und Interpretationen (= professionelle Kategorien in der Psychotherapie), sie ermöglichen uns eine effiziente Informationsverarbeiten. Gleichzeitig führen sie aber auch zu voreiligen Beurteilungen (= Stereotypien und Vorurteile). Bei lückenhafter Information ergänzen wir die Fehlenden durch die in der dazugehörigen Kategorie befindlichen. Wir bemerken und merken uns Informationen bessern, die den Kategorien entsprechen. Das bedeutet, jene Ereignisse, die unser Weltbild bestätigen, fallen uns auch mehr auf! Zwei Theorien: 1. George A. Kelly´s Theorie der persönlichen Konstrukte 2. Albert Ellis rational-emotive Verhaltenstheorie Ad 1) George A. Kelly´s Theorie der persönlichen Konstrukte (1955) George A. Kelly´s Theorie der persönlichen Konstrukte berücksichtigt sowohl innere Prozesse als auch die Umwelt, in der wir uns bewegen. Dazu kommen motivationale Prozesse, die für Kelly die wichtigste Rolle, wichtiger noch als unsere vergangenen Lernerfahrungen, spielen. Kognitive Persönlichkeitstheorien betonen das Potenzial zu Kreativität und Veränderungen im Verhalten, kurz: so wie Sie die Welt sehen, sind Sie. Kelly´s Sicht auf das Individuum unterscheidet sich grundlegend von seinen Vorgängern. Er betrachtete den Menschen als Wissenschaftler, der seine Umwelt zu verstehen und zu kontrollieren versucht, wobei er jedoch – anders als echte Wissenschaftler – sehr subjektiv vorgeht. Er gewinnt Informationen durch Interpretation. Kelly lehnt die Existenz einer von allen geteilten objektiven Wirklichkeit ab. (Damit ist er ein Visionär => Diese Sichtweise wurde später von den Konstruktivisten und Systemikern weiter entwickelt.) Nach Kelly – dem Konstruktivisten erster Stunde – konstruieren wir Hypothese, um Erklärungen für unsere Beobachtungen zu finden, und dann prüfen wir diese Hypothesen und ändern sie gegebenenfalls, wenn dies nötig ist, um sinnhafte Erklärungen für unsere Beobachtungen zu finden. Dabei gehen wir stets davon aus, dass unsere eigene Wahrnehmung die einzig wahre und richtige ist. Unsere Hypothesen sind meist privater Natur. Wir tauschen uns selten darüber aus (und wenn doch, merken wir erst, wie unterschiedlich wir die Welt sehen). Ein Beispiel (aus Maltby, 2011, S. 200): Freunde mieten ein Haus, wer bekommt das größte Zimmer? Jeder bringt Argumente, wie eine faire Aufteilung passieren könnte. Jeder aus der Gruppe ist überzeugt davon, dass sein Argument das richtige ist. (Um zu argumentieren wählt (= bewertet) man bestimmte wichtige Aspekte einer Situation aus. Diese Aspekte sind persönliche Konstrukte. Persönliche Konstrukte sind Kriterien, die wir benutzen, um Ereignisse auf eine bestimmte Weise wahrzunehmen, zu bewerten, vorherzusagen und zu interpretieren. Laut Kelly erstellen wir so eine Sicht der Welt und verhalten uns so, dass es für uns in dieser konstruierten Welt Sinn macht. Bei Konstrukten kann man Übergeordnete und Untergeordnete unterscheiden. Z. B.: Sie lernen jemanden kennen. Die erste Einschätzung ist freundlich/unfreundlich. Dies ist ein übergeordnetes Konstrukt, denn darunter befinden sich weitere Konstrukte (die individuell, inhaltlich – je nach Interessen und Geschmack – und in Anzahl unterschiedlich sind. So werden Psychologen/Therapeuten mehr Konstrukte haben, die sich auf die Beschreibung von Menschen beziehen, als Menschen ohne dementsprechenden, psychologischen Wissen). Da die mögliche Anzahl an Konstrukten schier unendlich ist, bilden wir Menschen Strukturen aus, die es uns ermöglichen die Komplexität der Welt zu reduzieren. Das individuelle Konstruktsystem strebt z. B. nach Widerspruchsfreiheit. (Darum ändern sich in Therapie die Konstrukte oft nur langsam, weil unser inneres Konstruktsystem ins sich schlüssig ist und die Veränderung eines Teils, das Konstruktgebäude wackeln lässt. Z. B.: Ändere ich das innere Konstrukt von „ich bin nicht liebenswert“ zu „ich bin liebenswert“, müssen alle Misserfolgserlebnisse neu bewertet werden.) Je nachdem wie wir unsere persönlichen Konstrukte einsetzen, werden wir uns verhalten. Nach Kelly erklären sich so die Verhaltensunterschiede zwischen uns Menschen. Gleichzeitig ermöglicht dieser Prozess Kreativität im Verhalten, da wir jederzeit alternative Interpretationen vornehmen können. Die wichtigste Aussage ist: Wir können unser Verhalten ändern. Die Tatsache, dass jeder Mensch die Welt auf völlig unterschiedliche Art wahrnimmt und dass es keine objektive Realität gibt, ist ein zentraler Aspekt von Kelly´s Theorie und wird von ihm „konstruktiver Alternativismus“ bezeichnet. Kelly ist überzeugt davon, dass der Mensch einen freien Willen hat, dennoch werden unsere Gedanken und Verhaltensweisen zeitweise von Situationen oder anderen Menschen beeinflusst. Es gibt eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen freiem Willen und Determinismus. Menschen sind zukunftsorientierte Wesen. Wir haben Ziele und wir benützen unsere persönlichen Konstrukte um diese Ziele zu erreichen (um Entscheidungen zu treffen, die der Zielerreichung nützen). Wenn unsere Strategie nicht erfolgreich ist, verändern wir die Interpretation der Ereignisse und die dazugehörigen Konstrukte. Der Mensch hat die Fähigkeit zur Antizipation = Kellys fundamentales Postulat: „Die Prozesse einer Person werden psychologisch durch die Art, wie diese Person Ereignissen entgegensieht, kanalisiert“. Unsere Handlungsmotivation entstammt der Orientierung hin zu zukünftigen Zielen (nicht früheren Lernprozessen aus der Kindheit). Unsere persönlichen Konstrukte organisieren wir hinsichtlich Ähnlichkeit und Gegensatz. Ein Konstrukt besteht aus mindestens drei Elementen, von denen sich zwei auf eine Ähnlichkeit beziehen und das dritte auf das Gegenteil, den Kontrast. Z. B.: Wenn ich sage, Sara und Peter sind extravertiert, dann muss ich auch jemanden kennen, der introvertiert ist (also den Kontrast bildet). (Wenn etwas A ist, kann es nicht X sein). Kelly formuliert 11 Korollarien (= Folgesätze), die beschreiben, wie interpretative Prozesse uns die Bildung von Konstrukten ermöglichen. Konstruktionskorollarium: Wir konstruieren unsere Antizipationen mit Hilfe vergangener Erfahrungen. Wir erwarten, dass die Dinge so passieren, wie sie in der Vergangenheit passiert sind (von der Theorie zur Hypothese, vom Konstrukt zur Antizipation). Erfahrungskorollarium: Wenn die Dinge nicht so sind, wie in der Vergangenheit, dann müssen wir Anpassungen vornehmen – rekonstruieren. Diese Rekonstruktion verändert unsere Antizipation: Wir lernen. Dichotomiekorollarium: Wir speichern Erfahrungen in Form von persönlichen (=subjektiven), dichotomen Konstrukten (~Schablonen). Z. B. wenn ich an dünne Menschen denke, muss ich „dick“ kennen. Ordnungskorollarium: Konstrukte sind voneinander abhängig. Sie befinden sich in Beziehungen der Über- und Unterordnung. Konstellationen bezeichnen „Stapel“ von Konstrukten, also Konstrukte auf einer Hierarchieebene (Bäume: Nadelbäume – Laubbäume: Eiche, Ahorn, Linde, …). Wenn wir kreativ sind, dann lockern sich unsere Konstrukte, wir produzieren alternative Konstrukte. Korollarium der Reichweite: Es gibt allgemeinere und speziellere Konstrukte. Gut / schlecht ist ein sehr allgemeines Konstrukt und kann auf fast alles angewendet werden. Genderkonstrukte sind z. B. nur auf Menschen anwendbar. Modulationskorollarium: Einige Konstrukte sind elastischer als andere, sie modulieren, sie sind für Erweiterungen offener als andere. Auswahlkorollarium: Menschen wählen die Alternative, die ihr Verständnis von der Welt vergrößert und persönliches Wachstum bewirkt. Individualitätskorollarium: Da jeder unterschiedliche Erfahrungen hat, ist auch die Konstruktion von Realität unterschiedlich (=> Repertoir-Test). Gemeinschaftskorollarium: Wir haben ähnliche Konstrukte, zeigen dennoch unterschiedliches Verhalten. Je mehr gemeinsame Ansichten wir haben (Konstrukte), desto eher werden wir ähnliche Verhaltensweisen zeigen. (z. B.: Meinung innerhalb einer Kultur zum Umgang mit Frauen). Fragmentierungskorollarium: Wir können in ihrem Verhalten inkonsistent sein. Für die Wahrheit eintreten und trotzdem die Steuer betrügen. Geselligkeitskorollarium: Hilft den Prozess der sozialen Interaktion zu verstehen: wir haben ein Wissen über die das Konstruktsystem einer Person, das uns hilft, ihr Verhalten vorherzusagen und dadurch befriedigenden Interaktionen aufzubauen. Konstrukte des Übergangs: Kelly nannte Emotionen (Affekte, Gefühle) „Konstrukte des Übergangs“. Weil es sich um Erfahrungen handelt, die wir machen, wenn wir die Welt oder uns selbst oder andere nicht mehr auf eine bestimmte Weise betrachten. Wenn Konstrukte nicht gut funktionieren, empfinde Sie Angst. (Das kann alles Mögliche sein: Konto überzogen, Sie haben sich verlaufen, ...) Angst ist die Erwartung / Antizipation von großen Veränderungen unserer Konstrukte. Sie ist eine Bedrohung. Wenn Sie Dinge tun, die nicht im Einklang mit Ihren Konstrukten sind, empfinden Sie Schuldgefühle, wenn Sie darauf beharren, dass ihre Konstrukte gültig sind, kann daraus Feindseligkeit entstehen, etc… => psychische Krankheit wäre somit der Versuch ein Konstrukt beizubehalten, obwohl es nicht (mehr) gültig ist. Persönlichkeitsentwicklung nach Kelly: Ziel ist, das Wissen um die Welt zu maximieren. Der Mensch hat ein angeborenes Streben nach Wissen. Umso größer die Übereinstimmung in unseren Konstrukten untereinander ist, desto eher ist Verständnis möglich. Umso älter wir werden, umso mehr Konstrukte haben wir zur Verfügung. Durch Feedback von der Umwelt, Eltern, etc. bilden sich immer genauere und effektivere Konstrukte heraus. Angesichts einer neuen Situation verhalten wir uns laut Modell in einem „VorsichtVorwegnahme-Kontroll-Kreislauf“ (circumspection-pre-emption-control CPC cycle). Zuerst ziehen wir alle möglichen Deutungen der Situation in Betracht. Dies beinhaltet eine auf unsere Erfahrungen beruhende Interpretation der Situation. In der Phase der Vorwegnahme, sortieren wir jene Interpretationen und Verhaltensmöglichkeiten aus, die wenig erfolgversprechend scheinen. Die verbleibenden Konstrukte bewerten wir dann dahingehend, wie gut wir glauben, dass sie unserer gewünschten Zielerreichung dienen. Dann entscheiden wir und übernehmen die Kontrolle über unser Schicksal. Wir führen das Konstrukt aus, das wir für das Geeignetste halten. Entwicklung ist für Kelly ein dynamischer Prozess, der zwischen Individuum und Umwelt stattfindet. Das persönliche Konstruktsystem stellt damit die Persönlichkeit des Menschen dar. Es bestimmt, wie ein Mensch wahrnimmt und wie er sich verhält. Diese Konstrukte verändern sich über die Lebensspanne. Kelly hat „normale“ Menschen studiert und zur Analyse der Konstrukte einen sehr innovativen und wertvollen Test entwickelt (=> Stichwort „Psychodrama“: ähnlich dem „Soziogramm“ nach Moreno): Rollen-Konstruktions-Auswahl-Test („Role-Construct Repertory Test, später auch unter dem Namen „Repertory Grid“-Test bekannt. Dieser ist immer noch in Verwendung.). Ziel des Tests war, die hinter der Personenbewertung liegenden Konstrukte deutlich zu machen und in der Psychotherapie seiner Klienten zu nützen. Repertory Grid Test nach Kelly (Rollen-Konstruktion-Repertoir-Test) Geben Sie für jede der angegebenen Rollen den Namen einer bestimmten Person an, die diese Rolle in Ihrem Leben erfüllt: (1) Ihre Mutter oder Vater: ________________________________________ (2) Ihr bester Freund: _____________________________________________ (3) Ihre altersmäßig nächste Schwester oder eine weibliche Person, die der Rolle einer Schwester am nächsten kommt): ____________________________ (4) Ihr altersmäßig nächster Bruder (oder eine männliche Person, eines Bruders am nächsten kommt)_______________________________ (5) Ihr Partner/ Ihre Partnerin: ______________________________________ (6) Ein Lehrer/eine Lehrerin, die Sie mochten:__________________________ (7) Ein Lehrer/eine Lehrerin die sie nicht mochten:______________________ (8) Ihr Vorgesetzter/Vorgesetzte:____________________________________ (9) eine Ihnen bekannte erfolgreich Person:____________________________ (10)Eine ihnen bekannte erfolglose Person:____________________________ die der Rolle Da die Klienten selbst die Konstrukte wählen, nach denen sie die Personen ordnen, gibt das Ergebnis sehr deutlich Aufschluss, welcher Natur die jeweiligen Konstrukte sind. Diese Konstrukte wenden Klienten auch auf sich selbst an! James Biris (1955) schlug vor, diesen Test auch dafür zu verwenden, zu einer Einschätzung zu kommen, wie komplex bzw. differenziert ein Individuum wahrnehmen kann. Bonarius (1965) entdeckte, dass Menschen mit hoher kognitiver Komplexität die Folgen von eigenem Verhalten besser einschätzen können und empfindlicher auf die Meinungen anderer reagieren. Individuen mit kognitiver Simplizität wären eher egozentrisch. Klinische Anwendung des „Rep-Grid-Tests“: Kelly definierte die Rolle des Therapeuten darin, den Klienten ihre fehlerhaften Konstrukte deutliche zu machen und ihnen zu helfen, diese Konstrukte zu verändern. Das beginnt schon beim Erstkontakt des Klienten mit dem Therapeuten. Klienten haben Vorstellungen (Konstrukte) über das, was Psychotherapie ist/sein kann und wie man sich dort verhält (das gilt auch für den Therapeuten). Auch der Therapeut hat Vorstellungen über den Klienten. Beide Konstrukte müssen sich verändern. Kelly definiert verschiede Methoden um Konstrukte zu verändern: Wichtig ist ihm, dass sich der Klient vom Therapeuten akzeptiert fühlt. Dann folgt die „kontrollierte Elaboration“. Die Probleme des Klienten werden erörtert und er wird unterstützt, Schlussfolgerungen zu ziehen. Dadurch können nicht hilfreiche Konstrukte verworfen werden und Veränderung wird möglich. Damit das gut funktioniert fordert Kelly Selbsterfahrung für Therapeuten. Sie müssen ihre eigenen Konstrukte kennen und bewusst und flexibel mit ihnen umgehen lernen, damit sie sich gut auf ihre Klienten einstellen können. Die Vergangenheit ist für die Behandlung zwar relevant, aber nur soweit, wie sie Aufschluss über die Entstehung der Konstrukte liefert. Zwei weitere Instrumente, die Kelly entwickelte sind die Selbstcharakterisierung und die fixierte Rollentherapie. Bei der Selbstcharakterisierung schreiben die Klienten eine in der dritten Person verfasste Beschreibung von sich selbst. Das interpretiert der Therapeut und schreibt einen sogenannten Rollen-Sketch. Eine fiktive Rolle, die der Klient die nächsten Wochen „spielen“ soll. Dieser RollenSketch weicht von der Persönlichkeit des Klienten ab (= fixierte Rollentherapie). Diese neue Rolle wird zunächst im Behandlungszimmer geprobt und später ins Leben implementiert. Der Klient kann so die eigenen Rollen und Konstrukte erweitern. Ad 2) Albert Ellis rational-emotive Verhaltenstheorie Ellis studierte zunächst Betriebswirtschaftslehre, verlor aber in der großen wirtschaftlichen Depression der 30er-Jahre seinen Job. Danach studierte er Psychologie und beschäftigte sich mit Persönlichkeitstests. Er genoss eine Ausbildung zum Psychoanalytiker, die er jedoch frustriert abbrach. Er arbeitete bei Dollard und Miller und versuchte die behaviorale Therapie und die Psychoanalyse zu vereinen. Später entwickelte er aus seinen Versuchen heraus die Rational-Emotive Verhaltenstherapie und gründete in New York das „Institute for Rational-Emotive Behavior Therapy (REPT)“. Theoretische Grundlagen der rational-emotiven Verhaltenstherapie: Ellis kannte das Problem, dass man, nur weil man versteht, warum man sich fürchtet, die Furcht noch lange nicht besiegt hat. Die Dekonditionierung der Verhaltenstherapie funktioniert zwar, ist jedoch ethisch fragwürdig (Klienten werden so lange der Angst auslösenden Situation ausgesetzt, bis sie sich nicht mehr fürchten.) Für Ellis greift die rein lerntheoretische Erklärung von Verhalten zu kurz. Außerdem erklärte sie nicht, warum Menschen ihr Verhalten beibehalten, das sie eigentlich schädigt. Das Nachdenken in immer wieder gleicher Weise über ein frustrierendes Ereignis würde dieses bestärken. Dennoch tun wir es. (Z. B.: Wir ärgern uns über einen Freund. Indem wir jedes Mal über den Freund ärgerlich denken, verstärken wir unsere Wut auf ihn.) Aus dieser Beobachtung heraus stelle Ellis die Frage wie unsere Kognitionen unsere Emotionen und unser Verhalten beeinflusse. Dabei wurde Ellis von den Philosophen der griechisch-römischen Antike, dem Buddhismus und Taoismus beeinflusst. Die Kernaussage seiner Theorie ist: Der Mensch ist sowohl ein rational als auch ein irrational denkendes Wesen. (Psychische) Störungen sind das Resultat unlogischer, irrationaler Denkweisen und Überzeugungen. [Die Arbeit mit Überzeugungen und Glaubenssätzen wurde später in der systemischen Therapie und in der neurolinguistischen Programmierung, kurz NLP, vertieft und weiterentwickelt.] Therapie würde in diesem Sinn bedeuten, dass man irrationale Denkweisen durch rationale ersetzt. Für Ellis streben Menschen nach zwei Dingen im Leben: 1. Sie streben danach am Leben zu bleiben, 2. Sie streben nach Glück. Rationales Verhalten bezeichnet dann jene Verhaltensweisen, die dazu dienen, diese Ziele zu verwirklichen. Irrationales Verhalten hindert Menschen am Erreichen dieser Ziele. Für Rationalität gibt es allerdings keine absoluten Kriterien, sie ist subjektiv. (So kann es für einen Menschen, der nach Perfektion strebt, rational sehr gesund sein, fehlerhafter zu werden und dies zu akzeptieren (obwohl das eigentlich unlogisch ist). Ellis ist überzeugt, dass diese Disposition zu Rationalität und Irrationalität angeboren ist (80 %) und zu einem guten Teil auch von unseren Eltern gelernt wird (20 %). Er nennt dabei das Beispiel, dass wir glauben, die Welt sei gerecht, weil uns unsere Eltern gerecht behandelt haben. Tatsächlich müssten wir lernen zu akzeptieren, dass die Welt nicht gerecht ist. Unser Glauben ist ein irrationaler Glaube, der viel Leid schafft, denn wir Menschen neigen dazu, der „fordernden Natur“ unserer Glaubenssätze nachzugeben. Wir glauben so fest daran, dass wir von anderen Menschen Verhaltensweisen fordern, die unseren Glauben bestätigen. Dazu haben wir aber kein Recht und wir haben auch nicht die Mittel, andere Menschen zu etwas zu zwingen, von dem sie nicht überzeugt sind. Der Glaube an die gerechte Welt ist ein fundamentaler Attributionsfehler (Sozialpsychologie). Wir schließen einen Vertrag mit der Welt, in der wir gute Behandlung erwarten, wenn wir uns korrekt verhalten. Verletzungen dieses Glaubens können zu psychischer und physischer Krankheit führen (Z. B.: MOBBING). Ellis postuliert weiter, dass die Wut, die wir empfinden, wenn unser Glaube verletzt wird, uns zum Teil handlungsunfähig macht. Dies verursache wiederum weiteres Leid. Rationales Denken wäre damit ein Heilmittel gegen quälende Emotionen, die wir aufgrund der Verletzung unserer irrationalen Glaubenssätze erleben. Ellis geht aber noch einen Schritt weiter. Er untersucht die Prozesse hinter der Bildung von Glaubenssätzen (das sind Hypothesen über die Welt) und meint, dass es in der Therapie um die Prüfung der Hypothesen ginge. Jeder Mensch konstruiert seine Sicht der Welt. Unsere Glaubenssätze sind Konstrukte nicht Abbildungen der Wirklichkeit. Er folgt damit Epiktet´s Ausspruch: „Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben.“ Kurz: Die Menschen erzeugen ihre Emotionen selbst. Ellis unterscheidet vier Prozesse mit denen wir die Welt „konstruieren“: 1. 2. 3. 4. Wahrnehmen Fühlen Denken Emotion Z. B.: Wir treffen einen Freund im Supermarkt, dieser geht wortlos an uns vorüber. a. Wir messen dem Vorfall keine Bedeutung bei. Er ist wohl in Gedanken versunken gewesen. Das nächste Mal scherzen sie mit ihm darüber. b. Sie bekommen Schuldgefühle, denken sich: „Habe ich das letzte Mal etwas falsch gemacht?“ Sie ängstigen sich. c. Sie ärgern sich maßlos über ihn. Ein und dieselbe Situation kann drei völlig unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Dabei erleben wir unsere Emotionen durch äußere Ereignisse hervorgerufen. Ellis widerspricht dem und sagt, dass wir es sind, die unsere Emotionen erzeugen und kontrollieren. Die Rational-emotive Verhaltenstherapie versucht nun methodisch diese inneren Selbstgespräche, in denen wir unsere Emotionen erzeugen, zu erhellen, dem Bewusstsein zugänglich zu machen, sie so auf ihren irrationalen/rationalen Gehalt zu überprüfen und gegebenen Falls zu verändern. Diese Selbstgespräche laufen automatisch und sehr schnell ab und entziehen sich so oft genug der Beobachtung. Ellis geht von einem freien Willen des Menschen aus. Wir sind selbstverantwortlich für unser Schicksal und selbst wenn wir glauben keine Alternativen zu haben, irren wir. Meisten sind die Alternativen nur zu schmerzvoll. (Z. B.: Party oder Großmutters Geburtstag? Wenn wir uns für die Party entscheiden, dann ist die Familie enttäuscht. Da uns wichtig ist, dass die Familie gut über uns denkt, verzichten wird auf die Party). Die Konsequenz des Postulats des freien Willens ist, dass wir für unsere Handlungen verantwortlich sind. Die Akzeptanz der Verantwortlichkeit für die eigenen Emotionen und verhaltensbezogenen Entscheidungen sieht Ellis als unabdingbare Voraussetzung für psychische Gesundheit an. Ein Faktor, der uns krank machen kann, ist unser Glaube, dass wir andere Menschen kontrollieren könnten in dem Sinn, dass wir von ihnen ein bestimmtes Verhalten fordern. Dieses Recht haben wir nicht! Die Akzeptanz führt dazu, dass wir uns nur für den Teil verantwortlich fühlen, für den wir auch verantwortlich sind, nämlich für unsere Interpretationen und den daraus erzeugten Emotionen. Ellis betont sehr die Verwendung von Sprache. Sie würde unser Denken in höchstem Maß beeinflussen. Ein weiterer Aspekt der Theorie ist, zwischen langfristigen und kurzfristigen Hedonismus/Zielen zu unterscheiden und eine angemessene Balance zu finden. Ellis geht in seiner Theorie davon aus, dass der Mensch prinzipiell gut ist. Er führt die weitreichende Unterscheidung zwischen Person und Verhalten ein. Menschen können böse Dinge tun, sie sind deshalb noch keine bösen Menschen. Damit zeichnen sich die ersten Strahlen am Himmel der Humanisten ab. Er ist nicht nur ein Behaviorist sondern auch einer der ersten, der sich dem ethischen Humanismus verpflichtet fühlte. Er forderte von Therapeuten hohe ethische Standards. Er tritt für die Selbstakzeptanz und der Akzeptanz für die Verantwortlichkeit für Entscheidungen, die man im Zuge des Strebens nach Glück trifft, ein. Jeder Mensch hat das Potenzial zur Veränderung seines Verhaltens! Jeder Mensch hat in sich die angeborene Tendenz zur Bewertung, diese sei ungesund, da sie zu konstanter Unsicherheit führe. Urteile könne man nur auf Basis vollständiger Information treffen und diese ist in Bezug auf das Lebendige nie vorhanden. Das Ziel ist, so gut zu sein, wie man nur kann. Fehlbarkeit ist eine natürliche Eigenschaft des Menschen, die Forderung korrekt zu sein, ist daher irrational. Die Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit bedeutet Heilung. Persönlichkeitsentwicklung nach Ellis: Die Fähigkeit zu rationalen und irrationalen Denken ist angeboren. Die Eltern verstärken das irrationale Denken, somit gibt es für Ellis – so wie für die Psychoanalytiker – Altlasten, die auf familiäre Erziehung zurück zu führen sind. Die angeborenen Unterschiede sowie diese Altlasten sind für unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten verantwortlich. Persönliches Wachstum geschieht nicht automatisch durch das Älterwerden, Veränderungsprozess des Denken statt. sondern durch einen kontinuierlichen ABCDE-Modell: A… Auslösendes Ereignis (activating event) B… Überzeugungssystem (belief system) C… Emotionale und verhaltensbezogenen Konsequenzen (consequences) Die meisten Menschen glauben A führt zu C, in der Therapie wird versucht, B zu erhellen um zu zeigen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Glaubenssysteme haben und deshalb unterschiedlich interpretieren und handeln. Die aktuelle Stimmungslage beeinflusst die Interpretation. Entwicklung von Einsicht in die Ursachen von Emotionen und Verhalten ist das Kernelement der Therapie. Unsere Emotionen basieren auf unseren Selbstgesprächen. D… Disputation (Streitgespräch) „Sokratischer Dialog“ Gemeinsam mit dem Therapeuten werden die zugrunde liegenden irrationalen Überzeugungen hinterfragt. Die Phase B erhellt. (Später nannte Ellis die irrationalen Überzeugungen in „dysfunktionale Überzeugungen“ um.) Da das bloße Wissen um die Irrationalität noch zu keiner Verhaltens- und Empfindensänderung führt, versucht Ellis einen Transfer der Veränderung in den Alltag zu bewirken. Dies tut er mittels Hausaufgaben. E… Effekte (effektive new thinking) Das neue Denken wird angewandt. Psychische Störungen resultieren nach seiner Theorie aus Ich-Störung und Störung der Toleranz von Unbehagen. Ich-Störung: Die Person stellt Forderungen an sich selbst und die Umwelt. Wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, entsteht Leid, im Sinne einer negativen (Selbst)Bewertung. Heilung erfolgt durch die Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit. Störung der Toleranz von Unbehagen: Der Mensch geht mit dem Glaubenssatz an das Leben heran, dass die Welt einfach und die Ziele nicht allzu schwer zu erreichen sein sollten (irrationaler Gedanke). Er hat eine geringe Frustrationstoleranz. Die Frustrationstoleranz ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die die individuelle Fähigkeit beschreibt, o eine frustrierende Situation über längere Zeit auszuhalten, ohne die objektiven Faktoren der Situation zu verzerren, o langfristig psychische Spannungen zu ertragen, die aus der Nichtbefriedigung von Triebwünschen herrühren (Saul Rosenzweig´s Picture Frustrations Test, kurz PFT). Der PFT von Rosenzweig ist ein projektives Verfahren und dient der Untersuchung der Frustrationstoleranz, d. h. der Belastbarkeit einer Persönlichkeit in sozialen Konfliktsituationen. Der Vorteil gegenüber anderen Aggressions- und Konfliktfragebögen liegt darin, dass sich der Proband im PFT nicht selbst beurteilen muss, d.h. introspektive Fähigkeiten nicht erforderlich sind. Der PFT besteht aus 24 skizzenartig gezeichneten Situationen. In diesen Situationen richtet eine Person frustrierende Äußerungen an eine zweite, deren Antwort der Proband assoziativ ergänzen soll. Die 24 Situationen des Verfahrens können in zwei Gruppen aufgeteilt werden: solche, die das „Ich“, und solche, die das „Über-Ich“ blockieren oder frustrieren. • • „Ich“ blockierende Situationen liegen dann vor, wenn ein Hindernis – persönlicher oder unpersönlicher Art – das Subjekt hemmt, enttäuscht, behindert oder sonst wie vereitelt. Beispiel: In den „Über-Ich“- blockierenden Situationen wird das Subjekt durch eine andere Person beschuldigt, angeklagt, getadelt oder diskriminiert. Beispiel: Die rational-emotive Verhaltenstherapie ist hoch wirksam und sehr sparsam (10–15 Therapiestunden) und bietet viel Struktur für Therapeuten und Klienten. Sie wird aber auch kritisiert, z. B. von der Depressionsforschung. Hier ist noch lange nicht geklärt, ob negative Gedanken Depressionen erzeugen oder umgekehrt. In jüngerer Zeit wird verstärkt dieser Aspekt wieder untersucht unter dem Gesichtspunkt der Rückfallprophylaxe. Im Konzept des Mindfulness based stress release-Trainings (MBSR) werden achtsamkeitsbasierte Verfahren gelernt, die es den Klienten ermöglichen, negative Glaubenssätze aufzuspüren und allein durch deren Akzeptanz (nicht durch deren Bekämpfung) zu verändern. Diese Trainings sind gut evaluiert und sehr erfolgreich. Ein weiterer Aspekt ist wichtig zu bedenken (wenn man sich mit Persönlichkeitsforschung beschäftigt): Ellis stellt die These auf, dass es ein rationales (= richtiges) Denken gibt. Die Kritiker meinen, dass hier nur eine Wertvorstellung durch eine andere – funktionalere – ersetzt würde. Die Methoden greifen zu kurz, Menschen würden z. B. stressresistenter gemacht ohne dass die Rahmenbedingungen, die den Stress auslösen, verändert würden. Was als gute Wertvorstellung gesehen wird, ist kulturabhängig. Ellis scheint hier sehr moralische und dem christlichen Gedankengut verbundene Werte zu vertreten. Filmempfehlung zum Thema: „Geständnisse (Wie konstruiert die Hauptfigur ihre Wirklichkeit?) – Confessions of a Dangerous Mind“ Kellys Arbeit wir in der klinischen Praxis angewendet und hat viele hilfreiche Einsichten in die Natur der Denkstörungen bei Schizophrenie und anderen Störungsbildern (z. B. Depressionen, Zwangsstörungen, ...) gebracht. Der Rep-Grid-Test findet Einsatz in der Arbeitspsychologie zur Erkundung von Beziehungen am Arbeitsplatz und bei der Berufseignungsdiagnostik. Kellys Arbeit war visionär. Sie stellte zu der Zeit eine ziemliche Herausforderung für die etablierten Lerntheoretiker dar. Sie war grundlegend für die Entwicklung der systemischen Therapieformen. Ellis Arbeit findet ein noch breiteres Einsatzspektrum, die Spanne reicht von der Arbeitswelt bis in die klinische Praxis. Die rational-emotive Verhaltenstherapie wird immer noch gelehrt. Humanistische Persönlichkeitstheorien: Aus einer Unzufriedenheit mit dem eher negativen Menschenbild der Analytiker und dem „mechanistischen“ der Behavioristen, begann sich in Amerika eine neue Strömung zu entwickeln. Sie nahm Anleihe bei den europäischen existenzialistischen Philosophen (Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre). Diese Philosophen interessierten sich für jene Faktoren, die unserem Leben Sinn verleihen. Sie betonen die Einzigartigkeit des Individuums, dessen Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. In dieser Tradition verstehen sich Abraham Maslow und Carl Rogers. Sie gelten als Begründer der humanistischen Persönlichkeitsforschung, die durch folgende Eigenschaften charakterisiert wird: 1. Das persönliche Wachstum des Menschen steht im Vordergrund. Menschen sind durch das Streben nach positiver Entwicklung motiviert. 2. Die menschliche Natur ist gut. 3. Entscheidend ist das Hier und Jetzt. Die Kindheit hat keinen Einfluss und es macht auch wenig Sinn, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, denn 4. Jeder Mensch hat die Möglichkeit Kraft seiner Entscheidungen sein Leben zu verändern. 5. Damit verbunden ist auch die hohe Eigenverantwortlichkeit für das eigene Leben. Wir haben Willensfreiheit aufgrund derer wir Entscheidungen treffen. Wenn wir das Gefühl haben, keine Wahlfreiheit zu haben, dann liegt das weniger an dem tatsächlichen Fehlen von Möglichkeiten, als vielmehr an der Qualität der Möglichkeiten. Wir halten alle Alternativen für wenig erstrebenswert – das bedeutet aber nicht, dass es keine gibt. (=> Siehe Artikel aus dem Standard: Alleinsein mit sich ist hart, 3.7.2014) 6. Ein weiteres wichtiges Merkmal der humanistischen Theorien ist die Betonung der „Phänomenologie als erkenntnistheoretisches Werkzeug“. Das bedeutet, der Mensch wird als einzigartig angesehen und ist für sich und sein Leben der Experte. Die Haltung des Therapeuten ist demzufolge jene, der Begleitung. Niemals würde ein humanistisch orientierter Therapeut Lösungen bereitstellen. Abraham Maslow: Abraham Maslow war das älteste von sieben Kindern einer russisch-jüdischen Einwandererfamilie. Da seine Familie in dem Viertel, in dem sie lebten, die einzige mit einem jüdischen Background war, fühlte er sich sehr einsam. Die Einsamkeit füllte er mit Büchern. Seine Familie achtete sehr darauf, dass er sich weiter bildete. Nach einem abgebrochenen Jurastudium, begann er Psychologie zu studieren und promovierte im Bereich der Verhaltensbeobachtung (Affen). Sein Karriereweg war von dem Wunsch nach Verständnis der menschlichen Persönlichkeit geprägt. Er genoss eine psychoanalytische Ausbildung, konnte sich aber mit dem negativen Menschenbild nicht identifizieren. Vielmehr interessierten ihn Menschen, die seiner Meinung nach bahnbrechende Ideen hatten (heute würde man diese „highpotentials“ nennen). Er beschrieb diese als selbstverwirklichend. Die Selbstverwirklichung wurde sein zentrales Forschungsthema. Das Konzept der Selbstverwirklichung: Maslow wandte sich in seiner Forschung von der klinischen Psychologie ab und begann „normale1“ Menschen zu untersuchen. Er wollte wissen, wie es möglich wird, dass der normale Mensch glücklicher und gesünder würde. (siehe Aaron Antonovsky´s Modell des Salutogenese). Sein Konzept kreist um die zwei Gedanken, dass der Mensch von Natur aus gut sei und er eine angeborene „instinktoide“ Tendenz habe, sich Weiterzuentwickeln und zu wachsen. Diese instinktoide Tendenz sei aber sehr schwach und könne ganz leicht von Umwelteinflüssen verformt und überlagert werden. Dies geschehe in der Kindheit. Wenn Kinder negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt werden, verlieren sie ihre instinktoide Tendenz und werden aggressiv, destruktiv und kalt. In seiner Forschung konzentrierte er sich auf die positiven, fördernden Faktoren. Die Psychoanalyse sah er zu seinem Konzept als Ergänzung. Ausgehend von seinen Tierbeobachtungen formulierte Maslow eine Motiv-Pyramide. Er beobachtete, dass Tiere von bestimmten Motiven angetrieben werden. Wenn diese befriedigt sind, treten andere Motive in den Vordergrund. Er postulierte daraufhin die Hypothese, dass dies auch für Menschen gelte. Beim Menschen gäbe es eine Bedürfnishierarchie, die von niederen Bedürfnissen – den sogenannten Defizitbedürfnissen – zu den höher organisierten Bedürfnissen – den Wachstumsbedürfnissen – hin organisierst ist. Ein Defizitbedürfnis ist ein Bedürfnis, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es auf einen Mangel beruht. Ist der Mangel gestillt, ist auch die Motivation weg. (Zum Beispiel Durst: Wenn ich etwas trinke, ist der Durst gelöscht. Es besteht kein weiterer Bedarf nach weiteren Getränken solange, bis ich wieder durstig bin.) Die Wachstumsbedürfnisse sind bei jedem Individuum einzigartig. Sie nehmen nach ihrer Befriedigung tendenziell zu. Sie haben das Ziel, das Potenzial des Menschen voll auszuschöpfen, ihn weiter zu entwickeln, ihm neue Erfahrungen zu vermitteln. Ihre Befriedigung bringt meistens ein weiteres Verlangen nach mehr mit sich. Die Defizitbedürfnisse stellen unser Überleben sicher. Die Wachstumsbedürfnisse repräsentieren ein höheres Funktionsniveau und sollen sicherstellen, dass wir glücklicher und gesünder werden. Maslow´s Kritik an der Psychoanalyse ist, dass sie die Defizitbedürfnisse überbetont. Unser Streben nach Triebreduktion ist zu einseitig. Motivation ist wesentlich komplexer. Wenn wir ein Verhalten zeigen, kann dies durch unterschiedliche Motivationen gleichzeitig angetrieben werden. So essen wir, weil wir Hunger haben, aber auch sehr oft, weil wir einsam sind, … 1 „normal“ bezeichnet jenen Teil der Bevölkerung, der sich von „klinisch“ unterscheidet, also nicht im psychologischen Sinn mit einer Diagnose belegt wurde. Die Bedürfnishierarchie: Maslow erkannte, dass Bedürfnisse hinsichtlich ihrer Bedeutung für unser Überleben unterschiedlich sind. Sind die Basisbedürfnisse befriedigt, werden andere Ziele attraktiv. Seine Bedürfnishierarchie hat besonders im Wirtschaftsbereich Interesse gefunden und dazu geführt, dass man über eine Umorganisation der Arbeitswelt nachdachte. Es wurden z. B. Karrierepläne für Mitarbeiter entwickelt, etc. PHYSIOLOGISCHE BEDÜRFNISSE: Hunger, Schlaf, Durst, Sauerstoffversorgung, Ausscheidung, Sexualität, ... Sie sind Defizitbedürfnisse. In der westlichen Welt, in der wir selten Hunger oder Durst leiden, sind diese Bedürfnisse selten in ihrer Reinform anzutreffen (zum Beispiel: „Into the Wild“ verfilmte Reportage von Jon Krakauer) Sind diese Grundbedürfnisse befriedigt, wenden wir uns dem Bedürfnis nach Sicherheit zu. SICHERHEITSBEDÜRFNIS: Wir Menschen, aber auch Tiere, streben nach einer sicheren Umwelt. Dazu gehört Schutz vor Umweltbedingungen und vor Gewalt. Dieses Bedürfnis ist bereits bei Kleinkindern und Säuglingen beobachtbar, die durch Unvorhersehbarkeit und Störung ihrer Sicherheit gebenden Routinen irritiert werden. Maslow beton einerseits, dass es eine kindgerechte Erziehung geben müsse, in der Kinder sich selbst entdecken können – die also frei ist, von Vorgaben durch Erwachsene. Gleichzeitig betont er aber auch die Wichtigkeit von Regeln und Verhaltensbeschränkungen. Diese geben den Kindern Halt und Sicherheit, sodass sie sich gut entwickeln können. Menschen bevorzugen es, in einer stabilen Umgebung zu leben. Manchmal steht dieses Bedürfnis aber unserer Entwicklung im Weg, wenn wir Entscheidungen treffen, die die sicherte Option betreffen, nicht die Beste. (Zum Beispiel: Jobwechsel) SOZIALE BEDÜRFNISSE: Sobald wir uns gut genährt und sicher fühlen, tritt das Bedürfnis nach sozialem Kontakt in den Vordergrund. Wir wollen ein Teil der Gesellschaft sein. Uns wird unser Bedürfnis nach Nähe bewusst. Maslow unterscheidet bei den sozialen Bedürfnissen zwei Arten von Liebe: a) Defizit-Liebe: Diese Liebe stammt aus dem Gefühl der Leere in uns, das wir beseitigen möchten. Der Andere wird nicht um seiner selbst willen geliebt (Wachstumsliebe), sondern als Mittel zum Zweck verwendet. Es ist eine egoistische Art der Liebe, sie ist Ausdruck unseres Bedürfnisses nach Anerkennung, Zärtlichkeit, Hochgefühlen, sexueller Erregung, ... b) Wachstumsliebe: Sobald die Bedürfnisse nach der Defizit-Liebe gestillt sind, wird Wachstumsliebe möglich. Sie ist nicht besitzergreifend und bedingungslos. Sie akzeptiert den anderen als den, der er ist. In dieser Liebe kann man die Bedürfnisse des Anderen über die eigenen stellen. Es ist eine emotional reife Art der Liebe und ist nur dann möglich, wenn die Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt sind. Sie zählt bereits zur Selbstverwirklichung. INDIVIDUALBEDÜRFNISSE: Sie gehören zu den letzten Grundbedürfnissen und wieder unterscheidet Maslow zwei Arten: a) Das erste Bedürfnis besteht darin, dass wir uns selbst kompetent und leistungsfähig erleben wollen. b) Das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Respekt durch andere Menschen. (Darum ist jemand, der seine Position durch Schwindeln bekommen hat, nicht befriedigt, da das erste Bedürfnis, nämlich sich selbst als kompetent zu erleben, unbefriedigt bleiben muss => vgl. Narzissmus). BEDÜRFNIS NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG: Maslow geht davon aus, dass Menschen sich bis zur völligen Entfaltung ihres Potenzials weiter entwickeln wollen um mit sich selbst Frieden schließen zu können. Allerdings erreichen nicht alle Menschen diese Stufe. Maslow räumt sogar ein, dass Selbstverwirklicher insgesamt andere Bedürfnisse haben als andere Menschen. Er bezeichnet diese Bedürfnisse als Metabedürfnisse. Diese zeichnen sich durch einen anderen Fokus aus, sie beziehen höhere ethische und ästhetische Standards mit ein (Schönheit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, ...). Maslow meinte selbst, dass sein Modell sehr vereinfacht ist und dass es viele Ausnahmen dazu gäbe. Die Priorität unserer Bedürfnisse hänge auch vom Lebensalter und den Lebensumständen ab. Außerdem muss eine Bedürfnisstufe nicht völlig befriedigt sein, um Bedürfnisse auf einer höheren Stufe zu aktivieren. Maslow gibt ein Maß an, dass z. B. 85 % der physiologischen, 70% der Sicherheitsbedürfnisse, 50 % der sozialen Bedürfnisse und 40 % der Individualbedürfnisse sowie 10 % der Selbstverwirklichungsbedürfnisse beim Durchschnittsmensch befriedigt sind. Zum Beispiel: Nach dem Ende einer langen Liebesbeziehung wird das Bedürfnis nach sozialem Kontakt spürbarer. Eigenschaften von SELBSTVERWIRKLICHERN: Maslow unterstellt Selbstverwirklichern anders zu sein als andere Menschen. Um diese These zu stützen, untersuchte er die Biografien von Menschen, denen er diese Eigenschaft unterstellte. Dazu zählte er Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Thomas Jefferson, Albert Schweitzer, Jane Addams, Baruch Spinoza. Er wollte zu einem tiefen Verständnis des Individuums gelangen. Eine Eigenschaft, die er all diesen Menschen zuordnete, war die der Kreativität (nicht im Sinne von künstlerischer Tätigkeit!). Er meinte damit eine Fähigkeit, Alltägliches in einer neuen Art und Weise zu sehen und zu machen. Selbstverwirklicher können immer noch staunen, sie sind interessiert, sie denken anders. Sie nützen die sogenannte Wachstumskognition. Dieses sei eine wertungsfreie Art zu denken, bei der man sich selbst und die Welt so akzeptiert wie sie ist. Diese Wachstumtskognitionen treten bei sogenannten Gipfelerlebnisse (peak-Erlebnissen vgl. Csikszentmihalyi´s „Flow“) auf. Die Wachstumskognitionen stehen im Gegensatz zu sogenannten Defizitkognitionen. Sie sind wertend und bestimmen wie gut eine Erfahrung unsere Defizitbedürfnisse befriedigen kann. Die Wachstumskognitionen sind vorübergehende Erscheinungen – wir denken nicht immer in Wachstumskognitionen. Maslow meinte sogar, dass ein permanent nicht wertendes Denken gefährlich sei. Selbstverwirklicher weisen einen höheren Wert bei der Selbstakzeptanz auf, sie sind zudem toleranter und schätzen die Realität präziser ein. Sie haben weniger Realitätsverzerrungen (Abwehrmechanismen). Sie haben hohe ethische und moralische Ansprüche, engagieren sich sozial. Sie interessieren sich mehr für das Gesamtbild als für die Details und sie werden mehr durch das Ausschöpfen ihres Potenzials motiviert, denn durch Wohlstand. Sie sind unabhängiger und bilden sich eher eine eigene Meinung. Sie haben tiefere, dafür weniger freundschaftliche Beziehungen. Maslow betont, dass niemand ständig Selbstverwirklicher ist – Gipfelerlebnisse kommen und gehen und dass diese nicht die perfekten Menschen sind. Persönlichkeitsentwicklung nach Maslow Maslow ist überzeugt davon, dass Kinder einen natürlich Trieb zur Weiterentwicklung haben. Laut ihm gäbe es eine sensible Phase, in der Kinder entscheiden, ob sie auf ihre innere Stimme hören oder sich dem Druck der Erwachsenenwelt anpassen. Maslow meinte, dass der kulturelle und elterliche Druck viel zu oft dazu führe, Kinder zu beeinflussen und die instinktoide Tendenz zu zerstören. Als Beispiel wird die Summerschool in Großbritannien angeführt. Dort dürfen die Kinder selbst entscheiden, was sie lernen wollen. Es gibt zwar auch Regeln, diese werden aber mit den Kindern ausgehandelt. Kindern wird früh Verantwortung beigebracht. Maslow wehrte sich gegen Diagnostik und sah die Grundlage von Störungen in dem Fehlen der Befriedigung von Bedürfnissen. Behandlungstechnisch ging er eklektisch vor. Er behandelte sowohl analytisch, als auch verhaltenstherapeutisch oder gruppentherapeutisch. Kritik: An einem Punkt ist Maslows Modells inkonsistent. Er geht von einer instinktoiden Tendenz aus, die schwach, leicht durch Umwelteinflüsse überlagerbar und wahrscheinlich unbewusst ist. Sie beeinflusst unser Verhalten unbewusst. Zusätzlich anerkennt er auch Freud´s Abwehrmechanismen, die unbewusst angewendet uns den Blick auf uns selbst verstellen. Aufgrund unserer Vergangenheit werden also unbewusste Motive erworben. Damit widerspricht er der Annahme, dass wir einen freien Willen haben. Da Maslow in vielen seiner Ideen vage blieb, ist sein Modell auch nicht gültig evaluiert worden. Carl Rogers: Carl Rogers wurde 1902 geboren. Seine Familie war sehr religiös, der Vater war erfolgreicher Bauingenieur und betrieb nebenbei eine Farm. Rogers wurde in die Arbeit auf der Farm eingebunden, beschäftigte sich mit Viehzüchtung und begann ein Agrarwissenschaftsstudium. Bald jedoch wechselte er zu Religionswissenschaften und letztendlich zu Psychologie. Er begann – weil er seine Familie ernähren musste - in einem Institut für Erziehungsberatung zu arbeiten. Es folgten sehr viele Publikationen und Professuren. Rogers Ansatz war revolutionär sowohl was die Sprache als auch das Denken über Menschen anbelangte. Die Prinzipien Rogers Therapie: Rogers entwickelte sein Konzept aus der klinischen Arbeit mit straffälligen Jugendlichen heraus. Er hatte eine psychoanalytische Ausbildung fühlte sich aber mit der Tätigkeit des Analytikers sehr unwohl. Er akzeptierte wohl, dass Erfahrungen eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung spielen, sah aber Entwicklung als lebenslangen Prozess, der nicht nur in der Kindheit passiert. Individuen spielen eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihres Lebens. Wie Maslow sah er Menschen als zukunftsorientiert an. Wir wollen etwas erreichen. Rogers begann seine Patienten „Klienten“ zu nennen. Patient (lat.: der Erduldende) würde das Machtgefälle zwischen Behandler und Behandelten zementieren. Für ihn waren aber beide gleichwertige Partner in einem Beratungsprozess. Der Klient ist der Experte für seine Lebenssituation. Die Rolle des Therapeuten wäre es, dem Klienten zu einem besseren Verständnis des Problems zu helfen. Rogers war überzeugt davon, dass – sobald der Klient verstanden hat was sein Problem ist – er die Lösung schon selbst finden würde. Rogers änderte später die Bezeichnung klientenzentriert auf personenzentriert, weil ihm dieser Begriff wertneutraler vorkam, heute sind beide Begriffe gebräuchlich. Rogers Arbeit war bahnbrechend. Er vertrat den phänomenologischen Ansatz, nach dem wir alle die Welt subjektiv erfahren und wahrnehmen. Er lehnte die Möglichkeit einer objektiven Realität ab. Wir leben alle in unserer eigenen Realität. Die Wahrnehmung einer Situation hängt stark von unserer eigenen Stimmung, unserem Charakter, unseren Überzeugungen, unseren Erfahrungen und vielen anderen Faktoren ab. Als Therapeut ist es daher unerlässlich, dass wir uns um das Verständnis der Situation der Klienten bemühen. Wir sollen die subjektive Weltsicht des Klienten kennen. Ein zentraler Begriff des Konzepts Rogers ist der der Selbstaktualisierung. Rogers legte Nachdruck auf die Einzigartigkeit der Individuen und die Tatsache, dass jeder Mensch wachsen und sich entwickeln möchte. Diese Tendenz der Selbstaktualisierung sei angeboren. (Selbstaktualisierung ist der Selbstverwirklichung Maslows sehr ähnlich). Selbstaktualisierung ist ein positiver Trieb zur Weiterentwicklung und Verwirklichung des eigenen Potenzials. Psychische Probleme kommen aus einer Blockade der Selbstaktualisierung. Gesund ist, wer die Schwierigkeiten des Lebens meistert und sich seinem Potenzial gemäß entwickelt. Selbstaktualisierung besteht nach Rogers aus zwei Komponenten: a) Der biologische Aspekt umfasst den Trieb zur Befriedigung unserer Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Schlaf, Sicherheit und Fortpflanzung. b) Der psychologische Aspekt umfasst die Weiterentwicklung unseres Potenzials und der Qualitäten, die uns zu einem wertvolleren Menschen machen. Rogers ging davon aus, dass der Mensch grundsätzlich gut ist. Destruktivität entstünde, wenn Menschen unter widrigen Umständen leben. Damit hat die Gesellschaft großen Einfluss auf die Entwicklung des Selbst. Rogers unterschied zwischen den Selbstkonzept und den Selbst. Das reale Selbst ist unser grundlegendes organismisches Selbst. Der genetische Bauplan für die Person, die wir werden können. Warum wir diese Person nicht sind, erklärt Rogers wie folgt: Wir Menschen sind soziale Wesen, die von anderen Menschen gemocht/geliebt werden wollen. Dieses von anderen Menschen „geliebt werden wollen“ beschreibt Rogers als bedingungslose positive Wertschätzung und grenzt sie gegen die Liebe ab, die oft Bedingungen hat (siehe Maslows Defizit- und Wachstumsliebe). In unserer Entwicklung lernen wir Bedingungen der Wertschätzung kennen. Wir lernen, dass wir – wenn wir uns in einer bestimmten Weise verhalten – mehr gemocht werden, dass andere (z. B. Eltern, Freunde) glücklicher sind. Diese Bedingungen verzerren die Richtung unserer Selbstaktualisierung bis dahingehend dass wir Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Die Bedingungen der Wertschätzung wirken sich auf das Selbstkonzept aus. Das Selbstkonzept ist die Art und Weise, wie wir uns selbst beschreiben. Dabei handelt es sich aber meistens um Wahrnehmungen, die auf dem Feedback anderer Menschen beruhen. Wir verwenden diese Bedingungen der Wertschätzung, die wir durch andere gelernt haben, für die Beurteilung unseres eigenen Verhaltens und als Richtlinie bei Entscheidungen in unserem Leben. Sie sind uns bewusst. Wir neigen auch dazu, Dinge so wahrzunehmen, dass sie zu unserem Selbstkonzept passen. (Z.B.: Gutbestanden Prüfung – Glück, weil ich ja nicht so intelligent sein kann.) Unser organismisches Selbst ist uns nicht bewusst. Ein negatives Selbstkonzept ist sehr änderungsresistent, da wir viele Bedingungen der Wertschätzung schon in frühester Jugend gelernt haben. Sie wirken negativ auf unseren Selbstwert, weshalb wir auch weniger versuchen Änderungen herbei zu führen. (Jemand der gelernt hat, dass er tollpatschig ist, wird wahrscheinlich keinen Tanzkurs besuchen und somit nicht die Erfahrung machen, dass das gar nicht stimmt.) Das Selbstkonzept ist sozial konstruiert und wir bewerten uns eher nach dem, was andere über uns sagen, als nach unserem eigenen Gefühl. Umso größer die bedingungslose Wertschätzung, die wir erfahren haben, desto größer ist die Übereinstimmung zwischen Selbst und Selbstkonzept und desto gesünder sind wir. Die bedingungslose Wertschätzung, die uns zu gesunden Menschen werden lässt, sollte natürlich in erster Linie von den Eltern kommen. Je nachdem wie angemessen deren Selbstkonzept ist, werden sie ihre Kinder mehr oder weniger bedingungslos wertschätzen. Dementsprechend wie sehr jemand Bedingungen der Wertschätzung internalisiert hat, wird er für hoch- oder niederfunktional eingestuft. Hochgradig funktionale Erwachsene haben ein großes Maß an Akzeptanz für sich selbst und andere Menschen und belegen ihre Kinder daher mit weniger Bedingungen der Wertschätzung. Geringgradig funktionale Personen hingegen sind aufgrund ihrer eigenen vielfältigsten Bedingungen der Wertschätzung weniger akzeptierend und daher in höherem Maß bewertend. Ihre Kinder werden mit vielen Bedingungen der Wertschätzung belegt. Unsere Bedingungen der Wertschätzung sind somit dafür verantwortlich, dass wir eine wertende Haltung gegenüber uns selbst und anderen gegenüber einnehmen. Man könnte auch sagen, dass selbstakzeptierende Menschen weniger Abwehrmechanismen brauchen, weshalb sie laut Rogers die Welt realistischer wahrnehmen und sie daher in weniger großen Umfang durch Verzerrungen an ihr Selbstkonzept anpassen müssen. Im Laufe der Therapie sollen laut Rogers die Verzerrungen der Wahrnehmung abnehmen und das Individuum einen Zugang zu seinem organismischen Selbst bekommen. Rogers ging davon aus, dass Kinder ein organismisches Selbstkonzept hätten, nachdem sie entscheiden, welche Erfahrung richtig und welche falsch ist. Er ging sogar soweit, dass er meinte, Babies würden sogar das richtige Essen für sich wählen, wenn man sie ließe. (Das wurde in späteren Experimenten widerlegt). Bestätigt ist jedoch, dass, wenn Erwachsene persönliches Wachstum erfahren wollen, sie auf die Signale ihres Körpers und ihre Intuition vertrauen müssen. Dies gelingt umso leichter, je weniger Bedingungen die Eltern stellten. Rogers formulierte daraus ein Rezept für eine gute Schule, die demokratisch wäre und Bedingungen bereitstelle, die das Lernen des Kindes begünstigen. Kinder sollen in einem sicheren und humanen Umfeld aufwachsen. Für die Selbstaktualisierung gibt es keine sensible Phase. Sie findet das ganze Leben hindurch statt. Notwendig ist eine positive Umgebung damit optimales, persönliches Wachstum möglich wird. Der Endpunkt der Selbstaktualisierung besteht für Rogers darin, dass die Person voll funktional, offen für Erfahrungen und mit hoher Selbstakzeptanz ausgestattet ist. Sie hat zudem wenige Bedingungen der Wertschätzung. Sie lässt sich von ihrem organismischen Selbst leiten. Wenn sie Fehler macht, können diese offen gelegt werden und sie kann daraus lernen. Allerding meinte Rogers auch, dass solche Menschen weniger Fehler machen. Rogers Konzept psychischer Probleme: Je mehr Bedingungen der Wertschätzung jemand aufweist, desto weniger psychisch gesund ist er. Das Individuum wird durch diese Bedingungen von seinem wahren organismischen Selbst entfremdet. Es wird unzufrieden, aggressiv oder depressiv. Rogers verwehrte sich gegen Diagnostik, da sie das Gefälle zwischen Klienten und Therapeuten festschreibe, den Klienten entmachte. Therapieziele sind für Rogers, dass der Klient eine positive wertschätzende Beziehung und eine sichere Umgebung erlebt, damit er sein wahres Selbst erkennen kann. Rogers therapierte in Gruppensitzungen. Wenn wir viele Bedingungen der Wertschätzung haben, bewerten wir uns selbst danach. Wir wissen, dass wir viele Makel haben, da wir uns diese Bedingungen auferlegen. Nur wenn wir die Bedingungen erfüllen, werden wir geliebt. Umso weiter das ideale Selbst und das wahre Selbst auseinander liegen, desto unwohler fühlen wir uns, desto unglücklicher sind wir. Die Rolle des Therapeuten: Rogers sah als erster, dass die Beziehung zwischen Klienten und Therapeuten essentiell ist. Die Klienten tragen die Fähigkeit zur Veränderung in sich, der Therapeut ermöglich den Prozess. Damit der Therapeut das kann, muss er bestimmte Eigenschaften besitzen. Rogers war der erste, der Selbsterfahrung für Therapeuten forderte, denn diese Eigenschaften wären Kernbedingungen der Therapie. 1. Klient und Therapeut müssen zum jeweils anderen psychologischen Kontakt haben. Therapie ist mehr als nur mit jemanden zu sprechen. Es geht um die Diskussion von Gefühlen, die sich auf das Selbst beziehen. Therapiegespräche würden nach Rogers in folgenden 7 Phasen ablaufen: 2. Der Klient befindet sich in einem Zustand der Inkongruenz und empfindet deswegen Angst. Diese Angst/Erregung motiviert den Klienten überhaupt erst in Therapie zu kommen. 3. Der Therapeut ist kongruent in der Beziehung. Er muss aufrichtig sein und nicht nur eine Rolle spielen. Sie müssen sich ihrer eigenen Gefühle bewusst sein und sie müssen mit ihren eigenen Gefühlen im Reinen sein und diese kommunizieren, wenn es angemessen ist. 4. Der Therapeut erlebt bedingungslose Wertschätzung für den Klienten. Er muss wertungsfrei gegenüber dem Klienten sein und ihn als menschliches Wesen schätzen. 5. Der Therapeut erlebt empathisches Verständnis für den internen Bezugsrahmen des Klienten. Er akzeptiert, dass es keine externe Realität gibt, sondern dass wir alle eine subjektive Sicht haben. Er bemüht sich die Weltsicht des Klienten zu verstehen, damit er nachvollziehen kann, was der Klient erlebt und fühlt. Hier unterscheidet Rogers zwischen Mitgefühl und Empathie. Mitgefühl ist etwas, das wir ausdrücken, wenn wir z. B. einem Freund sagen, dass es wirklich schrecklich ist, was er gerade erlebt, dass wir wissen, wie er sich fühlt. Damit stimmen wir der negativen Interpretation des Erlebnisses zu. Wir verstärken die Wahrnehmung. Das ist nicht die Aufgabe des Therapeuten! Der Therapeut ist empathisch, er beurteilt die Erfahrungen des Klienten nicht. Durch aufmerksames Zuhören und das Stellen von Fragen in Bezug auf die vorangegangenen Ereignisse hilft der Therapeut dem Klienten sich selbst klarer über seine Situation und Gefühle zu werden. 6. Der Therapeut ist ein Rollenmodell. Der Klient nimmt die bedingungslose positive Wertschätzung auf Seiten des Therapeuten und das empathische Verständnis für seine Probleme wahr. Damit erlebt der Klient das erste Mal eine Beziehung in der er sich wertgeschätzt und verstanden fühlt. Die fördert persönliches Wachstum und Veränderung. Diese therapeutische Beziehung fördert beim Klienten: Eine realistischere Wahrnehmung ihrer Lebensumwelt – sie werden für neue Erfahrungen offener Sie verhalten sich rationaler, Selbstaktualisierungstendenz Sie übernehmen mehr persönliche Verantwortung Sie achten sich selbst mehr. Ihre Gefühle in Beziehung auf sich selbst basieren nun auf ihren eigenen Wertvorstellungen statt auf dem Lob und den Bedürfnissen anderer Menschen Sie haben eine gesteigerte Fähigkeit zu guten interpersonellen Beziehungen Sie leben nach ethischen Prinzipien, sie vertrauen den eigenen inneren Gefühlen, statt des Sich-Verlassens auf externe Autoritäten Sie konzentrieren sich in ihrem Wertesystem auf Menschen und Beziehungen (nicht auf Dinge) Sie schätzen die Natur mehr und haben Ehrfurcht ihr gegenüber haben einen besseren Zugang zu ihrer Gemessen wird das Selbstkonzept mit der Q-Sort-Technik: Die Q-Sort-Technik stammt von William Stephenson (1953) und wird zur Messung der subjektiven Sichtweise einer Person angewendet. Der Test besteht aus 100 Adjektiven, die auf Kärtchen gedruckt sind. Die Testperson soll diese Karten dann in neuen Kategorien sortieren, je nachdem wie sehr dieses Adjektiv oder diese Aussage auf sie zutrifft. 1. Durchgang: der Klient sortiert die Karten nach der Übereinstimmung mit dem aktuellen Selbstkonzept. (Was bin ich für eine/r?) 2. Durchgang: die Karten werden neu gemischt und dann noch einmal durch den Klienten sortiert nach dem idealen Selbst. Dieser Test wird im Laufe der Therapie immer wiederholt, damit sichtbar wird, wie sich unser Selbstkonzept verändert und wie unser organismisches Selbst beschaffen ist. Zu Beginn der Therapie ist die Diskrepanz zwischen Idealem Selbst und Selbstkonzept gering. Das Individuum akzeptiert sich in bestimmten Bereich nicht. Diese Diskrepanz sollte nach einiger Zeit der Therapie geringer werden.