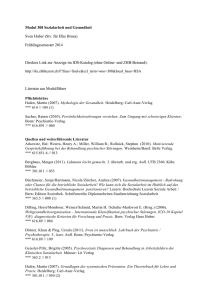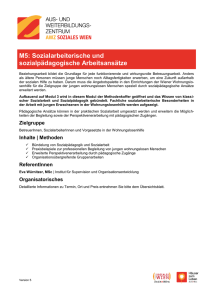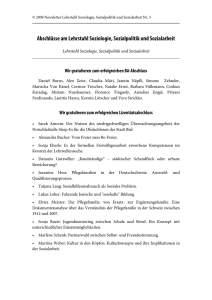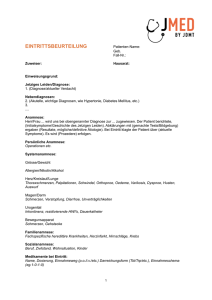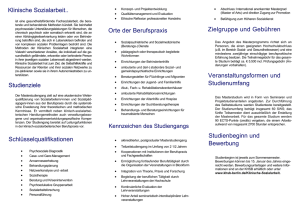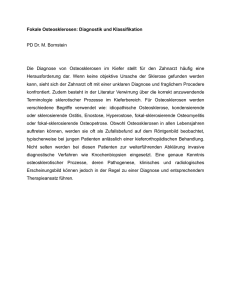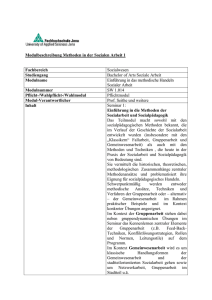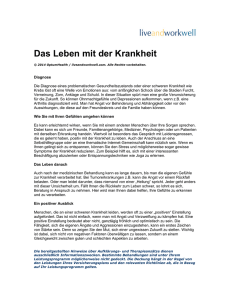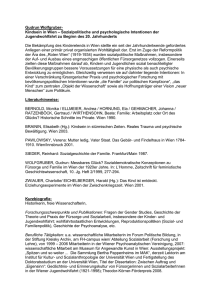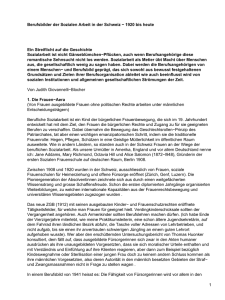Warum es keine standardisierte Soziale Diagnose geben kann
Werbung
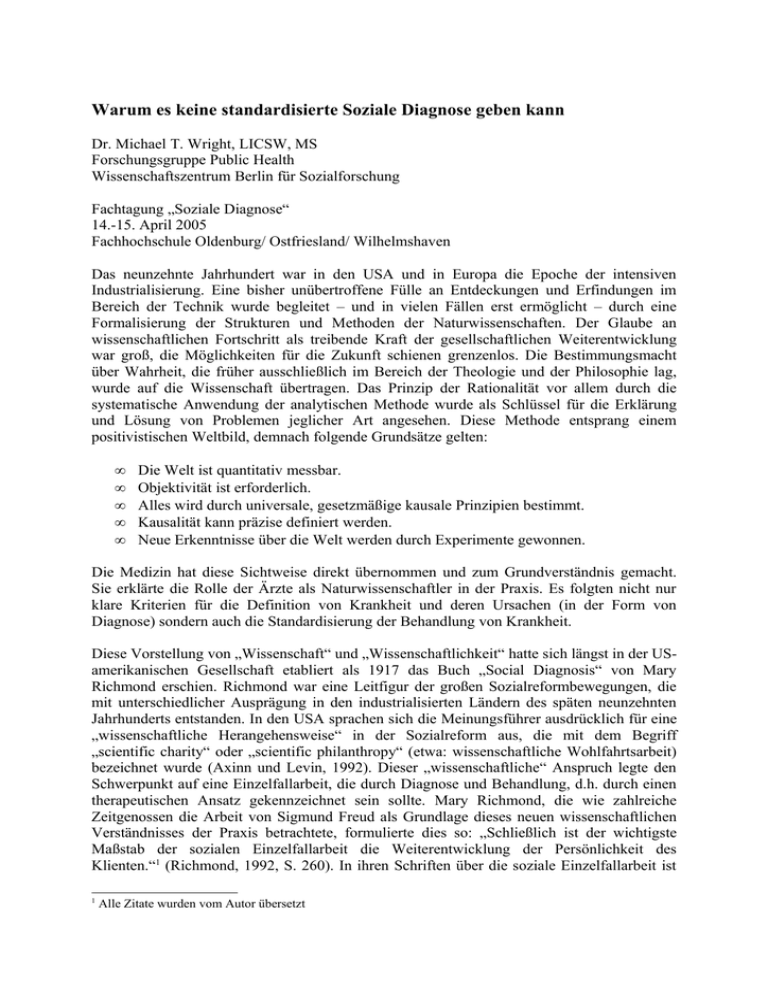
Warum es keine standardisierte Soziale Diagnose geben kann Dr. Michael T. Wright, LICSW, MS Forschungsgruppe Public Health Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Fachtagung „Soziale Diagnose“ 14.-15. April 2005 Fachhochschule Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven Das neunzehnte Jahrhundert war in den USA und in Europa die Epoche der intensiven Industrialisierung. Eine bisher unübertroffene Fülle an Entdeckungen und Erfindungen im Bereich der Technik wurde begleitet – und in vielen Fällen erst ermöglicht – durch eine Formalisierung der Strukturen und Methoden der Naturwissenschaften. Der Glaube an wissenschaftlichen Fortschritt als treibende Kraft der gesellschaftlichen Weiterentwicklung war groß, die Möglichkeiten für die Zukunft schienen grenzenlos. Die Bestimmungsmacht über Wahrheit, die früher ausschließlich im Bereich der Theologie und der Philosophie lag, wurde auf die Wissenschaft übertragen. Das Prinzip der Rationalität vor allem durch die systematische Anwendung der analytischen Methode wurde als Schlüssel für die Erklärung und Lösung von Problemen jeglicher Art angesehen. Diese Methode entsprang einem positivistischen Weltbild, demnach folgende Grundsätze gelten: • • • • • Die Welt ist quantitativ messbar. Objektivität ist erforderlich. Alles wird durch universale, gesetzmäßige kausale Prinzipien bestimmt. Kausalität kann präzise definiert werden. Neue Erkenntnisse über die Welt werden durch Experimente gewonnen. Die Medizin hat diese Sichtweise direkt übernommen und zum Grundverständnis gemacht. Sie erklärte die Rolle der Ärzte als Naturwissenschaftler in der Praxis. Es folgten nicht nur klare Kriterien für die Definition von Krankheit und deren Ursachen (in der Form von Diagnose) sondern auch die Standardisierung der Behandlung von Krankheit. Diese Vorstellung von „Wissenschaft“ und „Wissenschaftlichkeit“ hatte sich längst in der USamerikanischen Gesellschaft etabliert als 1917 das Buch „Social Diagnosis“ von Mary Richmond erschien. Richmond war eine Leitfigur der großen Sozialreformbewegungen, die mit unterschiedlicher Ausprägung in den industrialisierten Ländern des späten neunzehnten Jahrhunderts entstanden. In den USA sprachen sich die Meinungsführer ausdrücklich für eine „wissenschaftliche Herangehensweise“ in der Sozialreform aus, die mit dem Begriff „scientific charity“ oder „scientific philanthropy“ (etwa: wissenschaftliche Wohlfahrtsarbeit) bezeichnet wurde (Axinn und Levin, 1992). Dieser „wissenschaftliche“ Anspruch legte den Schwerpunkt auf eine Einzelfallarbeit, die durch Diagnose und Behandlung, d.h. durch einen therapeutischen Ansatz gekennzeichnet sein sollte. Mary Richmond, die wie zahlreiche Zeitgenossen die Arbeit von Sigmund Freud als Grundlage dieses neuen wissenschaftlichen Verständnisses der Praxis betrachtete, formulierte dies so: „Schließlich ist der wichtigste Maßstab der sozialen Einzelfallarbeit die Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Klienten.“1 (Richmond, 1992, S. 260). In ihren Schriften über die soziale Einzelfallarbeit ist 1 Alle Zitate wurden vom Autor übersetzt 2 Richmond bemüht, eine methodische Basis für die neue Profession der Sozialarbeit zu schaffen, um dadurch nicht nur die Praxis der Sozialarbeiter zu verbessern sondern auch mehr Anerkennung für den spezifischen Beitrag der Sozialarbeit zur Linderung sozialer Probleme zu verdeutlichen. Richmond beklagte die Unvollständigkeit ihrer methodischen Ausführungen sowie die noch fehlenden Beweise für die Wirksamkeit der Einzelfallarbeit, war aber zuversichtlich, dass durch Forschung und die weitere Systematisierung der Praxis „die Wahrheit“ sozialer Probleme und deren Ursachen entdeckt werden könnten. Dementsprechend machte sie nach naturwissenschaftlichem Vorbild eine Genauigkeit in der Praxis der Diagnose zum Ziel (Richmond, 1917; S. 51): „Der Gebrauch des Begriffs ‚Diagnose’ beschränkt sich nicht auf die Medizin, sondern findet auch Anwendung in der Zoologie und der Botanik, zum Beispiel als „eine kurze, präzise, einzig richtige Definition“. In der sozialen Diagnose wird ebenfalls versucht, so genau wie möglich die soziale Situation sowie die Persönlichkeit des Klienten zu definieren.“ Dem Zeitgeist der Entdeckung und des Forschritts entsprechend stellt Richmond in einem anderen Werk fest: (1922, S. 257): „Wichtige Bausteine für eine praxisleitende Philosophie werden hier in diesem Buch vorgestellt – aber im vollen Bewusstsein dessen, dass andere, grundlegend wichtigere Bausteine bald entdeckt werden könnten.“ Dem Appell Mary Richmonds folgend machte sich die US-amerikanische Sozialarbeit zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts auf die Suche nach einer standhaften wissenschaftlichen Grundlage für die Praxis. Beinahe hundert Jahre später sind Fakultäten für Sozialarbeit an zahlreichen US-amerikanischen Universitäten etabliert. Alle akademischen Abschlüsse bis zur Promotion werden in über 600 akkreditierten Studiengängen angeboten. Mehr als 400 Fachzeitschriften werden in der nationalen wissenschaftlichen Literaturdatenbank der Sozialarbeit erfasst. Zahlreiche Spezialisierungen und Schwerpunkte der Fachsozialarbeit werden anerkannt – nicht nur diverse Formen der klientenbezogenen oder der so genannten klinischen Sozialarbeit, sondern auch Sozialmanagement, Forschung und politische Themenfelder. Für die meisten Arbeitsbereiche existieren Leitlinien und Standards. Staatsexamen und Berufsregister kennzeichnen die verschiedenen Stufen der staatlichen Anerkennung, die auch die Abrechnung von Beratungsgesprächen über Krankenversicherungsträger ermöglicht. Entgegen der Vorstellung von Mary Richmond hat jedoch die weitere Professionalisierung der Sozialarbeit in den USA weder zu einer Standardisierung der Methoden noch zu einer eigenständigen, allgemein akzeptierten theoretischen oder empirischen Grundlage für die Praxis geführt. Wie der renommierte Francis Turner – Autor zahlreicher Aufsätze und Lehrbücher zu Methoden der klinischen Sozialarbeit – feststellt, gab es in der Geschichte der nordamerikanischen Sozialarbeit noch nie eine so große Vielfalt an Praxisansätzen und so ausgeprägte Meinungsunterschiede zu deren Anwendung wie heute. Dies gilt auch für die Praxis der sozialen Diagnose. Wie zu Zeiten von Mary Richmond bleibt sogar der Begriff „Diagnose“ unter Praktikern und Theoretikern noch umstritten, vor allem wegen dessen medizinischer Konnotationen (Turner, 2002). 3 Wie kommt es, dass bis heute noch keine allgemeingültige Definition der sozialen Diagnose existiert? Was ist die Folge dieses Zustandes für die Sozialarbeit, vor allem für die weitere Professionalisierung der Sozialarbeit in Deutschland? Obwohl der Positivismus bereits im neunzehnten Jahrhundert von Auguste Comte auf die wissenschaftliche Abhandlung sozialer Probleme übertragen wurde und bis heute noch eifrige Anhänger in vielen sozialwissenschaftlichen Bereichen genießt, gab es im Gegensatz zu den Naturwissenschaften zu keiner Zeit einen erkenntnistheoretischen Konsens. Was überhaupt „das Soziale“ ist, wie es zu untersuchen und beschreiben ist oder wie gesellschaftliche Probleme angegangen werden sollen wird je nach theoretischem Ansatz sehr unterschiedlich betrachtet. Neben der Arbeit von Comte wurden zur gleichen Zeit Grundlagen für andere gegen den Positivismus gerichtete Traditionen der Sozialwissenschaft gelegt, vor allem für die verstehende oder interpretative Tradition (z.B. nach Max Weber oder Wilhelm Dilthey) und die kritische Tradition (z.B. nach Karl Marx oder später Theodor Adorno). Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und methodischen Herangehensweisen lehnen diese Traditionen Objektivität, die Quantifizierung der sozialen Realität sowie die Beschränkung auf experimentelle Verfahren in der Empirie ab. Stattdessen werden das Subjektive und das Situative sowie die Notwendigkeit des menschlichen Handels zur Beseitigung gesellschaftlicher Missstände in den Vordergrund gestellt. Aus diesen Traditionen heraus ist eine unüberschaubare Vielfalt der heute existierenden Erklärungsmuster und Handlungsansätze entstanden: Konstruktivismus, Psychoanalyse, feministische Theorie, Systemtheorie, Materialismus, Empowerment-Theorie, Diffusionstheorie, Funktionalismus, Strukturalismus, Rollentheorie, Integrationstheorie etc. etc. etc. Die Liste der Möglichkeiten wächst ständig. Nicht nur die theoretische Vielfalt sondern auch der zunehmende Zweifel an theoretischen Erklärungen, der durch die postmoderne Kritik sichtbar geworden ist, erschwert erheblich die Suche nach einer einheitlichen wissenschaftlichen Grundlage für die Praxis. In unserer globalisierten Welt und in einer stark vom Individualismus geprägten Gesellschaft glaubt man einfach nicht mehr an „große Erzählungen“, das heißt, man glaubt nicht, dass es eine Theorie geben könnte, die den Menschenzustand endgültig erklärt. In der Praxis ist man besonders stark mit der Vielfalt der Klientenrealitäten konfrontiert: Die Komplexität und Unfassbarkeit des subjektiven Erlebens in einer multikulturellen Gesellschaft entzieht sich jeglicher Möglichkeit einer übergreifenden Klassifizierung. Ein weiterer Aspekt, der uns davon abhält, eine standardisierte Praxis der Diagnose und Behandlung zu entwickeln, ist die heutige Fokussierung der Sozialarbeit – sowohl in Deutschland als auch in den USA – auf die Selbstbestimmung des Hilfesuchenden. In den letzten dreißig Jahren hat sich auf Grund eines wachsenden Bewusstseins über gesellschaftliche Machtverhältnisse – auch hinsichtlich des Machtgefälles zwischen sozialen Einrichtungen und Hilfesuchenden – eine Werthaltung entwickelt, die die Wünsche und Weltanschauung des Hilfesuchenden in den Mittelpunkt stellt. Es hat sich nicht nur eine große Sensibilität in Bezug auf die Stigmatisierung und Ausgrenzung, die durch fremdbestimmte Problemdefinitionen und –lösungen entstehen können, entwickelt. Auch unterschiedliche Grundwerte, die Menschen innerhalb einer Gesellschaft vertreten, finden immer mehr Beachtung. Der vielfältige, selbstkritische sozialwissenschaftliche Diskurs, die hoch differenzierte, relativierende Sichtweise der Postmoderne sowie die radikale Individualisierung der Praxisbeziehung waren für Mary Richmond unvorstellbar – sind aber unsere Realität. Obwohl 4 diese Realität eine Standardisierung der Praxis unmöglich macht, heißt das nicht, dass weitere Professionalisierungsbestrebungen der Sozialarbeit der Beliebigkeit ausgesetzt sind. Zwei Grundaussagen von Richmond sind nach wie vor von zentraler Bedeutung: die systematische Problemanalyse ist ein zentrales Merkmal der professionellen Sozialarbeit, und jeder Sozialarbeiter muss diese Analyse begründen können. Zum letzten Punkt kommentiert Richmond (1922, S. 257): „Kein Einzelfallhelfer muss die Philosophie seiner Kollegen annehmen. Er muss jedoch eine Philosophie für seine Arbeit haben.“ Unsere Aufgabe in der weiteren Professionalisierung der Sozialarbeit – auch durch die weitere Akademisierung der Profession – ist es, Praktiker dabei zu unterstützen, eine Schärfe in der Problembetrachtung hilfebedürftiger Menschen dadurch zu erreichen, dass sie sich Klarheit sowohl über ihre eigene Werthaltung als auch über ihre eigene theoretische Grundorientierung in ihrer Arbeit verschaffen. Dabei sind die bereits existierenden sozialwissenschaftlichen Theorien von großem Nutzen, da sie eine Auseinandersetzung mit grundlegenden Themen der Entstehung und Behandlung sozialer Probleme fördern. Einige Praktiker finden durch diese Auseinandersetzung eine „theoretische Heimat“, die sie in ihrer Arbeit dauerhaft begleitet. Die Identifizierung mit einem bestimmten Theoretiker oder mit einer bestimmten theoretischen Richtung ist jedoch nicht das Ziel, sondern eine Sensibilisierung für die oft impliziten persönlichen Erklärungsmuster, die die Praxis leiten und mit einem bestimmten Menschenbild zusammenhängen. Professionalität bedeutet, dass diese implizite theoretische Grundlage explizit gemacht wird und durch regelmäßige und transparente Prozesse der Überprüfung der eigenen Arbeit – auch durch Einbeziehung der Wirkung der Arbeit – reflektiert wird. Das Ergebnis sollte sein, dass Sozialarbeiter in die Lage versetzt sind, ihr Handeln stets begründen zu können – und dies auf der Basis nachvollziehbarer Kriterien der Plausibilität, die sich auf eine empirische Grundlage stützen (wobei sich „empirisch“ nicht auf formale Untersuchungen beschränkt, sondern auch die interne Dokumentation der Ergebnisse von Interventionen sowie externe Daten über die Entwicklung des zu bekämpfenden sozialen Problems einschließt). Dies hat zur Folge, dass nicht die von außen entwickelten Theorien und Praxismethoden, sondern die aus der Praxiserfahrung vor Ort entstehenden lokalen Theorien und empirischen Beobachtungen im Mittelpunkt einer professionellen und qualitätsgesicherten Praxis stehen. Dementsprechend ist der wichtigste Maßstab für die Praxis der Diagnose und Behandlung nicht die Frage, ob eine bestimmte sondern ob überhaupt eine theoretische Erklärung für die Arbeit vorliegt. Zudem muss diese Erklärung die Entwicklung angemessener Maßnahmen ermöglichen. Deren Eignung lässt sich letztendlich daran messen, inwieweit die Hilfesuchenden angesprochen werden und ob die von der Einrichtung im Rahmen deren Auftrags formulierten Ziele erreicht werden können. Es ist eine große wissenschaftliche und praktische Herausforderung zu definieren, wie eine derart dezentralisierte Qualitätssicherung in der Praxis zu unterstützen ist, eine Form der Qualitätssicherung, die Professionalität nicht als Normierung und Standardisierung, sondern als transparenten Prozess der diskursiven, theoretisch geleiteten, empirisch gestützten Gestaltung versteht. 5 Literatur Axinn, J; Levin, H (1992) Social welfare. A history of the American response to need. London, New York: Longman Publishing Group. Richmond, ME (1917) Social diagnosis. New York: Russell Sage Foundation. Richmond, ME (1922) What is social case work? New York: Russell Sage Foundation. Turner, FJ (2002) Diagnosis in social work. New imperatives. New York: The Haworth Social Work Practice Press.