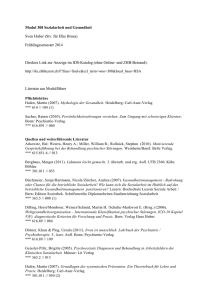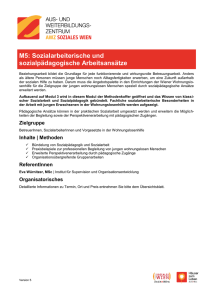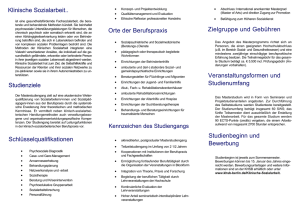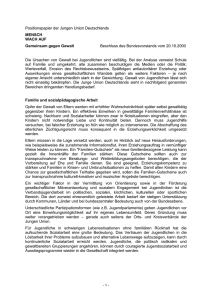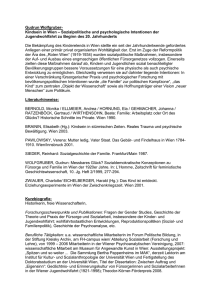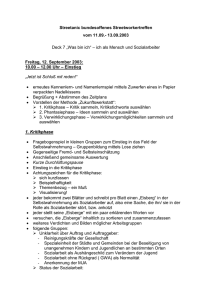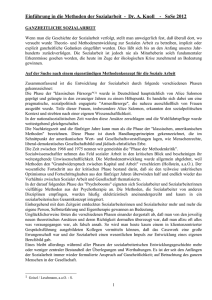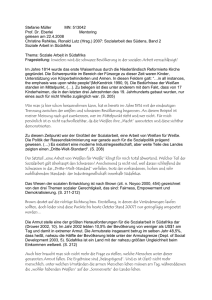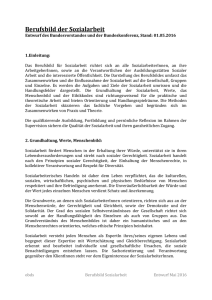Berufsbilder der Sozialen Arbeit in der Schweiz
Werbung
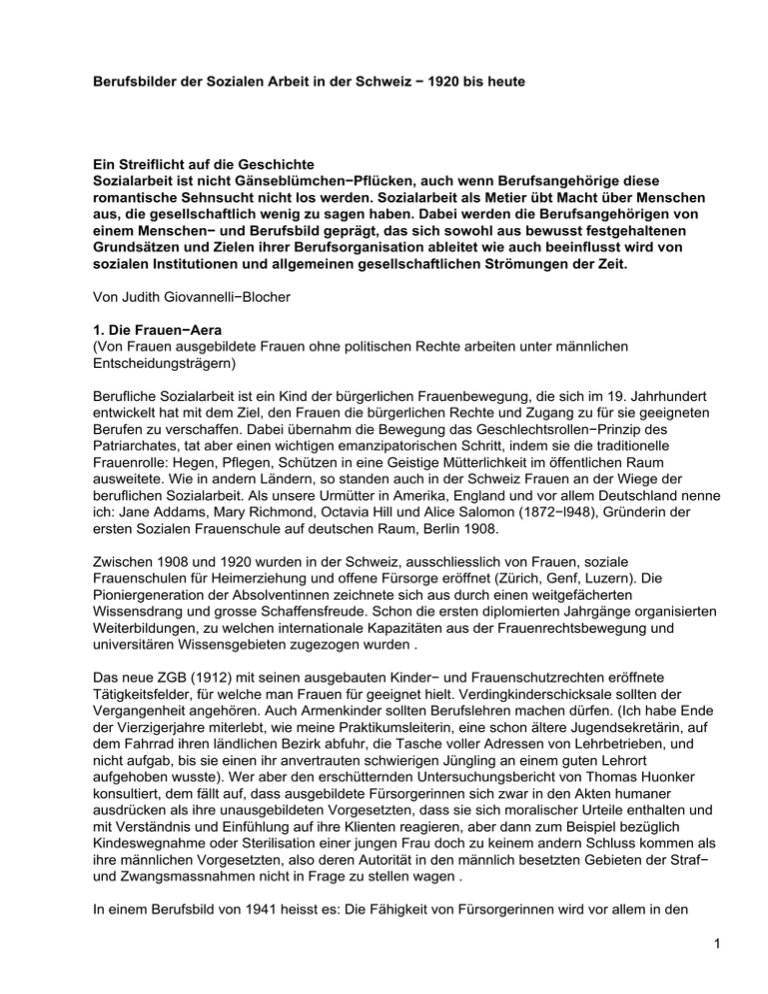
Berufsbilder der Sozialen Arbeit in der Schweiz − 1920 bis heute Ein Streiflicht auf die Geschichte Sozialarbeit ist nicht Gänseblümchen−Pflücken, auch wenn Berufsangehörige diese romantische Sehnsucht nicht los werden. Sozialarbeit als Metier übt Macht über Menschen aus, die gesellschaftlich wenig zu sagen haben. Dabei werden die Berufsangehörigen von einem Menschen− und Berufsbild geprägt, das sich sowohl aus bewusst festgehaltenen Grundsätzen und Zielen ihrer Berufsorganisation ableitet wie auch beeinflusst wird von sozialen Institutionen und allgemeinen gesellschaftlichen Strömungen der Zeit. Von Judith Giovannelli−Blocher 1. Die Frauen−Aera (Von Frauen ausgebildete Frauen ohne politischen Rechte arbeiten unter männlichen Entscheidungsträgern) Berufliche Sozialarbeit ist ein Kind der bürgerlichen Frauenbewegung, die sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat mit dem Ziel, den Frauen die bürgerlichen Rechte und Zugang zu für sie geeigneten Berufen zu verschaffen. Dabei übernahm die Bewegung das Geschlechtsrollen−Prinzip des Patriarchates, tat aber einen wichtigen emanzipatorischen Schritt, indem sie die traditionelle Frauenrolle: Hegen, Pflegen, Schützen in eine Geistige Mütterlichkeit im öffentlichen Raum ausweitete. Wie in andern Ländern, so standen auch in der Schweiz Frauen an der Wiege der beruflichen Sozialarbeit. Als unsere Urmütter in Amerika, England und vor allem Deutschland nenne ich: Jane Addams, Mary Richmond, Octavia Hill und Alice Salomon (1872−l948), Gründerin der ersten Sozialen Frauenschule auf deutschen Raum, Berlin 1908. Zwischen 1908 und 1920 wurden in der Schweiz, ausschliesslich von Frauen, soziale Frauenschulen für Heimerziehung und offene Fürsorge eröffnet (Zürich, Genf, Luzern). Die Pioniergeneration der Absolventinnen zeichnete sich aus durch einen weitgefächerten Wissensdrang und grosse Schaffensfreude. Schon die ersten diplomierten Jahrgänge organisierten Weiterbildungen, zu welchen internationale Kapazitäten aus der Frauenrechtsbewegung und universitären Wissensgebieten zugezogen wurden . Das neue ZGB (1912) mit seinen ausgebauten Kinder− und Frauenschutzrechten eröffnete Tätigkeitsfelder, für welche man Frauen für geeignet hielt. Verdingkinderschicksale sollten der Vergangenheit angehören. Auch Armenkinder sollten Berufslehren machen dürfen. (Ich habe Ende der Vierzigerjahre miterlebt, wie meine Praktikumsleiterin, eine schon ältere Jugendsekretärin, auf dem Fahrrad ihren ländlichen Bezirk abfuhr, die Tasche voller Adressen von Lehrbetrieben, und nicht aufgab, bis sie einen ihr anvertrauten schwierigen Jüngling an einem guten Lehrort aufgehoben wusste). Wer aber den erschütternden Untersuchungsbericht von Thomas Huonker konsultiert, dem fällt auf, dass ausgebildete Fürsorgerinnen sich zwar in den Akten humaner ausdrücken als ihre unausgebildeten Vorgesetzten, dass sie sich moralischer Urteile enthalten und mit Verständnis und Einfühlung auf ihre Klienten reagieren, aber dann zum Beispiel bezüglich Kindeswegnahme oder Sterilisation einer jungen Frau doch zu keinem andern Schluss kommen als ihre männlichen Vorgesetzten, also deren Autorität in den männlich besetzten Gebieten der Straf− und Zwangsmassnahmen nicht in Frage zu stellen wagen . In einem Berufsbild von 1941 heisst es: Die Fähigkeit von Fürsorgerinnen wird vor allem in den 1 erzieherischen, pflegerischen und hauswirtschaftlichen Gaben gesehen, in der Fähigkeit, die Mütterlichkeit vom Haus auf die Gemeinde zu übertragen. Im Film Die Fürsorgerin, der an der Landi 1939 gezeigt wurde, erscheint diese in weisser Schürze im Haushalt einer Armenfamilie und schaut tatkräftig zum Rechten. Obwohl die Absolventinnen der Sozialschulen auch zu den vorberatenden Kommissionen der IV und AHV−Gesetzgebung beigezogen wurden, obwohl sie, besonders in der Behinderten− und Jugendfürsorge, auch leitende Stellen inne hatten: den Primat behielten die patriarchalen Normen. Die langjährige Leiterin der Schule für Sozialarbeit Zürich, Dr. iur. Margrit Schlatter (1934 −1960), suchte in allen wichtigen Belangen stets den Rat des Präsidenten der Schule, des freisinnigen Regierungsrats Dr. Robert Briner; sein Urteil war ihr sakrosankt. Die gesellschaftlich verordnete Bescheidenheit in der Sozialarbeit, deren Ende Silvia Staub−Bernasconi 1995 dringlich und ingrimmig fordert, damit diese endlich einer Menschenrechtsprofession Platz mache , hat hier ihren Ursprung. Berta Hohermuth Teilnehmerin des Zürcher Kurses 1926−1928 und später in internationalen Kaderfunktionen tätig, beschrieb im Alter ihre beruflichen Anfangsjahre so: Man wurde derart gebraucht und ich liebte meine Arbeit so, dass ich es fast nicht fassen konnte, dass ich auch noch dafür bezahlt wurde (Fr.300.− pro Monat). Das erinnert mich an den Diakonissen−Leitspruch: Mein Lohn ist, dass ich darf! 2. Die Frauen lassen die Männer rein (Der Beruf professionalisiert sich, sein Ansehen steigt) Das Motiv entstammte der Sorge um die Entwicklung des Berufs. Es war unhaltbar, dass Sozialarbeiterinnen unter männlichen Chefs arbeiten mussten, die keinen fachberuflichen Hintergrund hatten. Durch die Aufnahme von Männern in die Ausbildung und dann rasch auch in die Dozentenschaft und Schulleitung, drang sozialarbeiterisches Denken und Handeln in jene Berufskreise vor, die noch immer das Sagen hatten . Da die Pioniergeneration von Sozialarbeiterinnen wie gezeigt trotz emanzipatorischen Idealen (gelegentlich wurde in der Öffentlichkeit gemunkelt, an den Sozialschulen würden Suffragetten ausgebildet) sich noch nicht getraute, den patriarchalen Deckel über sich zu sprengen, ist es nicht verwunderlich, dass sie den einströmenden Männern gleich die Führungsplätze überliessen. Im Handumdrehen waren die vorher ausschliesslich von Frauen geleiteten Schulen in den Führungsgremien vorwiegend männlich besetzt und die zentralen Basisfächer wurden von Männern erteilt, während die Frauen für die ausführenden Sparten zuständig waren: Methoden, Praktikumsvermittlung, Supervision etc. 1950 brachte Anni Hofer von ihrem Aufenthalt in der USA als UNO−Stipendiatin (zusammen mit Nelly Morell−Vögtli) die Methode des Caseworks an die Zürcher Schule. Die Begegnung mit der Psychoanalyse gab der Social−work−Methodik eine deutliche psychologische Orientierung. Das psychoanalytische Ordnungssystem der Persönlichkeit und die damit verbundene dynamische Betrachtungsweise führten dazu, den Klienten ausdrücklich in den Mittelpunkt zu stellen, sagt Tuggener in seinem Buch . Das Berufsbild wurde geprägt von der Akzeptierenden Haltung und der Beruflichen Distanz. Die Berufsfelder wurden ausgeweitet in die soziale Gruppen− und Gemeinwesenarbeit. Die neue Betrachtungsweise durchzusetzen, bedeutete einen heroischen Kampf . Die Sozialbehörden waren konsterniert, dass es plötzlich wichtig war, dass ein anzuschaffender Mantel auch der Klientin gefallen müsse (so hiessen nun die früheren Schützlinge). Nach der modernen Methode arbeitende Heime wie etwa der Erlenhof bei Basel nahmen Mitbewohner nur dann auf, wenn diese selbst ihre Zustimmung dazu gaben. Ich habe den Frust von Eltern miterlebt, die im Geschäft einen Tag freigenommen und sich in Sonntagskleidung gestürzt 2 hatten, um mit ihrem Sohn nach Basel zu fahren − und dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause zurückkehren mussten, weil ihr missratener Sprössling die Zustimmung zum Aufenthalt verweigert hatte! Mit der Zeit relativierten sich die radikalen Anfänge dieser Methode etwas, aber Grundlegendes blieb: Kinder werden auf ihre Umplazierung gründlich vorbereitet und auch befragt, ihre Wünsche sind bei der Kinderzuteilung in Scheidungsfällen massgeblich, vor allem aber: im Zentrum der sozialarbeiterischen Entscheidungen steht das Gespräch mit dem Klienten, das Kennenlernen seiner subjektiven Sicht, seiner persönlichen Beweggründe und Möglichkeiten. Die berufseigene Methode, eng verknüpft mit der Einführung von Supervision, damals in der Schweiz ein Novum, profilierte den Beruf zu einer selbständigen Profession. Sozialarbeit wurde verstanden als ein Behandlungsprozess, beginnend mit gründlicher Abklärung und gemeinsamer Zielformulierung, die dann in vertiefter Gesprächsführung zu erreichen versucht wurde. Sachhilfe rückte etwas in den Hintergrund. Die Professionalisierungsbestrebungen erhielten mächtig Auftrieb durch die vom Berufsverband in Auftrag gegebene Leistungsanalyse bei der ETH, die unseren Beruf auf dem Niveau eines Sekundarlehrers einstufte. Dies war ein Markstein, der das Ansehen des Berufs (und die Löhne) hob. Dennoch hatten Sozialarbeitende Bedenken, den Beruf wie alle andern voll und ganz in die gängige Berufshierarchie einzugliedern. Die Solidarität mit Randständigen als Haltungsgrundsatz blieb wichtig. Sozialarbeit definiere sich selbst, erklärte damals die an der Zürcher Schule tätige Paula Lotmar stolz. 3. Handlanger einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung? (Die politische Phase und ihr allmähliches Verblassen im Psycho−Boom, esoterischen und künstlerischen Selbsterfahrungs−Techniken) Das 1973 erschienene Buch: Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen entlarvte Sozialarbeit als Instrument bürgerlicher Herrschaft zur Disziplinierung unbotmässiger Menschen. Es löste in Berufskreisen einen Schock aus. Zahlreiche linke Gruppierungen aus der 68−er Bewegung, wie die Heimkampagne oder die Speak−Out−Stellen für sich missverstanden fühlende Klienten drangen in das bisher beinahe geschlossene Haus der Sozialarbeit ein und fühlten uns unzimperlich auf den Zahn, unterstützt von Medien− und Filmjournalisten. Ich erinnere mich, wie eine Delegation der Heimkampagne in mein Büro auf der Jugendanwaltschaft Horgen eindrang und mir vorwarf, dass ich einen begabten Jungen in einem Rosstall plaziert hatte (nach dieser Stelle hatte ich lange gesucht, um den Wunsch des Burschen nach einer Arbeit mit Tieren zu erfüllen). Nach einer auf Druck der Intervenierenden vorgenommen Umplazierung in eine WG von Pfarrer Sieber zeigte es sich, dass der Klient zwar seine sozialen Probleme nicht los wurde, aber deutlich an Selbstsicherheit dazu gewann. Sozialarbeit, besonders die Heimerziehung und Institutionen des Strafmassnahme−Vollzugs verdanken der 68−er Bewegung sehr viel. Dank ihrem radikalen Vorgehen und dem Einbezug der Medien wurden damals viele Institutionen, die noch immer in repressivem Stil geführt wurden, endlich umstrukturiert und professionalisiert. Die Entlarvung der Wissenschaften und der Rechtssprechung als Herrschaftsinstrumente rückte Autoren wie Ivan IlIich und Paulo Freire in eine Vorreiterrolle. In ihrem bahnbrechenden Referat: Sozialarbeit im Spannungsfeld sozialer Gesetzgebung liess Paula Lotmar die neuen Erkenntnisse auf überzeugende Weise aufleuchten: Die Normengerechtigkeit des Gesetzes und die Wirklichkeitsgerechtigkeit der Sozialarbeit können sich oft nicht decken, sagte sie, und: Es ist meine persönliche Überzeugung, dass es nicht Aufgabe des Sozialarbeiters ist, am Schutz der Gesellschaft vor Gesetzesübertretern mitzuwirken. Wer sich im Spannungsfeld der Sozialarbeit mit doppeltem Mandat nicht mehr wohl fühlte oder nicht länger links reden und rechts essen wollte, 3 ging in die alternative Sozialarbeit, jene in Selbsthilfe gegründeten Einrichtungen für geschlagene Frauen, Drogenkranke, psychiatrische Wohngemeinschaften etc. Hier gab es viel Arbeit, wenig Lohn und grosse Lernprozesse bezüglich gruppendynamischer Probleme innerhalb der basisdemokratischen Strukturen. Es war eine anstrengende Zeit. Kein Wunder, dass sich bald Fluchtwege aus der politisierenden Sozialarbeit, wo die Helfer der Randständigen selbst in den Geruch von Aussenseitern gerieten, anboten: es waren die Techniken der humanistischen Psychologie, künstlerische und esoterische Ansätze. Ruth Brack musste mit: Methode − Fetisch oder Arbeitsinstrument? den Mahnfinger erheben und einige Jahre später auf Konkurrenz aus angrenzenden Berufen (Psychologie/Ethnologie etc.) aufmerksam machen und zur Abgrenzung anhalten. Das 1980 erschienene Berufsbild von Christina v. Passavant hütet sich vor Zuspitzungen und bleibt sehr im Allgemeinen . Eine sehr innovative Ausweitung des Berufsbildes leistet seit den 70er−Jahren bis heute die feministische Bewegung innerhalb der Sozialarbeit. Weibliches Arbeitsvermögen, weibliches Denken und Fühlen, die Wichtigkeit von Körper und Sexualität, geschlechtsspezifische Unterdrückung, weibliche Armut, Sexismus und Rassismus: diese vorher vernachlässigten Themen werden nun in Aus− und Fortbildung heftig diskutiert, aber vor allem: die tradierten Geschlechtsrollen wurden in den letzten Jahrzehnten vielleicht in keinem andern Beruf so stark aufgelöst wie in der Sozialarbeit, wo Männer Betreuungs− und Pflegeaufgaben übernehmen, in Horten und Kleinkinderheimen arbeiten etc. Aber noch immer hapert es auf dem Hauptgebiet: bei der Verteilung der Macht, den Führungspositionen. Und bis heute ist das Fussvolk der Sozialarbeit zu zwei Dritteln weiblich. 4. Sozialarbeit im Würgegriff von Sparmassnahmen und Sozialabbau Unsanft wurde die Sozialarbeit anfangs der 80−er Jahre an ihre Grundaufgabe erinnert. Das Stichwort Neue Armut, zunehmende Arbeitslosigkeit, Working Poors, Alleinerziehende mit Kindern, Asylbewerber: Armut war nicht mehr, wie seit Jahrzehnten, ein individuelles Phänomen; die Ursachen waren vielmehr in generellen Gruppierungen analysierbar. In wenigen Jahren nahmen die Unterstützungsfälle um das Doppelte zu. Dadurch geriet die Sozialarbeit ins Interesse der Öffentlichkeit, der Politik, der Medien. Evaluation dessen, was geschah, erhöhte Kontrolle, zum Beispiel der Anspruch auf laufende Qualitätskontrolle, wertete einerseits unsere Berufstätigkeit auf und gab ihr neue Impulse: man wurde plötzlich ernst genommen. Die Ausbildungsstätten wurden auf Hochschulniveau angehoben und endlich, endlich gibt es auch berufseigene Forschungstätigkeit, wenigstens in Anfängen. (Ein erstes Resultat: 170'000 Working Poor−Haushalte in der Schweiz mit einem Einkommen unter der Sozialhilfe−Grenze verzichten auf Sozialhilfe. Das stellt ernsthafte Anfragen an die Bedingungen unserer Sozialfürsorge!). Andererseits fügen sich ins nun ökonomisch geprägte Berufsbild neue Stichworte wie New Public Management, Case Management, lösungsorientierte Ansätze. Im Vordergrund steht nicht die Frage nach den Armutsursachen (z.B. dem völlig neuen Phänomen, dass massenweise Betriebsmitarbeiter auf die Strasse gestellt werden, der Betrieb selbst aber weiterhin floriert...) Rosmarie Ruder, bis 2002 Generalsekretärin der SKOS, sagt es so: Ziele wurden formuliert, Produkte, (Dienst)−Leistungen definiert, Kennzahlen aggregiert. Und quasi durch die Hintertür (da nicht reflektiert) kam der sogenannte Paradigma−Wechsel, wonach nicht mehr die Probleme und Defizite der Klientinnen und Klienten im Mittelpunkt des sozialarbeiterischen Handelns stehen sollen, sondern die Lösungsorientierung. Es wird kaum thematisiert, dass damit soziale Probleme individualisiert werden und die gesellschaftliche Dimension von Armut ausgeblendet wird, ganz im 4 Sinne einer neoliberalen Denkweise. Als Lösung wird allzu oft nicht mehr die volle Integration von sozial Schwachen in die Gesellschaft, also auch ihre kulturelle Teilhabe, verstanden, sondern kurz und bündig einfach ihre Ablösung von finanzieller Unterstützung. Die neuesten Veränderungen im Sozialmanagement, zum Teil euphorisch umjubelt, motivieren mich dazu, an die Warnung von Max Frisch zu erinnern: Es gibt, so scheint es, einen menschlichen Masstab, den wir nicht verändern, sondern nur verlieren können. Judith Giovannelli−Blocher, Absolventin der Sozialarbeits−Ausbildung Zürich, 1952−54, nachfolgend 14 Jahre Praxis, dann Dozentin an verschiedenen Schulen für Sozialarbeit, u.a. für Geschichte des Sozialwesens, Leiterin Abt. Fort− und Weiterbildung Schule für Sozialarbeit Bern 1979−l986,seither beruflich selbständig als Supervisorin, Organisationsberaterin und Schriftstellerin www.avenirsocial.ch 5