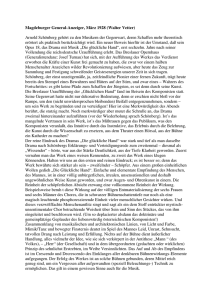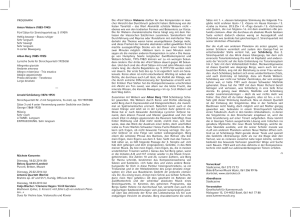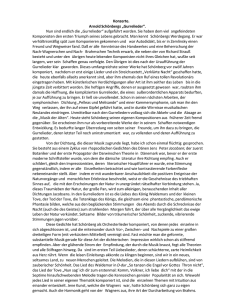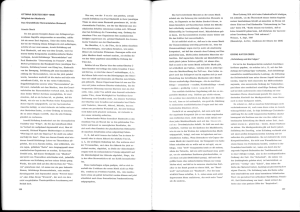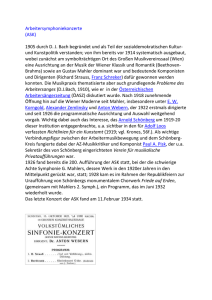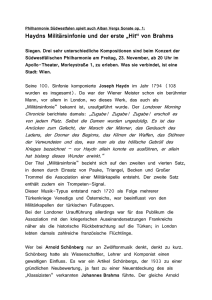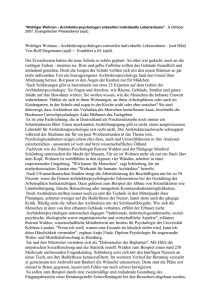Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung
Werbung
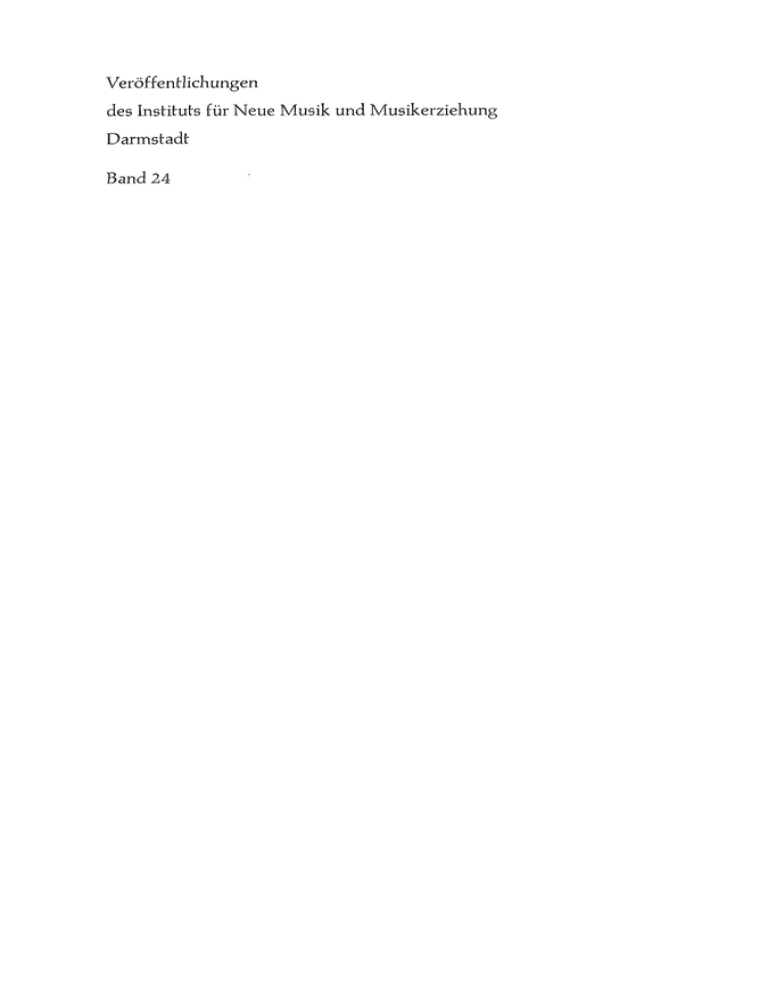
Veröffentlichungen
des Instituts für Neue M usik und M usikerziehung
Darm stadt
Band 2 4
Me
heut«
Neun Beiträge.
Herausgegeben von
Carl'Dahlhaus
Mainz •London - New York •Tokyo
B estell-N r. ED 7188
© B. S ch o tt's Söhn e, M ainz, 1983
U m schlag g estaltu ng : G ü n th er Stiller, Taun usstein
Printed in G erm any ■B S S 45413
IS B N 3-7957-1764-7
IS S N 0418-3827
INHALTSÜBERSICHT
Vorbemerkung
Reinhold Brinkmann
Einleitung am Rande
9
Carl Dahlhaus
Zum Spätwerk Arnold Schönbergs
19
Christian Martin Schmidt
Schönbergs Streichtrio opus 45
33
Rudolf Stephan
Alban Berg
45
Giselher Schubert
Zur Rezeption der Musik Anton von Weberns
63
Hermann Danuser
Hanns Eisler - Zur wechselhaften Wirkungsgeschichte
engagierter Musik
87
Friedrich Hommel
Aus der Frühzeit der Kranichsteiner Ferienkurse Fragestellungen, Überlegungen, Folgerungen zur
Situation der Neuen Musik. Ein Exkurs
lo5
Hans-Christian Schmidt
Der Widerspenstigen Zähmung: Vom zweiten Dasein
der Wiener Schule in der Schule
116
Werner Klüppelholz
Kontrapunkt und Konfusion. Über das Schreiben und
Hören von Musik im 2o. Jahrhundert
138
VORBEMERKUNG
Die Wahl des Kongreßthemas der 37. Hauptarbeitstagung
(8 . bis 13. April 1983) des Darmstädter Instituts für
Neue Musik und Musikerziehung, "Die Wiener Schule heute",
ging von der Beobachtung aus, daß die Wirkungs- oder Re­
zeptionsgeschichte der Komponisten, die man zur "Wiener
Schule" zählt - gleichgültig, wie weit oder eng man den
Begriff faßt -, extrem verschieden ist. Gehört das Oeuvre
Alban Bergs längst dem festen Konzert- und Opernrepertoire
an, so ist Anton von Webern, das durch Mißverständnis ein­
flußreiche Vorbild der seriellen Komponisten in den 195oer
Jahren, inzwischen fast vergessen; Arnold Schönberg ist
im allgemeinen Bewußtsein nur durch tonale und einige der
frühen atonalen Werke präsent, während die dodekaphonen
Stücke eher einen Gegenstand der Analyse als der leben­
digen musikalischen Erfahrung bilden und das Spätwerk
noch weitgehend unentdeckt blieb; und Hanns Eisler ist
in einen Streit der Ideologien hineingezogen worden, in
dem seine fragmentarischen Theoreme manchmal wesentlicher
erscheinen als seine Kompositionen.
Der Herausgeber dankt den Referenten für ihre Mitarbeit,
Frau Christine Werner (Darmstadt) für organisatorische
Hilfe und dem Verlag B. Schott's Söhne für die Sorgfalt
der Drucklegung.
Darmstadt/
im Juni 1983
Carl Dahlhaus
7
Reinhold Brinkmann
EINLEITUNG AM RANDE
Eine grundlegende Einleitung im anspruchsvollen Wortsinn,
eine "Vorrede" also, in der zentrale Ideen vorab vorge­
stellt, Voraussetzungen diskutiert, Ergebnisse vorbereitet
werden - eine solche Einleitung als fundamentum formuliert
man notwendigerweise nach den Hauptkapiteln eines Buches,
zumindest jedoch, nachdem deren Inhalt feststeht und skiz­
ziert ist. Von einer analogen Situation kann heute, am
Beginn eines Kongresses mit einer breiten Palette von Re­
feraten, Seminaren und Kolloquien, keine Rede sein. Und
so darf ich mir die Freiheit nehmen, einige eher subjek­
tive Anmerkungen zum Generalthema zu machen, es am Rande
umkreisend und abklopfend, ohne große Rücksicht auf die
folgenden Referate. Dabei hege ich keine wie immer gear­
tete kritische oder polemische Absicht und meine auch
nicht, "Chaos in die Ordnung" bringen zu sollen oder zu
können - das war nach dem bedenkenswerten programmatischen
Satz eines prominenten Mitglieds der sogenannten Wiener
Schule die "Aufgabe von Kunst" am Beginn der fünfziger
Jahre. Wohl aber möchte ich einige wenige Punkte berühren,
die vielleicht übersehen werden könnten, wenn man sich
allein positiv auf das Zentrum des Generalthemas konzen­
triert .
1. In diesem Zentrum stehen, das ist keine Frage, die drei
Namen, denen die ersten Referate dieses Kongresses gelten
werden. Schönberg selbst hat das ausgesprochen:
"Laßt uns - für den Augenblick wenigstens - alles ver­
gessen, was uns je hätte trennen können; so bleibt doch
für die Zukunft erhalten, was erst posthum zu wirken
beginnen könnte: man wird uns drei - Berg, Webern,
Schönberg - zusammen nehmen müssen, wie eine Einheit,
weil wir mit Intensität und opferbereiter Ergebenheit
an einmal erschaute Ideale geglaubt haben und niemals
von ihnen gelassen hätten, auch wenn es gelungen wäre,
uns irre zu machen".
Diese von Schönberg benannte Einheit des Denkens und Glau­
bens in Sachen Kunst ist unzweifelhaft, sie wurde in Wis­
senschaft wie Publizistik vielfach dargestellt. Und sie
auch rechtfertigt den Begriff einer "Wiener Schule" der
neuen Musik (der schon früh angewandt wurde, vgl. Egon
Wellesz, Schoenberg et la jeune ecole viennoise, in: Revue
musicale mensuelle SIM VIII, 1912). Trotzdem möchte ich
gleich zu Beginn des Kongresses davor warnen, diese Einheit
über Gebühr zu betonen, zu überschätzen. Und dies bereits
9
im ästhetisch-kompositorischen Bereich. Gerade die Ent­
faltung der Werke der drei Komponisten in der Geschichte,
vermittelt vor allem auch durch die kompositorische Re­
zeption, hat in Wissenschaft wie Praxis die Ohren für
Differenzierungen geschärft. Heute verblaßt der Schulzusammenhang vor den Individualitäten. Mein erstes Plädoyer
also gilt der entschiedenen Zeichnung spezifischer künst­
lerischer Physiognomien und ihrer geschichtlichen Wirkung.
Aber dann, und dies wird stets unterschätzt: Differenzie­
rung auch außerhalb der Werke. Bezeichnend an Schönbergs
zitiertem Text ist sein beschwörender Ton ("Laßt uns für den Augenblick wenigstens - alles vergessen, was uns
hätte trennen können ...") . Und Trennendes gab es in der
Tat, vor allem zwischen Schönberg und Webern, insbeson­
dere in den späteren Jahren. Damit meine ich weniger jene
Brüche der Freundschaft durch das stets latente wechsel­
seitige Konkurrenzdenken, das Beharren auf Prioritätsan­
sprüchen im kompositorischen Bereich (das wird manifest
werden, sobald endlich der zweite Band der SchönbergSchriften und die Briefwechsel ediert sein werden), son­
dern die in meinen Augen letztlich doch fundamentale Dif­
ferenz im Verhältnis beider zur Realität. Als Zeitgenossen,
als politische Menschen und damit für uns heute als Zeugen
ihrer geschichtlichen Situation sind Schönberg und Webern
nicht auf einen Nenner zu bringen. Merkwürdig verquer und
widersprüchlich scheint ihr Verhalten: der aristokratisch­
monarchisch denkende, deutschnationale Konservative
(Schönberg) wird ein hellsichtig früher und kompromiß­
loser Gegner des Nationalsozialismus - der in der austrosozialistischen Arbeitermusikbewegung Aktive (Webern) da­
gegen, der engste Vertraute seiner geschundenen oder emi­
grierten jüdischen Freunde und selbst Verfemte, kommt in
Briefen der frühen Kriegsjahre zu jener unfaßbaren Bewun­
derung Adolf Hitlers:
"Und es wäre noch Einiges zu nennen, das auf ein Fort­
schreiten in der inneren Reinigung absolut hinweist.
Das ist heute Deutschlandl Aber eben das n a t i o ­
n a l s o z i a l i s t i s c h e
!!! Nicht irgend­
eines ! Das ist eben der n e u e
S t a a t , zu dem
die Saat vor nun mehr als 2o Jahren gelegt worden ist.
Ja ein n e u e r
S t a a t
i s t
e s , wie er noch
niemals bestanden hat.
E i n
N e u e s
i s t
es!
Geschaffen von diesem einzigen Manne!!! Sehn Sie, Sie
spüren meine Sorge: man könnte es als selbstverständ­
lich (schließlich) nehmen, was so e i n m a l i g
entstand, was eben nur d i e s e r
N a t u r
ent­
springen konnte, diesen E i n m a l i g e n
zum Urhe­
ber hat..."(H.u.R.Moldenhauer, Anton von Webern, Zürich
198o, S .479f.).
lo
Das Vokabular Weberns kennen wir: es ist jene Emphase
(hier durch ein neues George-Erlebnis verstärkt, vgl.
den Brief vom 21.12.194o) des "Neuen", das in seinen
Vorträgen über den Weg der neuen Musik als Signum der
geschichtlichen Leistung der Wiener Schule gilt. Den Innovationsgedanken, verbunden mit der Vorstellung der
schöpferisch-genialen Natur, auf den großen Moralisten
Schönberg ebenso angewendet zu sehen wie auf den Unmen­
schen Hitler - das ist für mich (und dies darf ich hier
sehr persönlich sagen) eine der schmerzlichsten und an­
dauernden Irritationen der letzten Jahre. Sie tangiert
für mich das Bild Weberns insgesamt. Trotz aller verste­
henden Einsicht in die schwierige Lage Weberns, seine
furchtbare Isolation, seine zusammengedrängte, gedemütigte Existenz in den späten dreißiger und frühen vier­
ziger Jahren - hier gibt es wohl keine Brücke, keine Ein­
heit der Ideale und des unbeirrbaren Glaubens. Ich meine:
auch das gehört zum Problem der Wiener Schule heute.
2. Auf die Rezeption der Webernschen Musik hat dies si­
cher keinen Einfluß gehabt. Ob späte Esoterik und man­
gelnder Realitätssinn korrelativ sind, wäre überdies
erst noch zu erweisen. Dennoch: auch unter dem Rezeptions
aspekt bietet das Werk Weberns heute die größten Probleme
(Das gilt auch für den wissenschaftlichen Zugriff auf das
Oeuvre. Während ein Schönberg-Archiv etabliert ist, eine
wissenschaftliche Gesamtausgabe erscheint, während der
Berg-Nachlaß zugänglich wird, eine Gesamtausgabe in Pla­
nung ist, sind die Materialien zu Webern, sind zentrale
Manuskripte und Dokumente - trotz öffentlichem Verspre­
chen vor einem Jahrzehnt - immer noch durch private Ver­
fügung unzugänglich.)
Berg und auch Schönberg sind im Musikleben generell durch
gesetzt, so weit, wie man es auch bei optimistischer Ein­
schätzung angesichts einer hochkomplizierten atonalen
Faktur der Musik innerhalb der tonalen Konkurrenz des
historisch orientierten Konzertbetriebs kaum je hat glau­
ben können. Weberns Wirkung dagegen ist, wie Christian
Martin Schmidt im Kongreßprogramm richtig bemerkt, ver­
blaßt. Das mag unter anderem gattungsgebundene Prämissen
haben. Es sind bei Berg wie Schönberg die großdimensio­
nierten Werke, Opera mit symphonischem Anspruch, die an
der Spitze der Gunst stehen: das Violinkonzert, "Wozzeck"
und "Lulu" - nicht die Lyrische Suite oder das Kammer­
konzert; "Moses und Aron" - nicht das 3. Streichquartett
oder das Streichtrio. Werke solchen Ausmaßes, solchen
Tons, hat Webern bekanntlich nicht komponiert, und gewiß
hat auch der am großen Orchesterklang orientierte Publi­
kumsgeschmack hier selektierend mitgewirkt. Doch kann das
11
nicht primär sein. Denn auch unter den Komponisten, den
Experten also, hat sich offenbar eine neue Bewertung der
Wiener Trias ergeben - ebenfalls zu Ungunsten Weberns.
1955 hatte Ernst Krenek über Webern emphatisch geschrie­
ben: der "Stein, den die Bauleute verworfen haben, der
ist zum Eckstein geworden"; das war das Credo der Darm­
städter Schule: Weberns Werk als historische Legitimation
der neuen seriellen Technik, des Denkens in Strukturen
von Klang und Stille (Boulez 1954: "Dieses Werk ist
d i e
Schwelle geworden... eine erregende Gefahr...").
In den siebziger Jahren dagegen formuliert Hans Werner
Henze ein neues Paradigma: nicht Webern sei der bedeu­
tendste Komponist des 2o. Jahrhunderts, sondern - Gustav
Mahler. Die Abkehr von der Systematik eines primär struk­
turell begründeten Denkens in Tönen, die ein solcher Pa­
radigmenwechsel bekundet, die Hinwendung zu einer nun
betont emotionell artikulierten Expressivität des Klanges
(mitsamt den kompositionstechnischen Implikationen dieser
neuen Traditionsvergewisserung) an der gegenwärtigen Re­
zeption der "Wiener Schule" im kompositorischen Bereich
sichtbar za machen - das könnte eine aktuelle Aufgabe
dieses Kongresses sein. Aus einem scheinbar akademischen
Tagungsthema erwüchsen Aspekte einer Gegenwartsdiagnose.
Daß unter diesem Gesichtspunkt Anton Webern der interes­
santeste Komponist wäre, ist offenkundig.
Einen parallelen aufschließenden Aspekt dieser prinzi­
piellen Wandlung der kompositorischen Szene: die verän­
derte Einschätzung eines Rekurses auf ästhetische Theorie,
werde ich in anderem Zusammenhang noch streifen. Zunächst
jedoch sei hilfsweise eine Zwischenbetrachtung einge­
schaltet .
3. Wir reden von einer Zweiten Wiener Schule. Es ist viel­
leicht nicht unnütz, auf das Mißverständnis in dem Bezug
der Zählung hinzuweisen. Denn: Wiener Schule erster Zäh­
lung, das war zunächst eine Erfindung Wiener Musikwissen­
schaftler, um die Wiener Provenienz der Wiener Klassik
entgegen der Setzung einer Mannheimer Schule der Vorklassik
durch Hugo Riemann zu behaupten. "Gründlichkeit ohne Pedanterey, Anmuth im Ganzen, noch mehr in einzelnen Theilen,
immer lachendes Colorit, großes Verständnis der blasenden
Instrumente,vielleicht etwas zu viel komisches Salz, sind
der Charakter der Wienerschule", schrieb bereits Christian
Friedrich Daniel Schubart am Ende des 18. Jahrhunderts in
seinen "Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst"(S.77). Und
zu dieser "Wiener Schule" der Vorklassik zählten in der
Schule des Wiener Musikwissenschaftlers Guido Adler (zu
der am Beginn unseres Jahrhunderts auch Anton Webern,
Karl Horwitz, Heinrich Jalowetz und andere Mitglieder der
12
Zweiten Wiener Schule gehörten) die Monn, Wagenseil,
Muffat, Starzer - lokale Größen Wiens zur Zeit Maria
Theresias. Die Zählung einer Zweiten Wiener Schule aber
bezieht sich natürlich nicht auf diese Vorklassiker,
sondern auf die Trias der Haydn, Mozart, Beethoven (und
dies auch nach dem Selbstverständnis der Schönberg-Generation), auf die dann der Schulbegriff in Bezug auf Wien
übertragen worden war.
Auf dem Hintergrund dieser Begriffsverwirrung also reden
wir von einer Zweiten Wiener Schule. Aber wer gehört ei­
gentlich dazu? Alle Schüler Schönbergs von Webern bis zu
John Cage und deren Schüler ebenfalls? Oder definiert
sich der SchulZusammenhang durch eine geistige und kom­
positorische Haltung? Schönberg, Berg, Webern und Eisler
bedenkt der Kongreß - neben dem Schulhaupt also drei sei­
ner Schüler. Wellesz, Leibowitz, Apostel, Jemnitz, Pisk
werden im Eröffnungskonzert in den SchulZusammenhang ge­
stellt: ein Kontrapunkt-Schüler und Biograph Schönbergs
aus dem Wien des Jahrhundertbeginns; ein Schönberg- und
Webern-Schüler aus dem Berlin der frühen dreißiger Jahre;
ein Schönberg- und vor allem Berg-Schüler im Wien der
zwanziger Jahre; ein Schüler von Reger und Straube, der
auch nach Studien bei Schönberg im Berlin des zweiten
Jahrzehnts weiter im Regerschen Idiom komponierte; ein
Schüler Schrekers und Schönbergs aus dem Wien wieder des
Jahrhundertbeginns. Und nicht ganz ohne Ironie hat ein
aufmerksamer Zuhörer dieses Eröffnungskonzerts bemerkt,
er habe selten in einem Konzertprogramm eine derart mas­
sierte kompositorische Hindemith-Nachfolge (und dazu noch
keineswegs eine gute) erlebt...
Wie sah es Schönberg selbst? In einem Text vom Oktober
1932 hat er neben den in obiger Notiz genannten einige
weitere Namen aufgeführt:
"Meine Gegner.
Ich habe immer wieder die Frage geprüft, ob ich so an­
gegriffen werde, weil ich zu wenig Talent habe, zu
wenig kann, nicht recht genug arbeite oder auf einem
Irrweg bin.
Nun aber halte ich folgende Tatsachen gegeneinander:
I. a) Nationalen Musikern gelte ich als i n t e r ­
n a t i o n a l ,
b) Im Ausland aber gilt meine Musik als zu
d e u t s c h .
II. a) Nationalisten gelte ich als K u l t u r b o l s c h e w i k .
b) Die Kommunisten aber lehnen mich als b ü r
g e r l i c h
ab.
III.a) Antisemiten perhorreszieren mich als Juden,
meine Richtung als jüdisch.
13
b) Aber in meine Richtung sind mir fast keine
Juden gefolgt. Dagegen sind vielleicht die
einzigen, die in der von mir angegebenen Rich­
tung weiterschreiten, die Arier: Norbert von
Hannenheim, Anton von Webern, Alban Berg,
Winfried Zillig, Nikos Skalkottas. Und die
Komponisten, die (außer meinen Schülern) mir
am nächsten stehen, sind die Arier: Bartok,
Hauer, Krenek und Hindemith..."
Ganz andere Namen also; Eisler nicht erwähnt, Zemlinsky,
Schreker nicht (wenngleich zugegebenermaßen der Anlaß
die Auswahl bestimmt haben dürfte). Und zu Wellesz stand
der spätere Schönberg sehr distanziert, um es milde aus­
zudrücken. 1944 notiert er:
"He still calls himself a pupil of mine - or at least
never protested against being called one - though he
never should have pretended it. The truth is that he
studied during 1 (one single) year together with another young musician - Rudolf Weirich - counterpoint,
elementary counterpoint and nothing eise. He worked
very little and extremely poorly, while Weirich was
brilliant..."
Scheint es nicht vernünftig zu sein, den Begriff ein­
engend zu gebrauchen und nur die Situation im Wien des
Jahrhundertbeginns und den engsten Schülerkreis einzu­
begreifen? Müßte man nicht sonst auch die amerikanischen
Schüler einbeziehen? Warum dann zum Beispiel nicht Leon
Kirchner, der heute an Harvard lehrt und in dessen Wer­
ken, die hierzulande kaum bekannt sind (Hans Rosbaud
führte einmal sein Erstes Klavierkonzert auf), und Un­
terricht sich eine lebendige und eigenständige SchönbergTradition erhalten hat? Oder Earl Kim, ebenfalls SchönbergSchüler und an der gleichen Institution tätig, der stark
zu Weberns strukturellem Komponieren neigt? Eines ist
sicher: es hat sich um Schönberg vieles getan, was nicht
mehr auf Wien beziehbar ist und in dem Begriff einer
Wiener Schule nicht mehr aufgeht. Ich meine sogar, dies
gelte auch für Schönberg selbst.
Wenn man aber so weitherzig ist, dann darf ein anderer
Name nicht fehlen. Es handelt sich um einen Komponisten
und Theoretiker, den man heute gern vergißt, aburteilt,
schmäht, und der gerade an diesem Institut eine außer­
ordentliche Wirkung getan hat. Auf ihn abschließend hin­
zuweisen im Kontext dieses Kongreßthemas ist auch, aber
mehr als eine Ehrenpflicht. Zur Zweiten Wiener Schule
gehört in vielfältiger Hinsicht ihr großer Theoretiker.
4. Am 11. September 19o3, also zwanzig Jahre nach Anton
Webern, ist Theodor W.Adorno geboren. Er wäre in diesem
14
Jahr 8 0 geworden. Und Adorno, Kompositionsschüler und
Freund Alban Bergs, hat an diesem Darmstädter Institut
für Neue Musik und Musikerziehung in den Jahren 1952 und
1954 auf Einladung Erich Dofleins seine Plädoyers gegen
eine musikpädagogische Musik, seine Kritik des Musikanten
vorgetragen, deren Wirkung auf das Bewußtsein von Musik,
auch über den engeren Kreis der Musikpädagogen hinaus,
kaum überschätzt werden kann. Daß dies eine Wirkung aus
dem Geist der Wiener Schule war, darf man mit Fug und
Recht behaupten.
Ich spreche an dieser Stelle drei Punkte knapp an.
a) Am 13.12.1926 schrieb Alban Berg an Arnold Schönberg
über Adorno:
"Die Aufführung von Wiesengrunds rasend schwerem
Quartett war ein Husarenstück des Kolischquartetts,
das es in 8 Tagen studiert hatte und ganz klar zur
Darstellung brachte. Ich finde die Arbeit Wiesengrunds
s e h r
g u t
und ich glaube, daß sie auch Deine Zu­
friedenheit finden wird, wenn Du sie einmal kennen
lernen wolltest. - Jedenfalls ist es in seinem Ernst,
seiner Knappheit, und vor allem der unbedingten Rein­
lichkeit seiner ganzen Faktur würdig, als zur Schule
Schönbergs (und nirgends anders hin!) gehörig bezeich­
net zu werden".
Und als der holländische Komponist Daniel Ruyneman 1929/3o
Konzerte mit Werken der Wiener Schule veranstalten wollte
und sich außer an Webern auch an Berg wandte, schlug dieser
damit sein Votum über den Komponisten Adorno bekräftigend neben Schönberg und Webern nur Eisler und Adorno vor, von
letzterem jetzt einen der Klavierlieder-Zyklen (vgl.P.Op
de Coul, Unveröffentlichte Briefe von A.Berg und A.Webern
an D.Ruyneman, Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziek Geschiedenis XXII, 1972, S.2ol ff.). Dem
Urteil Bergs über den Komponisten Adorno brauche ich
nichts hinzuzufügen; es wäre jetzt, da wenigstens eine
Auswahl an Kompositionen erscheint, an der Zeit, sich
diesem originären Ton zwischen Expressionslyrik und Sach­
lichkeit zuzuwenden, in Aufführung und in Analyse.
Von Schönbergs Einschätzung Adornos ist bisher - neben
dem von Stuckenschmidt gern ausgestellten Brief an ihn nur das Pamphlet aus der Zeit der D r .Faustus-Kontroverse
bekannt geworden, das Jan Maegaard veröffentlichte (Melos
1974) und das Konrad Boehmer vorschnell gegen Adorno aus­
schlachtete ("Der Korrepetitor am Werk", Zeitschrift für
Musiktheorie IV,1 1973), um ihn nicht nur politisch, son­
dern auch in bezug auf seine kompositorisch-theoretische
Kompetenz zu verdächtigen. Dem sei hier ein abgewogeneres
Urteil Schönbergs (ein Akademiegutachten vom Januar 1933)
entgegengestellt:
15
"Wiesengrund Adorno zu loben, unterlasse ich ('ihr
lobt ihn, Meister V o g e l s a n g G r u n d s ä t z l i c h bin
ich der Meinung, daß die Prüfung nicht um ihrer selbst
willen, oder um dem Bewerber Schwierigkeiten zu machen,
erfolgen soll, sondern lediglich in jenen Fällen, wo
man durch kein anderes Mittel erfahren kann, ob ein
Bewerber das erforderliche Niveau eines Lehrers be­
sitzt . Hier liegt Material genug vor, um sich ein Ur­
teil zu bilden. Ich halte W. n i c h t
für einen
Komponisten, unstreitig aber kann er, was man lehren
kann; und über sein Niveau kann es wohl keinen Zweifel
geben. Was aber die ändern Fächer anbelangt, so würde
es mich interessieren zu erfahren, wie viele Kompo­
nisten diese Prüfung bestehen würden. - Schließlich
aber sollte man nicht übersehen, daß die beigefügten
Analysen bedeutsame Leistungen auf musiktheoretischem
Gebiet darstellen"
b) Nicht nur ist das Bild der Wiener Schule nach dem
Zweiten Weltkrieg entscheidend von Adorno geprägt worden,
ihre internationale Geltung als eine der großen ästhe­
tischen Konzeptionen in der Kunst des 2o. Jahrhunderts
überhaupt hat wesentlich Adorno vermittelt. Rudolf Stephan
hat in der Einleitung zum Wiener Schönberg-Kongreß von
1974 diese Tat Adornos besonders hervorgehoben. Daß In­
tellektuellen nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade auch
solchen, die nicht Musiker waren, die Musik Schönbergs
und Weberns als kritische Instanz einer gesellschaft­
lichen Wahrheitsfindung durch Kunst galt, ist allein
den Schriften Adornos zu danken. Es gab zudem, wie man
weiß, Musiker, Komponisten, die Deutsch lernten, um die
"Philosophie der neuen Musik" lesen und verstehen zu
können.
Und in der Bewertung der kompositorischen Physiognomien
scheint es mir, als habe die Rezeptionsgeschichte der
Werke Schönbergs, Bergs und Weberns seit den fünfziger
Jahren Adornos so oft bezweifelte musikalische Urteile
als außerordentlich treffend bestätigt: bei Schönberg
die Zentralstellung der großen Werke der freien Atonalität, später des Dritten Quartetts und des Trios, vor
allem dann des fragmentarischen "Hauptwerks"; bei Webern
die verstehende Skepsis gegenüber dem Spätwerk, insbe­
sondere aber auch so unvergleichliche Kennzeichnungen
wie die der Webernschen "absoluten Lyrik" als "Boten
kommender Katastrophen" (Klangfiguren, Frankfurt/Main
1959, S.169, mit der Assoziation der fernen Wahrnehmung
des "Kanonendonners von Verdun") - aufschließende Ver­
stehenshilfen , die die Werke j enseits des bloßen Struk­
turdenkens in ihrer künstlerischen Gewalt, der Eindring­
16
lichkeit ihrer Sprache treffen wollen und sie treffen unübertrefflich. (Ich gestatte mir freimütig dieses be­
wundernde Wort. Über der Darstellung der Grenzen des
Adornoschen Ansatzes seine Vorzüge zu vergessen, schien
mir stets absurd.)
c) Daß zwei der bedeutendsten philosophischen Denker des
2o„ Jahrhunderts, Ernst Bloch und Theodor W.Adorno, Werk
und Theorie Schönbergs als paradigmatischen Gegenstand
ihrer Reflexionen auf Kunst, Gesellschaft und Geschichte
wählten, sagt etwas aus über diese Musik. Daß die Avant­
garde nach 195o - Stockhausen, Boulez, Ligeti - in stetem
Rekurs auf die ästhetische Theorie Adornos (positiv oder
negativ) komponierte, sagt etwas aus über diese Avantgarde.
Daß heute die jüngeren Komponisten auszukommen glauben
ohne eine Konfrontation mit einer ästhetischen Theorie
als kritischer Instanz, sagt etwas aus über die gegen­
wärtige Lage des Komponierens.
Die Wechselwirkung im Verhältnis Adornos zum Darmstädter
Komponistenkreis der fünfziger und frühen sechziger Jahre
ist offensichtlich. Tibor Kneif hat sie vor einem Jahr­
zehnt anhand unbekannten Materials für die Beziehung
Adorno-Stockhausen eindringlich beschrieben (Zeitschrift
für Musiktheorie IV,1,1973). Hier interessieren aus dem
Gesamtkomplex zwei Aspekte. Einmal wird aus Briefen Stock­
hausens an Adorno deutlich, daß ersterer gleichsam im An­
gesicht der kritischen Theorie komponierte:
"Wenn ich Ihre Bücher und Artikel lese, weiß ich, daß
ich Ihnen wahrhaftig ein Gegner bin, den Sie und ich
nicht vermuten, wenn wir uns begegnen: hier und dort
entdecke ich einen Ihrer Sätze, der mir die Haut durch­
brennt . Und ich schlage zurück oder habe schon ge­
schlagen mit Waffen, die unheimlich und scharf sind, In meiner Musik geschehen seit kurzem Dinge, die so
quer zu Ihrem Denken einschlagen, daß es Sie wundern
muß, wenn Sie es eines Tages entdecken. Sie werden ge­
troffen sein, wie ich mich getroffen weiß; diesmal
aber heimlich und gefährlich" (14.5.196o).
Zum zweiten handelte es sich bei Adornos Position (und
im Gegensatz zu Kneif meine ich, auch im Aufsatz über
eine "Musique informelle", deren Urbild ganz deutlich
Schönbergs "Erwartung" ist) um eine aus den Werken der
Wiener Schule, primär Schönbergs, als Erfahrungs- und
Reflexionshintergrund hervorgegangene ästhetische Theorie
der Musik, die der Darmstädter Ästhetik, die sich eben­
falls auf die Wiener Schule beruft, aber primär auf Weberns
Spätwerk, entgegengehalten wird. Adornos Thesen vom "Altern
der neuen Musik" treffen mit Kategorien der Wiener Schul.e
eine Komponistengeneration,, die aus dem Weiterdenken et- n
1
dieser Wiener Schule ihre wesentliche historische Auf­
gabe ableitete. Das ist ebenso ein Beleg für den immensen
Reichtum, den ästhetischen Radius dieser Ideen, wie es
eine offenbar einmalige geschichtliche Situation und
Chance umschreibt. Und vielleicht waren gerade dieses Zu­
sammenwirken von künstlerischer Phantasie mit philosophisch-ästhetischer Orientierung, von kompositorisch­
handwerklichem mit geschichtsphilosophischem Denken und
die Intensität dieser gewollten und gesuchten Konfronta­
tion Voraussetzung für gelungene, bedeutende Konzeptionen
in beiden Bereichen. Die Musik jedenfalls, die so ent­
stand, hat dies bereichert. Auch das gehört zum Thema
Wiener Schule heute, zur Dimension ihrer geschichtlichen
Wirkung.
Das aufgreifend gestatten Sie mir bitte in dieser gele­
gentlich persönliche Urteile nicht verschmähenden Kon­
greß-Einleitung ein ebenfalls durchaus subjektives,
schlicht behauptendes und ganz ungeschütztes Schlußwort.
Ich vermisse einen solchen Rekurs auf ästhetische Theorie
als Instanz, eine (neue und anders begründete wie formu­
lierte) Philosophie der neuen Musik heute; ich vermisse
die Konfrontation mit dem philosophisch-kritischen Ge­
danken und ich vermisse ihn oder vermeine ihn hörend zu
vermissen in den Kompositionen. Könnte aber nicht eine
solche relevante neue Philosophie der neuen Musik, auf
andere Weise natürlich, aber doch hoffentlich mit glei­
cher Treffsicherheit und Intensität, heute - da doch
alles wieder so ordentlich wird - eine immense Aktualität
gewinnen und der Kunst eine ihrer genuinen Funktionen er­
neut und verstörend bewußt machen? Es war Theodor W.Adorno,
der das in seinem schönsten Buch, den "Minima Moralia",
die vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs notiert
wurden und im Untertitel "Reflexionen aus dem beschädigten
Leben" genannt werden, formulierte: "Aufgabe von Kunst
heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen". Das Kon­
greßthema "Die Wiener Schule heute" könnte auch zu einer
solchen Gegenwartsdiagnose führen. Die Werke der Kompo­
nisten und die Theorie des Philosophen erlauben dies.
Carl Dahlhaus
ZUM SPÄTWERK ARNOLD SCHÖNBERGS
1
Im allgemeinen Bewußtsein, einer durchaus unverächtlichen
Instanz, ist Arnold Schönberg einerseits der Komponist
der "Gurrelieder" und der "Verklärten Nacht", auch des
"Pierrot lunaire" und der George-Lieder, andererseits der
Erfinder oder Entdecker der Zwölftontechnik: eines Ver­
fahrens, das als esoterisch und rätselhaft gilt, obwohl
die Merkmale, die es als Methode, Regelkodex oder "Vor­
formung des Materials" konstituieren, mit wenigen Sätzen
erklärbar sind, zu deren Verständnis man nicht einmal
über die Fähigkeit des Notenlesens zu verfügen braucht.
Die Probleme, die ins Unwegsame führen, beginnen erst
dort, wo die Methode in Komposition übergeht.
Der Zusammenhang zwischen den frühen Werken, die im Kon­
text der Restauration des Jugendstils und der Sezession
zu Bestandteilen des Konzertrepertoires wurden, und der
Dodekaphonie der zwanziger Jahre - dem Untersuchungsge­
genstand eines Zirkels von Eingeweihten, deren Bemühungen
um die philologische, kompositions- und ideengeschicht­
liche Problematik der opera 23 bis 25 kreisen - ist in
dem Bild, das man sich von Schönberg macht, gestört oder
sogar zerbrochen. Und wenn es ein fast hoffnungsloses
Unterfangen sein mag, im Bewußtsein des Publikums zwi­
schen der musikalischen Erfahrung der frühen Werke und
dem Gerücht über die Zwölftontechnik zu vermitteln, so
ist es immerhin möglich, einige Gründe zu skizzieren,
die den Blick auf die Kontinuität von Schönbergs oeuvre
verstellen.
Erstens ist die Assoziation der frühen Werke mit dem Ju­
gendstil, dessen zweites Dasein bereits länger dauert als
das erste, eher ein rezeptions- als ein kompositionsge­
schichtlicher Sachverhalt. Der ideengeschichtliche Kontext,
in dem die Werke seit anderthalb Jahrzehnten wahrgenommen
werden, steht in schiefer Relation zu deren Ursprung: Mit
Adolf Loos, dem Gegner und Antagonisten der Wiener Sezes­
sion, fühlte sich Schönberg nicht allein durch persönliche
Sympathie, sondern auch durch eine tiefgreifende Überein­
stimmung der ästhetischen Überzeugungen verbunden: Schön­
bergs Begriff der musikalischen Prosa impliziert, neben
anderen Momenten, die Feindschaft gegen das Ornament, die
Loos proklamierte. Und ohne daß man sich in eine Kontro­
verse darüber, ob den in die spätere, eine Affinität zum
Jugendstil suggerierende Rezeption einfließenden Vorstel­
lungen eine eigene, unabhängige ästhetische Legitimität
zugestanden werden soll, zu verlieren braucht, kann man
jedenfalls konstatieren, daß die Kategorien, von denen
eine Analyse und Interpretation der frühen Werke ausgehen
muß - die Begriffe "musikalischer Gedanke", "Darstellung
des Gedankens", "entwickelnde Variation" und "musikalische
Prosa" - eine kompositionsgeschichtliche Vermittlung mit
der Dodekaphonie nicht allein zulassen, sondern geradezu
fordern, also eine Revision der wirkungsgeschichtlichen
Trennung der frühen von den späteren Werken nahelegen.
Zweitens darf man, wie die Geschichte der Rezeption des
Beethovenschen Spätwerkes zeigt, von der Erwartung aus­
gehen, daß die Kontinuität eines oeuvres, die sich zu­
nächst nur der Reflexion von Eingeweihten erschloß, spä­
ter auch der Intuition des Publikums zugänglich wird,
daß also der Bruch, den man zunächst empfand, allmählich
immer geringer erscheint. Daß eine kompositionsgeschicht­
liche Logik rekonstruierbar ist, die von der Tonalität
zur Atonalität führte, ist inzwischen von den Hörern ge­
wissermaßen ästhetisch eingelöst worden, und zwar dadurch,
daß ihnen die Differenz zwischen der "Verklärten Nacht"
und dem "Pierrot lunaire" längst nicht mehr so tiefgrei­
fend erscheint, wie es eine Musikgeschichtsschreibung
suggeriert, die in der Emanzipation der Dissonanz den
Anfang der Neuen Musik zu erkennen glaubt. Und es ist
nicht ausgeschlossen, daß in analoger Weise auch aus der
analytisch erfaßbaren Stringenz, die der Entstehungsge­
schichte der Dodekaphonie zugrundeliegt, am Ende ein äs­
thetisches Kontinuitätsgefühl des Publikums, eine Intui­
tion der inneren Einheit des Schönbergschen oeuvres, re­
sultiert. Schönbergs Diktum, daß dem Formgefühl des Kom­
ponisten eine einstweilen noch unerkannte Logik entspre­
chen müsse, ist rezeptionsgeschichtlich zu der Voraus­
sage umkehrbar, daß aus der erkannten Logik schließlich
ein Formgefühl des Publikums, das der Reflexion nicht
mehr bedarf, hervorgehen werde.
2
Erscheint die Dodekaphonie immerhin als Objekt theore­
tischer Anstrengungen sowie der fragwürdigen Art von Ruhm,
deren Substanz ein Gerücht bildet, so ist das Spätwerk,
das in der Emigrationszeit entstand und partiell zur To­
nalität zurückkehrte, einer Vergessenheit zum Opfer ge­
fallen, an der vereinzelte Aufführungen des Streichtrios
opus 45 oder des "Überlebenden aus Warschau" opus 46
2o
i
wenig ändern. Irritiert durch das Nebeneinander von dodekaphonen und tonalen Werken - durch den Wechsel zwischen
einer Esoterik, von der man sich abgewiesen fühlte, und
einer Konzilianz, der man mißtraute -, ging man dem Spät­
werk aus dem Wege, zumal der emphatische Bekenntnischa­
rakter - die Hervorkehrung des Jüdischen, die bei Schön­
berg, da er Person und Werk niemals trennte, die Musik
unverkennbar beeinflussen und prägen mußte - mit der kos­
mopolitischen Attitüde, die die Zwölftontechnik bei ihrer
geradezu epidemischen Ausbreitung nach dem Zweiten Welt­
krieg annahm, schlecht zusammenstimmte.
Auch ein fragmentarischer, im Bewußtsein der Unzuläng­
lichkeit unternommener Versuch einer historischen Inter­
pretation - ein Versuch, einige der Probleme zu rekon­
struieren, als deren Lösung das Spätwerk verstanden werden
kann -, ist ohne Reflexion über die Gründe, die dazu
führten, daß es aus dem allgemeinen Bewußtsein nahezu
restlos verdrängt wurde, kaum sinnvoll möglich. Und die
Tatsache, daß die Philosophie Theodor W.Adornos gerade
einen Tiefpunkt ihrer Rezeption erreichte - wie ihn Adorno
selbst nicht ohne Ranküne vor Jahrzehnten bei dem inzwi­
schen wieder in den Vordergrund gerückten Martin Heidegger
registrierte -, sollte nicht daran hindern, in Adornos
Interpretation (die Schönberg selbst allerdings verwarf)
die Motive versammelt zu sehen, die jahrelang - und darin
gleicht Adornos Schönberg-Exegese der Wagner-Kritik
Nietzsches - dem Verständnis des Spätwerks teils den Weg
verstellten und es teils auf die Bahn brachten.
Schlichte Irrtümer und Fehldeutungen zu erwähnen, ist
zwar pedantisch und ein wenig subaltern, aber unvermeid­
lich, wenn sie mit den Einsichten, deren Diskussion immer
noch lohnt, auf eine manchmal vertrackte Weise verquickt
sind. Erstens ist Adornos Behauptung (in der "Philosophie
der neuen Musik"), daß "Die Jakobsleiter" und "Moses und
Aron" Fragmente blieben, weil Schönberg durch ein "unbe­
wußtes Mißtrauen" gegen die Möglichkeit von "Hauptwerken"
an der Vollendung gehindert wurde, eine bloße Vermutung,
die sich durch das Wort "unbewußt" einer rationalen Er­
örterung entzieht. Bewußt ist jedenfalls keines der Wer­
ke, an denen Schönberg bis zu seinem Tode arbeitete oder
zu arbeiten entschlossen war, preisgegeben worden. Zweitens geht Adorno, wenn auch nicht ohne fühlbare Skru­
pel, von einer Unterscheidung zwischen dodekaphonen Hauptund nicht-dodekaphonen Nebenwerken oder "Parerga" aus,
die sich im Hinblick auf die Zweite Kammersymphonie opus
38, "Kol Nidre" opus 39, die "Variationen über ein Rezi­
tativ für Orgel" opus 4o, die "Variationen für Blasor­
chester" opus 43 A, das "Prelude" opus 44, den "Überle21
*
benden aus Warschau" opus 46 und die "Drei Volkslieder"
opus 49 als schlechterdings unhaltbar erweist. Auch die
Differenz zwischen Werken mit und ohne Opuszahl läßt, wie
es scheint, keine Schlüsse zu: Zwischen der Suite für
Streichorchester, die Schönberg ohne Opuszahl ließ, und
den Variationen für Blasorchester opus 43 A einen prin­
zipiellen, tiefgreifenden Unterschied zu konstruieren,
wäre schiere Willkür.
Drittens ist Adornos Versuch, Schönbergs Spätwerk als
Ausdruck einer "Lossage vom Material" zu deuten - und un­
ter Material versteht Adorno nichts Geringeres als den
musikalisch sich manifestierenden objektiven Geist -,
insofern prekär, als die Dialektik, die er praktiziert,
schließlich in ein Dickicht gerät, in dem die Gedanken­
motive unentwirrbar erscheinen. Einerseits glaubt Adorno,
die "Nebenwerke", die er zu Unrecht als solche klassifi­
ziert, mit dem Argument "retten" zu sollen, daß der geschichtsphilosophischen Wahrheit, die sich in den dodekaphonen Werken manifestiert, eine Art Menschenrecht
gegenüberstehe, "welches noch dem schlechten Bedürfnis
innewohnt" (Philosophie der neuen Musik, Frankfurt am
Main 2^958, 116). Mit anderen Worten: Es wäre inhuman,
die Gegenwart, so miserabel sie ist, ausschließlich im
Namen der Utopie, deren Verwirklichung in eine nahezu
unerreichbare Ferne gerückt ist, zu verurteilen; man muß
ihr vielmehr, wenn auch mit schlechtem geschichtsphilo­
sophischem Gewissen, partiell die Musik gönnen, die sie
braucht, um ästhetisch zu überleben. Andererseits soll
die "Lossage vom Material" jedoch bedeuten, daß "inkom­
mensurabel die Subjektivität endlich über die Konsequenz
und Stimmigkeit des Gebildes hinausgreift" (118) : Die
Preisgabe der Dodekaphonie erscheint als Ausbruch ins
Freie. Undialektisch und trivial gesprochen: Adorno zögert,
sich zu entscheiden, ob er den Verzicht auf dodekaphone
Strukturierung in einem großen Teil von Schönbergs Spät­
werk als Emanzipation vom Zwang der Methode rühmen oder
als herablassendes Zugeständnis an die bestehende Situa­
tion abtun soll. Und die Unschlüssigkeit - aus der er
sich nicht durch eine ästhetische Differenzierung der
nicht-dodekaphonen Werke in geglückte und mißlungene her­
ausziehen mag - ist nichts weniger als zufällig, denn
Adorno sah in der Dodekaphonie immer schon eine geschicht­
liche Notwendigkeit und zugleich ein ästhetisches Verhängnis:
Der Zwangscharakter des Verfahrens war ihm suspekt. Das
besagt nicht, daß der repressive Zug, den er herausfühlte,
dem der bestehenden Gesellschaft simpel und undialektisch
- nach dem vulgärmarxistischen Analogieverfahren - gleich­
gesetzt worden wäre: Die Dodekaphonie "entwirft das Bild
der totalen Repression und nicht deren Ideologie" (lo9).
22
Und als Bild ist sie Kritik, nicht Affirmation. Zugleich
partizipiert sie jedoch an der ins Falsche umgeschlagenen
Rationalität der europäischen Neuzeit: an der Dialektik
der Aufklärung, in deren geschichtlichem Prozeß die Natur­
beherrschung schließlich in eine Unterdrückung der Men­
schen durch die Instrumente, die im Dienste der Naturbe­
herrschung entstanden waren, überging. Das "selbstge­
machte Regelsystem im unterworfenen Material" tritt in
der Dodekaphonie dem Subjekt als "entfremdete, feind­
selige und beherrschende Macht entgegen" (112). Die Hoff­
nung, daß am Ende der Geschichte, das einstweilen nicht
absehbar ist, der Zwang der Zwölftonmethode in eine neue
Spontaneität freien Komponierens aufgehoben werde (llo),
bleibt leere Utopie, obwohl Adorno die Möglichkeit, in
dem Postulat könne der Ausgangspunkt einer Rechtfertigung
des Schönbergschen Spätwerks liegen, zögernd andeutet
(117). Der objektive Geist, unter dessen Diktat Adorno
zu philosophieren glaubte, verstellte den Ausweg, den
die Pietät gegenüber Schönberg nahelegte. Unausweichlich
manövrierte Adorno die Dialektik in die Ausweglosigkeit.
Andererseits verfängt er sich, wo er eine Chance zu er­
kennen meint, in Fallstricke. Das Wort Sinnzusammenhang,
eine tragende Kategorie in Adornos Ästhetik, ist insofern
ein zwiespältiger Begriff, als offen bleibt, ob Zusammen­
hang als solcher bereits Sinn verbürgt oder ob der ex­
pressive oder gestische Sinn, den ein musikalisches Motiv
mitbringt, sich in einen Zusammenhang fügt, der ihn dann,
analog zu einem Wort innerhalb eines Satzes, präzisiert
und modifiziert. Bei der Interpretation von Schönbergs
Spätwerk entscheidet sich Adorno für eine schlichte Gleich­
setzung von Sinn und Konsistenz, allerdings mit einem Rest
schlechten philosophischen Gewissens,den die Anführungs­
zeichen verraten, die das Wort "Sinn" in Distanz rücken.
"Denn was den 'Sinn' von Musik, auch der freien Atonalität, ausmacht, ist nichts anderes als der Zusammenhang"
(121). Die grobe Simplifizierung aber führt dazu, daß
Adorno, um von der Expressivität des Spätwerks zu spre­
chen, eine "Zerstörung des 'Sinnes'" - also des Zusammen­
hangs - vorausgehen läßt und die Expressivität dann mit
einem an Walter Benjamin erinnernden Begriff als "einge­
legten" - die Konsistenz sprengenden - Ausdruck charak­
terisiert (122). Das geschichtliche Modell, das dem Ge­
dankengang zugrundeliegt - unausgesprochen, aber aus
Adornos Beiträgen zu Thomas Manns "Doktor Faustus" re­
konstruierbar -, ist die Musik Claudio Monteverdis, die
ihre Expressivität zum Teil der von Artusi getadelten
Durchbrechung des überlieferten kontrapunktischen Regel­
kodex verdankte. Zu dem Vergleich, den Adorno unter Be­
rufung auf Ernst Krenek an anderer Stelle zwischen der
23
!
Disziplinierung durch die Zwölftontechnik und den Exer­
zitien im Palestrinasatz zieht (111), bildet die Inter­
pretation von Schönbergs Spätwerk als Restitution des
Ausdrucks jenseits des Systemzwangs das genaue Korre­
lat. Da aber Adorno die geschichtliche Analogie, die er
meint, nicht beim Namen nennt, versäumt er es, sie zu
rechtfertigen, und die Argumentation bleibt gewisser­
maßen im Leeren hängen. Das Problem, wie sich die Expres­
sivität der dodekaphonen und die der nicht-dodekaphonen
Werke voneinander unterscheiden - und das müßten sie,
wenn Adornos These stringent sein soll -, wird nicht ein­
mal gestreift.
3
Einen Versuch, Schönbergs späte Werke, die er "retonal"
nannte, sowohl kompositionstechnisch als auch geschichts­
philosophisch zu interpretieren, unternahm 1955/56 Dieter
Schnebel (Denkbare Musik, Köln 1972, 195-197). Die Prä­
misse, von der er ausging, war die frappierende Behaup­
tung, daß der Begriff der Stimme "eine Kategorie der to­
nalen Musik" sei. Und dadurch, daß Schönberg nicht auf­
hörte, kontrapunktisch - also in Stimmen - zu denken, sei
er gezwungen worden, zur Tonalität zurückzukehren. In der
Rückwendung aber, die demnach nichts weniger als zufällig
ist, glaubt Schnebel eine Veränderung nicht nur des Be­
wußtseins von der Geschichte, sondern der realen Geschichte
selbst als eines Prozesses zu erkennen. "Dann aber zeigt
sich, daß die Geschichte aufhört, nur in einer Richtung,
nur vorwärts zu verlaufen. Sie kann nun sowohl vorwärts
als auch rückwärts entwickelt werden. Diese Tatsache weist
jedoch darauf hin, daß die Geschichte selber verfügbar ge­
worden ist".
Schnebels Voraussetzungen sind allerdings teils brüchig,
teils undurchschaubar. Der Begriff der Stimme - muß die
Trivialität überhaupt erwähnt werden? - ist keineswegs
tonal fundiert; und da es einen vor-tonalen Kontrapunkt
gab, fällt es schwer, sich die Hypothese zu eigen zu ma­
chen, daß ein nach-tonaler Kontrapunkt in sich wider­
spruchsvoll sei. Umgekehrt ist im Begriff der Tonalität,
des funktionalen Akkordzusammenhangs, nichts enthalten,
was zu einem Denken in Stimmen zwingt: Die Beziehung ei­
ner Dominante zu einer Tonika ist prinzipiell unabhängig
von der Oktavlage der Töne; eine Zerklüftung oder Zer­
splitterung des Tonsatzes hebt die Tonalität nicht auf.
Außerdem ist die Idee, daß die Richtung der Geschichte
umkehrbar sei, ohne eine explizite Philosophie der Zeit,
24
die Schnebel schuldig bleibt, nicht nachvollziehbar.
Schnebels Theoriefragment ist ein Aphorismus, der ab-,
bricht, ohne einem Fortgang der Reflexion den Weg zu
bahnen.
4
Heinz-Klaus Metzger entwarf 1976 eine Erklärung der "retonalen" Musik, deren Bezeichnung er von Schnebel überrnahm, in der Form einer Kritik an der Kritik, die unter
seriellen Voraussetzungen an Schönberg geübt worden war
(Arnold Schönberg von hinten, in: Arnold Schönberg. MusikKonzepte 198o, 29-34). Daß bei Schönberg ein ungeschlichteter Widerspruch zwischen der atonal-dodekaphonen Ton­
höhenstruktur und einer rhythmisch-syntaktischen Ordnung
bestehe, die die Spuren ihrer Herkunft aus tonalen Formen
des 18. und 19. Jahrhunderts unauslöschlich an sich trage,
war der Topos, der einerseits in den 195oer Jahren die
Übertragung der Reihentechnik auf die Tondauer rechtfer^
tigen und andererseits zugleich begründen sollte, warum
Schönberg in manchen späten Werken zur Tonalität zurück­
kehrte: Er gehorchte durch diese Regression, wie man
meinte, den Implikationen der rhythmisch-syntaktischen
statt denen der Tonhöhenstruktur.
Demgegenüber beharrt Metzger auf der These, daß in to­
nalen Spätwerken wie dem "Kol Nidre" opus 39 einerseits
das entscheidende Moment der Atonalität, die Emanzipation
oder Loslösung des einzelnen aus der Hierarchie der Klänge,
bewahrt und andererseits ein fataler Zug der Zwölftontechnik, der Zwangscharakter der Methode, vermieden wurde.
Allerdings gerät Metzger in die Aporie, jedem Klang "Indi­
vidualität als singuläres Exemplar" zuschreiben und den­
noch behaupten zu müssen, daß das "nivellierte Material"
durch die Tonalität "wieder qualifiziert" worden sei. Un­
verständlich bleibt, wie eine Qualifizierung der Akkorde
ohne Hierarchie und ein tonaler Konnex trotz strikter
Individualisierung der Zusammenklänge technisch möglich
sein sollen. Die Idee eines tonalen Funktionszusammenhangs
ohne Substituierbarkeit des einen Akkords durch einen an­
deren - und das heißt: ohne Preisgabe eines Stücks Indi­
vidualität der Akkorde - erscheint einstweilen als leere
Utopie. Und eine Theorie der Tonalität, die ohne den Be­
griff der Akkordhierarchie auskommt, zeichnet sich in
Metzgers Erklärungsversuch, der einer flüchtig aufblit­
zenden Intuition gleicht, ohne daß die Anstrengung der
theoretischen Fundierung unternommen worden wäre, nicht
einmal in blassen Umrissen ab.
25
Daß Metzger einen Sachverhalt meint, den Rene Leibowitz
andeutete, ohne ihn genauer darzustellen, ist möglich
und sogar wahrscheinlich, obwohl die Anknüpfung unausge­
sprochen bleibt. Leibowitz geht, um die nach-atonale To­
nalität zu erklären, davon aus, daß das deklarierte Ziel
einer neuen Tonalität, das durch die Dodekaphonie er­
reicht werden sollte - Schönberg sprach von "Pantonalität"in den zwanziger Jahren verfehlt worden sei. "The problem
of new tonal functions has remained in the balance: it
has been avoided but not resolved" (Schoenberg and His
School, ^197o, 116). Und im tonalen Spätwerk - Leibowitz
bezieht sich, wie später Metzger, auf das "Kol Nidre"
opus 39 - glaubt er eine Tonalität zu erkennen, deren
Reichtum an Akkorden und Akkordbeziehungen durch kompo­
sitorische Erfahrungen, die der Dodekaphonie zu verdanken
waren, geprägt wurde. "Here we find many of the tone-row
principles incorporated into a freely handled tonality.
All possible aggregations of the total resources of
chromaticism are tried" (119). "The most distant, unheardof tonal relationships are established; there is a systematic effort not to let a. single possibility of such
tonal relationship go unused" (126). Im Grunde ist es je­
doch nicht das Reihenprinzip, das in tonaler Transfor­
mation wiederkehrt, sondern eine Tendenz, die Schönbergs
musikalisches Denken immer schon beherrschte und darum
auch die Dodekaphonie in wesentlichen Zügen prägte: die
Tendenz, den gesamten chromatischen Ton- oder Akkordbe­
stand auf engstem Raum auszunutzen und - in einem tonalen
Tonsatz - die Repetition eines Zusammenklangs so lange
zu verzögern, wie es die Notwendigkeit, den musikalischen
Faden nicht reißen zu lassen, irgend erlaubte.
5
Man muß, um sowohl der Dodekaphonie und ihrer scheinbaren
inneren Widersprüchlichkeit als auch dem zunächst irri­
tierenden Nebeneinander von dodekaphonen und nicht-dodekaphonen Werken in der Emigrationszeit gerecht zu werden,
von dem einfachen Sachverhalt ausgehen, daß Schönberg das
thematisch-motivische Denken, die Erbschaft des 18. und
19. Jahrhunderts, niemals preisgab. Weder war seine Über­
zeugung, daß durch die Dodekaphonie eine bis zu Bach und
Beethoven zurückreichende Tradition fortgesetzt wurde,
eine bloße "Legitimationsideologie" - um in einem denunziatorischen Soziologenjargon zu reden -, noch läßt sich
Schönbergs Gewohnheit, im Kompositionsunterricht aus­
schließlich Werke des 18. und 19. Jahrhunderts zu ana­
lysieren, statt Voraussetzungen und Probleme der Zwölf­
26
tontechnik zu erörtern, als bloße Marotte eines pedan­
tischen Lehrers abtun, der von den Prämissen, die er all­
zu ausführlich darstellen zu müssen glaubt, niemals zu
den Konsequenzen gelangt, die seine Schüler eigentlich
von ihm erwarten.
Daß Schönberg seine Zwölftonreihen, als wären sie Themen
oder Melodien, der Intuition und nicht der Konstruktion
verdankte, ist glaubwürdig genug überliefert. Der Name
"Grundgestalt" - in einer abstrakten Zwölftontheorie
streng genommen ein inadäquater Terminus, weil sämtliche
48 Reihenformen, wie Adorno behauptete, "gleich nah zum
Mittelpunkt" sind - ist also in Schönbergs konkreter
musikalischer Poetik Ausdruck einer kompositorischen Re­
alität. Als "musikalischer Gedanke" ist die "Grundgestalt"
mehr als bloß die chronologisch erste Form, in der die
Reihe - Inbegriff von 48 gleichberechtigten Ausprägungen in einem Satz erscheint. Zwischen dem Original und der
Krebsumkehrung besteht - insgeheim, unausgesprochen und
der Theorie entgegen - ein hierarchisches Verhältnis.
Andererseits ist der Motivbegriff, der aus der Beethovenund Brahms-Tradition stammte, von Schönberg tiefgreifen­
den Veränderungen unterworfen worden. Die Idee des verti­
kalen oder harmonischen Motivs wurde zwar in Wagners
späten Musikdramen vereinzelt und vage antizipiert, be­
deutete aber dennoch in der Form, die sie bei Schönberg
erhielt, einen qualitativen Sprung des musikalischen Den­
kens. Das Prinzip, Zusammenklänge als Motive zu erklären
und zu behandeln, als wären sie Tonfolgen in anderer Rich­
tung, erscheint als Lösung eines Problems, das durch die
Emanzipation der Dissonanz entstanden war: Die Entschei­
dung, Dissonanzen nicht mehr aufzulösen, versetzte Ak­
korde, die bisher durch den Fortschreitungszwang von der
Dissonanz zur Konsonanz miteinander verkettet worden waren,
in eine Isolierung und Beziehungslosigkeit, die den mu­
sikalischen Konnex gefährdete. Und ein Ausweg aus der
Schwierigkeit - die Schönberg, ein Rigorist des musika­
lischen Zusammenhangs, als besonders gravierend empfinden
mußte - bestand in dem Gedanken, daß Akkorde - analog zu
Tonfolgen - Motive sind oder sein können, also die Verti­
kale demselben Motivgeflecht angehört wie die Horizontale.
Die Kehrseite des Theorems, das bei Schönberg "Einheit
des musikalischen Raumes" heißt, war allerdings eine
Emanzipation oder Loslösung der Diastematik vom Rhythmus
(der für ein Motiv in der Vertikale nicht konstitutiv
sein kann) - oder genauer: eine Spaltung des Motivbegriffs
in diastematische und rhythmische Ausprägungen. Spuren des
Verfahrens, diastematische Beziehungen unabhängig von
rhythmischen und umgekehrt rhythmische Zusammenhänge ge­
27
trennt von diastematischen herzustellen, lassen sich be­
reits im 19. Jahrhundert entdecken: das eine eher bei
Beethoven und später bei Liszt, das andere vor allem bei
Schubert. Von Schönberg aber ist die Trennung der Momente
ins Extrem getrieben worden (und erst dadurch wurde die
Vorgeschichte des Verfahrens im 19. Jahrhundert überhaupt
sichtbar). Für atonale Werke ^ dodekaphone wie nicht-dodekaphone - ist es charakteristisch, daß Rhythmen gewis­
sermaßen als Themen fungieren, deren Diastematik aus­
tauschbar ist, und daß umgekehrt diastematische Struk­
turen einen Konnex stiften, der unterhalb der Oberfläche
des rhythmisch-syntaktisch auskomponierten Tonsatzes
bleibt. (Daß "sub-motivische", rhythmisch indifferente
diastematische Konfigurationen den latenten inneren Zu­
sammenhalt eines Satzes verbürgen, läßt sich bereits an
Werken von Beethoven demonstrieren; und Rudolph Reti ent­
wickelte aus dem Sachverhalt eine durch einen falschen
Universalitätsanspruch leider an die Grenze des Sektie­
rerischen getriebene und dadurch partiell diskreditierte
Theorie der "thematischen Zellen”) .
6
Versucht man nun unter der Prämisse, daß Schönberg das
motivische Denken zwar niemals preisgab, aber tiefgrei­
fend modifizierte, das Nebeneinander von dodekaphonen
und nicht-dodekaphonen Werken in der Emigrationszeit kom­
positionstechnisch zu verstehen, so erweist sich die skiz­
zierte Erweiterung des Motivbegriffs als ausschlaggeben­
der Sachverhalt. Denn sofern ein Motiv sowohl eine diastematisch-rhythmische als auch eine entweder diastema­
tische oder rhythmische Struktur sein kann, ohne seine
zusammenhangbildende Funktion zu verlieren, wird die Ent­
scheidung zwischen dodekaphoner und nicht-dodekaphoner
Atonalität und sogar zwischen Atonalität und Tonalität
sekundär, weil lediglich die Art, in der ein Motivkonnex
wirksam ist, sich ändert, aber nicht die fundamentale
Tatsache, daß er überhaupt besteht.
Daß Akkorde Motive sind, ist in tonalen Werken möglich,
aber nicht essentiell. Umgekehrt braucht ein dodekaphoner
Tonsatz, in dem die Zusammenklänge nicht unmittelbar aus
der Reihe, sondern aus Tönen verschiedener, melodisch be­
gründeter Reihenformen resultieren, besondere Vorkehrungen,
um die Akkorde kontrapunktisch - durch Stimmführungen, die
den Übergang vom einen zum anderen vermitteln - zu rechtfertigen. Daß die Harmonik nur partiell dodekaphon be­
gründet ist, erzwingt gewissermaßen als Ausgleich eine
polyphone Legitimation.
28
Die kontrapunktisehen Implikationen der Harmonik werden
in Harmonielehren, die nach dem Vorbild von Moritz Haupt­
mann und Hugo Riemann vom Funktionsbegriff ausgehen, im
allgemeinen vernachlässigt: Was die Funktionstheorie an
einem Akkord registriert, ist von Stimmführungstendenzen
der Töne weitgehend unabhängig. Schönberg wuchs jedoch
in der Wiener Tradition der Stufen-, nicht der Leipziger
der Funktionstheorie auf; und je weniger Zusammenklänge
funktional, durch ihre unmittelbare oder indirekte Be­
ziehung zur Tonika, erklärt werden, um so wesentlicher
erscheinen die kontrapunktisehen Verbindungen, die von
Akkord zu Akkord führen.
Eine Harmonik aber, die immer schon von Kontrapunkt durch­
drungen ist, hält sich für Modifikationen der Akkordstruk­
turen - sofern sie eben kontrapunktisch stringent sind prinzipiell offener als eine funktionale Harmonik, deren
Theorie jedem Ton eine Legitimation als Prim, Terz oder
Quinte einer Tonika, Dominante oder Subdominante abver­
langt .
Ein kontrapunktisches Denken, das noch die entlegenste
Harmonik zu rechtfertigen vermag, bildet demnach in Ver­
bindung mit einem Motivbegriff, der außer diastematisch­
rhythmischen auch ausschließlich diastematische oder rhyth­
mische Strukturen umfaßt, die Voraussetzung, die es er­
laubt, tonale, dodekaphone und atonale, aber nicht-dodekaphone Werke in gleichem Maße und ohne Wechsel der grund­
legenden musikalischen Denkform als tönenden Sinnzusammen­
hang zu konstituieren.
Mit dem, was Adorno als "Gleichgültigwerden des Materials"
bezeichnete (112), hängt in Schönbergs Spätwerk eine Rück­
wendung zum "Ideenkunstwerk" zusammen, die sich in der Ab­
sicht, nach einem Vierteljahrhundert Unterbrechung "Die
Jakobsleiter" zu vollenden, ebenso unverkennbar manife­
stiert wie in der Konzeption von "Moses und Aron", der
als Hauptwerk im emphatischen Sinne intendierten Bekennt­
nisoper, deren erster und zweiter Akt 193o-32 den Abschluß
einer Periode markierten, in der seit opus 23, abgesehen
von einigen Chören und der als Konversationsstück in Zwölftontechnik zwiespältigen Oper "Von Heute auf Morgen", die
Instrumentalmusik einseitig dominierte.
Der Begriff des "Ideenkunstwerks" schließt, wenn auch pe­
ripher, programmatische Instrumentalmusik ein, die in
Schönbergs Spätwerk nicht selten ist, angefangen von der
"Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene" opus 34, die
29
gleichzeitig mit "Moses und Aron", 193o, entstanden ist.
Nichts berechtigt zu Zweifeln an Thomas Manns Bericht,
daß Schönberg im Streichtrio opus 45 den Verlauf einer
Krankheit, von der er kaum noch zu genesen hoffte, musi­
kalisch ausgedrückt habe. Und daß die Programmskizze,
die Schönberg zum Klavierkonzert opus 42 notierte, ge­
radezu bestürzend simpel, direkt und naiv wirkt, ist kein
Grund, ihre Authentizität zu leugnen: "Life was so easy /
suddenly hatred broke out (Presto) / a grave Situation
was created (Adagio) / But life goes on (Rondo)".
Die Vermutung, daß Schönberg die Ästhetik der Programm­
musik, die er 1912 in dem Aufsatz "Über das Verhältnis
zum Text" entwarf, später änderte oder verwarf, läßt sich
durch Dokumente, wie es scheint, nicht stützen. Demnach
bildet ein Programm, in verschiedenen Graden literarischer,
bildlicher oder biographischer Detailliertheit, zwar den
Ausgangspunkt der Komposition und der Rezeption, aber nie­
mals den Inhalt und die Substanz eines musikalischen Wer­
kes. Schönberg war vielmehr 1912, im Sinne von Schopen­
hauers durch Wagner vermittelter Metaphysik, davon über­
zeugt, daß es die Musik ist, die "das innerste Wesen der
Welt ausspricht". Sie stellt die Innenseite dar, ein Text,
und zwar in der Vokal- ebenso wie in der Programmusik,
bloß die Außenseite.
Das Verhältnis zwischen Musik und Sprache, das der Drama­
turgie von "Moses und Aron" zugrundeliegt, sowie Schön­
bergs Rückkehr zum jüdischen Glauben, zu dessen Wesens­
zügen es gehört, die Sprache in einem emphatischen Sinne
beim Wort zu nehmen, lassen allerdings die Schopenhauersche Ästhetik, die sich um 19oo für deutsche Komponisten
in der Nachfolge Wagners von selbst verstand, ins Zwie­
licht geraten. Die programmatischen Momente in Instrumen­
talwerken, vor allem aber die Dominanz der Vokalmusik und
der Charakter der Texte, die sämtlich eine philosophische
oder biographische Last tragen und deren sprachliche Ge­
stalt manchmal fragwürdig sein mag, deren bekenntnishafter
Ernst sie jedoch der Kritik entzieht, erzwingen eine an­
dere Interpretation, als sie Schopenhauers Metaphysik
nahelegt: eine Metaphysik, die als Philosophie der abso­
luten Musik entstand und in der Texte, Programme und sze­
nische Vorgänge als austauschbare Oberflächenphänomene
der einzig die Tiefe der Welt erreichenden Musik erschei­
nen. Im gleichen Maße, wie die Differenz der musikalischen
Mittel gleichgültiger wurde, ist in Schönbergs Spätwerk
die Bedeutung des Inhalts gewachsen. Die absolute Musik,
die später, im Serialismus der 195oer Jahre, noch einmal
zu ausschließlicher Herrschaft gelangte, war Schönberg,
wie es scheint, in den letzten Jahrzehnten seines Lebens
ferngerückt.
3o
8
Von der Aktualität eines Phänomens zu sprechen, das der
Vergangenheit - und zwar einer fast vergessenen Vergangen­
heit - angehört, ist zweifellos prekär. Denn daß Geschich­
te sich nicht wiederholt, ist ein Topos, dessen Geltung
nicht einmal durch den Strukturalismus, der allenthalben
die lebendigen Akteure der Ereignisgeschichte durch an­
onyme Strukturen zu verdrängen trachtete, ernstlich ge­
fährdet wurde. Dennoch dürfte der Versuch, eine sich un­
willkürlich aufdrängende Analogie zwischen Schönbergs
Spätwerk und einigen Tendenzen der 197oer Jahre in groben
Umrissen zu skizzieren, zu den gerade noch erlaubten Ri­
siken gehören, die die Geschichtsschreibung von Zeit zu
Zeit eingehen muß, um nicht in der bloßen Häufung von
Daten und Fakten zu ersticken.
Das "Gleichgültigwerden des Materials", das Adorno, wie
erwähnt, in Schönbergs Spätwerk konstatierte,besagt er­
stens, daß Atonalität und Tonalität sowie dodekaphone
und nicht-dodekaphone Atonalität nebeneinander zu exi­
stieren vermochten, ohne daß die eine das Daseinsrecht
der anderen auslöschte, und zweitens, daß die Geschichte,
als deren Träger in Adornos ästhetischer Theorie das Ma­
terial erscheint, die Macht verlor, den Komponisten zu
diktieren, was erlaubt und was verboten sei. Und mit dem
"Gleichgültigwerden des Materials" war, wie Adorno zu er­
kennen glaubte, eine Restitution des musikalischen Aus­
drucks verbunden, der unter der Herrschaft und dem System­
zwang der Dodekaphonie von Schrumpfung bedroht war.
Ob oder in welchem Maße es zulässig ist, wie Adorno einen
"authentischen" Ausdruck, der einen Teil des Schönbergschen Spätwerks charakterisiert, von einem gleichsam "ent­
liehenen" zu unterscheiden, wie ihn die klassizistischen
Werke von der Suite opus 25 bis zum Klavierkonzert opus
42 ausprägen, muß offen gelassen werden - nicht, weil
Adornos Differenzierung von Schönberg selbst mit Entrü­
stung bestritten worden wäre, sondern weil sich über das
verwickelte Verhältnis zwischen Dodekaphonie und Expres­
sivität mit wenigen Sätzen nichts Triftiges sagen läßt.
Wesentlicher ist der Sachverhalt, daß überhaupt ein Zu­
sammenhang zwischen emphatischer Expressivität, einem
unbefangenen Wechsel zwischen Atonalität und Tonalität
und einer Bewußtseinsverfassung, die später - einige Jahre
nach Adornos "Philosophie der neuen Musik" - von Arnold
Gehlen "Post-histoire" genannt wurde, zu bestehen scheint:
ein Zusammenhang, der in den 197oer Jahren in den musi­
kalischen Phänomenen, die widersinnig und zum Entsetzen
der betroffenen Komponisten als "Neue Einfachheit" eti31
kettiert worden sind, unverkennbar zutage trat. Die Wahl
zwischen Tonalität und Atonalität prinzipiell offen zu
halten, sich dem zu entziehen, was Adorno als Diktat und
Konsequenzzwang der Geschichte proklamierte, und statt
"objektiver Stimmigkeit", dem Idol der 195oer Jahre, ei­
nen rückhaltlos subjektiven, individuellen Ausdruck zu
erstreben - sämtliche Impulse also, die im letzten Jahr­
zehnt wirksam wurden, waren in Schönbergs Spätwerk latent
und unter anderen geschichtlichen Bedingungen bereits ent­
halten, ohne daß den jüngeren Komponisten, wie es scheint,
der Zusammenhang bewußt gewesen wäre. Der Mangel an Doku­
menten über eine unmittelbare Anknüpfung braucht jedoch
einen Historiker nicht zu beirren und ist für ihn nicht
ausschlaggebend. Denn daß von geschichtlicher Kontinuität
oder Affinität auch dort, wo die Akteure der Ereignisse
von ihr nichts wissen, die Rede sein darf, gehört zu den
Maximen, ohne die keine Geschichtsschreibung möglich wäre,
an denen also ein Historiker festhalten muß, wenn er nicht
den Sinn seines Metiers preisgeben will.
32
Christian Martin Schmidt
MATERIALIEN FÜR EINE ANALYSE
DES STREICHTRIOS OP. 45 VON ARNOLD SCHÖNBERG
I. Zur Reihentechnik
1. Grundlage der Reihenbildung im Streichtrio op. 45 ist wie in den meisten Zwölftonkompositionen Schönbergs - die
spezifische Auswahl des Tonvorrats in den beiden sechstönigen Reihenhälften (Hexachorden). Numeriert man die
Töne der chromatischen Skala ungeachtet ihrer Oktavlage
mit O bis 11, so ergeben die Töne des einen Hexachords
skalenmäßig geordnet die Folge 0 1 4 5 6 7, die des an­
deren die Folge 2 3 8 9 10 11. Spiegelt man den Tonvorrat
des ersten Hexachords 0 1 4 5 6 7 vertikal (Umkehrung)
z.B. um den Ton 5, so erhält man 10 9 6 5 4 3; versetzt
man sodann diese Folge um sieben Halbtöne, d.h. um eine
Quinte, nach unten (Transposition), so erhält man mit
3 2 .11 10 9 8 die gleichen Werte, die den Tonvorrat des
zweiten Hexachords bilden. Wird die Achse der Umkehrung
verschoben, so ändert sich - außer bei der Tritonusverschiebung - auch das erforderliche Transpositionsintervall.
Nur wenn nach Ausführung der beiden Transformationen Um­
kehrung und Transposition sich Gleichheit des Tonvo^rrats
zwischen dem transformierten einen und dem untransfarmier­
ten anderen Hexachord ergibt, ist die Möglichkeit zü, dem
von Schönberg ausgiebig angewendeten Verfahren der "qombinatoriality" gegeben; nur wenn der Tonvorrat der ersten
(bzw. zweiten) Reihenhälfte einer Grundgestalt mit dem,
der zweiten (bzw. ersten) Hälfte einer Umkehrungstrans-^position identisch ist, können die ersten (bzw. zweiten)
Hexachorde der so aufeinander bezogenen Grundgestalt und
Umkehrung miteinander kombiniert werden, ohne daß Ton­
wiederholungen auftreten; denn die Tonvorräte der beiden
gleichen Hälften dieser Reihenvarianten ergänzen einander
zur Zwölftönigkeit. (Die im vorangehenden gewählte Dar­
stellungsform übernimmt Ansatzpunkte aus Allen Forte, The
Structure of Atonal Music, New Haven/London ^1911. Der in
op. 45 grundlegende, aus sechs Elementen bestehende Ton­
vorrat = pitch-class set hat bei ihm - S.18o - die Nummer
6-5. Der vector des pitch-class set, der die Anzahl sämt­
licher in dem Tonvorrat enthaltenen Intervalle angibt,
ist 4 2 2 2 3 2; möglich sind somit vier kleine und zwei
große Sekunden, zwei kleine und zwei große Terzen, drei
Quarten und zwei Tritoni bzw. deren Äquivalente Septime,
Sext und Quint.)
33
Schönberg hat in seinen Zwölftonkompositionen - je spä­
ter sie entstanden, desto mehr - als komplementäres Paar
Grundgestalt und unterquinttransponierte Umkehrung bevor­
zugt. In seinem Kommentar zur Wunder-Reihe^-, die dem "Mo­
dernen Psalm" op.5o C zugrundeliegt, ging er sogar davon
aus, daß dieses Paar sich gleichsam gesetzmäßig ergebe.
Tatsächlich stellt die Verbindung von Grundgestalt und
Unterquinttransposition der Umkehrung nur eine Möglich­
keit aus der großen Menge von Kombinationen dar, die das
Prinzip der combinatoriality erfüllen. Bedingung dafür
ist nämlich nicht allein der Tonvorrat in den Hexachorden,
sondern auch - wie oben angedeutet - die geeignete Wahl
der Umkehrungsachse, d.h. bei Schönberg die Wahl des er­
sten Tons der Reihe. Das belegt die Reihenbildung in op.
45: Nur wenn 5 (oder 11) erster Ton der Reihe ist, ver­
hält die unterquinttransponierte Umkehrung sich komple­
mentär zur Grundgestalt - vgl. unten Tabelle A 1; fängt
die Reihe aber beispielsweise mit 7 (oder 1) an, so ist
die Umkehrung um eine große Septime nach unten zu trans­
ponieren, um Komplement der Grundgestalt sein zu können v g l . unten A 2.
2. Das ausführliche Eingehen auf den noch nicht in der
Reihenfolge festgelegten, lediglich skalenmäßig systema­
tisierten Tonvorrat (in der Terminologie von Forte "unordered set") ist bei Schönbergs Streichtrio sachlich ge­
fordert. Er stellt nämlich die verbindende Grundlage von
je zwei hinsichtlich der Reihenfolge fixierten Ausprä­
gungen ("ordered sets" - im folgenden Permutationen ge­
nannt) sowohl im ersten als auch im zweiten Hexachord dar.
(Wiewohl Schönberg bis zu seinem Lebensende - vgl. in den
genannten Veröffentlichungen seine Ausführungen zur WunderReihe und die Skizzen zum "Modernen Psalm" op. 5o C als Bezeichnung für die erste Reihenhälfte "Vordersatz"
bzw. "antecedent", für die zweite "Nachsatz" bzw. "consequent" beibehalten hat, sollen im folgenden, um alle
Mißverständnisse zu vermeiden, das erste Hexachord mit A,
das zweite mit B bezeichnet werden. Die Permutationen
von A und B werden durch hinzugesetzte Zahlen gekenn­
zeichnet .)
1 Vgl. Josef Rufer, Das Werk Arnold Schönbergs, Kassel etc. 1959,
Faksimile vor S.121, sowie Arnold Schönberg, Sämtliche Werke,
Reihe B Band 19, Mainz/Wien 1977, S.VIII
34
Grundgestalt
A 1
1
6
0
5
b
es a
d
Komplementäre Umkehrung
A 1
7
e
4
cis
5
d
1
b
0
a
4
6
cis es
h
9
3
f is c
8
f
10
g
2
h
3
c
11
9
gis fis
5
d
7
e
0
a
4
1
cis b
5
d
0
a
11
gis
8
f
B 1
B 1
2
2
h
A 2
A 2
7
e
10
g
11
9
10
gis f is g
8
f
3
c
10
g
3
c
4
6
cis es
B 2
B 2
8
9
f is f
1
b
11
2
gis h
6
es
7
e
In der vorangehenden Tabelle sind die einzelnen Elemente
der Permutationen durch die Tonqualitäten derjenigen
Transpositionsstufe konkretisiert, die in der Komposition
als erste auftritt und von der auch Schönberg bei der
Kompositionsarbeit als untransponierter ausging. Im fol­
genden werden die acht Permutationen, die als Ausprä­
gungen zweier komplementärer Hexachorde zusammengehören,
unter dem Begriff "Region"2 zusammengefaßt - ein Vorgehen
im übrigen, das sich auf die Bezeichnungsart in Schön­
bergs Reihentabellen zu op. 45 stützen kann und das die
Darstellung der Beziehungen zwischen den verschiedenen
Transpositionsstufen erheblich erleichtert. Die Region,
deren Tonqualitäten in der Tabelle genannt sind, heißt
R°, ihre Transpositionen in steigender Folge r ! , R 2 ...
Rll.
3. Stehen bei einer Komposition, die sich auf eine ein­
zige, die Bedingungen der "combinatoriality" erfüllende
Zwölftonreihe stützt, zwei in der Reihenfolge der Ele­
mente festgelegte Permutationen (mit den Krebsformen vier)
eines Hexachords zur Verfügung, so sind es beim Streich­
trio vier (mit den Krebsformen acht). Daß diese vier Per­
mutationen auch während der kompositorischen Arbeit in
Betracht gezogen wurden, daß sie somit Bestandteil des
Kompositionsprozesses sind, bestätigen die von Schönberg
zusammengestellten Reihentabellen, in denen ausschließ­
lich sie notiert sind.
2 Vgl. dazu den Begriff der "area" bei David Lewin, Moses und Aron:
Some General Remarks, and Analytic Notes for Act I, Scene 1, in:
Perspectives on Schoenberg and Stravinsky, hg. von B.Boretz und
E.T.Cone, Princeton 1968, S.61-77, besonders S.64
35
Im konkreten musikalischen Text gewinnt jedoch noch eine
weitere Aufgliederung der Hexachordelemente an Bedeutung.
Der Kern der 2. Episode (T. 184-191, dann T. 194 Vcl.,
T. 196 2. Zählzeit bis T. 197) ist bestimmt durch die
Anordnung der sechs Elemente von A 1 bzw. B 2 als 1.-3.4.-2.-5.- 6 . Unterlegt ist dieses Anordnungsmuster den
beiden Reihenhälften in gerader Richtung und im Krebs;
das Anordnungsmuster selbst jedoch wird nicht rückläufig
gebraucht. Es ergeben sich somit nur je vier neue, stets
in gerader Richtung gebrachte Permutationen der beiden Hexachorde; als unmittelbar auf die Reihenfolge der Ele­
mente in A 1 und B 2 bezogen wären sie als Subpermutationen zu bezeichnen. (Um den Vergleich mit der Tabelle
oben zu ermöglichen, werden auch hier die Hexachorde von
RO angeführt, obwohl in der Komposition an dieser Stelle
andere Regionen verwendet sind.)
Grundgestalt
A la
5
6
d
es
A lb
4
0
cis a
B 2a
9
11
fis gis
B 2b
3
2
c
h
Komplementäre Umkehrung
A la
IO 9
3
2
8
11
f
gis
g
fis c
h
A lb
9
8
2
10
11
3
gis c
fis f
h
g
B 2a
0
1
7
4
a
b
e
cis
6
7
e
1
5
b
d
10
g
3
6
1
7
5
0
c
es cis b
B 2b
e
d
a
es
2
8
h
f
4
10 8
9
5
7
11
0
1
4
6
fis
gis g
f
a
b
cis d
e
es
Exponiert wird das Anordnungsmuster gleichsam unauffällig
durch die Verteilung der ersten (1.-3.-4.) und zweiten
Dreitongruppe (2.-5.-6 .) auf zwei Stimmen, auf Geige und
Bratsche in T. 184. Schon im selben Takt jedoch führt
das Violoncello die Aufgliederung als Folge in einer
Stimme ein. Und sie verselbständigt sich - zumal im Ka­
non ab T. 188 - in einem Maße, das ungewöhnlich ist in­
nerhalb der Reihentechnik Schönbergs und das es berech­
tigt erscheinen läßt, von Permutationen eigenen Rechts
zu sprechen. In jedem Fall unterstützt auch diese kom­
positorische Besonderheit die Beobachtung - auf die noch
näher einzugehen sein wird
daß im Streichtrio nicht
die Reihenfolge der Töne Ausgangspunkt der Konstruktion
ist, sondern der Tonvorrat der Hexachorde als primär
anzusehen ist.
4. Aus dem Repertoire der genannten Permutationen wählt
Schönberg für die von ihm bezeichneten Formteile zwei be­
stimmte Gruppen von Permutationen aus, die als unveränderte
eine formbildende Funktion gewinnen. Teil 1 und 2 stützen
36
sich auf A 1, A 2 und B 1, die beiden Episoden auf A 1
und B 2 (die 2. Episode unter Einbeziehung der Subpermutationen A la, A lb, B 2a, B 2b). Allerdings wird der
Wechsel zwischen den Permutationsgruppen an den Grenzen
der Formteile nicht betont hervorgekehrt, zumeist ist er
durch die Dominanz von A 1, die als einzige beiden Grup­
pen zugehört, fließend; an der Nahtstelle zwischen Teil
1 und 1. Episode reicht die erste Permutationsgruppe
durch A 2 noch um sechs Takte in den neuen Formteil hin­
ein. In Teil 3, der auf weite Strecken die vorangehenden
Formteile rekapituliert, stehen zunächst zwei Sektionen
annähernd gleicher Länge nebeneinander, deren Tonsatz
von der ersten (T. 2o8~237) bzw. zweiten Gruppe (T. 238266) bestimmt ist; in die Schlußsektion T. 267-293, die
im wesentlichen die Permutationen der ersten Gruppe be­
nutzt, sind lediglich eineinhalb auf die zweite Gruppe
bezogene Takte (T. 279 zweite Takthälfte und 28o) einge­
lagert .
Die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Permutationen
in zwei feste Gruppen ist auch von allen Reihentabellen
abzulesen, die Schönberg bei der Kompositionsarbeit ver­
wendet hat: Zusammengestellt sind entweder A l , B l und
A 2 oder aber A 1 und B 2.
5. Die Auffassung, daß in op. 45 nicht die festgelegte
Aufeinanderfolge der Töne bzw. Intervalle in der Reihe,
sondern weit mehr der Tonvorrat der Hexachorde Ausgangs­
punkt der Konstruktion sei, läßt sich schon mit der Bil­
dung mehrerer Permutationen begründen. Sie findet aber
im Text der Komposition weitere Unterstützung. Auffällig
ist zunächst, welch untergeordnete Rolle der horizontalen
Entfaltung ganzer Permutationen oder gar der von zwölftönigen Linien aus A und B zukommt. Des weiteren tritt
an manchen Stellen, z.B. T. 25-33, die Reihenfolge der
Elemente als Ordnungsprinzip so weit in den Hintergrund,
daß zwar das grundlegende Hexachord klar, nicht aber die
Permutation erkennbar ist. Am deutlichsten jedoch wird
der Primat des Tonvorrats beim Blick auf die Intervallik
der konkreten musikalischen Gestalt.
Im oben erläuterten vector des Hexachord-Tonvorrats 4 2
2 2 3 2 ist die kleine Sekunde mit 4 dominant. Das kommt
in der Reihenfolge der Elemente bei den drei Permutati­
onen, die als erste Gruppe Teil 1 und 2 bestimmen, nicht
zum Ausdruck; A 2 und B 1 enthalten diesen Intervall­
schritt je einmal, A 1 verzichtet gänzlich darauf. Und
dennoch gewinnt im konkreten musikalischen Text dieser
Teile die kleine Sekunde (bzw. ihre Äquivalente große
Septime und kleine None) eine überragende Bedeutung.
Sie kann nicht auf die Folge der Elemente in den Permu­
37
tationen zurückgeführt werden, also nicht auf die Quali­
tät des "ordered set", sondern allein auf den Intervall­
inhalt des Tonvorrats, d.h. eine Qualität des "unordered
set" .
Die Takte 1 bis 4 exponieren das zentrale Gewicht der
kleinen Sekunde in aller Deutlichkeit: Mit Ausnahme der
Bratsche in T. 2 werden sämtliche Phrasen der Passage
von diesem Intervall gebildet (daß bei einer solchen intervallischen Grundlage sich häufig kontrapunktisehe
Varianten von B-A-C-H ergeben, mag ein Zufall sein, frei­
lich ein bemerkenswerter). Innerhalb dieses Kontextes
kann in T. 2-4, Geige und Violoncello, ein weiteres we­
sentliches Moment der Komposition vorbereitet werden:
die Selektion der Permutationsrandtöne, die bei den Per­
mutationen der ersten Gruppe wiederum stets kleine Se­
kunden bilden. Ganz in den Vordergrund treten sie dann
bei der Hauptstimme der Geige in T. 12-17 (ebenso T. 214221 und 267-272, Geige, sowie T. 273-275, Violoncello);
sie reiht ausschließlich die kleinen Sekunden aneinander,
die als Randtöne der folgenden Permutationen bestimmt
sind: G: A 1-B 1-A 2, U: A 2K-B 1K-A 1K. Und in Teil 2,
T. 142 sowie T. 145-147 schließlich wird der gesamte Ton­
satz vollständig aus Permutationsrandtönen erstellt.
Das führt zurück zu der Anordnung der Elemente in den
drei hier in Frage stehenden Permutationen. Zwar hat sich
das Übergewicht der kleinen Sekunde im Tonvorrat nicht
in ihrer Reihenfolge insgesamt niedergeschlagen, wohl
aber erwächst aus ihm die Placierung von je zwei neben­
einanderliegenden Halbtönen am Anfang und Ende der Per­
mutationen. Die bewußte Planung zeigt sich auch darin,
daß durch die Randtöne der drei Permutationen, die zur
ersten Gruppe gehören und den gleichen Tonvorrat haben,
sämtliche Elemente des Vorrats vertreten sind: Bei 0 1
4 5 6 7 sind die Randtöne i n G : A l 5 4 , i n G : A 2 7 6
und in U: B 1 1 O.
Auf die Besonderheit der Permutationsrandtöne verweisen
auch diejenigen von Schönbergs Reihentabellen, die die
Permutationen der ersten Gruppe aufzeichnen: Die Rand­
töne sind durch gesonderte Stiele mit Achtelfähnchen her­
ausgehoben .
6. Vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit ist bei der Be­
trachtung der Schönbergschen Zwölftonkomposition bislang
dem Aspekt geschenkt worden, inwieweit die Aufeinander­
folge der verschiedenen Transpositionsstufen der Reihe
im Fortgang der Stücke Gegenstand des rationalen kompo­
sitorischen Zugriffs ist, ob sie auf einem konstruktiven
Plan beruht und wie dieser begründet ist. Über die Fest38
Stellung, daß die Kompositionen am Ende überwiegend zu
der Transpositionsstufe zurückfinden, von der sie ausge­
gangen sind, kam man selten hinaus. Auch das Streichtrio
folgt diesem Muster; der ganze Teil 1 (T. 1-51) mit den
ersten sechs Takten der 1. Episode stützt sich ebenso
auf die Permutationen der Region R° wie die letzten zwölf
Takte (T. 282-293).
Einige weitergehende Hinweise haben Milton Babbitt3 und
David Lewin^ gegeben: Schönberg setzt häufig Reihenva­
rianten in Beziehung zueinander oder verbindet sie in
unmittelbarer Folge, die - sei es in der Intervallfolge
von Einzelelementen, sei es im Tonvorrat von Teilsegmenten
Konstellationen identischer Tongualitäten aufweisen. Diese
Beobachtung gibt einen erfolgversprechenden Ansatzpunkt
für die Untersuchung der sukzessiven Disposition der Re­
gionen auch im Streichtrio.
Teil 1 stützt sich, wie erwähnt, allein auf R°. Die 2.
Episode läßt von T. 57 bis 92 r 8 und R 5 alternieren, Re­
gionen also, die drei Halbtöne oder eine kleine Terz von­
einander entfernt sind. Drei jeweils eine kleine Terz von­
einander entfernte Regionen sind von T. 93 bis 121 in
fallender Skalenfolge angeordnet: r 9 , r6 ; r 3 ; die letzten
beiden sind wiederholt, sie werden überdies in T. lo4 bzw.
117-119 simultan miteinander verbunden. Vier jeweils eine
kleine Terz voneinander entfernte Regionen sind von T.
122 bis 132, also am Ende der 1. Episode, in steigender
Skalenfolge angeordnet, wobei der Übergang von der zwei­
ten zur dritten fließend ist: r 8 , R Ü , r 2, r 5 . Bemerkens­
wert daran sind drei Punkte: Die Zahl der einen plausiblen
intervallischen Zusammenhang bildenden Regionen wächst
kontinuierlich von 1 bis 4 (diese Entwicklung setzt sich,
wie noch zu zeigen sein wird, am Anfang von Teil 2 fort).
- Grundlage des intervallischen Zusammenhangs sind Klein­
terzketten, die mit vier Gliedern im Rahmen der zwölftönigen Skala einen Zyklus bilden (solche Zyklen bilden
außerdem Großsekundketten mit sechs, Großterzketten mit
drei und Tritonusketten mit zwei Gliedern). - Ausgewählt
sind zwei der drei möglichen Kleinterzzyklen, und ihre
Glieder sind alternierend angeordnet: R° in Teil 1 und
r 9, R^, r 3 in ^er Mitte der 1. Episode ergänzen einander
3 Milton Babbitt, Moses and Aaron, in: Perspectives on Schoenberg and
Stravinsky, hg. von B.Boretz und E.T.Cone, Princeton 1968, S.53-6o
4 a.a.O.
39
zum vollständigen einen Zyklus, der am Anfang der 1. Epi­
sode mit r 8 und
nur durch zwei Glieder vertretene an­
dere Zyklus ist am Ende des Formteils mit allen Gliedern
R 8 , r H , R 2 und R^ vollständig.
Was aber, das ist die entscheidende Frage, begründet die
Verbindung der um eine kleine Terz voneinander entfernten
Regionen? Die Passagen, an denen zwei Regionen simultan
vermittelt werden (T. 1 1 7 - 1 1 9 r3 und R^, T. 1 2 9 - 1 3 o R Ü
und r2), belegen im konkreten musikalischen Text die be­
wußt auskomponierte Verwandtschaft: Die ersten vier Töne
von A 1 der Grundgestalt in einer Region und die ersten
vier Töne von A 1 der Umkehrung in der um drei Halbtöne
höheren Region sind hinsichtlich des Tonvorrats gleich;
so zum Beispiel:
R 3 G: A 1
f
cis fis e g e
R 6 U: A 1
cis f
c
fis h
d
In dieser Weise verbunden sind etwa R® und R^ in T. 7475 durch die Akkorde auf den Taktschwerpunkten sowie R^
und R 8 in T. 8o-81 durch die Übernahme der Tonqualitäten
von Bratsche und Violoncello in die Hauptstimme der Geige,
später im Teil 2 nochmals ganz an der musikalischen Ober­
fläche r 6 und r3 durch die Tonqualitätengleichheit der
Akkorde beim Taktwechsel von 178 zu 179.
(Eine analoge Verwandtschaft besteht im übrigen auch zwi­
schen den letzten vier Tönen von G: B 1 einer Region und
U: B 1 der um eine kleine Terz höheren Region; ihre letzten
vier Elemente haben den gleichen Tonvorrat. Stellt man A 1
- B 1 von G der einen und von U der anderen Region einander
gegenüber, so wird der hohe Verwandtschaftsgrad deutlich:
Die ersten Tetrachorde der ersten sowie die letzten der
zweiten Hexachorde haben jeweils den gleichen Tonvorrat,
die Resttöne werden zwischen erstem und zweitem Hexachord
ausgetauscht.
R 1 1 G: A 1
Bl
cis a
d
gis es c
b
g
f
fis e
h
R 2 U: A 1
Bl'
a
cis gis d
g
b
c
es f
e
fis h
Die Episoden benutzen - wie oben ausgeführt - nur die Per­
mutationen der zweiten Gruppe A 1 und B 2 . Die Beziehung
zwischen den B 1-Permutationen könnte also nur in den
Partien der Komposition Verwendung finden, die sich auf
die erste Permutationsgruppe A l , A 2 , B l stützen; aber
auch dort scheint sie nicht in die Konstruktion einbe­
zogen worden zu sein.)
A 1 gehört beiden für die Formteile ausgewählten Permutationsgruppen an; Beziehungen wie die oben gezeigte, die
4o
sich allein auf die Reihenfolge der Elemente in dieser
Permutation gründen, können mithin überall in der Kompo­
sition auftreten. Nur in den Episoden dagegen bzw. in
den entsprechenden Rekapitulationsabschnitten des Teils
3 kann eine Verwandtschaft Gestalt gewinnen, die zwischen
zwei Grundgestaltpermutationen der zweiten Gruppe besteht
Die ersten drei Töne von A 1 einer Region und die letzten
drei von B 2 der um eine kleine Terz höheren Region sind
gleich; so z.B. (vgl. den Übergang bei T. 67):
R5 G: A l
g
es gis d
a
fis
R 8 G: B 2
d
cis e
g
es gis
Ob Schönberg diese Beziehung bewußt eingesetzt hat, mag
zweifelhaft sein; in jedem Fall ist die Übereinstimmung
der beiden Tremoloakkorde des Taktes 65 bzw. 67-68 hin­
sichtlich der Tonqualitäten unüberhörbar.
Die zweite wesentliche Verknüpfung der Regionen neben der
Kleinterzverkettung ist im Streichtrio die von jeweils
einen Ganzton voneinander entfernten Regionen. Sie wird
am Anfang des Teils 2 exponiert; T. 133-147 halten sich
in r 5, danach folgen in taktweisem Wechsel r 9, r 7, R Ü ,
Rl und schließlich r 3 , die über drei Takte bis T. 154
ausgebreitet ist. Die sechs Regionen repräsentieren den
sechsstufigen Ganztonzyklus innerhalb der zwölftönigen
Skala vollständig; anders aber als bei den Terzketten in
der 1. Episode unterliegt ihre Anordnung keiner Systema­
tik, sondern ist - wie zu zeigen sein wird - vom konkre­
ten musikalischen Zusammenhang bestimmt. Mit sechs benutz
ten Regionen setzt der Anfang des Teils 2 die kontinuier­
liche Entwicklung hinsichtlich der Zahl der einen plau­
siblen intervallischen Zusammenhang bildenden Regionen
fort, die sich von 1 in Teil 1 über 2, 3 und 4 in der 1.
Episode entfaltet.
Die sechs einen Ganztonzyklus bildenden Regionen haben
die Eigenschaft, daß die Permutationsrandtöne von A 1,
A 2 und B 1 jeweils die gleichen Kleinsekundintervalle
bilden; bei den in T. 133-154 benutzten sind es - stets
freilich in einer anderen der sechs Permutationen: c-cis,
d-es, e-f, fis-g, gis-a, h-b. Es wurde oben dargestellt,
welch wichtige Rolle den Permutationsrandtönen bei der
Tonsatzbildung in Teil 1 und besonders am Anfang von Teil
2 zukommt. Hier nun wirkt sich ein wesentliches Moment
der Detailkonstruktion auf die übergreifende Disposition
der Regionen aus. Die Verbindung dieser beiden Ebenen
wird in T. 148-152 unmittelbar deutlich, und damit ist
zugleich die Verbindung der Regionen im Ganztonabstand
und ihre Anordnung konkret im Tonsatz begründet. Inner­
41
halb der sich in latenter Zweistimmigkeit bewegenden
Begleitfiguration wird die Hauptstimme der Geige aus T.
12-17 quarttransponiert und mit nur leichten Modifika­
tionen abgebildet (T. 149 f-e steht für e-f, T. 152 d-es
und cis-c sind "simultan" verbunden); in T. 148-151 steht
die "Oberstimme" der Figuration für die Beziehung ein:
g'-fis1, f-e, a'-as', h"-b", in T. 152 sind die beiden
letzten Glieder auf "Ober-" bzw. "Unterstimme" verteilt:
d"-es" bzw. cis'-c1. Stammen in T. 12-17 die Halbtonschritte als Randtöne aus den verschiedenen Permutationen
einer Region, so sind sie hier mit nur einer Ausnahme als
Randtöne einer bestimmten Permutation verschiedener Re­
gionen entnommen: Nur das vorletzte Glied übernimmt die
Randtöne aus G: B l , alle anderen sind Randtöne von U:
B 1.
II. Zur musikalischen Gestalt
1. Der Teil 1 entfaltet sich in einem Tonsatz, der keine
melodischen Linien kennt. Zwar werden Momente von Themen­
bildung angedeutet wie die Gegenüberstellung von Vorderund Nachsatz in T. 1-4 oder die Formulierung einer eini­
germaßen kontinuierlich verlaufenden und homogen beglei­
teten Hauptstimme in T. 12-17; zwar werden auch in sich
einheitlich gebildete Flächen größerer Ausdehnung expo­
niert wie die in T. 25-33. Bei all dem aber wird die Kon­
stituierung eines geschlossenen melodischen Zusammenhangs
vermieden. Vorherrschend vielmehr ist der Eindruck des
Kleingliedrigen, Zerstückelten, der aggressiven Geste.
Zu dieser Wirkung trägt nicht zuletzt die Dominanz der
kleinen Sekunde und besonders ihrer intervallischen Äqui­
valente große Septime und kleine None in Aufeinanderfolge
und Zusammenklang bei, aber auch die starke Einbeziehung
von Spielarten wie Flageolett, col legno, pizzicato, am
Steg etc.
Dagegen stellt die 1. Episode in T. 53-56 - der Kontrast
ist kaum plastischer zu realisieren - eine viertönige,
höchst expressive Geigenmelodie, und das Moment der Rück­
besinnung wird noch unterstrichen durch die liegende Terz
als Begleitung. Die Möglichkeit von Melodiebildung, an
die hier so nachdrücklich erinnert ist, wird auch sogleich
(T. 57-62) aufgegriffen, tritt danach jedoch wieder in den
Hintergrund. Voll eingelöst ist das Versprechen, Melodie
zu bilden, erst in T. 8 6 , wo die melodische Gestalt inner­
halb eines geprägten Bewegungstypus, eines Tanzes, ihren
festen Rahmen findet. Und Tanz- bzw. Walzertypen, denen
in Schönbergs Oeuvre spätestens seit dem "Pierrot lunaire"
op. 21 eine besondere Rolle zukommt, gewinnen in der 1.
Episode, in Teil 2 und der 2. Episode ein immer größeres
42
Gewicht; sie werden zum zentralen Gegensatz der Satzart
in Teil 1.
2. Teil 3 stellt eine Rekapitulation von Abschnitten der
vorangehenden Formteile dar; allein auf die 2. Episode
wird nicht zurückgegriffen. Die Art der Wiederaufnahme
reicht von der fast identischen Wiederholung über die
Entsprechung als Umkehrung des gesamten Tonsatzes bis hin
zur Umformung aufgrund gleicher Substanz. T. 2o8-232 neh­
men Taktgruppen aus Teil 1 wieder auf (vgl. 2o8-2o9 und
1-2, 21o-211 und 4-5, 212-213 und 8-9, 214-221 und 12-17,
222-227 und 25-33, 228 und 44, 229-231 und 45-47, 232 und
51), T. 233-256 solche aus der 1. Episode (vgl. 233-24o
und 52-59, 241-243 und 62-64, 244-25o und 79, 2. Viertel
bis 85, 251-256 und lo5-llo). Bis zu dieser Stelle hält
sich die Rekapitulation in Selektion stets an die Reihen­
folge des Exponierten und verzichtet auf jegliche Ergän­
zung neuer Takte; bemerkenswert ist, daß sich unter den
ausgelassenen Partien auch der erste Tanzabschnitt (T.
8 6 ff.) befindet.
Dieser wird nun in T. 263-266 (vgl. 86-89) gleichsam nach­
geholt, und seine geänderte Placierung hat zur Folge, daß
die zu ihm hinführenden Takte ebenfalls umgestaltet wer­
den. Schließen T. 259-26o (vgl. 116-117) noch an die Re­
kapitulationsreihung des Vorangehenden an, so sind die
umgebenden Zweitakter T. 257-258 bzw. T. 261-262 neu for­
muliert .
Nach der Wiederkehr des ersten Tanztypus wird das bis T.
256 strikt beibehaltene Rekapitulationsprinzip der unver­
änderten Reihenfolge endgültig aufgegeben; und ließ bis
zu diesem Takt die Wiederaufnahme auch den Satzzusammen­
hang und Umfang der Taktgruppen unangetastet, so treten
nun Momente der freien Verarbeitung in den Vordergrund.
In T. 267-275 werden nochmals T. 12-17 aus Teil 1 aufge­
griffen und in extremer Reduktion des Tonsatzes, doch
auch in sukzessiver Doppelung entfaltet. T. 276-279 be­
ziehen sich auf T. 142-145 aus Teil 2, lassen die zweite
Takthälfte von T. 144 aus und vertauschen die beiden Takt­
hälften von T. 145; in T. 279-28o wird der zweite Tanz­
typus der 1. Episode (vgl. T. 122) angedeutet, T. 281
übernimmt mit T. 155 wiederum einen Takt aus Teil 2. Die
ausgedehnteste Verarbeitung jedoch erfährt die Wiederauf­
nahme eines Tanzabschnitts in T. 282-293; durch Tempo und
den Tonsatz seines Anfangs deutlich auf T. 159ff. in Teil
2 bezogen, greift er jedoch auch Elemente aus anderen Tanz­
abschnitten auf.
Die Rekapitulation in Teil 3 unterstreicht die besondere
Rolle der Tanztypen im Streichtrio. Die Änderung des Re­
43
kapitulationsprinzips nach T. 256 geschieht im Hinblick
auf die Wiederkehr des ersten Tanzabschnitts, der zuvor
gezielt ausgespart blieb. Und die verarbeitende Wieder­
aufnahme kulminiert in einem von Tanzelementen bestimmten
Abschnitt, mit dem die Komposition ausklingt.
3. Ein Jahr nach dem Streichtrio schrieb Schönberg "A
Survivor from Warsaw" op. 46. Als zentraler Gedanke die­
ser - ebenfalls dodekaphonen - Kantate ist die Gegenüber­
stellung des expressiven atonalen Idioms, das keine The­
men und Motive kennt, und der gebundenen Zwölftontechnik
anzusehen, in der es wieder möglich war, Themen, Melodien
zu schreiben. Dieser Konfrontation kommt in op. 46 eine
über den internen musikalischen Zusammenhang hinausge­
hende Bedeutung zu, nicht nur eine politische im Zusam­
menwirken mit dem Text, sondern auch als Abbild der Ent­
wicklung des Schönbergschen Komponierens^. Die weitge­
hende Übereinstimmung mit der Konzeption des Streichtrios
ist unverkennbar. Aber während in op. 46 die musikalische
Idee auch im musikalisch-technischen Bereich, im Übergang
vom athematischen zum thematischen Komponieren, stringent
auskomponiert wird, steht im Streichtrio die Ausdrucks­
sphäre, der Gegensatz zwischen aggressiver Geste und dem
melodiös Schönen, im Vordergrund. In beiden Kompositionen
jedoch ist der formale Verlauf auf der Grundlage der ge­
genübergestellten Bereiche der gleiche; beide Komposi­
tionen gehen aus vom Amelodischen, Zerstückelten und füh­
ren hin zum Thematisch-Melodischen, Gebundenen.
5 Vgl. Christian Martin Schmidt, Arnold Schönbergs Kantate "Ein
Überlebender aus Warschau" op. 46, in: Archiv für Musikwissen­
schaft XXXIII, 1976, S.174-188 und 261-277
44
Rudolf Stephan
ALBAN BERG
Alban Bergs Name, der eines der edelsten Komponisten un­
seres Jahrhunderts, ist verknüpft sowohl mit einem der
größten Erfolge als auch mit einem der häßlichsten Skan­
dale. Am 31. März 1913 fand in Wien, einen knappen Monat
nach der triumphalen Uraufführung der Gurre-Lieder Arnold
Schönbergs, ein Konzert des Akademischen Verbandes für
Literatur und Musik statt, das Werke von Schönberg, Zem­
linsky, Webern und Berg brachte und noch die Kindertotenlieder Mahlers bringen sollte. Bei den Orchesterstücken
Weberns gab es schon Unruhe, bei der Aufführung zweier
kurzer Lieder nach Ansichtskartentexten von Peter Alten­
berg von Alban Berg brach ein beispielloser Lärm aus. Der
Skandal ist oft geschildert worden, es bleibt jedoch denk­
würdig, daß ein Werk Bergs - ein freilich als provokato­
risch empfundenes Werk - ihn ausgelöst hat. Es läßt sich
schon sagen, was den Skandal provozierte, der Text A'ltenbergs - "siehe Fraue, auch du brauchst Gewitterregen" -,
die Diskrepanz zwischen dem riesenhaften Orchesteraufge­
bot und dem Miniaturcharakter der beiden aufgeführten
Lieder usf. Die notorische Atonalität wird noch als das
geringste Übel empfunden worden sein...
Und dann, noch nicht ganz zwölf Jahre später, in Berlin
der ganz auRerordentliche Erfolg der Uraufführung der
Oper "Wozzeck" an der Preußischen Staatsoper unter Erich
Kleiber. Die Hetze gegen das Werk, die von gewissen Krei­
sen betrieben wurde, hat den Erfolg stimuliert und ihm
erst die richtige Würze und Würde gegeben. Daß Berg über
den Erfolg, wie Adorno gelegentlich berichtete, hätte ge­
tröstet werden müssen, gehört wohl ins Reich der Legende.
Der Skandal kam dann in Prag, er war politisch motiviert.
Er richtete sich gegen die Aufführung des Werkes eines
deutschen Komponisten am tschechischen Nationaltheater.
Aber auch das ist alles Vergangenheit. Heute stehen die
Werke Bergs nicht nur in hohem Ansehen, sie werden sogar
ständig aufgeführt; und sie haben Erfolge, sowohl bei den
Kennern als auch den Liebhabern (um in Kategorien des 18.
Jahrhunderts zu reden), sogar beim breiten Publikum.
Es ist erstaunlich, ein wie hoher Prozentsatz der Werke
Bergs dauerhaften Erfolg hat: die beiden Opern, "Wozzeck"
und "Lulu", die beiden Konzerte, das Kammerkonzert und
das Violinkonzert, die beiden Quartette,
das Opus 3 und
die "Lyrische Suite"; die Klaviersonate op.l galt Eduard
Erdmann um 192o als das beste moderne Klavierstück, und
45
auch die Orchesterstücke o p . 6 sowie die - veröffentlich­
ten - Lieder werden so oft aufgeführt, daß ihr Erschei­
nen auf Konzertprogrammen kaum als Besonderheit gebucht
zu werden braucht. Allenfalls tritt die Konzertarie "Der
Wein" etwas zurück, aber das besagt schließlich auch nichts.
Berg hat insgesamt wenig komponiert, aber das Wenige hat
sich durchgesetzt, fast ausnahmslos durchgesetzt. Dennoch
empfand es Berg als bedrückend oder beschämend, so wenig
komponiert zu haben (vor allem, da er ja kein ausübender
Musiker wie Mahler oder Zemlinsky war), und aus diesem
Grund hat er darauf verzichtet, nach seinem opus 7, dem
"Wozzeck", die Werke mit Opuszahlen zu versehen. Hätte er
weitergezählt, er wäre gerade bis op.12 gekommen. (Krenek
hatte aus dem umgekehrten Grunde mit dem Zählen aufgehört,
aber später, um sich und anderen einen Überblick zu ermög­
lichen, die Zählung wieder aufgenommen: mit 5o Jahren älter wurde Berg nicht - stand Krenek bei op.125.)
Indessen täuscht bei Berg die geringe Zahl etwas. Es gibt
bei ihm eine ganze Reihe von Zweitfassungen, die selbstän­
dige Bedeutung beanspruchen dürfen: die drei Sätze aus
der Lyrischen Suite für Streichorchester, die Lulu-Suite,
allein wegen der unvergleichlichen zukomponierten Einlei­
tungstakte, das Adagio aus dem Kammerkonzert für Klavier,
Klarinette und Geige u.a.m. Es gibt da noch Neues zu ver­
melden: nicht nur jene Fuge über zwei Themen für Streich­
quintett und Klavierbegleitung, die als erstes Werk des
jungen Berg in der Öffentlichkeit erklungen ist (im Rah­
men eines Konzerts von Schülern Schönbergs im Jahre 19o7) ,
sondern auch Bearbeitungen für Klavier zu vier Händen,
und zwar eine des Streichquartetts op.3 und eine des er­
sten der Orchesterstücke op. 6 . Im Nachlaß Bergs finden
sich natürlich zahllose Jugendwerke, auch die Übungsstücke,
die Berg für Schönberg komponiert hat. Der Übergang vom
Übungsstück zur Komposition ist bei Berg übrigens nicht
eindeutig fixierbar.
Jedenfalls gingen dem ersten aner­
kannten Werk Bergs, der Klaviersonate op.l, noch weitere
Sonaten voran, ja es scheint, daß die veröffentlichte So­
nate nur die reifste der komponierten ist, eigentlich die
sechste. Man wird nicht sagen können, daß die anderen fünf
gänzlich aus Bergs Gesichtskreis verschwunden sind, wenn
man erkennt, daß die vierte Sonate (in d-Moll) in dem be­
rühmten großen Zwischenspiel vor dem letzten Bild der Oper
"Wozzeck" wieder aufscheint: nicht eine bloß skizzierte
Symphonie aus der Zeit vor den Orchesterstücken o p . 6 ist,
wie gelegentlich zu lesen ist, in dieses große Zwischen­
spiel eingegangen, sondern eine der frühen Klaviersonaten
aus der Zeit des Unterrichts. Berg hat eben seine Frühwerk§ nicht verleugnet - das zeigt schließlich auch die
damals von Avantgardisten als anstößig empfundene Bear­
46
beitung, Instrumentation und Herausgabe von Jugendliedern
als "Sieben frühe Lieder" (1928) .
Die Symphoniefragmente Bergs, die teilweise schon in Faksimile-Reproduktionen allgemein zugänglich sind, bisher
jedoch kein Interesse erregt haben, sind äußerst lehr­
reich: sie zeigen, wie Berg komponierte, wie er musika­
lische Gedanken entwickelte und formulierte. Sie werden,
wie alles Relevante aus Bergs Hinterlassenschaft, im Rah­
men der Gesamtausgabe der Werke Bergs der Öffentlichkeit
bekannt gemacht werden.
Schönberg, der Lehrer, und Webern, der Freund, haben zu
wiederholten Malen hervorgehoben, daß es ihnen, nach der
Preisgabe der Kunstmittel der Tonalität, nicht möglich
war, umfangreichere Instrumentalkompositionen zu schrei­
ben. Sie komponierten einerseits "Kurze Stücke", anderer­
seits Vokalwerke, deren Form durch Länge, Struktur und
Gliederung des poetischen Textes bestimmt wird. Der Wunsch,
wieder große Formen im Bereich der Instrumentalkomposition
realisieren zu können, war einer der Antriebe, die zur
Entwicklung der Kompositionsmethode mit zwölf nur aufein­
ander bezogenen Tönen geführt hat. Schönberg fühlte sich,
als die Methode sich als erfolgreich erwies, erleichtert
und sprach von der Wiedergewinnung der Spontaneität. Berg
kannte diese Probleme, trotz der in den Klarinettenstücken
op.5 und den Altenbergliedern op.4 realisierten kleinen
Formen, offenbar nicht. Dies erweisen nicht nur das Quar­
tett op.3 - unter diesem Aspekt ein Werk von einzigartiger
Bedeutung - und die Orchesterstücke op.6 , sondern vor allem
das Kammerkonzert, das schließlich bereits konzipiert und
weitgehend ausgearbeitet war, als Berg die ersten verläß­
lichen Nachrichten über die neuen Formprinzipien erhielt.
Auch die Symphoniefragmente aus der Vorkriegszeit erwei­
sen, daß Berg diese Probleme eigentlich fremd waren. Um
diese Tatsache richtig würdigen zu können, erscheint es
angezeigt, sich an einiges zu erinnern.
Schönberg hat in dem Kapitel "Ästhetische Bewertung sechsund mehrtöniger Klänge" seiner Harmonielehre (1911) , von
der er gesagt hat, er habe sie von seinen Schülern ge­
lernt, auch einen (damals) ungewöhnlichen Klang von Alban
Berg zitiert. "Warum das so ist und warum es richtig ist,
kann ich im einzelnen vorläufig noch nicht sagen. (...)
Aber daß es richtig ist, glaube ich fest, und eine Anzahl
anderer glaubt es auch" (1.Aufl.,S.469). Edwin von der
Nüll, der diese beiden Sätze ebenfalls zitierte, wagte ei­
ne Analyse: "Wir erklären", so schrieb er in seinem Buch
"Moderne Harmonik" (1932) , "die beiden Akkorde (der er­
ste bleibt orgelpunktartig liegen) folgendermaßen: simul­
tane Dur-Moll-Vermischung über dem Grundton h ergibt den
47
Vierklang h-d-dis-fis (dis ist hier falsch als es notiert)
dem die Septe a beigefügt ist; Dur-Moll-Vermischung über
dem Grundton e verursacht den Vierklang e-g-gis-h (gis
fälschlich als as geschrieben); 'es ' ist Unternebenton
des Grundtons e, c Obernebenton der Quinte h. Die Akkord­
folge ist im Sinne einer Dominant-Tonika-Kadenz zu ver­
stehen. Dabei wollen wir die Geschlechtervermischung durch
Vereinigung der Tonartzeichen (...) Formel: Ee: V I" (S.
84) .
Diese Analyse ist scharfsinnig, aber, wie bereits Lukas
Richter bemerkte, leider nicht richtig. Den musikalischen
Sachverhalt treffend zu beschreiben, hätte es der Einsicht
in den musikalischen Zusammenhang, in dem sich diese
Klänge finden, bedurft. Dieser wird aber in der Harmonie­
lehre nicht gegeben. Schönberg kommentiert das Beispiel
selbst sehr merkwürdig: "Für die Folgen solcher Akkorde
scheint die chromatische Skala verantwortlich gemacht wer­
den zu können. Die Akkorde stehen meist in dem Verhältnis,
daß der zweite möglichst viel solcher Töne enthält, die
chromatische Erhöhungen der im vorhergehenden Akkord vor­
kommenden sind. Aber sie kommen selten in derselben Stim­
me vor. Dann habe ich bemerkt, daß Tonverdopplungen, Ok­
taven, selten Vorkommen" (1.Auf1.,S.469). Ist das jedoch
eine zutreffende Beschreibung des Berg-Zitats? Oder ein
hinreichender Kommentar zu den musikalischen Vorgängen?
Schönberg hat in den späteren Auflagen der Harmonielehre
gerade diese Partie stilistisch verbessert, verdeutlicht,
nicht aber den Inhalt modifiziert. Das wäre jedoch nötig
gewesen. Hat nicht der zweite Akkord zwei Töne mit dem
ersten gemeinsam, Es und H? Bilden die gemeinsamen Töne
keine Oktaven? Schließlich kann die Bemerkung, daß sich
die Stimmen des Tonsatzes selten in kleinen Sekundschritten darstellen - so die Bemerkung der dritten Auflage (S.
5o5) - nur dahingehend interpretiert werden, daß es sich
in Schönbergs Werken so verhält. Bei Berg ist dies jeden­
falls anders. Gerade der Zusammenhang, in dem sich das
Zitat findet, im Schlußabschnitt des letzten der Lieder
op.2 (also im dritten Mombert-Lied, op.2, Nr.4, Takt 22),
der ersten nicht mehr tonalen Komposition Bergs, ist hier
überaus aufschlußreich.
Der erste der zitierten Klänge ist Endpunkt einer Ent­
wicklung, der zweite hat mehr koloristische Bedeutung.
Die dem Hauptklang vorangehende Tonbewegung läßt sich
leicht beschreiben: im Baß die aufsteigende Folge reiner
Quarten b-es-as-des-ges-ces (umgedeutet als h), in den
Oberstimmen der chromatisch abwärts geführte Quartenakkord-, bestehend aus einer übermäßigen und einer reinen
Quart as-d-g (über b). Die jeweiligen Akkorde können also
48
NB 1: Alban Berg, Vier Lieder für eine Singstimme m i t Klavier, op.2,
nach Gedichten von Hebbel und Mombert
hier: op„2 Nr.4 (T.16-25)
@
1928 by Schlesinger'sehe Buch- u. Musikhandlung, Berlin­
Lichterfelde; @
-Renewal 1956 by Frau Helene Berg, Wien
nicht umstandslos aus der Baßfolge abgeleitet werden. Die
Behauptung von Redlich, "das harmonische Geschehen dieser
Takte ist in der völlig vertikalen Auswirkung des hori­
zontalen Geschehens der Baßlinie enthalten", ist sicher
unzutreffend. Redlich, dessen Ausführungen leider gele­
gentlich unklar sind, kommt das unbestreitbare Verdienst
zu, die Wichtigkeit dieser Stelle erkannt und die Bezie­
hung zu dem harmonischen Schema, das sich am Anfang des
ersten (noch tonalen) Mombert-Liedes (op.2,Nr.2) findet,
bemerkt zu haben. Aber seine Argumentation zielt in die
falsche Richtung. Er sucht Antizipationen der Zwölftonmethode, während es doch in der Tat darum geht, die un­
mittelbare Folge der Klänge zu erklären. Alle erschei­
nenden Klänge sind Abkömmlinge von Septakkorden, aber
ihre konkrete Gestalt - d.h. hier, die Entscheidung, wel­
cher Akkordton jeweils durch einen unmittelbar benach­
barten Ton ersetzt wird - verdanken sie dem Schema: Quart­
folge gegen chromatisch fallende Quartenakkordkette.
Dieses Schema ist vorgegeben - es kann nicht zufällig
entstanden sein - und leitet sich gewiß aus Parallelbe­
wegungen, die Berg etwa bei Debussy hat studieren können,
45
ab. (Die Herkunft der Quartfolge aus Schönbergs Kammer­
symphonie bedarf keines Nachweises.)
Die Verbindung von chromatischen Gängen und Quartfolgen
(und Quartklängen) ist für die Mombert-Lieder charakte­
ristisch. Am Anfang des ersten (op.2,Nr.2) findet sich
eine etwas andere Kombination. Die Harmoniefolge kombi­
niert ab dem vierten Klang die Quartfolge im Baß mit der
chromatisch fallenden Bewegung der drei Oberstimmen (zu
denen noch die Singstimme tritt).
Langsam (Tempo I)
Alban Berg,Op.2. H° 2
NB 2: Alban Berg, Lied op.2 N r . 2 (T.l-5)
Auch hier nötigt der Wunsch, die Oberstimmen so (und nicht
anders) zu führen, zu Alterationen der Septakkorde über
des und ces. Es ist kaum zweifelhaft, daß als Grundmuster
eine Klangfolge anzusehen ist, die die chromatische Be­
wegung auch für die Anfangsklänge annimmt. Indessen spielt
hier noch das Motivische eine Rolle: verminderte Quart
und kleine Terz (fes-es-c) als Melodie und die abwärts
gleitende Chromatik: "Schlafend trägt man mich in mein
Heimatland". Das Schlafmotiv aus der "Walküre" ist die
Quelle der Chromatik (nicht jedoch des Tonsatzes).
In welchem Umfang chromatisches Gleiten für den nicht
tonalen Tonsatz Bergs bezeichnend ist, zeigt vornehmlich
eine andere Taktgruppe im letzten Mombert-Lied. (Auf die
Füllung der Takte 3f. mit Ausschnitten aus der chroma­
tischen Skala, desgleichen die chromatischen Gänge nach
dem Höhepunkt Takte 15ff., c-Gis, des-f, a-d1, ist hier
als auf die einfachsten Gestalten resp. Formbildungen nur
hinzuweisen.)
In den Takten 12 bis 15 bietet ein wichtiges Motiv den
auftaktigen
|J Tritonus c-fis, der vielfach wiederholt
wird. In den Unterstimmen setzt von der Quint Fis-cis aus­
gehend eine sich spreizende chromatische Gegenbewegung
5o
poco rit. - . schmilzt
und glit-zert
kal - ter
V
Nock langsameres Tempo
— r—
....
Schnee, ein
r*—
M;id - chen
r— "T"*
in
,—
------- r—
^^
grau-em Klei - de
sehr ausdrucksvoll
# -
-
spitz
—
te—
^
t —i
lehnt an feuch-tem
, f*- ... f i i
r - ---- u - t , - - # : ---------- ^
mfspi
..................
y Zeit lass m
P
.......................
jt
"
qi
Der Vorschlag ruhig und langsam zu nehmen!
NB 3: Alban Berg, Lied op.2 N r . 4 (T.11-15)
bis Dis-e ein, dann in Takt 14 dieselbe von E-dis begin­
nend bis D-f, schließlich mit Dis-e beginnend bis D-es.
Gibt man jedem Klang eine Kennziffer, so entsteht die
Zahlenfolge 1-2-3-4/3-4-5/4-5. Im Oberstimmenkomplex der
Takte 15 und 16 spielt sich folgendes ab:
Oberstimme:
c fis g
c fis
c fis
c fis
51
Mittelstimme:
Unterstimme:
c
c
c
c
c
c
c
c
h
cis
cis
h
h
c
d
d
b
b
es
a
a
Es ließe sich dazu sicher noch manches sagen, etwa näher
erklären, wie das Glissando in Gegenbewegung, das die
Kommentatoren schon immer gereizt hat, aus dieser Klang­
bewegung herauswächst, d.h. - sie aufbricht. Auch über
die Verwandlung des Rhythmus wäre zu sprechen. Das sei
hier vernachlässigt zugunsten der wichtiger erscheinenden
Feststellung: Die chromatische Skala beherrscht die Me­
lodiebildung nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Die
Tonbewegung wird primär durch abstrakte Zeichen - seien
dies nun Zahlen oder graphische Bilder - gesteuert.
Der Steuerungsplan wirkt sich nicht bis in alle Einzel­
heiten hinein aus - so kann der Eintritt eines neuen Tones
verzögert werden, Einzelstimmen können sich vereinigen
usf.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel bietet der Schluß
des dritten der Klarinettenstücke op.5. Hier entwickeln
sich aus der Terz c 1 -e ' vierstimmige Akkordkomplexe.
Jeder der beiden Töne wird zum Ausgangspunkt einer chro­
matischen Auf- und Abwärtsbewegung: e '- f '-fis'- g 1 -as' und
e'-es'-d', sowie c '-cis'- d '-es 1 und c'-h-b-a. Der Schluß­
ton g tritt an die Stelle des as, das mit Rücksicht auf
die oberste der genannten Stimmen, und im Hinblick auf
die noch hinzutretende tiefste Stimme, entfällt. Diese
tiefste Stimme, die ihren Ausgangspunkt von dem in die
Terz c-e hineingespielten d' nimmt, ist eine durch Oktav­
versetzung gebrochene chromatische Skala: d ’-es-e-F-FisG-As-A.
Der Sinn eines derartigen kompositorischen Verfahrens be­
steht darin: Der Autor hat es bei der Komposition nicht
mit Einzeltönen zu tun, sondern bereits mit recht diffe­
renzierten größeren Einheiten: Klangkomplexen und Klang­
folgen. Dieses Verfahren ist mit ähnlichen in Zusammenhang
zu sehen, so etwa mit der Technik des Klangzentrums, die
bei Berg ebenfalls eine ganz erhebliche Rolle spielt; das
soeben beschriebene Verfahren hat jedoch den Vorzug, daß
es eine Klangfolge bildet, bei der die Aufeinanderfolge
der Einzelklänge als begründet erscheint. Ob sie als lo­
gisch bezeichnet zu werden verdient, ist eine andere (mehr
terminologische) Frage. Wenn die Voraussetzungen als solche
52
Im m er noch rascher.
sempre
NB 4: Alban Berg, Klarinettenstück op.5,3 (T.14-18)
©
1924 by Universal Edition; ©
-Henewal 1952 by Frau Helene
B e r g , Wien
anerkannt sind, kann das Ergebnis als logisch aus diesen
Voraussetzungen folgend betrachtet und angesprochen wer­
den .
Es gibt natürlich noch etliche andere Techniken, die ei­
ne sinnvolle Tonkonstellation ermöglichen, z.B. die der
Füllung eines durch ein Motiv bezeichneten Intervalls,
also die Realisierung eines chromatischen Totais inner­
halb eines fixierten Ambitus. Hierfür kann der Anfang des
genannten dritten Klarinettenstücks einstehen: Der über­
mäßigen Quint c'-gis' folgt als Zentrum das e'; von die­
sem Ton ausgehend entwickeln sich aufsteigend f'fis'-g 1
53
und absteigend es '- d '-des'.
NB 5: Alban Berg, Klarinettenstück op.5,3
(T.l-3)
Die Technik der Gegenbewegung ist keineswegs ein bloß
ausgedachtes Verfahren, sie hat vielmehr eindrucksvolle
Vorbilder. Das chromatische Gegenbewegungsmodell im er­
sten Satz der Zweiten Symphonie von Mahler gehört in die­
sen Zusammenhang. Das Wichtigste dürften aber die aushar­
monisierten unendlichen (freilich überwiegend diatonischen)
Skalen sein, die sich insbesondere in der Kirchenmusik­
tradition finden, vor allem eindrucksvoll bei Bruckner
(z.B. in der d-Moll-Messe), aber auch bereits früher, z.B.
in den letzten von Mozart komponierten Lacrimosa-Takten
seines Requiems.
Das Kompendium der Satztechniken, die einen tonartfreien
musikalischen Zusammenhang wenn nicht erzwingen, so doch
ermöglichen, sind die vieldiskutierten Orchesterlieder
nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg op.4. Hier
müssen Hinweise genügen. Der Mittelteil des dritten Liedes
- "Leben, und Traum vom Leben" - ist ein Musterbeispiel
für die chromatische Gegenbewegung.
tt«1
¥
W" «ca. Vf
NB 6 : Alban Berg, 5 Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von
Peter Altenberg op.4
hier: op.4 Nr.3 (T.12-14 Klavierauszug)
©
54
1953 by Universal Edition A.G., Wien
Die Rahmenteile bieten den durch die Mittel der Instru­
mentation ständig in sich kreisenden Zwölfklang, eine mu­
sikalische Allegorie des Alls, von dem der Text spricht.
Das letzte Lied, eine Passacaglia, verarbeitet mehrere
musikalische Gedanken unterschiedlicher Herkunft und un­
terschiedlicher Bedeutung. Der Passacagliabaß g-as-b-cis-e
wird nicht nur wiederholt, sondern auch noch als Akkord
und als klangdarstellende Figur verwendet. Als solche
wird er auch transponiert. Wichtig ist also hier die Transponierbarkeit des Motivs, seine Umwandlung in Klang und
seine gleichzeitige Verwendung auf mehreren Bedeutungs­
ebenen ("Schichten"). Eines der Motive basiert auf Quarten,
ein anderes ist - wie bekannt - eine Zwölftonfolge. Diese
ist nichts anderes als eine Melodisierung der chromatischen
Gegenbewegungsfigur: c-des-h-b-d-a-es-as-g-fis-f-e.
NB 7: Alban Berg, Orchesterlied op.4 N r . 5 (T.5-10 Klavierauszug)
Die Konsequenzen aus den Errungenschaften, die diese Werke
boten - vor allem die Klarinettenstücke und die Altenberglieder - sollte die Symphonie ziehen. Berg plante minde­
stens zwei Sätze, einen freien und einen passacagliamä­
ßigen. Die Entwicklung der musikalischen Einzelheiten aus
Strukturverhältnissen wie den beschriebenen, aus als ele­
mentar zu denkenden Satztypen, Bewegungsformen und Ton­
konstellationen ist ganz deutlich erkennbar. Berg hat die­
sen Plan nicht realisiert, die begonnene Arbeit abgebro­
chen. Die Symphoniefragmente, wie sie überliefert sind,
stellen die einzigen nennenswerten Bruchstücke aus Bergs
Nachlaß dar. Warum Berg die Komposition abgebrochen hat,
läßt sich genau nicht mehr ermitteln, vermutlich war ein
Einspruch Schönbergs der Grund. Schönberg empfahl Berg
nämlich, Charakterstücke zu schreiben, d.h. nichts ande­
res, als vom Ausdruck und nicht von der Konstruktion aus­
zugehen, also das Thematische oder Motivische wieder als
das Primäre anzusehen und nicht die konkreten musikali­
schen Gestalten aus einem abstrakten Modell abzuleiten.
Charakterstücke bedürfen (vor allem rhythmisch) geprägter
55
musikalischer Gestalten, nicht nur bestimmter Tonkonstel­
lationen, die sich verarbeiten lassen. Berg hat also den
Symphonieplan aufgegeben und dafür eine Art Suite, eben
die Orchesterstücke op.6 , komponiert. Die einzelnen Stücke
rücken Mahlersche Charaktere in den Vordergrund: im zwei­
ten sind es Walzer- resp. Ländlercharaktere, im dritten
Märsche. Manche der charakteristischen Motive - keines­
wegs sämtliche: es gibt auch noch andere Quellen - sind
freilich gleichwohl nach den uns jetzt schon geläufigen
Prinzipien entwickelt, z.B. das Violinmotiv (II,16f.)
oder die Holzbläserfigur (11,24). Geblieben ist jedoch
den Abschnitten, die nicht von thematischem Geschehen be­
herrscht werden, die Fundierung auf einer vorgegebenen
Tonfolge. Im zweiten der Orchesterstücke basieren die er­
sten 14 Takte auf einer (sich übrigens beschleunigenden)
aufsteigenden chromatischen Skala im Baß vom Umfang einer
kleinen Non, von cis bis d - über die formale Gestaltung
im einzelnen ist jetzt hier nichts auszuführen -, die
Takte 14/15 sind ein als Nebenstimme bezeichneter rascher
chromatischer Abstieg von ges" bis c", die Takte 16 bis
2o im Baß ein Aufstieg von fis bis b, in der Oberstimme
ein rascher Abstieg durch 2 Oktaven von b" bis b. In Takt
2o beginnt dann der Walzer, und mit seinem Einsetzen ge­
winnen bestimmte Figuren, Rhythmen und Wendungen die Ober­
hand: sie dienen als Außenhalt.
Es ist selbstverständlich, daß nicht nur chromatische
Gänge vorprogrammiert sein können, sondern jede beliebige
Konstellation, z.B. die Folge: Halbton - Ganzton - kleine
Terz, d.h. Abstände von aufeinanderfolgend 1, 2 resp. 3
Halbtönen (wie etwa im Passacagliathema des letzten der
Altenberglieder), oder Ganztonreihen, Quartenfolgen usf.
Dies alles sind abstrakte Dispositionen, die erst nach­
träglich mit musikalischem Inhalt gefüllt werden. Das­
selbe gilt für Rhythmen oder, wenn man will, Dauerwerte.
Berg hatte also bereits vor dem ersten Weltkrieg Verfah­
ren entwickelt, die die Realisation sinnvoll erscheinen­
der großer Formen ermöglichte. Er hat sein für die Kom­
position verbindliches Ausgangsmaterial niemals bis auf
den Einzelton reduziert, sondern ist stets von Tonkonstel­
lationen, seien dies Klänge oder Tonfolgen, ausgegangen.
Vor allem jedoch von Klängen. Hier wäre ein genauer Ver­
gleich von Bergs Klarinettenstücken und Schönbergs klei­
nen Klavierstücken, auf die sich Berg, nach Adornos Be­
obachtung, direkt bezieht, wohl auch mit den gleichzeitig
entstandenen Quartettbagatellen op.9 und den kleinen Or­
chesterstücken op.lo von Webern nützlich. Aber es genügt
ein Blick auf die Klangflächen und Akkordsäulen Bergs, um
den grundsätzlichen Unterschied sofort gewahr zu werden.
56
Theodor W.Adorno, der einige von Bergs kompositionstech­
nischen Funden erkannt hat, schrieb 1961, also vor mehr
als zwanzig Jahren:
"Der Unterschied kleiner Formen - bei Webern - und
großer - bei Berg - ist nicht bloß quantitativ. Aus­
dehnung bestimmt die Qualität jeder Einzelheit von
Musik obersten Anspruchs. Bei Webern hieß Detailar­
beit: Profilierung des Details, so sehr, daß das kur­
ze Gebilde an Kontrast und Übergang weniger Gestalten
sein Genügen hat. Bei Berg meint Durchbildung der De­
tails fast etwas wie deren Vernichtung, Aufhebung.
Worin er der Tonalität sich anschloß, die Leittönigkeit, die Allgegenwart des kleinsten Schritts, war ein
traditionelles Mittel, jenes Untraditionelle, die Ver­
nichtung des musikalisch Einzelnen durchs Ganze, zu
bewirken. Bergs Musik ist, wie die der Schönbergschule
insgesamt, panthematisch, will sagen, es gibt keine
Note, die nicht abgeleitet wäre, die nicht aus dem Mo­
tivzusammenhang des Ganzen folgerte; jedenfalls nicht,
seitdem Berg das Schwergewicht der tonalen Harmonik
abschüttelte, die dem panthematischen Verfahren ent­
gegen ist" (Quasi una fantasia,1963,S .249f.).
Es sei versucht zu verstehen, was Adorno hier meint. Die
"Allgegenwart des kleinsten Schritts", der kleinen Sekund
ist schon festgestellt worden, wenngleich der Begriff
"Allgegenwart" vielleicht doch etwas übertrieben erscheint.
Daß diese Schritte jedoch dazu da seien, das musikalisch
Einzelne zu vernichten oder diese Vernichtung zu bewirken,
erscheint fragwürdig, mindestens des Beweises bedürftig.
Ich halte diese Ansicht für unbeweisbar und wohl auch un­
zutreffend. Auch die Behauptung, die Musik Bergs sei pan­
thematisch im gleichen Sinne wie die Schönbergs, die an
Verfahren von Brahms anknüpft, erscheint eher problema­
tisch. Adorno erkennt als Vorbilder für Berg Symphonie­
sätze Mahlers, das Finale der Sechsten und den ersten
Satz der Dritten, die nun wahrlich alles andere als pan­
thematisch sind.
Wenn etwa der Anfang des ersten der Orchesterstücke op . 6
beschrieben werden sollte, so müßte die allmähliche Kon­
stitution eines Klanguntergrundes (oder -hintergrunds)
aus einzelnen, sich verdichtenden Geräuschen beschrieben
werden, dann das allmähliche Entstehen von Melodieschrit­
ten (Fagott T. 6 f.) und Rhythmen in extremer Farbe (Alt­
posaune in hoher Lage, T.9ff.), die jedoch alle noch
nicht als Thema, kaum als Motiv angesprochen werden kön­
nen. Alle diese Ereignisse bereiten vielmehr auf zunächst
nur zu erahnende musikalische Ereignisse vor, die dann
T.15ff. tatsächlich auch eintreten. Es wäre schon möglich,
57
den Vorgang als Herauswachsen des Thematischen zu be­
schreiben? aber das, woraus es herauswächst, ist selbst
noch nicht thematisch, also vorthematisch; eben noch
nicht, wie man früher sagte, "gestalthaft", wenn auch
vielleicht die Quelle von Gestalten. Es ist der Hinter­
grund, aus dem das Thematische hervortritt, oder der Un­
tergrund, aus dem es aufsteigt, also das gerade Gegenteil
eines die Einzelheiten Vernichtenden. Das heißt jedoch
nicht, daß nicht vielfach der Eindruck erweckt werden
sollte, als wäre dieser Untergrund (Klanghintergrund) das
Vernichtende, insofern das erkennbare motivisch-thema­
tische Geschehen in ihm untergeht. Tatsächlich ist er
jedoch nichts anderes als die Folie, vor der sich alles
abspielt und die verschiedenartigste Beziehungen zwischen
Hintergrund und (motivisch-thematischem) Vordergrund zu­
läßt. Die von Adorno verabsolutierte Funktion des Vernich­
tenden ist nur eine einzelne unter mehreren gleichberech­
tigten Funktionen, und sicher nicht die wichtigste.
Damit fällt auch die These von der Bergschen Panthematik.
Die Marschmotive im dritten der Orchesterstücke dienen
ja auch weniger der Ermöglichung thematischer Arbeit als
der Artikulation des durch die rhythmischen Impulse vor­
angetriebenen Klangstroms. Sie gewähren, wie die Muster
Barcarole, Walzer usf. im "Pierrot lunaire", musikalischen
Außenhalt. Die Stücke selbst sind eben, wie Berg sagte,
Charakterstücke.
Das Thematische hat für Berg überhaupt eine Funktion, die
den Begriff der Panthematik kaum als sinnvoll auf seine
Werke anwendbar erscheinen läßt. Oder er gewinnt, wenn er
angewandt werden soll, eine ganz neue Bedeutung. Daß in
einer Komposition jede Note thematisch ist, kann nur dann
festgestellt oder sinnvoll behauptet werden, wenn sämt­
liche Gestalten sich auf ein einziges Thema oder einige
wenige Themen zurückführen lassen: Jedenfalls kann nicht
eine beliebige, vielleicht sogar unendliche Zahl von The­
men als Ausgangspunkt angenommen werden. Panthematik
heißt ja nicht nur, daß alle vorkommenden Gestalten oder
Figuren irgendwie thematisch bestimmt sind, sondern daß
dadurch musikalischer Zusammenhang gestiftet wird. Werden
zahlreiche Themen angenommen, so entfällt die zusammen­
hangbildende Funktion. Das ist schon früh bei Berg auf­
fällig. Das dicht gewobene letzte der Altenberglieder,
das eine Passacaglia ist, kennt (mindestens) vier thema­
tische Substrate: das Passacagliathema, die Zwölftonfolge,
die Quartenfolge und ein aus kleinen Sekunden und großen
Terzen zusammengesetztes Thema. Aus all diesen Tonfolgen
werden allerdings kaum Themen im traditionellen Sinn ge­
bildet, geschlossene Sätze oder Perioden, kaum Derivate
58
davon. Das sind eigentlich alles nur strukturbildende
Faktoren. Das Thematische selbst, die Arbeit mit gepräg­
ten Gestalten, tritt hier, wie auch sonst bei Berg, ganz
zurück. In dem besagten Altenberglied läßt sich wohl al­
les auf eine dieser vier Tonkonstellationen zurückführen,
aber zusammenhangbildend ist doch nur die eine, das Passa­
cagliathema, das wiederum nicht nur als solches, sondern
auch noch in anderer Funktion wirksam wird. Es gibt also
zusammenhangstiftende und zusätzliche thematische Bezie­
hungen. Der Begriff des Thematischen bedarf hier eben zu­
sätzlicher, differenzierender Bestimmungen. Sollten auch
die anderen in dem Stück nachweisbaren Beziehungen Zusam­
menhang stiften - was übrigens gar nicht bestritten zu
werden braucht -, so bilden sie eben Zusammenhang auf
ganz andere, wesentlich andere Weise, nicht formal, son­
dern eher assoziativ, wie Leitmotive.
Dem entspricht durchaus die Verwendung der den späteren
Werken zugrundeliegenden Zwölftonreihen. Aus ihnen wird
entweder, wie im Violinkonzert, zuerst der Klanghinter­
grund abgeleitet und später erst die Themen - aber die
Steuerung des Gesamtklangs ist die viel wichtigere Funk­
tion der Reihe als die Prägung von Themensätzen -, oder
es werden aus einer Reihe, wie in der "Lulu", neue Reihen
abgeleitet, die allenfalls ideell, jedenfalls nicht mu­
sikalisch, zur Ausgangsreihe gehören. Das Thematische in
einem strengen Sinne spielt eben bei Berg gar keine so
zentrale Rolle.
In der gegenwärtigen Vortragsreihe wird sicher ein Wort
zur Wirkungsgeschichte von Alban Bergs Oeuvre erwartet.
Über gewisse Aspekte dieser Rezeptionsgeschichte gibt es
bereits mehrere Schriften, vor allem natürlich zu "Wozzeck"
auch über "Lulu" (namentlich wenn man die Vorgeschichte
der Komplettierung der Instrumentation des dritten Auf­
zugs mit einbezieht). Wenn von einer künstlerischen BergNachfolge gesprochen wird, so erinnert sich jeder Opern­
freund sofort der "Soldaten" von Bernd Alois Zimmermann,
fraglos einem Hauptwerk des neueren Musiktheaters. Form­
prinzipien, Texteinrichtung, Sprachbehandlung knüpfen an
die Verfahrensweisen Bergs an und entwickeln sie weiter.
Insbesondere das Zitatwesen hat bei Zimmermann eine erheb­
lich gesteigerte Bedeutung gewonnen. Selbstverständlich
gibt es auch unterscheidende Momente, z.B. die Aktuali­
sierung des Geschehens. Da die "Soldaten" ein bedeutendes
und großes Werk sind und so gar nichts Wohlfeiles an sich
haben, möchte ich hier nicht durch einige Worte eine ge­
bührende Würdigung zu ersetzen suchen. Eines ist ganz
sicher: ohne Bergs Vorgang hätte dieses gewaltige Opern­
werk nicht entstehen können, wäre seine Konzeption nicht
möglich gewesen.
59
Nicht nur die Opern, auch die anderen Werke Bergs haben
deutliche Spuren im zeitgenössischen Schaffen hinterlas­
sen. Adorno bemerkt einmal beiläufig, daß sich Spuren
der "Lyrischen Suite" schon in Bartoks Viertem Quartett
fänden (Berg,1968,S .36) und Berg darauf stolz gewesen sei.
Tatsächlich hat die "Lyrische Suite", vor allem durch
ihre spieltechnischen Neuerungen, erheblich gewirkt. Das
erste Quartett op.7 des Berg-Schülers Hans Erich Apostel,
das vom LaSalle Quartett so meisterhaft vorgetragen wird,
entstammt ganz dieser Sphäre. Es ist Berg zum 5o. Geburts­
tag gewidmet und, aus Trauer über den vorzeitigen Tod des
Meisters, unbeendet geblieben. Apostel hat einen Satz we­
niger, als ursprünglich konzipiert worden war, niederge­
schrieben. Das zweite Quartett Apostels op.26 (1956) hat
sich von dem großen Vorbild etwas entfernt: Es ist im
Thematischen konziser, weniger verschlungen, insgesamt
etwas spröder und nüchterner. Vor allem im Stimmungs­
mäßigen ist es weniger Bergisch. Aber auch dieses Quar­
tett verdiente, wie so vieles von Apostel, eine allge­
meinere Beachtung.
Die Frage der Wertschätzung solcher Werke wäre einmal
grundsätzlich zu diskutieren. Sie werden geschätzt von
all den Musikfreunden, die es begrüßen, daß es nicht nur
ein Werk oder zwei Werke dieser Art gibt, sondern mehrere:
Musikfreunden oder Beobachtern, die in den Nachfolgewer­
ken einen Beweis für die Qualität der Vorbilder und für
die Tragfähigkeit der Kompositionsprinzipien, denen sie
sich verdanken, sehen. Die Kommentatoren dagegen, die,
meist aus geschichtsphilosophischen Erwägungen, auf der
Einmaligkeit der Werke bestehen, sehen in den Nachfolge­
werken entweder einen Abklacsch, der überflüssig ist,
oder eine Widerlegung bzw. eine Zurücknahme. Die Musiker
des LaSalle-Quartetts jedenfalls, die beide Quartette
seit Jahrzehnten gern spielen, also wissen, wovon sie
sprechen, lieben diese Werke.
Der ungarische Komponist Matyäs Seiber, der seit 1928 in
Frankfurt am Main an Dr. Hochs Konservatorium eine JazzKlasse leitete, hat, vielleicht vermittelt durch Theodor
Wiesengrund-Adorno, nähere Bekanntschaft mit Zwölfton­
musik gemacht. (Daß Adorno und Seiber miteinander bekannt
waren und gemeinsam musikalische Probleme besprachen, geht
aus einer Notiz in der Zeitschrift für Sozialforschung,
5,1936,S.235, hervor.) Das noch in Frankfurt begonnene
Zweite Streichquartett Seibers, das erst 1941 uraufge­
führt und erst 1954 gedruckt wurde, ist bereits ein Zwölf­
tonwerk. Die Reihe freilich erinnert eher an Webern. John
S. Weissmann beschreibt sie in seinem Aufsatz über "Die
Quartette von Matyäs Seiber": "Die Reihe kann in drei
6o
Gruppen von je vier Tönen geteilt werden, die eine ge­
wisse Symmetrie in der Bauart zeigen: die dritte Gruppe
ist die Umkehrung der ersten, und die beiden letzten Töne
der Mittelgruppe entsprechen den ersten zwei (Tritonus!).
Die erste Gruppe und deren Abkömmlinge werden im Laufe
des Werkes viel häufiger verwendet als die beiden ande­
ren" (Melos 22, 1955, S.346) . Ganz und gar Bergisch ist
das in den Jahren 1949 bis 1951 entstandene Dritte Quar­
tett, das der Komponist nicht zufällig "Quartetto lirico"
nennt. Schon eine Satzüberschrift wie Andante amabile er­
innert an das Vorbild, das Weissmann seltsamerweise nicht
sogleich erkennt. Das Werk ist dreisätzig, der letzte
Satz ein Lento espressivo. Nicht nur Berg, auch Bartoks
Zweites Quartett mag hier nachwirken. Seiber, auf der
Höhe seines Lebens, schreibt mit diesem Quartett ein
durchaus selbständiges Werk, in welchem sowohl Berg als
auch Bartok nachklingen. Der Anfang des ersten Satzes je­
denfalls erinnert sehr eindringlich an den Anfang von
Bergs Quartett op.3. Die Reihe hat Seiber frei behandelt.
Einige Bemerkungen zur Reihe und zur Analyse finden sich
in dem genannten Aufsatz von Weissmann (Melos 23,1956,
S.38-41) .
Nicht nur die Quartette haben in bemerkenswerter Weise
nachgewirkt, sondern auch - und vor allem - das Violin­
konzert. So mancher Komponist hat sich unter dem Eindruck
gerade dieses Werkes, das schon bei seiner Uraufführung
auf dem Musikfest in Barcelona tiefe Eindrücke hinterlas­
sen hat, überhaupt erst mit der Kompositionsmethode mit
zwölf Tönen befaßt und so begonnen, sich von einer mehr
klassizistisch orientierten Schreibweise abzuwenden. Ein
Zeugnis dafür ist Bernd Alois Zimmermanns Violinkonzert
von 195o, das aus einer Violinsonate hervorgegangen ist.
"Der langsame Satz" steht, nach des Komponisten eigenen
Worten, "ganz im Zeichen von sowohl höchster Expressivi­
tät als auch lyrischer Meditation" ("Intervall und Zeit",
S.8 6 ). Von keinem früheren Werk Zimmermanns hätte dies
gesagt werden können.
Fand bei Zimmermann der Übergang zur Dodekaphonie rela­
tiv spät statt, so bei dem jüngeren Hans Werner Henze
früh. Er hat zunächst ebenfalls ganz im Zeichen des da­
mals herrschenden Klassizismus komponiert - mit bemer­
kenswert leichter Hand und mit allerdings beachtlichen
lyrischen Qualitäten. Henze war damals ganz auf die Äs­
thetik des Spielerischen, ja auf einen (zur Not der Zeit
bewußt im Widerspruch stehenden) Ästhetizismus einge­
schworen. Der unerhörte Eindruck einer Aufführung des
Bergschen Violinkonzerts ließ ihn dann aber sofort den
Entschluß fassen, ebenfalls ein Werk derselben Art zu
61
komponieren: sein Erstes Violinkonzert 1947.(Es wurde
allerdings erst 1956 gedruckt.) Henze wußte damals über
die Verfahrensweise der Dodekaphonie so gut wie nichts,
und aus dem Auszug des Berg-Konzerts, der einzig verfüg­
bar war, war auch nicht viel zu entnehmen. Henze hat an
den Anfang seines Konzerts eine Zwölftonfolge gestellt nicht als Thema, sondern als Solo-Einleitung - und dann
aus dieser Folge einen harmonischen Satz abgeleitet, der
dem Bergschen durchaus entspricht. Henze hat also aus
der Reihe nicht das Thema, sondern die Harmoniefolgen
entwickelt. Natürlich gibt es bei Henze Freiheiten, die
sich bei Berg in dieser Weise nicht finden, aber der Ton
und die Satzidee sind stellenweise ganz von dem großen
Vorbild, das ihn dann auch veranlaßt hat, im folgenden
Jahr die Unterweisung von Rene Leibowitz zu suchen, in­
spiriert. Henzes Erstes Violinkonzert ist, obgleich sich
in ihm noch zahllose Klassizismen (Ostinati, laufende Be­
wegungen etc.) finden, ein Werk, dem nicht nur für die
persönliche Entwicklung seines Autors Bedeutung zukommt,
sondern für die Geschichte der Musik in Deutschland nach
1945 insgesamt: Es ist das erste Werk, in dem der Versuch
unternommen wird, den Gegensatz Neoklassizismus - Dode­
kaphonie zu überwinden. Die Musik sollte, bei aller spie­
lerischen Brillanz, nicht mehr betont unpersönlich, aus­
druckslos sein, sondern das Ausdrucks- und Bekenntnis­
hafte, wenn auch mit Maßen, mit einbeziehen. Henze ist,
wie man weiß, kein strenger Zwölftonkomponist geworden,
wenngleich er die Zwölftonkomposition regelrecht studiert
hat, außer bei Leibowitz auch bei Rufer, und so manchen
strengen Tonsatz (etwa im zweiten Quartett) geschrieben
hat. Henze hat also die Verfahrensweisen der Dodekaphonie
bald seiner Schreibart integriert und somit eine Entwick­
lung eingeleitet, die später in anologer Weise, wenn auch
mit ganz anderem Resultat, von seinem Lehrer Wolfgang
Fortner und noch später von Igor Strawinsky vollzogen wur­
de. Henze hatte bei diesem entscheidenden Schritt keiner­
lei Vorbild. Das Bergsche Konzert gab lediglich die Anre­
gung .
Bergs Musik galt damals in Deutschland, wo die HindemithSchule das Feld beherrschte, als spätromantisch, also
leicht veraltet: wegen ihrer Ausdruckshaftigkeit, ihrer
Chromatik, ihrer Weichheit. Aber sie vermochte es, dem
herrschenden klassizistisch geprägten Zeitgeschmack eben­
so entgegenzuwirken wie später, im Zeitalter des Serialis­
mus, als die Avantgardisten sie derselben Eigenschaften
wegen belächelten oder schmähten. Stets vermochte Bergs
Musik mächtige Impulse zu geben, Impulse, die niemals
verloren gehen sollten.
62
Giselher Schubert
ZUR REZEPTION DER MUSIK ANTON VON WEBERNS
Die Geschichte der Webern-Rezeption in Mitteleuropa ließe
sich als eine Verfallsgeschichte der musikalischen Avant­
garde skizzieren: sei es resignativ-bedauernd, polemisch­
aggressiv oder höhnisch-schadenfroh. Webern ist Anfang
der fünfziger Jahre durch die Ausbildung der seriellen
Musik, die sich radikal avantgardistisch verstand, als
der wichtigste historische Anknüpfungspunkt rezipiert
worden nach einer Periode von geradezu "widerwärtiger
Mittelmäßigkeit", wie Boulezl 1949 meint. Die folgende
Auseinandersetzung mit Webern bestand - pointiert ausge­
drückt - fast nur noch in der Revision des sich weithin
durchsetzenden Bildes, das serielle Komponisten von Webern
entworfen haben. Nach dem Scheitern serieller Techniken,
die Sinopoli - wie auch alles was dann folgte - 197 5
"Theorie im Dienste des Unvermögens" 2 nennt, ist ihm die
Aktualität, die er gehabt hatte, nachgerade zum Verhäng­
nis geworden. Schon die flüchtigste Vergegenwärtigung
der Rezeption Webernscher Musik - so kann gefolgert werden
sollte die Neigung mindern, mit allzu besessener Bekenner­
wut Partei zu ergreifen und vorwurfsvolle Postulate als
Darstellung der Rezeption seiner Musik zu maskieren. Es
kann deshalb hier nur darum gehen, die Rezeption seiner
Musik möglichst außerhalb des Kreises der "Eingeweihten"
und vor allem die gegenwärtige Rezeptions-Situation als
Teil eines offenen, manchmal kontinuierlich verlaufenden,
manchmal schroff wechselnden Prozesses zu begreifen; des­
halb wird auch eine chronologische Form der Darstellung
gewählt.
In der aus den frühen fünfziger Jahren stammenden "Helden­
legende" Weberns als eines im Schatten Schönbergs kümmer­
lich existierenden Komponisten, der unerkannt seine "Dia­
manten" schlifft, können leicht die Momente einer zumin­
dest latenten Selbstkritik jener Autoren erschlossen wer­
den, die diese Legende maßgeblich geprägt oder verbreitet
haben. Wolfgang Fortner beruft sich noch 196o auf Hans
Mersmann als die maßgebliche Instanz, die ihm den unvorein
genommenen Blick auf Webern Ende der zwanziger Jahre ver­
stellt hätte^; Heinrich Strobel gesteht Mitte der sechzi­
ger Jahre, die Werke Weberns nur als "Zeugnisse einer seit
samen Abseitigkeit" in den zwanziger Jahren wahrgenommen
zu habend. strawinsky hatte 1912 in Berlin auf einem Emp­
fang den anwesenden Webern einfach nicht bemerkt^; und im
Verlauf der zwanziger Jahre hörte er - der dann eine taube
63
Welt der Unwissenheit und Gleichgültigkeit anklagen wird sich offensichtlich kein Werk von Webern bewußt an (Bergs
"Wozzeck" charakterisierte er damals als "une musique
boche", Mahler taufte er "Malheur"7). Vor allem aber ha­
ben unter Strawinskys unmittelbarem, bestimmendem Ein­
fluß jene französischen Komponisten ihre Kontakte zur
Schönberg-Schule gelockert, die wie Milhaud und Poulenc
die Nähe Schönbergs und seines Wiener Kreises gesucht
hatten. Beide b e r i c h t e n 8 unabhängig voneinander vom fas­
zinierenden Eindruck, den Schönbergs Klavierstücke op.19
noch vor 1914 auf sie gemacht haben, und beide glauben, in
welch vermitteltem Sinn auch immer, von diesem Werk beein­
flußt worden zu sein. Ihre erste gemeinsame Auslandsreise
führte sie 1921 nach Wien; und sie lernten neben Schön­
berg auch Berg und Webern kennen, mit denen sie - wie
Milhaud berichtet - "lange Gespräche" über deren neue Mu­
sik f ü h r t e n ^ . Webern schreibt 1922 nach der wiederholten
Salzburger Aufführung seiner "Fünf Sätze für Streichquar­
tett" op.5 an Berg: "Mein Quartett wurde am nächsten Tag
in geschlossenem Kreis wiederholt. Die anwesenden Fran­
zosen (Honegger, Poulenc, Wiener) und Engländer (Bliss)
waren sehr lieb u. sagten mir viel Herzliches"1°.
Die erste Darbietung dieses Webernschen Werkes hatte je­
doch in Salzburg eine Schlägerei im Publikum ausgelöstH
und mußte abgebrochen werden; die Interpreten, die sich
spontan bereit erklärten, das Werk am folgenden Tag noch
einmal zu spielen, waren das Amar-Quartett mit Hindemith
als Bratscher. Und so wie Milhaud und Poulenc von Schön­
bergs op.19 enthusiasmiert wurden, so war Hindemith so­
gleich von den wenigen vor 192o publizierten Werken We­
berns geradezu gefangen genommen worden. Er hatte bereits
1915 das als Beilage zur Zeitschrift "Der Ruf" 1912 er­
schienene Stück für Violine und Klavier op.7 Nr.l von
Webern abgeschrieben und dann zunächst auch Ähnliches
zu komponieren versucht: "Wenn ich in diesem Genre weiter­
arbeite, komme ich einmal in eine Gegend jenseits von Gut
und Böse", schreibt er in einem Brief 1917 über seine
neuen Klavierstückel 2( "mir machen die Sachen aber eine
Riesenfreude. Eines der Stücke ist 9 Takte lang. Ich setze
meinen ganzen Ehrgeiz darein, demnächst eines zu schreiben,
das nur aus 3 Takten besteht, Thema, Durchführung, Coda"!3 .
Das Amar-Quartett hat sich die ganzen zwanziger Jahre
hindurch intensiv um die Werke Weberns gekümmert, die es
überall in Europa und stets auch zu zentralen Anlässen
aufführte. 1924 spielte das Quartett in Donaueschingen
die Uraufführung von Weberns Bagatellen op.9; im selben
Jahr führte der Cellist des Quartetts, Maurits Frank,
erstmals Weberns Cellostücke op.11 auf. 1928 betreuten die
64
Anton von Webern, op. 7 Nr. 1 in einer Abschrift Hindemiths aus
dem Jahre 1915
(Im Besitz der Hindemith Stiftung/Archiv des Paul-HindemithInstituts, Frankfurt a.M.)
65
Mitglieder des Quartetts die skandalträchtige deutsche
Erstaufführung von Weberns Trio op.2o auf dem Schweriner
Fest des "Allgemeinen Deutschen Musikvereins"14. Während
der überaus schwierigen Einstudierung^ dieses Trios, de­
rentwegen er die Komposition seiner Oper "Neues vom Tage"
unterbrechen mußte, schrieb Hindemith auch das Vorwort
zu seiner Kantate "Frau Musica" nieder^®. Ein größerer
Gegensatz als zwischen dem Trio op.2o von Webern und je­
ner Kantate und vor allem auch zwischen der musikalischen
Gesinnung, die hinter diesen Arbeiten steht, ist schlech­
terdings nicht vorstellbar. Diese schockierende Gleich­
zeitigkeit des Inkommensurablen bedarf dringend der Deu­
tung, freilich weniger von der Position Weberns her, der
dergleichen Kantaten auch nicht im geringsten tolerierte!"?,
sondern vielmehr von der Position der "mittleren" Kom­
ponisten wie Milhaud, Honegger, Poulenc oder Hindemith
her, die mit der Musik Weberns relativ gut vertraut waren,
sie durch Aufführungen förderten - sich also mit ihr aus­
einandersetzten -, kompositorisch aber dann doch unbeein­
flußt von ihr blieben. Denn die Erkenntnis, daß ihre Wer­
ke hinter dem vergleichslosen Maß an musikalischer Konzentriertheit und Differenzierung zurückstehen, das Webern
fast 2o Jahre zuvor schon erreicht hatte, darf jenen mitt­
leren Komponisten zugetraut werden. Dieser Sachverhalt ist
nicht nur zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich gedeu­
tet worden. Josef David Bach argumentierte Anfang der
dreißiger Jahre geschichtsphilosophisch: Weberns Musik
repräsentiere den fortgeschrittensten Stand, hinter den
alle andere Musik, die diesen nicht erreiche, tendenziell
als anachronistisch und irrelevant zurückfallein. Diese
Argumentation, die völlig dem Webernschen Selbstverständnis!9 in jener Zeit entspricht, hat sich erst seit den
fünfziger Jahren durchgesetzt. Die in den zwanziger Jahren
vorherrschende Deutung stammt von Mersmann. Auch er er­
kennt den Fortschritt in Webernscher Musik, den er jedoch
als einen Schritt zum Ende von Musik hin deutet20. Für
Mersmann, der Weberns Musik nicht für analysierbar hielt2!,
ist Fortschritt über die Webernsche Position hinaus nicht
möglich; er kann nur hinter ihr liegen: in derjenigen der
mittleren Komponisten. Eine Skizze ihrer musikalischen
Poetik22, die sie in den zwanziger Jahren noch nicht zu le­
gitimieren brauchten, hätten ihr offensichtlich zwiespäl­
tiges Verhältnis zum absoluten musikalischen Fortschritt
Weberns ebenso zu berücksichtigen wie ihre ambivalente
Einstellung zu einer "Gebrauchsmusik", denn einen anderen
als einen rein musikalischen Gebrauch haben sie nie erwo­
gen. Fehlt ihrer zu extrapolierenden Poetik die verpflich­
tende Idee einer emphatischen immanent-musikalischen Fort­
schrittlichkeit ebenso wie die einer radikal funktioneilen
66
Musik, so haben sie gegen die funktionelle Musik mit pri­
mär ästhetischen Kategorien argumentiert - sei es, daß
sie funktionelle Musik als Vehikel eines trüben "Gemein­
schaftsgefühls" mißbraucht sahen23; Sei es, daß ihnen
politisch angewandte Musik als Kunst schlechterdings irrelevant24 erschien - und gegen eine radikal fortschritt­
liche autonome Musik mit eher funktionellen Kategorien:
solche Musik lasse sich tendenziell nicht gebrauchen^,
Demgegenüber scheint ihre Poetik sich ganz an der Kate­
gorie der Aktualität zu orientieren, an ihrem Bestreben,
möglichst unmittelbar eingängige musikalische Äguivalente
für ihre Gegenwart zu schaffen. Mit solch einer nun tat­
sächlich mittleren Poetik wurde dem Webernschen Werk die
virulente Spitze gebrochen: Die radikale Fortschrittlich­
keit seiner Musik konnte einerseits durch den Hinweis auf
ihre manifeste mangelnde Brauchbarkeit unterlaufen werden,
und andererseits fand man in dieser Musik weniger die
zwanziger Jahre ausgedrückt als vielmehr die Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg^, ja sogar etwas spezifisch Österrei­
chisches. Eine dergestalt rezipierte Musik konnte man be­
wundern und sich für sie einsetzen, ohne sie jedoch als
kompositorisch verpflichtend zu empfinden.
Die konstant wachsende Anerkennung Webernscher Musik im Ver­
lauf der zwanziger Jahre läßt sich auch von den zeitgenös­
sischen Rezensionen ablesen. Dabei ist zu berücksichtigen,
daß Weberns Werke gleichzeitig mit denen der jüngeren Kom­
ponistengeneration ins Bewußtsein drangen, obwohl sie
teilweise bis zu 2o Jahren früher entstanden waren; und
das Verstörende, das von seinen Werken ausgeht, wird oft
durch den Hinweis auf die ganz andersartigen Arbeiten der
jüngeren Komponisten neutralisiert. Durch diese Gleich­
zeitigkeit der Rezeption erschien der von Schönberg initi­
ierte Weg im Werk Weberns an seinem über Webern hinaus
nicht mehr fortgesetzten und wohl auch nicht mehr fortsetzbaren Ende angelangt.
Den ersten "unbestrittenen, nachhaltigen" Erfolg27 er­
zielte Webern 1922 mit seiner Passacaglia op.l auf dem
Tonkünstlerfest in Düsseldorf. Die bereits genannte Auf­
führung der "5 Sätze für Streichquartett" op.5 im selben
Jahr in Salzburg kommentierte Paul Bekker: "Unter den
Wienern ist er die eigentümlichste, charaktervollste Be­
gabung, Schüler Schönbergs und ihm unmittelbar anhängend.
Aber es scheint, als ob im Schüler die persönliche Wider­
standskraft fehlte, die rezeptive Nachwirkungen ins Ei­
gene umzuwandeln vermag. Es ist, wie wenn ein scharf ät­
zender Tropfen in eine zarte weiche Substanz gefallen
wäre"28. über die Uraufführung der Bagatellen op.9 von
1924 kann man immerhin lesen: "Die 'Kleinen Stücke für
67
Streichquartett' offenbaren eine Konzentriertheit des
musikalischen Denkens, eine Knappheit im Ausdruck, die
selbst den unvorbereiteten Zuhörer von der Geistigkeit
dieses inneren Musikers überzeugen"29. Den offenbar größ­
ten Erfolg überhaupt erzielte Webern 1926 auf dem Fest
der IGNM in Zürich mit seinen Orchesterstücken op.lo, der
als ein "Sensationserfolg"3o verbucht wurde: "Die Poesie
dieser vorwiegend traumhaften Stücke ist sondergleichen",
hieß es^l, "der kaum enden wollende Beifall der musika­
lischen Feinschmecker drängte nach einer Wiederholung."
Beschrieben wurde das Werk mit Worten, die Weberns Inten­
tionen entsprechen dürften: "Alpenglühen, Herdenglocken,
tiefe Stille! Eine wundervoll bang zitternde Tonsprache
des Pianissimo, ein Glanz von Gottes freier Hochgebirgswelt
her leuchtet hier auf"32. Ein Resümee lautet: "...Mahlersche
Einsamkeit auf hohen Bergen nachgeträumt"33 # £>er weithin ver­
nommene Erfolg dieses Werkes wiegt umso schwerer, al-s auf
demselben Fest Werke wie Schönbergs Bläserguintett, Weills
Violinkonzert oder Hindemiths Konzert für Orchester auf­
geführt worden waren.
Erst Ende der zwanziger Jahre läßt sich eine zunehmende
Kritik an Weberns jeweils jüngsten Werken in dem Moment
konstatieren, in dem er sich als Dirigent allmählich
durchzusetzen beginnt. Rezensionen des Trios op.2o oder
der Sinfonie op.21 etwa entsprechen argumentativ ganz
jener mittleren Poetik; über das Trio heißt es: "...so
kunstreich und logisch, und ... so unnütz wie alles bloß
Kunstreiche und Kunststückhafte"34. jn (3er Sinfonie op. 21
erscheine Webern 193o "wie die ewig tragische Figur eines
Postens357 ... dessen Ablösung vergessen wurde, und der
nun als letzter Getreuer das bedenklich schwankende Ge­
bäude einer Ästhetik bewacht, die längst das Weite ge­
sucht und den Jonny gefunden hat"36. wenn solche Kritik
kompositionstechnisch je spezifiziert wird, so verweist
man auf die 12-Ton-Technik als ein System, das angeblich
einst als "Erlösung" gefeiert, seit 193o jedoch - so be­
hauptet man - "leise weinend ad acta gelegt worden"37 sei.
(Um so mehr sind der Mut und die Selbständigkeit von Kom­
ponisten wie Krenek oder Vogel zu bewundern, die erst
nach 1933 die 12-Ton-Technik anwendeten).
Von einer Rezeption Webernscher Musik zwischen 1933 und
etwa 1947 kann schlechterdings nicht die Rede sein; und
die wenigen erfolgreichen Aufführungen seiner Werke in
Prag, London, Basel oder Winterthur können nicht darüber
hinwegtäuschen, daß er in völlige Vergessenheit38 gerät.
Webern wird nicht einmal (bzw. glücklicherweise auch
nicht) negativ in die kulturpolitischen Auseinanderset­
zungen jener Jahre gezerrt39. An dieser Inexistenz seiner
68
Musik setzt die Rezeption in der Nachkriegszeit an, nicht
aber an jener Existenz, die sie in den zwanziger Jahren
gehabt hat. Weberns Musik hat für diejenigen, die sie
erst nach 1945 entdecken, keine Geschichte; und daß sie
angeblich keine Geschichte machen konnte, wird nun gegen
diese Zeit ausgespielt. Boulez brandmarkt etwa das Pariser
Musikleben durch den Hinweis, selbst Weberns Passacaglia
hätte erst 1958 hier aufgeführt werden4o können; selbst­
verständlich wurde dieses Werk jedoch schon in den zwan­
ziger Jahren relativ erfolgreich in Paris aufgeführt.
Jene mittleren Komponisten konnten die nun einsetzende
Musikentwicklung nur noch mit gereizten Protesten komment i e r e n ^ l ,
oder sie wunderten sich über die plötzliche
Aktualität einer Musik, für die sie sich in ihrer Jugend­
zeit auch einmal begeistert hatten, waren vor allem aber
von der Entwicklung Strawinskys b e t r o f f e n ^ 2 . p ü r die jun­
gen Komponisten war Weberns Musik weder ausdrucksmäßig
noch historisch fixiert.
Die Rezeption neuer Musik nach dem Zweiten Weltkrieg ist
zunächst durch das Pariser Musikleben geprägt worden,
schon weil hier bereits vor Ende des Krieges Konzerte
mit neuer Musik organisiert werden konnten. Das spekta­
kulärste und überraschendste Ergebnis dieser ersten Kon­
zerte ist die heftige Ablehnung der jüngsten Werke Stra­
winskys, ja des ganzen Neoklassizismus. Über diese Ereig­
nisse informiert authentisch der Briefwechsel zwischen
Milhaud und P o u l e n c 4 3 . im Januar 1 9 4 5 berichtet Poulenc,
daß in der Kriegszeit nur ein einziger Komponist Reputa­
tion gewonnen hätte, nämlich Messiaen, der einen beträcht­
lichen Einfluß auf die junge Komponistengeneration ausübe,
die sich für seinen Geschmack allzu doktrinär und ein­
seitig gebe44; die Musik Strawinskys ende für sie mit
dem " S a c r e " 4 5 . jm jun 1 9 4 5 schreibt P o u l e n c 4 6 von einer
gegen Strawinsky gerichteten offenen Kampagne, hinter der
die Schüler Messiaens ständen; Poulenc selbst erhebt öf­
fentlich Einspruch gegen eine offenbar schon weithin ge­
teilte Meinung, Strawinsky habe keinen Einfluß auf die
moderne französische Musik ausgeübt. (Poulenc übersieht
offensichtlich, daß als "moderne" Musik jetzt diejenige
von Messiaen oder Jolivet gilt.) Zwei Jahre später orien­
tiert sich - nach Poulenc47 _ die junge Komponistenge­
neration ausschließlich an Messiaen oder an der Dodeka­
phonie, die vor allem Rene Leibowitz, ein Schüler Schön­
bergs und Weberns, propagiert. Strawinskys Neoklassizis­
mus verliert demnach spätestens 1 9 4 7 den beherrschenden
Einfluß in Frankreich. Wohl werden die Dodekaphonisten
noch als eine einheitliche Richtung dargestellt, doch
läßt sich aus den nun erscheinenden Schriften von Leibowitz^® erschließen, daß der Primat Schönberg zufällt.
69
Er behauptet etwa, Webern hätte keine Note49 geschrieben,
die nicht auch von Schönberg stammen könnte^o. Leibowitz
hob wahrscheinlich aus zwei Gründen auf die Einheit der
Dodekaphonisten ab: Einerseits sollte die offensichtliche
Verschiedenartigkeit der Werke als etwas Selbstverständ­
liches erscheinen und den Verdacht zerstreuen, aus der
Einheit der Technik resultiere Sterilität; andererseits
aber wird nun mit zunehmender polemischer Heftigkeit so­
wohl ästhetisch als auch kompositionstechnisch zwischen
den Werken von Schönberg, Berg und Webern unterschieden.
Bereits 1948 fällt Boulez über Berg das ästhetische Ver­
dikt des "schlechten Geschmacks der maßlos übersteigerten
romantischen Herzensergießungen"51, und im folgenden Jahr
hat Boulez schon die Grundzüge seiner kompositionstech­
nischen Kritik an Schönberg voll entwickelt, die dann
1951 berühmt wird. Boulez schreibt 1949; "...diese vor­
klassischen und klassischen Formen sind der größte Wider­
sinn, der sich in der zeitgenössischen Musik finden läßt
und der uns die Tragweite von Schönbergs Oeuvre generell
aufzuheben scheint: dieses Werk wird von zwei gegensätz­
lichen Konzeptionen hin und her gerissen - das Resultat
ist bisweilen katastrophal"52. Allein die Zwölftonwerke
Weberns können - nach Boulez - als fortschrittlich gelten
und als Anknüpfungspunkt dienen; weder trügen sie - wie
die Werke Bergs - den Ausdruck des nach Boulez "radikal
fragwürdig gewordenen Erbes" des 19. Jahrhunderts^3, noch
restituierten sie - wie Schönbergs Arbeiten - die bekann­
ten Formen. Daneben läßt Boulez nur noch gewisse rhyth­
mische Verfahrensweisen in Strawinskys "Sacre" gelten .
Diese Entwicklung in Paris, die das dodekaphone Werk
Weberns favorisiert, wurde in den ersten Darmstädter
Jahren nicht nur unter Einbeziehung von Kompositionen
Hindemiths und Bartoks intensiver und extensiver nachge­
holt; sie wurde dort im wesentlichen bestätigt, gefestigt
und internationalisiert, obwohl nun Arbeiten wie Adornos
"Philosophie der neuen Musik" vorliegen oder Dozenten
wie Messiaen, Leibowitz, Krenek, Adorno oder Varese in
Darmstadt wirken. Diese Entwicklung hat in der Boulezschen Provokation von 1951 - "Schoenberg est mort"55 _
ihren ersten Markstein, führt zur Darmstädter WebernEhrung von 1 9 5 3 ^ 6 bis hin zum weithin als Ausdruck singu­
lärer Verehrung verstandenen zweiten Heft der Publikation
"die reihe" von 1955. Auf die Ausbildung der seriellen
Technik, durch die diese Wertschätzung getragen wird,
braucht nicht eingegangen zu werden; es genügt, die über­
ragende Position, die Webern nun eingeräumt wird, mit
Hilfe von Ausführungen Nonos^^ Zu vergegenwärtigen. Da­
nach repräsentiert Schönbergs Reihenbegriff nur ein er­
stes Stadium: er bezieht sich - nach Nono - nur "auf die
70
Folge der zwölf verschiedenen Töne, die in ihrer Gesamt­
heit das zu verarbeitende thematische Material bilden";
das zweite, zentrale Stadium repräsentiere Weberns Spät­
werk: "Die konstruktive Funktion der Reihe entfaltet sich
nicht mehr in bezug auf die charakteristische thematische
Gestalt der Reihe"; vielmehr - so Nono - folgte der Auf­
bau der Komposition "dem Rhythmus, dem Timbre, der Melo­
dik und der Harmonik nach" eng der Zwölftonreihe. Im
dritten, voll entfalteten Stadium der Reihenkomposition,
das in "völliger logischer Kontinuität der Entwicklung" wie Nono schreibt - aus dem Webernschen Spätwerk hervor­
gehe, regle das Reihenprinzip "jedes Element der Kompo­
sition derart, daß zwischen den Elementen genaue Vertauschbarkeit möglich ist." Diese Entwicklung ist im Verständnis
jener Komponisten keine partielle, neben der andere sinn­
voll möglich sind; vielmehr bestimmt Boulez bereits 1951,
daß jeder "Komponist unnütz ist, der sich außerhalb der
seriellen Bestrebung stellt" 5 8 . Nach Stockhausen ist
1952/53 das mit Webern einsetzende Reihendenken die ein­
zige universell ausbaufähige Methode, die die Übergangs­
stile der letzten 5o Jahre hinterlassen h a b e n 5 9 .
Die unvergleichliche Wertschätzung, die Webern Anfang der
fünfziger Jahre genießt, wird vor allem von den jungen
Komponisten getragen gegen die unverhohlene Skepsis je­
ner Älteren und "Eingeweihten", die Weberns Werk bereits
vor dem Krieg kennengelernt hatten, vor allem aber gegen
Adorno. Die "Philosophie der neuen Musik", die eine ge­
wichtige Webern-Kritik enthält, scheint unmittelbar nach
ihrem Erscheinen 1949 keinen Einfluß ausgeübt zu haben.
Offensichtlich im Hinblick auf dieses Buch konstatiert
etwa Bernd Alois Zimmermann 1951, wie "wenig Glut eine
Musikphilosophie" entfache, die mit dem, "was an Musik
der jungen Generation unter den Nägeln" brenne, höchstens
"die Bemühung gemeinsam" habe^o. Er glaubt vielmehr eine
"kritische InstinktSicherheit" bei den jungen Darmstädter
Komponisten zu entdecken, mit der sie gegen "Systeme" im­
munisiert seien, die mit ästhetischer Unfehlbarkeit vor­
getragen werden6!.
Adorno unterzieht 1949 gerade jenes dodekaphone Spätwerk
Weberns einer grundsätzlichen Kritik, an das die seri­
ellen Komponisten unmittelbar angeschlossen haben. "We­
bern realisiert die Zwölftontechnik und komponiert nicht
mehr", heißt es in der "Philosophie der neuen Musik"62,
und: "In sonderbar infantilem musikalischem Naturglauben
wird das Material mit der Kraft begabt, von sich aus den
musikalischen Sinn zu setzen... Das selbstgemachte Ge­
setz der Reihe wird wahrhaft fetischisiert in dem Augen­
blick, in dem der Komponist sich darauf verläßt, daß es
71
einen Sinn von sich aus hat"63. jn <jem Aufsatz "Über das
Altern der Neuen Musik" von 1 9 5 5 6 4 verknüpft Adorno die
Kritik am späten Webern unmittelbar mit jener an der se­
riellen Musik: Webern reduziere "die Musik auf die nackten
Vorgänge im Material, das Schicksal der Reihen als sol­
cher"; diese Perspektive verfolgten, so Adorno, neuer­
dings eine Reihe von Komponisten weiteres, und über die
gerade entstandene elektronische Musik urteilt er: "Es
hört sich an, als trüge man Webern auf einer Wurlitzerorgel vor"66. In der Auseinandersetzung mit Adornos Kritik
an der seriellen Musik wird erstmals der Einfluß Weberns
abgewertet, Adornos Kritik also indirekt anerkannt. "Vom
späten Webern geht die Linie in der Tat nur zu dem, was
man einmal den 'punktuellen Styl ' 6 7 genannt hat, was viel­
leicht sogar einmal eine historische Phase in der Ent­
wicklung dieser Komponisten gewesen ist, aber eine sehr
vorübergehende, und was doch nur einen Extremfall in der
gesamten Skala der Technik dieser Komponisten darstellt",
wendet Metzger6^ 1957 gegen Adorno ein; "es ist ganz eigen­
tümlich, daß man deshalb ... diese Komponisten mit Webern
in Verbindung bringt, von der nachwebernschen Musik spricht
und so tut, als ob sie nun nichts weiter getan hätten, als
den Webern noch ein wenig ins Extrem zu steigern. Dagegen
hilft es diesen Komponisten offenbar nichts, ... wenn sie
selber eine Musik schreiben, die mit Webern nun wirklich
nicht mehr sehr viel zu tun hat". Adorno äußert sich 1959
noch einmal zu Webern6^; obwohl er sein Urteil über das
Spätwerk nicht revidiert, läßt sich auf dem Hintergrund
der angedeuteten Distanzierung von Webern seine Arbeit
als ein Plädoyer für diesen Komponisten verstehen; denn
nun heißt es: "Webern kann trotz allem Recht gehabt haben,
das Verständnis kann hinter ihm herhinken"7o. Adorno for­
dert zur Geduld gegenüber Webern auf71 und konstatiert
das Interesse an der Tendenz, die sich von seinem Werk
ablesen lasse, ein Interesse, das jenes an den Werken
selbst verdrängt habe; doch was zähle, so Adorno, seien
die Werke, nicht die Mittel72. Adornos Plädoyer blieb in
einer Zeit ungehört, in der der Werkbegriff ausgehöhlt
und aufgelöst worden ist und sich die musikalische Ent­
wicklung primär in den Verfahrensweisen manifestiert, die
nicht einmal zu Werken führen müssen. In der Problemge­
schichte der seriellen Musik ist Weberns Werk nur als
ein aufgehobenes Vergangenes gegenwärtig; und mit ihrem
Scheitern hat es keine unmittelbare Bedeutung mehr, wäh­
rend von einer emphatischen Erkenntnis seiner Werke folgt man Adorno - noch nicht gesprochen werden kann.
Weberns Einfluß schwindet nach Stockhausen^3 schon 1956,
spätestens jedoch seit 1 9 5 8 7 4 ; sein Werk verliert die un­
mittelbare Zeitgenossenschaft, wird historisch, und die
72
Wirkung, die es Anfang der fünfziger Jahre ausübte, spielt
man ebenso herunter, wie man das Abrücken von der seri­
ellen Rigorosität - wenn auch zu verschiedenen Zeiten offen eingesteht. Bereits 1955 hatte sich Stockhausen
von seiner epochemachenden, sachlich fragwürdigen Ana­
lyse des Webernschen Konzerts op.24 insofern distanziert,
als er erklärte: "Der Vorwurf wurde geäußert, man sehe
in Weberns Musik etwas hinein, was gar nicht darin sei,
und man täte ihr Gewalt an... Aber wenn andere Musiker
Webern nun aus ihrer Sicht betrachten, so kündigt sich
darin eine Veränderung des Denkens an, die man auch ein­
mal zu verstehen suchen möge"75. "Wenn Weberns Werke ana­
lysiert werden", so Stockhausen weiter76f "...sagen die
aufgezeigten Dinge nichts darüber aus, 'wie man's heute
macht' ... und es soll nicht verwundern, wenn man in jetzt
entstandenen Kompositionen der erklärten Webernnachfolge
vergeblich nach dem sucht, was in den Webern-Analysen so
detailliert aufgezeigt wird...". Freilich ist der Sinn
von Webern-Analysen fraglich, die seinem Werk eingestande­
nermaßen "Gewalt" antun und zugleich auch nichts über die
aktuellen Kompositionen aussagen. Schon die aus der "punk­
tuellen Form" und der "Gruppenform" hervorgegangene "sta­
tistische Form" ist nach Stockhausen nicht mehr von We­
bern her verstehbar; er schreibt: "Was die Form angeht,
so hat er (Webern) sich nur ganz selten von den auf mo­
tivisch- thematische und damit melodisch-harmonische Funk­
tionen der Töne beschränkten Formvorstellungen gelöst. Er
hat immer vom Einzelnen zum Ganzen gedacht, man hört im­
mer einzelne Töne..."77. Nono wird schließlich, ohne Grün­
de anzugeben, erklären, die "Interpretation von Webern
in Darmstadt" immer als falsch empfunden zu haben78. und
die entschiedenste Distanzierung von Weberns Spätwerk
trägt Boulez vor. Danach sei die Form bei Webern immer
einfacher geworden; es fehle diesen Werken das Geheimnis­
volle, Labyrinthische. Vielmehr ließen sie sich sogleich
überschauen und langweilten bei wiederholtem Hören. "Das
Werk von Webern", führt Boulez nun aus79x "erfordert keine
mehrmalige Lektüre, wenn man sein Wesen und sein Vokabular
einmal erfaßt hat." Auch Strawinsky^o entdeckt nun einen
"unangenehmen Anflug von Charme" in Weberns Vokalmusik,
banale Harmonien und eine geringe Spielbreite der Formen
in der Zweiten Kantate; zudem habe er "diese molto ritenuto,
molto espressivo, die verlöschenden Phrasenschlüsse über".
Das immanente und durch äußere Anstöße bewirkte Scheit e r n S l serieller Techniken und die bemerkbare Distanzie­
rung von Webern stehen in einem zeitlichen Zusammenhang
mit der Auflösung und Zerstörung der von Stadien**2 so ge­
nannten "Webern-Legende", d.h. der seriellen Webern-Deutung. Einerseits wollte man mit einer immanenten Über73
prüfung und Falsifizierung der seriellen Webern-Analysen
eine Kritik an der seriellen Musik überhaupt verbinden,
andererseits kontrastierte man das nun aus publizierten
Schriften erschließbare Selbstverständnis Weberns mit dem
Webern-Verständnis der seriellen Komponisten. Diese Ausein
andersetzung mit Webern seit Beginn der sechziger Jahre,
die nicht mehr von den Komponisten, jedenfalls nicht mehr
von den entscheidenden Komponisten geführt wird, voll­
zieht sich also auf der Folie serieller Webern-Deutungen.
Da die Gewaltsamkeiten und Einseitigkeiten der seriellen
Webern-Analyse von den Komponisten mittlerweile selbst
eingestanden wurden, können gegenwärtig fast nur noch die
erkenntnisleitenden Interessen Aufmerksamkeit beanspru­
chen, die hinter den unterschiedlichen Deutungen jener
Einseitigkeiten und Haltlosigkeiten stehen. 1954, auf
dem Höhepunkt serieller Komposition, konnte noch mit der
Kritik einer Stockhausenschen Webern-Analyse83 zumindest
tendenziell argumentativ in die aktuelle Musikentwicklung
eingegriffen werden. 1973 wird im Gefolge der Studenten­
bewegung konstatiert84t die fehlerhaften Webern-Analysen
könnten "im Rahmen" einer "gemeinsamen Ideologie", die
zwischen Webern und den seriellen Komponisten herrsche,
aufgehoben werden und seien daher irrelevant^. 1974
schließlich kann eine als Sachlichkeit nur schlecht ver­
kleidete bornierte Besserwisserei die längst schon histo­
rische Musikentwicklung der fünfziger Jahre so kritisieren
als gelte es, sie rückgängig zu machen und gleichsam auszuradieren^ö.
Dagegen ist seit den Publikationen der Webernschen Vor­
träge über Neue Musik, seines Briefwechsels mit Hildegard
Jone und Josef Humplik oder einiger seiner Analysen ei­
gener Werke geradezu schmerzhaft bewußt geworden, daß
Weberns ästhetisches, historisches und schließlich auch
politisches Verständnis fast nichts mit dem zu tun hat,
was man in seinem Werk erkennen zu können glaubte. Die
ursprünglich auf Walter B e n j a m i n ^ zurückgehende Vorstel­
lung oder Hoffnung, daß fortschrittliche Materialbehand­
lung und richtige (linke) Tendenz in der Gesinnung zusam­
menfallen, hätte nicht gründlicher enttäuscht werden kön­
nen. Webern habe komponiert - so H e n z e 8 8 _ / ais ob nichts
passiert sei, als ob keine Klassenkämpfe stattgefunden
hätten, als ob es keinen Imperialismus gäbe, keine Kriege,
als ob die Gesellschaft in Ordnung wäre; als ob alles so
sei wie die Grashalme auf der Alm. Die auffälligste Diver­
genz entstand zwischen dem traditionellen, fast konserva­
tiven Selbstverständnis W e b e r n s 8 9 und der Interpreta­
tion seines Spätwerks als etwas gegenüber Schönberg völ­
lig Neuem und F o r t s c h r i t t l i c h e m ^ 0 . Zwei Interpretations­
74
tendenzen dieser Divergenz (die nur deshalb eine solche
bedeutende Rolle spielen konnte, weil die Literatur über
Musik, das Moment der Musiktheorie, eine unvergleichliche
Wertschätzung genoß) lassen sich unterscheiden: Einerseits
trennt man zwischen dem im Werk objektivierten Sachver­
halt und dem Komponisten als empirischem Subjekt und atte­
stiert Webern kein volles Verständnis seiner eigenen Mu­
sik, nennt seine Ausführungen mißverständlich^ oder me­
taphorisch^ oder erkennt apologetische Motive in seinen
Ausführungen, die über die befremdende Erscheinungsform
seiner Werke hinweghelfen sollten^3 . Andererseits konsta­
tiert man den grundsätzlichen Abstand zur mittlerweile
gescheiterten seriellen Technik und bedauert, daß der
Augenblick der rechtzeitigen Publikation dieser Schriften,
durch deren Kenntnis die Entwicklung vielleicht anders
verlaufen wäre, versäumt wurdet4.
Weberns konservatives Selbstverständnis konnte erst eine
andere Bedeutung annehmen, als sich die zunächst noch la­
tent restaurative Tendenz jenes Typs postserieller Kompo­
sition vollständig offenbarte, der wohl den intensivsten
Einfluß in den sechziger Jahren ausübte: der Klangkompo­
sition vor allem von Ligeti. Ebenso wie der Fortschritt
der seriellen Technik läßt sich paradoxerweise auch die
restaurative Entwicklung^5 der Klangkomposition im Sinne
einer kontinuierlich verlaufenden Problemgeschichte des
Komponierens darstellen. Seinen Ausgangspunkt, von dem er
allerdings zunächst ausdrücklich abrückte96# entwickelt
Ligeti doch wohl in seinen 1949/5o publizierten Aufsätzen9 '.
Er schreibt 195o über den späten Bartok: "Denken wir...an
den Anfang vom Adagio des III. Klavierkonzertes, wo der
C-dur-Akkord plötzlich erklingt wie eine neue, noch nie
beobachtete Naturerscheinung. Reine Harmonien und tonale
Verbindungen treten auch in diesem Stil auf, aber die Lo­
gik dieser Bindungen ist ganz anders als die festumrissene
Ordnung der alten Funktionen; sie weicht ebenso weit von
dieser ab wie die Zwölftonmusik, nur in anderer Richtung...
Es ist heutzutage" - 195o - "Mode, daß die Anhänger der
einen Richtung sich als die einzigen Heilsbringer ausrufen. Wieviel bereichernder ist es aber einzusehen, daß
beides nebeneinander besteht, daß beides seine Vorzüge
hat, und daß das Entscheidende nur darin besteht, wer bes­
sere Werke schreibt"98. und weiter schreibt Ligeti 195o:
"Heute ist es nicht mehr interessant, eine komplizierte
Dissonanz zu konstruieren, es ist eine größere Heldentat,
einen einfachen Dreiklang so zu schreiben, ihn in eine
solche tonale Umgebung hineinzusetzen, daß er neu und ori­
ginell wirkt"99. Ende der fünfziger Jahre führt das seri­
elle "Umkippen der Harmonik in intervallisch neutrale, aharmonische Geräuschstrukturen" und das der rhythmischen
75
Artikulation in nicht gegliederte, kontinuierliche Vorgängel°° Ligeti zur neutralen Rhythmik und Harmonik der
Werke "Apparitions" und "Atmospheres". Als Reaktion auf
diese Reaktion hebt Ligeti seit 1964 durch "intervallische
K r i s t a ll is at io ns ke rn e "d ie neutrale Harmonik, seit 1968
die neutrale Rhythmik aufl°2. In "Lontano" erweckt er be­
wußt mit einer "pseudotonalen Harmonik" gewisse Assozia­
tionen an die von ihm so genannte "späte Romantik"1°3•
und die Komposition "Melodien" und "San Francisco Polyphony" restituieren schon in ihren Werktiteln traditionelle
satztechnische Sachverhalte. Daß diese Entwicklung zur
Komposition einer "Sinfonie" führen könnte, braucht kaum
erwähnt zu werden. Bedenkt man Ligetis Ausgangspunkt von
195o und die keinesfalls vorhersehbare Bedeutung, die je­
ne "Assoziationen an die späte Romantik" in "Lontano"
mittlerweile gewonnen haben, so erscheint für einen Mo­
ment das serielle Denken als ein manieristisches Inter­
mezzo.
Ligeti hat nur in der ersten Hälfte der sechziger Jahre
über Webern p u b l i z i e r t l ° 4 • zwar sind die ersten dieser
Arbeiten noch seriellem Denkenl°5 verpflichtet, doch gilt
das nicht mehr vollständig für jene über Weberns Melodik,
eine Kategorie, die der seriellen Musik tendenziell un­
bekannt ist. Von seiner mit "Lontano" erreichten Position
aus, die die Konsonanzen restauriert, auf die "späte Ro­
mantik" anspielt und einem nachdrücklichen Avantgardismus nicht mehr nachfolgt, hat sich Ligeti nicht mehr über
Webern geäußert. Das haben - mit offenbar einer Ausnahme auch die "jungen Komponisten"1°6 in der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre nicht getan. Und Sinopoli, die er­
wähnte Ausnahme, schreibt vor allem als ein historisch
bewußter Dirigent über Webern. Daß er an Webern all jene
Momente der "späten Romantik" rühmen wird, ist zu erwar­
ten; doch haben die Promptheit, mit der sich bei ihm all
diese Kategorien einstellen, und die allzu hohle Polemik,
mit der sie vorgetragen werden, etwas - um mit Berg zu
sprechen - Fades. Ihn interessierte an Webern weniger der
Serialismus als vielmehr das "entschiedene Bewahren eines
musikalischen Traditionsbewußtseins..." schreibt Sinop o l i l ° 7 1 9 7 5 ; vier Jahre später verdeutlicht Sinopoli
seine Polemik: Webern sei nach Darmstadt ohne sein Ge­
wand gekommen, nämlich ohne die "Phrasierung Fin de siecle".
Er wurde vielmehr zum Ausgangspunkt für "jene Myriade von
Komponisten vom Strich", denen es genügte, "zwölf Töne in
der Art eines Kreuzworträtsels zu verschachteln", um sich
"von Rechts wegen der Avantgarde zugehörig" zu f ü h l e n l ° 8 .
"Bei keinem anderen Komponisten" - so Sinopoli - "ist die
musikalische Wiener Tradition mit solcher Notwendigkeit
76
und Dogmatik zugegen wie bei Anton Webern, einschließ­
lich aller dadurch bedingten Kleinbürgerlichkeit". Heute
könnten wir jedoch getrost und vielleicht sogar "mit ei­
nem befriedigten Grinsen" sagen, daß die Wiener Tradition
uns sehr viel mehr interessiere als all die diversen Erd­
beben, die seit den fünfziger Jahren die europäische Musik"kruste" erschüttert hätten. Man lasse also, fordert
S i n o p o l i l o 9 ; Webern schnellstens nach Wien zurückkehren.
Webern scheint hier doch nur als Pointe einer immer noch
gegen das serielle Denken gerichteten Polemik zu fungie­
ren; denn Sinopolis Erkenntnisse waren mittlerweile durch
musikwissenschaftliche Arbeiten (z.B. Budde, Gerlach)
längst bekannt.
Man steht, wenn man die gegenwärtige Position Weberns be­
stimmen will, vor der Schwierigkeit, eine Auseinander­
setzung zu rekonstruieren, die nicht mehr stattfindet
und zu der sich Komponisten nicht mehr herausgefordert
und genötigt sehen. Es kann deshalb abschließend nur an
einigen Aspekten eine grundsätzliche Divergenz erläutert
werden, ohne daß eine Verständigung angestrebt würde, die
nur imaginär bleiben könnte. Unter der gegenwärtigen Si­
tuation sollen in einer sehr groben ersten Orientierung
verstanden werden das von Hermann Sabbe 1971 beschrie­
bene Verfügen über "eine Materialtotalität", durch die
kein bestimmter Stand des Materials mehr ausgeprägt wird^°,
die desillusionierenden Widersprüche zwischen Theorie
und Praxis innerhalb der emphatischen musikalischen Avant­
garde, die z.B. Manfred Trojahn benannt hat und die ihm
etwa den Anschluß an diese unmöglich erscheinen l a s s e n ^ ,
die Dezentralisierung der M u s i k e n t w i c k l u n g ü - 2 # durch die
weder eine bestimmte Entwicklung akzentuiert wird noch
die Spitze einer solchen erkennbar wird und durch die die
Position fast aller sogenannten Außenseiter - in Deutsch­
land z.B. Hartmann, Zimmermann, Killmayer oder Henze eingeholt wird, schließlich die Abwendung von geschichts­
philosophischen Kategorien hin zu ästhetischen, die sich
unmittelbar in den schon kaum mehr zu überblickenden Re­
naissancen der verschiedenartigsten Komponisten nieder­
schlägt .
1. Webern hat nicht mit denjenigen Werken in den fünfziger
Jahren Einfluß gewonnen, die nach einem allgemeinen UrteilH3 ais seine gelungensten Werke gelten (an einige
dieser Werke hat nur der junge Eisler^-^ angeschlossen),
sondern mit Werken, deren technische Faktur sich am über­
sichtlichsten darstellen läßt. Zudem hat das, was als das
Unvergleichliche an diesen Werken beschrieben worden ist,
schon seiner Idee nach nie unmittelbar prägend wirken kön­
nen. Boulez etwa spricht von der "Stille" der Webernschen
77
Werke und gesteht, "daß die Stille bei Webern etwas war,
was ihm allein gehört und was man nur sehr schwer fort­
führen könne, ohne epigonal zu werden"H5. und nach Stock­
hausen ist der Webernschen Besonderheit nur durch ein kom­
mensurables eigenes Streben gerecht zu werden: "In dem
Augenblick", schreibt e r ^ 6 , "in dem man dem Grund der
Webernschen Musik nahe kommt, erreicht man auch den Grad
der Einsicht in ihre Einmaligkeit und Abgeschlossenheit
und in ihre Empfindlichkeit gegen jede Reproduktion. Man
muß etwas ganz anderes, Eigenes machen und Courage besit­
zen, wenn man nach seiner Musik noch eine Note schreiben
will". Die Einsicht in das Inkommensurable des Webern­
schen Werkes - so könnte die Überlegung verallgemeinert
werden - führt erst recht dann von Webern weg, wenn das
eigene Komponieren primär ästhetisch begründet, vor allem
die Unverwechselbarkeit des eigenen musikalischen Aus­
drucks angestrebt wird, ohne daß deshalb nun durch die
bloße Kategorie der Einmaligkeit ein Zusammenhang gestif­
tet wird.
2. Webern hat seine kompositionstechnische Entwicklung
stets exklusiv verstanden und andere Entwicklungen als
überflüssig kritisiert. Dieses Verständnis, gestützt von
einer geschichtsphilosophischen Begründung des Komponierens, prägte auch die serielle Musik. Eine Ästhetik der
seriellen Musik, wie sie Boulez als zweiten Band seines
"Musikdenkens heute" ankündigtel17;
bislang nicht er­
schienen. Das Fehlen einer solchen Ästhetik mag ein wenig
die Hilflosigkeit erklären helfen, die Werke auslösen,
von deren Bedeutung man überzeugt ist, deren Kompositions­
technik hingegen als widersprüchlich oder unstimmig emp­
funden wirdll°. Die Umrisse einer seriellen Ästhetik, wie
sie jetzt aus frühen Briefen Stockhausens^^ zu extrapo­
lieren wäre als eine des "Ausgleichs" und der "Mitte",
sind historisch in einem anderen Kontext erst seit Ende
der sechziger Jahre hervorgetreten und immer nur politisch
als irrational-autoritäre oder imperialistische Attitüde interpretiert worden. Gegenwärtig wird eine kompositions­
technische Vielfalt geradezu programmatisch gefordert.
"Wir dürfen keinesfalls so ignorant sein, den Reichtum
heutigen Komponierens zu leugnen, oder gar so dumm sein,
uns der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Mittel nicht
zu bedienen", schreibt von Bosel2°, un(j Wolfgang Rihm for­
muliert: "Ironischerweise war es immer die Idee von Rein­
heit der Tonkunst, die der Einheit von Tonkunst im Wege
stand"121. gr vergleicht die gegenwärtige Situation mit
jener der Wiener Klassik und fordert Komponisten zur "Synthesebereitschaft"122 auf. Diese Bereitschaft setzt die
Anerkennung der Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit
78
dessen voraus, was zur Synthese gebracht werden soll. Um­
gekehrt können bestimmte kompositionstechnische Sachver­
halte immer nur eine partielle Bedeutung erhalten.
3. Weberns Musik prägt eine besondere Dialektik von Buch­
stäblichkeit und Bedeutung: Der Prozeß der formalen Re­
duktion und Sublimierung, der jedes musikalische Ereig­
nis außerordentlich gewichtet, geht einher mit einer un­
geheuren Bedeutungserweiterung, nach der, wie Schönberg
beschrieb, ein Roman durch eine Geste ausgedrückt wird*23.
Wird bei Webern vom Vorgang des Verschweigens und Weg­
lassens gesprochenl24t s o ist das, was verschwiegen wird,
immer hinzuzudenken oder zu imaginieren. Entsprechend
formuliert Adorno, daß in einer Bagatelle Weberns mehr
Geschichte stecke als in der Stilimitation etwa der "Klas­
sischen Sinfonie" von
jew^25 Deshalb sei bei Webern
- auch interpretatorisch - nichts "wörtlich" zu nehmenl26.
Dieser Dialektik scheint gegenwärtig nicht mehr getraut zu
werden. Wolfgang Rihm diskutiert dieses Problem in einem
Beitrag, der charakteristischerweise um das Problem der
musikalischen Verständlichkeit kreist: "Nicht was hinter
der Musik ist, ist ihr Sinn, sondern was in ihr ist", be­
stimmt er nüchternl27( uncj: "je mehr in einem musikalischen
Kunstwerk versucht ist, spezielle Bedeutungen dem Einzel­
ereignis aufzubürden, desto unverständlicher wird das Gan­
ze sein."128 Damit fällt der Akzent auf das musikalisch
Buchstäbliche, auf die unmittelbare sinnliche Erscheinungs­
weise von Musik, in der ihre Bedeutung beschlossen liegt.
Entsprechend verhalten sich gegenwärtig komponierte Sin­
fonien zur "späten Romantik", auf die sie sich beziehen,
oft so wie neoklassizistische zu klassischen.
P r
o
k
o
f
.
4. Adorno erkennt 1959 "das Authentische der Wirkung We­
berns" paradoxerweise im "Mangel einer subjektiven Souve­
ränität des Komponierens": "Weberns Musik ... möchte von
Anfang an erscheinen, als wäre sie absolut, an sich, zu
akzeptieren als etwas Daseiendes, nichts weiter."129
Adorno spielt damit auf das an, was Webern selbst als
den letzten Grund von Kunst erkennt: "Je weiter man vor­
dringt, um so identischer wird alles, und man hat zuletzt
den Eindruck, keinem Menschenwerk gegenüberzustehen, son­
dern der Natur", schreibt Webernl3o. jn diesen Zusammen­
hang eines Verständnisses von Musik als etwas unabhängig
von Menschen Existierendem gehört auch etwa das folgende
Exzerpt des späten Webern: "... wenn Musik spricht, so
spricht sie doch zu Gott, nicht zu uns. Das vollendete
Kunstgebilde hat keinen Bezug zum Menschen, außer dem,
daß es ihn übersteht"131. Dem gegenwärtigen Komponieren
sind solche ästhetischen Vorstellungen weitgehend fremd.
Die autonome, souveräne kompositorische Subjektivität wird
hervorgekehrt und nimmt etwas "blind Befehlendes" an.
Vordergründig greifbar ist dieser Aspekt, der nach Adorno
die Möglichkeit imaginieren läßt, in einem Werk könne al­
les ebensogut auch anders sein!3 2; in der Rihmschen Er­
klärung, er werde einen bestimmten Text, den er schon
wiederholt vertont hatte, wohl noch viele Male vertonen-*-33;
oder: Musik sei manisch auf Kommunikation angewiesen.
5. Weberns Musik des "reinen Ausdrucks", des "erfüllten
Augenblicks" ist ausdrucksmäßig nicht zu fixieren. Nach
Mersmannl3^ spricht sich in ihr das ideelle Ende von Mu­
sik aus; Adornol3^ bestimmt ihren Ausdruck als Gebärde
des Verstummens; Schönbergl36 als den der bedeutungsvollen
Stille. Lachenmann hingegen versteht eben diesen Ausdrucks­
gehalt weniger ästhetisch als vielmehr soziologisch, als
Kommunikationsverweigerungl3^ . Dagegen ist für Eimertl38
Weberns Musik hart, dünn, klar und genau, für Christian
Wolff139 drahtig, gefährlich gespannt, zugleich dünn, kon­
zentriert und zart. Stockhausen spricht zwar nur von sei­
ner Liebe zu dieser Musikl^o, doch wird er sie 1953 als
wunderschön, hell, fröhlich und absichtslos empfundenl41
haben. Henze wiederum nennt sie kritiklos aff i r m a t i v l 4 2 ,
Sinopoli hebt - wie erwähnt - auf das Wiener "Fin de siecle'
abl43. Solche verschiedenartigen Deutungen korrelieren of­
fenbar weniger einer ungeheuren Komplexität als vielmehr
einer Abstraktheit des Ausdrucksgehalts, die dann als Man­
gel erscheinen kann, wenn man von der Musik fordert, sie
müsse voller Emotion sein!44.
6. Weberns Position scheint gegenwärtig jener durchaus
vergleichbar zu sein, die er in den zwanziger Jahren inne­
gehabt hatl45.
eines esoterischen Avantgardisten; doch
trägt solcher Avantgardismus im Verständnis einiger junger
Komponisten jetzt akademische Züge-^6 . wie in den zwan­
ziger Jahren wird kein Anschluß an fortschrittliche avant­
gardistische Verfahrensweisen mehr gesucht, sondern man
bezieht sich, ohne direkte Allusionen zu scheuen, auf ei­
ne vorvergangene Epoche, die freilich auch den jungen We­
bern geprägt hat. Führte Weberns Entwicklung konsequent
aus dieser Epoche hinaus, so wird durch die Werke einiger
junger Komponisten Weberns Weg, der damit keine Verbind­
lichkeit mehr für sie haben kann, geradezu revoziert. Ent­
weder - so scheint es - muß Weberns Werk gegenwärtig kom­
positorisch ignoriert werden, oder aber all die Eigen­
schaften, durch die es zum Paradigma emphatisch Neuer Mu­
sik Anfang der fünfziger Jahre aufrückte, müssen von ihm
abfallen oder zumindest andere Bedeutungen annehmen.
8o
ANMERKUNGEN
1 P.Boulez, Flugbahnen (1949), in: Anhaltspunkte, Stuttgart 1975,
S. 264
2 Selbstportrait, in: Programmheft Donaueschinger Musiktage 1975,
S. 29
3 I.Strawinsky, Geleitwort, in: Anton Webern (=die reihe 2), Wien
1955 (II. Fassung), S . 7
4 W.Fortner, Anton Webern und unsere Zeit, in: Melos XXVII, 196o,
S.325f.
5 H.Strobel, So sehe ich Webern, in: Melos XXXII, 1965, S . 285
6 Vgl. M.Druskin, Igor Strawinsky, Leipzig 1976, S.198
7 Vgl. Igor Strawinsky mit Robert Craft. Erinnerungen und Gespräche,
Frankfurt 1972, S.24o
8 Cl.Rostand, Gespräche mit Darius Milhaud, Hamburg o.J., S.128;
Fr.Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, Paris 1954, S.199
9 Gespräche mit Darius Milhaud, S.129; Entretiens avec Claude
Rostand, S . 199
10 Zit. nach H.und R.Moldenhauer, Anton von Webern, Zürich 198o,
S . 225
11 H.und R.Moldenhauer, Anton von Webern, S . 224
12 Jugendbriefe von Paul Hindemith aus den Jahren 1916-1919, in:
Hindemith-Jb.1972/11, S.195
13 Ebd., S.195f. Hindemith ironisiert sogleich dies Konzept, wenn
er fortfährt: "Eines kommt hinzu, da muß man ins Klavier greifen
u. die Saiten mit der Hand anreißen, bei einem anderen wird der
Klavierdeckel zugeschlagen u. zwar stets bei der Stelle, wo mir
per Zufall ein ungetrübter Dur-Akkord unterlaufen ist, damit man
durch ihn nicht in seinem musikalischen Zartgefühl beleidigt
wird." (S.196)
14 Vgl. R.Stephan, Weberns Werke auf deutschen Tonkünstlerfesten,
in: ÖMZ XXVII, 1972, S.122ff.
15 Folgende Angaben nach dem Briefwechsel zwischen Hindemith und dem
Schott-Verlag (Hindemith-Institut, Frankfurt) vom Mai 1928.
16 Vorwort zu "Frau Musica", Edition Schott 146o; dort heißt es:
"Diese Musik ist weder für den Konzertsaal noch für Künstler g e ­
schrieben. Sie will Leuten, die zu ihrem eigenen Vergnügen singen
und musizieren oder die einem kleinen Kreise Gleichgesinnter vor­
musizieren wollen, interessanter und neuzeitlicher Übungsstoff
sein. Diesem Zwecke entsprechend werden an alle Ausführenden
keine sehr großen technischen Anforderungen gestellt..."
17 Vgl. H.und R.Moldenhauer, Anton von Webern, S.313
18 J.D.Bach, in: Wiener Arbeiterzeitung, 1932, vgl. G.Schubert,
Vorgeschichte und Entstehung der "Unterweisung im Tonsatz. Theo­
retischer Teil", in: Hindemith-Jb.198o/IX, S . 33, Anm. 5o. Bach
ist Widmungsträger von Weberns op.19.
19 Der Weg zur Neuen Musik, Wien 196o, SS.34,49,51
20 Musik der Gegenwart, Berlin 1923, S . 79
81
21 Vgl. R.Stephan, Über Schwierigkeiten der Bewertung und der Ana­
lyse neuester Musik, in: Musica XXVI, 1972, S.228f.
22 Das Anschauungsmodell dieser fragmentarischen Hinweise bildet
primär das Werk Hindemiths.
23 P.Hindemith, Forderungen an den Laien, in: Musik und Gesellschaft
I, 193o, S.9
24 P.Hindemith, Wie soll der ideale Chorsatz der Gegenwart oder bes­
ser der nächsten Zukunft beschaffen sein?, in: Hamburger Jb. für
Musikwissenschaft IV, Hamburg 198o, S.114
25 Vgl. etwa E.Krenek, Selbstdarstellung, Zürich 1949, S.18
26 Vgl. Poulenc, Entretiens, S.199
27 Vgl. Stephan, Weberns Werke, S.122ff.
28 Zit. nach H.Schmidt-Garre, Webern als Angry Young Man, in: NZ
CXXV, 1964, S.132
29 Nach Schmidt-Garre, S.133
30 E.Doflein, Die neue Musik des Jahres, in: Melos V, 1925/26, S.38o
31 Nach Schmidt-Garre, S . 134
32 Nach Schmidt-Garre, S . 133
33 Nach Schmidt-Garre, S. 133
34 Nach Schmidt-Garre, S . 136
35 Vgl. dazu Th.W.Adorno, Anton von Webern, in: Klangfiguren,
Frankfurt 1959, S.169
36 Nach Schmidt-Garre, S.13 7
37 Nach Schmidt-Garre, S . 137
38 Vgl. dazu die Briefe K.A.Hartmanns an seine Frau, in: A.McCredie,
Karl Amadeus Hartmann, Wilhelmshaven 198o, S.14off.
39 Nur im Katalog zur Ausstellung "Entartete Musik", hg. v. H.G.Zieg­
ler, Düsseldorf 1938, S.17 wird Webern angeprangert. Vgl. auch die
Ausstellung "Entartete Kunst" in Wien (Moldenhauer, Webern, S . 454)
40 Zehn Jahre danach (1962/63), in: Anhaltspunkte, S . 259
41 Vgl.dazu die späten Schriften von Honegger oder Hindemith.
42 Igor Strawinsky mit Robert Craft, S.24o; Fr.Poulenc, Correspondence i915-1963, Paris 1967, S.236
4'3 Poulenc, Correspondence, a.a.O.
44 Poulenc, Correspondence, S . 156 (3.Januar 1945)
45 Poulenc, Correspondence, S.163 (27.März 1945)'
46 Poulenc, Correspondence, S . 166
47 Poulenc, Correspondence, S . 178 (11.Juni 1947)
48 Schoenberg et son ecole, Paris 1947; Introduction ä la musigue
de douze sons, Paris 1949; Q u ’est-ce que la musique de douze s o n s ,
Liege 1948
49 Schoenberg et son ecole, S . 212
50 Vgl. H.Deppert, Studien zur Kompositionstechnik im instrumentalen
Spätwerk Anton Weberns, Darmstadt 1972, S . 6
51 Mißverständnisse um Berg (1948), in: Anhaltspunkte, S.321
52 Flugbahnen (1949), in: Anhaltspunkte, S.257
53 Flugbahnen, S . 245
82
54 Strawinsky bleibt (1951), in: Anhaltspunkte, S.163ff.; vgl. K.H.
Stockhausen, Beitrag zum lo. Geburtstag Strawinskys (1952), in:
Texte zur Musik 197o-1977, Köln 1978, S.663
55 Vortrag bei den Darmstädter Ferienkursen 1951, in: Anhaltspunkte,
S .288ff.
56 Vgl. Darmstädter Beiträge zur neuen Musik X, Mainz o.J., S.98
57 L.Nono, Die Entwicklung der Reihentechnik (1958), in: Texte, hg.
v. J.Stenzl, Zürich 1975, S.21ff.
58 Schönberg ist tot (1951), in: Anhaltspunkte, S . 295
59 Zur Situation des Metiers (1953), in: Texte zur elektronischen
und instrumentalen Musik I, Köln 1963, S.46
6 0 Material und Geist, in: Melos XVIII, 1951, S . 6
61 Material und Geist, S . 5
62 Frankfurt 2ig58, S .lo 6
63 a.a.O.,S-lo7
64 In: Dissonanzen, Göttingen 2 1 9 5 3 , S.136ff.
65 Das Altern, S.144
66 Das Altern, S.153
67 Die altertümliche Schreibweise "Styl", die offenbar einen uner­
meßlichen inneren Abstand evozieren soll, stammt von Metzger;
Eimert, der den Begriff prägte, schreibt stets: "Stil".
68 Disput zwischen Theodor W.Adorno und Heinz-Klaus Metzger (1957),
in: H.-Kl.Metzger, Musik wozu, Frankfurt 198o, S.lol
69 Anton von Webern, in: Klangfiguren, S. 157ff.
lo Anton von Webern (1959), S.176
71 Anton von Webern (1959), S . 176
72 Anton von Webern (1959), S.159
73 Die aktuelle Bedeutung Weberns (197o), in: Texte zur Musik 1963197o, Köln 1971, S . 352: "Natürlich war für uns junge Musiker ...
in den Jahren 1951 bis ca. 1956 Webern besonders aktuell..."
74 1958 wirkte Cage in Darmstadt.
75 Zum 15.September 1955, in: die reihe 2, S . 43
76 Zum 15.September 1955, S . 43
77 Von Webern zu Debussy, in: Texte zur elektronischen und instru­
mentalen Musik I, S . 78
78 L.Nono, Gespräch mit Guy Wagner (1971), in: Texte, S . 261
79 Wille und Zufall, Stuttgart 1977, S.25
80 Vgl. M.Druskin, Igor Strawinsky, S . 199
81 Vgl. dazu etwa Boulez' Selbstkritik in: Musikdenken heute 1
(=Darmstädter Beiträge zur neuen Musik), Mainz 1963, S.2of.:
"Als wir begannen, die Reihe auf alle Komponenten des Phänomens
Klang auszudehnen, haben wir uns Hals über Kopf, oder vielmehr:
kopflos an die Zahl verloren..."
82 P.Stadien, Die Webern-Legende, in: Musica XV, 1961, S. 6 6 ff.
83 C.Dahlhaus und R.Stephan, Eine 'dritte Epoche' der Musik?, in:
Deutsche Universitätszeitung 1954, Heft X
84 W.M.Stroh, Anton Webern, Historische Legitimation als komposi­
torisches Problem, Göppingen 1973
83
85 Vgl. C.Dahlhaus, "Historische Legitimation", in: NZ CXXXIV, 1973,
S .572f.
86 W.Kolneder, Anton Webern, Wien 1974
87 Der Autor als Produzent, in: Gesammelte Schriften 11(2), S.683ff.;
vgl. dazu R.Bubner, Kann Theorie ästhetisch werden?, in: Materia­
lien zur ästhetischen Theorie. Th.W.Adornos Konstruktion der M o ­
derne, hg. v. W.Lüdke, Frankfurt 198o, S.12o
88 Musik und Politik. Schriften und Gespräche 1955-1975, München
1976, S.243
89 Vgl. A.Webern, Der Weg zur Neuen Musik, S.37: "Also das wollen
wir festhalten: über die Formen der Klassiker sind wir nicht
hinaus"; S. 6 o: "Ganz neu sagen wollen wir dasselbe, was früher
gesagt wurde." Vgl. auch dazu H.P.Krellmann, Webern, Reinbek bei
Hamburg 1975, S.95f.
90 So vor allem Boulez; vgl. etwa: Bach als Kraftmoment (1951), in:
Anhaltspunkte, S.7o
91 Vgl. Fr.Döhl, Zum Formbegriff Weberns, in: ÖMZ XXVII, 1972, S . 137
92 H.-Kl.Metzger, Plattentext zur Schallplatte DGG 253o284: "...mag
auch Webern in seiner eigenen Analyse metaphorisch von 'Themen'
sprechen..."
93 Vgl. zu diesem Komplex auch: Chr.M.Schmidt, Brennpunkte der Neuen
Musik, Köln 1977, S.38ff.
94 P.Stadien, Die Webern-Legende, S. 68
95 Bereits 1965 distanziert sich Ligeti vom musikalischen Avantgardismus; vgl. G.Ligeti, Viele Pläne, aber wenig Zeit, in: Melos
XXXII, 1965, S . 251; vgl. auch: Blick in die Zeit, in: Melos XXVIII,
1971, S .21 3 f .
96 Vgl. Kl.Kropfinger, Ligeti und die Tradition, in: Zwischen Tra­
dition und Fortschritt (Veröffentlichungen des Instituts für
Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 13), Mainz 1973, S.136
97 Neue Musik in Ungarn, in: Melos XVI, 1949, S. 6 ; von Bartok bis
Veress, in: Melos XVI, 1949, S. 6 o; Zwölftonmusik oder "Neue To­
nalität"?, in: Melos XVII, 195o, S.45
98 Zwölftonmusik oder "Neue Tonalität"?, S.45
•99 Zwölftonmusik oder "Neue Tonalität"?, S . 45
100 G.Ligeti, Fragen und Antworten von mir selbst, in: Melos XXXVIII,
1971, S .5o 9 f .
101 Fragen und Antworten, S.51o
102 Fragen und Antworten, S.51o
103 Blick in die Zeit, S . 213
104 Über die Harmonik in Weberns erster Kantate, in: Darmstädter Bei­
träge zur neuen Musik III, Mainz 196oj Weberns Stil, in: gehört­
gelesen 196o, Nr.3; Die Komposition mit Reihen und ihre Konse­
quenzen bei Anton Webern, in: ÖMZ XVI, 1961; Weberns Melodik,
in: Melos XXXIII, 1966
105 Über reihenmäßige Bildung der Klangfarben vgl. etwa: Die Kompo­
sition mit Reihen, S.299ff.
10 6 Diese Komponisten empfinden sich selbst emphatisch als "junge
Komponisten"; vgl. H.-J.von Bose, Suche nach einem neuen Schön­
84
107
10 8
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
heitsideal, in: Darmstädter Beiträge zur neuen Musik XVII,
Mainz 1978, S.35
Selbstportrait, in: Programmheft Donaueschinger Musiktage 1975,
S . 27
Von Darmstadt nach Wien, in: Zwischen den Kulturen, hg. v.H.W.
Henze, Frankfurt 1979, S . 236
Von Darmstadt nach Wien, S.238
Philosophie der neuesten Musik - ein Versuch zur Extrapolation
von Adornos 'Philosophie der neuen Musik', in: Studia Philosophica
Gaudensia, Heft 9, 1971, S.lo9
M.Trojahn, o.T., in: Programmheft Donaueschinger Musiktage 1978,
S . 29: "Am Ende der sechziger Jahre steht der Werkbegriff in Auf­
lösung - kaum ein Komponist befolgt jedoch die theoretischen E r ­
fordernisse und enthält sich der Produktion..."
Vgl. C.Dahlhaus, Vom Einfachen, vom Schönen, vom einfach Schönen,
in: Darmstädter Beiträge zur neuen Musik XVII, S.33
z.B. Th.W.Adorno, Anton von Webern (1959), S.165
Vgl. R.Stephan, Zu einigen Liedern Anton Weberns, in: Beiträge
'72/73, Webern-Kongreß, Kassel 1973, S.143f.
Wille und Zufall, S.14
Zum 15.September 1955, S.43
Vgl. J.Butzga, Interview mit Pierre Boulez in Prag, in: Melos
XXXIV, 1967, S.162
Diese Bemerkung gilt schon für Schönbergs Verwendung der Dode­
kaphonie; vgl. dazu Chr.Möllers, Reihentechnik und musikalische
Gestalt bei Arnold Schönberg, Wiesbaden 1977; damit bestätigt
sich indirekt auch die Kritik, die Boulez an der Schönbergschen
Reihentechnik übt (z.B. in: Bach als Kraftmoment, in: Anhalts­
punkte, S .6 9 f .).
H.Sabbe, Die Einheit der Stockhausen-Zeit, Musik-Konzepte
Heft 19, München 1981
Suche nach einem neuen Schönheitsideal, S.38f.
Der geschockte Komponist, in: Darmstädter Beiträge zur neuen
Musik XVII, S . 43
Der geschockte Komponist, S . 43
Vorwort zu Weberns Bagatellen op.9, UE 7575
Th.W.Adorno, Anton von Webern (1959), S.166ff.
Th.W.Adorno, Tradition, in: Dissonanzen, S . 125; vgl. dazu auch
die Diskussion: Wo ist echte Tradition?, in: Melos XXVII, 196o,
S .294ff.
Th.W.Adorno, Anton von Webern (1959), S.167
Verständlichkeit und Popularität - künstlerische Ziele?, in:
Darmstädter Beiträge zu neuen Musik XVIII, Mainz 198o, S.62f.
Verständlichkeit und Popularität, S.63
Anton von Webern (1959), S.174
Der Weg zur Neuen Musik, S. 6 o
H.Moldenhauer, Weberns letzte Gedanken, in: Melos XXXVIII, 1971,
S . 273
Anton von Webern (1959), S . 174
85
133 Programmnotiz zu: umhergetrieben, aufgewirbelt, in: Programm­
buch Vorwärts schauen, schauen zurück, Frankfurt 1981, S . 112
134 Musik der Gegenwart, S . 79
135 Zuerst in: Anton von Webern (1932), in: Impromptus, Frankfurt
1968, S.49; identisch mit: Philosophie der neuen Musik, S.I 08
136 Vorwort zu Weberns Bagatellen op.9
137 Die gefährdete Kommunikation, in: Musica XXVIII, 1974, S . 229:
"Kommunikation verweigern und zugleich erzwingen: nur der
äußersten ästhetischen Intensität kann dies gelingen. Umgekehrt
ist gerade solche Intensität möglich einzig in der Auseinander­
setzung mit den geltenden Ausdruckskategorien..."
138 Die notwendige Korrektur, in: die reihe 2, S.37
139 Kontrollierte Bewegung, in: die reihe 2, S . 66
140 Zum 15.September 1955, S . 42
141 Vgl. H.Sabbe, Die Einheit der Stockhausen-Zeit, S . 54
142 Musik und Politik, S.243
143 Von Darmstadt nach Wien, S.238
144 W.Rihm, In den Spiegel gelauscht, in: Programmheft Donaueschinger
Musiktage 1974, S . 21
145 Vgl. W.Rihm, Ins eigene Fleisch... in: NZ CXL, 1979, S. 8 ; vgl.
dazu die von H.Deppert, Studien zur Kompositionstechnik im in­
strumentalen Spätwerk Anton Weberns, S . 221 anvisierte "Kodifizierung des späten Instrumentalstils Weberns" im Sinne eines
Ersatzes des als Lehrgegenstand "bewährten" Palestrinastils
(solch eine Vorstellung in bezug auf die 12-Ton-Technik über­
haupt entwickelte bereits K renek).
146 Vgl. dazu R.Busch, Vorbemerkung zu: August Halm über die Kon­
zertform, in: Notizbuch 5/6, Berlin 1982, S.lo7ff.
86
Hermann Danuser
HANNS EISLER - ZUR WECHSELHAFTEN WIRKUNGSGESCHICHTE
ENGAGIERTER MUSIK
Für Christoph Keller
Als vor nunmehr 14 Jahren Reinhold Brinkmann an diesem
Ort über "Kompositorische Maßnahmen Eislers" sprach im Rahmen des damals zur rechten Zeit veranstalteten Kon­
gresses über "Musik und Politik"1 -, war Hanns Eisler im
Westen nur einem kleinen Kreis bekannt, seine Schriften,
soweit überhaupt greifbar, wurden wenig gelesen, seine
Musik noch weniger gespielt. Fast über Nacht aber änderte
sich diese Situation von Grund auf: Chöre und Ensembles
wurden gegründet, die Eislers Namen tragen, seinem Schaf­
fen gewidmete Konzerte, Retrospektiven und Symposien fan­
den statt, Editionen von Schriften und Gesprächen, Musik­
noten und Schallplatten gelangten neu auf den Markt, eine
feuilletonistische, kritische und wissenschaftliche Lite­
ratur schwoll bald zu einem schwer überschaubaren Ausmaß
an. Jäh rückte Eisler in Westeuropa um 197o aus dem Dun­
kel von Vergessenheit und Verdrängung in den Brennpunkt
der Aktualität. Heute indessen ist dieses Interesse merk­
lich abgeklungen, der Zenith der westlichen Eisler-Rezep­
tion erscheint überschritten und gehört bereits der jün­
geren Vergangenheit an, nicht anders als die Studenten­
bewegung, von der sie vorab getragen wurde. In dem Maße
aber, in dem Eislers unmittelbare Aktualität sich ver­
ringerte, dürften sich die Chancen erhöht haben, seine
Musik historisch und ästhetisch gelassener zu bewerten
und sie nicht länger zu bloßer Exemplifizierung einer Po­
sition politisch-musikalischen Engagements zu benutzen in einer vorwiegend theoretisch geführten Diskussion, in
der das ausgiebige Zitieren von Eislers Schriften das Hö­
ren und Verstehen seiner Musik weitgehend verdrängt hat.
1 Reinhold Brinkmann, Kompositorische Maßnahmen Eislers, in: Über
Musik und Politik, hg. v. R.Stephan (Veröffentlichungen des In­
stituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Band l o ) ,
Mainz 1971, S.9-22
87
I. E i s ler u n d die S c h ö n b e r g - S c h u l e
Während die persönlichen Beziehungen Eislers zu Schönberg
in wesentlichen Zügen erforscht sind - bei allen Diffe­
renzen hat der Schüler dem Lehrer auch öffentlich, frei­
lich nicht ohne Nuancen, stets die Treue g e h a l t e n 2 -,
stellt Eislers Verhältnis zur Schönberg-Schule noch ein
offenes Problem dar, sofern der Begriff der SchönbergSchule über das Pädagogische hinaus kompositionsgeschicht­
lich gefaßt wird. Perioden der Nähe wechselten mit Phasen
der Ferne zu ihr so drastisch, daß die Frage nach der Ein­
heit des Eislerschen Oeuvre, danach also, ob und inwie­
fern es jenes - neuerdings vielbeschworene - Ganze tat­
sächlich im Sinne eines inneren Zusammenhangs bilde,
nicht bloß rhetorisch aufgeworfen werden darf. Vor einem
Vierteljahrhundert jedenfalls, zur Zeit des Kalten Krie­
ges, wurden die verschiedenen Schaffensphasen Eislers in
Ost und West gänzlich konträr bewertet, und hier wie dort
wäre wohl die Frage, ob Eisler überhaupt der SchönbergSchule angehöre, verneint worden - aufgrund entgegenge­
setzter Urteilskriterien. Im Westen, wo sich nach 195o
eine Avantgarde unter weitgehender Ausklammerung gesell­
schaftlicher und sozialer Aspekte der Musikproduktion
entfaltete, wurde Eislers Funktionsorientierung zugunsten
einer dem Sozialismus nützlichen Musik - etwa gar die Kom­
position der DDR-Hymne - als bedauerlicher Irrweg eines
von den Prinzipien der autonomen Neuen Musik abgefallenen
Schönberg-Schülers betrachtet, wie bekanntlich schon
Schönberg selbst, dessen Leben der Kunst galt, die poli­
tische Entscheidung eines Komponisten von Eislers Bega­
bung, die Kunst in den Dienst eines sozialistischen Lebens­
ideals zu stellen, nie begreifen, geschweige denn billigen
2 Albrecht Dümling, Eisler und Schönberg, in: Hanns Eisler, Sonder­
band Nr.5 der Zeitschrift Das Argument, Berlin 1975, S.57-85 (im
folgenden zitiert als AS 5)
Ders., Schönberg und sein Schüler Hanns Eisler. Ein dokumentarischer
Abriß, in: Die Musikforschung 29. Jg. (1976), S.431-461. Der V e r ­
fasser möchte Herrn Dr. Dümling an dieser Stelle vielmals danken
für einige Informationen zur jüngsten Eisler-Rezeption.
Günter Mayer, Arnold Schönberg im Urteil Hanns Eislers (1975), in:
Weltbild-Notenbild. Zur Dialektik des musikalischen Materials,
Leipzig 1978, S.349-383
Walter. Szmolyan, Schönberg und Eisler, in: Österreichische Musik­
zeitung 33. Jg. (1978), S.439-444
88
konnte. Im Osten andererseits, zumal in der neugegrün­
deten DDR, wo eine dem Sozialistischen Realismus ver­
pflichtete Kulturpolitik den modernitätsfeindlichen Po­
pulismus der dreißiger und vierziger Jahre bruchlos fort­
setzte und auf der Stagnation eines tonalen musiksprach­
lichen Materials beharrte, wurde Eisler als Sänger der
Arbeiterklasse und Begründer des Sozialistischen Realis­
mus in der deutschen Musik gefeiert, wobei das Lob seiner
Kampfmusikperiode um 193o und der in der DDR bis zu sei­
nem Tod im Jahre 1962 entstandenen "angewandten Musik"
jedoch seine Kehrseite hatte in der unverhüllten, gar
grobschlächtigen Kritik an Perioden der "Esoterik", der
er, Schüler des diffamierten Schönberg, in seinen Lehr­
jahren und später im amerikanischen Exil um 194o verfal­
len sei3 . Indem Eislers vier Schaffensphasen dergestalt
brüsk zweigeteilt und die Perioden einer "formalistischen"
Neuen Musik und einer "realistischen" angewandten Musik
in der marxistischen und nichtmarxistischen Kritik völlig
entgegengesetzt bewertet wurden, war die Eisler-Rezeption
während des Kalten Krieges ein genaues Spiegelbild der
kulturpolitischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West.
Solch holzschnittartige Kontrastierung bedeutet indessen
eine Verzerrung der historischen Wirklichkeit, wenn sie
sich auf den Gegensatz von rückhaltlos autonomer und be­
dingungslos funktionaler Musik stützt. Gewiß - die Wider­
sprüche in Eislers Weg reichen tiefer, als daß die mit­
unter drastischen Stil- und Qualitätsdifferenzen ledig­
lich als gattungsbedingte Unterschiede innerhalb eines
einheitlichen Oeuvre gelten könnten. Sie lassen sich je­
doch kaum im Sinne einer tendenziellen Spaltung des Eislerschen Bewußtseins dergestalt interpretieren, daß des­
sen politisch-ethische Seite der revolutionären Arbeiter­
bewegung, seine ästhetische aber der Schönberg-Schule ver­
pflichtet gewesen sei und deshalb, je nach externer Vor­
aussetzung, diese oder jene Richtung vorgeherrscht habe.
Widersprüchlichkeiten in Eislers Schaffen, insbesondere
3 So u.a. Heinz Alfred Brockhaus, Hanns Eisler (Musikbücherei für
Jedermann Nr.19), Leipzig 1961, und Ernst Hermann Meyer, Vorwort
zu Hanns Eisler, Lieder und Kantaten, Band 1, Leipzig 1955.
Dazu Brinkmann, a.a.O., S.9f. und Rudolf Stephan, Kleine Beiträge
zur Eisler-Kritik, in: Musik zwischen Engagement und Kunst (=Studien zur Wertungsforschung, Band 3, hg. v.O.Kolleritsch), Graz
1972, S.53-68, v.a. S.64f.
89
der Bruch mit der Kunstmusik der Moderne nach 1925, wer­
den vielmehr verständlicher, wenn wir, statt es mit den
Oeuvres von Webern oder Berg zu vergleichen, der Tatsache
Gewicht beimessen, daß Eisler der zweiten Schülergenera­
tion Schönbergs angehörte und - wie Milhaud, Honegger,
Poulenc in Frankreich, Hindemith, Krenek, Weill in Deutsch­
land - erst nach dem Ersten Weltkrieg auf den Plan trat.
Im Unterschied zur Vorkriegsgeneration der Neuen Musik
bezog die Nachkriegsgeneration insgesamt das Moment der
Funktion in den Umbruchprozeß mit ein, so daß Eislers
Schritt zu einer politisch engagierten Musik - im Zei­
chen einer allgemeinen Funktionalisierung der artifizi­
ellen Musik - musikhistorisch eine sinnvoll mögliche Ent­
scheidung darstellte. Die bewußte Abkehr dieser jungen
Komponistengeneration von der Tradition der absoluten
Musik gestattete ein Neben- bzw. Nacheinander vielfäl­
tigster Ansätze und zeitigte ein rastloses, schnell und
spontan entscheidendes Experimentieren innerhalb eines
stilistisch und gattungsmäßig weitgespannten Bereichs
von Musik, der insgesamt als "mittlerer" charakterisiert
werden k a n n 4 _ auf doppelte Weise: zum einen im Hinblick
auf den Kunstanspruch durch einen mittleren Stilhöhenbereich zwischen dem "Oben" der absoluten Kunstmusik und
dem "Unten" schierer Trivialmusik, zum ändern - um die
Raummetapher nun geschichtsphilosophisch zu wenden - im
Hinblick auf den Stand des musikalischen Materials durch
eine mittlere Position zwischen dem "Vorn" einer strikten
(freien oder dodekaphonen) Atonalität und dem "Hinten"
einer traditionellen funktionsharmonischen Tonalität.
Keineswegs stellte die junge Generation dabei die neuen
Arten von "Funktionsmusik" der ehemaligen "Kunstmusik"
kontradiktorisch gegenüber. Vielmehr zielte sie auf eine
Einheit von Kunstgehalt und Funktionserfüllung, d.h. sie
hielt den Grad kompositorischer Artifizialität variabel
und paßte ihn dem jeweiligen Funktionsanspruch an. Weil
dies in vollem Umfang auch für Hanns Eisler zutrifft, ist
seine Zugehörigkeit zur Schönberg-Schule,. für die der
Kunstanspruch einer Neuen Musik verpflichtend war, nur
eine, wenn auch wichtige Wurzel seines Schaffens. Von
ihrer Relevanz zeugen bekannte Werke wie die Klaviersonate
4 Dazu im näheren vom Verfasser: Die "mittlere Musik" der Zwanziger
Jahre, Vortrag, gehalten auf dem Kongreß der Internationalen Ge­
sellschaft für Musikwissenschaft in Straßburg 1982, Kongreßbericht
in Vorbereitung
opus 1 (1924) oder das Quintett "14 Arten, den Regen zu
beschreiben" opus 7o (194o), Werke einer originären Neuen
Musik, die - auf der Grundlage von Kompositionsprinzipien
der Wiener Schule wie der entwickelnden Variation - einen
spezifisch Eislerschen Tonfall ausprägen, dem stets auch bei größter Ausdrucksintensität - eine gewisse Di­
stanziertheit eignet. Diese Wurzel fand jedoch ein star­
kes, streckenweise überwiegendes Gegengewicht in Eislers
Teilhabe an der Komponistengeneration der "mittleren Mu­
sik", deren Arbeit den Erfordernissen des Tages, jeden­
falls der Gegenwart galt.
Eislers musikhistorische Bedeutung erwächst aus diesem
Spannungsverhältnis zwischen Schönberg-Schule und "mitt­
lerer Musik", sein Rang daraus, daß er es zu großen Tei­
len fruchtbar zu entwickeln vermochte, so daß daraus mehr
als ein fauler Kompromiß zwischen Kunst- und Funktions­
anspruch resultierte. Begreiflicherweise konnte unter die
sen Voraussetzungen seine Musik selten das von der Trias
Schönberg, Webern, Berg gesetzte oberste Kunstniveau der
Schule erreichen, andererseits - und diese Betrachtungs­
weise erscheint angemessener - wird daraus Eislers be­
sondere Position in der Komponistengeneration der "mitt­
leren Musik" verständlich, die ihn auszeichnet im Hin­
blick auf die Logik der Musiksprache. So wird man seine
Agitationschöre, Massenlieder und Balladen aus den Jahren
um 193o zwar nicht zur Musik der Schönberg-Schule rechnen
dürfen, doch - wie etwa Reinhold Brinkmanns Analyse des
"Solidaritätsliedes" aus "Kuhle Wampe" (1931) zeigt5 _
an ihrer Faktur ein bei Schönberg geschultes und trotz
der Zurücknahme des musikalischen Materials noch wirk­
sames Denken erkennen können: Grund ihrer Neuheit und
ihres - in diesen Gattungen unleugbaren - ästhetischen
Rangs.
Indessen kann selbst die hartnäckigste Apologetik die
Augen vor der Tatsache nicht verschließen, daß Eisler ge­
legentlich nicht nur den Materialstand, sondern auch die
Materialbehandlung auf blanke Konventionalität zurück­
schraubte. In dem Kitsch der "Neuen deutschen Volkslieder
5 Brinkmann, a.a.O., S.llf. Außerdem vom selben Verfasser: Kritische
Musik - Bericht über den Versuch Hanns Eislers, in: Über Musik und
Kritik, hg. v. R.Stephan (Veröffentlichungen des Instituts für
Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Band 11), Mainz 1971,
S.19-41
91
(195o) oder in der Neuromantik der Orchestersuite zu
Bechers "Winternacht" (1955) hat sich Eislers Wort aus
dem Jahre 1948, die Schönberg-Schule werde geschlossen^,
in einem ganz anderen als dem gemeinten Sinn erfüllt. In
solchen Werken lassen sich keinerlei Spuren eines von
Schönberg repräsentierten Musikdenkens mehr entdecken,
auch der dünnste Faden eines kompositionsgeschichtlichen
Zusammenhangs zur Wiener Schule erscheint hier zerrissen.
In solchen Kompositionen hat Eisler in dem Bemühen, dem
Sozialismus nützliche Musik zu schreiben, sein eigenes
Programm preisgegeben, demzufolge der Kampf gegen die
politische und der gegen die musikalische Dummheit als
ein und derselbe zu führen seien. Bei allem Bedauern über
die Existenz dieses Teils von Eislers Oeuvre sollte man
indessen nicht übersehen, daß ein solchermaßen schwanken­
des Niveau, so unverträglich es mit dem Anspruch der Schön­
berg-Schule ist, ein ganz und gar typisches Charakteristi­
kum jener "mittleren Musik" darstellt, der Eisler in sei­
nem Musikverständnis primär verpflichtet war.
II. Zum späten Eisler
Im "Brief nach Westdeutschland" von 1951, der als Gegen­
entwurf zum Kunstideal der Wiener Schule gelesen werden
kann, heißt es: "Wir brauchen dringend für unerfahrene
Hörer leichtverständliche Musik. Es ist schwer genug, sie
zu schreiben, ohne in abgenutzte Klischees zu verfallen...
Verbindet sich Musik mit anderen Künsten: Poesie, Theater,
Tanz, wird sie zur angewandten Musik, dann bekommt selbst
Abgenütztes einen neuen Sinn und damit eine neue Nützlichkeit"7. Unter Verzicht auf jenen Freiraum der Phantasie,
der ihm im amerikanischen Exil eine Rückkehr zur künst­
lerischen Modernität gestattet hatte, orientierte Eisler
sein Schaffen in der DDR strikt an diesem Konzept einer
"angewandten Musik". Den Gegenbegriff "Kon_zertmusik"
scheint er dabei auf reine Instrumentalmusik einzuschrän­
ken, so daß die Vokalmusik, bei der die Musik sich mit
Poesie verbindet, zur "angewandten Musik" zu rechnen wäre
6 Hanns Eisler, Gesellschaftliche Grundlagen der modernen Musik,
in:
Materialien zu einer Dialektik der Musik, hg. v. M.Grabs, Leipzig
1976, S.177
7 Hanns Eisler, Brief nach Westdeutschland, a.a.O., S.2o5f.
92
und dieser Begriff demnach querstünde zum Gegensatz autonom
funktional, wenngleich das Funktionsmoment daran primär er­
scheint. Man mißverstünde das Eislersche Konzept, sähe man
in ihm vorab eine List der musikalischen Vernunft, um unter
den Bedingungen einer extrem modernitätsfeindlichen Musik­
politik sich dem Zwang zur bombastischen Symphonik des
Sozialistischen Realismus zu entziehen und durch äußerste
Selbstbeschränkung wenigstens einige Elemente einer auf­
klärerischen neuen Kunst zu bewahren.
"Ich wollte nicht das machen, was mir Spaß macht, sondern
das, was notwendig war", äußerte Eisler 19588. und not­
wendig erschien ihm im Anfangsstadium des sozialistischen
Aufbaus, die aus feudalen und bürgerlichen Zeiten stam­
mende Spaltung der Musikkultur in eine hohe und eine nie­
dere zu überwinden und durch die Komposition einfacher,
doch qualitativ gehaltvoller Musik in den angewandten
Genres der Vokal-, Bühnen- und Filmmusik den Zustand zu
beseitigen, den er als musikalischen Analphabetismus an­
prangerte. Insofern Eisler die Funktionsbestimmung nicht
mehr nur für eine einzelne Gesellschaftsschicht vornahm,
sondern eine ästhetisch-politische Erziehungsarbeit für
das ganze Volk leisten wollte, handelt es sich beim Kon­
zept der - zumal auch in den Medien - "angewandten Musik"
um eine populistische Variante der "mittleren Musik".
Über die dabei erforderliche Selbstbescheidung als Künst­
ler scheint er sich im ganzen keiner Täuschung hingegeben
zu haben; umso mehr wuchs gegen Ende seines Lebens die
Verbitterung, als er erkennen mußte, daß sein Kampf gegen
die musikalische Dummheit auch in der DDR ohne breiten
Erfolg blieb.
Dem letzten, kurz vor seinem Tode (1962) abgeschlossenen
Werk, einem Gesangszyklus für Bariton und Streichorchester
nach Texten verschiedener Dichter, gab Eisler - in eigen­
tümlicher Parallele zu Brahms - die Überschrift "Ernste
Gesänge". Ein Hölderlin-Epigramm, in einem Vorspiel prä­
sentiert, wird dem Werk zum Motto: "Viele versuchten um­
sonst, das Freudigste freudig zu sagen,/Hier spricht end­
lich es mir, hier in der Trauer sich aus". Man wird darin,
nicht anders als in einigen Spätwerken Schostakowitschs,
die melancholische Antwort eines Sozialisten auf die im
8
Ders., Zehn Jahre DDR, in: Neues Deutschland,
Günter Mayer: Weltbild-Notenbild, S.294
7.1o.l959, Zit. nach
93
Zeichen des Sozialistischen Realismus verordnete Pflicht
zu uneingeschränkter Affirmation der Kunst erblicken dür­
fen. Seiner pragmatischen, keinem Autonomiedenken ver­
pflichteten Arbeitsweise entsprechend griff Eisler größten­
teils auf frühere, zum Teil gar aus der Exilzeit stammende
Lieder zurück. Der entstehungsgeschichtlichen Hetero­
genität des Zyklus steht aber die stilistische nicht nach:
Die "Ernsten Gesänge" stellen in der Vielfalt der herangezogenen Vokaltypen eine Art Summe Eislers dar. Anfangs­
und Schlußgesang ("Asyl" nach Hölderlin bzw. "Epilog"
nach Stefan Hermlin) belegen eine enge Verbundenheit
mit der Tradition der Kunstmusik - dieser bezeugt eine
Brahms-, j ener eine Bach-Rezeption -, und in beiden Fäl­
len ist sie unmittelbarer als bei den anderen Meistern
der Wiener Schule greifbar, so daß die Gefahr der Epigonalität aufscheint. Der fünfte Gesang ("XX. Parteitag"
nach einem Gedicht von Helmut Richter) - der Text gibt
den mit der Entstalinisierung verknüpften Hoffnungen Aus­
druck ("Leben, ohne Angst zu haben") - ist in seiner
Schlichtheit die lyrische Transformation eines Massen­
liedes , wobei der Marschtypus in einem 3/4-Takt aufge­
hoben erscheint. Gegen die hier verwendete Diatonik kon­
trastiert scharf die dichte Chromatik der übrigen Ge­
sänge , die, wenn sie auch nicht strikt der einfachen Eislerschen Zwölftontechnik folgen, dennoch von der Erfah­
rung der Dodekaphonie zehren - auch in ästhetischer Hin­
sicht . Wie Eisler bei anderen Gesängen des Zyklus und
insgesamt in seinem Vokalschaffen, statt integrale Dich­
tungen zu vertonen, die Texte eigenständig montierte,
komponierte er auch beim dritten Gesang ("Verzweiflung")
nur einen Ausschnitt aus Giacomo Leopardis Gedicht "A
se stesso". Höhepunkt der Negativität, lautet der Text;
"Nichts g ibt's , was würdig wäre deiner Bemühungen, und
keinen Seufzer verdient die Erde. Schmerz und Langeweile
sind unser Los und Schmutz die Welt, nichts anderes, be­
ruhige dich."
Zwischen Streichersatz und Singstimme besteht ein Span­
nungsverhältnis, wie es für Eislers Vokalkomposition
charakteristisch ist. Ein chromatisch aufgewühltes Vor­
spiel und Clusterbewegungen der Streicher sind hier aller­
dings kein Beispiel des vielberufenen "dramaturgischen
Kontrapunkts" der Musik zum Text bzw. Bild^, sondern fas­
sen den Textinhalt - Verzweiflung - nach Maßgabe tradi­
tioneller Prinzipien musikalischen Ausdrucks. Die Sing­
stimme beteiligt sich jedoch nicht an dieser Ausdrucks­
dimension . In reinem c-Moll gehalten, trägt sie den Text
vielmehr referierend - aus Distanz - vor und macht dadurch
die Situation der Verzweiflung als eine veränderbare,
nicht als unaufhaltsames, höheres Geschick erfahrbar.
94
In der Komposition ist somit der für die konzertmäßige
Vokalmusik charakteristische Vortragsstil vorgezeichnet,
den Eisler im Vorwort zu den "Ernsten Gesängen" wie folgt
umreißt:
"Der Sänger möge sich bemühen, durchweg freundlich,
höflich und leicht zu singen. Es kommt nicht auf sein
Innenleben an, sondern er möge sich bemühen, den Hö­
rern die Inhalte eher zu referieren als auszudrücken.
Dabei muß künstliche Kälte, falsche Obj ektivität, Ausdruckslosigkeit vermieden werden, denn auf den Sänger
kommt es schließlich a n „"
In den Gesprächen mit dem Literaturwissenschaftler Hans
Bunge hat Eisler gegen Ende seines Lebens die Möglichkeit
angedeutet, daß die Einschränkung des Kunstanspruchs durch
eine bloß "angewandte", also nicht mehr selbständig-freie
Musik in einer entwickelteren Phase des Sozialismus wieder
aufgehoben werden könnel°. Der Gedanke einer "Zurücknahme
der Zurücknahme" (Günter Mayer) nach einer "Übergangs­
periode " wurde allerdings zu spät gefaßt, als daß er bei
ihm selbst noch hätte kompositorisch wirksam werden kön­
nen „ Wenige Jahre nach seinem Tode j edoch wurde er von
9 Theodor W.Adorno - Hanns Eisler, Komposition für den Film. Text­
kritische Ausgabe von Eberhardt Klemm (=Harms Eisler: Gesammelte
Werke, Serie III, Band 4) Leipzig 1977, S.62f. Zu den "Ernsten
Gesängen" vgl. u.a. Karoly Csipäk, Probleme der Volkstümlichkeit
bei Hanns Eisler (--Berliner Musikwissenschatliehe Arbeiten, hg.
v. C.Dahlhaus und R.Stephan, Band 11), München-Salzburg 1975,
S .224f.;Albrecht Betz, Hanns Eisler. Musik einer Zeit, die sich
eben bildet, München 1976, S .2o6f.; Manfred Grabs, "Wir, so gut
es gelang, haben das Unsre getan" - Zur Aussage der HölderlinVertonungen Hanns Eislers, in: Beiträge zur Musikwissenschaft
15.Jg. (1973), S.49-6o, und ders., Hanns Eisler - Werk und Edition.
Eine Dokumentation (=Arbeitshe£te der Akademie der Künste der Deut­
schen Demokratischen Republik. Forum: Musik in der DDR, Heft 28),
Berlin 1978, S .48f., sowie Facsimilia 4o und 41. Die Dokumentation
von Manfred Grabs bietet Grundlegendes zu der Ausgabe der "Gesam­
melten Werke" Hanns Eislers, die, von der Akademie der Künste der
DDR betreut, im VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig erscheint.
Io Hanns Eisler, Gespräche mit Hans Bunge. Fragen Sie mehr über Brecht.
Übertragen und erläutert von H.Bunge (H.Eisler, Gesammelte Werke,
Serie III, Band 7), Leipzig 1975, S. 238. Dazu G.Mayer, a.a.O.,
S.316f.
einer jungen Komponistengeneration auf eine Weise voll­
zogen, die den historischen Irrtum von Eislers popu­
listischem Erziehungsprogramm offenbart. Indem man sich
nämlich mit der weiterbestehenden Spaltung der Musik­
kultur in divergierende Teilbereiche abfand, wurde eine
der Voraussetzungen dafür geschaffen, daß auch in der DDR
eine Neue Musik sich entfalten und internationalen An­
schluß finden konnte. Die Eisler-Rezeption spielte hier­
bei freilich nur eine begrenzte Rolle. Eisler war und
blieb teilweise modellhaft für die Genres der angewandten
Musik, seine Schriften und Gespräche erlangten - zumal
in Günter Mayers Rekonstruktion und Ausdifferenzierringt
grundlegende Bedeutung für eine marxistische Theorie der
Musik; kompositionsgeschichtlich hingegen blieb sein Oeuvre
für die Entwicklung der Neuen Musik in der DDR ohne Belang.
Als der offizielle Bann gegen die Schönberg-Schule aufge­
hoben wurde, konnten Komponisten wie Friedrich Goldmann
und Siegfried Matthus sich direkt mit Schönberg, Berg und
der westlichen Avantgarde auseinandersetzen und brauchten
- etwa zur Aneignung der Reihentechnik - nicht den Weg
über Eisler zu nehmen, der ein Umweg gewesen wäre. Darin
eine Tragik erblicken zu wollen, vertrüge sich schlecht
mit Eislers aufklärerischer Physiognomie. Einesteils
rächte sich hier seine pauschale Diffamierung der west­
lichen Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg, womit er,
denkt man an Hindemith und Honegger, unter den Vertretern
seiner Altersgeneration im übrigen nicht allein stand.
Andernteils erfolgte der entscheidende Wandel der EislerRezeption in der DDR - die Rehabilitierung des atonalen
und dodekaphonen Oeuvre -, trotz eines ausgezeichneten
Aufsatzes von Eberhardt Klemm aus dem Jahre 1 9 6 4 J-2 zu
11 Günter Mayers Arbeiten zur Kategorie des musikalischen Materials
bei Hanns Eisler, die ~ im Zusammenhang mit Mayers Dissertation
entstanden - seit 1966 veröffentlicht wurden, sind bibliographiert und zu wichtigen Teilen publiziert im zitierten Band
Mayers: Weltbild-Notenbild, S.93-348. V gl. jüngst außerdem Käroly
Csipäk, Was heißt "Dummheit in der Musik"? Überlegungen zu Hanns
Eislers Musikdenken, in: Notizbuch 5/6, hg. v. R.Kapp, BerlinWien 1982, S.175-2oo
12 Eberhardt Klemm, Bemerkungen zur Zwölftontechnik bei Eisler und
Schönberg, in: Sinn und Form 16.Jg. (1964), S .771-784
96
spät - offiziell nämlich nach 1970^3
ais daß die Eislersche Zwölftontechnik wenigstens im Sinne einer Zwischen­
stufe der Aneignung für die jüngeren Komponisten noch
hätte von Interesse sein können.
III. Die Eisler-Rezeption in Westeuropa
In einer auffällig koinzidierenden Gegenläufigkeit, die
möglicherweise mit dem Beginn der Entspannungspolitik in
der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zusammenhängt, ent­
brannte zu der Zeit, als in der DDR eine Neue Musik unter
Abkehr vom Eislerschen Konzept der "angewandten Musik"
ihren Aufschwung nahm, in Westeuropa - zumal in den deutsch­
sprachigen Ländern und in Italien - das Interesse an Eisler
unter Abkehr vom Avantgardekonzept der Neuen Musik. Wurde
Eisler dort - sei es als Komponist der Arbeiterklasse,
sei es gesamthaft als kulturelles Erbe - tendenziell zum
Klassiker neutralisiert, so wurde er hier plötzlich zu
einer Symbolfigur, an der sich heftige Diskussionen um
Autonomiecharakter und Funktionsgebundenheit von Musik
entzündeten. Die Dynamik der westlichen Eisler-Rezeption
aber resultierte aus dem Zusammentreffen musikalisch-in­
terner und externer Voraussetzungen.
Die wichtigste interne Voraussetzung lag in einer Krise
der Avantgardemusik, die spätestens gegen 197o offenbar
wurde. Das aus der "Philosophie der neuen Musik" herge­
leitete Theorem einer geschichtlichen Tendenz des musi­
kalischen Materials, die ein Komponist unter Beachtung
eines wachsenden Kanons des Verbotenen zu vollstrecken
habe, hatte damals seine musikhistorische Tragweite er­
schöpft und zu einer aporetisehen Situation geführt. Ge.
genüber regressionsverdächtigen Lösungen wie Stockhausens
Wende zu einer Intuitiven Musik ("Aus den sieben Tagen"
1968) oder dem Collagieren von Musikzitaten (z.B. E3e.ri.os
"Sinfonia" 1968/69) bot der Ansatz, für den Eisler ein­
stand, einen entscheidenden Vorzug: Das Avantgardekonzept.,
das - im Gegensatz zu heute - um 197o noch attraktiv er­
schien, brauchte nicht preisgegeben, sondern lediglich
13 Dazu insbesondere die Beiträge in: Hanns Eisler heute. Berichte Probleme - Beobachtungen (=Schriftenreihe des Präsidiums der Aka­
demie der Künste der DDR, Forums Musik in der DDR. Arbeitsheft
19), Berlin 1974
97
modifiziert zu werden, ja man zielte, indem man eine mu­
sikalische Avantgardeposition mit einer politischen ver­
schränkte, geradezu auf eine Potenzierung der Idee von
Avantgarde. Die Modifikation des musikalischen Avantgarde­
konzeptes bestand darin, daß eine - von der skizzierten
Krise im allgemeinen und von der politischen Zwecksetzung
im besonderen geforderte - Vereinfachung des musikalischen
Materials postuliert, gleichzeitig aber der Anspruch auf
ästhetische Fortschrittlichkeit bekräftigt wurde durch
die Unterstellung avancierter Kompositions v e r f a h ­
r e n . Für die Kritik am Theorem einer geschichtlichen
Tendenz des musikalischen Materials gewann folgende Pas­
sage aus "Komposition für den Film" (1944 abgeschlossen)
ausschlaggebende Bedeutung: "Trügt jedoch nicht alles,
dann hat die Musik heute eine Phase erreicht, in der Ma­
terial und Verfahrensweise auseinandertreten, und zwar
in dem Sinn, daß das Material gegenüber der Verfahrens­
weise relativ gleichgültig w ird... Die Kompositionsweise
ist so konsequent geworden, daß sie nicht länger mehr die
Konsequenz aus ihrem Material sein mu ß , sondern daß sie
gleichsam jedes Material sich unterwerfen kann"14. Als im
Sommer 1969 Adornos Mitautorschaft an dem zuvor nur unter
Eislers Namen veröffentlichten Buch bekannt wurdet, war
die Bahn der Wirkungsgeschichte zumal dieser Passage be­
reits vorgezeichnet: gegen Adorno und nicht im Sinne ei­
ner Ausdifferenzierung seiner Theorie. Dies, obgleich in
der "Philosophie der neuen Musik" mit Blick auf Schönbergs
Spätwerk von einer "Vergleichgültigung des Materials" die
Rede ist 16 und die Theorie des Neoklassizismus, freilich
pejorativ gefärbt, im formalistischen Sinn einer Verfrem­
dung historischen Musikmaterials zu einem modernen Sprach-
14 Komposition für den Film, a.a.O., S.125. Die spätere Passage "Im
Prinzip gebührt dem wirklich neuen musikalischen Material der
Vorrang..." (a.a.O., S.126) wurde demgegenüber weniger beachtet.
15 Durch die von Adorno kurz vor seinem Tode veranlaßte Ausgabe des
ursprünglichen Textes beim Münchner Verlag Rogner & Bernhard.
Zur Quellenlage vgl. das mustergültige Vorwort Eberhardt Klemms
zu der Schrift in der Eisler-Gesamtausgabe, a.a.O., S.5f. Zum
Verhältnis der beiden Autoren zueinander vgl. vor allem Günter
Mayer, Adorno und Eisler, in: Adorno und die Musik, h g . v.
0.Kolleritsch (=Studien zur Wertungsforschung, Band 12), Graz
1979, S.133-155
16 Theodor W.Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt 1958,
S .115f.
98
gefüge gleichfalls in eine verwandte Richtung zielt. Ins­
besondere Günter Mayers Arbeiten zur Dialektik des musi­
kalischen Materials, die zum Teil noch von einer irrtüm­
lichen Quellensituation ausgingen, haben die Diskussion
zu einer Auseinandersetzung um Eisler gestempelt und dazu
verholfen, das für die Filmmusik entworfene Theorem der­
gestalt zu verallgemeinern, daß sich das (zur Erreichung
breiter Hörerkreise unerläßliche) bekannte oder "ver­
brauchte" Material insgesamt durch avancierte Kompositionsverfahren zu einer neuen, ästhetisch anspruchsvollen
Musik gestalten lasse, die politische Zweckbestimmung al­
so nicht durch eine regressive Ästhetik, die die Musik
zum bloßen Transportmittel politischer Inhalte verkommen
läßt, erkauft werden müsse.
Ihre externe Voraussetzung hatte die westeuropäische
Eisler-Rezeption in der Politisierung der Studentenschaft
zur Zeit des Vietnam-Kriegs, als Probleme des Marxismus
die Theoriediskussion beherrschten und der Wunsch nach
einer reformerisehen bzw. revolutionären Veränderung der
kapitalistischen Industriegesellschaft virulent war. Nach
dem sich die Neue Musik nach 195o im Rahmen einer festge­
fügten , spezialisierten Teilkultur entwickelt hatte, in
der Künstler mit sozialen Intentionen wie Luigi Nono be­
argwöhnt oder mißachtet wurden, sahen sich die Kompo­
nisten plötzlich und dringlich mit der Frage konfrontiert
"Für wen komponieren Sie eigentlich?" (Hans Jörg Paulil7)
Fragen nach der gesellschaftlichen Funktion von Musik,
ihrer sozialen' Nützlichkeit, der Praxisrelevanz von Theo­
rie waren aufgeworfen und zeitigten fruchtbare Auseinan­
dersetzungen, in deren Verlauf auch der Konservatismus
zur Reflexion seiner Position gezwungen war. Was lag da
näher - jedenfalls in den deutschsprachigen Ländern - als
ein Rekurs auf den Marxisten Eisler, der sein komposi­
torisches, theoretisches, organisatorisches und pädago­
gisches Schaffen in den Dienst des Sozialismus gestellt:
hatte und der, Schönberg-Schüler und freundschaftlicher
Antipode Adornos, bei der Wende von der Kritischen Theo­
rie zum Marxismus eine Kontinuität des musikalischen und
soziologischen Denkens gestattete?
Für die musikalische Praxis entscheidend erwies sich
Eislers Schaffen als Chorkomponist. Da auf dem Gebiet der
17 So der Titel einer Sammlung von Gesprächen, die Pauli mit 6 Kom­
ponisten der Neuen Musik führte (Frankfurt am Main 1971) .
99
Musik die Kritik am Bestehenden zentral auf die Institu­
tionen des Konzert- und Opernbetriebs zielte, deren bür­
gerlicher Sozialcharakter bekämpft wurde, erblickte man,
um den Anspruch auf Gegenkultur institutioneil einzu­
lösen , im Chorgesang eine Organisationsform, die es ge­
statten sollte, gleichzeitig - durchaus Eislers ursprüng­
licher Intention gemäß - musikalische und politische Ar­
beit zu leisten. Die studentische Aneignung Eislers er­
folgte also nicht - jedenfalls nicht primär - innerhalb
der etablierten Chorkultur, etwa der sozialdemokratischen,
sondern mittels programmatischer Neugründungen, die über manche Wandlungen hinweg - zumeist bis heute Bestand
haben. Besonders intensiv widmeten - und widmen - sich
der Eisler-Pflege, zum Teil auch in theoretischer Hinsicht,
der "Hanns-Eisler-Chor" Westberlin, der "Ernst-Busch-Chor"
Kiel, der "Bert-Brecht-Chor" Essen und der Chor "Kultur
und Volk" Zürich, während andere Chorvereinigungen wie
der "Theodorakis-Chor" Tübingen oder "Die Zeitgenossen"
Bremen dem politischen Folkloregesang breiten Platz ein^
räumen. Welchen Umfang diese neue Chorkultur in der B u n ­
desrepublik inzwischen erreicht hat - auch durch Chöre
gewerkschaftlicher Provenienz wie die DGB-Chöre Kassel
und Hannover -, zeigte sich im September vergangenen Jah-.
res bei einem Chorfest in Recklinghausen, wo sich über
fünfzig politisch engagierte Chöre einfanden^ 8 . Der erste
Überschwang, in dem eine neue musikalische Welt entdeckt
wurde, trug zunächst über Unstimmigkeiten hinweg. Indem
Geschichte rekonstruiert, Vergangenheit aufgearbeitet
wurde, erwies sich der Rückgriff auf vergessenes Altes
einmal mehr als Stimulus des Neuen.
Welche Probleme sich indessen dabei stellten, läßt, sich
am Beispiel des ersten der "Vier Stücke für gemischten
Chor" opus .13 aus dem Jahre .1927 einsichtig machen. Im
"Vorspruch" - so seine Überschrift - hat. Eisler den Bruch
auskomponiert, der seine revolutionären Arbeiterchöre von
dem bürgerlichen und sozialdemokratischen Chorwesen ab­
heben sollte. Das "Chor-Referat", wie der- Untertitel des
Stücks lautet, soll laut seinen Angaben die Folge "Intro­
duktion, Tema con 3 variazioni, Coda" ausprägen, doch
bleibt dieser musikalische Formplan fiktiv und ist, wie
18 Von den zahlreichen weiteren Veranstaltungen im In- und Ausland,
in denen Eislers Werk, im Zentrum stand, sei hier wenigstens das
vom Tübinger Club Voltaire 1977 organisierte Festival erwähnt.
1 OO
Luca Lombardi erkannte, Teil der parodistischen Inten­
t i o n ^ _ Auf die Ankündigung in der Introduktion, es werde
heute von etwas anderem als dem üblichen gesungen, folgen
knappe musikalische Parodien beliebter Chortypen wie Re­
ligiöse Stimmung ("Die Kirchenglocken"), Naturlieder ("Der
grüne, grüne Wald") und Liebeslieder ("Das schönste Mäd­
chen der Welt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten") sie werden von einem Sprecher ausgerufen und damit im vor­
aus als Klischees denunziert -; die Erklärung: "Das h e i ß t :
sich abwenden von der Wirklichkeit.. ." leitet dann über
zur Quintessenz der Eislerschen Kampfmusik: "Auch unser
Singen muß ein Kämpfen sein!", worauf die - musikalisch
auf die Introduktion zurückgreifende - Coda m i t einem Textund Musikzitat der "Internationale" das Stück beschließt.
Die HauptSchwierigkeit der Eisler-Rezeption nach 197o be­
stand in der Frage, ob und inwiefern sich historisches
und aktuelles Interesse zur Deckung würden bringen lassen
und aus den Bemühungen um eine Wiederentdeckung der Kampf­
musik aus der Zeit der Weimarer Republik eine ästhetisch
und politisch tragfähige Gegenkultur heute erwachsen könnte.
Bezog die Aufforderung zum revolutionären Traditionsbruch
im "Vorspruch" aus opus 13 ihre Sprengkraft seinerzeit
aus einer Situation der Arbeitersängerbewegung, die poli­
tisch und musikalisch zu realisieren erlaubte, was im Chor­
stück programmatisch entworfen ist, so blieb dieser Aufruf
nach 197o, da in Westeuropa keine revolutionären Arbeiter­
bewegungen bestehen und auch das Arbeitergesangwesen ein
anderes geworden ist, abstrakt. Solange sich die vorwie­
gend studentisch besetzten Chöre des Umstands bewußt blie­
ben, daß Eislers proletarische Chormusik sich heute nur
im Sinne einer Dokumentation historischer Vergangenhe5.it
aufführen läßt, konnten sie auf ästhetisches Gelingen hof.
fen - freilich unter Preisgabe des Anspruchs auf Gegenkul.
tur, denn nun bestand kein prinzipieller Unterschied mehr
zu dem als "museal" charakterisierten bürgerlichen Musik­
betrieb. Wo immer man jedoch dem Irrtum verfiel, Eislers
Musik ließe sich umstandslos aktualisieren, da entpuppte
sich der politische Anspruch rasch als illusionär.
19 In der bedeutenden Abhandlung "II contributo di Hanns Eisler
all'elaborazione di una estetica e poetica musicale marxista",
die Luca Lombardi seiner italienischen Edition ausgewählter
Schriften Eislers voranstellte. Hanns Eisler, Musica della rivoluzione» hg. v. L.Lombardi, Milano 1978, S .59
1o1
Der Zwiespalt zwischen historischen und aktuellen Inter­
essen stand übrigens auch im Hintergrund der Auseinander­
setzungen, in denen sich linke Gruppen in den siebziger
Jahren um die Legitimität der Eisler-Rezeption stritten„
Vertreter der maoistischen KPD polemisierten gegen die
"revisionistische" Kurskorrektur der DDR, nunmehr statt
des Massenliederkomponisten den g a n z e n
Eisler zu
würdigen, und drängten zugunsten einer politisch-revo­
lutionären Zweckbestimmung musikalisch-ästhetische Aspek­
te völlig zurück, indem sie politisch opportune Neu­
textierungen Eislerscher Lieder forderten und anderer­
seits das Oeuvre der Exilperiode für gegenwärtig bedeu­
tungslos e r k l ä r e n ^ 0 . Umgekehrt hielten Exponenten der DDR
und ihr nahestehende Gruppen in der Bundesrepublik und
Westberlin mit ihrer Kritik an den sogenannten "Links­
sektierern" und "Chaoten” nicht zurück und plädierten da­
für, bei der Beurteilung des Aktualitätsbezugs der EislerRezeption das historische Interesse nicht zu unterschla­
gen^ „
Um den Reiz des Neuent.deckten vor musealem Staub zu be­
wahren , mußte - und dies stand von vorneherein fest - die
Aufarbeitung des Eislerschen Oeuvre durch neukomponierte
Musik ergänzt werden. Konzentrierte man sich wie etwa Luca
Lombardi, der die Eisler-Rezeption in Italien maßgeblich
gefördert hat22, darauf, den theoretischen Ansatz Eislers
- unabhängig von seinem Stil - auf die Gegenwart zu über­
tragen , so sah man sich mit den allgemeinen Chancen und
Schwierigkeiten politisch engagierter Musik heute konfron­
tiert, die an dieser Stelle nicht erneut erörtert zu wer-
20 Vgl. insbesondere die Beiträge im Heft 2o/21 "Hanns Eisler, Musik
im Klassenkampf" der Sozialistischen Zeitschrift für Kunst und
Gesellschaft vom November 1973. Eine mildere Kritik jüngst von
Frieder Reininghaus, Die Kunst zu erben. Anmerkungen zu Hanns
Eisler, außer der Reihe, in: Neue Zeitschrift für Musik, 143. Jg.
(1982) Nr.11, S.4-8
21 Hierzu einschlägige Beiträge in dem Arbeitsheft "Hanns Eisler
heute", zitiert in Anmerkung 13, sowie in dem Eisler-Sonderband
der Zeitschrift Das Argument, zitiert in Anmerkung 2.
22 Zur Eisler-Rezeption in Italien vgl. Franco Fabbri, Eisler und
die italienische Linke, in: Musik und Gesellschaft 32, Jg. (1982),
S.539-542
den brauchen^. Lombardi arbeitete 1974 in jenem Autoren­
kollektiv mit, das mit der Szenischen Kantate "Streik bei
Mannesmann!" den Versuch unternahm, den Brecht-Eislersehen
Typ des Lehrstücks anläßlich des im Titel genannten Ereig­
nisses zu aktualisieren und die Musik als Waffe im poli­
tischen Kampf zu verwenden. Wirkt die in dieser Kantate
für erforderlich erachtete Zurücknahme der Musiksprache
zu größter Einfachheit in ihrem lehrhaften Gestus bereits
antiquiert, so eröffnen andere Kompositionen Lombardis,
zum Beispiel die "Tui-Gesänge" für Sopran und fünf Instrumentalisten nach Texten von Albrecht Betz aus dem Jahre
1977, künstlerisch anspruchsvollere Perspektiven für eine
engagierte Musik heute.
Der Schweizer Max E .Keller, um noch ein weiteres Beispiel
kompositorischer Eisler-Rezeption zu erwähnen, knüpfte
1976/77 in einem "Gegenlied zu 1Von der Freundlichkeit
der W e l t '" nach Bertolt Brecht für Singstimme und Gitarre
unmittelbar an den Eislerschen Kampfliedtypus an, betrach­
tet j edoch selber diesen Versuch als eine kaum gelungene
" F i n g e r ü b u n g " 24 beim Bemühen um eine zeitgenössische Volks­
tümlichkeit . Offenbart das schlichte Lied die Epigonalitätsgefahr, die j edem stilistischen Anschluß an Eisler
droht, so machen andererseits die "Gesänge II", die Keller
nach Gedichten von Erich Fried 1977 für Sopran und Instru­
mentalensemble schrieb (es handelt sich um eine Vertonung
des Abschnitts "Verhaltensmuster" aus Frieds Sammlung "Die
Beine der g r o ß e m Lügen"), deutlich, wie eine Eisler-Re­
zeption heute fruchtbar werden kann: Die Musik wird gleich­
sam gespalten in eine leicht faßliche Gesangsschicht, wel­
che die Textverständlichkeit garantiert und damit die Mög­
lichkeit einer politischen Wirkung begründet, und in eine
musiksprachlich avancierte Instrumentalschicht, die einen
ästhetischen Avantgardeanspruch einlöst. So endigt. "Gegen­
beweis", das erste Lied des Fried-Zyklus, mit Achtelrepe-
23 V g l . vor allem die Aufsätze von Carl Dahlhaus, Thesen über en­
gagierte Musik, sowie: Politische und ästhetische Kriterien der
Kompositionskritik, beide wieder abgedruckt im Samrnelband Schön­
berg und andere, Mainz 1978, S„3o4-313 bzw. S.314-326, und die
teilweise polemische Diskussion, die sich in mehreren der oben
genannten Publikationen daran anschloß.
24 In einem Brief an den Verfasser vom 3o.Januar 1983. Zur Urauf­
führung von Kellers "Gesänge II" vgl. den Bericht von Toni Haefeli
in der Schweizerischen Musikzeitung 118. Jg. (1978), S .168f.
103
titionen im Klavier, welche die Tradition der Eislerschen
Marschmusik lediglich subtil andeuten, ohne diese kollek­
tive Handlungsform appellhaft zu propagieren.
Und Eisler heute? Der sich 1926 von der damaligen Moderne
lossagte, spielt keine Rolle für die Kunstmusik der gegen­
wärtigen Postmoderne. Ihre Vertreter pflegen die tradier­
ten Gattungen von Oper und Konzertmusik und lehnen jeg­
liche Verquickung von Musik mit Politik strikt ab. Selbst
bei ihren Bestrebungen zu einer einfacher strukturierten
Musiksprache und neuen Möglichkeiten der Konsonanzbehand­
lung bleibt Eislers Zwölftontechnik, deren Einfachheit
aus dem Willen zur Kontrolle einer konsonanzfähigen Har­
monik resultiert, ausgeklammert - wohl auch deshalb, weil
Eislers nüchtern-aufklärerische Ästhetik dem Ideal einer
neuen Ausdrucksmusik im Lichte Mahlers und Bergs diametral
entgegensteht. Für die politische Musik andererseits, die
sich in der Friedensbewegung artikuliert, scheint Eisler
gleichfalls recht bedeutungslos zu sein. Der Seriosität
dieses Komponisten, der die Erbschaft der Schönberg-Schule
selten preisgab und der in der revolutionären Arbeiterbe­
wegung seine politische Heimat fand, begegnet man dort,
wo die Gunst Liedermachern und nicht Komponisten gilt,
aus ästhetischen und politischen Gründen mit unverhohlener
Skepsis, wenn nicht mit offener Feindseligkeit^ Gerade
die Tatsache aber, daß die Eisler-Rezeption, dem Spannungs­
feld unmittelbarer Aktualität enthoben, dennoch vielfach
lebendig bleibt, eröffnet - wie eingangs angedeutet - die
Chance für ein tieferes Verständnis seiner Musik als poli.
tisch engagierter Kunst, so daß großartige Werke wie die
im Exil komponierte Dritte Klaviersonate endlich den ver.
dienten Eingang ins Repertoire finden könnten.
25 V g l . die Rezension einer Schallplatte des Berliner Hanns EislerChors ("Ohne Angst leben" von Hartmut Fladt) durch Joachim Deicke
in: Zitty Nr.25, 1982, S.63
Friedrich Hommel
AUS DER FRÜHZEIT DER KRANICHSTEINER FERIENKURSE FRAGESTELLUNGEN, ÜBERLEGUNGEN, FOLGERUNGEN ZUR SITUATION
DER NEUEN MUSIK. EIN EXKURS
Auf die Gefahr hin, daß das für einen Werbetrick gehal­
ten wgrden könnte, möchte ich im Zusammenhang meines und Ihres - Themas auf die in einem Mainzer Verlag erschei­
nende Schriftenreihe*hinweisen, die das Internationale
Musikinstitut Darmstadt seit dem Jahr 1958 herausgibt,
und zwar speziell auf das erste Heft. Es enthält in kurz­
gefaßter Form eine offizielle Chronik der ersten 12 Inter­
nationalen Ferienkurse für Neue Musik - auch heute noch
verschiedentlich unter dem Namen "Kranichsteiner Kurse"
zitiert, obwohl nur die ersten drei dieser Kurse tatsäch­
lich im Schloß Kranichstein stattgefunden haben -, und
der Anlaß des Jubiläums scheint zunächst einmal die runde
Zahl 12 gewesen zu sein.
Ein Vorwort des Herausgebers Wolfgang Steinecke, der 1946
die Kurse und 1948 das Kranichsteiner Musikinstitut, das
heutige "Internationale Musikinstitut Darmstadt", initiiert
hatte, findet sich nicht, aber er kommentiert ein voraus­
gestelltes unveröffentlichtes Fragment Schönbergs, spricht
von den Gefahren der Fixierung, "wo alles im Fluß ist",
und von der Hoffnung, "daß zwischen den Zeilen dieses Bu­
ches ... das Geheimnis der schöpferischen Entwicklung"
spürbar bleibe, "welche die Vergangenheit vergessen muß
und die Zukunft nicht erraten darf, um sich der Gegenwart
in treuster Pflichterfüllung zu widmen". Den Beiträgen
ferner vorangestellt ist die Einleitung eines Kranich­
steiner Vortragszyklus von Theodor W.Adorno (Eduard Steuer.
mann gewidmet) ,* dem Text sind Porträtaufnahmen Schönbergs
und Adornos beigegeben. Alles das, auch das für Steinecke
ganz ungewohnte hohe Pathos der Rede, läßt auf einen be­
sonderen historischen Anlaß schließen.
Mancher wird sich daran erinnern, daß Gertrud Schönberg
und Helene Berg bei diesen 12 Kursen zugegen waren, und
daß zu den Mitwirkenden Hermann Scherchen zählte, daß Nono
über Schönbergs Kompositionstechnik sprach, Pousseur wie Scherchen - über Webern, daß Maderna und Travis mit
einem Dresdener Ensemble Programme zum Thema "Webern und
die junge Generation" leiteten (Boulez hielt seinen be­
rühmten Vortrag "Alea"). Und trotz Stockhausens Urauffüh­
rung von Klavierstück XI, trotz einer größeren Zahl erst­
mals neu in Erscheinung tretender Namen - darunter Brown,
1o 5
Cardew und Clementi - wird klar, daß die ganze Veranstal­
tung auf ein geheimes Konzept hin angelegt war, das
nirgends explizit benannt wurde: auf ein Schönberg-Fest,
auf eine Festveranstaltung zum Thema Schönberg und seine
Schule, Schönberg und die Folgen, Schönberg und die jün­
gere Generation. Man sieht heute leicht darüber hinweg,
daß der grüne Einband des Hefts zudem in schwungvoller
Handschrift als Signet das Quartenthema aus Schönbergs
KammerSymphonie trägt, nach Steineckes Worten "das früheste
Signal der Neuen Musik des 2o. Jahrhunderts", Fanfare für
den "Ausbruch aus dem Reich der Tonalität".
Wie reimt sich das alles zusammen? War Steineckes Darm­
stadt , im Rückblick auf die ersten zwölf Jahre, das Darm­
stadt Schönbergs mit der großen Zahl deutscher und selbst
europäischer Schönberg-Erstaufführungen? Das Darmstadt
Adornos, Steuermanns, Kolischs, Scherchens? Die Hochburg
der öffentlich ja immer noch schwer verdaulichen "Dodekaphonie"? Steinecke sprach wenig später bereits vom Eintritt
in die "postserielle" Phase, nachdem er - in einem Zagreber Vortrag - nicht gezögert hatte, den Begriff der
"Darmstädter Schule" mit dem der "Seriellen Musik" gleich­
zusetzen. Nochmals also die Frage: war dieses SchönbergFest anno 1957, am Eintritt in die spät- und postserielle
Phase, ein Rückzug in die Hochburg? Ein Sammeln auf soli­
dem Grund? Oder ein Abschied?
Ich nehme hier einmal vorweg, was die offizielle Chronik
- diese so wenig wie die späteren - nicht erkennen läßt:
es war ein Abschied wider Willen, malgre lui; und ich er­
laube mir, skizzenhaft und in kurzen Zügen, anhand von
weniger bekannten Details, die Ansicht zu vertreten, daß
es sich hier nicht um eine müßige historische Frage handelt.
Auch möchte ich Sie um Verständnis dafür bitten, daß mir
dabei vor allem die Frage der Tragfähigkeit der Institu­
tion wichtig ist: worauf ist diese Einrichtung Darmstädter
Ferienkurse, worauf ist diese Arbeit gegründet, zu der
auch Sie seit Jahren Ihren eigenen wichtigen Beitrag lei­
sten und der die Stadt Darmstadt ihren Traditionen ent­
sprechend unbeirrt seit vielen Jahren ihre Hilfe leiht.
Einrichtungen solcher Art - um es einmal so zu sagen
die das Unwahrscheinliche versuchen, müssen ständig "neu
begründet" werden, und das geht nicht ohne eine gewisse
diagnostische Wachsamkeit.
Nun verkenne ich zwar keineswegs die hilfreiche Funktion
freundlicher Legenden, derart etwa, als habe der nach
Kriegsende zweifellos zu konstatierende Nachholbedarf aus
unserem Land plötzlich das Dorado gemacht, in dem die neu­
en Künste nun besonders zu florieren sich anschickten.
Aber ein verläßlicherer Weg ist wohl in der Tat die stän­
106
dige Revision des Vorhandenen, solange es noch vorhanden
oder zur Hand ist. Hier möchte ich zwei Fußnoten zur Me­
thodik anbringen. Erstens: man muß natürlich nicht immer
gleich von "Revision", gar in irgendeinem arroganten Sinn,
sprechen, wenn mit zunehmender historischer Distanz Gegen­
stände aus dem Nebel der unmittelbaren Zeitgenossenschaft
mit leicht veränderten Profilen auftauchen. Und zweitens,
die Situation des Nachholbedarfs betreffend: gerade unsere
Kurse mit ihrer über alle Jahre gleich zahlreich geblie­
benen internationalen Teilnehmerschaft führen uns vor Au­
gen, wie breit gestreut, wenn auch nicht ungeheuer dicht
gesät, der Nachholbedarf, oder schlicht Bedarf, in allen
Ländern ist.
Es darf hier vielleicht einmal behauptet werden, daß die
eigentliche Geburtsstunde der Darmstädter Ferienkurse
nicht das Jahr 1946, sondern das Jahr 1948 war, als die
Stadt Darmstadt in alle Welt die Ankündigung ergehen ließ,
sie beabsichtige die Gründung einer Art Akademie, Ecole
Superieure (das Modell Bauhaus war nicht weit davon ent­
fernt) . Und daß j eder so Angesprochene, sei es In- oder
Ausländer, sich als eingeladen sehen konnte, ausersehen
für die Rolle als Lehrkraft, wenn nicht gar des Präsidenten.
(Wolfgang Steinecke übrigens hätte als Präsidenten gern
den in Frankreich geborenen Fred Hamei gesehen, einen Mann
mit britischem Paß, dem er selbst, schon vor dem Krieg,
als Journalist viel Förderung verdankte. Hamei war damals
für den Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg sowie als
Produktionsleiter der Deutschen Grammophongesellschaft tä­
tig und leitete die "Musica"-Redaktion. Er war es auch,
der Steinecke veranlaßt hatte, schon vor dem Krieg als
Korrespondent der Berliner Deutschen Allgemeinen Zeitung
den Wohnsitz im Südwesten - nämlich in Darmstadt - zu
nehmen).
In vieler Hinsicht trügt übrigens das Bild vom tragenden
Elan des Nachholbedarfs j ener ersten Nachkriegsjahre: Kaum
daß das Kranichsteiner Institut als Dauereinrichtung ge­
gründet war, im dritten Jahr der Ferienkurse, verlor es
durch Aufkündigung des Vertrags vonseiten der Vermieter
auch schon wieder seine Bleibe. Schon zuvor, am Tag nach
den Kursen von 1948, die wegen der Folgen der Währungs­
reform ums Haar hätten annulliert werden müssen, hatte
Steinecke wegen verwaltungsinterner Differenzen sein Amt
als städtischer Kulturreferent hingeworfen. Er ging zum
Journalismus zurück, behielt die Leitung des Instituts
ehrenamtlich, verlor aber im Schloß die eigene Wohnung
und stand binnen kurzem vor dem finanziellen Ruin; gesund­
heitlich war er ohnehin immer wieder zum Pausieren ge­
zwungen .
1o 7
Der Verlust des Schlosses Kranichstein traf Steinecke be­
sonders hart, da er es Schönberg als ständigen Wohnsitz
hatte anbieten lassen. Ich möchte nun keineswegs den dra­
matischen Verlauf j ener frühen Jahre im einzelnen nach­
zeichnen , mich vielmehr auf die Skizzierung der Rolle kon­
zentrieren , die Steinecke für Darmstadt speziell der Per­
son Schönbergs und seinem Werk zugedacht hatte« Eine Prä­
ferenz vom ersten Anbeginn an ist so wenig zu konstatieren,
wie es zutrifft, daß die Musikkurse Steineckes Hauptan1iegen bei Beginn seines Amtes als Kulturreferent der Stadt
gewesen seien: er hat sich mit Vehemenz der Gründung einer
Akademie neuen Typs für die Bildenden Künste, dem Musikschulaufbau und dem Volksbildungswesen gewidmet. Im April
1948 schrieb Rene Leibowitz an Steinecke: "... ich weiß,
wie sehr es ihn (Schönberg) kränkt, daß man seit Kriegs­
ende bis jetzt so wenig in Deutschland für seine Musik ge­
tan hat. Ich sehe aus Ihren Programmen, daß Komponisten
wie Hindemith und Strawins'ky eine viel größere Rolle spie­
len als Schönberg, der doch schließlich und endlich der
größte (deutsche) Komponist der Gegenwart ist...". (Einem
Hinweis von Leibowitz folgend, hat sich Steinecke im Jahr
darauf auch mit Adorno in Verbindung gesetzt, und es scheint
nicht ganz abwegig anzunehmen, daß auch die Darmstädter
Suche nach einem Gründungspräsidenten für die Kranichstei­
ner Akademie Adornos Rückkehr nach Frankfurt beflügelt
haben m a g .)
Eine der vielen Folgen der durch die Währungsreform ent­
standenen finanziellen Situation, die verstärkte und not­
wendige Kooperation mit den Rundfunkanstalten, zeigte in­
dessen auch ihre Kehrseite: in der Programmfrage der öf­
fentlichen Konzerte war Steinecke zu Kompromissen der ver­
schiedensten Art gezwungen. Persönlichkeiten vom Schlag
eines Heinrich Strobel vom Südwestfunk waren nicht zimper­
lich in der Frage des musikalischen Kanons; bald war es
Debussy, bald Strawinsky und Bartok, denen er den Vorrang
eingeräumt sehen wollte. Für den Fall einer Bevorzugung
der Zwölftonschule hatte Steinecke sogar- vonseiten des
"Melos" Ungnade zu gewärtigen. Noch 195o mußte ein "Zwölfton'kongreß" außerhalb des eigentlichen Kursprogramms stattfinden. Andererseits konnte gerade in dieser Zeit die Ver­
bindung mit der IGNM wiederaufgenommen werden; Steinecke
war der Schriftführer der neugegründeten Deutschen Sektion,
deren erster Präsident StuckenSchmidt wurde. Während er
ursprünglich an eine Neugründung des Allgemeinen Deutschen
Musikvereins gedacht und dabei Kontakte mit Joseph Haas
und Werner Egk gewonnen hatte, entzog er sich nun der Be­
einflussung , indem er die Zeit des Nachholbedarfs bald­
möglichst für beendet anzusehen geneigt war und mit Macht
seine neue Einrichtung der "Konzerte der jungen Generation"
1o8
ausbaute. Und auf die internen Querelen vor Ort reagierte
er, gestützt und gefördert durch den Oberbürgermeister
Ludwig Metzger, mit dem Entwurf größer dimensionierter, ja
utopisch erscheinender internationaler Projekte, wie der
Absicht, Schönberg für immer nach Darmstadt zu bringen.
Steinecke berief sich auf eine durch Josef Rufer vermit­
telte Nachricht, daß Schönberg in der Tat die bleibende
Rückkehr nach Europa erwog, nach Baden-Baden der Bäder
wegen oder nach Darmstadt der Musik wegen, wie zu erfahren
wa r . Leibowitz schloß von Anfang an zwar den Gedanken an
eine Kursteilnahme Schönbergs, wie sie für 1949, 195o und
schließlich für 1951 geplant wa r , aus und behielt damit
de facto recht. Aber der Briefwechsel Steineckes bezeugt
- und schildert eindringlich - den dreimal neu gefaßten
Vorsatz Schönbergs, nach Darmstadt zu kommen. "Ohne Zutun",
sagt Steinecke, sei Schönbergs Werk schon 1948 bei den
Kursen in den Mittelpunkt des Interesses geraten - trotz
Bartok und Strawinsky. Schönberg versprach zu kommen, "wenn
ich irgendwie kann", und "wenn der Plan gelingt": "Hoffent­
lich glückt alles" (1949).
Inzwischen war der Plan einer Wohnung Schönbergs in Schloß
Kranichstein zunichte gemacht, Steinecke selbst sah sich
schon den illustren Gast in einer Ausweich-Mansardenwohnung
empfangen. Aber er gibt nicht auf, lädt erneut ein, "falls
ich gesundheitlich noch einmal davonkomme". Seinen eigenen
Zustand beschreibt er Schönberg als "hochgradige nervöse
Erschöpfung". Schönberg selbst ist hin und her gerissen.
Er stimmt der .öffentlichein Ankündigung seiner Teilnahme
an den Kursen zu, sagt dann aber aus gesundheitlichen
Gründen ab. Das wiederholt sich 195o, Er schreibt: "Mein
Doktor und ein konsultierender Arzt 'können in meiner Kon­
stitution nichts Krankes finden, sodaß, wenn es wahr sein
sollte, ich eine gewisse Hoffnung habe, noch einiges Zeit
zu leben". Im Jahr darauf, 1951, dem Todesjahr Schönbergs,
häufen sich die Hindernisse. Es sind die Reisekosten für
die ganze Familie, Gerüchte von "Nazidemonstrationen" ge­
gen seine Werke, die Gesundheit, nicht zuletzt die ganze
"kriegerische Situation" - die auch einen Ernst Krenek
eine Zusage haben zurückziehen lassen? auch der junge Nono
wettert gegen die "Verbrecher" mit ihren Atombomben. Stei­
necke zeigt Galgenhumor.
Selbstverständlich waren die dreimal wiederholten Vorbe­
reitungen für Schönbergs Anwesenheit nicht ohne Einfluß
auf die Programme der Darmstädter Konzerte geblieben. Zu
den deutschen Erstaufführungen des Klavier- und Violin­
konzerts, des Streichtrios, des 4.Streichquartetts war
195o die des "Überlebenden aus Warschau" gekommen. Für
19 51 wurde, im Rahmen des Frankfurter IGNM-Festes, wieder
1o 9
unter Scherchens Leitung, die Uraufführung des "Tanzes
um das Goldene Kalb" aus "Moses und Aron" vorbereitet.
Aber kurz nach Erhalt der Nachricht von der triumphal auf­
genommenen Aufführung starb Schönberg, der wieder nicht
hatte kommen können. "Schönstes Gelingen wünschend" hatte
er sich auf dem letzten Briefgrüß von Steinecke verab­
schiedet .
Steinecke, nach dem Verlust einer Stellung bei der Essener
West-Ausgabe der "Welt" wieder einmal in Existenznöten,
gesundheitlich ruiniert, war wenige Monate vor den Kursen
im Streit um innerstädtische Kompetenzenregelungen, die
seinen engsten Mitarbeiter und auch das Darmstädter In­
stitut für Neue Musik und Musikerziehung betrafen, ent­
schlossen, nun auch sein Ehrenamt als Kursleiter zur Ver­
fügung zu stellen. Wieder einmal konnte erst in letzter
Minute die Fortarbeit gesichert werden. Aber dann, Anfang
1952, kehrte Steinecke nach über vierjähriger Abwesenheit
ganz und hauptamtlich nach Darmstadt zurück. Die Anwesen­
heit Gustaf Rudolf Sellners als neuer Intendant des Lan­
destheaters , dem Steinecke in einer musikdramaturgischen
Teilfunktion zugeordnet wurde, versprach neue Antriebe.
Die beiden kannten einander schon aus den Kriegsjahren.
Zum erstenmal konnte sich Steinecke (fast) ganz den Auf­
gaben des Kranichsteiner Instituts widmen. Das Todesj ahr
Schönbergs bildete die Zäsur.
Zäsur: Es ist hier einmal darauf hinzuweisen, daß im Jahr
.1951 ein Titel wie "Schönberg est mort" wohl zunächst ein­
mal das bedeutete, was er sagt: Schönberg ist tot. Ich
neige noch immer dazu, diesen Titel weniger metaphorisch
zu nehmen, mehr als lapidar.isches Kürzel für den Augen­
blick einer Zäsur. Der von Boulez erhobene Vorwurf des
Akademismus und des Mangels an Kühnheit, "gemessen ein
Schönbergs eigener Entdeckung", hätte damals schon das
Stichwort für die Diskussion um Schönbergs Spätwerk sein
können: vor nunmehr 3 2 Jahren. Und ich komme auf die hi­
storische Distanz zurück, den Abstand von einer Generation,
in dem sich der eine oder andere Zug verdeutlicht, sobald
die Nebel der Polemiken aus dem Fenster -gezogen sind oder
auszuziehen beginnen.
Man könnte einwenden, daß dieses ein neuer Nebel ist, der
über Steineckes Biographie gezogen wird, indem man eine,
seine, Schönberg-Chronologie über den Raster seiner Kurs­
arbeit breitet und dabei ihre Konturen entschärft. Wir
lassen es einmal dahingestellt sein, ob Steinecke spezi­
ell zu den Adressaten von Boulez 1 Aufsatz gehörte; ob
Boulez ihm mit seinem "Schönberg est mort" einen Spiegel
vorzuhalten beabsichtigte, der zugleich Trost bedeuten
sollte. Zwar schien es, als ob im folgenden Jahr 1952 mit
1 1o
Thematiken wie Strawinsky, Bartok, Dallapiccola dem Be­
dürfnis einer Nachholbedarfsbefriedigung wieder einmal
besonderer Raum gegeben werden sollte. Aber daneben gab
es natürlich Anlaß für ein Schönberg-Gedenken anhand ei­
ner Aufführung des "Pierrot lunaire". Und Schönberg be­
hauptete seinen Platz in den Programmen auch weiterhin.
So etwas war "noch nie der Fall", konnte Steinecke 1953
Gertrud Schönberg berichten, als der Andrang zu einem
Schönberg-Konzert den Saal der Marienhöhe überquellen
ließ .
In Steinecke reifte mehr und mehr der Plan, mit Hilfe des
Bundes, Landes und der Stadt Darmstadt ein Schönberg-Nachlaßarchiv einzurichten,
d a s
Schönberg-Archiv, für das
sich allerdings auch die Berliner Akademie interessierte.
Inzwischen war Darmstadt Sitz des Schönberg-Kuratoriums
geworden, das die Schönberg-Medaille vergab. Mit Bitter­
keit stellte Frau Schönberg fest, daß "die Berliner noch
immer nicht ihre Schuldigkeit getan haben und für den Ver­
lust , den Arnold erlitten hat, nicht bereit sind, etwas
Großzügiges zu unternehmen".
Für Steinecke begann wieder eine Zeit des ungeduldigen
Wartens, auch der öffentlich zu erbringenden Vorleistungen,
und die Konzertprogramme der folgenden Jahre spiegeln das
alles genau wieder. Im Theater glaubte m a n , sich an eine
"Moses und Aron"-Aufführung wagen zu können. Auch Leibo­
witz machte sich Hoffnung auf den Durchbruch einer seiner
unaufgeführten Opern. Für 19 57 erwartete man die Beschluß­
fassung aller Beteiligten. Aber Bonn mochte sich nicht
entscheiden. Auch Gertrud Schönberg wurde allmählich zu­
rückhaltender, obgleich die Stadt Darmstadt, wie Steinecke
versichern konnte, den Plan längst "zu einem ihrer wich­
tigsten Anliegen" gemacht hatte. Steinecke sprach von der
"Krönung" seines Lebenswerks. Nochmals, nach dem Besuch
der Witwen Schönbergs und Bergs, Verschiebung um ein Jahr.
Neues Warten. Steinecke war sogar bereit, im Ablauf der
Kurse eine Zäsur eintreten zu lassen zugunsten eines gro­
ßen Schönberg-Festes als Arbeitstagung junger Komponisten
mit drei festlichen Konzerten, darunter die erhoffte Ur­
aufführung der "Jakobsleiter". Die Aufgabe desr Traditions­
bewahrung nahm nunmehr in seinem Denken - neben der stän­
digen Verpflichtung zur Förderung des Neuen - einen immer
größeren Raum ein. Auch Boulez war inzwischen in Los
Angeles zu Besuch und mahnte zu baldiger Einrichtung.
Gertrud fragte sich, "ob die Herren da oben wirklich In­
teresse haben und mich nicht nur weiter hinziehen".
Die Pläne scheiterten und mußten begraben werden. Steinecke,
niedergeschlagen wie noch nie, grämte sich über die "Nie­
derlage" und wurde von Gertrud Schönberg rührend aufge»
111
richtet: "Ich weiß, daß viele froh wären, wenn Sie
aufgeben würden. Eine idealistische Sache ist den 'Kauf­
leuten' ein Dorn im Auge". Die Kurse im Jahr der "Nieder­
lage", 1958, waren Steineckes dreizehnte. Die SchönbergFestschrift, ihrer ursprünglichen Bestimmung beraubt,
wurde zum Band 1 der "Darmstädter Beiträge" und künftig
fortgesetzt. In den Beiträgen - sie stammten von Schön­
berg und Adorno, von Krenek, Fortner, Nono, Pousseur,
Boulez, Stockhausen, Henze, Kolisch und Stuckenschmidt dominierte die Schönberg-Thematik durchaus. Noch drei
Jahre später, in seinem Todesjahr, versicherte Steinecke
in seiner letzten Mitteilung an Frau Schönberg, "daß die
Werke von Schönberg wieder wie immer den stärksten Anteil
an unseren Programmen haben".
Das war nicht übertrieben. Schönberg hielt die Spitze, in
beträchtlichem Abstand gefolgt von Webern, Bartok, Hindemith und Hermann Heiß in etwa gleicher Stärke, gefolgt
von Krenek vor Strawinsky, Fortner, Henze, Berg, Debussy
und Engelmann; die dann folgenden Maderna, Nono, Zimmer­
mann und Stockhausen erreichten - zu Lebzeiten Steineckes gemeinsam etwa die Zahl der Aufführungen von Schönberg.
Rückblickend im Jahr seiner letzten Ferienkurse nannte
deren Gründer zwei Daten besonders: das Jahr 1948 mit der
beginnenden und zugleich vollzogenen Internationalisierung,
also das Jahr der Institutsgründung mit der beginnenden
zentralen Auseinandersetzung mit Schönberg; und daneben
das Gedenkjahr 1952, das den vorausgegangenen Depressionen
und Rückschlägen um das Todesjahr Schönbergs gefolgt war.
Denn just in jenem Jahr der "Zäsur" war es - durchaus noch
im Schatten der Bestürzung - zu einem der "Wunder" von
Darmstadt gekommen, zu jenem Konzert, das im selben Pro.
grarran das "Kreuzspiel" des debütierenden Stockhausen, Madernas "Musica su due dimensioni", Boulez' "Trois Structures pour 2 pianos" und Nonos erstes Lorca-Epitaph ent­
hielt. Es mag hier am Rande interessieren, daß Steinecke
im Rückblick, ein knappes Jahrzehnt später, in Stockhausen
den radikalsten Experimentator, Form-Experimentator, der
Gruppe sah und daß er dessen "suchende, experimentierende
Art" als besondere nationale, sprich deutsche, Färbung
einschätzte; und daß er, ebenfalls in dem für Zagreb vor­
bereiteten Vortrag, unter den "wichtigsten" Komponisten
j ener Jahre Bruno Maderna an erster Stelle nannte (ich
füge diese Feststellung heute, im zehnten Todesjahr Madernas, hier an, weil mitunter Zweifel geäußert worden sind,
ob Madernas kompositorischer Rang in Darmstadt je voll
erkannt worden sei).
An dieser Stelle möchte ich jedoch auf ein, wie ich meine,
wirkliches, und zwar ganz allgemein bestehendes Erkenntnis-
11 2
Defizit hinweisen, wenngleich auch dieses am wenigsten
den Darmstädter Kursen angelastet werden kann: die ge­
rechte Einschätzung der Verdienste von Rene Leibowitz.
Steinecke hat mehrere Anläufe unternommen, Leibowitz in
den Kursen eine dauernde und zentrale Rolle zuzuweisen.
Schließlich war es Leibowitz, der Steinecke zuerst auf
Adorno, dann auf die zentrale Bedeutung Weberns aufmerk­
sam gemacht hatte, ganz abgesehen davon, daß er ja einer
ganzen Generation als Anreger und Lehrmeister gedient hat.
Er am meisten war davon betroffen, daß Steinecke es über
Jahre hinweg nicht riskieren konnte, der Schule Schönbergs
ganz offen die zentrale Stellung einzuräumen. Ich greife
hier die Frage Reinhold Brinkmanns auf, wer denn im Rück­
blick zum "harten Kern" der eigentlichen Wiener Schule
zu zählen sei, und meine, daß neben Adorno auch Leibowitz
sich diesen Rang verdient hätte, nimmt man nur alle seine
enormen Verdienste zusammen. Große Teile von Leibowitz'
musikalischem Werk, Belegstücke eines hellsichtigen und
scharfen musikalischen Denkens, harren noch der allerer­
sten Erschließung„ Die Schriften sind zum Teil weit zer­
streut . Ich biete hier die Hilfe unseres Instituts an,
das selbst viele Materialien besitzt. Zu ihnen zählt der
bisher unveröffentlichte Beitrag für die Festschrift aus
Anlaß der erhofften Eröffnung des Schönberg-Archivs. Er
trägt den Titel "Webern und Mahler" und ist - möglicher­
weise - wegen seiner sprachlich etwas mißverständlichen
Schlußthese nicht gedruckt worden. Leibowitz spricht da
unter anderem von dem "unglaublichen Mißbrauch, dem die
Musik Weberns heute ausgesetzt ist", und beklagt - wenn
ich es recht verstehe - die Unsitte späterer Adepten,
"eine primitive Arithmetik" für den programmatischen In.
halt Webernseher Musik zu halten. Leibowitz' brieflich
ausgesprochenes, auf ein nicht zustandegekommenes Treffen
bezogenes Bedauern, "einander verpaßt zu haben", gewinnt
so, nach mehr als zehn Jahres währenden engsten Kontakten,
einen bitteren Nachgeschmack.
Ich bin Ihnen, nach diesen Exkursen in die Frühzeit der
Ferienkurse, bisher den Ausblick schuldig geblieben. Ich
habe zu zeigen versucht, daß das Werk Schönbergs die gan­
ze Kursarbeit Steineckes - sogar zunehmend ~ wie eine
große Hüllkurve begleitet, umgeben hat: was er selbst von der Öffentlichkeit oft ganz unbemerkt - mit sich als
die "Niederlagen" abzumachen hatte, das Scheitern der
großen Pläne der Zurückholung Schönbergs, des Archivs
als "Krönung".
Ich habe versucht zu zeigen, daß - bedingt durch die gro­
ßen Hindernisse auf dem Weg - die Schönberg-Programme in
den immer neuen Anläufen an Ausdehnung zugenommen haben
(von mir das Moment "malgre lui" genannt).
113
Mit dem 4. Heft der "Darmstädter Beiträge", dem BoulezHeft, verschwand von der Titelseite (wie auf den Kurs­
programmheften) Schönbergs Quartenthema. Hinfort gab es
für die Kurse die "Hüllkurve", den Schutz und Anspruch
der großen Tradition, der "Klassiker" der Moderne, nicht
mehr. "Klassik", Maß und Größe neu stiften, repräsen­
tieren zu müssen, ist ein Problem für j eden öffentlichen
Veranstalter neuer Musik. Und es ist allerorten zu be­
obachten, wie die Öffentlichkeit nach den Halteseilen ver­
langt , nach der Absegnung durch Veteranen und Honoratioren,
nach dem Schutzmantel der Tradition und Traditionen.
Der TraditionsZusammenhang des Serialismus mit der Dodekaphonie der Wiener Schule liegt auf der Hand. Mir scheint
es bei weitem wahrscheinlicher, daß sich das Jahrzehnt
der Seriellen demnächst zur Heroenzeit verklären wird,
als daß es völlig aus der Erinnerung entschwindet. Zu den
optimistischen Aspekten von heute zähle ich, daß die Aus­
gangsbedingungen , das will sagen: der Informationsstand
der jungen Komponisten und Musikstudierenden den der Nach­
kriegszeit weit hinter sich läßt. Nicht auszudenken, was
eintritt, wenn die heutige Generation sich eines Tages
entschließen sollte, von den angehäuften Materialien der
Information erst einmal den vollen Gebrauch zu machen.
Ob die materielle, wirtschaftliche Lage junger Komponisten
heute wirklich viel besser ist als damals, wage ich zu be­
zweifeln. Es gibt genügend Beispiele für Verhungersyndrome
inmitten einer Welt, die für technische Neuerungen - nicht
nur für militärische - ungeheure Summen auszuwerfen bereit
ist, womit ich die Rückkehr zum technikfeindlichen Barfüßertum, zum grün und billig Selbstgestrickten, keines­
wegs befürworten will. Was ich befürworte, sind die kur­
zen, unbürokratischen Wege der Vermittlung, die Ermunte­
rungen , die sich auf dem Weg an ihre Adressaten und Empfän­
ger nicht zum größten Teil in "Institution" umsetzen und
verschleißen. Was ich bewundere, und auch andernorts
zur Nachahmung nur empfehlen möchte, sind dies fortgesetz­
ten (und wie ich hoffe fortdauernden) Einrichtungen der­
art, wie sie von Wolfgang Steineeke für diese Stadt er­
kämpft worden und von seinem Nachfolger Ernst Thomas unter
kaum leichteren Bedingungen weiter gefestigt worden sind.
Ich möchte Ihnen zum Schluß noch einen ganz kurzen Text
vorlesen, einen Brief aus dem Dezember 1929 (?) , der dank der Vermittlung von Wilhelm Schlüter - erst vor kur­
zem in den Besitz unseres Instituts gelangt ist. Er lau­
tet: 11Sehr geehrter Herr, nach Wien zurückgekehrt, finde
ich Ihren Artikel über meinen 'Wozzeck' in der 1Volkswacht'
vom 7.J.er vo r . Es tut mir aufrichtig leid, das nicht schon
1 14
in Essen, worin ich 8 Tage lang mich aufhielt, gelesen,
und Sie nicht kennengelernt zu haben. Denn ich finde Ihren
Artikel schon ganz famos u . so ganz in meinem Sinne, wie
weniges, was ich über den 'Wozzeck' gelesen habe. Lassen
Sie sich, geehrter Herr Doktor, wenigstens aufrichtig und
von Herzen danken und seien Sie unbekannter- und dennoch
bekannterweise schönstens gegrüßt von Ihrem ergebenen
Alban Berg". Den gedruckten Bericht in der "Volkswacht"
haben wir zwar noch nicht auffinden können. Aber es ist
aus den Fundumständen anzunehmen, daß der 19jährige Wolf­
gang Steinecke - damals bei weitem noch nicht "Doktor" der Adressat ist. Die Schönbergsehe "Hüllkurve", von der
oben die Rede w a r , würde damit tatsächlich ein ganzes Be­
rufsleben von Anbeginn umfassen. - Wolfgang Steinecke ist
nur wenig älter als Alban Berg geworden; er war 1961, bei
seinem Tod, 51 Jahre alt.
(Der Beitrag ist dem Andenken Hella Steineckes, geb. Dahms,
gewidmet, die am 14. September 19 82 61jährig in Darmstadt
gestorben ist.)
* Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, I-V, VIII-XVIII, Mainz 1958'
198o (Anm. des Hg.)
1 15
Hans-Christian Schmidt
DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG: VOM ZWEITEN DASEIN DER
WIENER SCHULE IN DER SCHULE
Einer, der den Einspruch von Theodor Warner und Theodor
W. Adorno gegen die geschichtsblinde musische Erziehungs­
werkelei beherzt beim musikpädagogischen Wort nahm; einer
dem es in den sechziger Jahren einleuchtete, daß Neue
Musik ihr Daseinsrecht im schulischen Musikunterricht
haben müsse, dieser eine ~ gemeint ist Michael Alt - hat­
te damals schon (ich sollte genauer sagen: hatte damals
noch) die freimütige Ehrlichkeit, seine didaktische und
methodische Ratlosigkeit einzugestehen im Falle der Zwölf
tonmusik:
"Denn die moderne Musik ist nicht repräsentativ, son­
dern in einem bisher ungeahnten Maße subversiv. Sie
fühlt sich dazu aufgerufen, die Spannung zwischen der
Freiheit des künstlerischen Schaffens und dem sozialen
Druck der Gesellschaft durchzuhalten mit immer verän­
derten Mitteln. Sie versteht sich also als Restdomäne
der Freiheit, in der freie,■unendliche Betätigung mög­
lich bleiben m u ß . Sie will nicht steckenbleiben in
erstarrten Formen, sonst geht sie ihrer Funktion als
'Entlastung' (A.Gehlen) vom alles und alle überwäl­
tigenden Sozialdruck verlustig. Dieser wesentliche
und unaufhebbare Widerspruch kann auch musikpädago.
gisch nicht aufgelöst werden; er macht die jeweils
neueste Musik unerreichbar. Aber diese neue Rolle der
Musik muß ins Bewußtsein gehoben werden" (Alt, 1968,
29) .
Ich widerstehe der Versuchung, Michael Alt zu fragen, ob
es nicht gerade die Neue Musik war, die sich der Funktion
vom überwältigenden Sozialdruck zu entlasten, sukzessive
verweigert hat; ich frage ihn statt dess'en, wie weit er
dem sogenannten musikalisch Neuen erlaube, dem didak­
tischen Zugriff sich gefügig zu machen. Er antwortet:
"Solange dieser Meinungsstreit währt, kommt es für
den Musiklehrer darauf a n , aus dem Bereich der Neuen
Musik nur das in die Lehre einzubeziehen, was inzwi­
schen gesicherter Besitz ist; so etwa der Zwölfton"
(a.a.O., 57).
Die Sprache verrät den pädagogischen Besitzerstolz: "der
Zwölfton" als ein Kürzel für Schönbergs "Methode der Kom­
position mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen" sig­
nalisiert griffige Handhabbarkeit auf dem Niveau etablier
ter Gebrauchsgüter wie etwa dem des "Kammertons", des
"Sinustons 11 oder des "Leittons". Indessen ist es mit der
vorschnellen Gleichsetzung "'kompositorischer Zwölf ton =
musikdidaktischer Umgangston" doch nicht so weit her,
w i e 1s den Anschein hat, weil - so die Befürchtung Michael
Alts - das eigentlich Neue an der Neuen Musik in der Wir­
kung weit dahinter zurückbleibe:
"So kommt es, daß die Zwölftonmusik noch außerhalb
des Horizontes der Schule steht. Noch ist es nicht ge­
lungen, diesen neuen musikalischen Komplex didaktisch
in den Griff zu bekommen und zu methodisieren, ob­
gleich Jelineks Zwölfton-Elementarwerke, W.Fortners
1Madrigale 1 u.a. mit dieser Absicht geschrieben wur­
den . Man wird nach dem 1Altern' der Neuen Musik nicht
daran vorbeikommen, gangbare Wege zur Zwölftonmusik
und darüber hinaus zur seriellen Musik überhaupt, al­
so zum Werkschaffen Schönbergs, A.Weberns und ihrer
Nachfolger, zu entwickeln. Das Machbare an dieser Tech­
nik lädt geradezu dazu ein, im Experimentieren mit
seriellen Elementen bei der GehörerZiehung und der
Improvisation das Hören der repräsentativen Werke die­
ser Kunstrichtungen vorzubereiten" (a.a.O., 23o).
"... nach dem Altern der Neuen Musik ..." - sollte hier
einer nach dem Muster gedacht haben: "Es gibt vieles zu
tun, warten w i r 1s ab"? Sicher ist bei aller Michael Altsehen Unsicherheit seine Idee von der "Machbarkeit", die
sich seiner Vorstellung nach zu Elementarübungen "ver.
dichten" könnte:
"Damit würde man endlich zu einer Elementarisierung
der neuen und neuesten Musik Vordringen, wenn auch
die Formelemente nur als propäde;utische Übungen zum
Verständnis der neuen Materialordnungen zu entfalten
wären. Jedenfalls könnten so die elementaren Grund­
begriffe Zwölfton, serielle Musik, 'Struktur' und
'Klangraum', aber auch das Neuartige am Kompositions.
Vorgang ... in Übungen übersetzt werden, mit denen
diese neuen Klang- und Formelemente in die musika.
Irische Vo.rstellungswe.lt gelangten. Der Weg von hier
zum Verstehen der neuesten Musik ist dann nicht näher
und nicht weiter als der von den überlieferten Ele­
mentarübungen zum überlieferten Kunstwerk. Das wäre
eine Aufgabe für die junge Generation der Musiker­
zieher, die aus ihrer Zeitgenossenschaft heraus dazu
berufen ist" (a.a.O., 28).
Michael Alts Widersprüche sind unüberhörbar: einerseits
sei das, was er "Zwölfton" nennt, inzwischen gesicherter
Besitz, andererseits stehe die Zwölftonmusik noch außer­
halb des Horizonts von Schule; einerseits ist seine grund­
sätzliche didaktische Vorstellung an der Geschichtlich­
keit und am Kunstcharakter von Musik orientiert, anderer­
117
seits empfiehlt er eine Elementarisierung von neuer Musik
nach dem alten Muster "Vom Volkslied zur Symphonie". Und
fügt, dieser erfahrene Fuchs, sogleich lächelnd hinzu,
daß der Weg vom Element zum Verstehen der neuesten Musik
nicht näher und nicht weiter sei als der von den über­
lieferten Elementarübungen zum überlieferten Kunstwerk.
Und überhaupt sei das die Aufgabe der jüngeren Musiker­
zieher-Generation . Womit diese den schwarzen ZwölftonPeter zugeschoben bekam. Wir werden sehen, was sie mit
ihm anzufangen wußte. Michael Alt jedenfalls löste das
12-Ton-Problem im Unterricht auf nonchalante Weise: von
414 Seiten seiner "Musikkunde in Beispielen für Gymnasien",
genannt "Das musikalische Kunstwerk", widmet er diesem
Kapitel ganze drei Seiten, eingeleitet mit der lapidaren
Feststellung:
"Schönberg entwickelte aus seinen bisherigen Kompo­
sitionen die Gesetze der Zwölftontechnik" (31967, 373).
Folgen die üblichen Erklärungen, was eine Reihe sei und
wie man ihre Grundgestalt zur Umkehrung, zum Krebs und
zur Krebsumkehrung verwandeln könne• Folgen drei ThemenIncipits: a) Schönbergs Orchestervariationen op.31 (5
Takte), b) Schönbergs Violinkonzert (3 Takte), c) Schön­
bergs Kleine Suite o p .25 (3 Takte). Folgt die erleich­
terte Feststellung:
"Auf vielfache Weise wurde versucht, das starre Regel­
werk des Schönbergsehen Zwölftons aufzulockern" (a.a .
0., 375).
Das belegen 7 Takte aus Liebermanns Oper "Penelope", 2
Takte aus Benzes "Variationen für Klavier" und 2 Takte
aus Fortners "Fantasie über b-a-c-h". Den Schluß dieses
Zwölfton-Geschwindmarsches macht Ernst Kreneks Klavier­
stück op. 83,4 "The Moon Rises", ein unkommentiertes
Notenbeispiel.
Fazit: Michael Alt läßt die Zwölfton-Kartoffei sehr schnell
fallen. Immerhin war ihm klar, daß sie heiß ist. Und mit
den versprochenen Elementarisierungen hat er den lesenden
Lehrer gottlob verschont.
Ähnlich nüchtern, immerhin aber reichhaltiger das Infor­
mationsangebot im 3.Band des Musikwerks für Schulen "Die
"Garbe" -(31961) . Es wartet mit einem kurzgefaßten SchönbergLebenslauf, mit Auszügen aus dessen Harmonielehre, Ganzton- und Quartenakkorde betreffend, und einer dreiviertel­
seitigen Erklärung auf, was die Zwölftontechni'k sei. Ihre
Weisheit gipfelt in der lakonischen Feststellung:
"Diese Reihe kann kontrapunktisch durch Umkehrung,
Krebs oder Umkehrung des Krebses abgeändert werden
(Modi, Variationstechnik). Die Reihe ist das Gesetz
für' die gesamte Komposition" (a.a.O., 644) .
118
Der Testfall fürs Reihenabzählverfahren ist der Walzer
aus den "Fünf Klavierstücken" op.23, wo j ede Note sorg­
sam durchnumeriert ist und wo es im Kommentar abschlie­
ßend viel- und nichtssagend heißt:
"Die vorliegende Komposition ist dem Charakter eines
Walzers entsprechend leicht verständlich,.gliedert
sich deutlich in Abschnitte, die, z.T. wenig variiert,
wiederholt werden, vermeidet aber bis auf die 4taktige
melodische Eingangsperiode meist symmetrischen Aufbau;
auch fällt der Beginn der musikalischen Phrasen oft
nicht mit dem Beginn der Reihe zusammen, ein Beispiel
für den Kontrapunkt von Expression und Kon st rukt iv ität" (a.a.O., 648).
Wehe dem Lehrer, dessen Schüler nach diesem "Kontrapunkt
von Expression und Konstruktivität" übers bloße Abschmekken solcher Sprachhülsen hinaus mit einem "Wo?" und "War­
um? " fragen. Vielleicht verwiese er sie auf jenen Text
an gleicher Stelle, wo Fragen nach dem Sinn und nach der
Hörbarkeit von Reihenkompositionen gestellt werden. Doch
stammen sie - Ironie des Schicksals eines langen Meinungs­
streits - aus dem 22. Kapitel des "Doktor Faustus" von
Thomas Mann. Schönberg würde vermutlich getobt haben,
hätte er lesen müssen, daß der syphilitische Leverkühn
nun auch noch, wo er ihm doch schon den Erfinder-Primat
streitig gemacht ha t , den musikpädagogischen Nachlaßver­
walter spielen darf.
Michael Alt und seine Hoffnung auf die jüngere Generation
von Musikerziehern. Bleiben wir bei solchen Unterrichts­
werken für den schulischen Musikunterricht, die sich aufs
Informieren beschränken. Blättern wir in solchen, die sich
aufs Beschränken beschränken, z.B. in "Musik aktuell"
(^1978). Im 6 . Kapitel, "Im Konzert" genannt, schlingern
die Themen wähl- und ziellos durchs Gelände mit Unter­
titeln wie "Mozart als Konzertunternehmer", "Musiklieb­
haber", "Das Mannheimer Orchester", "Über das Dirigieren",
"Das Concerto grosso", "Das Solokonzert", "Was ist eine
Sinfonie?" (man erfährt 1 s auf knapp einer Textseite),
"Fuge - sinfonisch" usw. Das tanzende Schifflein schrammt
denn auch ganz kurz am 12-Ton-Ufer vorbei, wo Weberns
op.21 mit Thema und anderthalb Variationen verlegen grüßen.
Eine Seite Partiturbild und etliche Fragen dazu:
"1. Wir untersuchen die Intervallfolge der Reihe vorund rückwärts. Nach welchem Gesetz ist die Reihe an­
gelegt? Inwiefern weicht die Klarinettenstimme von
der Reihe ab?
2. In der I.Variation, Violinstimme, beginnt die Reihe
mit dem Ton c. Man sagt, sie ist um eine Quinte abwärts
transponiert. Erscheint die Reihe auch in anderen Stim­
men?" (a.a.O., 181f).
Die Reihe als Gesetz und ein Klarinetten-Dissident. Er­
scheint die Reihe denn nun nochmal oder nicht? Der Leser
wird's nicht erfahren, denn statt der Antworten kommen
schon die "Sinfonien mit Vokalmusik" als neues Thema:
Bartok husch-husch und Dvorak mit einer Notenzeile. Musik
pädagogisches Daumenkino, neuere Musik in vierzehn Tagen,
Webern als Einseiten-Anekdote. Hat er ja auch gar nicht
besser verdient: wer in derart aphoristischer Kürze kom­
ponierend sich ausdrückt, den ereilt das Schicksal der
Angemessenheit. Indessen geht es Schönberg im Lehrbuch
"Sequenzen" nicht anders, eher noch verächtlicher. Breit
ausgewalzt der Lernkomplex 4b: "Tonhöhe". Vorbei die Zei­
ten der Dur-Tonleiter, denn
"diese Reduzierung und Verengung der Tonhöhenwahrnehmung ... ist in einem modernen, allgemeinbildenden
Musikunterricht nicht mehr zu verantworten" (1972,
4.2.2.) .
Verantwortet wird hingegen der Anfang beim Sinuston, der
Fortgang über Grund- und Obertöne, Geräusche, Cluster,
Klangbänder. Wir lernen, daß Wasserfälle hoch und tief,
Springbrunnen mittelhoch und GartenSchläuche mit schar­
fem Strahl sehr hoch klingen. Später die Klangfülle bei
Haydn und Mendelssohn, dann eine Drittelseite Schönberg:
"Das Hauptthema der Kämmersinfonie op.9 (komponiert
19o6) von Arnold Schönberg besteht aus sechs aufstei­
genden Tönen, wobei sich zwischen allen Tönen der Ton­
höhenabstand (das Intervall) einer Quart befindet. Da­
durch entsteht ein 'atonales' Gebilde; Die Töne lassen
sich nicht mehr auf einen gemeinsamen Grundton bezie­
hen .
In der Originalgestalt steigt das Thema raketenartig
nach oben ..." (Sequenzen, 1972, 4.2.28).
Weiter g eht 1 s zu Jimi Hendrix, zu Beethoven, zu Globokar.
Alle haben sie Tonhöhen komponiert, mal rauf, mal runter,
diqhter und dünner, mal springend, mal gleitend. Wir lan­
den, wen wundert's , bei der Maultrommel und ihrem Ton­
höhenreichtum. So kommt denn Schönberg (Webern kommt gar
nicht vor) auch in den Zeitquantitäten reichlich kümmer­
lich w e g : beigelegt sind den "Sequenzen" insgesamt 29
Stunden 25 Minuten Klangbeispiele auf Tonband. Für Schön­
berg blieben ganze 87 Sekunden, das entspricht einem Pro­
zentanteil von 0 . 0 8 . Moped-, Staubsauger- und Preßluft­
hammergeräusche kosten eben ihren Preis. Mit 8 '46 ' ' steht
dagegen Alban Berg prächtig da (=o.5%) : der 5.Satz seiner
"Lyrischen Suite" für Streichquartett erscheint vollstän­
dig im Noten- und Klangbild. Warum? Weil sich hier die
Unterscheidungen zwischen "laut - leise", "schnell - lang
sam", "geringe Veränderungen - große Kontraste" und "wech
selnd
konstant" treffen lassen. Kommentar zum 5.Satz:
"Das Trio hebt sich beim ersten Mal schroffer von den
umliegenden Scherzo-Teilen ab als beim zweiten M a l .
Die Gliederung des Satzes ist sehr sinnfällig. Des­
halb kann man im Unterricht mit dem Abhören des voll­
ständigen Satzes beginnen. Die Höraufgabe zielt dann
auf die Gliederung im großen. Dabei können verbale
und graphische Beschreibung sinnvolle Unterstützung
leisten ..." (a.a.O., 5.57).
Ein Schüler, dem die "Sequenzen" die einzige musiktheoretische und musikhistorische Erfahrungsquelle wären,
müßte demnach Schönberg für einen Quarten-Bastler, Berg
für einen Gliederungs-Spezialisten und Webern für nicht
existent halten. So es um die leicht zu unterscheidenden
Tempo- oder Lautstärkenmerkmale geht, frage ich mich,
warum man um Himmelswillen einen 15-jährigen Hauptschüler
durch das Gestrüpp von alterierten Dreiklängen, Mischto­
nalitäten und durch die motivisch-rhythmischen Vertrackt­
heiten eines Bergschen Streichquartettsatzes scheucht;
wären da die Musik-Collagen von Eiskunstläufern nicht
bessere Trainingsfelder? Denn um das begründungslose
Formhören geht es bei diesem Streichquartettsatz, um
nichts sonst.
Michael Alt und seine Hoffnung auf die jüngere Generation
von Musikerziehern. Unter der Kapitelüberschrift "Musik
im Konzertsaal" befaßt sich das "Lehrbuch der Musik" Band
3 (1972, 44ff.) mit dem Violinkonzert von Alban Berg, kom.
mentarlos eingerahmt von Bachs 2.Brandenburgischem Konzert
und dem Klarinettenkonzert A-Dur von Mozart (KV 622). Der
Erklärungsansatz folgt dem Muster der gängigen Schulana.
lyses vorg€5stellt werden die hauptsächlichen Themen (die
Reihe, die Volksweise, der Choral), die Formschemata der
einzelnen Sätze, die thematischen Verwandtschaften nebst
einigen Notentextzitaten. Und weiter g e h t 's zu Mozart.
Im unmittelbaren Anschluß an Bach fällt das Stichwort
"Reihe" und daß sie aus 8 Terzen und 3 Ganztonschritten
aufgebaut sei (a.a.O., 44). Soll heißen: dieses Konzert
ist seines historischen Kontextes gänzlich beraubt,* die
Individualität des Bergschen Reihendenkens bleibt ohne
den Bezug zum Reihenverständnis Schönbergscher Prägung
außen vor; ausgeklammert bleiben obendrein die vielfachen
Beziehungen zwischen Soloinstrument und orchestralem Satz
in ihren Verflechtungen, wie sie ohne Kenntnis des 2.
Klavierkonzerts von Brahms ohnehin unverständlich blieben.
Statt dessen bieten die Herausgeber einen anderen Kontext
a n : den des Aufführungsortes. Und der ist derart unspezi­
fisch, daß man Bergs Violinkonzert ohne weiteres austauschen könnte gegen das 3 .Klavierkonzert von Rachmaninow
oder das Gitarrenkonzert von Villa-Lobos. Warum es gerade
121
dieses Konzert nach Bach und witzigerweise vor Mozart
sein mußte, in welcher Weise es - wenn man denn schon
nach ahistorischen Prinzipien Ausschau halten will - das
"Prinzip des Konzertierens" (wie es S.42 programmatisch
tönt) in besonderer, des Erwähnens würdiger Form einlöst,
bleibt dunkel. War Berg ein Prinzipieller, oder war er
es nicht? Sprach Michael Alt noch mutig-ängstlich vom
"Zwölfton", so findet das Reihendenken hier, wo es be­
reits seine historischen Voraussetzungen synthetisiert,
indem es die Schönbergsehe Rigidität umgeht, bereits kei­
ne Erwähnung mehr. Die Erleichterung darüber, daß sie
sich der Tonalität verschwistert und obendrein mit dem
"Andenken eines Engels" gleichsam vermenschlicht, hat
musikdidaktischen Tritt gefaßt.
Indessen sollte, vor allem mit Blick auf erlebnisbetonte,
in der Pubertät befangene Jugendliche der Weg zu diesem
Konzert, das in gleich zweifacher Hinsicht die Bedeutung
eines Requiems hat, nicht vorschnell abqualifiziert wer­
den . Im 2.Band des UnterrichtsWerks "Resonanzen" für die
Sekundarstufe I fangen die Autoren das jugendliche In­
teresse eben nicht über eine ins Tonale gewendete 12Ton-Reihe ein, sondern über den Choral "Es ist genug",
über die doppelte biographische Bedeutung, über die sub­
jektive Betroffenheit auf Seiten des Komponisten und da­
mit auch auf Seiten des jugendlichen Hörers. Nicht unge­
schickt , den Choral zunächst singen und seine ungewöhn­
liche Diatonik sozusagen körperlich erfahren zu lassen
in Verbindung mit einem Text, wo es u.a. heißt "Mein
Jesus kommt: nun gute Nacht; o Welt, ich fahr ins Himmelshausi Ich fahre sicher hin mit Frieden .
Bergs Violin­
konzert als ein Dokument einer sehr persönlichen existen­
tiellen Not? Warum nicht, wenn sich diesem Grundgedanken
die Analyse strikt anverwandelt und wenn der mehrfach an
sich selbst erfahrene Choral sowie die biographisch ge­
tönten Verweise, etwa in Form eines Ländler-Zitats, gleich­
sam zum roten Faden, zur Hör- und Verstehenshilfe werden,
Doch leider bleiben die Autoren bereits im Ansatz dieses
erlebensbetonten Zugangs stecken, verheddern sich dann
doch alsbald in einer Diskussion der 12-Ton-Reihe und
ihrer Permutationsmöglichkeiten und landen schließlich
dort, wo sie alle landen: beim Aufstellen einer gra­
phischen Hörpartitur, will sagen: bei einer formalen Be­
wältigung dieses Werkes. Vorbei und vergessen das sehr
persönliche "Es ist genug"; vertan die Möglichkeit, neuere
Musik durch die Trauer des schreibenden Subjekts hindurch
zu begreifen. Wie wenig den Autoren übrigens an diesem
erlebensbetonten Zugang gelegen war, zeigt auch hier wie­
der der inhaltliche Kontext: das Berg-Violinkonzert folgt
nach einem Hornkonzert von Haydn (es ging also wieder
122
mal ums konzertante "Prinzip") und leitet über zur Dis­
kussion der Beliebtheitsränge von Komponistennamen auf
Programmen des öffentlichen Musiklebens mit der stolzen
Feststellung:
"Zu den am meisten aufgeführten Werken gehören die
Symphonien Beethovens" (Resonanzen Bd,2, 19 75, 67).
Michael Alt und seine Hoffnung auf die jüngere Generation
von Musikerziehern. Sie tritt im Lehrwerk "Musik um uns"
für die Klassenstufe 11-13 als Generation von schulmeister
liehen Pedanten in Erscheinung. Nach dem dort üblichen
Muster "Regel und Anwendung" hat der lesende Schüler zu­
nächst einmal das Regelsystem zu verkraften: der Kompo­
nist bringt die zwölf Töne in eine bestimmte Reihe, kehrt
sie um, bastelt einen Krebs, transponiert die Reihe usw.
Folgen Beispiele aus der Klaviersuite op.25 als Anwen­
dungsfälle, wobei sich die - um ein Wort von Ehrenforth
aufzugreifen - "dodekaphonischen Suchtrupps" mit Fleiß
auf die Pirsch begeben und tüchtig durchnumeriert haben.
Bleibt als nicht numeriertes Trainingsfeld das MenuettTrio : hier soll selbst geknobelt werden nach alter Suchrätselmanier "Wo steckt der Jäger?". Bevor es dann hurtig
zu Hindemiths "Ludus tonalis" weitergeht, noch schnell
einige Aufträge;
"Vergleichen Sie das Schema mit dem Notenbeispiel und
den Modi, und kennzeichnen Sie die Bögen des Schemas
mit R, RT , U„ Urp, usw. Charakterisieren Sie die Art
der Mehrstimmigkeit in Menuett und Trio" (Musik um uns,
1978, lo9).
Webern ergeht es wenig später ganz ähnlich. "Struktur und
Strukturgruppen" heißen die Zauberworte in der Analyse
des Streichquartetts op.5, und die Analyse des Konzerts
op.24 besteht aus einer verwirrenden Fülle von Notenbei.
spielfetzen, Kreisen, Pfeilen, ausgezählten Reihen und
reduzierten Dauern, Artikulationen sowie Farben, alles
in Schaubilder übertragen und sehr schön anzusehen. Ich
wage, weil der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen
ist, zu bezweifeln, ob die Zahlen- und Tabellenakrabat.i'k
das bezeugt, was eingangs der Konzert-Analyse behauptet
wird s
"Es liegt eine 3-Ton-Reihe vor, die durch 12-Tönigkeit
in größeren Zusammenhang gebracht wird. Die 12-TonReihe stiftet Proportionierung höheren Grades" (a.a.
0. , 154) .
Sie stiftet vor allem kein Verständnis dafür, warum ein
Komponist im Jahr 1934 so und nicht anders komponiert;
gestiftet wird dagegen - jenseits aller individuellen
und historischen Notwendigkeit - ein anderes Verständnis:
daß nämlich eines auf das andere folgte. Im Klartext:
lückenlos reiht sich in diesem Schulbuch Messiaens "Mode
1 23
de valeurs et d 1 intensites" an das Webern-Konzert op.24,
elegant verkleistert mit der folgenden Textmodulation;
"Es ist erstaunlich treffsicher und höchst sinnvoll,
diese Kompositionstechnik in eine Zeit zu transplan­
tieren, für die gleichgestellte Durchorganisation al­
ler Gebiete der Musik wesentlich wird" (a.a.O., 155).
Wie mag sich der Komplex 12-Ton-Musik bei einem Schüler
wohl abbilden? Vermutlich als Gleichsetzung "12-Ton-Musi'k=
Zahlenkolonnen = Gesetz und Regel = Liniendiagramme =
eine Ordnung, die stets als eine 1höhere 1 angepriesen
wird". Schönberg und Webern müsse man zu Leibe rücken
mit Bleistift, Zählwerk und Kurvenlineal; ihre Musik kön­
ne man besser in Tabellen übersetzen denn hörend erschlie­
ßen . Oder aber - und das halte ich für noch verwegener schlicht selber und möglicherweise besser machen. Denn
was Michael Alt einst im Hinblick auf "Elementarisierung"
des Denkens von Neuer Musik überlegte, ist in derzeitiger
Schulbuchlandschaft auf fruchtbaren Boden gefallen und
treibt bunte Blüten. Recht schüchtern noch nimmt sich der
scheue Versuch im Opus "Ton und Taste" (1975, 148) au s ,
wo im Kapitel "Musikalische Formen" (Unterkapitel "Motiv")
zwischen dem Lied "Spißi spaßi Kasperladi" und einem Mozart-Menuett acht Takte aus einem 12-tönigen Andante von
Hans Jelinek sich verstecken, ohne daß erkennbar wäre,
wie und warum sie dorthin geraten sind. Ist eine Klasse
schon so gutmütig, den Kasperladi-Nonsens fraglos zu er­
tragen, so sollten die paar Takte 12~Ton~Wunderlichkeiten
wohl ebenso klaglos toleriert werden, zumal man auf den
übrigen 3 28 Seiten damit dann nicht mehr behelligt wird.
Aber es gibt bessere Möglichkeiten, der 12-Ton-Musik den
Giftzahn zu ziehen, eben durch die Methode der Elementari­
sierung. Der 2.Band des "Lehrbuchs der Musik" (1972, 2of„)
druckt einen 12-Ton-Walzer von Finn Mortensen ab und läßt
nach gehabter Manier zunächst einmal die Reihe suchen und
finden. Feststellung;;
"Eine solche Reihe, in der alle 12 Töne; unseres Systems
verkommen, nennen die Musiker eine Zwölftonreihe" (a.
a.O., 2 1 ) ,
Und ist erst einmal auf leichtem Wege der Finder-Stolz
befriedigt, so läßt Erfinder-Ehrgeiz leicht sich wecken:
"Hier eine weitere Zwölftonreihe. Numeriere ihre Töne
und überprüfe, ob keine Note (Taste) vergessen worden
ist:
(folgt eine neutral notierte Reihe)
Erarbeitet mit dieser Reihe folgendes kleines Solo­
stück ;
1. Schreibe die Reihe dreimal hintereinander in Dein
Notenheft. Spiele sie vorher mehrmals auf einem In­
strument . ..
1 24
2. Setze die so entstandene Tonfolge in einen 4/4Takt und verwende dabei folgende Notenwerte (Halbe,
Viertel, Achtel). Dabei darfst Du keine Note auslassen
und nach Möglichkeit auch keine Note wiederholen.
Sieh Dir noch einmal den Walzer von Finn Mortensen an.
Du findest kleine Zahlen in den Noten. Was werden Sie
bedeuten?" (a.a.O., 2 1 ).
Ähnliche Gestaltungsübungen peilt auch das Lehrbuch "Mu­
sik um uns" (Klassenstufe 7~lo) a n . Wieder ist der Walzer
aus o p .23 dran, wieder wird fleißig gezählt und genummert
und geprüft und nach ReihenVerarbeitungen geforscht. Der
Aufgabenkatalog gipfelt schließlich in der Anweisung:
"Wir versuchen eine Zwölfton-Gruppenimprovisation"
(a.a.O., 241).
Wie diese vonstatten gehen soll, verrät nicht der Schüler­
band, sondern das Lehrerbegleitheft: man erfinde eine
Reihe, verteile j eden Ton auf einen Mitspieler, der dann
dran ist, wenn sein Reihenton drankommt ("Jeder Schüler
kennt seinen Vorder- und Hinter - 1T o n '") , das rhythmische
Nacheinander erfolge bei der Improvisation frei, gewandtere
Schüler dürften oktavversetzen, mehrere Reihentöne könnten
zu Akkorden zusammengefaßt werden etc., alles nach dem
Motto: Das bißchen Zwölftonmusik machen wir uns selber.
Dodekaphonie in Heimbauweise. Nicht auszuschließen, daß
diese "Improvisation" dann ebenso bizarr klingt wie der
Schönberg-Walzer. Das liegt dann eben an diesem komischen
12-Ton-System.
Die gleiche 12-Ton~Heimwerker-Methode in "Resonanzen" Bd.2
(1975, 33) s
"Komponiert selbst ein Zwölftonstück, z.B. mit Hilfe
von Klingenden Stäben.
Stellt zwölf verschiedene Klingende Stäbe in einer
Grundreihe nebeneinander.
Spielt die Zwölftonreihe in gleichmäßigen Tonlängen.
Rhythmisiert die Grundreihe, so daß ein Thema ent­
steht .
Verändert diese Tonfolge durch Tonwiederholungen und
Oktavversetzungen, wie sie in der Zwölftontechnik er­
laubt sind usw." (a.a.O., 33).
Dieses "Zwölftonmusik ist, wenn man ..."-Verfahren hat
sich in schulischer Praxis zur üblen Gewohnheit etabliert.
In der Referendarausbildung, bei Abiturprüfungen und
schriftlichen Musiktests sind Aufgabenstellungen wie folgt
üblich:
"Erfinden Sie eine 12-Ton-Reihe. Verarbeiten Sie diese
Reihe zu einem Thema. Stellen Sie die Modi auf. Schrei­
ben Sie eine dreistimmige, 12-tönige Invention und be­
nutzen Sie dabei die Reihe nebst ihren Modi sowohl hori­
zontal wie vertikal!"
125
Niemandem fiele bei, ein Gleiches auch vom Palestrinaoder Bach-Stil abzuleiten; niemand würde auf die Idee
kommen, ein Rondo in Haydn-Manier komponieren zu lassen.
Nur diese unselige Erfindung dieses Arnold Schönberg und
seiner Schüler taugt in besonderer Weise dazu, auf einer
elementaren Ebene unzählige Male kopiert und zur Anwen­
dung gebracht zu werden. Die Verhältnisse sind hier ja
auch besonders günstig: bis 12 zählen kann j eder, und
keinen brauchen die Ängste vor Quintparallelen zu plagen.
Es hat den Anschein, als seien das pedantische Nachzäh­
len oder die ebenso pedantischen Reihen-Erfindungsübungen
der einzige Weg, sich einem rätselhaften Komponisten zu
nähern, indem man sich paradoxerweise seiner elementaren
Methode bedient, wo man dessen kompositorische Resultate
in anderer Weise zu verstehen nicht fähig ist (oder nicht
gewillt ist, sie zu verstehen). Wir müssen folglich festhalten, daß auf jenem eingeschliffenen Wege der hausge­
machten 12-Ton-Basteleien Schönberg und seine Schüler ei­
ner Laisierung zum Opfer gebracht werden, die den Schrekken, den ihre Werke immer noch zu verbreiten scheinen,
mit der Erkenntnis: "Das ist ja ganz leichtI" neutralisiert.
Am Rande gesprochen: dem Blues und dem traditionellen
Jazz geht es ganz ähnlich; unsere Schulbücher sind voll
von eingefrorenen "Modellen" für die Hand von jedermann.
Ein 12-taktiges Schema und ein paar Blue-note-Gewürze
lassen leicht die Illusion aufkeimen, daß es genau so
klinge wie. Handele es sich um eine fernstehende kultu­
relle Artikulation oder um eine immer noch fernstehende
musikalische Ausdrucksweise - das inferiore Gefühl des
nicht verstehenden Unbehagens läßt sich rasch durch ein
trotziges "Das können wir auch" in genügsame Überlegen­
heit ummünzen. Zu welchen jammervollen Auswüchsen das
führt, möchte ich an einem Schulbuchbeispiel demonstrieren,
das mir zunächst (ähnlich dem Zugriff auf Bergs Violin­
konzert) auf guten Wegen zu gehen schien. Das Buch "Re­
sonanzen", Band 2, befaßt sich eingehend mit Schönbergs
"Überlebendem aus Warschau". Es befaßt sich sorgsam mit
dem historischen Vorfeld, dem Krieg, dem Warschauer Ghetto,
den Augenzeugenberichten, dem Befreiungskampf, dem Plan
von Schönberg zu dieser Komposition. Sehr richtig setzt
die einführende Analyse beim Shema Yisroel an, bei Sprechund Singübungen, kurz: bei einem Teil der Komposition, bei
dem Schüler so etwas wie ein kollektives Einverständnis
erfahren könnten. Menschliche Katastrophe und menschliches
Hoffen - soweit stimmt der We g , auf dem Jugendliche mitge­
nommen werden können. Aber dann kommt, was unvermeidlich
scheint: anzutreten haben der Reihenprüfdienst, die Regel­
abweichungs-Kontrolleure, die Klangmerkmals-Tabellographen,
die Strukturdiagrammatiker und Motiv-Ordner, die Klang­
126
farbenpartiturZeichner und Großgliederungs-Ingenieure.
Und als besonderen methodischen Bonbon hat abschließend,
nach Judenfrage und Warschauer Aufstand, nach Shema
Yisroel und Gaskammer-Abzählverfahren, der Lehrerband
ein Silbenrätsel parat für den Lehrer, der sich um die
nachträgliche Sicherung des am "Überlebenden aus Warschau"
erworbenen Wissens und Verstehens sorgt:
isolierter Wohnbezirk
GHETTO
alle Instrumente spielen dasselbe UNISONO
eine Art Rezitativ
SPRECHGESANG
machtsymbolisierendes Instrument
TROMMEL
Hebräisch: Herr, Gott
ADONOY
ausgeschriebenes Wort für V c l .
oder V c .
VIOLONCELLO
Vokalgruppe in "Ein Überlebender" MÄNNERCHOR
Vorname Schönbergs
ARNOLD
kleinstes Intervall der
chromatischen Skala
HALBTONSCHRITT
Sterbeort Schönbergs (2 Wörter)
LOS ANGELES
Ausdruck für Vernichtung
des Judentums
ENDLÖSUNG
Materialaufstellung für
Zwölftonkomposition
REIHE
Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Begriffe ergeben
der Reihenfolge nach gelesen den Namen eines Freundes
Arnold Schönbergs, der gleichzeitig ein bekannter Kom­
ponist ist (GUSTAV MAHLER)
(Resonanzen, Lehrerin­
formation, 1975, 57).
Michael Alt und seine Hoffnung auf die jüngere Generation
von Musikerziehern, Hier endlich hat sie ihn wohl schnöde
betrogen, denn wenn sich der künstlerisch gebändigte N o t ­
schrei im "Überlebenden aus Warschau" in einen Tummelplatz
für Bleistift-Inspizienten verwandelt, wenn sich der Name
Gustav Mahler als Akrostichon aus Ghetto und Endlösung
nebst Violoncello herleitet und wenn der Begriff Schön­
berg zum Silbenrätsel-Arnold zusammenschrumpft und auf
ein Niveau herunterkommt, das ich beim besten Willen nicht
einmal mehr niedlich nennen kfinn, so wäre es wohl das
beste, man deckte die sogenannte Zweite Wiener Schule
mitsamt ihren Gesetzen, Regeln und Methoden mit dem Man­
tel eines verlegenen Schweigens zu und erklärte sie da­
mit zu musikdidaktischen Personae non gratae. Armer Schön­
berg . Für ihn trifft, soweit seine Existenz in Schul­
büchern in Rede steht, nicht einmal seine im Dankschrei­
ben an die Gratulanten zum 75. Geburtstag wiederholte Be­
fürchtung zu:
"Die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts wird durch Über­
schätzung schlecht machen, was die erste Hälfte durch
UnterSchätzung gut gelassen hat an mir" (zitiert nach
Stein, 1958, 3ol).
1 27
Statt Überschätzung müssen wir sagen: Fehleinschätzung;
und von Schlechtmachen im Sinne von Desavouieren kann
wohl auch keine Rede sein, eher von schlecht Machen im
Sinne einer vom mißverstandenen System verführten Analyse-Methodik. A propos Mantel des Schweigens: In den
jüngst erschienenen Unterrichtswerken "Banjo" (Klassen­
stufe 7-lo) und "Musikunterricht Sekundarstufe I" (Klas­
se 7-lo) kommen Namen wie Schönberg, Webern und Berg oder
Krenek sowie deren Werke überhaupt nicht mehr v o r . Weise
Einsicht ins Unabänderliche oder neue inhaltliche Präfe­
renzen oder Zeichen nicht nur fürs Altern, sondern das
Hingeschiedensein von Neuer Musik? Im Falle von "Banjo"
zweifellos Ausdruck einer neuen inhaltlichen Orientierung:
dort tritt "Musik im Hintergrund" radikal in den Vorder­
grund, und weil Schönberg, Webern oder Berg niemanden
manipuliert haben, finden sie auch keine Erwähnung im
musikalischen Manipulations-Repertoire. Im Falle von "Mu­
sikunterricht Sekundarstufe I" hätte man die Zweite Wiener
Schule schon unterbringen können, z.B. im Kapitel "Neue
Musik im Konzert", doch beginnt dort die Neue Musik mit
Stockhausen, Bartok, Ligeti und Kagel. Und im Kapitel
"Musik und ihre MaterialStruktur" sind die 12-Ton-Turnübungen gottlob aus nun bekannten Gründen ausgelassen.
Zwischenbilanz: das zweite Dasein der Wiener Schule in
der Schule entlarvt sich als eine verbogene Projektion,
oder anders: als eine Werke und Absichten verfälschende
Reduktion, weil
1. Schönberg, Berg oder Webern als Namen nur flüchtig
gestreift werden unter Auslassung von deren Werken und
Wirkungen; oder weil
2. der Schritt vom befreiten Umgang mit der Tonalität
zur strikten Bindung an die 12-Ton-0rganisation zum
Gesetz, zur Regel, zum Gebot erklärt 'wird, was zur
Folge hat, daß
3. zwischen der kurzgefaßten Methodenlehre (nach dem
Muster: 12-Tontechnik geht folgendermaßen ...) und
den immer wieder gleichen Kompositionen ein "Regel
und Anwendungsfa.il "-Verhältnis gestiftet wird mit der
Folge, daß sich
4. die analytische Diskussion im Nachzählen und. Aus­
zählen von Reihen bzw. Reihenmodifikationen erschöpft
oder daß
5. zwischen der 12-Ton-Kompositionsmethode und selber
fabrizierten 12-Ton-Werkchen eine "learning by doing"Beziehung sich knüpft;
6 . scheint e s , als verführen einige Schulbuchheraus­
geber nach dem Motto: hin und wieder ein paar Takte
Schönberg, denn Gewöhnung macht süchtig. Und
128
7. scheint es, als gebe es bei solchen Werken, von
denen man weiß, sie seien Reihenkompositionen, keinen
anderen Weg als den, sie gleichsam wörtlich, d.h. beim
dodekaphonen Versprechen zu nehmen.
8 . Schließlich: auch eine Möglichkeit, mit Schönberg
und anderen fertig zu werden, ist, sie einfach hinaus­
zuwerfen aus den Schulbüchern; Gartenschläuche, Maul­
trommeln und Penderecki-Clusters handhaben sich nun
mal einfacher im improvisatorischen Umgang im Vergleich
zu hakeligen 12-Ton-Reihen.
Wo liegt der kardinale Fehler im pädagogisch-didaktischen
Kalkül? Ich meine: im mangelhaften Studium beider Seiten der von Schönberg einerseits (um bei ihm exemplarisch zu
bleiben) und der des Schülers andererseits. Beide, so
will ich behaupten, wurden und werden nicht beim Wort,
werden nicht zur Kenntnis genommen„ Schönberg 1923 in ei­
nem Brief an Josef Matthias Hauer:
"Wahrscheinlich wird das ... immer wieder neu abge­
grenzte und immer wieder erweiterte Buch schließlich
diesen bescheidenen Titel erhalten: 1Die Komposition
mit 12 Tönen 1 . Soweit stehe ich seit c a . 2 Jahren und
muß gestehen, daß ich bisher - zum ersten Mal - noch
keinen Fehler gefunden habe, und daß mir ein System
unter der Hand, ohne mein Hinzutun wächst. Was ich für
ein gutes Zeichen halte. Ich bin dadurch in der Lage
so bedenkenlos und phantastisch zu komponieren, wie
man es nur in der Jugend tut, und stehe trotzdem unter
einer präzis benennbaren ästhetischen Kontrolle" (zi­
tiert nach Stein, lo9).
Schönberg in einem Schreibern vom 16. Juli 1931 an Josef
Rufer:
"Es ist nämlich wirklich eigentümlich, daß noch nie­
mand sich mit der offenkundigen Schönheit meiner
F o r m befaßt ha t . Die müßte auch mancher zu erken­
nen imstande; sein, der einer Melodie oder einem Thema
mit dem Ohr oder seiner Vorstellung niemals wird fol­
gen können. Aber, und das ist der Grund dafür: es gibt
nur sehr wenige Leute, die von musikalischer Formschön.
heit einen Begriff haben" (a.a.O., 167).
Den Schulbuch-Analytikern ins Stammbuch geschrieben ein
Brief vom 27.7.1932 an Rudolf Kolisch:
"Die Reihe meines Streichquartetts hast Du richtig ...
herausgefunden. Das muß eine sehr große Mühe gewesen
sein, und ich glaube nicht, daß ich die Geduld dazu
aufbrächte. Glaubst Du denn, daß man einen Nutzen da­
von hat, wenn man das weiß? ... Nach meiner Überzeu­
gung kann es ja für einen Komponisten, der sich in der
Benützung der Reihen noch nicht gut auskennt, eine An­
regung sein, wie man verfahren kann, ein rein handwerk­
1 29
licher Hinweis auf die Möglichkeit, aus den Reihen
zu schöpfen. Aber die ästhetischen Qualitäten erschlie­
ßen sich von da aus nicht, oder höchstens nebenbei.
Ich kann nicht oft genug davor warnen, diese Analysen
zu überschätzen, da sie ja doch nur zu dem führen, was
ich immer bekämpft habe: zur Erkenntnis, wie es g e ­
m a c h t
ist; während ich immer erkennen geholfen
habe: was es i s tl ... Ich kann es nicht oft genug
sagen: meine Werke sind Zwölfton= K o m p o s i t i ­
o n e n , nicht Z w ö l f t o n =Kompositionen ...
Für mich kommt als Analyse nur eine solche in Betracht,
die den Gedanken heraushebt und seine Darstellung und
Durchführung zeigt. Selbstverständlich wird man hiebei
auch artistische Feinheiten nicht zu übersehen haben"
(a.a.O., 179).
"Und schließlich", schreibt Schönberg an den Komponisten
Roger Sessions 1944,
"möchte ich erwähnen, was ich, um eine Würdigung mei­
ner Musik zu ermöglichen, für das Wertvollste halte:
daß Sie sagen, man muß sie auf die gleiche Weise an­
hören wie jede andere Art Musik, die Theorien verges­
sen, die Zwölfton=Methode, die Dissonanzen etc. - und
ich möchte hinzufügen, womöglich den Autor ... Daß ich
diesen oder j enen Stil schreibe, diese oder jene Me­
thode anwende, ist meine Privatsache und geht den Hö­
rer gar nichts an" (a.a.O., 234f.).
"... denn das Verständnis für meine Musik leidet noch
i m m e r
darunter, daß mich die Musiker nicht als
einen normalen, urgewöhnlichen Komponisten ansehen,
der seine mehr oder weniger guten und neuen Themen
und Melodien in einer nicht allzu unzureichenden mu­
sikalischen Sprache darstellt - sondern als einen dis­
sonanten Zwölftonexperimentierer" (Brief vom 12.5,1947
an Hans Rosbaud; zitiert nach Reich, 255).
Und wenn Schönberg sich im Brief vom 4. Juli 1944 an Rene
•Leibowitz gleichsam selbst vergewissert ...
"Was Andeutungen von Tonalität und Vermischung mit
konsonanten Dreiklängen betrifft, muß man sich daran
erinnern, daß der Hauptzweck der 12=Ton=Komposition
ist: Zusammenhang durch die Verwendung einer einheit­
lichen Tonfolge zu erzielen, welche zum mindesten wie
ein Motiv funktionieren sollte. Auf diese Weise soll
die organisatorische Kraft der Harmonie ersetzt werden"
(a.a.O., 26o).
. . . wenn also Schönberg Reihe und Motiv funktional ineins
setzt, dann offenbart sich das Dilemma schulbuchhafter
Analysen dergestalt, daß sie keine sind: analytische An­
sätze allenfalls, die bei der Motivsuche und -nennung
stehen bleiben.
1 3o
Aus einer "Notwendigkeit" erwachsen, habe die Methode,
mit zwölf Tönen zu komponieren, kein anderes Ziel als
"Faßlichkeit". Sie, die Reihe,
"muß der erste schöpferische Gedanke sein. Dabei macht
es keinen großen Unterschied, ob die Reihe in der Kom­
position sofort wie ein Thema oder eine Melodie er­
scheint oder nicht, ob sie als solche durch Merkmale
des Rhythmus, der Phrasierung, der Konstruktion, des
Charakters usw. gekennzeichnet ist oder nicht ... Dem­
nach ist der musikalische Gedanke, obwohl er aus Me­
lodie, Rhythmus und Harmonie besteht, weder das eine
noch das andere allein, sondern alles zusammen" (Stil
und Gedanke = GS 1, 1976, 76f.).
Wieder ins Stammbuch geschrieben, nun aber den 12-TonReihen-Amateuren, seine Feststellung:
"Die Einführung meiner Methode, mit zwölf Tönen zu
komponieren, erleichtert das Komponieren nicht; im
Gegenteil, sie erschwert es ... Die Einschränkungen,
die der Zwang, nur eine Reihe in einer Komposition zu
verwenden, dem Komponisten auferlegt, sind so streng,
daß sie nur von einer Phantasie, die eine Vielzahl von
Abenteuern bestanden hat, überwunden werden können.
Diese Methode schenkt nichts; aber sie nimmt viel" (a.
a.O., 79) .
Und noch einmal die gleiche Warnung im "Rückblick" 1949:
"Es scheint mir dringend, meine Freunde vor Orthodoxie
zu warnen. Komponieren mit zwölf Tönen ist in Wirklich­
keit nur in einem geringen Grade eine 'verbietende',
eine ausschließende Methode. Es ist in erster Linie
eine Methode, welche logische Ordnung und Organisation
sichern soll; und deren Resultat müßte leichtere Ver­
ständlichkeit sein" (= GS 1, 1976, 4o8).
Stets die gleichen abwehrenden Gesten gegen das stets
drohende Gemeinverständnis, als Methodiker und Konstruk­
tivist verkannt und unterschätzt zu werden; als einer,
dem es um eine praktikable und kopierfähige Methodenlehre
hätte gehen können. In den Bemerkungen zum dritten und
vierten Streichquartett findet sich, wie so oft in seinem
Schrifttum, der immer gleiche Stoßseufzer:
"Ein Komponist muß ein volles, unerschütterliches Ver­
trauen in die Folgerichtigkeit seines musikalischen
Denkens besitzen ... Tiefe erfordert keine methodischen
Verfahrensweisen. Den auszudrückenden Gegenstand unab­
lässig im Sinn, könnte der Komponist seine Vision wie
von einem Modell abschreiben - eine Einzelheit nach
der anderen. Schließlich wird das vollendete Wei'k so
reich an Inhalt sein, wie es an Einzelheiten ist, und
vielleicht sogar reicher - es könnte einen schöpfe­
rischen Zug tragen" (= GS 1, 1976, 423).
131
Beinahe wahllos herausgegriffene Selbstbekundungen Schön­
bergs, die um immer die gleichen Begriffe, ich sollte ge­
nauer sagen: Ziele kreisen; sie sind mit Vokabeln wie
"phantasievolles Komponieren", "Schönheit der Form", "mu­
sikalischer Gedanke", "gute Themen und Melodien", "orga­
nisatorische Kraft", "schöpferischer Gedanke", "Phantasie
und Strenge", "Faßlichkeit und leichtere Verständlichkeit"
und "Folgerichtigkeit des musikalischen Denkens" kurz Um­
rissen : Leitbilder eines Komponisten und seiner Schüler­
generation, wie sie in keinem der gesichteten Schulbücher
Vorkommen, geschweige denn analytisch nachgeprüft und er­
läutert werden; nicht der phantasievolle Reichtum an mu­
sikalischen Charakteren in den Variationen op.31, nicht
das Neue des Weins im alten Suitenschlauch. Auch nicht
die nach dem "Prinzip der entwickelnden Variation" struk­
turell gebändigte Angst im "Überlebenden aus Warschau"
oder in der "Begleitungsmusik zu einer Lichtspielscene",
wo es den Anschein hat, als lege sich im ersten Fall die
Trauer, im zweiten Fall die begriffslose politische Furcht
gleichsam strenge Zügel an, um nicht im vollen Sinn des
Wortes "maßlos" zu werden. Ebenfalls nicht die aus aus­
konstruierter Vagheit heraus entwickelte, klagende Schön­
heit des Themas von o p .31, nicht ihre Kompromißlosigkeit,
die Schönberg in seinem Vortrag über op.31 mit dem Ver­
gleich zu einer denkbaren tonalen Fassung dieses Themas
verblüffend deutlich macht: es sei ihm eben nicht in ei­
ner Fixierung auf F eingefallen. Schließlich nicht das,
was Schönberg zu betonen nicht müde wird: daß die Methode,
mit zwölf Tönen zu komponieren, über Jahre hinweg gewach­
sen sei; daß ihre "Notwendigkeit" ein großes Stück seiner
persönlichen Geschichte darstelle. Das meint: keines der
Schulbücher zeichnet diesen Weg von der "Verklärten Nacht"
über "Pelleas", übers 1.Streichquartett, über die "Kammer.
Symphonie", über das "Buch der hängenden Gärten", über
die "Glückliche Hand" und den "Pierrot lunaire" zur Klavier­
suite op.25 und von dort aus weiter zu den späten geist­
lichen Vokalkompositionen nach; nicht dies "Gurrelieder"
hier, nicht das Klavierkonzert dort. Bis auf die wenigen
Favourites, von denen hier des öfteren bereits die Rede
w a r , bleibt der ganze Schönberg (und bleiben der ganze
Webern und Berg) unerkannt und somit verzeichnet durch
einzelne Segmente des Schaffens. Die Gründe leuchten uns
nun ein: es sind jene Segmente, die sich als besonders
griffig, als besonders analysierbar, als besonders leicht
zu verharmlosen erwiesen haben. Angesichts dessen halte
ich es für ein Zeichen von Fairness, wenn das für die
Sekundarstufe II 19 8 o erschienene Schulbuch "Materialien
zur Musikgeschichte" sich mit dem Abdruck aus Auszügen
von Schönbergs 12-Ton-Kapitel in "Stil und Gedanke" be132
scheidet: es läßt wenigstens ungestört den Komponisten
selbst zu Worte kommen, obgleich von einer Vermittlung
zwischen dem kompositorischen Anspruch dort und der Er­
wartung eines Jugendlichen von heute hier freilich keine
Rede ist.
Und damit bin ich beim zweiten Manko im didaktischen Kal­
kül: bei der Tatsache, daß Jugendliche in den referierten
didaktischen Entwürfen nicht ins Spiel gebracht werden.
Ich bin damit auch bei der Frage an mich selbst, wie das
Verhältnis, von dem wir erkannt haben, daß es gestört sei,
zwischen der Wiener Schule und der Schule heute aufzu­
bessern sei. Man verzeihe mir die Binsenweisheit: was
sollte einen an der Musik normal interessierten Jugend­
lichen wohl beflügeln, sich mit Schönbergs oder Weberns
komplizierten, zunächst einmal kühl und befremdlich klin­
genden Schreibweisen neugierig zu befassen? Die spröde
Klanglichkeit weist ihn zunächst ab, und mit der Einsicht,
daß dort Reihen nebst ihrer Permutation ein verworrenes
Spiel treiben, ist wohl auch nichts zu gewinnen, vom denk­
baren sportiven Respekt vor so viel Kunstfertigkeit ein­
mal abgesehen. Binsenweisheit Nr.2: ein sechzehnjähriges
Mädchen oder ein siebzehnjähriger Junge filtern j ede neue
musikalische Erfahrung durch das natürliche Sieb ihres
Erlebens- und Miterlebensbedürfnisses. In diesem Alter
fällt j ede Neubegegnung mit der akuten Frage "Wer und
was bin ich?" zusammen. Die Entdeckung der Welt, der äu­
ßeren wie der inneren, vollzieht sich axich durch die Sache
hindurch: das Ich fängt sie ein und entdeckt ein Stück
Selbst in ihr. Wo das nicht möglich ist, dort -geschehen
die uns wohlbekannten Verweigerungen. Vergröbert gesagt:
wo in der Sache solche Ich-Begegnungen nicht ermöglicht
werden, dort fruchtet kein Vermittlungsversuch. Anders
ausgedrückt: zu suchen wäre jenseits eines rationalen Ver.
stehenszugriffs ein Zugang, der über das erlebensbetonte
Einverständnis ginge. Im Falle der genannten Komponisten
ist dieser Zugang insofern besonders schwer, als auch
der Instrumente spielende oder in einem Chor singende
Schüler so gut wie keine praktischen Vorerfahrungen ma­
chen kann,- dem Instrumentisten oder dem Sänger bahnen
sich da und dort erste Kontakte zu Strawinsky, Bartok,
Hindemith oder Fortner an; welcher Klavierlehrer oder
Chorleiter aber hat schon Webern oder Schönberg im Re­
pertoire? Deren Musik wird hauptsächlich rezeptiv und
kaum praktizierend erfahren, was einen handelnden Um­
gang mit ihr weitgehend ausschließt. Dennoch scheinen mir
Zugänge, d.h. erlebens- und nacherlebensbetonte Annähe­
rungen an die Musik der Wiener Schule denkbar, sofern man
bereit wäre, vom Begriff der Wiener "Schule" Abstand zu
nehmen, mithin dem Versuch widerstände, sie von der Seite
ihrer Methode her verstehen zu wollen.
Vorschlag 1: Ein Thema über ein halbes Jahr hinweg sei
genannt: "Komponieren als Trauerarbeit". Ausgangspunkt
seien sehr persönliche Befindlichkeiten wie Furcht oder
Trauer, dokumentiert und für Jugendliche nachvollziehbar
in entsprechenden schriftlichen Dokumenten. Ob man den
Bogen bereits ab barocken Tombeaus spannen will, mag eine
Frage der verfügbaren Zeit sein, immerhin streift ein
solcher Themengang Stationen wie Beethovens 3.Sinfonie
(Mozarts Requiem vielleicht auch), das Deutsche Requiem
von Brahms, Mahlers 9.Sinfonie, Bruckners Siebte, Schön­
bergs "Überlebenden", die Metamorphosen für 23 Solostrei­
cher von Richard Strauss, Hindemiths bestellte Trauermusik,
Bergs Violinkonzert, Smetanas Quartett e-Moll, Pendereckis
"Threnos", Schuberts "Winterreise" oder Dvoraks Streich­
quartett F-Dur op.96. Man störe sich nicht an der Willkürlichkeit solcher Beispiele, auch nicht daran, daß un­
ter dem Stichwort einer subj ektiven Trauer nur Teile der
genannten Werke zur Diskussion stehen können. Indessen
ist es gerade jene "existentielle Bedeutsamkeit", die w i e 's Wellek einmal sagte - "dem ästhetischen Wert nicht
nur entgegensteht, sondern ihn in eigentümlicher Weise
steigert" (1963, 223). Und sollten die Reihenkonstruk­
tionen in Schönbergs "Überlebendem" oder in Bergs Violin­
konzert dabei unerwähnt bleiben und statt dessen nur jene
Momente zur Sprache kommen, wo sich persönliche Betroffen­
heit musikalisch kundtut, so wäre wenigstens durch diese
Betroffenheit hindurch eine Tür geöffnet, die sich dem,
der das Ganze haben will, überhaupt nicht aufschließt,
Vorschlag 2; Wenn schon Schönberg zentral, dann aber seine
ganze Persönlichkeit - seine frühen Jahre, seine; Tätig­
keit an Wolzogens "Überbrettl", seine Wiener Hungerjahre,
die Berliner Erniedrigungen, das amerikanische Exil -,
seine kompositorischen Stationen, seine Lehrertätigkeit,
seine Schriften, die Reaktionen der Öffentlichkeit, die
Skandale und Anfeindungen. Da müßte dann auch Melichars
"Musik in der Zwangsjacke" gelesen und gespiegelt werden
an des Komponisten Anspruch. Jawohl, mehr eine Biographie
denn ein Katalog seiner Werke, mehr das sehr persönliche
Schicksal denn die Kompositionsverfahren. Hinzunehmen
wären dabei die sehr fragmentarischen Einsichten ins Oeuvre
zugunsten lückenlosen Wissens um eine Komponistenpersön­
lichkeit , die Zeit ihres Lebens einen Begriff von Wahr­
haftigkeit hatte und mutig für sie eingetreten ist.
Vorschlag 3: "Komponisten schreiben für den Film". Viele
taten es, z.B. Satie, Schostakowitsch, Eisler, Hindemith,
Saint-Saens, Prokofjew, auch Schönberg. Nicht nur mit
134
seiner den Mustern der Stummfilmmusiken abgehörten "Begleitungsmusik zu einer Lichtspielscene", sondern filmisch
waren auch die Absichten, die er zusammen mit Kokoschka
und Kandinsky bei seinem Opern-Einakter "Die glückliche
Hand" zu realisieren hoffte. Die Tatsache, daß alle Er­
eignisse auf der Bühne Projektionen von Hoffnungen, Wün­
schen und Ängsten sind, zeigt, wie sehr Schönberg daran
gelegen war, seelische Vorgänge mit den Mitteln der Farbe
und des Lichtes ins Optische zu übersetzen. Das Jahr 1913,
das Jahr der "Glücklichen Hand", und das Jahr 1929/3o, die
Zeit der "Begleitungsmusik", sind markante Daten in der
Geschichte der Stummfilmmusik: dort schwingt sie sich zur
orchestralen Üppigkeit auf, hier ist sie bereits vom Ton­
film überrollt. Wie bei meinem ersten Vorschlag ein für
Jugendliche erlebnishaft nachvollziehbares Thema nach dem
Gedanken: und dann und wann Schönberg in behutsamer Do­
sierung? vor allem aber: Schönberg nicht als der Zwölftöner, sondern als einer, der sich mit den neuen Ausdrucks­
möglichkeiten seiner Zeit, auch denen des jungen Films,
neugierig befaßte.
Vorschlag 4: Beim Nachdenken darüber, wie man aus einem
toten Methodiker einen lebendigen, in seiner Zeit tätigen,
leidenden, kämpfenden, kritisierenden Menschen machen kann,
damit ihn junge Menschen von heute gleichsam anfassen kön­
nen, schwebte mir eine Art sozialgeschichtlicher Kurs vor.
Und während er noch schwebt, flattert er mir als Manu­
skript fertig auf den Tisch (für einen der Folgebände der
"Studienreihe Musik"). "Arnold Schönberg und das Prinzip
'Kunstmusik'" nennt Wolfgang Martin Stroh sein im Unter­
richt getestetes Konzept, das an Umfang, Farbe, Wider­
sprüchlichkeit und vor allem an Möglichkeiten des handeln.
den Umgangs für Schüler nichts zu wünschen übrig läßt.
Ich denke, es wird bereits an den Kapitelüberschriften
deutlich:
"Oh, du lieber Augustin!" / "Arnold Schönbergs 2.Streich­
quartett op.lo" / "Spielkonzepte zum Lied 'Oh, du lieber
Augustin1" (in der Tat: hier werden verschiedene Formen
der harmonischen Verfremdung mit den Schülern wirklich
gespielt) / "Anwendung der Spielkonzepte für die Kompo­
sitionsanalyse" (die durch die Spielpraxis erworbenen Er­
kenntnisse gehen als Vorstufen in den analytischen Erkennt­
nis-Akt ein) / "Hinweise auf Form und Struktur des 2.
Satzes und auf weitere Kompositionstechniken" (der Kreis
zieht sich sukzessive weiter) / "Erfolg und Mißerfolg der
Musik Arnold Schönbergs" (das beruhigt jene Schüler, die
Verstehensschwierigkeiten weiterhin haben) / "Mögliche
Beurteilungen des Uraufführungsskandals" / "Mißerfolg als
Gütezeichen von Musik?" / "Kunstmusik, Volksmusik und
Unterhaltungsmusik" (hier kommt ein anderer Name ins Spiel:
1 35
Oscar Straus) / "Ein Walzertraum - ein Erfolg wird ge­
macht" / "Kunstmusik, Volksmusik und Unterhaltungsmusik
als drei Arten, Wirklichkeit zu verarbeiten". Um ein Bild
zu bemühen: Stroh hat einen Stein in ein gewähltes Zentrum
geworfen, in diesem Fall in den zweiten Satz des 2.Streich­
quartetts; von dort aus ziehen sich die Kreise immer wei­
ter: sie erfassen den Schriftsteller Schönberg, seine Wir­
kung, sein gesellschaftliches Umfeld und mit Oscar Straus
seine Gegenfigur. Stets bleibt der Schüler im Spiel: als
Lesender von Texten, die nach dem Gedanken der Widersprüch­
lichkeit montiert sind; als Singender und Spielender dort,
w o 1s möglich und nötig ist; als einer, der stufenweise
in der Erkenntnis fortschreitet; als einer, der im Span­
nungsfeld zwischen Schönberg und Straus zur wertenden Stel­
lungnahme provoziert wird. Ich nehme mir die Freiheit,
dieses Konzept für mustergültig zu halten. Es stellt ein
Stück Schönberg auf den Prüfstand, macht ihn befrag- und
erkennbar, macht ihn auch mit Hilfe der Spielkonzepte
be-greifbar, macht ihn zu einem Fall, den es abzuwägen
und zu bewerten gilt. Wissenschaftlichkeit, so sie sich wie
hier als eine zum Anfassen darstellt, muß in der Schule
doch nicht am fremden Ort sein, wenngleich der Begriff
"Wiener Schule" in diesem Konzept nicht vorkommt. Es sei
ihm gedankt.
Bestürzend freilich ist dieses: '75 Jahre nach der Urauf­
führung des 2.Streichquartetts von Schönberg führt es end­
lich und zum ersten Male in einem Schulbuch eine didak­
tisch-methodische Existenz, die es und seinen Komponisten
unverfälscht betrifft. Michael Alt und seine Hoffnung auf
die jüngere Generation von Musikerziehern - sie hat sich
lange gedulden müssen. Das ist für die Branche der Musik­
pädagogen, mich eingeschlossen, Grund genug zur Scham,
denn wie immer auch die Geschichte weiterhin ihr Urteil
über die sogenannte Zweite Wiener Schule fällen mag und
ob dieser eine längerfristige Wirkungsgeschichte erlaubt
sei oder nicht - so ich ihr Bild, das bisher von Schul­
büchern gezeichnet wurde, beim Wort nehme, muß ich schluß­
folgern : es wurde sowohl in der Absicht als auch in der
Sache verstümmelt. Und was das Dasein der Wiener Schule
in der Schule anlangt, kann - so lange sich die Schriften
Schönbergs lesen wie ein posthumer Protest gegen die weit
später geschriebenen Schulbücher - von einem wirklichen
Dasein kaum gesprochen werden ... wurden sie doch nicht
nach der Parole "Der Widerspenstigen Zähmung" gefertigt,
sondern nach dem Motto "Wie es Euch gefällt".
136
LITERATUR
Alt, M.:
Das musikalische Kunstwerk. Musik­
kunde in Beispielen für Gymnasien
Teil II, Düsseldorf -^1965
Ders.:
Didaktik der Musik. Orientierung am
Kunstwerk, Düsseldorf 1968
Binkowski, B. / Brändle, W. / Musik um uns. 7.-Io. Schuljahr,
Stuttgart 13i98o
Prinz, U. (Hg.):
Binkowski, B. / Hug, M. /
Koch, P . (H g .):
Musik um uns. 11.-13. Schuljahr,
Stuttgart 1°1978
Breckoff, W. et al.:
Musik aktuell, Kassel ®1978
Frisius, R. et al.:
Sequenzen. Musik Sekundarstufe I,
Stuttgart 1972
Hopf, H. et al.:
Lehrbuch der Musik Bd.2 / Band 3,
Wolfenbüttel 1972
Meierott, L. / Schmitz, H.-B.:Materialien zur Musikgeschichte für
die Sekundarstufe II, München 198o
Neuhäuser, M. / Reusch, A. /
Weber, H . :
Resonanzen Bd.2 / Bd.3, Arbeitsbuch
für den Musikunterricht, Frankfurt/M.
1973 bzw. 19 75
Noll, G. / Rauhe, H.
Musikunterricht Sekundarstufe I,
Mainz 198o
(Hg.):
Schließ, R. / Lischka, R.:
Ton und Taste. Unterrichtswerk für
Musik auf der Sekundarstufe 1,
Paderborn 1975
Schmidt, H.W. / Weber, A.
(Hg.) :
Die Garbe. Ein Musikwerk für Schulen,
Bd.3, Köln 31961
Schönberg, A . :
Ausgewählte Briefe. Ausgewählt und
hg. von E.Stein, Mainz 1958
Ders.:
Stil und Gedanken - Aufsätze zur Musik
=Vojtech, I. (Hg.): Gesammelte Schriften
1, Frankfurt 1976
Schutte, S. / Hodek, J.
(Hg.):
Studienreihe Musik, Stuttgart 1981 ff.
Wellek, A . :
Musikpsychologie und Musikästhetik,
Frankfurt/M. 1963
137
Werner Klüppelholz
KONTRAPUNKT UND KONFUSION
Über das Schreiben und Hören von Musik
im 2o. Jahrhundert
"Es ist wesentlich, zu bemerken", konstatiert Hegel in
seinen Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte,
"daß der Gang des Geistes ein Fortschreiten ist". Und we­
nig später: "Die Weltgeschichte stellt nun den Stufengang
der Entwicklung des Prinzips dar, dessen Gehalt das Be­
wußtsein der Freiheit ist" (7,13o). Zur gleichen Zeit be­
freit Simon Bolivar Ecuador von spanischer Herrschaft,
schreibt Beethoven das Streichquartett op.127, hebt die
Katholische Kirche das Verbot der kopernikanisehen Schrif­
ten auf, erfindet Sebastien Erard die Repetitionsmechanik
des Klaviers, wird Louis Pasteur geboren, tritt Johann
Strauß Vater als Bratschist dem Tanzorchester Lanners bei,
entdeckt Ferdinand Petrowitsch von Wrangel Inseln vor
Nordsibirien, läßt Schubert die h-Moll-Sinfonie unvoll­
endet und findet in Köln der erste Roseninontagszug statt.
Parallel zur technisch-industriallen, kapitalistischen,
ideologischen, innovativen Dynamisierung der Gesellschaft
kommt zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch die Musikge­
schichte in eine Bewegung, deren Tempo bis dahin unbe­
kannt gewesen, und an deren Ende der Untergang der Tona­
lität steht.
Ohne allzu grobe Gewaltsamkeit läßt sich
dieser Prozeß auch empirisch als ein einigermaßen line­
arer Fortschritt der Emanzipation des sich selbst entfes­
selnden kompositorischen Geistes beschreiben, als Befrei.
ung von den zwanghaften Selbstverständlichkeiten der Tra­
dition. Folgt man dem Bild des frühen Adorno vom späten
Beethoven, so markieren dessen Quartette und Bagatellen ei­
ne erste Station auf diesem Weg, indem sie sich den Anforde­
rungen der Form, der syntaktischen Entfaltung des Einfalls,
dem musikalisch-logischen Diskurs verweigern. Glättende Ver­
mittlung weicht abrupten Brüchen, fremdartige Prägungen
wechseln mit trivialen Floskeln, Musik, befreit vom Schein
der Ganzheit und Objektivität, handelt zum ersten Mal über
sich selbst. Folgte die Ablösung der Töne von Wort und
Stoff, eine Entwicklung, deren Herold Hanslick wa r , po­
stulierend , nichts als "musikalische Ideen" seien der ei­
gentliche Inhalt von Musik. Folgte das Entschwinden der
ursprünglichen Funktionen von Musik, Singen und Tanzen,
die noch Schönbergs erste Zwölftonkomposition, eine Suite,
wie beschwörend zu bewahren suchte; die Emanzipation der
schon länger von Klerus und Aristokratie unabhängigen
138
Musik auch vom bürgerlichen Markt, zugunsten ihrer sektenhaften Autonomie; die Entfesselung aus instrumentalen
Begrenztheiten, 19o6 von Busoni gefordert und ein halbes
Jahrhundert später eingelöst von der Elektronischen Musik
(die auf dem Gipfel der Autonomie, als serielle, sich
freilich stärksten Zwängen unterwarf); die strikte Abwen­
dung von symmetrischer Architektonik, auf der Busoni glei­
chermaßen bestand wie heutigentags Wolfgang Rihm, der
überdies sich nicht weiter vom guten Geschmack will gän­
geln lassen; der Verzicht auf Klang überhaupt, in Konzep­
ten wie Schnebels "MO - NO - Musik zum Lesen”; schließ­
lich, Klimax der Emanzipation, die Befreiung der Musik
von der Person des Komponisten in den Zufallsoperationen
des John Gage, so gesehen der Erbe Beethovens.
Den Prozeß der kompositorischen Emanzipation für jugendliche Laien wahrhaft nachvollziehbar, den Weltgeist sozu­
sagen experimentell in der Schulstube sichtbar zu machen,
ist indes der Musikdidaktik bislang nicht geglückt. Der
Hinweis, musikalischer Fortschritt sei doch so notwendig
wie jeder andere, verschlägt wenig, zumal in einer Welt,
in der gerade Musik - tonaler - immer häufiger die Aufgabe
zufallen dürfte, die unbewußt empfundenen Bedrohungen des
Fortschritts zu überspielen. "Will der Komponist uns auf
den Arm nehmen?" - "Ist das noch Musik?" - "Warum nur Dis­
harmonien? " - "Wo bleiben Gefühl (Melodie, Rhythmus...)?"
- "Ich habe da keinen Durchblick m e h r !" - "Das soll sich
anhören, wer will!" - oder, in durchaus vorwurfsvollem
Ton; "Wie ist es überhaupt zu einer solchen Art von Musik
gekommen?" Äußerungen siebzehnjähriger Frankfurter Gym­
nasiasten des Jahres 1982 über die "Tanzscene" aus Schön­
bergs Serenade aus dem Jahre 1923, die im Klassenzimmer
hervorragend dcirge'boten. wurde durch das "Ensemble Modern
der Jungen Deutschen Philharmonie". Auf Schönbergs Kontra­
punkt reagieren diese Hörer mit Konfusion, und zwar im
strikt juristischen Sinn des Begriffes; mit der Forderung
nach "Verständlichkeit" und - wenn man es kantianisch ausdrücken will - mit der Schuld der Unfähigkeit zum Ver­
stehen, beides vereint in derselben Person. Warum ist
Schönbergs Musik immer noch so schwer verständlich? Von
einem recht pragmatischen Verstehensbegriff ausgehend,
der auf Gewohnheiten, Erwartungsmuster und unbewußtes
Funktionsverständnis setzt (vgl.z.B. 6,61ff. und lo,225f.),
ist schlicht festzustellen, daß die nach wie vor tonal
und periodisch geprägten Erwartungsmuster einer übergroßen
Mehrzahl von Hörern zur Musik der Wiener Schule, nament­
lich Schönbergs und Weberns, schroff divergieren. Die
strukturelle Funktion von Klangelementen wird schon allein
deshalb nicht verständlich, weil das vermutlich heute ent­
scheidende Kriterium aller musikalischen Rezeption, die
139
physisch-psychische Gebrauchsfunktion von Musik, dort
subjektiv nicht erfüllt ist. Da ein naives und spontanes
"Verstehen" Schönbergs mithin nicht statthat, jedenfalls
bei den meisten seiner Werke, bedarf es pädagogischer Um­
wege, von denen einer über die sprachlich geäußerten Er­
klärungen der Avantgarde des 2o. Jahrhunderts führen
könnte. In didaktischer Absicht, mit dem Ziel einer Ver­
mittlung des Bewußtseins der Komponisten mit dem Bewußt­
sein jugendlicher Laien, gehe ich also der Schülerfrage
nach, welche Ursachen - jenseits des Weltgeistes - die
Neue Musik haben entstehen lassen, welche Motive der Kom­
ponisten - außer Geld, Ruhm und der Liebe von Frauen, wie
Freud den Künstlern unterstellt - bei der Revolution des
Tonsatzes wirksam waren.
Es waltet eine merkwürdige Dialektik von Freiheit und Not­
wendigkeit, Pflicht und Willkür. Ineinander verschränkt
sind die Selbstherrlichkeit des verfügenden Autors und
seine Unterwerfung unter die Gesetze des kompositorischen
Handwerks: "Nur Meister dürfen niemals alles schreiben,
müssen das Notwendige tun: ihre Aufgabe erfüllen" (14,
487).- "Ist es nicht die Pflicht eines jeden Künstlers,
einem zu erzählen, was man nicht weiß, wovon man nie zu­
vor gehört hat, was man niemals selber finden, entdecken
oder ausdrücken könnte?" (15,325) - "Wir haben eine Pflicht
gegenüber der Musik: sie zu erfinden" (19,38) . "Die musi­
kalische Vorstellung verlangt heute nach Klängen, die noch
niemand gehört hat" (17,218). Oft ist das Gefühl der Ver­
pflichtung zum Neuen verbunden mit einer Mentalität des
Forschers und Wissenschaftlers, der einsam und auf eigenes
Risiko seine Recherchen unternimmt: "Wenn z.B. Höhlenfor­
scher an einen engen Gang kommen, wo nur einer durchkann,
dann haben zwar gewiß alle das R e c h t , dieses Frage
zu prüfen, und doch wird man nur einen beauftragen und
sich auf sein Urteil verlassen müssen. Solche engen Gänge
führen aber zu allen unbekannten Stätten, und wir wüßten
immer noch nicht, wie die Gegend am Nordpol beschaffen ist,
wenn wir warteten, bis die Mehrheit sich entschließt,
selbst nachzusehen" (15,255). Doch scheint der Komposi­
tionsforscher des 2o. Jahrhunderts weniger ein autonomes
Individuum als vielmehr getrieben zu sein von höheren
Mächten: "Ein Komponist präludiert, wie ein Tier wühlt.
Beide tun es aus dem Drang des Suchens" (19,39). - "Das
Schaffen des Künstlers ist triebhaft. Er hat das Gefühl,
als wäre ihm diktiert, was er tut. Als täte er es nur nach
dem Willen irgendeiner Macht in ihm, deren Gesetze er nicht
kennt. Er ist nur der Ausführende eines ihm.verborgenen
Willens, des Instinkts, des Unbewußten in ihm. Ob es neu
oder alt, gut oder schlecht, schön oder häßlich ist, er
weiß es nicht. Er fühlt nur den Trieb, dem er gehorchen
14o
muß" (14,497). - "Der Mensch ist nur das Gefäß, in das
gegossen ist, was die 'allgemeine Natur 1 ausdrücken will"
(2o,ll). - "Ich habe es seit vielen Jahren unzählige Male
gesagt und manchmal geschrieben: Daß ich nicht MEINE Mu­
sik mache, sondern die Schwingungen übertrage, die ich
auffange; daß ich wie ein Übersetzer funktioniere, ein
Radioapparat bin. Wenn ich richtig, in der richtigen Ver­
fassung komponierte, existierte ich SELBST nicht mehr"
(18,365). Von den noblen Vorbildern - goetheanisches Den­
ken bei Webern, asiatisches Nicht-Denken bei Stockhausen einmal abgesehen, führen solche, ein wenig an die Tatbe­
gründungen paranoider Straftäter gemahnende Äußerungen
tief in mythische Gefilde. Die Berufung auf höhere Mächte,
dem Ich des Komponisten übergeordnete Befehlsinstanzen
macht aber die Notwendigkeit des Neuen wie die Pflicht
zur Forschung zu einer Sache des Glaubens, zu einer irre­
duziblen Größe und läßt den nach Begreifbarkeit durch
Nachvollziehbarkeit suchenden Laien auf ein erstes, kaum
überwindliches Hindernis im Labyrinth der Motive stoßen.
Eine Gemeinsamkeit so unterschied1ieher Komponisten wie
Schönberg, Strawinsky, Webern und Stockhausen liegt also
im Empfinden einer ethischen Pflicht zur Fortentwicklung
der Musik. Hat sich solch ein Glaube an den musikalischen
Fortschritt mitsamt dem Optimismus, der ihn getragen, seit
Beginn der sechziger Jahre auch verflüchtigt, geblieben
ist - zumindest in der heute mittleren Komponistengenera­
tion - das Gefühl sittlicher Verantwortung. Ob Gage ver­
sucht, "die Menschen freizusetzen, ohne daß sie dumm wer­
den" (3,lo2), Nono Musik als "Moment der Bewußtwerdung,
des Kampfes, der Provokation, der Diskussion, der Teil­
nahme" versteht und Komponieren als gleichwertig der Teil.
nähme an einem Streik sinsieht (16, 23o) , Henze Werke sehr ei­
ben möchte, die dem Sozialismus nützen, Schnebel mit Musik
Aufklärung "in Richtung auf besseres Verhältnisse" leisten
will (12,32) - stets handeln die Genanntem nach Maßgabe
künstlerischer wie zugleich sozialer Motive?. Einzig Kagel
bekennt, da Neue Musik ja ohnehin nicht gebraucht würde,
schreibe er, was e;r wolle, mit der Einschränkung aller­
dings: "Komponieren ist für mich viel eher eine Frage von
Ethik als eine von Begabung" (12,91), womit gemeint ist,
die Lebenszeit von Hörern nicht durch überflüssige Wieder­
holungen der Musik zu verkürzen, was Heinz-Klaus Metzger
in den unvergleichlichen Satz faßt, alle schlechte Musik
"gravitiert zum Mord".
Dem Reich der Fron ist aber auch in Neuer Musik ein Reich
des Spiels hinzugesellt. Strawinsky spricht vom "Wohlbe­
hagen der Schöpfung", ebenfalls von Liebe, Appetit und
Reizung - Komponieren mithin als sublimiert libidinöser
141
Akt. "Ich glaube, daß ein wirklicher Komponist aus keinem
anderen Grund schreibt, als weil es ihm Freude macht",
bemerkt Schönberg, um dann die Bewunderung der Militär­
genossen gegenüber seinem Schreibtempo zu zitieren (15,
lo5). Ähnliches bekennt Hindemith: "Die materialbedingten
Einschränkungen aber nicht nur als Last zu empfinden, sie
im Gegenteil als schöpfungsfördernd vorteilhaft auszu­
nutzen, ist von jeher die Aufgabe des Komponisten gewesen
und ist, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung reden darf,
sogar einer der reizvollsten Teile der kompositorischen
Arbeit und vielleicht der, wenn der Ausdruck erlaubt ist,
sportlich interessanteste" (8,184) . Komponieren heißt dem­
nach auch, ein Metier zu beherrschen, Widerständen trotzen
zu können, Kompetenz zu demonstrieren, Sieger über die
Noten zu bleiben, allgemeine, etwa des Kontrapunkts, oder
individuelle Regeln zu meistern. Schönbergs ironische
Inversion, in der Dodekaphonie seien Konsonanzen nur vor­
bereitet und auf schlechtem Taktteil gestattet, bietet
eine Formel solchen Handwerkerstolzes. Im Gegensatz zur
überprüfbaren Erfüllung obj ektiv gegebener Regeln und
doch im Einklang damit steht ein spezifisches Maß an Subjektivität, das gerade die als emotionslos gescholtenen
Schönberg und Webern "Gefühl" nennen: "Ich habe dabei das
Gefühl gehabt: Wenn die zwölf Töne abgelaufen sind, ist
das Stück zu Ende", nämlich eine der Bagatellen Weberns
op.9. Oder er spricht von Schönbergs zweitem George-Lied:
"Es wird nicht mehr zum Grundton zurückgekehrt; den Schluß
fühlt ohnehin jeder". Und vom fünften; "Das Lied kehrt zu
seinem Anfang zurück. Für das feinere Formgefühl war es
aus, und eine Wiederholung wäre eine Trivialität für das
feinere Empfinden" (2o,53ff.). Der Verzicht auf Gemein­
plätze bedürfe allerdings des Mutes» Durch Sperrdruck ak­
zentuiert, enthält Schönbergs Harmonielehre eiinen Satz,
der allem Regelgehorsam und Weltgeistzwang zu widerspre­
chen scheint: "Der Künstler, der Mut hat, überläßt sich
ganz seinen Neigungen. Und nur der sich seinen Neigungen
überläßt, hat Mut, und nur wer den Mut hat, ist Künstler"
(14,479) . Diese triadische Tautologie hä'lt den gordischen
Knoten der Neuen Musik zusammen. Die Neigungen und - weit
gewichtiger - Abneigungen des Komponisten sind eben so,
wie sie sind. Mit einem Schlag befreit sich Schönberg von
der Bürde aus Ethos und Tradition, wird zum autonomen
Subjekt, das sich vor allem durch Idiosynkrasie gegen
Wiederholungen leiten läßt, gegen die forma1e , werkin­
terne Wiederholung, etwa als Sequenz und - möge eine solch
umstandslose Analogie erlaubt sein - gegen die materiale,
werkexterne, zum Beispiel die der als abgegriffen angese­
henen Konsonanzen der vorausgegangenen Epochen. Mokant ver­
merkt- Eisler, Schönberg habe nie erklären können, was ihn an
142
Konsonanzen störe, außer, seine Musik sei eben Resultat
des persönlichen Geschmacks und seines Formgefühls (vgl.
5,393). Was hat Schönbergs geschmackliche Abneigungen ge^
prägt? Ein Überdruß an der Tonalität in der Unterhaltungs-.
musik oder im musikalischen Historismus? Entsprang die
Atonalität am Ende einer Allianz beider? Jedenfalls müssen
die Kategorien Gefühl und Geschmack einer logischen Ab^.
leitung ebenso entraten wie die ethische Pflicht zur Innovation.
Um so mehr war gerade den Komponisten der Wiener Schule
an einer geschichtlichen Legitimation ihrer Musik gelegen,
die dem Vorwurf der Willkür begegnen sollte. Vor allem
der Musikhistoriker Webern, dessen Geschichtsbewußtsein
durchaus teleologische Züge trägt, durchmustert die Ver­
gangenheit nach Analogien und Vorläufern, um damit die
eigene Position sich und anderen zu erläutern: "Die erste
Bresche (sc.zur Atonalität) finden wir in den Sonatensätzen,
wo in die Haupttonart manchmal irgendeine andere Tonart
wie ein Keil eingesprengt ist. Dadurch wurde die Haupte
tonart zeitweise beiseite gedrängt. - Und dann in der Ka­
denz. - Was ist eine Kadenz? - Das Bestreben, eine Tonart
abzugrenzen gegen alles, was sie beeinträchtigen könnte.
- Man wollte aber die Kadenzen immer eigenartiger gestal­
ten und das führte schließlich zur Sprengung der Haupte
tonart"; es folgt ein Hinweis auf den Schluß von Brahms'
Parzengesang (2o ,47f f .) . "Zusammenfassend ist zu sagen:
Wie die Kirchentöne verschwanden und nur zwei Tonarten
Platz machten, so sind dann jene zwei auch verschwunden
und haben einer einzigen Reihe Platz gemacht: der chro­
matischen Skala" (2o,38). Den Kontrapunkt der Wiener Schu­
le, die Integration von Melodik und Harmonik, leitet We­
bern derart ab: "Aus der Begleitung wurde aber auch etwas
anderes: Man bestrebte sich, dem Komplex, der neben dem
Hauptgedanken einherging, noch eine besondere Bedeutung
zu geben, mehr Selbständigkeit als sie einer bloßen Be­
gleitung zukommt. - Und da hat den Hauptvorstoß Gustav
Mahler geleistet - das wird meist zu wenig beachtet! - So
wurde aus den Begleitformen eine Reihe von Gegengestalten
zum Hauptthema - und das ist eben polyphones Denken! Der Stil also, den Schönberg und seine Schule sucht, ist
eine neue Durchdringung des musikalischen Materials in
der Horizontalen und in der Vertikalen, eine Polyphonie.
die ihre Höhepunkte bisher gefunden hat bei den Nieder­
ländern und bei Bach, und dann weiter bei den Klassikern"
(2o,37). Solche und eine Fülle weiterer Verweise - auch
bei Schönberg, der etwa den Gebrauch der Ganztonskala als
historisch zwingend ansieht (vgl. 14,467), oder bei Berg,
der Parallelen zu seiner eigenen Singstimrnenbehandlung in
Schubert-Liedern erblickt (vgl. 2,3ol) - gehen indes von
143
einer kontinuierlichen Evolution aus, die künstlerisch
ebenso wenig existiert wie - denkt man an das Geschichts­
bild von Karl Marx - politisch. Weder war der Zusammen­
bruch der Tonalität unabweisbar konsequent (oder die Füh­
rungsrolle Schönbergs statt Hauers zum Beispiel), noch
wird es der - vielleicht niemals eintretende - Exitus
des Kapitalismus sein. Die historischen Deduktionen der
Wiener Schule appellieren an die Logik, ohne sie demon­
strieren zu können. Gleiches gilt von den außermusika­
lischen Analogien, derer sich Schönberg zuweilen bedient:
"Beispiele für diesen Begriff (veraltet) lassen sich eher
in unserem Alltag als im intellektuellen Bereich finden.
Langes Haar, zum Beispiel, galt vor dreißig Jahren als
bedeutender Beitrag zur weiblichen Schönheit. Wer weiß,
wie bald die kurzhaarige Mode veraltet sein wird? Pathos
war vor etwa hundert Jahren einer der am meisten bewun­
derten Vorzüge der Dichtkunst; heute mutet es lächerlich
an und wird nur zu satirischen Zwecken verwendet. Das
elektrische Licht hat das Kerzenlicht veralten lassen;
aber Snobs benutzen das letztere immer noch, weil sie es
in den Schlössern des Adels gesehen haben, wo kunstvoll
geschmückte Wände durch elektrische Leitungen zerstört
worden wären. Zeigt dies an, weshalb etwas veraltet?
Langes Haar wurde altmodisch, weil arbeitende Frauen es
als hinderlich ansahen. Das Pathos wurde altmodisch, als
der Naturalismus das wirkliche Leben und die Sprechweise
der Menschen, wenn sie ihre Geschäfte zu Ende bringen
wollten, nachzeichnete. Kerzenlicht wurde altmodisch, als
die Leute merkten, wie sinnlos es ist, seinen Dienstboten
- wenn man sie überhaupt bekommen kann - unnötige Arbeit
zu machen. Der gemeinsame Faktor bei all diesen Beispie­
len war ein Wandel unserer Lebensformen" (15,29f.). Schön­
bergs Text, bemerkenswert Brechtschen Charakters und in
der ersten Fassung aus dem Jahre 19 3o stammend, zeigt ein
funktionales Denken, das alles tilgen will, was zeitrau.
bend, hinderlich, langatmig, kurz: instrumentell unbe­
gründet ist. Ihm, wie man weiß, gab die Moderne, beispiels­
weise Adolf Loos, und mit ihr die Wiener Schule ästhe­
tischen Ausdruck; noch immer beharrt das Publikum hinge­
gen auf Atmosphäre und Sinnlichkeit in der Musik.
Fassen wir zusammen, wie sich das Bewußtsein unseres re­
präsentativen, wenn auch aus mehreren authentischen Indi­
viduen zusammengesetzten Komponisten, unseres wiederer­
weckten Adrian Leverkühn darstellt, welche Motive ihn an­
treiben und lenken. Die Pflicht zur Klangforschung, die
Lust am Kontrapunkt und der Abscheu vor dem Verbrauchten
sind die Antriebe seines kompositorischen Handelns, das
sich, zudem kraft Parallelen zur musikalischen Tradition
und zur allgemeinen Lebensweise seiner selbst gewiß sein
144
darf. Welche Vorstellungen hat Leverkühn vom Hörer?
Solche, das sei vorweg bemerkt, in denen sich - wie es
scheint - apologetische Naivität mit resignativem Wirk­
lichkeit ssinn mischen. Zentral für Webern, der unter an­
derem in Vortragsreihen über Neue Musik pädagogische Ar-,
beit geleistet hat, ist der Begriff der "Faßlichkeit",
den er definiert als "etwas, was überblickbar ist, dessen
Konturen ich überschauen kann" (2o,18ff.). Für die Voraus­
setzung von Faßlichkeit hält er den internen, strukturellen
Zusammenhang der musikalisehen Konstruktion: "Die Kompost-,
tion mit zwölf Tönen hat einen Grad der Vollendung des
Zusammenhangs erreicht, wie er früher auch nicht annä­
hernd vorhanden w a r . Es ist klar, wenn Beziehung und Zu­
sammenhang überall gegeben ist, daß dann auch die Faßlich­
keit garantiert ist11. Und nach Hinweisen auf die Wieder­
holung in Gregorianik und Beethovenscher Sinfonik lautet
Weberns Conclusio: "Aus dieser einfachen Erscheinung her­
aus , aus dieser Idee, etwas zweimal, öfter, möglichst oft
zu sagen, sich verständlich zu machen, haben sich nun die
kunstvollsten Dinge entwickelt, und wenn Sie wollen, kön­
nen wir den Sprung in unsere Zeit machen: Unsere Zwölftonkomposition beruht darauf, daß ein gewisser Ablauf der
zwölf Töne immer wiederkommt: Prinzip der Wiederholung!"
Was sich liest wie die Beschreibung der repetitiven Musik
unserer Tage, deren minimale Veränderungen sich der ge­
ringen Fähigkeit des ungeübten Ohres, Konturen zu erfassen,
nachgerade elementarpädagogisch anbequemt, meint hier tat­
sächlich die Dodekaphonie. Webern wähnt, deren Komponisten
hätten alles getan, um Verständlichkeit zu gewährleisten,
die nur noch auf den Mitvollzug des willigen Hörers ange­
wiesen sei. Was als "adäquates Hören", der Hörertypologie
Adornos entstammend, um 197o im didaktischen Konzept der
Hörerziehung Verbreitung fand, wurde zuerst von Alban Berg,
zu Beginn seines Essays "Warum ist Schönbergs Musik so
schwer verständlich?" formuliert: "Diese Sprache durchweg
zu verstehen und auch in ihren Einzelheiten zu erfassen,
das heißt, ganz allgemein ausgedrückt: Einsatz, Verlauf
und Ende aller Melodien zu erkennen, den Zusammenhang der
Stimmen nicht als Zufallserscheinungen, sondern als Har­
monien und Harmoniefolgen zu hören und die kleinen und
großen Zusammenhänge und Gegensätze als solche zu spüren,
kurz und g u t : einem Musikstück ebenso zu folgen, wie man
dem Wortlaut einer Dichtung folgt, deren Sprache man voll
beherrscht, ist für den, der die Gabe besitzt, musikalisch
zu denken, gleichbedeutend mit dem Verständnis des Werkes
selbst" (1,142) . Schönberg will den Hörer in die Pflicht
nehmen, die ihn selbst umfangen hält: "Und ist es nicht
die Pflicht des Zuhörers, offen zu sein für das, was der
Künstler zu sagen hat, und nicht Enttäuschung heraufzubt
145
schwören, indem er Dinge erwartet, die der Künstler nicht
zu erzählen beabsichtigt? (...) Die einzig richtige Hal­
tung einem neuen oder unbekannten Werk gegenüber ist, ge­
duldig abzuwarten, was der Autor sagen will" (15,325).
Auch ein listiger Appell an des Hörers Intelligenz dürfte
wenig Früchte getragen haben: "Intelligente Menschen sind
zu allen Zeiten beleidigt gewesen, wenn man sie mit Din­
gen belästigt hat, die jeder Trottel sofort verstehen
konnte" (15,3o). Die eigene Lage sieht Schönberg mit
durchaus realistischem Blick: "In meinem Kompositions­
stil ist häufig dieser Umstand eine der Hauptursachen,
warum ich so schwer zu verstehen b i n : ich variiere unun­
terbrochen , wiederhole fast niemals unverändert, springe
rasch auf ziemlich entlegene Entwicklungserscheinungen
und setze voraus, daß ein gebildeter Hörer die dazwischen­
liegenden Übergänge selbst zu finden imstande ist. Ich
weiß, daß ich mir damit nur selbst Enttäuschungen bereite,
aber es scheint, daß die Aufgabe, die mir gestellt ist,
keine andere Darstellungsweise zuläßt" (15, 257) . Summieren
wir die Voraussetzungen, die nach den eigenen Worten der
Autoren unerläßlich sind zum Verständnis dieser Musik:
eine unbedingte Offenheit gegenüber dem Unbekannten, ad­
äquater Mitvollzug, Formgefühl und die Fähigkeit zur ima­
ginativen Verbindung von Formteilen. Solche Voraussetzun­
gen dürften jedoch ihrerseits von weiteren Voraussetzungen
abhängen, die Berg implizit beschreibt, nämlich einer in­
timen Kenntnis von Kompositionsregeln und einer beweg­
lichen musikalischen Phantasie. Damit die Musik Schön­
bergs und anderer für Laien nicht länger Galimathias
bleibt, damit eine amorphe Klangmasse wirklich als Musik
aufgefaßt werden kann, dünkt - .mag es auch utopisch an.
muten - Unterweisung im Kontrapunkt unerläßlich. "Fabriquer c 'est comprendre", diese Devise Mersennes erweist
ihre Aktualität gerade an autonomer Neuer Musik, soll die
Bereitschaft und Fähigkeit zu ihrer ästhetischen, nicht
biographischen oder programmatischen Rezeption geweckt
werden. Das populär stets aufs Neue geforderte spontane
"Verstehen" scheint nämlich vor allem von einem Kriterium
bestimmt, das von der Rezeptionspsychologie bisher kaum
bemerkt wurde, von der Reproduktionsfähigkeit des Hörers.
Der Vorwurf fehlender Melodie meint eigentlich nichts
als einen Mangel an Nachsingbarkeit; ein Rhythmus gilt
als unverständlich, wenn er nicht direkt reproduzierbar
erscheint, wie die mit Körperrhythmen korrespondierenden
periodischen Zeiteinteilungen der Popmusik. Verstehbar
ist demnach nur, was beschränkt ist auf die eigenen leib­
lichen Fähigkeiten des Hörers. Da die kontrapunktisehe
Komplexität der Wiener Schule, die sich einem homophonen
Hören.verschließt, sich nicht auf solche rudimentären
146
Fähigkeiten reduzieren läßt, ist ihr Verständnis nur auf
dem Weg analytischer Vermittlung, nur über eine Aneignung
der ihr zugrundeliegenden Regeln denkbar. Das Schönberg oder die serielle Musik - verstehende Publikum schrumpft
mithin auf eine winzige Zahl kompositorisch kompetenter
Kenner. Auch diese Gegebenheit ist in Nietzsches, des Mu­
sikpsychologen hellsichtiger Trennung zwischen alter und
neuer Musik enthalten: "Übrigens wirkt fast jede Musik
erst von da an zauberhaft, wo wir aus ihr die Sprache
der eigenen Vergangenheit reden hören: und insofern scheint
dem Laien alle alte Musik immer besser zu werden, und alle
eben geborene nur wenig wert zu sein: denn sie erregt noch
keine 1Sentimentalität', welche, wie gesagt, das wesent­
lichste Glücks-Element der Musik für j eden ist, der nicht
rein als Artist sich an dieser Kunst zu freuen vermag"
(11,941). Hier sind freilich zwei Einschränkungen geboten:
zum einen wußte Nietzsche noch nichts von den Kurven der
ReizSättigung, die zum Überdruß an einer Musik führen kann,
zum anderen besteht Schönbergs Hörerschaft offenbar nicht
ausschließlich aus Artisten. Unter der Überschrift "Mein
Publikum" zählt Schönberg selber auf: einen Feldwebel, der
"viele Werke" kannte; je einen von den Gurre-Liedern be­
geisterten Nachtportier und Chauffeur; den bereits kranken
Puccini und einen Fahrstuhlführer, beide beeindruckt vom
"Pierrot lunaire". Vom letzteren gibt Schönberg wieder:
"Den (Pierrot) habe er nämlich vor dem Krieg (etwa 19121)
bei der Erstaufführung gehört und habe noch heute den
Klang im Ohr; insbesondere von einem Stück, wo von roten
Steinen ('Rote fürstliche Rubine') die Rede war. Und er
habe dama1s gehört, daß die Musiker gar nichts mit dem
Stück anzufangen wußten, und heute sei so etwas doch schon
ganz leicht verständlich!" (15,248f.). Hier irrt der Fahr.
stuhlführer, denn die Verbreitung Neuer Musik, angewiesen
auf Verständnis, hängt kaum oder nur in geringem Maße von
der Chronologie ihrer Entstehung ab, wovon nicht nur die
eingangs zitierten Gymnasiasten Zeugnis geben. Die Musik
der Wiener Schule . Berg stets ausgenommen - oder der
seriellen steht immer noch den durchschnittlichen Erwar­
tungsmustern zu fern, um allein durch Gewöhnung des Ohrs
als ästhetisches Objekt, als autonome Musik rezipiert zu
werden. Bei einem Publikum, dem das Ethos des komposi­
torischen Fortschritts oder der politischen Aufklärung
durch Musik ebenso fremd ist wie die Abneigung von Kom­
ponisten gegen Wiederholungen, das zu interesselosem Wohl­
gefallen und zu einer von persönlichen Bedürfnissen ab­
sehenden Kontemplation kaum in der Lage ist, das im Ge­
genteil - und die Daten sämtlicher Präferenzstatistikejn
deuten darauf hin - Musik primär als Mittel der psychi­
schen Hygiene, als Medium der Regression von gesellschaft­
147
lichem Druck benutzt, müssen andere Faktoren beim Ver­
ständnis und der Verbreitung Neuer Musik wirksam sein als
ästhetische. Die Frage von Carl Dahlhaus, warum dasselbe
Publikum Schönbergs "Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene" im Konzertsaal nicht erträgt, als Musik zu einem
Film aber sehr wohl akzeptiert (vgl. 4,291), führt hier
auf eine Spur, die eigentlich schon bei den roten Steinen
des Fahrstuhlführers beginnt.
Welche Teile der Neuen Musik haben Verbreitung gefunden,
welche Werke haben - wie es heißt - sich durchgesetzt,
welche Komponistennamen stehen für "erfolgreiche" Musik
im 2o. Jahrhundert? Nimmt man als Indikator für Erfolg
den gesellschaftlich stets noch angesehensten, die rein
quantitative Verbreitung einer Sache, und vermeidet man
das mühsame Stöbern in Verlaqsarchiven oder Konzertpro­
grammen (die indes kein wesentlich anderes Bild bieten
dürften), geht man überdies von der Annahme aus, daß
Schallplattenfirmen weniger mäzenatische als ökonomische
Zwecke verfolgen, so läßt sich aus der neuesten Fassung
des Bielefelder Katalogs mit Leichtigkeit eine Hitliste
des 2o. Jahrhunderts erstellen (von Beethovens Neunter
werden hier übrigens 3 6 Versionen feilgeboten):
1. Strawinsky: "Le Sacre
du printemps"
(21 Einspielungen)
2. Strawinsky: "Feuervogel"
(18 Einspielungen)
3. Strawinsky: "Petruschka"
(17 Einspielungen)
4. Bartok: "Konzert für Orchester" /
Orff: "Carmina burana"
je (13 Einspielungen)
5. Bartok: "Sonate für zwei Klaviere
und Schlagzeug"
(lo Einspielungen)
6 . Bartok: "Allegro barbaro" und
"Musik für Saiteninstrumente,
Schlagzeug und Celesta"
je; ( 8 Einspielungen)
7. Strawinsky: "Apollon Musagete" /
Messiaen: "Apparition de l'Eglise
eternelle" und "Le Merle no.ire"je( 7 Einspielungen)
8 . Messiaen: "Quartett auf das Ende
der Zeit" / Bartok; "Herzog Blau­
barts Burg" / Strawinsky: "Circus
Polka" und "Pulcinella" / Schönberg:
Klavierstücke op.11 und op.19 /
Webern: Streichquartett-Sätze op.5
und Klavier-Variationen op.27 je ( 5 Einspielungen)
Ungleich schwieriger erscheint die Frage nach den Erfolgsbedingungen solch unterschiedlicher Werke. Bei manchen
Stücken, etwa Messiaens, spielen vermutlich religiöse
Gründe hinein, bei anderen, etwa Orffs, folkloristisehe.
Zu konstatieren ist j edenfalls die unbestrittene Dominanz
148
Strawinskys und Bartoks einerseits, die relativ geringe Re­
präsentanz - mit wenig aufwendigen, sozusagen billigen
Stücken - Schönbergs und Weberns andererseits. Die Vor­
herrschaft Bartoks und Strawinskys verwundert freilich
wenig, da ihre Musik den beschriebenen Erwartungsmustern
noch am ehesten entgegenkoromt. Der Ostinato etwa kann als
spontan verstehbares Ordnungssystem gelten, das die Re­
zeption ungemein erleichtert, was heutigentags an der re^petitiven Musik ersichtlich ist, die - zumindest nach dem
Willen von Steve Reich - der Wahrnehmung keine größeren
Anforderungen zumuten möchte, als zur Beobachtung eines
Uhrzeigers notwendig (vgl.13,9). Auch daß gerade Ballett­
musik eine unangefochtene Spitzenstellung einnimmt, will
in einer Epoche des Films, der die stereotype Beförderung
von Bildern durch klangliche Gesten zur Gewohnheit machte,
wenig überraschen. Strawinskys 11Sacre", Bartoks "Blaubart"
und Messiaens Quartett aber stehen zugleich für eine bis­
her weniger beachtete Tendenz innerhalb der Neuen Musik,
für ihre programmatische Bindung ans Unheil, an Tod und
Verderben, Krieg und Mord, Geisteskrankheiten und alles
andere, was Unlustgefühle, Betroffenheit oder schlechtes
Gewissen zu zeitigen sich eignet. Pendereckis "Threnos Den Opfern von Hiroshima" bietet dafür ein kühl kalku­
liertes Beispiel, und es ließe sich -. jenseits solch kom­
merziellen Hintersinns - von Schönbergs "Überlebendem aus
Warschau" über Frederic Rzewskis "Coming together", das
die Gefängnis-Metzelei in Attica zum Gegenstand hat, bis
zu Vinko Clobokars jüngstem "Miserere", einem Stück über die
Fremdheit von Gastarbeitern, eine lange Reihe von Gebilden
aufstellen, die durch Titel, Text oder Libretto einer Äs-,
thetik des Häßlichen und einem Realismus des Unerfreu­
lichen verbunden sind. Je einsichtiger, erfahrungskon­
former, nachfühlbarer die gleichsam programmatische Au f ­
ladung von Dissonanz und Dichte dem Publikum erscheint,
desto stärker wächst offenbar dessen Bereitschaft zur
Wahrnehmung. Dies dürfte gerade den Typus einer Art lo­
gischen Wahnsinns erklären, der sich in den letzten Jahren
auf der Opernbühne etabliert hat, von Pendereckis "Die
Teufel von Loudun", Peter Michael Hamels "Ein Menschen­
traum", Volker David Kirchners "Die Trauung" bis zu Rihms
Kammeroper "Jakob Lenz", seinem "Tutuguri"-Ballett, auch
seinem "Wölfli~Liederbuch", die allesamt über geistige
Störungen und krankhafte Visionen handeln. Zu vermuten
steht, daß die Musik dabei kaum getrennt vom sprachlichen
oder szenischen Inhalt wahrgenommen, vielmehr als dessen
Illustration aufgefaßt wird, daß also die ästhetische ei­
ner semantischen Rezeption weicht. Die Programme fungieren
als Vermittlung zwischen Neuer Musik auf der einen, Be­
wußtseinsstand und Erfahrung eines Publikums, das alle
149
Kunst an sich selber mißt, auf der anderen Seite. Schön­
bergs "Begleitungsmusik" wird somit nicht länger als un­
taugliches Regressionsvehikel verurteilt, sondern als
tönende Umhüllung etwa eines Krimis verstanden und goutiert. Eine weitere, dem verwandte Tendenz ist in unserer
Rangfolge durch Strawinskys "Pulcinella" repräsentiert,
die Musik der historischen Vergleichbarkeit zu nennen
wäre. Seien es Gattungen wie Pendereckis Lukas-Passion,
Ligetis "Requiem" oder Berios "Sinfonia", durchweg Er­
folgsstücke, seien es Einzelwerke wie Kagels "Variationen
ohne Fuge..." auf der Grundlage der Brahmsschen HandelVariationen, seien es schließlich klassische Stücke der
Sprechbühne, wie Reimanns "Lear" - stets suchen die Kom­
ponisten dabei an das Vorwissen eines Bildungspublikums
anzuknüpfen, Altes als Folie des Neuen zu nutzen und so­
mit einen Reiz zu provozieren, der dem Vergleich zwischen
Einst und Jetzt entspringt. Die Literaturoper wie das
Paraphrasenwesen des vergangenen Jahrzehnts dürften sich
gleichermaßen dem Versuch der Komponisten verdanken, bei
dem anzusetzen, was Hörern vertraut sein könnte. So peri­
pher der Rang ist, den Schönbergs quantitative Verbrei­
tung auf dem Musikmarkt einnimmt, so ist auch den genann­
ten Moden gegenüber die Neue Musik als Geschichte kon­
struktiver Lösungen autonomer kompositorischer Probleme
ins Abseitige geraten. Sie lebt weiter in Einzelnen, wie
Klarenz Barlow, oder unter dem Schutz von Institutionen,
wie des IRCAM zu Paris oder des Utrechter Studios für
Sonologie, die dem Forschergeist der Wiener oder Darm­
städter Schule heute eine computerbewehrte Heimstatt
bieten. Vollends in den Hintergrund des zerklüfteten Pan­
oramas der Neuen Musik sind solche Autoren geraten, die
sich Adornos Diktum vom Gedicht nach Auschwitz zu Herzen
genommen haben und den Klängen nur gestatten, die Zweifel
an der eigenen Daseinsberechtigung in einer Welt des Bö.
sen verstummend auszudrücken, wie es zum Beispiel Mathias
•Spahlinger in dem charakteristisch betitelten Stück
"Pho
nophobie" unternimmt.
Wie soll nun die schulische Musikdidaktik auf derlei Ent­
wicklungen reagieren, wie könnte sie die Konfusion des
Hörers mindern, was hätte sie zu leisten jenseits der
fatalen "Didaktischen Analysen", die gemeinhin den Schü­
ler blindlings als voraussetzungslos bildbares Objekt
unterstellen? Sie hätte zunächst das wirklichkeitsfremd
puristische Postulat des "adäquaten Hörens" aufzugeben,
wie es die Komponisten selber, namentlich seit den sieb­
ziger Jahren, aufgegeben haben. Objektiv angemessen sind
die Werke der Wiener oder der seriellen Schule - eigent­
lich Musik von Komponisten für Komponisten - nur zu hö­
ren ,'wenn die theoretischen Voraussetzungen dazu als
15o
Bezugssystem gegeben sind. Doch Schüler zu Experten des
neuzeitlichen Tonsatzes erziehen zu wollen, wäre unter
den derzeit obwaltenden Umständen des Musikunterrichts
wohl illusorisch, bestenfalls als rare Ausnahme möglich,
unbeschadet der Erfahrung, daß sowohl die rationale Kon­
struktion Neuer Musik als auch ihre historische Ableitung
Motivation und Interesse zuweilen wecken können. Aber ge­
rade - ein durchaus eigentümlicher Befund - bei den bis­
lang bedeutsamsten Protagonisten der Moderne, Schönberg
und Webern, bietet der letztere W e g , da von einer Viel­
zahl von Voraussetzungen abhängig, meist unüberwindliche
Schwierigkeiten. Denn die verstehende Rekonstruktion von
Schönbergs Geschmack und Formgefühl läßt sich nur auf mu­
sikalischen Bahnen vollziehen; Worte, das notgedrungen
gebräuchlichste Medium des Musikunterrichts, vermögen
wenig. Sie können kaum das Empfinden musikalischer Schön­
heit vermitteln, nach dem Laien lechzen und das sie in
der Tonalität völlig mühelos befriedigen oder ohne allzu
große Mühe in den Werken der Neuen Musik, die von tonalen
Strukturen leben. Der übrige Teil, die meiste autonome
Neue Musik, dürfte noch für längere Zeit dem Verdikt der
Un-Musik anheimfallen. Mag sein, daß die wie auch immer
gearteten programmatischen Bindungen - von Bergs "Wozzeck"
bis Rihms "Jakob Lenz" - als Reflex dessen gelten können,
daß die Komponisten selbst die Schwierigkeiten einer äs­
thetischen Rezeption durch semantische Zugänge zu erleich­
tern suchen. Welchen Zorn erregt ein unverständliches Ge­
schehen und welche Dankbarkeit des Hörers ein verstell­
bares, mögen noch so arge Dissonanzen es begleiten. Warum
sollten Musikpädagogen nicht ebenso vergehen und dem Hö­
rer entgegenkommen? Eine Didaktik der Neuen Musik, die;
dieser wirklich Nutzen stiftet, hätte zugleich da anzu.
setzen, wo Einfühlung, Kompassion, Katharsis möglich sind.
Die Schaffung einer solchen psychischen Disposition des
Hörens dürfte die wirksamste Voraussetzung dafür sein,
daß Laien sich überhaupt auf die fremden Gebilde des Neuen
einlassen, deren Verständnis sich spontan nicht minder
emotional vollzieht als bei der ihnen gewohnten Musik.
Von dort aus wäre behutsam in die inneren Bezirke des
Klingenden einzudringen, zur Aufklärung in Tönen und zur
Ästhetik des Verstumrnens, zu den Neuinszenierungen ver­
gangener Werke und Gattungen, am Ende gar zu der Musik,
die nichts weiter sein will als Konstruktion und Form.
Ein didaktischer Beginn bei derjenigen Neuen Musik, die
als Illustration des Unheils mißverstanden wird oder etwa Henzes "We Come to the River" - tatsächlich so in­
tendiert ist, könnte in den Ruch vordergründiger Anpas­
sung an oberflächliche Hörgewohnheiten geraten. Doch die
strengste und unabhängigste Konstruktion auf höchstem
Formniveau des Jahrhunderts, zum Beispiel ein WebernQuartett, spricht sie von anderem als Angst und Kata­
strophe?
152
LITERATUR
1. A.Berg;
Warum ist Schönbergs Musik so schwer
verständlich? In: W.Reich, Alban Berg
Leben und Werk, NA Zürich 1963
2. ders.:
Was ist atonal? - Ein Radio-Dialog,
in: Alban Berg, Glaube, Hoffnung und
Liebe. Schriften zur Musik, hg. von
F.Schneider, Leipzig 1981
3. J.Cage:
Unbestimmtheit, in: die reihe V, Wien
1959
4. C.Dahlhaus:
Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber
198o (=Neues Handbuch der Musikwissen­
schaft Bd. 6 )
5. H.Eisler:
Musik und Politik, Schriften 1924 1948, hg. von G.Mayer, München 1973
6 . P.Faltin:
Der Verstehensbegriff im Bereich des
Ästhetischen, in: Musik und Verstehen,
hg. von P.Faltin und H .P .Reinecke,
Köln 1973
7. G.W.F.Hegel:
Vorlesungen über die Philosophie der
Weltgeschichte, 1.Band: Die Vernunft
in der Geschichte (1822/23), h g . von
G.Lasson, Leipzig 3/193o
8. P .Hindemith:
Hören und Verstehen ungewohnter Musik,
in: Hindemith-Jahrbuch 1973/III, Mainz
1974
9. E.Krenek:
Ober Neue Musik, NA Darmstadt 1977
10. Z.Lissa:
Ebenen des musikalischen Verstehens,
in: Musik und Verstehen, a.a.O.
11. F.Nietzsche:
Menschliches, Allzumenschliches, 2.Bd.
2. Abtl., NA München 198o
12. H.Pauli:
Für wen komponieren Sie eigentlich?
Frankfurt 1971
13. S.Reich:
Music as a Gradual Process, in:
Writings about Music, New York 1974
14. A.Schönberg:
Harmonielehre, Wien 7/1966
15. ders .:
Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik,
hg. von I.Vojtech, Frankfurt 1976
16. J.Stenzl (Hg.):
Luigi Nono. Texte - Studien zu seiner
Musik, Zürich 1975
17. K.Stockhausen:
Texte zur Musik Bd. 2, Köln 1963
18. ders.:
Texte zur Musik Bd. 3. Köln 1971
19. I .Strawinsky:
Musikalische Poetik, Mainz 1949
2 0 . A.Webern:
Der Weg zur neuen Musik, hg. von
W.Reich, Wien 196o
154