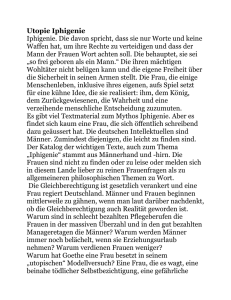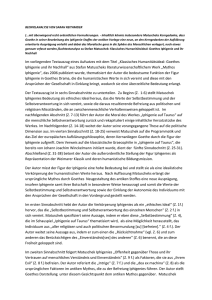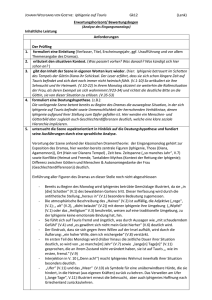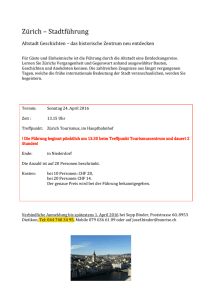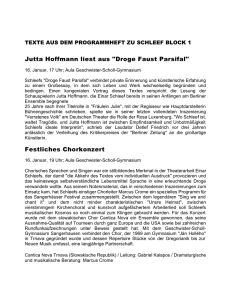110603 Süddeutsche Zeitung
Werbung

Süddeutsche Zeitung/Feuilleton, 3. Juni 2011 Liebhabereien Einar Schleef und Goethe bei den Ruhrfestspielen. Wir alle kennen das zur genüge: Theater, das karrieristisch denkt, aufs Publikum schielt oder routiniert Spielpläne vollstreckt. Wie schön, wenn man daran erinnert wird, was Theater auch sein kann: eine echte Herzensangelegenheit. Niemand zwingt Edgar Selge und seine Bühnen- und Lebenspartnerin Franziska Walser, Goethes 'Iphigenie' zu spielen, kein Intendant, kein Geldverdiendruck (hoffen wir jedenfalls). Nicht mal ein Regisseur - denn den gibt es nicht, wenn die beiden jetzt bei den Ruhrfestspielen und später im Maxim Gorki Theater in Berlin Goethes schwer verdauliches Versdrama auf die Bühne bringen. Es ist eine persönliche, fast private Vorstellung. Frau Walser selber erinnert noch daran, die Handys auszuschalten. Dann hört man Herrn Selge aus der ersten Parkettreihe zischen: 'Ja, wenn du nicht anfängst, fang ich an.' Was Frau Walser mit trotzigem 'Nee!' quittiert. Kaum auf der Bühne, steht ihr dann aber doch ganz theatralisch staunend der Mund offen mit tragischdramatischem Augenaufschlag. So tönt sie als Goethes gute Priesterin ins Publikum. Selbst scheinbar spontan improvisierte Eingebungen wie 'Ach, du lieber Gott, das ist ja gestrichen' wirken inszeniert. Edgar Selge spricht an diesem Abend große Worte gelassen aus; bei seiner Partnerin ist es eher umgekehrt. Ob als zu läuternder Barbarenkönig Thoas, Iphigenies gestrandeter Bruder Orest oder dessen aufwiegelnder Kumpel Pylades - immer blitzt das Selge-typische Augenzwinkern auf. Er kann auch zornig, aber er liebt es lässig. Das tut dem Text gut, der atmen kann. Aber Selge will mehr. Diese Inszenierung in Eigenregie, unterstützt von befreundeten Ausstattern, führt den Text mit einfachen Mitteln auf - und gleichzeitig vor. Per Filzstift kritzelt Selge seine Rollennamen an die Wand, und wenn zu viele Figuren dran sind, greift man betont linkisch zu putzigen Handpuppen. Man verehrt den Text: Sonst würde man ihn kaum aufführen. Aber verschaukelt ihn: Weil man ihm doch misstraut? Sagt Iphigenie: 'Ich zaudere.' Entgegnet Selge: 'Nein, an dieser Stelle des Stücks wird nicht mehr gezögert, du hast genug Monologe gehabt.' Hoho, wie frech. Die Zuschauer danken die Ironie mit frenetischem Beifall. Selten so gelacht bei einer 'Iphigenie'! Aber wozu eigentlich? Das spöttische Kommentieren ist mehr ein Kokettieren mit dem Publikum. Dass Goethes heiliges Humanitätsdrama konstruiert, pathetisch, sprachlich totgeschliffen ist, ist bekannt. Sich darüber zu belustigen, ist immer einfacher, als es lebendig und lebensnah zu machen wie es unlängst Sarantos Zervoulakos am Theater Oberhausen mit einer exzellenten Hauptdarstellerin Elisabeth Kopp gelang. Hier aber sieht und bestaunt man eine Edgar-Selge-Show. Am Ende geriert sich der Gatte noch keck als Schauspiellehrer: 'Noch mal, ich hab dich nicht verstanden.' Während Iphigenie zur störrischen Ehe- und Hausfrau wird: 'Ich bin so frei als wie ein Mann.' Das ist dann wenigstens ein Hauch von Interpretation. Aber vor allem Ausdruck der ältesten aller Literaten-Weisheiten: Was sich neckt, das liebt sich. Gilt hier mehr noch als gegenüber Goethe für den Spiel- und Ehepartner: Am Ende verbeugt man sich dankbar voreinander. Mit der Uraufführung von Einar Schleefs fast vollendetem Spätwerk 'Gute Reise auf Wiedersehen' erfüllt sich auch Regisseur Ernst M. Binder einen Herzenswunsch. Das Drama ist der vierte Teil der Tetralogie 'Totentrompeten', den Binder einst beim Meister in Auftrag gab. Schon Teil eins und zwei hatte er Mitte der Neunziger inszeniert. Zehn Jahre nach Schleefs Tod kann er jetzt mit seiner eigenen Truppe Drama Graz und dem Staatstheater Schwerin sowie in Koproduktion mit den Ruhrfestspielen - das letzte Kapitel dieser NachwendeAuf- und -Abarbeitung realisieren. Um es vorweg zu nehmen: Es täte dem Ruhm Schleefs keinen Abbruch, wenn das unvollendete Drama weiter in der Nachlassschublade schlummern würde. Es ist eine stilistisch ambitionierte, aber schwer verschachtelte Elegie aus staubigen DDR- und Wendejahre-Reflexionen. Trude, Elly und Lotte, die drei Alten aus dem Harz-Kaff Sangerhausen, sind durch Gewinn einer Fernreise irgendwo zwischen Italien und Amerika konfrontiert mit der geballten westlichen Freiheit, die sie fasziniert und irritiert und zu langen Bewusstseinsgrabungen im kollektiven Ost-Gedächtnis animiert. Von Stöckchen auf Hölzchen. Ein Gestrüpp, in das die Regie eine lichtende Schneise schlagen müsste. Binder versucht es, indem er einen ulkigen Polizisten-Prolog voranstellt, der in die Metaphorik von Schleefs Stummelsprache einführt, und mit einem Diavortrag aus vorherigen Inszenierungen als Nacherzählung 'Was bisher geschah'. So gewappnet, geht es mit Trude (Modell Morgenmantel mit Lockenwickler), Elly (Kostüm mit Feder im Haar) und Lotte (schlichtes Sommerkleid) auf die Hartplastik-Sitzschalen-Wartebank. Und dann wird geredet. Redlich müht man sich, aber der sperrige Text bleibt papieren und kommt einem selbst im bissigen Zank der drei Systemtrümmerfrauen nicht nahe. Schutt zu ihren Füßen. In ihrem Rücken eine Lufthansa-Stewardess, die artifiziell kranichartige Schreie ausstößt - der Ruf der Freiheit? Eher die Wende als Sturzflug. 'Die deutsche Geschichte', konstatiert Trude. Und Elly ergänzt: 'Kannste vergessen.' Und als bräuchte es da noch einen Kommentar, tritt schließlich der Dramaturg höchstselbst in einem Epilog auf die Bühne und spricht von der Verwurzelung des Menschen, aus der es kein Entkommen gebe. Was als posthumer Liebesdienst am großen Schleef gedacht war, endet so als Liebhaberveranstaltung. Rührig, aber nicht berührend. Goethe leicht bekömmlich, Schleef im Schlafrock? Das Herz des Kritikers schlägt woanders. VASCO BOENISCH