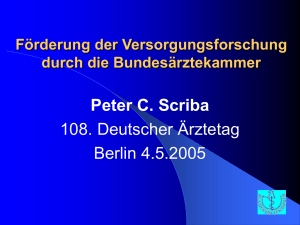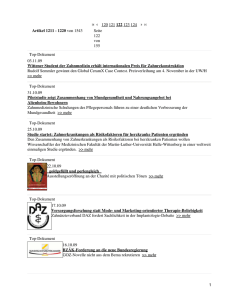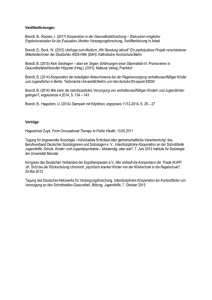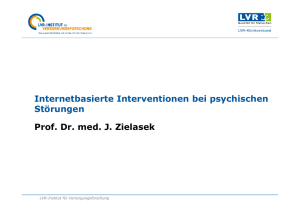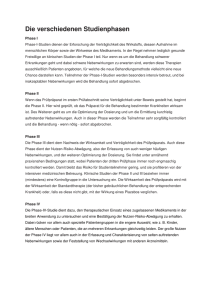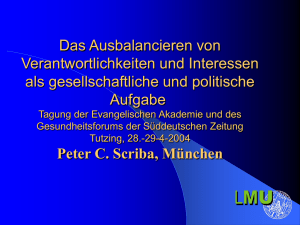PDF herunterladen - Medizintechnologie.de
Werbung
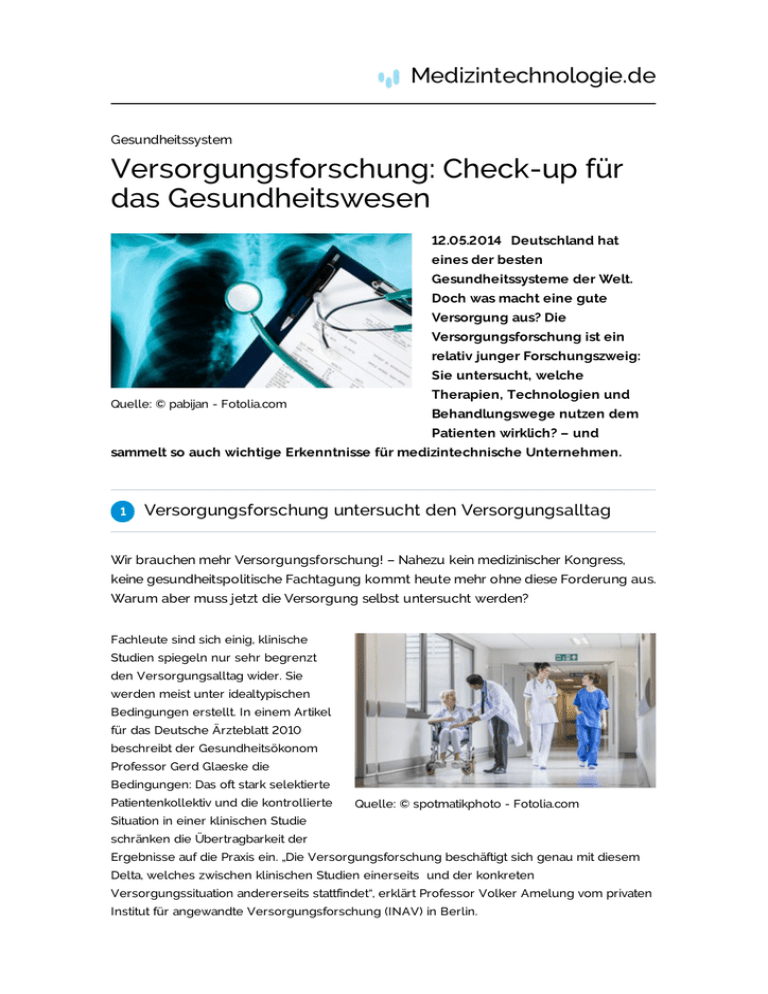
Medizintechnologie.de Gesundheitssystem Versorgungsforschung: Check-up für das Gesundheitswesen 12.05.2014 Deutschland hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Doch was macht eine gute Versorgung aus? Die Versorgungsforschung ist ein relativ junger Forschungszweig: Sie untersucht, welche Quelle: © pabijan - Fotolia.com Therapien, Technologien und Behandlungswege nutzen dem Patienten wirklich? – und sammelt so auch wichtige Erkenntnisse für medizintechnische Unternehmen. 1 Versorgungsforschung untersucht den Versorgungsalltag Wir brauchen mehr Versorgungsforschung! – Nahezu kein medizinischer Kongress, keine gesundheitspolitische Fachtagung kommt heute mehr ohne diese Forderung aus. Warum aber muss jetzt die Versorgung selbst untersucht werden? Fachleute sind sich einig, klinische Studien spiegeln nur sehr begrenzt den Versorgungsalltag wider. Sie werden meist unter idealtypischen Bedingungen erstellt. In einem Artikel für das Deutsche Ärzteblatt 2010 beschreibt der Gesundheitsökonom Professor Gerd Glaeske die Bedingungen: Das oft stark selektierte Patientenkollektiv und die kontrollierte Quelle: © spotmatikphoto - Fotolia.com Situation in einer klinischen Studie schränken die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Praxis ein. „Die Versorgungsforschung beschäftigt sich genau mit diesem Delta, welches zwischen klinischen Studien einerseits und der konkreten Versorgungssituation andererseits stattfindet“, erklärt Professor Volker Amelung vom privaten Institut für angewandte Versorgungsforschung (INAV) in Berlin. Versorgungsforschung ist – auch – Marktforschung Denn zurzeit gleicht unser Gesundheitssystem noch einer riesigen Black Box. Seit 2012 geben wir insgesamt – für gesetzliche und private Leistungen – rund 300 Milliarden Euro für Gesundheit aus, meldet das Statistische Bundesamt. Es können aber keine validen Aussagen darüber getroffen werden, „welche Krankenhäuser beispielsweise neue Medizintechnologien benutzen? Und gibt es einen Unterschied im Outcome? Sterben Patienten früher in den Häusern, die weniger moderne Medizintechnik benutzen?“ Fragen, die auch einen der Pioniere der Versorgungsforschung in Deutschland, Professor Holger Pfaff vom Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR) der Universität zu Köln umtreiben. Eine Intensivierung der Versorgungsforschung fordert deswegen auch schon seit langem der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) und empfiehlt, die Versorgungsforschung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen – um ein wenig Licht ins Dunkel der Black Box zu bringen. Dabei ist der relativ junge Forschungszweig besonders auch für Medizintechnikunternehmen interessant. Er liefert wertvolle Erkenntnisse über Marktpotenziale, die nicht nur am Anfang die Produktentwicklung beeinflussen, sondern auch in der späteren Markteintrittsphase von Bedeutung sein können. Beispiel Hausnotrufsysteme. Das INAV untersucht derzeit die Fragestellung: Kann durch diese Technologie die Pflegestufenprogression verlangsamt werden? Die Annahme: Nutzer von Hausnotrufsystemen trauen sich länger in ihrer häuslichen Umgebung zu verbleiben. Und: Welche Auswirkungen haben die Hausnotrufsysteme auf die nächsten Angehörigen? Hier die Annahme: Angehörige werden entlastet. Mit Erkenntnissen wie diesen können Hersteller besser vorbereitet in die Erstattungsverhandlungen mit den Krankenkassen gehen, ein professionelles Marketing aufsetzen, oder Kooperationen eingehen. Unübersichtliche Forschungslandschaft Es lohnt sich also, Versorgungsforschungsprojekte aufmerksam zu verfolgen, oder über Forschungsverbünde gegebenenfalls mit zu initiieren. Doch wer forscht gerade an welchem Thema? Die Forschungslandschaft ist groß und unübersichtlich. Angefangen von den Universitäten über Krankenkassen bis zur Bundesärztekammer werden unterschiedlichste Projekte aufgelegt, hinzu kommen private Anbieter wie das INAV, die Auftragsforschung betreiben. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat die Bedeutung der Versorgungsforschung früh erkannt und fördert seit nunmehr zwei Jahrzehnten diesen Forschungszweig, mittlerweile unter dem Dach der Gesundheitsforschung. Insgesamt stellt das BMBF in dem Förderzeitraum von 1998 bis 2016 etwa 170 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es in einem Papier des Gesundheitsforschungsrates. Eine Auswahl der wichtigsten Links zum Thema Versorgungsforschung und der vom BMBF geförderten Projekte finden Sie am Ende der Seite. Daneben hat das IMVR gemeinsam mit dem Institut der Techniker Krankenkasse, Wissenschaftliches Institut für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen (WINEG), eine Datenbank auf den Weg gebracht, die zum Ziel hat, den Stand der Versorgungsforschung in Deutschland abzubilden, Best-Practice-Modelle zu identifizieren und die Vernetzung zwischen den Forschern zu fördern. Die Datenbank umfasst derzeit 320 registrierte Projekte und ist frei und kostenlos zugänglich. Die meisten Projekte beschäftigen sich mit Patientenorientierung sowie dem Zugang und der Inanspruchnahme unseres Gesundheitssystems, 22 haben medizinische und technische Innovationen zum Forschungsgegenstand. Klar ist aber auch: Versorgungsforschung ersetzt nicht klinische Studien, vielmehr stellt sie eine sinnvolle Ergänzung dar. „Die Versorgungsforschung arbeitet mit mehr Variablen, dies erhöht deutlich die Komplexität“, erläutert Professor Volker Amelung. Dennoch betont er: „Viele Unternehmen könnten es sich einfacher machen, wenn sie in die Erstattungsphase gehen. Es muss nicht immer das große aufwendige Versorgungsforschungsdesign sein, häufig passt auch eine ganz kleine niedrigschwellige Studie. Nur sauber aufgesetzt muss sie sein.“ Linkliste zum Thema Versorgungsforschung www.gesundheitsforschung-bmbf.de Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die vom BMBF geförderten Versorgungsforschungsprojekte. www.netzwerk-versorgungsforschung.de Das Netzwerk Versorgungsforschung hat sich 2006 gegründet. Mit heute über 100 Mitgliedern bietet es eine Plattform für Fachgesellschaften, Institutionen und Wissenschaftlern, die sich der Erforschung unseres Gesundheitssystems verschrieben haben. Das Netzwerk organisiert den Deutschen Kongress für Versorgungsforschung vom 24. Bis 27. Juni 2014 in Düsseldorf. www.versorgungsforschung-deutschland.de In dieser Datenbank sollen alle Versorgungsforschungsprojekte in Deutschland registriert werden. Ziel ist, Transparenz im Projektdschungel zu bieten und die Versorgungsforscher miteinander zu vernetzen. www.monitor-versorgungsforschung.de Die Website des gleichnamigen zwei monatlich erscheinenden Print-Magazins bietet Nachrichten, Veranstaltungstermine und Abstracts. Der Monitor Versorgungsforschung ist ein Medium der eRelation AG - Content in Health. www.wido.de Das wissenschaftliche Institut der AOK ist eine der ältesten Einrichtungen in Sachen Versorgungsforschung. Seit 1976 arbeiten die Wissenschaftler daran, unser Gesundheitssystem zu erforschen. www.wineg.de Dieses Institut arbeitet im Auftrag der Techniker Krankenkasse. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Fragen im Sinne der Versicherten zu stellen und wissenschaftliche Antworten zu geben mit dem Ziel, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. www.inav-berlin.de Das Institut für angewandte Versorgungsforschung ist ein Beratungsunternehmen und begleitet seine Kunden von der Konzeption über die Markteinführung bis zur Evaluation im Gesundheitswesen. 2 Daten im Überfluss Obwohl Deutschland über eine gute Ausgangslage an Versorgungsdaten verfügt, profitierte die Versorgungsforschung bislang kaum davon. Ein Pilotprojekt des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) soll dies nun ändern. Auch medizintechnische Unternehmen haben künftig Zugang. Mehr als 70 Millionen Menschen in Deutschland gehören der gesetzlichen Krankenversicherung an. Die 134 Kassen in Deutschland verfügen damit über einen ungeheuren Schatz an Daten. Ob Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Arzneimittelverordnungen, Heil- und Hilfsmittelverordnungen – bei ihnen laufen die unterschiedlichen Quelle: © Gina Sanders - Fotolia.com Datenströme ihrer Versicherten zusammen. Diese Kassendaten werden Sekundär- oder auch Routinedaten genannt. Sie sind für die Versorgungsforschung von besonderer Bedeutung, weil dieser Datenpool ein wesentlich größeres Patientenkollektiv repräsentiert, als dies etwa in klinischen Studien dargestellt werden kann und weil sie sektorenübergreifend Rückschlüsse auf die Versorgungssituation der Patienten ermöglichen. Big Data: Milliarden von Versorgungsdaten stehen zur Verfügung Bis vor kurzem war der Zugang für die Versorgungsforscher zu diesen Daten nicht möglich. Und nicht nur die Kassendaten waren unter Verschluss, traditionell werden die Versorgungsdaten von den Organisationen der Selbstverwaltung gehütet wie ein Schatz. Mit der Datentransparenzverordnung aus dem Jahr 2012 hat das Bundesgesundheitsministerium nun eine Tür geöffnet hin zu mehr Datentransparenz. Seit dem Februar dieses Jahres startet das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) ein Pilotprojekt zur Nutzung von Versorgungsdaten. Es erlaubt der Selbstverwaltung, aber auch Forschungseinrichtungen und Interessenvertretungen von Patienten, mit Krankenkassendaten zu arbeiten. Was nicht im Gesetz steht: Auch privatwirtschaftliche Unternehmen können beispielsweise durch Kooperationen mit Forschungseinrichtungen indirekt die Daten nutzen. Sven Borowski, Presseverantwortlicher des DIMDI: „Wir können schon aus fehlenden rechtlichen und personellen Voraussetzungen keine Interessenskonflikte oder wirtschaftliche Verflechtungen prüfen.“ Möglich ist es nun, mit den Routinedaten der gesetzlichen Krankenkassen zu arbeiten. Die Routinedaten aller gesetzlichen Krankenkassen laufen beim Bundesversicherungsamt zusammen. Dort wird ein kassenartenübergreifender Finanzausgleich errechnet. Diese Datensätze erhält künftig das DIMDI. Damit stehen dem DIMDI zunächst 5,4 Milliarden pseudonymisierte Datensätze zur Verfügung, in einem weiteren Schritt sind es zirka 8,3 Milliarden. In dieser Größenordnung wurden die Datensätze der gesetzlichen Krankenversicherung bislang noch nicht zusammengeführt. Das Informationssystem Versorgungsdatenbank des DIMDI ist somit ein wichtiger Schritt für eine leistungsfähigere Versorgungsforschung in Deutschland. Denn nur eine Zusammenführung der Daten aus den unterschiedlichen Versorgungsbereichen erlaubt einen ganzheitlichen Blick auf unser Versorgungssystem. Allerdings werden mit dem DIMDI-Pilotprojekt nicht alle Wünsche der Versorgungsforscher erfüllt, beispielsweise ist noch keine Verknüpfung der Routinedaten mit anderen Datenquellen, wie zum Beispiel dem Krebsregister, möglich. Auch der Regionalbezug der Daten soll erst im Laufe des Projekts realisiert werden. Ohnehin sei der Umgang mit Routinedaten ein extrem mühsames Geschäft erläutert Professor Volker Amelung. „Es ist eines der am meisten unterschätzten Gebiete, unterschiedliche Datensätze miteinander verknüpfen, die zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, in unterschiedlicher Qualität, zur Verfügung stehen. Jeder Datensatz muss auf Plausibilität überprüft werden.“ Deswegen sei die Arbeit mit Routinedaten auch die klassische Kernkompetenz der Versorgungsforschung. 3 Register helfen Daten generieren Register sind ein wichtiger Teil der Versorgungsforschung: Sie generieren medizinische und produkttechnische Daten unter Alltagsbedingungen und dienen so der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung. Einer der häufigsten Eingriffe in deutschen Krankenhäusern ist das Einsetzen eines künstlichen Gelenks. Mehr als 360.000 Menschen erhielten 2013 ein künstliches Hüftoder ein künstliches Kniegelenk. Die Komplikationsrate liegt bei nur etwa zwei Prozent laut Bundesverband Medizintechnologie (BVMed). Dennoch ist es wichtig zu wissen, Quelle: © psdesign1 - Fotolia.com warum in zwei Prozent der Fälle ein Gelenkersatz Probleme bereitet oder gar eine Revisions-Op erforderlich macht. „Mit Registern sammeln wir Marktbeobachtungswissen“, sagt Joachim M. Schmitt, Geschäftsführer des BVMed. „In einer Längsschnittbeobachtung wollen wir herausfinden, war es ein Produktfehler, hat der Arzt einen Fehler gemacht oder lag es an der Compliance des Patienten.“ Um die Qualität bei Endoprothesen transparenter zu machen, ist der BVMed 2013 gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), dem AOK-Bundesverband und dem Verband der Ersatzkassen sowie dem BQS-Institut mit einem Endoprothesenregister gestartet und ist damit politischen Forderungen ein Stück zuvor gekommen. Im Koalitionsvertrag sind weitere Register geplant, ein Transplantationsregister und ein Implantateregister sollen aufgebaut, bereits bestehende Register sollen dabei einbezogen werden, die Datenlieferung ist dann verpflichtend. Industrie und Kassen haben den Wert von Registern früh erkannt Register schaffen ein Stück weit Transparenz. Vor dem Aufbau des Endoprothesenregisters gab es beispielsweise keine aggregierten Daten, wann und wo ein Fabrikat zum Einsatz kam – mangelhafte Produkte konnten nicht zurückverfolgt werden. BVMed-Geschäftsführer Joachim M. Schmitt spricht über den Aufbau des freiwillig zustande gekommenen Endoprothesenregisters deswegen auch von einem Leuchtturmprojekt der Versorgungsforschung. Ein wesentlicher Bestandteil des EPRD ist eine Produktdatenbank, die von den Endoprothetik-Unternehmen des BVMed finanziert und gepflegt wird. Die Produktdatenbank umfasst bereits über 35.000 unterschiedliche Artikel und ist damit auf einem guten Weg, das Marktgeschehen bei den Gelenkersatz-Implantaten möglichst vollständig abzubilden. Für den Aufbau des Registers sind drei unterschiedliche Datensätze erforderlich: die Routinedaten der Krankenhäuser, die pseudonymisierten Patientendaten der Krankenkassen sowie die Produktdaten der Implantatehersteller. Beteiligt sind rund 17 im BVMed vertretene Hersteller von Endoprothesen, dies sind rund 95 Prozent des Marktes. Beteiligt an dem Projekt sind Krankenkassen, die Medizinischen Fachgesellschaften und „zunehmend auch Krankenhäuser“, so Schmitt. Register dienen somit der Qualitätssicherung und damit dem Patientenschutz, aber auch die Unternehmen können wertvolle Hinweise erhalten, die in ihre Produktentwicklung einfließen. Die Industrie, so scheint es, hat die Bedeutung von Registern zunehmend erkannt, neben einem Herzklappenregister sind weitere Register im Aufbau: beispielsweise das Register PTAREG zur Behandlung von Gefäßverschlüssen (PVAK) mit Stent-Systemen, initiiert vom BVMed-Fachbereich. Allerdings steht und fällt die Güte der Datenqualität der freiwilligen Register mit ihrer Anzahl der beteiligten Firmen und Kliniken. Zugang zu den Registerdaten haben Hersteller, Krankenhäuser und Krankenkassen, nicht aber Patienten oder Patientenvertreter. Letztere werden durch eine Publikation informiert. Eine erste Evaluation der Registerdaten steht in diesem Jahr noch bevor. 4 Versorgungsforschung aus Sicht der AOK Die AOKen zählen zu den größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und sie unterhalten seit Jahrzehnten ein eignes Institut für Versorgungsforschung, das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO). Im Interview erklärt Geschäftsführer Jürgen Klauber, was das WIdO mit seinem Datenpool macht und warum nicht jede medizintechnische Innovation ein Fortschritt ist. Das WIdO gibt es nun seit 38 Jahren und es zählt mit seiner Arbeit zu den Pionieren in der Versorgungsforschung in Deutschland. Was hat damals zu seiner Gründung geführt? Warum ist es für die AOK heute wichtig, Versorgungsforschung zu betreiben? Jürgen Klauber: Als das Institut im Jahr 1976 gegründet wurde, wurde ihm die Aufgabe zugeschrieben, mit wissenschaftlicher Forschung für die AOK wie auch im Sinne der gesamten Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) tätig zu werden. Dabei wurde Wert darauf gelegt, einen mit entsprechenden Freiheiten ausgestatteten Wissenschaftsbetrieb im Verbandsgefüge auf den Weg zu bringen. Der bisherige Erfolg des WIdO bestätigt, dass diese Ausrichtung zukunftsweisend war. Versorgungsforschung bleibt auch heute für die AOK essentiell, geht es Quelle: © thomasp24 - Fotolia.com doch darum, den Menschen im Krankheitsfall eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten. Natürlich liegt es auch im Interesse der Versicherten und der Gesellschaft, diese möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Das WIdO versteht sich dabei als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis. Was sind die zentralen Forschungsschwerpunkte und Erkenntnisse Ihres Instituts? Klauber: Die Forschungsschwerpunkte des WIdO sind vielfältig. Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung werden seit Jahrzehnten sowohl in der sektoralen Betrachtung des Arzneimittelmarktes, der ambulanten und der stationären Versorgung empirisch analysiert wie auch in einer intersektoral am Patienten orientierten Versorgungsperspektive. Natürlich umfasst dies auch die ordnungspolitischen Gestaltungsoptionen. Beispielsweise haben die Analysen zum Arzneimittelmarkt, unter anderem dargelegt im jährlichen Arzneiverordnung-Report, seit Mitte der 80er Jahre vielfältige Impulse im Sinne einer rationalen, qualitativ besseren und wirtschaftlicheren Arzneimitteltherapie gesetzt. Diese haben Eingang in diverse Gesetzgebungen gefunden. Der aufkeimende Generikamarkt, Arzneimittelfestbeträge, der Marktrückgang umstrittener Arzneimittel, die Kritik patentgeschützter Nachahmerprodukte, die Entwicklung vertragswettbewerblicher Möglichkeiten bis hin zu den heutigen zentralen Preisverhandlungen wurden frühzeitig thematisiert, analysiert und befördert. Neben den Impulsen für die Gestaltung von Marktrahmenbedingungen werden aber auch die Marktakteure in der Praxis unterstützt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das WIdO Software bereitgestellt, die eine unabhängige pharmakologische Beratung der Ärzte unter Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsaspekten erlaubt. Mit Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR) bietet das WIdO heute ein Verfahren, das es gestattet, Unterschiede in der indikationsbezogenen Ergebnisqualität der Patientenversorgung im Krankenhaus deutlich zu machen und dies auch in der zeitlichen Nachverfolgung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. So ist es erheblich, wenn Komplikationsraten bei bestimmten Eingriffen im schlechtesten Viertel der Krankenhäuser mindestens doppelt so hoch sind wie im besten Viertel der Häuser. Wichtig ist natürlich auch hier der Transfer in die Praxis. Krankenhäuser können ausführliche Klinikberichte zur Verbesserung in ihrem klinikinternen Qualitätsmanagement nutzen. Versicherte und einweisende Ärzte haben die Möglichkeit, sich im Internet über Outcome-Unterschiede zu informieren. Zentrale Herausforderungen für die Versorgungsforschung sind die Auswirkungen der demographischen Entwicklung und die chronischen Volkskrankheiten. Umfänglichste Aktivitäten der Versorgungsforschung sind in den letzten zehn Jahren in Deutschland entstanden. Viele dieser Themen greift auch das WIdO in seiner Forschungsarbeit und in Forschungskooperationen auf. Ergebnisse werden unter anderem im Versorgungs-Report veröffentlicht, der sich mit chronischen Erkrankungen und Gesundheit im Alter befasst, aber auch einzelne Versorgungsfelder fokussiert. Jüngst wurde der aktuelle Report zum Schwerpunkt Depression veröffentlicht. Ein weiteres zentrales Themenfeld der WIdO-Arbeit ist die betriebliche Gesundheitsförderung und auch mit den Fragen der Sicherung der Pflege wird sich das Institut in den nächsten Jahren verstärkt befassen. Warum braucht eines der besten Gesundheitssysteme der Welt überhaupt Versorgungsforschung? Klauber: Auch wenn Deutschland ein gutes Gesundheitssystem hat, belegt es nicht in allen Bereichen Spitzenplätze. Hierzu kann man auf die Gutachten des Sachverständigenrates verweisen, die Fragen von Unter-, Über- und Fehlversorgung thematisieren. Beispielsweise Überlebensraten bei bestimmten Krebserkrankungen sind keineswegs international top sondern liegen eher im Mittelfeld. Hinsichtlich der Frage, welches Versorgungsniveau mit welchen Gesundheitsausgaben realisiert wird, zeigen internationale Rankings, z. B. des Commonwealth Fund, immer wieder, dass auch in unserem sicher recht guten Gesundheitssystem Luft nach oben besteht. Ganz abgesehen davon, dass man sich auch gute Plätze immer wieder neu erarbeiten muss. Versorgungsforschung steht und fällt mit der Datenqualität. Mit mehr als 24 Millionen Versicherten kann das WIdO auf einen hochwertigen Datenpool zurückgreifen. Wie aussagekräftig sind Ihre Daten? Was leisten sie und was nicht? Klauber: In der Tat erlauben die uns vorliegenden anonymisierten Routinedaten aus der Abrechnung der Leistungserbringer mit den Krankenkassen umfängliche Möglichkeiten der Versorgungsforschung. Die gesundheitliche Versorgung eines Versicherten kann so im Zeitverlauf und über alle Versorgungsbereiche hinweg, egal ob ambulante oder stationäre Leistungen, Arzneimittel, Heilmittel etc. untersucht werden. Dazu nutzen wir die modernsten Möglichkeiten der Big Data - Analyse. Der Vorteil dieser Daten liegt auf der Hand. Es entsteht kein zusätzlicher Erhebungsaufwand und zweckgebundene Abrechnungsdaten, die geprüft sind, stehen für Validität und Vollständigkeit. Natürlich haben auch Abrechnungsdaten ihre Grenzen, die man je nach Forschungsfrage sorgfältig betrachten muss. So muss man die Qualität der Daten gleichwohl immer auch prüfen, auch sind sie nicht immer ausreichend. So können beispielsweise beim zuvor benannten QSR-Verfahren nicht alle Qualitätsindikatoren mit Routinedaten gebildet werden, Prozessindikatoren der Versorgungsqualität im Krankenhaus brauchen sehr wohl auch zusätzliche Erhebung und Dokumentation. Zweifellos besteht aber mit den vorliegenden Routinedaten aus der Abrechnung ein umfänglicher Datenschatz, welcher der Versorgungsforschung gemäß § 303 SGB V ja auch zugänglich gemacht wird. Schaut man sich die WIdO-Forschungsschwerpunkte an, fällt auf, Sie nehmen so ziemlich alles unter die Lupe, nur die Medizintechnik nicht. Was ist der Grund dafür? Klauber: Leider können wir nicht alles machen. Unsere Versorgungsforschung ist zwar breit aufgestellt, aber im Focus steht zunächst der Patient, die Frage einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Versorgung. Unsere Tätigkeit ist da in der Tat schon sehr umfänglich. Einzelne Produktbewertungen oder Evaluationen von Produkteinführungen in die Versorgung, seien es Medizinprodukte, neue Therapieverfahren oder neue Hilfsmittel und telemedizinische Möglichkeiten in der Vernetzung der Gesundheitsversorgung, zählen aktuell nicht zu unserem direkten Tätigkeitsfeld. Zweifellos besteht hier aber auch ein wichtiges Feld der Versorgungsforschung, wenn es darum geht zu bewerten, was medizintechnische Innovationen tatsächliche leisten und für welche Patientengruppen sie geeignet sind. Verwiesen sei beispielsweise auf die Diskussion um die kathetergestützte Aortenklappen-Implantation. Generell gilt, dass nicht jede vermeintliche medizintechnische Innovation ein Fortschritt ist. Hier ist es neben der zunächst notwendigen Bewertung der Produkteignung und Produktsicherheit dann auch eine Aufgabe der Versorgungsforschung, den praktischen Nutzen und die Reichweite einer neuen Medizintechnik zu bewerten. 5 Versorgungsforschung in der Praxis – Beispiel Heimdialyse Das IGES-Institut hat herausgefunden: Jeder dritte Patient könnte zu Hause dialysiert werden. Nur fünf Prozent der heute 83.000 dialysepflichtigen Patienten nutzt diese Versorgung. Die Versorgungssituation von dialysepflichtigen Patienten richtet sich in Deutschland zu stark an strukturellen Gegebenheiten und nicht am individuellen Versorgungsbedarf der Patienten aus. Dies ist ein Ergebnis einer Untersuchung des IGES Institut in Berlin im Auftrag des Medizintechnik- und Pharmaunternehmens Baxter Quelle: © beerkoff - Fotolia.com Deutschland. „Vor allem die Peritonaldialyse, bei der Schadstoffe über das Bauchfell in eine Dialyselösung gelangen, ist als Heimverfahren besonders geeignet. Sie kommt jedoch zu selten zum Einsatz. 95 Prozent der Dialysepflichtigen werden mittels Hämodialyse behandelt. Dabei wird das Blut außerhalb des Körpers über synthetische Membranen gereinigt, was derzeit fast ausschließlich in Dialyseeinrichtungen geschieht.“ Künftiger Versorgungsbedarf ist nur durch Heimdialyse zu decken „Deutschland ist im Vergleich zu den internationalen Verteilungen stark auf die Hämodialyse in Dialysezentren ausgerichtet“, sagt Professor Dominik Alscher, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Notwendig sei eine verbesserte Patienteninformation über die Möglichkeiten der Peritonaldialyse, damit die Patienten selbst entscheiden können, welche Versorgung für sie die richtige sei. Hans-Holger Bleß, Leiter des Bereichs Versorgungsforschung im IGES Institut, nennt neben den infrastrukturellen Bedingungen auch eine fehlende Differenzierung in der Vergütung sowie mangelnde Kenntnisse der Nephrologen und Fachpflegekräfte in der Heimdialyse als Gründe für die Unterversorgung. Durch statistische Modellierung epidemiologischer Daten und durch Expertengespräche prognostizieren die Wissenschaftler einen Anstieg der Patientenzahlen bis 2020 um 20 Prozent und einen Rückgang der Fachärzte um acht Prozent. Ursachen für die Zunahme dialysebedürftiger Menschen sehen die Experten in der Zunahme der Volkskrankheiten Diabetes und Bluthochdruck, aber auch in den Erfolgen der Nierenersatztherapie. © medizintechnologie.de/im