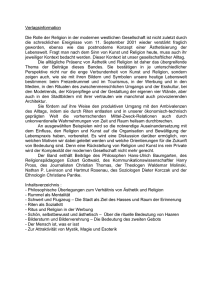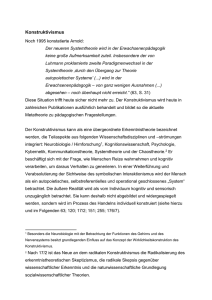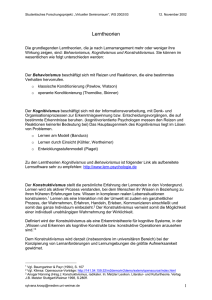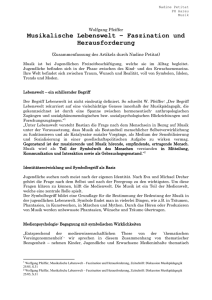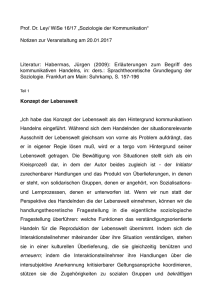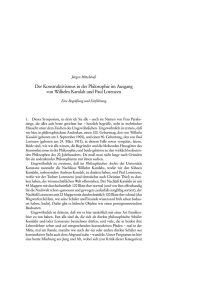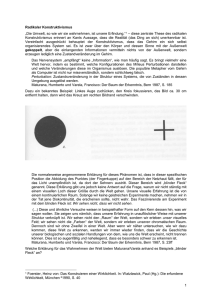als PDF herunterladen können
Werbung

Für ein neues pragmatisches Denken Harald Wohlrapp (Vortrag vor dem „Konstanzer Wissenschaftsforum“ am 13. Okt. 2011) Einleitung: Mir geht es in dieser Rede darum, einige Gedankenkomplexe, die im Umkreis des Konstruktivismus zu Themen wie ‚Handlung’, ‚Handlungstheorie’ und ‚pragmatische Basis’ entwickelt worden sind, zusammenzubringen. Dabei denke ich im Einzelnen an: 1) Lorenz’ Darstellungen, insbesondere in den Enzyklopädie-Artikeln zu ‚Handlung’: Hier wird von elementaren Situationen (Lehr-Lern-Situation, dialogische Elementarsituation) ausgegangen, in denen noch alles „zusammen“ ist – also Subjekt und Objekt, Sprache und Praxis. Von da aus wird der ganze Reichtum der sprachlichen, theoretischen und praktischen Kompetenzen des Menschen schrittweise rekonstruiert1. 2) Janichs Vorstellungen vom „gelingenden Handeln“ als Basis der theoretischen Geltung: Hier geht es um eine begründende Rekonstruktion der wissenschaftlichen Leistungen (in der Form eines Dreischritts von Konstitution, Konstruktion, Reflexion2), welche dem eigenen Anspruch nach auch die faktische Wissenschaftsgeschichte berücksichtigt. 3) Mittelstraß’3 und Gethmanns4 Bemühungen um eine Charakterisierung der „Lebenswelt“: Hier werden basale oder transzendentale Handlungsweisen (Behaupten, Auffordern, Herstellen) beschrieben, die einen allgemein zugänglichen Anfang für konstruktivistische Rekonstruktionen liefern sollen. 4) Kambartels Vorstellungen einer Praxis, die von einem „vernünftigen Glauben“ getragen ist: Hier wird aus dem Bewusstsein des Widerfahrnis-Charakters allen menschlichen 1 Vgl. auch: Lorenz, K., Dialogischer Konstruktivismus , sowie Artikulation und Prädikation, in: ders. Dialogischer Konstruktivismus, Berlin 2009, 5-23, 24-71. 2 Vgl. Janich, P., Konstitution, Konstruktion, Reflexion. Zum Begriff der „methodischen Rekonstruktion“ in der Wissenschaftstheorie, in: Demmerling, Ch. et al. (Hg.) Vernunft und Lebenspraxis. Für Friedrich Kambartel, Frankfurt/ M 1995, 32-51 3 Vgl. Mittelstraß, J., Das lebensweltliche Apriori, in: Gethmann, C.F. (Hg.) Lebenswelt und Wissenschaft. Studien zum Verhältnis von Phänomenologie und Wissenschaftstheorie, Bonn 1991, 114-142. 4 Vgl. Gethmann, C.F., Welche Hauptschule sollte der Vorschule folgen? in: Mittelstraß, J. (Hg.) Der Konstruktivismus in der Philosophie im Ausgang von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen, Paderborn 2008, 43-62. 2 Bewirkens und Erreichens eine quasireligiös vertrauensvolle Haltung der „Gelassenheit“ beschrieben5. 5) Schließlich noch Lorenzens Begriff von Vernunft als „Überwindung der Subjektivität“, wofür in Erlangen (m.W. von Mittelstraß) der Ausdruck „Transsubjektivität“ gefunden wurde6. Was die Motivation und meine eigene Beteiligung betrifft, ist vielleicht erwähnenswert, dass ich in den 70er Jahren mit zwei Arbeiten zur Diskussion über die Handlungstheorie beizutragen versucht hatte. In der ersten habe ich die Zusammenhänge zwischen pragmatischer und methodischer Ordnung aufzuklären mich bemüht und bin dabei auf das Problem des Verhältnisses von methodischem und dialogischen Prinzip gestoßen7. In der zweiten, einem 100seitigen Aufsatz über eine Episode aus der Geschichte der jüngeren Psychiatrie, habe ich festgestellt, dass der schematische Handlungsbegriff (Handeln ist Aktualisieren eines Schemas) zu eng ist und habe einen Begriff von forschendem Handeln oder „Handlungsforschung“ gebildet8. Das ist ein Handeln, welches seine wesentlichen Orientierungen nicht aus Wissen bezieht, sondern „nur“ aus Argumentationen (aus „thetischer“, nicht aus „epistemischer“ Theorie, wie ich das heute nenne). Es ist m.E. insbesondere dieser Forschungsbegriff, der in das pragmatische Denken des Konstruktivismus (auch des „Methodischen Kulturalismus“) einzubringen ist, um dessen unhistorische, formal und systematisch überakzentuierte Betrachtungsweise zu überwinden. Wie soll dazu vorgegangen werden? Es wird ein Begriff vom Handeln als einem Tun gebildet, das auf „Gelingen“ ausgerichtet ist, das insofern einerseits eine gewisse Orientiertheit schon mitführt, diese andererseits zu optimieren sucht. Solches auf Gelingen ausgerichtetes Handeln ist „dynamisch“, was ich erfassen möchte, indem ich drei Phasen unterscheide: Können, Forschen, Praktizieren. Können ist In5 Vgl. Kambartel, F., Über Gelassenheit, sowie Bemerkungen zum Verständnis religiöser Rede und Praxis, in: ders. Philosophie der humanen Welt, Frankfurt/M 1989, 90-99, 100-102. 6 Vgl. Lorenzen, P., Normative Logic and Ethics, Mannheim1969, 82f 7 Vgl. Wohlrapp, H., Was ist ein methodischer Zirkel? In: Mittelstraß, J./ Riedel, M. (Hg.), Vernünftiges Denken, Gedenkschrift für Wilhelm Kamlah, Berlin 1978. 8 Vgl. Wohlrapp, H., Handlungsforschung. Systematische Überlegungen zu einer dialektischen Handlungstheorie, insbesondere bemüht um ein Verständnis des Verhältnisses zwischen Erkennen und Handeln, nach welchem Handeln zugleich als Bewusstwerden und als Verbessern der Situation aufzufassen ist; nebst einer Illustration des Gemeinten anhand der Reformen des Psychiaters Jan Foudraine, in: Mittelstraß (Hg.), Methodenprobleme der Wissenschaften vom gesellschaftlichen Handeln, Frankfurt/M 1979, 122-214. 3 grediens des unmittelbaren Lebens. Es stößt an Grenzen, geht dort u.U. über ins Forschen und, wenn dabei etwas herauskommt, ins Praktizieren, welches durch Eingewöhnung zu einem Können in der nächsthöheren Ebene wird. Die drei Phasen sind nicht nur in getrennter Abfolge zu denken, sondern ebenso in Überlappung und Amalgamierung, sodass faktisches Handeln sie alle drei als Aspekte an sich haben kann. Für die Phasen sind entscheidend die Verhältnisse von Theorie und Praxis (bzw. von Objekt und Subjekt), die sich vermischen, verhaken, auseinander treten, neu und bewusst wieder zusammengefügt werden. Früher oder später beginnt wieder eine neue Runde dieses Prozesses, der auf die Dauer immer differenziertere Stadien menschlicher Lebenswirklichkeit hervorzubringen geeignet ist. Zusammenfassend: Dies ist ein Handlungsbegriff, bei dem das menschliche Handeln ein gelingen sollendes Handeln ist. Der Begriff ist in sich reflektiert, was sich als Einheit von zwei Ebenen darstellen lässt. Das Handeln enthält gleichsam seine eigene Vorform, über die es aber reflektierend bzw. theoretisierend hinaus strebt und dies partiell auch erreicht, wodurch sich ein Gegenstandsverhältnis und ein Selbstverhältnis ausbilden bzw. weiter ausdifferenzieren. Die avancierte Form fällt durch Eingewöhnung wieder zurück und erreicht eine Qualität analog der Könnensphase. Diagramm 1: Können Eingewöhnen Forschen Praktizieren In den folgenden drei Abschnitten werde ich diese drei Phasen charakterisieren, dann folgt ein vierter Abschnitt über „Vernunft“. Der Ausdruck 'Vernunft' bezeichnet hier keine von außen oder im Nachhinein auferlegte Forderung, sondern ein endogenes Verallgemeinerungsprinzip, das sich in den drei Dimensionen des Handlungsgelingens (Zweck, Wert, Sinn) unterschiedlich akzentuiert, und zwar als Subjektinvarianz, Intersubjektivität und Transsubjektivität. 4 1. Können Mit (einem) Können bezeichne ich einen Bestandteil des allgemeinen Leben-Könnens. Der Hintergrund dabei ist, dass wir leben immer schon können, dies also nicht erst zu lernen brauchen und dass es aus Teilen besteht, für die das gleiche gilt. Das Können (denken Sie etwa an Bewegungen des Körpers, der Glieder, an Stehen, Gehen, sich Umdrehen usw.) ist ein Tun, das nicht einfach eine Veränderung darstellt, sondern das gelingen soll, das also ein Minimum an Orientiertheit unterstellt, aus dem heraus wir es kontrollieren und korrigieren (im Extrem: unterlassen) können. Wieweit dazu Sprache, Verständigung und Theorie gehört, das kann einstweilen offen bleiben. Es geht auch ohne, bzw. mit ganz rudimentären Vorformen, denn solches Können lässt sich schon den Vormenschen, sogar den Tieren zuschreiben; aber ebenso lässt es sich an den gewohnheitsmäßigen Alltagsverrichtungen z.B. eines Mitglieds des Chaos Computer Clubs aufweisen. Können ist Aktivität mit einer schwebenden, nicht auf Einzelheiten gerichteten Aufmerksamkeit. Gegenstandsverhältnis und Selbstverhältnis sind undeutlich, lax gesagt: Subjekt und Objekt , Praxis und Theorie sind noch eins. So verstandenes Können ist die Grundlage des Handelns, wir brauchen dazu also eigentlich nichts aktiv zu tun, wir funktionieren einfach. Es ist ein Reiz-Reaktionsgeschehen, die Situation ist irgendwie und wir „reagieren“ – und im Normalfall eben auch richtig. Das allermeiste, was ein Mensch im Laufe seines „Alltags“ tut, ist von dieser Art. Sicherlich, sehr vieles davon haben wir mühsam erlernt, Lesen, Autofahren, sogar Reden und Gehen, aber jetzt können wir es. Und: wir hätten es nicht lernen können, wenn wir nicht vorher schon etwas gekonnt hätten. Der „Anfang“ des Könnens ist die Autopoiesis des Organismus. Das Leben kann leben, so könnte man sagen. Wir „können immer schon“ wachsen, atmen, verdauen usw. Dieses Lebenkönnen greift über die Nahrungsaufnahme, Wärmeschutzsuche usw. in die äußere Welt über. Dass Menschen etwas können, also jagen, Behausungen bauen usw. und dass sie im Hinblick darauf in ihrer Welt auch „orientiert“ sind, das hat uns „die Evolution“ geschenkt (sei sie nun blind oder intelligent). In derartigem Können stellt sich naturwüchsig ein Unterschied zwischen Innen und Außen her, aus dem dann mit zunehmend deutlicherer Orientierung (d.i. dem Fortschritt von der kommunikativen zur signifikativen Sprache, dem Artikulieren und Tradieren von Unterscheidungen und Inferenzen (d.i. Zusammenhängen zwischen Aktion und Folge)) ein Gegenstands- 5 verhältnis, (bzw. Gegenstände) und – über Interaktion und Kommunikation9 – ein Selbstverhältnis (bzw. Individuen) sich ausbilden. Hinsichtlich der Geltungsfrage der Orientierungen ist beim Können die grundsätzliche Antwort: Es zeigt sich, dass das richtig ist. Es gibt keine Gründe dafür – jedenfalls nicht in der Bedeutung, in der das Praktizieren (s.u.) Gründe geben kann. Das ist aber kein Mangel, weil – so wurde das im Konstruktivismus der Erlanger Schule (hauptsächlich bei Lorenz) gern ausgedrückt – die Frage „an dieser Stelle“ noch gar nicht auftritt. Im Rückblick, also vom Praktizieren her, ist das Können der Grund der theoretischen Geltung. Dessen Grund sind wir selber, bzw. wenn wir, von eventuellen Abgründen in unserem Praktizieren verunsichert, nach einer noch tieferen Begründung suchen, dann sind wir auf unser „Grundvertrauen“ verwiesen (dazu unten, Abschnitt 4). Ist es ratsam, das Können mit dem Husserlschen Begriff der „Lebenswelt“ zu etikettieren? Ich finde nicht. Zum einen waren Husserls Anliegen bei Einführung dieses Begriffs ziemlich heterogen, wenn nicht inkonsistent. Erkennbar ging es um zwei unterscheidbare Projekte im Hinblick auf die moderne Wissenschaft (sein Anstoß war die Algebraisierung der Geometrie), ein Begründungsprojekt und ein Sinngebungsprojekt. Für das Begründungsprojekt müsste die Lebenswelt deutlicher pragmatisch konzipiert werden, eben als ein praktisches Können. Husserl dagegen fokussiert die Anschaulichkeit (ein „Reich ursprünglicher Evidenzen“ sei die Lebenswelt 10 ), die er zudem auch noch als etwas subjektiv Relatives zeichnet. (Hier ist Janich mit dem Handwerk als Grundlage der Wissenschaft viel einleuchtender.11) Und für das Sinnstiftungsprojekt müsste die Lebenswelt über die etwas romantischen Andeutungen hinaus wohl historisch deutlicher aufgefüllt werden – als Phase, in der Sinnstiftung zur allgemeinen Kultur gehörte und zwar als Religion. Die Lebenswelt (wie das bei Gethmann und Mittelstraß gemacht wird) als den Ort aufzuziehen, in dem die transzendentalen Bedingungen des Wissenschaftstreibens angesiedelt sind, würde das Begründungsprojekt bedienen, das Sinngebungsprojekt weniger. Dass aber der Husserlsche Ausdruck für so etwas überhaupt geeignet ist, das liegt nicht gerade auf der 9 Diese Theoretisierung der Selbstverhältnisgenese verdanken wir (außer Hegel) hauptsächlich dem „Symbolischen Interaktionismus“ des amerikanischen Pragmatisten G.H. Mead. Vgl. Mead, Mind, Self and Society. From the standpoint of a social behaviorist, Chicago 1934, insb. Teil III: Self. 10 Vgl. Husserl, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, in: ders. Gesammelte Schriften (ed. Ströker, E.), Hamburg 1992, Bd. 8, dort § 34d. 11 Vgl. Janich, P. Handwerk und Mundwerk. Lebenswelt als Ursprung wissenschaftlicher Rationalität, in: Gethmann, C.F. (Hg.), Lebenswelt und Wissenschaft, Hamburg 2011 6 Hand. (Der einzige Vorteil beim Aufgreifen des Wortes „Lebenswelt“ für die vorwissenschaftliche Phase scheint mir zu sein, dass es eingebürgert ist). 2. Forschen Das Können stößt mitunter an Grenzen. Das sind Situationen, in denen unklare, mangelhafte, fehlende Orientierung das Handeln blockiert. Ich rede hier von Orientierungslücke. Das können Probleme sein, persistente Störungen, Verunsicherungen durch neue, nicht einzuordnende Ereignisse. Die Grenze provoziert die „Reflexion“ – im ursprünglichen Sinne: Die Aufmerksamkeit wird aktiviert, zurückgebeugt auf das bisher gekonnte Tun und den Täter. Die Fragerichtung dabei ist: Warum war das Handeln möglich und warum ist es nun nicht mehr möglich? Die Reflexion hat also vor sich entweder das bloße Tun, welches aber, insofern es doch gelang, Konturen und Regelmäßigkeiten gehabt haben muss, die es nun sprachlich-theoretisch zu artikulieren gilt. Dieses ist „ursprüngliche Reflexion“, sie führt vom Handeln zu erster Theorie (Wie-Wissen, Techne). Das ist selten, aber als Möglichkeit unbedingt zu bedenken. (Beispiel: Die „Erfindung“ der Renaissance durch Vasari). Die übliche Reflexion ist „vertiefend“, d.h. sie hat schon Theorie vor sich und drängt angesichts auftretender Defekte auf Elaboration. Holzschnittartig ist das der Schritt von den Wie-Fragen zu den Was- und WarumFragen (von Techne zu Episteme). Was ist zu tun, um hier zu Antworten zu kommen? Ich denke so: Es wird Einbildungskraft aktiviert und eine These formuliert, welche die Orientierungslücke schließt, d.h. darstellt, wie es sich dort verhält. Diese These wird dann nicht etwa gleich getestet (so in der Wissenschaftslehre des frühen Popper), sondern sie wird zunächst diskutiert. D.h. es wird der Geltungsanspruch, der mit der These einher geht, geprüft, indem eine Begründung konstruiert und gegen mögliche Einwände abgesichert wird. Wenn das gelingt, ist die These „gültig“. (Damit sie ist aber nicht etwa schon Wissen). Dann folgt die Realisierung der These: Dies ist das Forschungshandeln, eine Handlungsweise, bei der die Aufmerksamkeit sich zu teilen hat, nämlich gleichsam nach vorn auf die Sache (wie verhält es sich?) und nach hinten auf die These (stimmt sie?) gerichtet ist. Das realisierende Handeln wird ausgewertet: Haben sich neue Argumente – insbesondere: neue Einwände – zur These ergeben? Falls ja, wird die These modifiziert, wieder diskutiert, wieder realisiert usw. solange bis sie in der Schleife Thesen- 7 aufstellung-Thesendiskussion-Thesenrealisierung-Realisierungsauswertung-Thesenrevision usw. stabil bleibt. Dann hat die Forschung ein Resultat erbracht. Diagramm 2: Orientierungslücke These Auswertung Argumentation Realisierung Aber auch ein Forschungsresultat ist noch kein „Wissen“. Wissen wird es erst, wenn es innere Gütekriterien wie methodische Darstellbarkeit und Kohärenz erfüllt und wenn es in die Lebenswirklichkeit aufgenommen, wenn es „objektiviert“ ist (z.B. Statisches Wissen in Brükken, aerodynamisches in Flugkörpern, chemisches in Plastikverpackungen, sozialpädagogisches in Jugendzentren usw.)12 Für diesen Begriff des Forschens sind im konstruktivistischen Denken zwei korrigierende Erweiterungen nötig. Zum einen im Begriff des Arguments: Argumente sind nicht bloß formale oder rekonstruktive Schritte, sondern sie sind insbesondere semiformale und konstruktive Inferenzen, etwa: Metaphern, Analogien, Abstraktionen, Konkretionen, Verallgemeinerungen, Erklärungen usw. Das zweite ist der Begriff des Handelns: Das ist nicht bloß das Aktualisieren eines bekannten Handlungsschemas, sondern es ist insbesondere das versuchsweise Realisieren der These. Hier wissen wir nicht genau, worauf es ankommt, die Schematisierung, also das Verhältnis zwischen Schema und Aktualisierung ist unklar. Im Extrem wissen wir kaum oder gar nicht, was wir eigentlich tun. (Kolumbus’ Reise nach Indien, Errichtung der Republik auf dem Boden der Monarchie) Forschen ist also mit dem Experimentieren in der „Normalwissenschaft“ nicht hinreichend erfasst. Die theoretische Stützung besteht beim Forschen letztlich nicht aus Wissen, sondern aus Argumenten. Forschen ist das, was im pragmatischen Denken des Konstruktivismus immer unterbelichtet bzw. ignoriert war. Es war die Rede vom „Hochstilisieren“ der „lebensweltlichen Kompetenzen“, aber was das eigentlich ist, das beantwortet sich gerade nicht, indem das gegenwärtige 8 Wissen in einer zirkelfreien Schrittfolge aus der „Lebenswelt“ (in welchem Sinne auch immer) rekonstruiert wird. Der Wissensfortschritt ist eben nicht bloß kontinuierlich, er ist an wesentlichen Stellen diskontinuierlich (Das hat Kuhn entdeckt – auch wenn er gleich darauf Vieles an seiner Entdeckung verdorben hat13). Es geht in der Geschichte des Wissens nicht einfach darum, dass neue, bessere Theorie gebildet wird, sondern es geht darum, dass die Welt sich wirklich ändert, dass neue Gegenstände auftreten (Schwarzpulver, Bakterien, Röntgen-Strahlen, Flugzeuge), alte Gegenstände verschwinden (Ritterrüstungen, Feen, Phlogiston) und dass die Menschen sich ändern und erneuern. Was das lehrt: der Prozess führt nicht einfach vorwärts bzw. aufwärts, sondern er führt auch in Sackgassen – und wir wissen nie, ob wir nicht gerade in einer gelandet sind. Beispiel: Der Übergang von der Alchemie zur „wissenschaftlichen“ Chemie: Das ging über die Stahlsche Chemie, bzw. die klare Identifikation des alten Elements Feuer, welches in der Alchemie zum „Prinzip Sulfur“ geworden war, zum Feuerstoff „Phlogiston“, der in Stoffen enthalten sein, in sie eintreten und aus ihnen austreten kann. Dieses Phlogiston war ca. 60 Jahre lang die Krone des chemischen Wissens, Stahl konnte in seinem berühmten – auch von Kant gelobten - Experiment den Schwefel auflösen und wiedergewinnen. In den Andeutungen, die Janich14 und Psarros15 zur Entstehung der Chemie vortragen, wäre das Phlogiston nichts weiter als ein erratisches Aperçu innerhalb der Konstitutionsphase des Elementbegriffs. (Und das, obwohl klar ist, dass der Elementbegriff auf die Entwicklung der lytischen Verfahren rekurriert.) 3. Praktizieren Die dritte Phase ist Handeln, welches durch Theorie gestützt ist, die sich im Forschen stabilisiert hat. Das ist also wieder ein regulär gelingendes Handeln, welches orientiert ist, wobei die Orientierung theoretisch artikuliert ist, aber erweitert und vertieft: Es sind hier hinsichtlich der Geltung oder Wahrheit nicht nur Wie-Fragen, sondern auch Was- und Warum-Fragen beantwortbar. 12 Genauer ist dieser Wissensbegriff ausgeführt in: Wohlrapp, H. Der Begriff des Arguments, Würzburg 2009 Kuhn, Th. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962. Verdorben ist die Entdeckung, weil Kuhn die Geltung wissenschaftlicher Theorien auf die Akzeptanz durch die „scientific community“ reduziert. 14 Vgl. Janich, P., Wissenschaft als Konstruktion und Rekonstruktion, in: Mittelstraß, J. (Hg.) Der Konstruktivismus in der Philosophie im Ausgang von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen, Paderborn 2008, 213-226. 15 Psarros, N., Die Chemie und ihre Methoden. Eine philosophische Betrachtung, Weinheim 1999, 144. 13 9 Das Gelingen des Praktizierens ist gegenüber dem Können vielfältig stabilisiert. Ich gebe drei Hinweise: es ist schematisiert, instrumentiert und aggregiert. Kurz zur Erläuterung: (a) Mit Schematisierung meine ich die Klarheit darüber, was zur Handlung gehört, worauf es dabei ankommt. Die einzelne Handlung ist dann eine Aktualisierung des Schemas, wenn sie zwar ihre je situative Besonderheit hat, aber eben in der Hauptsache das Schema inszeniert. Dazu muss dieses Schema nicht nur bekannt sein (wie beim Können), sondern es muss auch erkannt sein, d.h. seine Details müssen unterschieden und in ihren Beziehungen zueinander und zur anvisierten Handlungsfolge theoretisiert sein. (b) Instrumentierung soll bedeuten, dass das Handeln zu vielfältigen Sorten von Gegenständen in einer verstandenen Beziehung steht, sei es, dass sie - als Naturgegenstände oder Artefakte – notwendige, förderliche oder hinderliche Bedingungen darstellen oder dass sie regelrechte Instrumente sind, also Geräte, Maschinen, Anlagen usw. (c) Aggregierung schließlich soll heißen, dass die Handlungsweise aus zahlreichen Einzelhandlungen zusammengesetzt ist, Einzelhandlungen, die sich gegenseitig ergänzen, verstärken, korrigieren, u.U. Ersetzen, so dass nicht durch das einzelne Tun, sondern durch das ganze Aggregat dafür gesorgt ist, dass die Handlungsweise in der Regel gelingt. Offenbar erfordern diese Qualitäten jenes höhere Maß an Orientiertheit, welches die Theoretisierung aufgrund des Durchgangs durch die Forschungsphase bereitstellt. Damit erreicht das anvisierte Gelingen des Handelns einen erheblichen Zuwachs an Stabilität und freier Ausführbarkeit, aber auch an Transparenz, Verstehbarkeit, allgemeiner Lehrbarkeit usw. Handlungsweisen, die in Theorie und Praxis derart elaboriert sind, nenne ich Praxen, das entsprechende Tun Praktizieren. (Beispiele: Kochen, Putzen, Körperpflege, Einkaufen, Autofahren, Felder bestellen, Straßen bauen, Unterrichten, Gesetze beraten, Verkehr regeln usw.) Praxen sind ihrerseits mit anderen Praxen vernetzt, d.h. die Aggregierung setzt sich fort, die Praxen werden aufeinander abgestimmt, stützen und stabilisieren sich gegenseitig. Das Resultat ist Kultur (Und zwar ist das eine Kultur, die im Prinzip universell ist, d.h. dies ist der „praxiologische“ Kulturbegriff, den Kambartel zur Abwehr des Relativismus-Vorwurfs zur Sprache gebracht hat16. Das Handeln in der Könnensphase bildet auch Aggregate aus, „Felder“, deren 16 Vgl. Kambartel, F., Vernunftkultur und Kulturrelativismus. Bemerkungen zu verschiedenen Problemen des Verstehens und Begründens, in: Steinmann, H./ Scherer, A. (Hg.), Zwischen Universalismus und Relativismus. Philosophische Grundlagenprobleme des interkulturellen Managements, Frankfurt/M 1998, 212-220 10 Zusammenstellung ebenfalls eine „Kultur“ bildet: das wäre dann der ethnologische Kulturbegriff - Können ist eben nicht per se universell, cf. etwa das Regenmachen.) Es bleibt noch zu erwähnen, dass die Handlungen in Praxis und Kultur auch emotional besetzt sind. Sie entfalten alle Sorten von Erwartungen, Wünschen, Sehnsüchten, Befürchtungen, von angenehmen und unangenehmen Gefühlen – auch von ästhetischen Gefühlen. Diese Gefühle mischen sich beinahe unweigerlich in die Beurteilung der situativen Angemessenheit einer bestimmten Handlung oder der Geltung einer bestimmten Theorie ein. Sie verleihen dem in Praxis und Kultur eingebetteten, üblichen Handeln eine Art emotionaler Richtigkeit. Und aus diesem Richtigkeitsgefühl heraus wird geurteilt, was derartige Beurteilungen oft zu einem einfachen Reiz-Reaktions-Geschehen machen kann. Dieser Gedanke lässt sich ausbauen zu einer generellen Charakterisierung dieser Phase: Der praktizierende Mensch hat genügend theoretische und praktische Orientierung, um sein Leben zu bewältigen. Das ist schön und befriedigend. Es führt zur Eingewöhnung und damit zu einem Zustand analog der Könnens-Phase. Ich nenne dies die normale Orientiertheit. In unseren Breiten wird sie mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter erreicht: Wir können und verstehen genug. Wir wollen nicht mehr „alles“ verstehen (wie die Kinder mit ihrem ewigen Warum-Gefrage) und wir haben insbesondere das faustische Fragen nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält (das uns als Halbwüchsige umgetrieben hat), aufgegeben. Der Kern unserer Theorie ist Wissen, insofern es „objektiviert“ ist, d.h. eingebaut in die materiellen und sozialen Strukturen unserer Welt, in Gebäude, Straßen, Kraftwerke, Fahrzeuge, Einwohnermeldeämter, Schulen, Gerichte, Armeen. Der normal orientierte Mensch hat sich, wie man in Abwandlung der Rawls’schen Metapher17 sagen könnte, unter dem „Schleier des Wissens“ eingerichtet. Dass wir dennoch eigentlich in einem kleinen, immer wieder leckgeschlagenen Boot auf dem Ozean des Nichtwissens treiben, das ist dann allenfalls noch für die Handvoll Philosophen von Belang. Konkret bricht auch das Praktizieren auf, auch wenn es dazu bedeutenderer Störungen bedarf als beim Können. Dann stellen sich irgendwo erneut die Fragen nach Was und Warum. Wenn dann die Forschung zu Resultaten gelangt und diese auf ihre theoretischen Grundlagen befragt werden, dann lässt sich mit der begründenden Rekonstruktion sicherlich bei einer Phase des Könnens einsetzen. Aber ob das nun eine lebensweltliche oder prototheoretische oder dialo17 Rawls hat zur Charakterisierung eines Zustandes, in dem der Mensch sich noch uneigennützig für oder gegen irgendwelche Normen entscheiden kann, den „veil of ignorance“ konstruiert. Vgl. Rawls, J., A theory of justice, Cambridge 1971, §24. 11 gisch-elementarsituative Fundierung sein sollte, das dürfte sich je nach dem konkreten Problem als mehr oder weniger adäquat darstellen. Eine eindeutige, immer taugliche Antwort wird es nicht geben (außer eben: Wenn die Sache überhaupt etwas getaugt hat, liegt ihr irgendwo ein Können zugrunde). 4. Vernunft Zum Schluss komme ich noch einmal auf die Grundbestimmung dieses Handlungsbegriffs mithilfe des Gelingens. Wie Janich erwähnt, verdanken wir dieses Definiens des Handlungsbegriffs eigentlich dem Begriff des Widerfahrnisses aus der Anthropologie von Kamlah18 (aber wir dürfen ruhig anerkennen, dass Janich den Gedanken entscheidend weitergeführt hat). Ich habe nun gefunden, dass die entsprechenden Überlegungen sich zwanglos noch erweitern und vertiefen lassen und dass auf diese Weise die Trennungen zwischen den Abteilungen Wissenschaft, Moral/Politik und Religion aufgehoben werden könnten. Damit wäre dann übrigens auch ein Anschluss an das pragmatische Denken in Nordamerika vom Anfang des 20. Jh. (Peirce, James, Dewey, Mead) gewonnen. Was bedeutet es, dass eine Handlung gelingt? Üblicherweise bedeutet es, dass sie zweckgerichtet ist, und den Zweck tatsächlich erreicht. Bei Janich kann man lernen, dass sich Gelingen und Erfolg unterscheiden lassen und das ist für die Zwecke, die er damit verfolgt, auch in Ordnung. Für meine Zwecke ist es nicht so wichtig, weil einerseits die Kriterien für das Gelingen natürlich so gefasst sind, dass sie Erfolg versprechen: sie werden, wenn das Wissen über den Zusammenhang zwischen beidem fortschreitet, weitergebildet. Andererseits ist es deshalb nicht so wichtig, weil mit der Aggregierung des Handelns zur Praxis eine Tendenz zur Weiterentwicklung der Gelingenskriterien etabliert ist. Darüberhinaus finde ich, dass die Zweckorientierung ohnehin nur eine Dimension des Handlungsgelingens ist; und zwar ist sie, wenn sie die einzige bleibt, zu eng (was leicht der Fall ist, wenn wir uns auf die je einzelne Handlung beziehen und die Aggregierung nicht zur Kenntnis nehmen). Der Zweck ist jenseits der Handlung und wenn wir wirklich nur auf den Zweck aus sind, dann leert sich die Handlung aus, sie verliert ihre eigene Bedeutung. So werden wir z.B. verführt, ihre sozialen und moralischen Aspekte abzutrennen und sie entweder zu ignorieren oder im Zuge der Arbeitsteilung in die Ethikkommission abzuschieben. 18 Kamlah, W., Philosophische Anthropologie. Sprachkritische Grundlegung und Ethik, Mannheim 1972 12 Wenn wir aber die Gelingensreflexion vertiefen, dann lässt sich doch leicht nachvollziehen, dass Praxen Handlungen sind, deren Subjekt nicht Einzelne sind, sondern Kollektive. Diese aber müssen sich nicht nur über ihr Handeln verständigen (die Platte/Würfel/Säule-Episode in Wittgensteins Sprachspiel-Erlääuterungen19), sondern sie müssen sich auch verstehen, anerkennen, achten, d.h. außer der Zweckdimension taucht hier eine moralische Dimension auf, die ich (in Anlehnung an Max Weber20) als die Wertdimension bezeichnet habe. Damit sind zwei grundsätzliche Hinsichten da, an denen sich die Reflexion aufs Gelingen des Handelns ausrichten sollte. Es gibt aber noch (mindestens) eine dritte, die Sinndimension. Das bedeutet: Für die Richtigkeit des Handeln, die wir anvisieren, wenn wir aufs Gelingen achten, haben wir Kriterien. Dafür dass die Kriterien richtig sind, haben wir andere, grundlegendere Kriterien. Und die? Letztlich stehen wir dafür mit dem Leben in der durch unser Handeln geprägten Form ein. Für die Richtigkeit dieses Ganzen des menschlichen Lebens haben wir keine – von ihm distanzierbaren – Gründe mehr. Ist das menschliche Leben sinnvoll – und nicht etwa eine Krankheit oder Sackgasse im Weltlauf? Darauf können wir nur vertrauen. Und dieses tiefe Vertrauen, das Grundvertrauen, das ist die Basis allen Handelns, insofern es auf Gelingen ausgerichtet und damit tendenziell reflexiv ist21. Derartiges Grundvertrauen ist ein Aspekt der Vernunft (ganz ähnlich schon Lorenzen in seiner „Politischen Anthropologie“22). Das auf ein umfassend verstandenes (3-D) Gelingen ausgerichtete Handeln ist das „vernünftige“ Handeln. Der Begriff der Vernunft wird in der Moderne durch Allgemeingültigkeit, Universalisierbarkeit, bzw. allgemeine Nachvollziehbarkeit von theoretischen und praktischen Sätzen bestimmt. Es ist deutlich, dass dabei die Subjektivität im Blick ist – und gerade in dieser Hinsicht changiert die Bestimmung zwischen einerseits der Distanzierung von der faktischen, partikularen Subjektivität und andererseits der Anerkennung bzw. Verträglichmachung der verschiedenen Subjektivitäten. Im Wiener Kreis ist der Ausdruck „Intersubjektivität“ verwendet worden, um die Allgemeingültigkeit der Beobachtungsdaten zu charakterisieren, eine Bedeutung, die bis heute einschlägig ist. Dabei geht 19 Vgl. Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Frankfurt/M 1969, § 2. Vgl. Weber, M., Soziologische Kategorienlehre, Kap. I, II, §2, in: ders. (2005): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Neu Isenburg 2005, 17-19. 21 Für die Ausarbeitung dieses Gedankens vgl. Wohlrapp, H., Eine pragmatische Definition der Religion, in: Tolksdorf, St./ Tetens, H. (Hg.) In Sprachspiele verstrickt – oder: wie man der Fliege den Ausweg zeigt, Berlin 2010, 379-407 22 Lorenzen, P., Politische Anthropologie, in: ders. Grundbegriffe technischer und politischer Kultur, Frankfurt/M 1985, 185-193 20 13 es eigentlich um Subjektinvarianz bzw. das Heraushalten von allem Subjektiven. Etwa zur gleichen Zeit (z.B. im Historismus, aber dann auch beim späten Wittgenstein) hat sich eine zweite, mehr relativistische Deutung von Intersubjektivität gebildet, die auf Anerkennung und Verträglichkeit der Subjekte abstellt. Auch diese ist bis heute relevant. Wie passt das zueinander? Wenn klar wäre, dass wir uns von unseren Idiosynkrasien zu distanzieren hätten, um unsere „eigentliche“ Subjektivität zutage zu fördern, dann wäre diese ohnehin verträglich mit anderen, d.h. es brauchte keine Anerkennungsforderung mehr. Aber es könnte sich bei der Distanzierung um einen Prozess handeln, der ungeheuer mühsam ist, de facto kaum vorankommt und daher im Wesentlichen bloß als Ideal vorschwebt. Und dann wäre für die Dauer seiner Entwicklung wohl die Anerkennung der faktischen Subjektivitäten angesagt. Lorenzen hatte Ende der 60er Jahre den Ausdruck „Transsubjektivität“ eingesetzt, um auszudrücken, dass es beim vernünftigen Handeln darauf ankommt, nicht seine faktische Subjektivität auszuagieren, aber von dieser auch nicht völlig abzusehen, sondern sie zu „überwinden“.23 Ich verstehe das inzwischen so, dass es dabei um die Ausbildung einer „durchlässigen“ Subjektivität geht, durchlässig nämlich für die anderen Subjektivitäten. Der Weg dahin könnte die Aktivierung der Vertrauensbasis im gelingenden Handeln sein. Dann lässt sich die Vernunft des handelnden Menschen den drei Gelingensdimensionen so zuordnen, dass sie in der Zweckdimension als Subjektinvarianz (Asubjektivität), in der Wertdimension als Intersubjektivität und in der Sinndimension als Transsubjektivität erscheint. 23 „Transsubjectivity is not a fact, but it is not a postulate either. Transsubjectivity is simply a term characterizing that activity in which we are always already involved if we begin to reason at all… Transsubjectivity … is still subjectivity, but a subjectivity which is aware of its own limits – and tries to overcome them….No person can do more than try to overcome his/her subjectivity”, vgl. Lorenzen, P., Normative Logic and Ethics, Mannheim1969, 82f