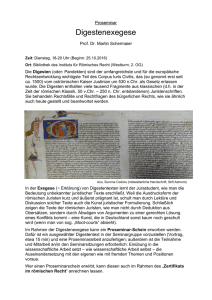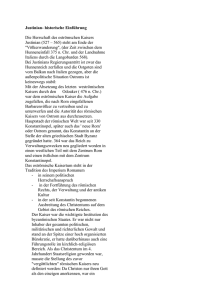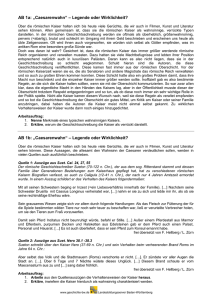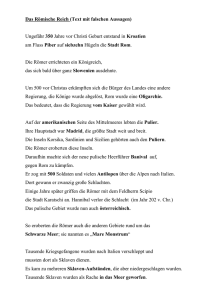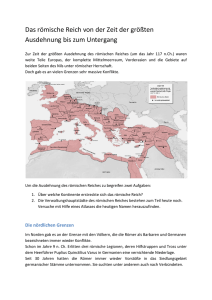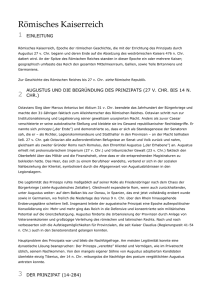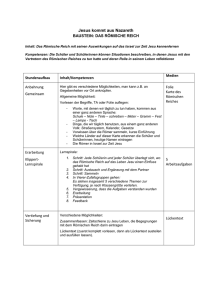Der Rhein von Basel bis Köln
Werbung

Titelbild:
Wandgemälde aus Raurica Augusta (Augst).
©Copyright by: Karawane-Verlag Ludwigsburg 1984
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Satz und Druck: Wachterdruck, Bönnigheim.
DIE KARAWANE
25. Jahrgang 1984 - Heft 2/3
(Doppelheft)
DERRHEIN
Vom Imperium Romanum bis Friedrich II.
herausgegeben im
KARAWANE-VERLAG LUDWIGSBURG
mit Unterstützung der Karawane-Studienreisen und des
Büros fl.ir Länder- und Völkerkunde
Ludwigsburg
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Dr. Bertold K. Weis
ERLEBTES RHEINMOSAIK . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WAHRZEICHEN DES
IMPERIUM ROMANUM AM RHEIN . . . . . . . . . 19
AULUS VITELLIUS EINE RÖMISCHE KAISERPROKLAMATION
AM RHEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
FLAVIUS CLAUDIUS IULIANUS EIN KAMPF UM DEN OBERRHEIN . . . . . . . . . . 50
AUSONIUS,
MOSELLA-EIN SPÄTRÖMISCHES
GEDICHT AUF DIE
MOSELLANDSCHAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
VOM ENDE DES RÖMISCHEN KÖLN . . . . . . . . 87
Dr. Alfred Mitatz
DER RHEINISCHE KÖNIGSRITT
FRIEDRICHS II. VON HOHENSTAUFEN ...... 100
Köln im Jahre 1850. Der Kölner Dom ist, 600 Jahre nach der Grundsteinlegung,
noch im Bau.
Zu diesem Hift:
Die sich im 18. und 19. Jahrhundert entwickelnde romantische
Bildungsreise mit ihrer, oft verklärenden, Hinwendung zu Schauplätzen der Geschichte und dem empfindsamen Erleben der
unberührten Natur, fand einen ihrer Höhepunkte in der Begegnung mit Europas berühmtesten Strom, dem Rhein. Viele Dichter und Schriftsteller haben die mit ihm verbundenen Sagen aufgezeichnet, seine romantischen, verfallenen Burgen besungen
und die großen geschichtsträchtigen Städte seiner Ufer beschrieben.
Schon 1828 erschien das erste, unter touristischen Gesichtspunkten verfaßte "Handbuch für Schnellreisende, Rheinreise von
Mainz bis Köln" von Prof. J. A. Klein, Vorläufer der Reisehandbücher Karl Baedeckers. 1850 bereits befuhren Ausflugsdampfer
den Rhein, wenn auch nicht von dem Fußwanderungen vorziehenden Baedecker empfohlen.
Der Rhein, Schicksalsstrom Europas, blickt auf eine lange und
reiche Geschichte zurück. Die zivilisatorische Leistung des
Imperium Romanum, des römischen Weltreiches, schuf gerade
hier wesentliche Grundlagen für die Entwicklung des Abendlandes, in der Auseinandersetzung zwischen Kelten, Römern und
Germanen.
Der Schwerpunkt der Beiträge dieses Heftes ist der Rhein in
römischer Zeit. Zusammengestellt wurden Vorträge, die während den Rheinkreuzfahrten der letzten Jahre mit MS "Austria"
an Bord gehalten wurden. Sie führen uns zurück in die Begegnung mit der römischen Antike: gegenwärtig und lebendig noch
heute nicht nur in Museen, sondern auch in Stadt und Land.
P.A.
3
Bertold K. Weis
Erlebtes Rheinmosaik
Der künftige Mentor ahnte noch nichts von Karawane-Studienreisen, von Studienkreuzfahrten, vom Auftrag eines Studienreiseleiters. Er war flinf Jahre alt, gerade alt genug, um das erste
Sümmchen bleibender Erinnerungen zu speichern. Sein Vater
hatte ihn und die vierjährige Schwester auf eine Reise nach Basel
mitgenommen. Dort wohnte ein Bruder des Vaters; er war inzwischen Schweizer Bürger geworden und wollte nun den Verwandten die stolze, traditionsreiche Stadt am Rheinknie zeigen. Vielleicht steht über allen Bildern aus einem so frühen Lebensalter
ein blendend heller Himmel. Jedenfalls ist diese erste Reise nach
Basel so im Gedächtnis geblieben: das Rheintal ein bunter, fröhlicher Garten, in der Fahrtrichtung links, sehr nahe, mit steigender und wieder fallender Kammlinie der Schwarzwald, auf der
rechten Seite, bedeutend weiter entfernt, aber doch blaugrün gedrängt und massig, die Vogesen. Vonall dem, was da unterwegs
vom kundigen Vater und eifrigen Mitreisenden gezeigt, bezeichnet und mit Namen genannt wurde, ist wenig später nicht viel
erinnerlich gewesen. Nur ein Turm, der unglaublich hoch, zart
und schlank, hinter den nächsten Auwäldern in den Himmel
wies, beschäftigte noch lange, wie auch der Name des Bauwerks,
die Phantasie: das Straßburger Münster. Mag sein, daß der Isteiner Klotz, dicht über Fluß und Bahnlinie auftrumpfend, im Bewußtsein haftet, doch kann dies auch HinzufUgung späterer
Erfahrung sein. In Basel empfing uns der Onkel, ein gesprächiger,
unterhaltsamer und trinkfreudiger Mann; er nahm eine Pferdedroschke, man fuhr durch die Stadt, zu den bekannten Sehenswürdigkeiten, aber die Eindrücke erwiesen sich als viel zu flüchtig, waren bald ausgelöscht von anderem. Wie auch sonst im Leben - mehr als die ganz großen Freuden, die Räusche des Glücks
- die Augenblicke des Verzichts, der schmerzlichen Enttäuschung unvergeßlich und untilgbar bleiben, so auch hier ein
höchst banal erscheinendes Erlebnis der ersten Begegnung mit
diesem schönen, unvergleichlichen Basel. Noch heute verbindet
die Münsterfahre den Fuß des Münsterfelsens mit dem Rheinweg auf der Kleinbaseler Seite; an einem Drahtseil, das quer über
den Strom gespannt ist, aufgehängt, pendelt sie zwischen den beiden Ufern herüber und hinüber wie eh und je, ohne Ruder oder
Motorkraft, nur vom Druck der starken Strömung bewegt. Der
Onkel mochte den heißen Wunsch des Neffen erraten haben und
4
Das Straßburger Münster.
5
Das Basler Münster und die Münsterfahre (Verkehrsverein Basel).
forderte zu einer Fahrt über den Fluß auf. Schon waren einige
Passagiere ins Fährboot gestiegen, wir sollten uns beeilen, da gab
es Verzug: die kleine Schwester weigerte sich, in das Boot zu steigen. Der Fährmann mahnte, der Vater hob das Mädchen auf, um
es in die Fähre zu tragen; doch das Schwesterehen schrie, strampelte, riß sich los und legte sich schluchzend flach auf den Boden.
Das Boot fuhr ab, glitt aufs vorbeischießende Wasser hinaus, hinüber nach Kleinbasel, während der Knabe, wie erstarrt von einem
unsäglichen Verlust, der prächtigen Münsterfähre nachstarrte.
Was danach noch kam an Unterhaltendem, Neuem, Vergnüglichem ist vergessen. Aber jedesmal, wenn ich von der Brüstung
des Münsterplatzes hinabschaue auf den immer noch grünen
Rhein und die Münsterfähre erblicke, spüre ich den Kloß von damals im Hals und fühle die tapfer unterdrückten Tränen. Gleichwohl bewährte sich auch an dieser schmerzlichen Kindheitserfahrung Hermann Hesses sinnspruchhafter Vers aus dem Gedicht
Stufen im Glasperlenspie/: "Undjedem Anfang wohnt ein Zauber
6
inne"; die erlittene Verweigerung vernarbte sanft zu einer lebenslangen Vorliebe für die Stätte, wo sie erlebt wurde.
Es kostete Mühe, diese Geschichte aus dem Nebel der Feme hervorzulocken; in späteren Jahren wird auch die eigene Frühzeit
zum mythologischen Bild, nur einzelnes, wie die Baseler Münsterfahre, tritt deutlicher zutage. Fünf Jahre später sitzen zwei
Zehnjährige zusammen in einer Schulbank des kleinen humanistischen Gymnasiums, das ein Speyerer Fürstbischof, ein Herr
Franz Christoph von Rutten (1743-1770), eröffnet hatte. In der
Sexta schließt man Freundschaften eher mühlos, unproblematisch und spontan; mitunter gelten sie fürs Leben. So bald verstanden auch wir beide uns als Freunde. Meine Eltern wohnten
in der ruhigen Amts- und Schulstadt; ihr glänzendes, von einem
Karlsruher Hochschulprofessor geschmackvoll renoviertes Barockschloß durfte mit den Namen Balthasar Neumann, Cosmas
Damian und Egidius Quirin Asam, Johann Michael Feichtmayr,
Johannes und Januarius Zick prunken. Hans, mein neuer
Freund, kam als sogenannter Fahrschüler oder Auswärtiger aus
einem noch viel kleineren Städtchen, das aber in der bewegten
Geschichte des alten deutschen Reiches als Reichsfestung Philippsburg ein Platz von europäischer Bedeutung gewesen war.
Sein Vater besaß dort eine Druckerei und verlegte eine winzige
Lokalzeitung - die deutsche Presselandschaft war damals noch
ein veritabler Blätterwald, in dem auch Strauchwerk und Unterholz zu gedeihen vermochten. Die einstige Reichsfeste lag am
Rhein, genauer gesagt an einem Arm des Altrheins. Die ehemaligen Festungswerke waren so gut wie verschwunden, abgetragen,
eingeebnet; das Städtchen träumte dahin in seinem stillen
Abseits hinter den Hochwasserdämmen des Stromes, den die
dichten Auwälder verhüllten. An den längst vergangenen Streit
der Großmächte, des Kaisers in Wien und des französischen Königs, um den Besitz der Festung erinnerten nur noch die Straßennamen: die Schanzenstraße, die Kronenwerkstraße, die Wallgärtenstraße, dazu die Namen vieler vergessener Generäle und
Kommandanten auf anderen Straßenschildern, und draußen, vor
dem Ort, von einem breiten Altrheinarm umschlossen die große
Rheinschanzinsel, wo heute zwei gewaltige, einhundertfünfzig
Meter hohe Kühltürme eines Kernkraftwerkes stehen, bei greller
Sonne glatt und gleißend, bei diesigem Wetter dunkel drohend
wie dämonische Giganten. Damals streckte über den niedrigen
Häusern nur die barocke Pfarrkirche ihre Turmhaube empor, dahinter wölbte sich wie ein grüner Wall der Rheinwald. Nach den
lebhaften Erzählungen und Schilderungen meines neuen Freundes war seine Einladung, an einem Sonntagnachmittag mit ihm
7
Altrheinmotiv bei Philippsburg.
zusammen die Flußlandschaft zu durchstreifen, nur die Erfiillung
eines heimlichen Wunsches. Es war Frühsommer, die Sonne lag
warm und feiertäglich über den Dächern und in den menschenleeren Straßen. Von dem kleinen Bahnhof gingen wir ziemlich eilig, fast hastig, als könnte uns eines unserer Ziele entwischen,
zum Städtchen hinaus und tauchten bald in die grüne Dämmerung der Uferwälder ein. Von einem leichten Lufthauch bewegt,
flimmerten die Blätter der Pappeln und der wuchernden Weidenbüsche wie umhergewirbelte Silberstücke. Vom Strom her ertönte laut warnend, den Neuling erschreckend, das Hupen eines
Schleppers. Auf einem schmalen Fußpfad, in den wie Fußangeln
wuchernde Sträucher hineinhingen, erreichten wir den Altrhein.
Da lag er vor uns, viel breiter, als ich ihn mir vorgestellt hatte, glatt
und reglos, und doch ein fließendes Gewässer, bald als grünschillernde Fläche, Überwachsen von teppichartigen Kolonien feuchtschimmernder Wasserlinsen und Grünalgen, bald als funkelnder
Spiegel vor tiefdunklem Untergrund. Da und dort an den Rändern des Altwassers reckte sich, zu Mauern zusammengedrängt,
hohes Schilfrohr auf, Vögel, von unseren Stimmen aufgeschreckt,
stoben aufund schossen kreischend durchs verschlungene Laubwerk davon. Wenn ich die Spinnweben der Zeit, die sich auch an
einzelnen Stellen dieses Erinnerungsbildes angesiedelt haben,
sehr sorgfältig entferne, sehe ich uns wenig später auf einem sehr
langen, flachen Boot, wie ich bisher keines gesehen hatte, lang-
8
sam auf dem Wasser dahintreiben, während gleich unter der
Oberfläche dichte Schwärme von Jungfischen vorüberschossen
und unten über dem Grund vereinzelt kräftige Hechte und behäbige Karpfen dahinzogen. Für einige Zeit schien unser Gesprächsstoff erschöpft zu sein oder die unendliche Stille, die Wald
und Wasser überwob, hatte auch uns ergriffen. Das Schweigen
hielt vor, bis die grünen Mauern, die uns bis dahin umgeben hatten, sich wie zu einem Tor öffneten, durch das der Altwasserarm
in den offenen Strom zurückkehrte. Dort legten wir an; zum
erstenmal sah ich die mächtige, stolze Wassermasse durch eine
freie Natur, durch Walder und abermals Wälder, dahinströmen,
den großen, feierlichen Domen entgegen, nach Speyer, Worms,
Mainz und zum heiligen Köln. Nur als Sprachlosigkeit läßt sich
bezeichnen, was diese Begegnung mit dem Rhein bewirkte.
Tränen, heimliche und unverhohlene, sah man Jahrzehnte nach
dieser Altrheinpartie bei eleganten, weitgereisten, weltkundigen
und ganz und gar unsentimentalen Damen an Bord der schnittigen A USTRIA auf der Fahrt durch den Rheingau: Angesichts des
vielbesungenen Lorelei-Felsens über der Stromenge erklang aus
den Bordlautsprechern, von einem gemischten Chor in einem lobenswert schlichten Volkston vorgetragen, Heinrich Reines weltbekanntes Lied von der schönen Lorelei in Friedrich Silchers Vertonung. Das wäre eine alltägliche Geschichte, nicht erzählenswert. Doch es waren nicht nur deutsche Passagiere, die dieser
Augenblick berührte. Französische Gäste waren an Bord, auch
MS "Austria" auf Rheinkreuzfahrt
Max Slevogt, Loreley.
Entwurf ftir ein Gemälde (1886).
sie nicht Normalbürger aus Paris oder aus der Provinz; eines der
beiden Ehepaare lebte seit Jahren in einem fernen afrikanischen
Land. Nun hatten sie die alte Liebe der Franzosen zu dieser schönen Landschaft, zur Rheinromantik, entdeckt und ihr eine Woche
des Heimaturlaubs vorbehalten. Sie kannten ihren Victor Hugo
und seine breit angelegte, auch den heutigen Leser noch fesselnde Reisebeschreibung Le Rhin, die vielen ihrer Landsleute unbekannt ist. Das Buch war damals, bei seinem ersten Erscheinen
(1842), Ertrag einer fast dreimonatigen Rheinreise, die den
großen Romantiker - nach seiner eigenen Formulierung - "die
Vergangenheit und Zukunft Europas erahnen" lehrte. Victor Rugo hat geradezu hymnische Sätze über den Rhein geschrieben; er
nennt ihn den Fluß der Vorsehung, einen symbolischen Fluß,
erklärt, er sei in seinem Lauf"sozusagen ein Bild der Zivilisation,
der er bereits so vielfaltig gedient hat und noch dienen wird." Von
der romantischen Märchengestalt, die Clemens von Brentanos
vielstrophige Ballade Die Lore Lay auf dem Felsen angesiedelt,
Heinrich Reine in alte Zeiten, superlativische Übertreibung sogar
in uralte Zeiten versetzt hat, spricht Victor Hugo freilich nur
andeutungsweise. Er nennt sie die arme Nymphe und erzählt desto ausführlicher von einem berühmten Echo, das er selbst erprobthabe; dabei gibt er sich sogar philisterhaft pedantisch, indem er
10
berichtet, er habe bei mehrfachen Versuchen statt des behaupteten siebenfachen Echos - das übrigens nach wie vor in den gedruckten Reiseführern zu finden ist- jedesmal nur ein fünffaches
feststellen können. Von diesem völligen Mangel an Verständnis
für die schöne Hexe Lorelei wollte ich den französischen Landsleuten des Klassikers in diesem Augenblick natürlich nicht sprechen. Jede kritische Bemerkung hätte die lyrische Atmosphäre,
das gerade jetzt so fühlbare Einverständnis der Nationen in der
unangenehmsten Weise stören müssen. Die eine der beiden Damen stand merkwürdig in sich versunken da und sah unverwandt
auf Wasser und Fels. Sie hat ihre Eindrücke und Empfindungen
viel später in einem Brief mitgeteilt, den sie gleich nach ihrer
Rückkehr in der Form eines höchst individuellen Reiseberichts
niederschrieb. Ich zitiere ihren Brieftext auszugsweise in deutscher Übersetzung: "Dann der Höhepunkt, die Verengung des
Stromes, der Zauber der Felsstürze und, in drei Sprachen angekündigt, die Lorelei. Der Eindruck ist gewaltig; ich muß tatsächlich die aufsteigende Bewegung hinunterschlucken, meine
Augen brennen. Die Sensation hält nur einige Augenblicke an,
denn aus den Lautsprechern hört man die Musik auf die Verse
von Heinrich Heine." Beiläufig wäre anzumerken, was ich im
Zitat weggelassen habe; Madame meinte, die Melodie sei von
Schubert, doch der Irrtum ist durchaus verzeihlich, denn wie sollte sie unseren schwäbischen Landsmann Friedrich Silcher kennen, wo doch auch in Frankreichjedermann den Schubert Franz
kennt! Unvergeßlich bleibt das Bekenntnis der Berichterstatterio
zu den Anzeichen der Rührung, die der erfahrene Mentor auch
aus den Eingeständnissen manches anderen, im übrigen total
verschlossenen Teilnehmers kennt. Wir haben am Ende der
Kreuzfahrt, vor dem Eintreffen in Köln, mit den französischen
Teilnehmern über die zahlreichen Begegnungen mit der deutschfranzösischen Geschichte gesprochen, die diese Reise notwendigerweise mit sich gebracht hatte. Monsieur B. meinte in Erinnerung an die Ruinen so vieler zerstörter Burgen und Schlösser:
"Ich habe den Eindruck gewonnen, daß die Franzosen diesem
Land allerhand Schlimmes angetan haben." Doch dieser Satz
durfte nicht als Resümee unserer gemeinsamen Rheinreise stehen bleiben. So einigten wir uns schließlich auf eine Geschichtsbetrachtung, die sich dem ewig gestrigen Aufrechnen gegenseitigen Verschuldeos verweigert und als Parole für die Zukunft das
Verständnis für den anderen und den Respekt vor seiner Eigenart
proklamiert: Vergangenes wird dann als dorniger Weg von den
gestrigen und vorgestrigen Wirrtümern zu den besseren, heilsameren Einsichten von heute und morgen begriffen werden. Die
11
Tränen für die Lorelei könnten so als Symbol der neu gewachsenen Völkerfreundschaft am Rhein gelten.
Vielleicht war es ein Vorzug, in einer Zeit aufwachsen zu dürfen,
als das Auto noch nicht zur obligaten Ausstattung des Primaners
oder doch wenigstens des Abiturienten gehörte. Ein Fahrrad
reichte hin zur Erkundung der faßbaren Umwelt. Es führte,
innerhalb bescheidener Grenzen, gleichwohl zu kostbaren, bewußtseinsbestimmenden, Weltansicht begründenden Begegnungen. An einem Samstagnachmittag zum Beispiel reichte der
Aktionsradius dieses Fortbewegungswerkzeugs erstaunlich weit.
Speyer zu erreichen, die Domstadt auf dem linken Rheinufer, bedeutete nichts weiter als eine gemächliche Spazierfahrt quer
durch die Ebene; sie führte sehr lange auf einem weichen, federnden Pfad dahin, durch hohe Buchenwälder zuerst, dann durch
starkduftenden Kiefernforst, auf dem alten Hochufer, dem sandigen, an endlosen Spargelfeldern vorüber, schließlich hinab ins
fruchtbare Schwemmland verschwundener Altrheinarme.
Durch das Tor eines langgestreckten Hochwasserdammes mündete das Sträßchen in die weitaus breitere Hauptstraße eines stillen, pappelumstandenen Dörfchens ein und führte schnurgerade
auf die Rampe einer primitiven Rheinfahre zu, die damals noch
eher ein paar Ochsengespanne als Autos über den Fluß zu befördern hatte. Wer diesen Weg nach Speyer wählte - für uns war es
wohl der kürzere -, betrat den historischen Kern der Stadt durch
eine der großartigsten deutschen Toranlagen, das Altpörtel; da
öffnete sich vor dem unwillkürlich einhaltenden Besucher der
Blick in eine wahrhaft königliche Straße und auf das in der Nachmittagssonne sehr hell, viel zu hell aufleuchtende Westwerk des
Domes, diesen vielgescholtenen, von den Puristen gallig gerügten Wiederaufbau der zerstörten Fassade durch den großherzoglieh badischen Oberbaudirektor Heinrich Hübsch. Doch derlei
stilkritische Auseinandersetzungen waren dem Gymnasiasten
noch fremd, vielleicht empfand er den Kontrast zwischen der originalen Bausubstanz des 11. Jahrhunderts und der Fassade des
19. Jahrhunderts überhaupt nicht. Ihn bewegte vielmehr die majestätische Komposition, die ihn als ungeheurer Eindruck überfiel und ihm, wie in einem taumelndem Traum, diese kaiserliche
Bühne mit den Bildern der Historie erfüllte. Kein späteres Wiederkommen, auch keine Wiederkehr mit der ganzen Fracht
indessen erworbener Kenntnis, kann die Magie des Erstmaligen
wiederholen oder gar überbieten. Es läßt sich schwer sagen, wieviele greifbare Erinnerungen an jenes erste Anschauen des Kaiserdomes geblieben sind; zu sehr sind sie überlagert von Späterem. Eines allerdings ist lebendig, ist gegenwärtig geblieben: das
12
Grabplatte Rudolfvon Habsburgs in der Kaisergruft im Dom zu Speyer.
Gefühl der Präsenz des Römischen ini romanischen Bauwerk
beim Blick durch die schlichte Größe des südlichen Seitenschiffes zur Treppe, die zum Querhaus hinauffuhrt. Neben diesem
ganz bedeutenden, spontanen Erlebnis scheintjener Nachmittag
eine zweite, wohl nicht ganz so tief eindringende, aber gleichwohl
nie mehr vergessene Vorstellung gezeitigt zu haben: die Iodentität des Begriffes Kaisergruft mit der Reliefplatte mit dem Bild
Rudolfvon Habsburgs. Die Stunde im Dom zu Speyer brachte,
wohl sehr zufällig, bald darauf einen Ertrag an einer Stelle, wo er
13
nicht mit Sicherheit zu erwarten war: im Schulalltag. Unser
Deutschlehrer, ein höchst präziser, nach heutiger Diktion autoritärer, von seinen Schülern, am meisten aber von sich selbst Leistung erwartender, kenntnisreicher Schulmann, erklärte uns eines Tages, er wolle mit uns eine Rezitationsstunde vorbereiten.
Jeder von uns erhielt ein Blatt mit einem Gedicht, das er flir die
betreffende Stunde auswendig lernen sollte. Überrascht, ja verblüfft, las ich die Überschrift des Gedichts, das mir zugedacht
war: Gräber in Speyer aus dem Zyklus Der Siebente Ring von Stefan George. Wie kam es, daß gerade mir diese Verse zugefallen
waren? Und es war eine schwierige Aufgabe, die gemeißelte
Sprache, der hieratische Tonfall, die esoterische Begriffswelt dieses Dichters. Den Text sich einzuprägen, war flir ein unverbrauchtes Gedächtnis gewiß kein Problem; ließ man uns nicht
auch Horaz-Oden und ganze Seiten Homer-Verse auswendig lernen? Doch ein so mächtiges Gedicht des großes Sprachmagiers
wirklich zu gestalten, seine dunklen Bilder plastisch erstehen zu
lassen, seine Tonsprache in allen Nüancen hörbar, erlebbar zu
machen! Dann kam die Rezitationsstunde, die letzte Stunde eines langen Vormittags. Wir gingen in den Musiksaal der Schule,
wo es ein Podium gab, von dem aus wir zu sprechen hatten. Was
die anderen vortrugen, weiß ich nicht mehr; zu sehr war meine
Spannung auf meinen eigenen Auftritt konzentriert. Die ersten
beiden Verse gingen noch schwer von der Zunge:
Uns zuckt die hand im aufgescharrten chore
Der leichenschändungfrische trümmer streifend.
Doch dann war vergessen, daß da unten die Kameraden saßen,
daß der Lehrer mir zuhörte, daß es nachher vielleicht Kritik und
Urteil geben werde. Noch einmal sah ich mich durch die
dämmerige Krypta und die Kaisergruft gehen und die Namen
lesen; es war, als sollte ich durch das Dichterwort beschreiben,
was ich, wenige Wochen zuvor, an jenem Samstagnachmittag
zum erstenmal mit meinen Augen erblickt hatte:
Urvater Rudolf steigt herauf mit Sippe.
Er sah in seinem haus des Reichespracht
Bis zu dem edlen Max dem letzten ritter.
Vielleicht hörte ich den letzten beiden Versen mit den fernen,
fremden Begriffen und Namen nach:
Weisheit der Kabbala und Römerwürde
Feste von Agrigent und Selinunt.
Der Lehrer stand auf: "Das war gut. Ich wußte nicht, daß Sie Gedichte so ausgezeichnet vortragen können." Wenn dieser Lehrer
14
lobte, blieb er knapp und präzis wie stets; aber sein Lob hatte
etwas zu bedeuten. Seitdem begleitet mich auch bei jeder Führung durch die Speyerer Kaisergruft Stefan Georges Gedicht
Gräber in Speyer.
In einem Lexikon der Weltarchitektur lese ich die nachstehende
Definition des Begriffs Mosaik: "Geometrische oder figürliche
Flächendekoration für Wände, Kuppeln oder Fußböden aus kleinen bunten Glas-, Stein- oder Marmorstückchen, die in einem
Mörtelbett aneinandergelegt werden. Die Mosaikkunst erreichte
in der römischen und byzantinischen Epoche ihren Höhepunkt."
Angesichts dieser Begriffsbestimmung und historischen Abgrenzung bekenne ich offen, daß das Erlebte Rheinmosaiknur ein Miniaturerzeugnis sein kann; eine erschöpfende Bearbeitung des
Themas ergäbe wohl ein riesiges Fußboden- oder Kuppelmosaik.
Das soll freilich berufeneren Meistern der Mosaikkunst vorbehalten bleiben. Eines ist gleichwohl gewiß: auch ein bruchstückoder lückenhaftes Mosaik müßte farbliehe Vielfalt mit thematischer Differenziertheit verbinden, müßte ein Zusammenspiellyrischer Motive mit starkem dynamischen Akzenten sein. Mitunter erklingen in diesem Konzert die konkurrierenden Stimmen
symphonisch - im ursprünglichen Sinn des Wortes. Das geschieht selten, das heißt dann, wenn Ort, Situation und Stunde in
eins zusammengehen. Diesen Glücksfall hat vermutlich schon
mancher Teilnehmer, manche Teilnehmerio an einer KarawaneRheinkreuzfahrt erlebt. Mir und einigen anderen Mitreisenden
wurde das am Abend des 1. Oktober 1983, am Ende der vierten
Rheinkreuzfahrt der Karawane in Köln zuteil. Unser Schiff, MS.
AUSTRIA, hatte unterhalb des Domhügels angelegt, seine
erleuchteten Fenster spiegelten sich im Wasser des Stromes,
ließen auch warmes Licht auf die Uferstraße rinnen. An Bord waren die Abschiedsreden gehalten, das Abendessen serviert worden, viele saßen noch in der Bar bei einer Flasche Wein, einzelne
hatten sich an einen ruhigen Tisch zurückgezogen und schrieben
ihr Reisetagebuch zu Ende, nicht wenige fühlten sich, überwältigt von den vielen Eindrücken, ermüdet und zogen sich in ihre
Kabinen zurück. Nur wenige waren es wohl, die glaubten, nach
dem letzten, mit Bildern und Gedanken so hoch angefüllten Tag,
der Einsamkeit, des Alleinseins zu bedürfen, um vor dem eigenen Bewußtsein die Summe zu ziehen, den Schlußpunkt selbst
zu setzen. Von der Anlegestelle des Schiffes bot sich der Gang
zum Domhügel von selbst an. Auch der schon weit vorgerückte
Abend hatte den Freiraum um den Dom noch nicht menschenleer gemacht. Doch der einsame Spaziergänger bemerkte das Gewimmel, das Stimmengewirr kaum. Zu riesig stieg vor dem Blick
15
Die Auferstehung. Älteres Bibelfenster im Kötner Dom.
das Gebirge des Bauwerks empor, zu erhaben, um nur als der kolossale Geselle zu gelten, den Reirich Reine noch als zukunftslose
Bauruine zu erkennen glaubte; auch große Dichter irren, wenn
sie sich vom Ingrimm die Rolle des Propheten aufdrängen lassen.
Mein Weg, ohne Plan und Absicht gewählt, führte zu einem ruhigen Wmkel der Südfassade; dort haftet im Stein eine Bronzetafel,
Erinnerung an den denkwürdigen, nicht nur als Datum der
Architekturgeschichte bedeutsamen 4. September 1842, an dem
- um noch einmal Reine zu zitieren- ein talentvoller König, Friedrich Wtlhelm IV. von Preußen und der Kölner Erzbischof den
16
Grundstein zu Weiterbau und Vollendung des Domes legten. Da
stand man nun sinnend in der Nacht und bedachte jenes Ereignis
und den Gang der Zeiten: wie leichthin überheben wir uns mit
unserem Stolz auf gegenseitige Toleranz und ökumenisches Einverständnis der Christen und vergessen, daß da vor nahezu eineinhalb Jahrhunderten ein evangelischer Herrscher und ein
katholischer Oberhirte ein beispielhaftes Bündnis eingingen zur
Erfüllung des Auftrages einer versunkenen Zeit. Im freien Raum
vor der Westfassade sah man Gruppen und Grüppchen von Menschen im Gespräch beieinander stehen. Der Ostpfeiler des Nordturmes verlangte ein kurzes Verweilen: auch im diffusen Licht
der Lampen war die Narbe des historischen Wundmals vom Luftangriff des 3. November 1943, die Ziege/plombe, erkennbar;
schmerzlich empfand man hier die ewige Spannung zwischen
den Mächten des Schöpferischen und des Zerstörerischen, zwischen den Werken des Friedens und jenen des Krieges. Der weitere Weg ftihrte mich dann ins Reich der Stille, entlang der Nordfassade zum Kapellenkranz des Chors mit dem krausen Filigran
der überreichen Schmuckformen. Wer das Bauwerk kennt und
deshalb liebt, mußte auch an diesem Abend, wenig vor Mitternacht, am Scheitelpunkt des Chorrunds innehalten, dort, wo in
der Längsachse des Doms die Dreikönigenkapelle in die Ostrichtung weist. Der Blick des Kundigen erhob sich, wie von Magie dahin gezogen, zum älteren Bibelfenster, dem ältesten farbigen
Fenster des ganzen Bauwerks; dort verbarg sich jetzt, oben im
Ausschnitt aus dem
Kölner DionysosMosaik. Tanzende
Frau und tanzender
Mann aus dem
Gefolge des Dionysos.
Köln, RömischGermanisches
Museum.
17
Dunkel das leuchtende Antlitz des triumphierend auferstehenden Christus. Es ist im Kölner Dombild Kalender 1984 abgebildet; die herrliche Aufnahme wurde möglich, nachdem im Sommer 1982 die Scheiben des Fensters herausgenommen und in der
Dombauhütte gereinigt worden waren. Ich weiß nicht, ob ich
mich auf diesem Rundgang überhaupt daran erinnert habe, daß
der ganze Riesenbau über den Fundamenten eines römischen
Tempels des Jupiter Mercurius sich erhebt. Jedenfalls wurde der
Schritt von einer unbewußten Eingebung hinübergelenkt zum
Schatzhaus, dem Thesauros, des römischen Köln, zum neuen
Römisch-Germanischen Museum; es ist wahrlich kein RömischGermanischer Supermarkt, wie im März 1974 nach der Eröffnung
des Museums ein Berichterstatter, der Masse der Exponate wegen, tadeln zu sollen glaubte. Das Poblicius-Monument und das
Dionysos-Mosaik, die beiden imposantesten Denkmäler des römischen Köln - Würde und Anmut, in zwei übereinander
angeordneten Geschossen vereinigt - zeigten sich hinter der
hohen Glaswand: Signale ferner Frühe. So endete der improvisierte Rundgang dort, wohin die folgenden Kapitel fUhren sollen:
Im Reich der Stadtgründer, in der Welt der römischen Colonia
Claudia Ara Agrippinensium.
Rheinkreuzfahrten
der Karawane Studienreisen 1981 - 1984
10. -17. 10.1981:
81/2-R Herbstkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"
Der Rhein von Basel bis Köln
17.- 2. 06.1982:
82/2-R 1 Kreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"
Der Rhein von Köln bis Basel
16.- 24. 10. 1982:
82/2-R 2 Herbstkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"
Rhein- und Moselkreuzfahrt von Basel bis Köln
24. 09.- 02. 10. 1983:
83/2-R Herbstkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"
Rhein- und Moselkreuzfahrt:
Römische Stadtanlagen, Kaiserdome und Landschaften von
Basel bis Köln
06.-13. 10.1984:
84/2-R Rheinkreuzfahrt mit MS "AUSTRIA"
Kaiserdome und Landschaften rechts und links des Rheins
(Vgl. Seite 114)
18
Bertold K. Weis
Wahrzeichen des Imperium Romanum am Rhein
Unter dem Titel Die Römer am Rhein zeigte das Römisch-Germanische Museum Köln im Frühjahr 1967 eine faszinierende Ausstellung. Der Katalog, ein dickes Buch von 371 Seiten mit einem
Anhang von 128 Bildtafeln, ist auch heute noch und in Zukunft
eine Quelle kostbarer Informationen. Das Interesse, das die Ausstellung in der Öffentlichkeit fand, wurde damals fast als sensationell empfunden. Voll und ganz bestätigte sich, was im Geleitwort
des Ausstellungskatalogs gesagt wurde: es handle sich hier "um
eine internationale und umfassende Schau von Rang, die es
bisher nicht gegeben hat und unserer Generation wohl auch
nicht noch einmal geboten wird". Sieben Jahre nach diesem Ereignis eröffnete (1974) das Römisch-Germanische Museum seine
neuen Räume am Kölner Domplatz. Der Publikumsandrang
übertraf alle Erwartungen. Eine große deutsche Tageszeitung
kennzeichnete das Außergewöhnliche des Ereignisses so: "Das
Ge wühle ist unbeschreiblich, mitten in der Woche. Es fallt einem
kein Beispiel ein, daß sich je eine Stadt derart aufihr Museum gestürzt hätte, ein Ansturm von Zehntausenden,jung und alt, Professorenmonokelneben Maurerkittel, Schülerinnen neben Rentnern, Familien mit Hund, Hausfrauen mit Einkaufstaschen,
Büroangestellte, die sich ftir eine "Besorgung" beurlauben ließen
-das Museum als Besitz der Bevölkerung, dieses immer so idealistisch ausposaunte Postulat, hier wird's Ereignis." Skeptiker
mochten vermuten, es handle sich um ein Eröffnungsspektakel;
ihre Vermutungen wurden in der Folge nicht bestätigt, das Interesse ist ungebrochen geblieben.
Ein Jahr danach (1975) erschien im Verlag Philipp Reclamjr. in
Stuttgart unter dem Titel Die Römer an Rhein und Mosel die deutsche Fassung eines umfangreichen Werkes des Luxemburger
Historikers Charles-Marie Temes: das französische Original La
vie quotidienne en Rhenanie Romaine (Das tägliche Leben im römischen Rheinland) war 1972 bei Hachette in Paris veröffentlicht
worden. In deutscher Sprache liegt der Band inzwischen schon in
der dritten Auflage (1982) vor, ein Argument gegen die oft behauptete und beklagte Geschichtsfeindlichkeit unserer Zeit; man
sieht, sie gilt zum mindesten nicht ftir die Geschichte der römischen Herrschaft in den Rheinlanden.
Wahrzeichen dieses Imperium in der unvergleichlichen Stromlandschaft sind vor allem die großen, aus allen Untergängen neu
19
Rauneorum
Augusta
und Castrum Rauraceuse
,,~~
:
~:_
'7
I,
I
leQende:\
1 Hauptforum
'' 2 curia
3 Basilika
_ ~ 4 Tempe~
5 Theate-r
6 Tempel
, 7 Tempeln. Neben·
8 Forum m
und Südforum
9 Zentraltherme"
Übersichtsp1a n von Aug usta Raurica.
20
lO Tempel
11 Amphitheater
12 Tempel
13 Rundbau
t4 Museum
Augusta Raurica. Modell der Stadt, Ansicht von Osten. BlickaufBasilica und Jupitertempel (Vordergrund), Theater und Tempel auf Schönbühl (Hintergrund).
Nach W. Eicbenberger.
aufgeblühten Städte des westlichen Ufers. Mit wenigen Ausnahmen tut sich ihre römische Herkunft noch in ihren heutigen Namen kund. Um auf Schweizer Boden zu beginnen: Augst, die
älteste römische Bürgerkolonie nördlich der Alpen, verdankt
ihren Doppelnamen Augusta Raurica einerseits dem Augustus,
andererseits den keltischen Bewohnern der Gegend, den Rauricern. L. Munatius Plancus, ein Freund Cäsars, der den Ort, vermutlich am 21. Juni 44 v. Chr., gründete, gilt auch den Baslern
als ihr Stadtgründer; sein Denkmal, die Stiftung eines Basler
Neubürgers aus dem Jahr 1574, steht im Hof des schönen spätgotischen Rathauses der Stadt.
Der Name des Munatius Plancus und seine Gründung Augusta
Raurica weisen auf den Ursprung der römischen Präsenz am
Rhein hin; sie ergab sich als historische Folgerung aus der Eroberung Galliens durch C. Julius Cäsar (58-51 v. Chr.) und währte
dann rund ein halbes Jahrtausend. Sie ftihrte auch zu einem
ersten großen militärischen Zusammenstoß der Legionen mit
den aufs linke Rheinufer übergetretenen, teilweise schon tief in
keltische Siedlungsgebiete eingedrungenen Germanenstämmen. In dem blutigen Waffengang mit dem begabten und selbstbewußten suebischen Heerkönig Ariovist - der Schlachtort lag
zwischen Belfort und Schlettstadt, vermutlich im Raum Mühlhausen- mochte der römische Eroberer die Bedeutung der nachmals geradezu sprichwörtlich gewordenen Germanengefahr
erkennen; mit ihr hatte Rom in den folgenden Jahrhunderten zu
leben. In dieser Begegnung dürfte schon Cäsar die Einsicht ge-
21
wonnen haben, daß der Rhein nicht geeignet sei, als sichere
Grenze die westwärts drängende, jenseits des Stromes einen goldenen Westen erwartende germanische Völkermasse aufzuhalten. Abschreckung allein schien Wrrkung zu versprechen. Sie hat
auch bereits Cäsar praktiziert, als er zuerst im Jahre 55 v. Chr. in
der Gegend von Weißenturm südlich Andernach, dann im Jahre
53 v. Chr. bei Urmitz gegenüber dem Südrand des Neuwieder
Beckens seine beiden berühmten Pionierbrücken über den
Rhein bauen ließ, um in germanisches Gebiet vorzustoßen. Weitere Pläne für Germanien zu verfolgen, war Cäsar nicht gegeben;
seine politischen Ziele riefen ihn nach Italien zurück und führten
ihn in einen Bürgerkrieg, in dem die römische Republik untergehen und einem neuen Herrschaftssystem Platz machen sollte.
Caesars Erbe und Nachfolger Augustus gedachte, das Werk seines Vorgängers folgerichtig weiterzuführen; einerseits betrieb er
auf dem linken, dem römischen Rheinufer, die Organisation und
Konsolidierung der Verhältnisse, andererseits setzte er sich die
Vorverlegung der Grenze des Imperium Romanum an die Eibe
zum Ziel. Im Rahmen der ersten Aufgabe erfolgte in den linksrheinischen Gebieten die An- oder Umsiedlung ursprünglich
rechtsrheinischer, mit Rom freundschaftlich verbundener Germanenstämrne. Die mit Ariovist auflinksrheinisches Territorium
Grabstein des
Centurio Marcus
Caelius der XVIII.
Legion. Er fiel im
Varus-Krieg. Der
Grabstein wurde bei
Xanten-Birten gefunden. Rheinisches
Landesmuseum Bonn.
22
M. Vipsanius Agrippa.
Darstellung auf der Ara Pacis Augustae, Rom.
übergetretenen Tribocer hatte schon Caesar im Unterelsaß angesiedelt; sie wurden als Civitas Tribocum um den Hauptort Brotomagus, dem heutigen Brumath an der Straße von Straßburg nach
Zabem, organisiert. Die Ubier hatten ihr Stammesgebiet zunächst östlich des Rheins, zwischen unterer Lahn und Taunus,
gehabt; sie wurden schon früh, in den Jahren 39/38 v. Chr., von
M. Vipsanius Agrippa, dem erfolgreichen Mitarbeiter und späteren Schwiegersohn des Augustus, als Civitas Ubiorum im Kölner
Raum ansässig gemacht und mit dem Schutz der Grenze beauftragt. Ihnen hatte bereits Caesar den Ehrentitel amici populi Romani (Freunde des römischen Volkes) verleihen und ihren Namen in das Verzeichnis der Freunde Roms (formula arnicorum)
eintragen lassen.
Weit problematischer war das andere Ziel: Germanien bis an die
Eibe römischer Autorität botmäßig zu machen; damit wäre der
Rheingrenze eine riesige Landmasse als Brückenkopfvorgeschoben worden. Diesem imperialistischen Vorhaben dienten zuerst
23
die Feldzüge der Stiefsöhne des Augustus, vor allem die kühnen
Vorstöße des Drusus; dieser drang in den Jahren 12 bis 9 v. Chr.
viermal mit bedeutender Heeresmacht weit in rechtsrheinische
Gebiete vor und erreichte tatsächlich die Eibe. Er war somit der
erste römische Feldherr, der auf germanischem Boden so weit
nach Osten gelangte. Doch der erst Dreißigjährige starb im September des Jahres 9 v. Chr. auf dem Rückmarsch an den Rhein
an den Folgen eines Unfalles. Sein früher Tod signalisierte die
kommende Schicksalswende in der römischen Germanienpolitik. Krasse Realität wurde sie knapp zwei Jahrzehnte später durch
die Katastrophe des Legatus Augusti pro praetore P. Quinctilius
Varus im Herbst des Jahres 9 n. Chr.: Rom verlor auf einen
Schlag die kampferprobten Truppen der XVII., XVIII. und XIX.
Legion, dazu drei Reiterschwadronen und sechs Auxiliarkohorten; die drei Legionsadler fielen in die Hände der Germanen. Die
offensive Germanienpolitik des Augustus war gescheitert; sie
mußte aufgegeben und durch eine defensive Konzeption mit
dem Rhein als Verteidigungs- und Grenzlinie ersetzt werden.
Doch diese Erkenntnis vermochte erst des Augustus Nachfolger
Tiberius (14-36) in politische und strategische Prinzipien umzusetzen.
Voraussetzung einer wirksamen Verteidigung der Rheingrenze
war die ständige Anwesenheit und Verfugbarkeit einer gewaltigen römischen Truppenmacht an den Ufern des Stromes. Daher
finden wir gegen Ende der Regierungszeit des Augustus acht römische Legionen mit ihren Reiterschwadronen und Auxiliarkohorten am Rhein. Sie waren je hälftig zwei Kommandobereichen
zugeteilt. Diese entsprachen den beiden, von den Römern in
ihrem germanischen Herrschaftsbereich dann eingerichteten
Provinzen Germania Superior (Obergermanien) und Germania
Inferior (Niedergermanien). Um die Einsatzbereitschaft der
Truppe und die Aufrechterhaltung der Disziplin zu sichern, war
die Anlage großer, fester, auf die Dauer berechneter, gegebenenfalls auch auf die Verteidigung eingerichteter Legionslager notwendig, mit allen für die Unterhaltung einer festen Garnison
erforderlichen Einrichtungen. Als demonstrative Entfaltung militärischer Macht stellten sich die Doppellegionslager dar, wie sie
ständig in Mogontiacum (Mainz), in Vetera (bei Xanten) und für
einige Zeit auch in Köln bestanden. Der Versorgungsbedarf so
großer Truppenverbände führte in der unmittelbaren Umgebung
der Legionslager zur Entstehung sogenannter canabae,
Ansammlungen von Händler- und Handwerkerbuden, von Läden, Magazinen und dergleichen, die sich zu einer Art von Lagervorstädten herausbildeten.
24
Die lebenskräftigsten, verwandlungs- und verjüngungsfähigsten
Schöpfungen der Römer am Rhein sind ihre Stadtgründungen in
Gebieten, in denen bis dahin in offenen dörflich-agrarischen
Siedlungen gewohnt worden war und städtische Organisationsformen des Zusammenwohnens unbekannt waren. Sie entstanden entweder als Vororte einheimischer Civitates und ihrer Stammesgebiete oder als römische Bürger- und Veteranenkolonien
mit eigenen Organen der Selbstverwaltung oder als Municipien
(Landstädte) mit verschiedenen Graden rechtsstaatlicher Kompetenz und als Zentren der Administration. In ihrer reifsten
Form hatten die städtischen Gemeinwesen an ihrer Spitze zwei
Bürgermeister, nach dem Grundsatz der Kollegialität, und einen
Rat, die decuriones. Bei den Stadtgründungen hatten die Agrimensores (Feldmesser), die nach ihrem Visiergerät(groma) auch
Gromatici genannt wurden, als Stadtplaner tätig zu werden; sie
hatten dabei nicht nur die Straßenführung und die Gliederung
der Wohnviertel (insulae) festzulegen, sondern auch die gesamte
Raumordnung, auch die des Umlandes, nach den alten, bewährten Prinzipien der römischen Feldmesserei zu fixieren. Aus dieser überlegten Stadt- und Raumplanung erklärt sich die verkehrsgünstige Lage der von den Römern neu gegründeten oder neu
organisierten und geförderten städtischen Siedlungen.
Glanzvollstes Beispiel wird wohl stets das römische Köln bleiben.
Zu seinem erstaunlichen Aufstieg trug wesentlich seine frühe
Erhebung zum Sitz des römischen Statthalters ftir Niedergermanien (Germania Inferior) bei. Kultisches Zentrum dieser Stadt
der Ubier, wie sie zunächst wohl noch hieß, wurde unter Kaiser
Tiberius (14-37) ein Altar des zu den Göttern erhobenen Augustus. Von diesem Altar erhielt der Platz dann den römischen Namen Ara Ubiorum, Altar der Ubier, kurz auch Ara. Unter Kaiser
Claudius (41-54) erfuhr die Stadt die bedeutendste, ihrer künftigen Entwicklung auch förderlichste Rangerhöhung: sie wurde
Colonia, römische Bürgerkolonie. Der Herrscher hatte eine besondere Beziehung zu dieser Stadt durch seine vierte Gemahlin,
die jüngere Agrippina, die zugleich des Kaisers eigene Nichte
war: sie war im Jahre 15116 als Tochter des Germanicus, eines
Sohnes des Drusus, in Köln geboren worden. Etwas bösartig bemerkt Tacitus, der Historiker der Epoche, Agrippina habe der
Öffentlichkeit ihren politischen Einfluß demonstrieren wollen,
indem sie den nachgiebigen Kaiser dazu bewog, ihre Geburtsstadt nicht nur durch die Ansiedlung römischer Veteranen zur römischen Bürgerkolonie zu erheben, sondern ihr auch den prunkvollen Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium zu verleihen; in dieser pompösen Titulatur ist der Name des Kaisers und
25
Das römische Köln, Grundriß.
der seiner Gattin vereinigt, die Kölner durften sich fortan Agrippinenser nennen. Die Abkürzung CCAA liest man noch heute
über dem Bogen des mittleren Durchlasses des römischen Nordtores von Köln, der jetzt zu den auffallensten, monumentalsten
Ausstellungsstücken des Römisch-Germanischen Museums der
Domstadt zählt.
Mit der Verleihung des Ranges einer Colonia war ein neuer
Rechtsstatus der Stadt, das Ius Italicum verbunden: Es brachte
u. a. insofern eine Veränderung des Bodenrechts, als der bisher
zu Rom und dem Territorialbereich der römischen Legionen gehörende Grundbesitz der Einwohner nun in deren tatsächlichen
Besitz überging; gleichzeitig waren sie damit von der Grund-
26
steuerDie Rangerhöhung beförderte auch den weiteren Aufstieg
der Stadt, deren äußeres Bild durch eine starke Stadtmauer mit
neun Toren und durch das bereits angedeutete, von den Agrimensores vermessene übliche Schema mit der rechtwinkligen
Anlage des Straßensystems und dervon den Straßen umschlossenen Insulae (Wohnviertel) mit den beiden traditionellen Hauptachsen des decumanus maximus (Ost-West-Straßenachse) und
des cardo maximus (Nord-Süd-Achse) bestimmt war.
Das Doppellegionslager der augusteischen Zeit war bereits während der frühen Regierungsjahre des Tiberius aufgelassen, die
beiden Legionen getrennt nach Neuss und Bonn verlegt worden.
Köln aber blieb Sitz des kaiserlichen Legaten für Niedergermanien und damit Administrationszentrum der Provinz. Nicht zuletzt diesem Umstand verdankte die Colonia Claudia Ara Agrippinensium einen Großteil ihres Ansehens und ihres glanzvollen
Stadtbildes in römischer Zeit. Das Praetorium, der Statthalterpalast, stand auf einem flach hügeligen, den Blick auf den Rhein beherrschenden Gelände in der Gegend des heutigen Rathauses
und bedeckte eine Fläche von 93 x 28 Meter. Nach dem Fluß hin
öffnete sich eine mächtige Säulenhalle. Neben dem Prätorium ist
ein weiterer größerer Bau festgestellt, vielleicht das Verwaltungsgebäude der vielgliedrigen Provinzialbehörde.
Daß in der aufstrebenden Stadt schon in den ersten Jahrzehnten
nach der Einrichtung der römischen Kolonie auch bemerkenswerte private Bauten und Denkmäler entstanden sind, beweisen
die Funde. Der auffallendste unter diesen war wohl das 1965
unter einem zerbombten Haus entdeckte, zuerst durch eine Privatgrabung freigelegte, jetzt im Römisch-Germanischen Museum eindrucksvoll rekonstruierte Grabdenkmal eines sonst
unbekannten Lucius Poblicius, das um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstanden sein könnte.
Das Kölner Nordtor.
Rekonstruktion der
Außenfassade.
27
Poblicius-Denkmal. Relief des Hirtengottes Pan. Köln, Römisch-Germanisches
Museum.
28
Zu den offiziellen Bauten, deren Fronten die Rußlandschaft beherrschten, trat in der Stadt am Strom eine Hafenanlage; sie diente zunächst als Rottenstation für die von den Römern unterhaltene, im Zusammenhang mit den militärischen Operationen
unentbehrliche Rheinflotte. Diese erscheint in der Geschichte
der Römer am Rhein zum ersten Mal im Jahre 12 v. Chr. unter
der Bezeichnung Classis Germanica. Einhundert Jahre später, im
Jahre 96 n. Chr. trägt sie den Ehrentitel Classis Germanica Pia Fidelis (die loyale und getreue). An sie erinnern Ziegelfunde aus
dem Raum um Köln mit dem Namensstempel dieser Rotte. Ihre
Verbände sollten bis in die Spätzeit hinein in den Kämpfen um
die Verteidigung der Rheingrenze eine nicht zu übersehende Rolle spielen. Neben der militärischen Zweckbestimmgung des Kölner Rheinhafens ist die Bedeutung der Hafenanlagen für die
zweifellos vorhandene und auch bezeugte Flußschiffahrt und
ihr Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt zu beachten. Leider wissen wir über die zivile Schiffahrt der römischen
Zeit auf dem Rhein noch zu wenig. Nachgewiesen zu sein scheint
der Zusammenschluß der Kölner Rheinschiffer zu einer eigenen
Korporation (Schifferzunft).
Eine römische Bürgerkolonie ohne ihr eigenes Kapitol ist nicht
denkbar. Zu ihm gehörte stets ein repräsentativer Kultbau, in der
Regel ein ansehnlicher Podiumstempel der stadtrömischen Trias:
J upiter, J uno, Minerva. In Köln sind Spuren dieses Tempels unter
der Kirche St. Maria im Kapitol gefunden worden; als christliche
Kirche bewahrt sie den römischen Namen des Platzes. Eine Stadt
von der Bedeutung Kölns besaß außer diesem Haupttempel natürlich auch andere Kultstätten: an der Nordostecke der römischen Wohnstadt ist ein kleiner Podiumstempel des Mercurius
Augustus festgestellt worden, der bald nach der Einrichtung der
Kolonie erbaut sein dürfte und, wie man annimmt, nicht lange
nach 388 abgebrannt ist. Weitere Kultstätten sind anzunehmen,
auch wenn sie bisjetzt nicht gefunden sind. Eine für Köln nachgewiesene Kultgemeinde der phrygischen Göttermutter Kybele hat
zweifellos auch ihr kleines Heiligtum besessen.
Hinter dem Aufstieg der Stadt zum administrativen, kultischen
und kulturellen Zentrum der Landschaft stand ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht zurück. An den großen Ausfallstraßen
entstanden vor den Toren die Produktionsstätten handwerklicher, kunsthandwerklicher und industrieller Erzeugnisse. Die
Ausgrabungsfunde, zufällige und gezielt ausgesuchte, haben das
römische Köln als Mittelpunkt einer leistungsfähigen und kunsthandwerklich hochstehenden Glasfabrikation erwiesen; Kölner
vitrarii (Glasbläser) waren die Schöpferjener bewundernswerten
29
Köln zur Römerzeit (2. Jh. n. Chr.).
und vielbewunderten Gläser, Schalen, Schälchen, Becher, Parfl.imflaschen, Krüge, vor denen die Besucher des Römisch-Geranischen Museums immer wieder gebannt verweilen.
Aus diesem Aufeinandertreffen und Zusammengehen differenzierter Kräfte aus Armee, Verwaltung, Handel, Gewerbe konnte
sich jene besondere Form städtischer Kultur und städtischen
Selbstbewußtseins entwickeln, die der Stadt als Idee über die
großen historischen Lücken hinweg bis heute treu geblieben ist.
Eindeutiger und ausdauernder als im Fall der Colonia Claudia
Ara Agrippinensium erwiesen sich die strategischen Gesichtspunkte als entscheidend bei der Wahl des Standortes eines regelrechten Feldlagers, das Agrippa um 18 v. Chr. oder bald danach
im Raum von Mainz angelegt hat. Es sollte zunächst als Ausgangspunkt fl.ir die geplanten Feldzüge nach Innergermanien dienen, als man noch an dessen Eroberung und Unterwerfung dachte. Von hier aus trat Drusus im Jahre 12 v. Chr. seinen Zug an die
Elbe an. Bald darauf- kurz nach dem Jahre 20 n. Chr.- wurde auf
dem Kästrich - die Bezeichnung wird auf das lateinische Wort
castrum (Lager) zurückgefl.ihrt - rund einen Kilometer vom
Rhein entfernt, etwa fl.infzig Meter über dem Fluß, von zwei
Legionen, der XIV. (Gemina) und der XVI. (Gallica) ein Doppellegionslager errichtet. Etwas weiter südlich, in Weisenau,
entstand ein weiteres Militärlager in der Form eines sogenannten
Auxiliarkastells, d. h. eines mit Hilfstruppen belegten Kastells,
30
-,
- - - RÖM. MAlJrR VERM.\)TrT
l/
"'
/~/
............./
~
RÖM. STilAUf aE"iu.tERT
R0:M. STRASSE VERMUTET
"_"..._. FftÄNK. 5TRASSE VERMUnT
A
RÖM. ALTAR. ODflt WEJkUTEilol.
F
L
~Ö .... MOSAiiC:-FIJU&Obl"N
RÖM. C.UÄUOE"IIUT
M
RÖM. M0NZSCMAT'i'FVND
T
llÖM. C.llAIJ
+
FR\)kGHRiSTL OOFRFFtÄNI<.CMB
Entwicklung der Stadt Mainz bis 700 n. Chr.
das jedoch so groß gewesen zu sein scheint, daß es später eine
ganze Legion aufnehmen konnte. Durch diese massierte Truppenstationierung wurde Mainz in den letzten Lebensjahren des
Augustus zum Hauptstützpunkt römischer Militärmacht am
Rhein; gleichzeitig war es von da an Amtssitz des römischen
Oberkommandierenden und Statthalters für Obergermanien.
Von dieser gewaltigen Truppenmasse ging in der Folgezeit aber
sehr viel politische, für das Reich verhängnisvolle Unruhe aus: so
31
im berüchtigten, blutigen Vierkaiserjahr 68/69, als die Mainzer
Legionen dem Kaiser Galba den Treueid verweigerten und auch
die Legionen Niedergermaniens mit in ihre Revolte hineinrissen
und sie veranlaßten, mit ihnen zusammen den Statthalter in
Köln, Aulus Vitellius, zum Kaiser auszurufen. Kaiser Domitian,
der im Jahre 89 n. Chr. eine wiederum von Mainz ausgehende,
diesmal vom Statthalter selbst inszenierte Rebellion niederwerfen mußte, zog die Konsequenz aus den negativen Erfahrungen
mit der allzu dichten Ballung großer Truppenverbände: die Doppellegionslager wurden aufgelöst, die Legionen ausgetauscht und
vor allem weiter auseinandergezogen. In Mainz verblieb nur eine
Legion.
Die Stadt selbst entwickelte sich am Platz einer weit älteren einheimischen Siedlung, die ein Stammesheiligtum eines keltischen
Gottes Mogon besaß, von dem der Ort den Namen Mogontiacum
erhielt. Bereits seit den achtziger Jahren des 1. Jahrhunderts
n. Chr. stellte eine feste Brücke die Verbindung mit dem rechten
Rheinufer dar, auf dem die Römer einen befestigten Brückenkopf, das castellum Mattiacorum behalten hatten; die Mattiaker
waren ein Teilstamm, der sich aus dem Stammesverband der
Chatten gelöst hatte und im Gebiet zwischen Mainmündung und
Taunus lebte. Wie Köln erhielt auch Mainz frühzeitig einen
Rheinhafen als Stützpunkt für die römische Rheinflotte. Sie setzte sich aus leichteren, für die Flußüberwachung und den Patrouillendienst geeigneten Schiffen, aus großen Dreiruderern oder Triremen, aus Schnellbooten für Verbindungsoffiziere und Kuriere
(cursoriae) und aus schweren Transportschiffen zusammen. Wie
in Köln existierte auch in Mogontiacum/Mainz neben dem Hafen der Kriegsflotte ein Handelshafen, der seinerseits von der
Truppe gesichert und geschützt wurde. Den Wohlstand, den die
Handelsschiffahrt auf dem Strom selbst und bis hinüber zu den
Hafenplätzen Britanniens den Unternehmern und Händlern einbrachte, bezeugt, wie in Köln das Poblicius-Denkmal, hier in
Mainz das aufwendige Grabmal eines Schiffseigners und Handelsmannesnamens Blussus, der auf dem Stein sich selbst, seine
Gattin und sein Schiff darstellen ließ. Auf den römischen Hafen
von Mainz wurde die Öffentlichkeit vor einiger Zeit durch einen
sensationellen archäologischen Fund aufmerksam gemacht. Bei
Aushubarbeiten für einen Hotelneubau wurden zwischen dem
November 1981 und dem Februar 1982 im Schlamm begraben
neun enggedrängt nebeneinander liegende, über elfMeter lange,
mittschiffs 3,70 Meter breite Ruderschiffe des 4. Jahrhunderts
n. Chr. gefunden. Wenige Monate später grub man noch zwei
weitere, ältere Römerschiffe aus. Mit Hilfe der sehr genauen den-
32
Grabstein des
Mainzer
Reeders
Blussus.
Mainz,
Landesmuseum.
drochronologischen Untersuchungsmethode (Holzringzählung)
datierte man die zuerst gefundenen Schiffe in die Zeit zwischen
320 und 394. Für das älteste der beiden zuletzt (d. h. im April
1982) gefundenen Schiffe wurde mit derselben Methode festgestellt, daß die Eichen zu seinem Bau im Jahre 81 n. Chr. gefällt
worden waren. Da man das Schiffsbauholz vermutlich nicht allzu
lange zu lagern pflegte, ist als Bauzeit die Regierung des Kaisers
Domitian (81-96) anzunehmen. Aus diesem Schiffsfriedhofkann
33
Mainz, Schiff 9: Leichtgebautes Rundspantschiff mit vermutlich 13 Ruderern an
jeder Seite und einem Segelmast im Vorschiff. Ein auf Schnelligkeit gebautes
leichtes und sehr bewegliches Kriegsschiff aus dem 4. Jh. n. Chr.
man schließen, daß in der stürmischen Zeit, als die Völkerwoge
germanischer Stämme den Limes überflutete und gegen die römische Rheingrenze anbrandete, der Mainzer Hafen noch immer
operativer Stützpunkt der römischen Verteidiger gewesen ist.
Aufwelches historische Ereignis der Zeit die Entstehung des bemerkenswerten Schiffsfriedhofes zurückzufUhren ist, bleibt
unbekannt. Der Zeitgenosse Ammianus Marcellinus berichtet
von einem alamannischen Überfall auf die Stadt am Osterfest des
Jahres 368: "Da ftihrte ein alamannischer Königssohnnamens
Rando eine lange vorbedachte Absicht aus und drang insgeheim
in das von Bewachern entblößte Mainz mit einer leichtbewaffneten Truppe zum Plündern ein. Da er die Christen zufällig bei der
Begehung eines kirchlichen Hochfestes antraf, konnte er ganz
ungehindert schutzlose Männer und Frauen jeglichen Standes
zusammen mit wertvollem Hausrat wegführen." Bei einem ähnlichen, doch weit brutaleren Überfall, von dem ein Brief des heiligen Hieronymus berichtet, wurden zwei Jahrzehnte später (407)
Tausende in den Kirchen versammelte Christen niedergemacht.
Daß Mogontiacum ähnlich wie die Stadt der Agrippinenser in der
Kaiserzeit eine gedeihlich sich entwickelnde Wrrtschaft besaß,
bezeugen die Funde. Doch im Gegensatz zu Köln erlangte die
Stadttrotz ihres Wachstums und ihrer Bedeutung erst erstaunlich
spät den Rang einer römischen Landstadt (Municipium), d. h. ei-
34
ner städtischen Gemeinde mit eigenem Rat und eigener Verwaltung. Diese Rangerhöhung fällt in die Regierungszeit des Kaisers
Diokletian (294-305); bei seiner bekannten Neuordnung des Reiches, erhielt der in Mainz residierende Oberkommandierende
den Titel eines Dux Mogontiacensis; die Stadt ist nun offiziell die
Metropole der Germania Prima, ein befestigter Mauerring
umgibt sie. Wie in Köln hat man auch hier Kultstätten und Kultbauten anzunehmen. Aus der Benennung eines Stadtteils als Vicus Apollinensis darf man wohl schließen, daß es dort einen Tempel des Apollon gegeben hat; dieser Apollon könnte die Interpretatio Romana, die römische Umdeutung des altkeltischen Gottes
Mogon, des Namensgebers der Stadt gewesen sein. Das würde
der Tendenz römischer Religionspolitik entsprechen, die Götter
der unterworfenen Stämme und Gebiete nicht zu verdrängen,
ihren Kult nicht auszurotten, sondern sie in das System der römischen Götterhierarchie zu integrieren.
Den großen, strategisch bedeutenden Lagergründungen des
Imperium Romanum am Nieder- und Mittelrhein entspricht am
Oberrhein das Legionslager Argentorale an der Stelle des heutigen Straßburg. Es wurde nach der Katastrophe des Varus
(9 n. Chr.), wie in Mainz bei einer älteren keltischen Siedlung,
eingerichtet. Bereits zuvor befand sich im Bereich des jetzigen
Münsters, wie die Archäologie nachzuweisen vermochte, ein
kleineres römisches Truppenlager, in dem nach Ausweis einer Inschrift, die bei der Kirche Jung-St.-Peter (Saint Pierre le Jeune)
gefunden wurde, eine Reiterschwadron der mit Rom verbündeten Treverer, die Ala Petriana Treverorum, stationiert war. An seiner Stelle wurde dann im zweiten Jahrzehnt des ersten
nachchristlichen Jahrhunderts, in den ersten Regierungsjahren
des Kaisers Tiberius (14-36), ein dreimal so großes rechteckiges
Lager errichtet; hier wurde die aus Spanien an den Rhein gerufene Legio II Augusta untergebracht. Aus dieser Zeit haben sich an
der Straße nach Basel mehrere Grabstellen gefallener oder gestorbener Soldaten dieser Legion erhalten. Das Legionslager, von
Armen der Ill umflossen, war durch einen Erdwall geschützt, der
außen durch Palisaden verstärkt war. Die canabae lagen vor dem
Lager an der Straße nach Königshoffen.
Zu Beginn der vierziger Jahre des ersten Jahrhunderts n. Chr.
wurde die Legio II Augusta von Straßburg nach Britannien verlegt und flir einige Zeit durch die ebenfalls aus Spanien abberufene Legio IV Macedonica ersetzt. In den ersten Regierungsjahren
des Kaisers Vespasian (69-79) wurde schließlich die Legio VIII
Augusta im Straßburger Lager stationiert. Sie sollte flir sehr lange
Zeit dort bleiben. Straßburg ist von dieser Zeit an nicht mehr
35
Glied der vorderen Verteidigungslinie; nach dem Ausbau des
obergermanischen Limes und der damit verbundenen Verschiebung der römischen Verteidigungsanlagen weit nach Osten lagen
Stadt und Legionslager nicht mehr im eigentlichen Grenzgebiet.
Die Stadt selbst entwickelte sich nun auch wirtschaftlich und kulturell. Als äußere Bekundung der Selbständigkeit und Sicherung
mag die erste steinerne Mauer gelten, die Argenterate gegen
Ende des 1. Jahrhunderts schützte. Die Backsteine, mit denen
der Mauerkern verkleidet war, tragen den Ziegelstempel der Legio Vlll; die Truppe hatte in Eckbolsheim, am Westrand des heutigen Straßburg, westlich von Königshoffen, eine Ziegelei eingerichtet. Wenn man den Querschnitt dieser römischen Stadtmauer, die oben etwa 90 Zentimeter, an der Basis etwa 130 Zentimeter stark war, betrachtet, erhält man nicht gerade den Eindruck eines wirksamen Verteidigungsbauwerks. Als von den
sechziger Jahren des dritten Jahrhunderts an die Alamannengefahr aus einem fernen Schreckgespenst zu drohender Wirklichkeit wurde, besann man sich auch in Straßburg auf eine stärkere
Wehranlage. So entstand im vierten Jahrhundert durch eine
erhebliche Verstärkung der bisherigen Mauer auf mehr als
dreieinhalb Meter Dicke die jüngere Mauer; sie wurde mit vier
Ecktürmen, neunzehn Türmen auf der Nordseite, elf bis zwölf
Türmen auf der Ostseite und mit wenigstens fünfTürmen auf der
Südseite entlang der 111 ausgestattet.
Neben der Wahrnehmung ihres militärischen Auftrags hat die
Legio VIII auch an Aufgaben der Infrastruktur mitgewirkt: an der
Verbesserung und dem Ausbau der Straßen - Argentorate lag ja
am Schnittpunkt zweier bedeutender Fernstraßen, von der es
später seinen alemannischen Namen erhielt - und bei der Einrichtung einer ausreichenden Wasserversorgung. Im Zusammenhang mit der ersten Aufgabe baute dieö Legion die Sandsteinbrüche bei Reinhardsmünster (südwestlich von Maursmünster/Marmoutier) ab; eine an Ort und Stelle verbliebene Inschrift
OFFICINA LEG (IONIS) Vlll AUG (USTAE) bezeugt dies. Die
von der Truppe errichtete Wasserleitung, eine doppelte Röhrenleitung, flihrte das Quellwasser von Kuttolsheim (nördlich Marlenheim, d. h. nördlich der Straße Straßburg-Zabern), in die
Stadt.
Von der Entfaltung künstlerischer Aktivitäten in der Stadt sprechen die Funde. Zunächst waren es vermutlich zugewanderte, in
Italien ausgebildete Bildhauer, die in Straßburg tätig wurden. Sie
schufen ihre Bildwerke noch unter dem Einfluß der Meisterwerke der griechischen Spätklassik. Neben sie treten dann, mit
ihren so ganz anders gearteten, provinziell oder auch primitiv
36
erscheinenden Versuchen, einheimische Steinmetzen und Bildhauer. Der rosenfarbene Vagesensandstein erscheint nun
erstmals in der Bildhauerei, das Material, aus dem, viele Jahrhunderte nach dem Ende der römischen Herrschaft am Rhein, am
Straßburger Münster so einzigartige Meisterwerke entstehen
sollten.
Bald nach der Mitte des vierten Jahrhunderts war das Umland
von Argentaraturn noch einmal der Schauplatz einer der letzten
großen Verteidigungsschlachten Romsam Rhein: der Statthalter
der gallischen Provinzen, der spätere Kaiser Julian, brachte einem gewaltigen Aufgebotgermanischer Krieger, die über den nahen Rhein ins Elsaß gekommen waren, eine vernichtende Niederlage bei und konnte damit den Zusammenbruch der römischen Rheingrenze um ein halbes Jahrhundert hinausschieben.
Als Stilicho schließlich im Jahre 401 die römischen Legionen vom
Rhein abzog, um Italien gegen Alarich zu sichern, war auch das
Schicksal Argentorates besiegelt: wenige Jahre nach der Preisgabe der Verteidung am Rhein bezeugt der heilige Hieronymus, der
die Situation der römischen Rheinlande aus der Zeit seiner theologischen Studien in Trier (um 370) kennen mußte, den Fall der
Städte Mainz, Worms, Speyer und Straßburg. Das gewaltsame
Ende der Römerzeit bedeutete jedoch auch für die römische
Gründung Argentorate nicht das endgültige Versinken in die
Melancholie einer verlorenen Ruinenstadt
Charles-Marie Ternes hat in seinem eingangs zitiertenBuch über
Die Römer an Rhein und Mosel auch die Frage gestellt, warum die
rheinischen Städte die Völkerwanderung überdauert haben. Er
erklärt dieses Überdauern aus dem Überleben römischer Traditionen bei den linksrheinischen Germanen: "Die linksrheinischen Germanen nahmen das römische Programm im Laufe der
Zeit wieder auf, begannen erneut mit der Eroberung des Ostens
und benutzten dabei die römischen Städte als Ausgangsbasis."
Ternes' These erschien manchem als nicht erschöpfend und restlos überzeugend. Geschichtliche Analogien aus anderen geographischen und kulturgeschichtlichen Räumen vermögen aber zu
zeigen, daß zukunftsbezogen geschaffenen, groß geplanten und
geprägten Stadtgründungen immer wieder ein Genius erwächst,
der ihr Fortleben oder Neuerstehen verbürgt.
37
~
·~ ~,~ ...~.
'
•
'
i
(j)V•I=~~~~:,
a>
u (
'
'
@ Leg1onslager
;'""
~..,.
!.II
..
~
/\. '
-
<
~
";)
1"11
~
T
r
e
v
b
r
e
"'
0
Mediomatrici
..
E
'
I
~oooHn)l.
/<~"$,.._
~~,?"Veoo''l:'{:;.\,
;'"·- ·-
'':.:..."-
/
Germanien und Rätien in römischer Zeit (nach Westermann Atlas 1956, 37).
38
"'0
~
I 0
,z
Bertold K. Weis
Aulus Vitellius Eine römische Kaiserproklamation in Köln
Auf der westlichen Domterrasse in Köln steht, wiederaufgebaut,
ein Seitenportal des ehemaligen Nordtores der römischen Stadtfast am antiken Platz. Der monumentale mittlere Bogen dieses
Tores, das erst 1826 als Verkehrshindernis abgebrochen wurde,
erhebt sich heute im benachbarten, großartigen Römisch-Germanischen Museum, dessen Besichtigung allein schon die Reise
nach Köln wert ist. Die Steine dieses Bogens tragen als Inschrift
die jedem Besucher auffallenden Buchstaben C CA A, - die
Abkürzung ftir Colonia Claudia Ara Agrippinensium, des römischen Namens der Stadt seit der Mitte des ersten Jahrhunderts
n. Chr.
Diese Inschrift stellt eine Art Kürzel ftir das erste Jahrhundertoder doch nicht viel weniger - der Geschichte des römischen
Köln dar. Octavianus, der spätere Augustus, schickte im Jahre
39/38 v. Chr. seinen Mitarbeiter M. Vipsanius Agrippa mit dem
Auftrag der Neuordnung der gallischen Provinzen und damit
auch der politisch-militärischen Situation am Rhein in die von
Cäsar eroberte Gallia Transalpina. Agrippa siedelte die germanischen Ubier, die bisher auf dem rechten Rheinufer sich zu halten
versucht hatten, auf das linke Rheinufer in das Gebiet um das
heutige Köln um. Vorort des Stammes wurde ein fester Platz, das
Oppidum Ubiorum. Als kultischen Mittelpunkt erhielt der Ort einen Altar des Augustus, die Ara Ubiorum. Von dem Doppellegionslager, das Augustus an dieser Stelle errichten ließ, war im
vorhergehenden Abschnitt die Rede. Dieses Lager nahm die
ruhmreiche alte Legio XX Valeria Victrix und die neuaufgestellte
Legio I Adiutrix (auch: Germanica) auf.
Die römische Neugründung am Rhein sollte unter der julischclaudischen Dynastie noch wiederholt eine Rolle spielen. Hier
hatte Germanicus, ein Sohn des Drusus und der Antonia Minordie beiden sind als junges Paar auf der Ara Pacis in Rom porträtgetreu dargestellt- , seinen Sitz, als er 13 n. Chr. den nachherigen
Kaiser Tiberius als Oberkommandierender der beiden Rheinarmeen abgelöst hatte. Hier wurde im Jahre 15 n. Chr. seine
Tochter Julia Agrippina, die später die Mutter des Kaisers Nero
und die vierte Gemahlin des Kaisers Claudius (41-54) wurde, geboren. Hier brach im Jahre 14 n. Chr. jene gefährliche Meuterei
der Legionen aus, die den Tiberius als Nachfolger des Augustus
ablehnten und Germanicus als Kaiser sehen wollten; die Rebel-
39
Drusus und seine Gemahlin Antonia mit ihrem kleinen Sohn, dem späteren Feldherrn Germanicus. Darstellung auf der Ara Pacis Augustae, Rom.
lion konnte nur unter großen Schwierigkeiten und mit viel diplomatischem Geschick beendet werden.
Als Germanicus im Jahre 17 n. Chr. von Kaiser Tiberius aus Germanien ab berufen wurde und mit einem politischen Auftrag des
Herrschers nach dem Osten des Reiches ging, ließ Tiberius das
Kölner Doppellegionslager auflösen: die Legio I Adiutrix (Germanica) wurde nach Bonn (Bonna), die Legio XX Valeria Victrix
nach Neuß (Novaesium) verlegt. Köln aber blieb Sitz des
Statthalters von Niedergermanien (Germania Inferior). Die
standortmäßige Trennung der beiden bisher in Köln stationierten
40
Servius Sulpicius Galba.
Legionen war von Tiberius wohl bedacht als logische Konzequenz aus den Erfahrungen der bedrohlichen Meuterei des Jahres 14 n. Chr.
Julia Agrippina, die in Köln geborene Tochter des Germanicus,
heiratete im Jahre 49 n. Chr. Kaiser Claudius (41-54), ihren eigenen Oheim. Sie war in erster Ehe mit L. Domitius Ahenobarbus
verheiratet gewesen und hatte diesem einen Sohn, den späteren
KaiserN ero, geboren. Von brennendem Ehrgeiz erftillt, verfolgte
sie ohne Skrupel die Absicht, ihren eigenen Sohn zur Herrschaft
zu fUhren. In ihrerneuen Machtstellung vergaß sie aber auch ihre
Geburtsstadt nicht, indem sie deren Erhebung zur römischen
Bürgerkolonie mit der Bezeichnung Colonia Claudia Ara Agrippinensium erwirkte. Tacitus, der große Historiker, sieht in diesem
Akt vor allem eine Demonstration des Machtwillens der Kaiserin. Er berichtet: "Um ihren Einfluß auch bei den verbündeten
Völkerschaften zu manifestieren, setzte sie es durch, daß römische Veteranen nach dem Oppidum der Ubier entsandt und eine
Kolonie dort eingerichtet wurde, die ihren eigenen Namen
erhielt."
Die julisch-claudische Dynastie, die sich schon zuvor mit mancherlei Greueln befleckt und mit Caius (Caligula), einem Sohn
des Germanicus, dem Reich einen unzurechnungsfähigen Herrscher zugemutet hatte (36-41), fand ein schmachvolles Ende mit
Nero (54-68), dem Mörder seines Stiefbruders Britannicus, seiner Mutter und seiner Gattin. N ero hielt sich ftir einen bedeutenden Kitharöden und begnadeten Sänger; als solcher auch öffentlich aufzutreten, hielt er durchaus für vereinbar mit seinem Herr41
scheramt. Als er sich im Jahre 67 n. Chr. auf eine Tournee nach
Griechenland begab, beklatschten seine Schmeichler und Zechkumpane die groteske Erniedrigung der Kaiserwürde.
Der Ruf zur Empörung gegen eine schändliche Regierung erhob
sich zuerst im Westen: C. Iulius Vindex, ein vornehmer Gallier
aus altem aquitanischem Königsgeschlecht, proklamierte den
Aufstand gegen den unwürdigen Kaiser. Servius Sulpicius Galba
und M. Salvius Otho, die römischen Statthalter in Spanien,
schlossen sich ihm an. Die Legionen im Osten des Reiches nahmen eine abwartende Haltung ein; dort warT. Flavius Vespasianus mit der Niederwerfung desjüdischen Aufstandes beschäftigt,
mit der ihn Nero im Jahre 67 betraut hatte. Eine erste Entscheidung führten die rheinischen Legionen herbei: sie betrachteten
N ero als ihren legitimen Herrn und wollten ihm treu bleiben. Ihre
kriegs-und kampferprobten Berufssoldaten bereiteten unter der
Führung des L. Verginius Rufus, des Statthalters von Obergermanien, um die Mittsommerzeit des Jahres 68 n. Chr. in einer
blutigen Schlacht bei Vesontio (Besanyon) den ungeübten Scharen des Vindex eine vernichtende Niederlage. Vindex wollte die
zwanzigtausend Toten seines etwa einhunderttausend Mann
starken Heeres nicht überleben und beging Selbstmord.
Nero hatte die Nachricht vom Aufstand des Vindex im Frühjahr
68 erhalten, als er, von seiner griechischen Gastspielreise zurückkehrend, in Neapel eintraf. Wie es scheint, hat er die Größe der
ihm drohenden Gefahr erkannt, denn er eilte sofort nach Rom.
Die Nachricht von der Niederlage und dem Tod des Vindex hätte
für den Kaiser die Rettung bedeuten können. Sein Prätorianerpräfekt C. Nymphidius Sabinus hatte anderes im Sinn. Er redete
der Prätorianergarde ein, Neros Sache sei verloren, und bewog
sie, Galba als Kaiser anzuerkennen. Nero sah keinen anderen
Ausweg als die Flucht in den Selbstmord; zwei Freigelassene halfen ihm dabei. Nun war nur noch ein Kaiser da: Galba. Freilich
nur für etwa ein halbes Jahr. Dann machte sich Galba seinen bisherigen Verbündeten und Mitstreiter Otho dadurch zum Todfeind, daß er einen anderen zum Nachfolger ausersah. Otho hatte
gute Beziehungen zu den Prätorianern. Es gelang ihm, sie dazu zu
bewegen, Galba umzubringen und ihn selbst zum Kaiser auszurufen. Dies geschah am 15. Januar des Jahres 69 n. Chr.
Galba hatte zu Beginn seiner kurzen Regierungszeit eine Maßnahme getroffen, die sich in ihren Folgen als höchst verhängnisvoll und katastrophal herausstellen sollte. Im Dezember 68
n. Chr. entsandte er einen Mann, den man bisher zu den Trabanten Neros zu rechnen gewohnt war, als Statthalter und Oberbefehlshaber der sieben damals am Rhein stehenden Legionen
42
Aulus Vitellius.
nach Germanien mit dem Amtssitz in Köln. Diese Ernennung
erwies sich in kürzester Frist als krasser Mißgriff. Wie sich das
herausstellte, wird nachher zu schildern sein. Zuvor aber ist die
Frage zu beantworten, was für ein Mann das war, den Galba für
ein so bedeutendes Amt ausersehen hatte.
Zeitgenössische Quellen im eigentlichen Sinne fehlen. Die ausführlichsten biographischen Nachrichten über Vitellius fmden
sich bei dem Schriftsteller C. Suetonius Tranquillus; er wurde um
das Jahr 70 n. Chr. geboren, seine Lebenszeit steht also der des
Vitellius noch relativ nah. Von Sueton besitzen wir die Biographien der vierzehn römischen Herrscher von C. Iulius Caesar,
dem Diktator, bis Domitian (81-96), den letzten Kaiser aus dem
Haus der Flavier. Aus Sueton kennen wir auch das Motiv, das
Galba bewog, gerade Aulus Vitellius nach Untergermanien zu
schicken: Servius Sulpicius Galba, der selbst aus einer alten, vornehmen römischen Adelsfamilie stammte, hatte von Aulus Vitellius, der als Schmarotzer und Schlemmer im Kreis Neros bekannt
war, eine sehr geringe persönliche Meinung, offenbar mit Recht,
denn auch Tacitus nennt den Vitellius einen niedrigen Charakter.
Als Galba diesen Menschen als Statthalter nach Köln schickte,
war man in der Umgebung des Kaisers über die Wahl erstaunt:
Galba aber soll erklärt haben, niemand sei weniger zu fürchten
als Leute, die nur an die Freuden der Tafel denken; Vitellius könne die Reichtümer seiner Provinz dazu benützen, seinen unersättlichen Bauch zu füllen. Aus dieser Äußerung zieht Sueton
den Schluß, Galba habe den Vittelius mehr aus Verachtung als
aus Huld für das Statthalteramt ausersehen. Aufjeden Fall sah er
43
in Vitellius keinen potentiellen Rivalen. Gerade in diesem Punkt
jedoch sollte er sich gründlich getäuscht haben.
Wie eine übel erfundene Groteske liest sich - Sueton soll auch
Klatsch nicht verachtet haben- die Schilderung der Schwierigkeiten, die Vitellius hatte, um überhaupt Rom verlassen und nach
Köln reisen zu können. Er soll sein Vermögen so heruntergewirtschaftet haben, daß er nicht einmal genug Geld hatte, um standesgemäß nach seinem künftigen Amtssitz zu gelangen. Um die
erforderliche Summe zusammenzukratzen, scheute er - immer
nach Sueton - nicht vor der äußersten Würdelosigkeit zurück: er
ließ seine Familie in eine Mietwohnung übersiedeln, um das
Haus auf dem Aventin, das seine zweite Frau, Galeria Fundana,
mit in die Ehe gebracht hatte, vermieten zu können, ja, er soll sogar seiner eigenen Mutter einen wertvollen Ohrring weggenommen haben, um ihn ins Pfandhaus zu tragen. Da er zudem noch
hoch verschuldet war, mußte er die seltsamsten Listen und Tükken ersinnen, um seinen Gläubigem, die ihn nicht vor der Begleichung seiner Verbindlichkeiten aus der Hauptstadt abreisen lassen wollten, zu entwischen.
Wie dieser seltsame Kandidat flir ein hochwichtiges Amt ausgesehen hat, läßt uns wiederum Sueton wissen: Vitellius sei überdurchschnittlich groß gewesen, berichtet der Autor, habe das gerötete Gesicht des regelmäßigen Weintrinkers und einen ansehnlichen Bauch gehabt; beim Gehen habe er das eine Bein etwas
nachgezogen, wohl als Folge eines Unfalls, den er vor Jahren als
Kumpan des Caligula beim Wagenrennen erlitten hatte. Die
Schilderung der Physiognomie wird durch Skulpturen und
Münzbilder bestätigt. Ein Porträtkopf des Vitellius steht in den
Kapitolinischen Sammlungen in Rom. Dieser Kopf stellt nach
Erika Simon, der Würzburger Ordinaria flir Klassische Archäologie, "einen feisten älteren Mann von gewöhnlichem Aussehen
dar. Sein Porträt ist naturalistisch aufgefaßt, die schlaffe Haut, die
Fettpolster des Halses, die kleinen Augen sind unangenehm getreu wiedergegeben." Diese Beschreibung wird durch die Münzbilder bestätigt: Der Eindruck des Gewöhnlichen wird dort durch
die Mundpartie mit den wulstigen Lippen noch unterstrichen.
Man versteht danach besser, daß Galba von diesem Manne
nichts beflirchten zu müssen glaubte, daß er ihn flir völlig ungefahrlich hielt. Dabei übersah Galba freilich, daß er selbst bei den
rheinischen Legionen in Mainz, Bann und Neuß keinerlei Sympathien genoß; vielleicht wußte er das auch nicht. Unter anderem
verziehen ihm die Soldaten nicht, daß er ihnen das Geldgeschenk
verweigert hatte, das ein Herrscher beim Regierungsantritt zu geben pflegte. Aber das war wohl nur der äußere Anlaß zu den auf-
44
kommenden Kundgebungen der Unzufriedenheit und des Mißfallens; den rheinischen Legionen ging es kaum noch um die Person des in Rom amtierenden Kaisers; sie wollten einen Machtwechsel, der ihren eigenen Interessen entsprach, die Erhebung
eines Kaisers ihrer eigenen Wahl, eines Mannes vor allem, von
dem sie sich einen erfolgreichen Zug über die Alpen mit rücksichtsloser Plünderung des Reichslandes, reiche Belohnungen,
lohnende Posten und alle möglichen anderen Vorteile versprachen.
In diese Situation hinein machte sich Vitellius auf die Reise nach
Köln. Mit einer Schläue und Geschicklichkeit, die ihm weder
Galba noch sonst jemand in Rom zugetraut hätte, verstand er es
schon unterwegs, sich durch betont joviales Auftreten bei den
einfachen Leuten und vor allem bei den Soldaten beliebt zu machen. Wenn wir noch einmal Sueton folgen dürfen, so "umarmte
er auf der Reise sogar gemeine Soldaten, die ihm begegneten,
zeigte sich in den Ställen und Herbergen gegen Eselstreiber und
Reisende höchst leutselig, fragte jeden Morgen jedermann, ob er
schon gefrühstückt habe, und tat durch Rülpsen kund, daß dies
bei ihm schon der Fall sei." Die Soldaten suchte er für sich zu gewinnen, indem er verhängte Ehrenstrafen annullierte und Verurteilten ihre Strafen erließ. Das war der Vorgesetzte, den die Soldaten sich wünschten. Aus dieser Stimmung heraus sollten sich mit
bestürzender Geschwindigkeit Ereignisse entwickeln, mit denen
kaum Vitellius selbst gerechnet hatte.
Wie in jedem Jahr war zum 1. Januar 69 n. Chr. die Erneuerung
des Eides der Legionen auf den Kaiser fällig. Im ersten Buch seiner Historien gibt Tacitus, der größte Geschichtsschreiber der
Epoche, eine äußerst farbige, für die Psychologie der Massen aufschlußreiche Darstellung der Vorgänge, die sich im Zusammenhang mit der geforderten Eidesleistung abspielten. Sein Bericht
sei hier nur knapp zusammengefaßt: Nach anfänglicher Unschlüssigkeit erhitzen sich in der versammelten Truppe die Gemüter, die aufsässigsten Elemente führen einen Tumult herbei,
schließlich fliegen Steine gegen die Bildnisse Galbas, sein Bild
wird von den Fahnen gerissen, die Meuterei ist da. Generäle und
Offiziere bleiben untätig, in Mainz sieht der Oberstkommandierende Hordeonius Flaccus dem Aufruhr machtlos und untätig zu.
Vier mutige Tribunen der Legio XXII Primigenia in Mainz werfen sich den Wütenden entgegen, um die Kaiserbilder zu schützen; sie werden von der tobenden Masse fortgerissen und in Fesseln gelegt. "Keiner dachte mehr an die geschuldete Treue und
den einmal geleisteten Eid." Um nicht in die Lage erklärter
Staatsfeinde zu geraten und der Ächtung zu verfallen, einigen
45
sich die Wortführer auf den untauglichen Ausweg, den Eid statt
auf den Kaiser auf die längst verloschenen Namen des römischen
Senates und Volkes zu leisten.
Die klarsichtigeren Führer des Aufstandes erkannten die Sinnlosigkeit und Nichtigkeit eines derart obsoleten Eides. Man brauchte einen Prätendenten, der sich an die Spitze der Bewegung stellen und mit den rheinischen Legionen gegen Galba ziehen würde. Es ist uns nicht überliefert, wer den Namen des Vitellius
zuerst genannt hat. Sicher wissen wir aber, daß noch an dem nämlichen 1. Januar 69 der Adlerträger der Vierten Legion sich aufs
Pferd warf, um nach Köln zu reiten. Nach einem Gewaltritt von
180 Kilometern traf er in der Nacht zum 2. Januar 69 dort ein und
begab sich sogleich ins Praetorium, den Amtssitz des Vitellius,
um diesem die Nachricht vom Abfall der Mainzer Legionen von
Galba und von ihrer Absicht, ihn selbst zum Kaiser auszurufen,
zu überbringen. Tacitus berichtet, Vitellius sei noch bei der
Abendtafel gesessen, als der, von dem langen Ritt erschöpfte und
durch die Umstände erregte Abgesandte der Aufständischen zu
ihm geführt wurde. Der Wirklichkeit kommt vielleicht die Schilderung des Sueton näher: Demnach war es schon ziemlich spät
am Abend oder schon in der Nacht, als der Bote Köln erreichte,
Vitellius hatte sich bereits zurückgezogen, um sich in seinem
Schlafzimmer zur Ruhe zu begeben; dort hätten ihn die Soldaten
ohne weitere Umstände aufgesucht, noch im Hausrock aus seinem Schlafraum geholt, ihn als Kaiser begrüßt, auf die Schultern
gehoben und als neuen Herrn des Reiches durch die Hauptstraßen der Stadt getragen. Um dem eher komischen als feierlichen Bild so etwas wie Würde zu verleihen, seien einige Soldaten,
vom Rausch des Ereignisses beflügelt, in den Marstempel der
Stadt geeilt, wo das reichverzierte Paradeschwert des Diktators
C. lulius Caesar wie eine kostbare Reliquie aufbewahrt wurde;
sie nahmen die ehrwürdige Waffe und überreichten sie unter
glückverheißenden, begeisterten Zurufen dem selbstgewählten
neuen Herrn des Reiches als Sinnbild seines Anspruchs auf die
Kaiserwürde. Dem improvisierten Huldigungszug durch die
nächtlichen Straßen machte eine Brandkatastrophe einEnde: Im
Quartier des soeben zum Kaiser ausgerufenen Vitellius war das
Speisezimmer in Brand geraten, die lodernden Flammen veranlaBten den Herrn des Hauses, eilends dorthin zurückzukehren
und für das Löschen des Brandes zu sorgen. Die Soldaten- abergläubisch, wie sie nahezu ausnahmslos waren - sahen in dem
Zwischenfall ein böses Omen und zeigten sich bestürzt. Nicht so
Vitellius; der Schlemmer bewahrte in diesem kritischen Augenblick die Geistesgegenwart und beruhigte die Erschreckten,
46
indem er ihnen zurief, so sollten die Fassung bewahren, das
Feuer habe ihnen allen nur geleuchtet. Er behielt die Übersicht in
der Gewißheit, daß es jetzt nur noch die Flucht nach vorwärts
gab, daß Zögern oder gar Zurückweichen den sicheren Untergang bedeutet hätte. Vor allem aber mußte er sich nun der Zustimmung und Ergebenheit nicht nur der Legionen, sondern
auch der benachbarten Völkerschaften und ihrer Städte versichern; noch in derselben Nacht schickte er Boten an die sieben
rheinischen Legionen und ihre Kommandeure mit der Aufforderung, sich ihm anzuschließen.
Das nächstgelegene Winterlager, so berichtet Tacitus, war das der
Ersten Legion in Bonn; ihr Befehlshaber, der Legat Fabius
Valens, war nach demUrteil des Historikers der energischste und
entschlossenste unter den Offizieren seines Ranges. Sein Vorgehen wurde zum Signal flir die Entscheidung der anderen rheinischen Legionen: Fabius Valens zog am folgenden Tag, dem 3. Januar 69, mit der Reiterei seiner Legion und ihrer Hilfstruppen in
Köln ein und proklamierte Aulus Vitellius feierlich zum Kaiser.
Nun gab es kein Halten mehr; als gelte es ein Wettrennen um den
Ruhm des Kaisermachers, beeilten sich sämtliche am Rhein stehenden Truppen - sie stellten die stärkste und schlagkräftigste
Armee des Reiches dar -, sich Vitellius anzuschließen und den
Eid auf ihn zu leisten. Die Begeisterung der Truppen ergriff auch
die Stämme und Städte der Region, unter ihnen vor allem natürlich die Einwohner von Köln und Trier; sie boten Vitellius flir seinen Zug nach Italien und Rom alle nur erdenklichen Hilfen an:
Waffen, Pferde, Hilfstruppen und auch Geld, ohne das man bekanntlich keine Kriege führen kann. Der Eifer scheint so groß gewesen zu sein, wenn man wiederum Tacitus folgt, daß in den Legionen die Manipel, jene bekannten, aus jeweils zwei Centurien
bestehenden taktischen Einheiten, geschlossen ihr Bargeld, ihre
Brust- und Wehrgehänge und ihre silberverzierten Waffen für
den Feldzug des neuen Kaisers zur Verfügung stellten; dasselbe
taten zahlreiche einfache Soldaten.
Anders als Galba verstand es Vitellius, sich bei der Truppe beliebt
zu machen. Er sprach den Legionen seine Anerkennung und seinen Dank aus flir ihr Vertrauen und ihre Bereitschaft, ihm zu folgen. Besondere Zustimmung fand eine seiner ersten Maßnahmen, mit der er eine Reihe von Hofämtern, die bisher mit Freigelassenen besetzt wurden, römischen Rittern übertrug; das bedeutete flir eine Anzahl ergeiziger Männer und ihren Anhang den
Zugang zu einflußreichen und auch einträglichen Posten. Den
Centurianen (Hauptleuten) ließ er aus Mitteln des Fiscus die ausstehenden Urlaubsgelder ausbezahlen. Wie sehr Vitellius die
47
Kreatur einer aufsässigen Soldateska war, bewies er durch seine
Nachgiebigkeit gegenüber der Forderung der Legionen, ihnen
Offiziere und Beamte, die unter seinem Vorgänger ihre Wut
erregt hatten, zur Bestrafung preiszugeben. Nur mit taktischen
Manövern unternahm er es, völlig Unschuldige, Korrekte und
Unbescholtene der ungerechten, gesetzwidrigen Verfolgung
durch eine Willkürjustiz zu entziehen. Daß er den Titel Augustus,
den man ihm in Köln anbot, nicht annehmen wollte und auch die
Bezeichnung Cäsar ein ftir allemal ablehnte, stellte nichts weiter
als Popularitätsbascberei dar, wie sie der Zeit keineswegs fremd
war.
Wahrend Vitellius mit der Einrichtung in seinem neuen Herrscheramt und mit der Vorbereitung seines Feldzugs beschäftigt
war, wurde Galba umgebracht, Otbo ließ sieb zu seinem Nachfolger ausrufen. Da die Abneigung der rheinischen Legionen sieb in
erster Linie gegen die PersonGalbas gerichtet hatte, war mit seiner Ermordung auch das Motiv eines Krieges gegen ihn entfallen;
dem Reich hätte ein Bürgerkrieg erspart werden können. Doch
durch die Kölner Kaiserproklamation hatte das Imperium in
Otbo und Vitellius wiederum zwei Kaiser; zwischen ihnen mußte
ein Waffengang entscheiden. Seine ausführliebe Schilderung gehört nicht mehr hierher. Die Entscheidung fiel am 14. April69 in
der Nähe von Cremona. Das Heer des Vitellius schlug die Truppen des Otbo, der zwei Tage nach der Niederlage Selbstmord beging. Vitellius war Alleinherrscher. Seinen niedrigen Charakter
offenbarte er in der widerwärtigsten Weise bei der Besichtigung
48
des Schauplatzes der Entscheidungsschlacht Als seine Begleiter
vor dem Gestank der unbestatteten, bereits verwesenden Leichen zurückschauderten, sagte er, ein erschlagener Feind rieche
gut, ein erschlagener Römer noch viel besser.
Im Juli 69 zog Vitellius als Triumphator in Rom ein, unter Trompetengeschrnetter, wie Sueton berichtet, bekleidet mit dem paludamentum, dem Feldhermmantel, mit dem Schwert gegürtet,
umgeben von Soldaten mit der blanken Waffe in der Hand. Mit
dem Triumph über Mitbürger verhöhnte der neue Kaiser die
Würde des Imperium Roman um; doch das kümmerte ihn nicht.
Unter seinen Taten als Kaiser, die sich im wesentlichen unter den
Stichwörtern Schlemmerei und Grausamkeit, Verschwendung
und Rechtsbruch, zusammenfassen lassen, kann eine vielleicht
doch auffallen: Durch ein Edikt ordnete er an, daß bis zum 1. Oktober 69 sämtliche Astrologen nicht nur Rom, sondern ganz Italien zu verlassen hätten. Zu seiner größten Erbitterung erschien
in den Straßen der Hauptstadt umgehend das, was wir heute als
Wandzeitung oder Wandparole bezeichnen würden; sie besagte,
die von dem Edikt Betroffenen gäben hiermit bekannt, daß Vitellius bis zu jenem Datum (1. Oktober 69) nirgends mehr sein werde. Vitellius verstand keinen Spaß, er antwortete mit brutaler Gewalt. "Auf die bloße Anzeige hin", erklärt Sueton, "ließ er alle diese Leute mit dem Tod bestrafen."
Hinsichtlich des Datums ftir das Verschwinden des Kaisers sollten die Astrologen mit ihrer Parole nicht ganz recht behalten; sie
verfehlten es jedoch nur um wenige Wochen. Kaiser Vielfraß, wie
ein Journalist unserer Tage den Vitellius bezeichnet hat, wurde
am 20. Dezember 69 nach der Einnahme der Hauptstadt durch
die Truppen seines Nachfolgers Vespasian vom Straßenpöbel zu
Tode gemartert, seine Leiche in den Tiber geworfen. DasJahr der
vier Kaiser, ein Jahr voll Blut und Greueln, war zu Ende; flir das
nächste Vierteljahrhundert stellte eine neue Dynastie, die der
Flavier, die Herren des Imperium Romanum.
Vespasian.
49
Bertold K. Weis
Flavius Claudius IulianusEin Kampf um den Oberrhein
Im Sommersemester des Jahres 355 sah man in den Hörsälen der
angesehensten Professoren der Athener Hochschule einen
dreiundzwanzigjährigen Prinzen aus dem Hause Konstantins des
Großen, einen Studenten unter Studenten, einen Bildungshunrigen, Wissensdurstigen unter anderen Bildungsbeflissenen, die
sich später in der Welt des Geistes einen Namen machen sollten.
Der ftirstliche Student war gegen Ende des Jahres 331 in Konstantinopel geboren worden, alsjüngster Sohn des Iulius Constantius,
eines Stiefbruders Konstantins, und der Basilina, einer gebildeten Frau aus vornehmer Beamtenfamilie. Die Mutter starb wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes, der Vater fiel nach Konstantins Tod (22. Mai 337) jener Mordnacht (Anfang 338) zum
Opfer, die allem Anschein nach von dem Kaisersohn Constantius
angestiftet worden war: Außer den drei von den Militärs als
Thronfolger anerkannten Söhnen Konstantins wurden alle
männlichen Verwandten des großen Herrschers umgebracht.
Der sechsjährige Iulianus entging nur deshalb dem Blutbad, weil
ihm, dem sechsjährigen Bübchen, niemand irgendwelche Beachtung schenkte. Seine Jugend verlebte er von da an in einer wohl
komfortablen, nichtsdestoweniger aber mißtrauisch überwachten Ehrenhaft außerhalb der Hauptstadt; dabei wurde ihm allerdings die Möglichkeit geboten, sich eine ebenso standesgemäße
wie umfassende Bildung zu erwerben. Verwehrt wurde ihmjeder
Auftritt undjede Ausbildung auf der politischen und der genauso
wichtigen militärischen Bühne der Zeit. Doch in dem Jüngling
steckte der angeborene Trieb, etwas Bedeutendes zu leisten,
etwas Großes in der Welt zu werden. Da ihm der Zugang zu politischem Wirken und zu soldatischer Bewährung versperrt blieb,
reifte in seinem Bewußtsein die Vorstellung, daß er zum bedeutenden Literaten und Hochschullehrer berufen sei. Unter diesen
Umständen geriet ihm seine Studienzeit in Athen mit den unvergleichlichen Denkmälern der großen Vergangenheit, mit den
Vorlesungen seiner immer noch berühmten Hochschule, mit den
unübersehbaren Bücherschätzen seiner öffentlichen, jedermann
zugänglichen Bibliotheken zu einem geistigen Rausch, der ihm
noch später diese Zeit zur glücklichsten seines Lebens verklärte.
Als Vetter des regierenden Kaisers Constantius II. (337-361) genoß der studierende Prinz, der ja auch in der Erbfolge angesichts
der bisherigen Kinderlosigkeit des Kaiserpaares durchaus noch
50
eine Rolle spielen konnte, verständlicherweise ein mehr als
alltägliches gesellschaftliches Interesse. Daß er sich zum erstenmal in seinem Leben so frei und ungezwungen bewegen durfte,
verdankte er der Gattin seines Vetters Constanius, der ebenso
schönen wie geistreichen und hochgebildeten Kaiserin Eusebia;
sie war am kaiserlichen Hof wohl der einzige Mensch, der dem
Prinzen ungeheucheltes Wohlwollen entgegenbrachte und den
Kaiser dazu bewogen hatte, die Erlaubnis zu Iulians Studienaufenthalt in Athen zu erteilen.
Über die äußere Erscheinung Iulians sind wir durch eine Beschreibung unterrichtet, die ein Zeitgenosse und Verehrer seiner
Person und seiner Leistung, der lateinisch schreibende Grieche
Ammianus Marcellinus aus Antiochia, der bedeutendste Historiker der Zeit, nach dem Tod seines Helden, gewissermaßen als
Epitaphios, als Leichenrede, verfaßt hat. Darin heißt es: "Er war
von mittelgroßer Statur, hatte weich fließendes, wie frisiertes
Haar und trug einen struppigen, unten in einer Spitze endenden
Bart. Die schönen, lebhaften, funkelnden Augen offenbarten eine scharfe Intelligenz. Die Augenbrauen waren elegant geschwungen, die Nase war sehr gerade, der Mund ein wenig zu
groß; die Unterlippe hing etwas herab, der Nacken war stark, dabei leicht gebogen, die Schultern waren kräftig und breit. Vom
Scheitel bis zu den Zehenspitzen war sein Körperbau harmonisch; daher besaß er bedeutende Körperkräfte und zeichnete
sich auch als guter Läufer aus."
Über Iulians Charakter und geistige Leistung äußert sich derselbe Ammianus mit Ausführungen, von denen er selbst meinte, sie
seien ihm fast zu einer Lobrede geraten: "Ein höheres Lebensgesetz scheint diesenjungen Mann von seiner vornehmen Wiege an
bis zu seinem letzten Atemzug geleitet zu haben. Denn in rasch
wachsender Größe glänzte er in Krieg und Frieden derart, daß er
wegen seiner Klugheit als ein zweiter Titus, Vespasians Sohn,
galt, daß er durch glorreiche Feldzüge einem Trajan ebenbürtig,
daß er gnädig wie Antoninus Pius war, daß er durch sein Aufspüren des korrekten, vollkommenen Wissens einem Mare Aurel
gleichkam, nach dessen Vorbild er sein Handeln und seinen Charakter zu formen strebte. Ciceros Autorität lehrt uns, daß alles
großen Wissens und Könnens Höhe uns beeindruckt wie die der
Bäume, nicht in gleichem Maße jedoch ihre Wurzeln und Stämme. So wurden auch die ersten Äußerungen dieser glänzenden
Begabung damals von vielen abschätzigen Kritikern mit Nebelschwaden verschleiert; und doch wäre sie seinen vielen späteren
erstaunlichen Leistungen schon deshalb vorzuziehen gewesen,
weil er als Jüngling, in frühen Jugendjahren, wie Erechtheus in
51
der Abgeschiedenheit der Minerva erzogen, aus dem stillen
Schatten des Akademiehaines, nicht aus einnem Soldatenzelt, in
den Staub der Schlachtfelder fortgerissen wurde, Germanien niederwarf, die Stromauen des eisigen Rheines befriedete und hier
das Blut mordlustiger Könige vergoß, dort ihre Hände in Ketten
legte."
Wie ein schönes, blitzendes Kristallglas zersprang die Euphorie
der Athener Studienzeit im Herbst desselben Jahres (355): Iulian
erhielt von seinem kaiserlichen Vetter den Befehl, Athen unverzüglich zu verlassen und sich am kaiserlichen Hof in Mailand einzufinden. Den Anlaß der Rückberufung darzulegen, hielt der Kaiser nicht für erforderlich. Ihn erfuhr der Prinz erst in Mailand vom
Kaiser persönlich. Was den mißtrauischen Herrscher, der sich
während seiner bisherigen Regierungszeit mit mehreren U surpatoren, Gegenkaisern, auseinanderzusetzen gehabt hatte, veranlaßte, einen Mitinhaber der Macht als Cäsar, d. h. dem Kaiser untergeordneten Mitherrscher, zu berufen, waren zwingende politische und militärische Gründe. Wieder einmal waren die beiden
seit langem brennenden Grenzen des römischen Reiches im
Osten und Westen aufs höchste gef:ihrdet. Gerade jetzt hatten am
Rhein Alamannen, Franken und Sachsen mehr als vierzig befestigte Plätze überrannt, verwüstet, geplündert, die Einwohner in
die Sklaverei verschleppt. Das einstmals so blühende Gallien
wurde durch die ständigen Raubzüge germanischer Scharen ausgeraubt, verödet, entvölkert. Iulian schildert die dortige Situation
in einem wenig später abgefaßten Bericht: "Zahlreiche Germanen hatten sich bereits, absolut ungehindert, in der Umgebung
der von ihnen zerstörten befestigten Städte niedergelassen. Sie
hatten die Befestigungsanlagen von etwa 45 Städten zerstört. Die
uns zunächst gelegene feindliche Verteidigungsstellung lag bereits 54 Kilometer westlich des Rheins. Dreimal so tief war dazu
die Ödlandfläche, die sie zwischen sich und uns gelegt hatten. Die
Gallier hatten nicht einmal Weideland ftir ihre Herden. Selbst aus
Städten, die von der feindlichen Invasion verschont geblieben
waren, hatten sich die Einwohner aus Furcht abgesetzt."
Das waren die Gründe, die Kaiser Constantius keine andere Wahl
erkennen ließen, als seinen jugendlichen, noch nicht ganz vierundzwanzigjährigen, politisch und militärisch absolut unerfahrenen Vetter zum Cäsar zu ernennen und ihn als seinen Stellvertreter und Sachwalter, als Repräsentanten der kaiserlichen Autorität, nach dem verwüsteten Gallien zu schicken, um die germanischen Eindringlinge in ihre Schranken zu weisen und über den
Rhein zurückzutreiben. Es gab niemand, dem Iulian seine tiefe
Verzweiflung über dieses Himmelfahrtskommando offenbaren
52
konnte; er wußte, daß ihm alle Voraussetzungenn für einen derart
gefährlichen Auftrag fehlten. Doch die Würfel waren gefallen, der
Kaiser hatte entschieden, sein einmal ausgesprochener Wille ließ
Einwände nicht mehr zu. Am 6. November 355 veranstaltete Kaiser Constantius vor den Toren Mailands einen großen Appell der
dort stationierten Truppen. Vor dieser waffenstarrenden Heeresversammlung bekleidete er seinen jungen Vetter, den neuernannten Cäsar, mit dem kaiserlichen Purpur. Um Iulian auch
durch Familienbande an sich zu fesseln und sich damit seiner unbedingten Treue zu versichern, verheiratete er ihn gleichzeitig
mit seiner Schwester Helena, die einige Jahre älter als Iulian gewesen sein dürfte. Sie sollte den Cäsar auf seinem Zug in die ihm
nun unterstellten Provinzen Galliens, Britanniens und Spaniens
begleiten. Am 1. Dezember 35 5 verließ lulian Mailand mit der geradezu kläglichen Eskorte von 360 Soldaten. In seinem Reisegepäck führte er ein ihm selbst kostbares Geschenk mit, das ihm
Kaiserin Eusebia mit auf den Weg in den lateinischen Westen
mitgegeben hatte, eine Bibliothek griechischer Autoren, die ihn
in seinen Mußestunden über die jähe Trennung von Studium und
Hochschule trösten sollten.
Als Iulian auf seinem Weg nach Gallien in Turin eintraf, erhielt er
eine Nachricht, die ihm gespenstisch vor Augen führen mußte,
was ihnjenseits der Alpen erwartete: Das römische Köln, die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, die Hauptstadt der Provinz Germania Inferior und Residenz des Provinzstatthalters, war
von den Franken erst belagert, dann erstürmt und verwüstet worden.
Als Residenz war Iulian die Stadt Vienne zugewiesen worden.
Doch als er sich hier eingerichtet hatte und mit seinen Aufgaben
vertraut zu machen begann, stellte er sogleich mit Enttäuschung
und Erbitterung fest, daß er nur dem Namen nach Statthalter des
Kaisers in seinen Provinzen sei, dabei aber nichts zu sagen haben
sollte. In Wirklichkeit hatte der Kaiser ihm nur die Rolle einer Repräsentationsfigur vorbehalten; der junge Cäsar sollte nichts weiter zu verantworten haben, als bei den unvermeidlichen öffentlichen Anlässen dem Volk den kaiserlichen Purpur zu zeigen und
mit ihm an die ferne Autorität des Kaisers zu erinnern. Im übrigen hatte Constantius dafür gesorgt, daß es seinem Vetter nicht
einfallen konnte, sich in die Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte oder gar in die Fragen des militärischen Kommandos und die
Entscheidungen über militärische Operationen einzumischen.
Dafür waren die Oberbeamten und ein vom Kaiser selbst ernannter General zuständig; der letztere sollte sich sehr bald als bösartig, widersetzlich und zu allem Überfluß auch noch als unfähig er53
Römische Legionäre in der Schlacht. Mainz, Landesmuseum.
weisen. Alles war so eingerichtet worden, daß jeder neue Tag dem
jungen Cäsar neue Demütigungen bringen mußte.
Ein anderer hätte resigniert und sich mit dem äußeren Glanz seiner Stellung zufriedengegeben. Nicht so lulian. Ihn erfüllte jener
unwiderstehliche Tatendrang, der ftir eine echte Führernatur
charakteristisch ist. Er benützte die Wmtermonate in Vienne, um
sich einerseits mit allen Problemen der Verwaltung und vor allem
mit den Fragen des Wiederaufbaus der heruntergekommenneu
Provinzen vertraut zu machen, andererseits sich die genaueste
54
Kenntnis aller Details des praktischen Dienstes mit der Waffe zu
verschaffen. Kein anderes Bild hätte die erstaunliche innere und
äußere Verwandlung des bisherigen Stubenhockers, Bibliotheksbesuchers, Bücherwurms und Zitatensammlers krasser veranschaulichen können als die Erscheinung des Purpurträgers auf
dem Exerzierplatz, auf dem er nicht nur den Paradeschritt einübte, sondern sich überhaupt den einfachsten und härtesten Übungen eines Rekruten unterwarf. Es war ihm durchaus bewußt, wozu er sich da selbst nötigte, denn auf dem Kasernenhof gedachte
er seufzend seiner geliebten Platon-Studien und rief, auf ein altes
Sprichwort anspielend, in ihm habe man einen Ochsen zum
Reitpferd gemacht.
Doch alles, was er ftirs erste tat, um sich das Rüstzeug ftir ein Wirken nach seinen Vorstellungen anzueignen, mußte so lange
Theorie bleiben, als ihm verwehrt blieb, sich so oder so die Kompetenz zu selbstverantwortlichem Handeln zu erstreiten. Davon
jedoch konnte vorerst gar keine Rede sein. Was ihm zuteil wurde,
war wiederum nur eine äußere Auszeichnung ohne praktische
Folgen: Der Kaiser beehrte den jungen Cäsar damit, daß er ihn
am 1. Januar 356 als Amtskollegen mit ihm zusammen, die von
vielen noch immer sehr begehrte Würde des Konsulats übernehmen ließ. Für Iulian bedeutete dies nichts weiter, als daß alle Gesetze und Edikte des folgendenJahresneben derUnterschriftdes
Kaisers auch die seines Cäsars trugen. Ein Karrierebeamter wäre
von der Auszeichnung entzückt gewesen. Daß solcher äußere
Glanz ftir ihn zugleich auch äußerste Ohnmacht bedeutete, sollte
Iulian bald erfahren.
Als das Frühjahr 356 und damit der Zeipunkt ftir den Beginn der
militärischen Aktivitäten gekommen war, machten sich die Alamannen, wie in den vorhergehenden Jahren gewohnt, zu einem
neuen Raubzug in die benachbarten GebieteGalliens aufund gelangten, ohne ernstlichen Widerstand zu finden, bis ins Morvan,
an den Nordwestrand der heutigen Bourgogne. Iulians spontanes,jugendlich ungeduldiges Temperament hätte zum sofortigen
Eingreifen gedrängt, doch ihm fehlte das militärische Kommando. Der General, den der Kaiser mit dem Truppenkommando betraut hatte, dachte nicht einmal daran, den Cäsar, der nach wie
vor in Vienne saß, über seine strategischen Absichten zu unterrichten. Genauso erging es diesem, als er kurz darauf die
Nachriebt erhielt, daß die Alamannen bei einem überraschenden
Überfall um ein Haar das wichtige, befestigte Augustodunum
(Autun) erstürmt hätten; nur das Eingreifen der im Umland der
Stadt angesiedelten Legionsveteranen hatte im letzten Augenblick den Fall der Stadt verhindert.
55
Kaiser Iulianus
Apostata. Paris, Louvre.
Erst viel später, um die Zeit der Sommersonnenwende, wurde lulian vom Kaiser selbst angewiesen, sich nach Remi (Reims) zur
Truppe zu begeben. Was er dort sollte, wurde ihm nicht mitgeteilt. Bereitsam 24. Juli war er mit seinem Begleitkommando, das
im wesentlichen aus seiner Leibwache bestand, in Au tun eingetroffen. Ohne sich um die Warnungen übervorsichtiger Offiziere
zu kümmern, gelangte er auf einem ungesicherten Abkürzungsweg nach Autessiodurum (Auxerre), zersprengte unterwegs marodierende Alamannenschwärme und nahm einzelne verstreute
Trupps von ihnen gefangen. Über Tricasini (Troyes) erreichte er
in Eilmärschen Reims. Erst hier wurde er über den Operations-
56
plan, an dem der Kaiser diesmal persönlich mitwirken wollte, unterrichtet. In einer Art Zangenbewegung, wie sie Jahrhunderte
zuvor, allerdings in weit umfassenderem Maßstab, schon Drusus
und Tiberius im rechtsrheinischen Germanien unternommen
hatten, sollte einerseits eine von Kaiser Constantius selbst befehligte Armee zwischen dem Bodensee und Basel den Rhein überschreiten und von Süden her gegen das Siedlungsgebiet der Alamannen im Schwarzwald vorgehen, andererseits erhielt die von
dem General Marcellus kommandierte Heeresgruppe, zu der Iulian in Reims gestoßen war, die Weisung, auf der elsässischen Seite stromabwärts zu operieren, die Kontrolle über das linke Rheinufer wiederherzustellen und die Alamannen an einem erneuten
Vorstoß über den Strom hinweg in gallisches Gebiet zu hindern.
Im Verlauf dieser Operationen am Oberrhein erfuhr Iulian, daß
Straßburg, Brumath, Zabern, Selz, Speyer, Worms und selbst das
starke Mainz in die Hände der Alamannen gefallen waren. In den
Städten selbst hielten sie sich jedoch nicht auf, da sie diese befestigten Plätze "wie mit Netzen umstrickte Gräber" scheuten;
dasUmlandder Städte aber hielten sie besetzt. Da Köln sich noch
immer in den Händen der Franken befand, gehörten nunmehr
am ganzen Rhein entlang die Einfallstore nach Gallien den Germanen. Es galt also, diese wichtigen Plätze ZUrückzugewinnen
und die Rheingrenze wieder sicher zu machen. Tatsächlich wurde
alsbald Brumath zurückerobert und den plündernd nach Westen
drängenden Alamannenscharen der Weg über die Zaberner Senke nach Innergallien gesperrt. In ähnlicher Weise wurden nacheinander die anderen Städte am Rhein zurückgewonnen und
schließlich gegen Ende des Sommers das wichtige Köln wieder in
römischen Besitz gebracht. Ohne selbst das Kommando innegehabt zu haben, konnte der junge Cäsar auf diesem ersten Feldzug
zahlreiche wichtige Erfahrungen sammeln, die ihm bald von unmittelbarem Nutzen sein sollten.
Als Standort flir sein Winterquartier 356/357 wählte Iulian die befestigte gallische Stadt Agedincum (Sens). Dorthin begab er sich
mit seiner Leibwache und den wenigen ihm überlassenen Soldaten. Er sollte dort schnell erfahren, wie unsicher und gefährdet die
Ergebnisse des Sommerfeldzuges waren, den er gerade mitgemacht hatte. Unversehens erschien eine starke Alamannenschar
vor den Mauern von Sens, hinter denen der Cäsar mit seiner kleinen Truppe sich sicher gewähnt hatte. Die Stadt wurde eingeschlossen und dreißig Tage lang belagert. Einen Ausfall zu wagen,
um die Belagerer mit Waffengewalt zu vertreiben, verbot die
Schwäche der Besatzung. Der nicht allzuweit von Sens überwinternde Marcellus rührte keinen Finger, um dem bedrängten Cä57
Gemme mit der Büste
Kaiser Constantius II., geschaffen
zwischen 350- 361. Berlin, Staatliche
Museen Preußischer Kulturbesitz,
Antikenabteilung.
sar zu Hilfe zu eilen oder ihm wenigstens eine kleine Hilfstruppe
zu schicken; es schien ihm im Gegenteil geradezu eine Genugtuung zu bereiten, den ihm - wohl schon wegen seiner Bildung
und geistigen Überlegenheit - widerwärtigen und wegen seines
offenkundigen Drängens nach eigener Aktivität als naseweis betrachteten jungen Mann in der Klemme stecken zu sehen. Doch
damit hatte er den Bogen überspannt und das Ehrgefühl und
Selbstbewußtsein des Cäsars unterschätzt. Als die Belagerer nach
dreißig bangen Tagen endlich abgezogen waren, beschwerte sich
lulian in aller Form beim Kaiser selbst. Sogar ihm schien nun die
Unverschämtheit des Marcellus das Maß zu übersteigen. Der General wurde aus dem Dienst entlassen und in Pension geschickt.
Das stellte zum mindesten einen Prestigeerfolg des jungen Cäsars dar. Iulian wurde nun in die Lage versetzt, in den ihm unterstellten Provinzen auch militärische Entscheidungen selbst zu
treffen, denn Severus, der Nachfolger des Marcellus, war nicht
nur ein erprobter, tüchtiger Soldat und General, sondern auch ein
loyaler Mitarbeiter, der bereit war, sich den Weisungen des Cäsars zu fUgen.
Für den Feldzug des nächsten Jahres (357) bot Kaiser Constantius eine weitere Heeresgruppe von 25.000 Mann auf. Aus Vorsicht und Mißtrauen unterstellte er sie aber nicht lulian selbst,
sondern gab ihr in dem Magister militum Barbatio einen eigenen
Oberkommandierenden, der Weisungen und Befehle nur unmittelbar vom Kaiser selbst empfangen sollte. Daß dies zu neuen
Schwierigkeiten, möglicherweise sogar zu militärischen Mißerfolgen, wenn nicht gar Katastrophen ftihren mußte, war geradezu
vorprogrammiert: Barbatio verhielt sich so, als sei seine Haupt-
58
Wichtige Straßenverbindungen der Römer.
aufgabe, Erfolge des Cäsars zu verhindem und eher lulians Unternehmungen zu behindern als die des Gegeners.
Der Feldzugsplan fl.ir das Jahr 357 sah vor, daß die Alamannen,
wiederum im Verlauf einer Zangenbewegung, durch zwei Armeen von Westen und Süden anzugreifen seien: im Westen
durch die Truppen Iulians und des Severus, im Süden durch die
59
25.000 Mann des Barbatio. Als erste Maßnahme hatte Iulian die
Neubefestigung von Zabem veranlaßt, um erneute Vorstöße der
Alamannen an dieser ihnen wohlbekannten Stelle zu unterbinden. Inzwischen aber hatte Barbatio, ohne Rücksicht auf den
vereinbarten gemeinsamen Operationsplan, versucht, eigene
Lorbeeren einzuheimsen. Er begann am Oberrhein, vermutlich
etwas unterhalb des Baseler Rheinknies, den Bau einer Schiffsbrücke über den Strom. Doch die Alamannen störten mit den primitivsten Mitteln - sie ließen starke Balken stromabwärts gegen
die Brückenpfeiler treiben- Barbatios U ntemehmen so wirksam,
daß der General kehrt machte. Auf seinem Rückmarsch in die
Ausgangspositionen überfiel ihn eine starke alamannische Abteilung. Barbatio verlor einen erheblichen Teil seines Trosses und
wurde bis über Basel hinaus in Richtung auf Augst (Augusta Raurica) verfolgt. Damit hatten die römischen Truppen nicht nur eine
schmähliche Niederlage erlitten, der ganze Feldzugsplan ftir diesen Sommer war undurchflihrbar geworden. Iulian sah sich mit
seiner Heeresgruppe bei Zabem isoliert. Für die sieben Alamannenflirsten, die sich unter Führung des kampferprobten, unerschrockenen Chnodomar zur Abwehr der römischen Angriffe zusammengeschlossen hatten, war dies das Signal, zu einem Vernichtungsschlag gegen die nunmehr allein gelassene Armee des
Cäsars auszuholen, denn diese war kaum mehr als halb so stark
wie die Truppen des geschlagenen und geflüchteten Barbatio.
Mit einem Umstand rechneten die Alamannenftirsten nicht: mit
der Tatsache, daß der zielbewußte Cäsar in der alamannischen
Kräftekonzentration flir sich selbst die Möglichkeit erkannte, den
Gegner so entscheidend zu schlagen, daß die zu durchlässig und
unwirksam gewordene Grenze am Rhein endlich wieder gesichert und den Jahr um Jahr sich wiederholenden Einfallen germanischer Scharen in Gallien ein Ende bereitet werden könnte.
Die Alamannenkönige begannen, unterhalb der Mündung der 111
auf dem rechten Rheinufer ihre Kriegerscharen zusammenzuziehen und dann den Rheinübergang zu bewerkstelligen. Innerhalb
von drei Tagen und drei Nächten brachten sie etwa 35.000 Mann
über den Strom auf das linke Ufer. Bis dahin hatte Iulian siegewähren lassen. Eine weitere Verstärkung des Gegners beabsichtigte er nicht zuzulassen. Auf der alten römischen Straße nach
Straßburg setzte er von Zabem aus seine Truppe in Marsch.
Es war Hochsommer, die Felder waren noch nicht abgeemtet.
Von einer leichten Bodenerhebung, die man in einer Geländewelle südlich des Dorfes Mundeisheim an der heutigen Straße
Straßburg-Brumath zu erkennen geglaubt hat, erblickten Iulians
Aufklärer erstmals die gewaltige alamannische Streitmacht. Den
60
Bronzestatuette eines Alemannen
(3. Jh. n. Chr.). Stuttgart, Württembergisches
Landesmuseum.
Verlauf der dann folgenden Schlacht, die als die berühmte
Schlacht von Straftburg in die Geschichte eingegangen ist, kennen
wir recht genau aus der Schilderung des Ammianus Marcellinus,
der als erprobter Offizier und kriegserfahrener Soldat, als Fachmann spricht, wenn er auch, als Literat, seinen Bericht gelegentlich etwas blumig ausschmückt, besonders wenn er die Reden zitiert, die der Cäsar unmittelbar vor dem Beginn der Schlacht an
seine Soldaten gerichtet haben soll und in einer wohl einfacheren
und kürzeren Form auch gehalten hat. Eine Kostprobe seiner
Darstellungskunst mag seine Beschreibung des alamannischen
Heerkönigs Chnodomar bieten, den er wie folgt charakterisiert:
"Chnodomar, der verhängnisvolle Urheber des ganzen Kriegsgeschehens trug einen flammend roten Helmbusch. Er ritt vor dem
linken Flügel seiner Reiterei her, verwegen, auf die gewaltige
Kraft seiner Muskeln vertrauend, stets dort zu fmden, wo ein hitziges Gefecht zu erwarten stand, riesenhaft, hochaufgerichtet auf
schäumendem Pferd, mit einem Wurfspeer von furchterregender
Länge bewaffnet. An seiner schimmernden Rüstung konnte man
ihn unter den anderen leicht erkennen."
Mit seiner starken Reiterei, dem Stolz seiner Streitkräfte, hatte es
Chnodomar zunächst auf die als unüberwindlich geltenden römischen Panzerreiter abgesehen. Um auch ihren gepanzerten Pferden beizukommen, hatte er zwischen seinen eigenen Reitern flinke, leichtbewaffnete junge Leute versteckt, die während der Atakke unter die römischen Pferde schlüpfen, ihnen den Bauch aufschlitzen, so die Reiter zu Fall bringen und eine Panik unter den
römischen Schwadronen hervorrufen sollten. Tatsächlich wandte
61
sich die römische Reiterei zu kopfloser Flucht und hätte um ein
Haar die Kampflinie der eigenen Legionäre niedergeritten; durch
sein persönliches Eingreifen brachte Iulian die Fliehenden zum
Stehen und führte dadurch eine Wendung herbei.
Auch bei den Legionären gab es in der Mitte der Schlachtordnung zuerst einen Augenblick der Schwäche; der Cäsar griff in
dieser kritischen Situation ebenfalls persönlich ein, ließ die in Bereitstellung wartenden Reserven vorrücken, brachte die vom
Weichenden zum Stehen und leitete einen energischen Gegenangriff ein. Die alamannischen Schlachtkeile sahen sich am Ende
von der römischen Kampflinie überflügelt und mußten die Umzingelung befürchten. Chnodomar selbst fürchtete, in römische
Gefangenschaft zu geraten unnd gab das Signal zum Rückzug.
Die alamannischen Krieger stoben in hastiger Flucht davon, dem
Rheinufer zu, um sichjenseits des Flusses aufihrem eigenen Territorium in Sicherheit zu bringen. Der Bericht des Ammianus
Marcellinus über das Ende dieser Vernichtungsschlacht hat strekkenweise pathetische Züge, entspricht im Kern aber gewiß der
Wirklichkeit: "Wie wenn bei einer Theateraufftihrung der aufgehende Vorhang manches wunderbare Szenenbild enthüllt, so
konnte man nun hier furchtlos zusehen, wie sich einzelne, des
Schwimmens unkundige, an tüchtige Schwimmer anzuklammern versuchten, während andere wie Baumstämme im Wasser
trieben, wenn sie von den Gewandteren weggestoßen worden
waren. Als ob der reißende Strom mit ihnen ringe, wurden manche von den Strudeln hinabgezogen und verschlungen. Manche
trieben auf ihren Schilden dahin, wichen den ihnen entgegenbrandenden, steil sich türmenden Wassermassen durch Zickzackschwimmen aus und erreichten nach vielen Fährnissen das
jenseitige Ufer. Schäumend von Barbarenblut war der rot verfarbte Strom selbst erstaunt über dieses ungewöhnliche Anschwellen seines Gewässers."
Chnodomar versuchte ebenfalls, mit seinen getreuesten Gefolgsleuten zu entkommen. Trotz seiner vorher zur Schau getragenen
Siegesgewißheit, hatte er auch die Möglichkeit einer Niederlage
in seine Überlegungen einbezogen undam Rhein einen Kahn bereitstellen lassen, mit dem er den Fluß zu überqueren und auf eigenes Gebiet zu entkommen gedachte. Auf dem sumpfigen Boden des Ufergeländes glitt sein Pferd aus und stürzte. Er selbst
konnte zu Fuß noch ein Versteck erreichen, wurde jedoch entdeckt, erkannt und gefangengenommen. In ihm verloren die Alamannen ihren fahigsten und tatkräftigsten Anführer; dies war
vielleicht das wichtigste Ergebnis der Schlacht von Straßburg.
Über die Verluste, die beide Seiten in dieser Schlacht erlitten hat-
62
Säulensockel mit der Darstellung gefangener Germanen (Ende des 1. Jh.). Mainz,
Landesmuseum.
ten, berichtet wiederum Ammianus: "In dieser Schlacht fielen
243 römische Soldaten und vier Offiziere: der Tribun der Comuten" - einer Truppe, die vermutlich nach einem hornähnlichen
Helmstück so hieß - "Bainobaudes, desgleichen Laipso und der
Chef der Panzerreiter lnnocentius, sowie ein namentlich nichtgenannter überzähliger Tribun. Auf der Gegenseite wurden auf
63
dem Schlachtfeld 6.000 tote Alamannen gezählt; ungezählte andere Leichen wurden von den Wellen des Stroms davongespült."
Da die Zahl von sechstausend toten Alamannen von einem anderen, allerdings späteren und griechisch schreibenden Autor bestätigt wird, darfman annehmen, daß sie das katastrophale Ausmaß der alamannischen Niederlager einigermaßen richtig charakterisiert. Im Rausch und Begeisterungstaumel des errungenen
Sieges wollten die Soldaten ihren jungen Feldherrn zum Augustus, zum Kaiser, ausrufen; Iulian wußte, daß die Annahme des
Titels zum bewaffneten Konflikt mit dem legitimen Kaiser, seinem Vetter Constantius, führen und den Bürgerkrieg bedeuten
würde. Er wies die Soldaten scharf zurecht, erklärte, sie handelten
leichtfertig, und beschwor, daß er diesen Titel weder erwarte
noch wünsche.
Den gefangenen Chnodomar ließ er sich vorführen und gab ihm
zu verstehen, daß er von ihmnichts zu befürchten habe. In einem
Brief, den lulian ein paar Jahre später an den Rat der Stadt Athen
schrieb, rühmte er sich etwas aufdringlich der schonenden Behandlung, die er dem gefangenen Alamannenftirsten angedeihen
ließ: "Ich hätte meinen Gegner hinrichten lassen können, auch
hätte mich niemand hindem können, ihn, Chnodomar, durch das
ganze Keltenland zu führen, ihn in den Städten zur Schau zu stellen und ihn in seinem Unglück zu verhöhnen. Ich war der Auffassung, daß ich nichts von alledem tun solle, und schickte den Gefangenen geradewegs zu Constantius." Der Kaiser ließ lulians
Gefangenen von Mailand nach Rom bringen. Dort lebte Chnodomar bis zu seinem Tod in dem Ausländerlager auf dem Mons
Caelius. Ammianus erzählt, der Alamannenfürst sei dort an
Schlafsucht (Somnolenz) gestorben; der Germane konnte vermutlich das Klima der Reichshauptstadt und die Gefangenschaft
nicht ertragen.
Iulian dachte nicht daran, sich auf den ersten Lorbeeren des Feldherrn auszuruhen. Ihm war klar geworden, daß bis zur Sicherung
der römischen Grenze am Oberrhein noch viel zu tun bleibe. Von
Zabem aus zog er mit seinen Truppen stromabwärts, ließ bei
Mainz eine Schiffsbrücke über den Rhein schlagen, die Dörfer
der Alamannen jenseits des Flusses brutal verwüsten und die
Fliehenden bis über den Main hinweg verfolgen. An der Mündung der Nidda in den Main veranlaßte er die Instandsetzung der
Ruine eines zerstörten, vor langer Zeit aufgegebenen Kastells,
das Kaiser Trajan vor zweieinhalb Jahrhunderten hatte errichten
lassen, und besetzte es mit einer kleinen Garnison; wieder bewachten römische Legionäre ein Kastell im rechtsrheinischen
Germanien. Das konnte freilich nur als Schaustück, als spektaku-
64
läre Geste des Auftrumpfens gelten; das war gewiß auch dem Cäsar klar. Auf der anderen Seite war diese Demonstration ein Signal für die Alamannen; sie wußtenjetzt, daß die Zeit der ungehinderten und ungestraften ÜberfaJle aufrömisches Gebietjenseits
des Rheins vorläufig vorbei sei. Ihre Einsicht bekundeten sie dadurch, daß sie ihre Fürsten zu Iulian schickten und um Frieden ersuchten. Dieser wurde gewährt und von beiden Seiten beschworen. Dann begab sich Iulian nach Paris, wo er auch in den folgenden Jahren sein Winterquartier bezog.
Im zeitigen Frühjahr 358 überraschte lulian die salischen Franken an der unteren Maas und Scheide und zwang sie zur Anerkennung der römischen Oberhoheit. Um aus Britannien, das für
die römischen Truppen im verwüsteten Gallien zur Kornkammer
geworden war, Proviant für seine Armee herbeischaffen zu können, befahl er, zweihundert Transportsschiffe, die er im Mündungsgebiet des Rheins und der Maas vorgefunden hatte, instandzusetzen; dazu ließ er in knapp zehn Monaten vierhundert
neue bauen. Nach der Wiederherstellung der Sicherheit auf dem
Rhein war mit dieser riesigen Transportflotte die Versorgung der
Truppen, mit denen der Cäsar seine weiteren Operationen durchzuführen gedachte, gesichert.
Nachdem der letzte Alamannenschwarm von gallischem Boden
vertrieben war, galt es, die verwüsteten Städte und Dörfer neu zu
besiedeln und die Felder zu bestellen. Dazu war notwendig, daß
Römi scher Gutshof. Zinnfiguren-Diorama. Aalen, Limesmuseum.
65
die Alamannen die Tausende von Gefangenen herausgaben, die
sie von ihren Streifzügen durch Gallien auf rechtsrheinisches Gebiet mitgeschleppt hatten und dort noch immer als Sklaven hielten. Erneut wurde eine Schiffsbrücke über den Oberrhein geschlagen, die Legionen wurden auf rechtsrheinisches Territorium
übergesetzt. Es war der Frühsommer des Jahres 359, des vierten
Jahres der Anwesenheit lulians in Gallien. Jetzt beugten sich die
Alamannenftirsten dem militärischen Druck und sagten die Freigabe aller aus Gallien weggeftihrten Gefangenen zu. Kleine
Schwindeleien, die sie bei der Übergabe versuchten, wurden
durch lulians Umsicht vereitelt. Ein wichtiger Schritt zum Wiederaufbau des verwüsteten Gallien war getan.
Die Erfolge des Cäsars sprachen sich natürlich auch in den anderen Provinzen des Reiches herum. Die Hofschranzen in Mailand
kannten ihren Herrn und glaubten, es ihm schuldig zu sein, die
Leistungen des noch nicht achtundzwanzigjährigen Cäsars, des
ehemaligen Buchgelehrten und Rhetorikadepten, mit höhnischen Kommentaren herabzusetzen. Sie bezeichneten ihn mit
dem Spitznamen Victorinus (Siegerlein), beschimpften ihn als geschwätzigen Maulwuif, als Affen im Purpur, als degenerierten griechischen Schreiberling. Dem hart erkämpften Erfolg antwortete
am Kaiserhof die schrille Stimme des Neides, der erbärmlichen
Mißgunst.
Gegen Ende des Jahres 359 veranlaßte die Bedrohung der Ostgrenze des Reiches am Euphrat durch das neupersische Reich
Kaiser Constantius zu einer sehr unüberlegten und ftir ihn selbst
verderblichen Maßnahme. Er schickte einen subalternen Abgeordneten nach Paris mit dem Auftrag, etwa rund die Hälfte der
besten Soldaten des Cäsars nach dem Osten zu fUhren; sie sollten
die Truppen des Kaisers verstärken. lulian selbst erhielt vom Kaiser nichts weiter als die briefliche Weisung, sich in diesen Vorgang
der Truppenverlegung nicht einzumischen. Aber die Soldaten IuHans wollten sich wedervon ihrem siegreichen Feldherrn trennen
noch an die ferne Ostgrenze des Reiches abkommandieren lassen. Die Mehrzahl von ihnen stammte aus den gallischen Provinzen. Germanen, die sich unter die römische Hilfstruppen hatten
einreihen lassen, waren mit der verbindlichen Zusage eingestellt
worden, daß man sie niemalsjenseits der Alpen einsetzen werde.
Es kam zu einer offenen Militärrevolte, die Armee rief den Sieger
von Straßburg, diesmal ohne wenn und aber, zum Augustus, zu
ihrem Kaiser, aus. Wiederum sträubte sich Iulian, die Kaiserproklamation anzunehmen, doch die Soldaten ließen sich, in ihrer
Erregung, auf kein Ausweichen oder Zögern ein. Iulian wurde,
mehr gezwungen als freiwillig, öffentlich zum Kaiser gekrönt.
66
Diese Vorgänge spielten sich in Paris gegen Ende des Wmters
359/360 ab. Jetzt konnte über den offenen Konflikt nur noch eine
bewaffnete Auseinandersetzung entscheiden. Über ihren Verlauf
ist in diesem Zusammenhang nicht mehr zu berichten. Der Bürgerkrieg jedenfalls wurde vermieden: Kaiser Constantius starb
überraschend auf seinem Zug gegen Iulian, ehe es zu einem Zusammenstoß der beiden Heere kam. Wieder hatte das Reich einen einzigen Kaiser: Iulian. Der Nachwelt ist er mehr durch einen
Religionskampf bekarmt, auf den er sich, gewiß aus Idealismus,
aber in völliger Verkennung der Situation, eingelassen hat; dieser
Konflikt hat ihm den Namen des Apostaten eingetragen, als der er
zum Helden zahlreicher Romane und romanhafter Biographien
geworden ist.
Sein Kampf um den Oberrhein hat den Zusammenbruch der römischen Herrschaft über Gallien und das linksrheinische Germanien um ein halbes Jahrhundert hinausgezögert. Sein Auftreten
am Rhein ist damit auch für die Geschichte des alten Germanien
von entscheidender Bedeutung geworden.
Münzporträt des Kaisers IuJianus. Solidus, geprägt um 360- 363 n. Chr.
67
Bertold K. Weis
Ausonius,
Mosella - Ein spätrömisches Gedicht
auf die Mosellandschaft
Man mochte das Jahr 365 n. Chr. schreiben, als am kaiserlichen
Hof in der Residenzstadt Trier ein etwa ftinfundftinfzigjähriger
Herr von soignierter äußerer Erscheinung, mit Habitus und Miene des selbstbewußten Gelehrten und Hochschullehrers eintraf
und sich als Decimus Magnus Ausonius aus Burdigala (Bordeaux) vorzustellen wünschte. Der Kaiser Valentinian I. (364 bis
375) hatte ihn aus dem entlegenen Aquitanien, von der damals
hochangesehenen Hochschule seiner Heimat Burdigala, von den
Ufern der Garurnna (Garonne) an die der Mosel berufen; er
wünschte den bekannten und geachteten Professor der Rhetorik
und Sprachkünstler als Erzieher seines älteren Sohnes, des achtjährigen Prinzen Gratian, in seiner Umgebung zu haben. Daß die
Berufung zum Prinzenerzieher eines Tages zu einer glänzenden
politischen Laufbahn fUhren würde, konnte damals Ausonius
selbst nicht ahnen. Man kann sich aber vorstellen, daß er die Reise nach Trier mit einem Gefühl des Stolzes unternahm; eine gewisse Beklemmung mag freilich auch nicht gefehlt haben, denn
es war bekannt, daß in der nächsten Umgebung dieses Herrschers zu leben, kein Dasein in ungetrübter Heiterkeit bedeutete.
Rekonstruierte Ansicht des spätantiken Triers (Anfang4. Jh. n. Chr.). Blick von der
Anhöhe südlich des großen Tempelbezirkes im Altbachtal nach Norden (vgl.
Stadtplan des römischen Trier).
In Valentinians Charakter herrschte ein jähes Wechselspiel zwischen gutmütigen und humanen Zügen einerseits, und barbarischer Maßlosigkeit andererseits. Er war bekannt und geflirchtet
wegen seines unbeherrschten Temperaments, seiner unberechenbaren, maßlosen Wutausbrüche - sein letzter hatte einen
Schlaganfall und den jähen Tod des Kaisers zur Folge-, wegen
seiner übertriebenen Strenge und grausamen Härte, die er auch
seinen Mitarbeitern in Administration und Truppenflihrung als
Prinzip einschärfte. Nach einem zeitgenössischen Berichterstat-
Stadtplan des römischen Tri er: I Porta Nigra; 2 Horrea-Getreidespeicher; 3 Doppelbasilika unter dem Dom und der Liebfrauenkirche; 4 Aula palatina; 5 Circus;
6 Amphitheater; 7 großer Podiumtempel am Herrenbrünnchen; 8 Tempelbezirk
im Altbachtal; 9 Kaiserthermen; 10 Forum; ll-12 städtische Villen und Paläste;
13 Barbarathermen; 14 Römerbrücke Güngere Steinpfeilerbrücke); 15 Tempelbezirk des Lenus Mars; 16-17 Brückenkopf und ältere Pfahlrostbrücke; 18-19
Triumph- und Ehrenbögen.
69
Kaiser Valentiman 1.,
schwere spätrömische Silbermünze (4. Jh. n. Chr.).
ter, der ihn wohl erlebt hat, "war er allen ein Schrecken (terrori
cunctis erat), wo man ihn auch erwartete, grimmig und heftig, wie
er war". Für Ausonius als Geistesmenschen mochte ein anderer
Charakterzug des Kaisers eine Vorwarnung sein, denn man sagte
von Valentinian, "er hasse gutgekleidete, gebildete, wohlhabende
und vornehme Menschen". Vorsicht im Umgang mit diesem allmächtigen Manne war also geboten. Uneingeschränkt freuen
konnte sich der Lehrer auf seinen Schüler: von dem jungen Gratianus hieß es später, er sei ein gütiger, liebevoller Mensch gewesen, und in unserem Jahrhundert sieht Otto Seeck, der Historiker
des "Untergangs der antiken Welt", in Ausonius' Schüler Gratian
"ein schönes, artiges Kind, wie es den Eltern Freude macht", und
meint, das sei er "sein Leben lang geblieben".
Kaiser Gratian, leichte
spätrömische Silbermü nze
(4. Jh. n. Chr.).
70
Wir besitzen eine ziemlich genaue Kenntnis der Herkunft, der Familienverhältnisse, des Bildungsgangs, der Lebensschicksale und
der literarischen Arbeiten des Ausonius. Das meiste davon verdanken wir dem Autor selbst, besonders fast alles, was Herkunft
und Familienschicksale angeht. Ausonius hat nämlich u. a. dreißig Gedichte auf verstorbene Familienangehörige hinterlassen.
Dieser Sammlung gab er den Titel Parentalia; das ist die Bezeichnung eines Totenfestes der römischen Familien, das zwischen
dem 13. und 21. Februar begangen wurde und sich bis in die Kaiserzeit hinein erhalten hatte.
Was wir nicht wissen, ist das genaue Geburtsjahr und Geburtsdatum des Ausonius. Mit einiger Sicherheit kann man jedoch annehmen, daß er um das Jahr 310 n. Chr. in Bordeaux als Sohn eines angesehenen und wohlhabenden Arztes geboren wurde. Mit
den Lehrern, die ihn in seiner Heimatstadt in die lateinische und
griechische Grammatik und Literatur einzufUhren hatten, war er
offenbar nicht sehr zufrieden; er gab ihnen später die Schuld daran, daß er nur unzulänglich Griechisch gelernt habe. Glücklicherweise war ein Bruder seiner Mutter, Aemilius Magnus Arborius, Professor der Rhetorik in Tolosa (Toulouse ). Dieser nahm
ihn in seinem Haus auf und sorgte fl.ir eine gründliche weitere Bildung. Doch gegen 330 wurde Arborius seinerseits als Prinzenerzieher an den HofKaiser Konstantins nach Konstantinopel berufen und blieb dort fl.ir den Rest seines Lebens. Ausonius blieb keine Wahl, als nach Bordeaux zurückzukehren und dort an der
Hochschule seine Studien fortzusetzen. Nach ihrem Abschluß
berief ihn seine Heimatgemeinde auf einen Lehrstuhl fl.ir Rhetorik. In den folgenden drei Jahrzehnten führte er das ruhige, fleißige Leben eines Hochschullehrers in der Provinz und entwickelte
sich in dieser Zeit nicht nur zu einem Meister der Sprache und
Stilistik, sondern erwarb sich zugleich auch eine stupende Kenntnis der großen klassischen und nachklassischen lateinischen Autoren. Wenn man seine poetischen Arbeiten liest, kann
man den Eindruck gewinnen, daß er z. B. den ganzen Vergil auswendig im Kopf hatte; so sehr begegnet man bei ihm aufSchritt
und Tritt sprachlichen Wendungen, die eher Zitaten aus dem großen augusteischen Dichter gleichen. Seine zunehmende artistische Sprachbeherrschung verfuhrt ihn zu poetischen Spielereien,
die mit echter dichterischer Sprachgestaltung nichts mehr gemein haben; in einer Zeit, die eine ausgesprochene Vorliebe fl.ir
sprachliche Kunststücke hatte, fanden sie gleichwohl zahlreiche
Bewunderer. Es genügt, zwei Beispiele anzuflihren: Das eine
trägt den bezeichnenden Titel Technopaegnium (Kunstspielerei),
ein Elaborat von 164 Hexametern, die sämtlich auf ein einsilbiges
71
Wort enden. Das zweite dieser Verskunststücke verfaßte Ausonius bereits in Trier, also nach 365, auf Wunsch Valentinians I.
und gab ihm die aufschlußreiche Überschrift Cento nuptialis
(Hochzeitsliederflickerlteppich); der Verfasser hatte es aus Teilen
von Vergilversen so zusammengesetzt - man müßte eigentlich
sagen zusammengeflickt-, daß die so gebildeten Hexameter ein
Hochzeitscarmen ergaben. Von diesen literarischen Basteleien
hebt sich dann die Mose/la, trotz des auch hier vorwaltenden
rhetorischen Grundtons, durch den immer wieder sich einstellenden Eindruck ursprünglicher Erlebnisfrische geradezu erquickend ab. Doch ehe auf die Mose/la ausftihrlicher eingegangen wird, sei der kurze Lebensabriß des Ausonius zu Ende gebracht; er ist erstaunlicher als seine literarischen Erfolge.
Ehe sich der Prinzenerzieher am HofValentinians I. an die Niederschrift des dichterischen Hauptwerks seiner Trierer Jahre machen konnte, verordnete der befehlsgewohnte Kaiser dem Professor und seinem Zögling eine ganz und gar unrhetorische und
unliterarische Aufgabe. Ebenso wie der junge Gratian, der künftige Thronfolger, mußte Ausonius den Herrscher auf einem seiner
Kriegszüge, die vor allem der Sicherung der Rheingrenze galten,
ins Gebiet der Alamannen begleiten; sie hatten nach dem Tod
des Kaisers lulian (363) die Lehre, die dieser ihnen als Statthalter
von Gallien in den Jahren zwischen 355 und 361 erteilt hatte, sehr
rasch vergessen und erneut mit den Überfällen auf römisches
Territorium begonnen. Auf seinem Feldzug gegen sie ftihrte Valentinian seine Truppen bis zu den Donauquellen (368/369).
Nach ihrer Rückkehr nach Tri er feierten Vater und Sohn einengemeinsamen Triumph über den wieder einmal besiegten Gegner.
Auch der Prinzenerzieher erhielt einen Anteil an der gemachten
Beute: der Kaiser schenkte ihm das als Gefangene weggeftihrte
hübsche blonde Schwabenmädchen Bissula, ein Geschenk, das
den Dichter zu den- freilich nur fragmentarisch erhaltenen- Bissula-Gedichten inspirierte. Walter John, dem wir eine ausgezeichnete zweisprachige und kommentierte Ausgabe der Mose/la
verdanken, bemerkt zu dieser Episode charmant, daß dieser Alamannin "der altemde Professor bald ganz wie einem Pflegekind
liebevolle Sorge zuwandte".
Offenbar war Kaiser Valentinian mit den Leistungen und Erfolgen des Prinzenerziehers Ausonius sehr zufrieden: Gratian, der
Thronfolger, lernte von seinem Lehrer die hohe Kunst eines
exemplarischen lateinischen Stils in Schrift und Rede; zugleich
erwarb er sich eine Bildung, die auch hohen Anforderungen genügen konnte; er war schließlich sogar in der Lage, selbst brauchbare Verse zu verfassen. Als Zeichen seiner Anerkennung verlieh
72
der Kaiser dem Erzieher seines Sohnes ein wichtiges Amt: die
quaestura sacri palatii; Ausonius wurde damit so etwas wie der
Kabinettschef des Kaisers und war als solcher u. a. für die Formulierung und sprachliche Redaktion neuer Edikte und Gesetze verantwortlich.
Bald darauf starb Valentinian I. (375). Gratian, damals gerade
sechzehn Jahre alt, war nun alleiniger Herrscher der westlichen
Reichshälfte. Über Nacht wurde der bisherige Erzieher der erste
Berater des jungen Kaisers. Ausonius machte seinen bedeutenden Einfluß zunächst einmal im Sinne einer Milderung und Humanisierung des unnachsichtig strengen, oft bis zur Grausamkeit
harten Regierungsstils Valentinians geltend. Bald konnte der ehemalige Erzieher von dem neuen Herrn des Westreiches rühmend
sagen, er habe den Trierer Kaiserpalast "aus einem Ort des
Schreckens zu einem liebenswerten Platz" gemacht. Steuerschulden, die Valentinian unerbittlich hatte eintreiben lassen - zahlungsunfähige Steuerschuldner ließ er kurzerhand hinrichten wurden zu Beginn der Regierung Gratians in einem großzügigen
Gnadenerweis erlassen, die amtlichenUnterlagen über aufgelaufene Zahlungsrückstände der Steuerpflichtigen öffentlich verbrannt. Ausonius versäumte es auch nicht, seine Kollegen, die
Trierer Grammatiklehrer und Rhetorikprofessoren, mit einer Gehaltserhöhung aus der Staatskasse erfreuen zu lassen. Auch er
Römische Basilika als Palastaula KaiserKonstantindes Großen in Tri er (um 310 n.
Chr. erbaut). Die Palastaula war in römischer Zeit Mittelpunkt des kaiserlichen
Palastbezirkes. Sie ist heute Kirche der evangelischen Gemeinde.
73
Das Innere der Palastaula Kaiser Konstantins. Rekonstruktionsversuch. Trier,
Rheinisches Landesmuseum.
selbst erfuhr nicht minder die Gunst seines dankbaren Schülers:
Gratian machte seinen ehemaligen Lehrer im Jahr 378 zum Praefecuts praetorio Galliarium, zum Statthalter der gallischen Provinzen, und im folgenden Jahr (379) zum Konsul. Das Konsulat
war noch immer ein begehrtes Ehrenamt, wurde doch nach den
Konsuln das jeweilige Jahr benannt.
Geradezu belustigend aber ist es zu sehen, wie Ausonius in einem ausgeprägten Familiensinn die Wohltaten der kaiserlichen
Huld seinen nächsten Angehörigen und auch entfernten Verwandten zugute kommen ließ. Dabei wurde nicht einmal sein
achtzigjähriger Vater übergangen: er erhielt die Titularwürde ei-
74
nes Praefectus praetorio von Illyricum; das Amt selbst auszuüben
vermochte er natürlich nicht mehr. Ausonius' Sohn Hesperius
und sein Schwiegersohn Thalassius stiegen zu hohen Verwaltungsämtern auf. Ein Neffe wurde zuerst Comes sacrarum largitionum und bekleidete damit eines der angesehensten Ämter der
kaiserlichen Finanzverwaltung, das sich mit der Stellung eines
Ministers vergleichen läßt, ein Jahr später (380) war derselbeN effe Stadtpräfekt der alten Reichshauptstadt Rom. Es kann deshalb
nicht als bösartige Übertreibung gelten, wenn man gesagt hat, der
Familienclan des Ausonius habe während einiger Jahre alle bedeutenden Ämter der westlichen Reichshälfte besetzt gehabt.
Die Zeit des Glanzes und der Befriedigung persönlichen Ehrgeizes war freilich auch ftir Ausonius begrenzt. Gegen Gratian erhob
sich schon im Jahre 383 ein Gegenkaiser, der Spanier Magnus
Maximus. Die Truppen, die Gratian gegen den Usurpator ins
Feld zu Hiliren gedachte, liefen zu diesem über; Gratian versuchte, nach Italien zu flüchten, wurde aber in Lyon umgebracht. Damit war das Ende der großen Tage des Ausonius gekommen.
Doch wiederum erwies er sich als ein Günstling der Glücksgöttin:
Die Porta Nigra in Tri er, das beste und größte erhaltene antike Stadttor der Welt.
Rekonstruktionsversuch mit der spätantiken Laubenstraße an der der Stadt zugewandten Seite (Zeichnung K Nagel, 1948).
75
unbehelligt von dem neuen Herrn konnte er sich in seine Heimat
Bordeaux zurückziehen, in deren Umgebung er bedeutenden
Grundbesitz hatte. In einem behaglichen Ruhestand lebte er dort
seinen wissenschaftlichen Studien, seinen poetischen Liebhabereien und der Korrespondenz mit alten Freunden und bedeutenden Zeitgenossen. Noch einmal erfuhr er auch die Huld eines
Mächtigen: Kaiser Theodosius I. (379 bis 395) bat ihn in einem
Handschreiben um ein Exemplar seiner gesammelten Werke;
Theodosius gab damit zugleich den Anstoß zu ersten, vom Autor
selbst besorgten Gesamtausgabe. Wie das Geburtsjahr ist auch
das genaue Todesjahr des Ausonius nicht überliefert: er muß um
393 gestorben sein.
Ausonius hat seine Mosella im Jahre 373 in Trier geschrieben. Sie
ist ein Lobgesang auf den Moselfluß und die Mosellandschaft in
483 kunstreichen, virtuos geschriebenen Hexametern mit zahlreichen, teilweise zitatartigen Anspielungen aufStellen aus Werken großer lateinischer Autoren. Das Gedicht beginnt mit einer
fast modern wirkenden Einleitung, der Schilderung einer Reise
vom Mittelrhein bei Bingen an die Mosel bei Neumagen. Auch
ein Reisebericht unserer Zeit könnte so beginnen; in Hexametern freilich würde sich ein heutiger Autor nicht äußern. Ich habe
versucht, die als Beispiele ausgewählten Verse im originalen Versmaß ins Deutsche zu übersetzen, durchaus im Bewußtsein der
Problematik des Unternehmens; zu sehr sperrt sich unsere Muttersprache gegen den Takt des hexametrischen Verses - trotz
Goethe, Schiller und Voß. Gleich die ersten Zeilen führen uns zu
bekannten Namen und Plätzen:
Über die eilige Nahe im Nebel war ich gekommen,
hatte die neuen Mauem ums alte Bingen bewundert,
dort wo vor Zeiten die Gallier ein römisches Cannae ereilte;
unbeweint bedecken Gebeine noch kläglich die Fluren.
Da betrat ich auf einsamem Steg eine waldige Wildnis.
Nirgends gewahrt' ich die Spur kultivierender Menschen, vorbei an
Dumnissus wandernd, wo überall dürstende Felder verdorren,
zog an Tabemae vorüber, das unversieglich der Quell tränkt,
auch an den Feldern, die jüngst man vermaß für sarmatische
Siedler.
Endlich zeigte sich mir sogleich an den Ufern der Belger
Noviomagus, das stolze Kastell Konstantins des Erhabnen.
Reiner streifen die Lüfte hier die Gefilde, und Phöbus
öffnet in Klarheit mit heiterem Licht den glänzenden Himmel.
Nicht mehr sucht man durch wirren Geästs verwachsene Wildnis
Himmelsbläue, die grünes Waldesdämmern verdunkelt.
76
Vom alten Bingen (Bingium heißt es schon bei Tacitus im ersten
Jahrhundert n. Chr.) spricht Ausonius mit Recht: die Stadt gehörte vermutlich zu den von Drusus auf dem linken Rheinufer geschaffenen Kastellen, war zur Zeit des Ausonius also an die vierhundert Jahre alt. Neue Mauem hatte das römische Bingen 359,
zwölf Jahre vor der Niederschrift der Mosella, durch den späteren
Kaiser Julian erhalten; die alten waren vier Jahre zuvor von den
Alamannen zerstört worden. Ausonius kannte die Gegend aus
persönlicher Anschauung; wie bereits erwähnt, war er im Jahre
368 mit Kaiser Valentinian I. in einen Alamannenkrieg gezogen.
Der Kaiser und sein Gefolge waren damals von Trier aufgebrochen, auf dem linken Rheinufer stromaufwärts gezogen und von
der Neckarmündung aus auf rechtsrheinisches Gebiet vorgestoßen. Von einem römischen Cannae, das die Gallier bei Bingen
durch die Römer erlitten haben sollen, ist nichts bekannt, die
"kläglich auf den Fluren bleichenden Gebeine" der Gefallenen
muß man wohl der dichterischen Phantasie zugute halten.
Mit Absicht, des Kontrastes wegen, hüllt der Autor die Mündung
der Nahe (Nava) und die Straße, die bei Bingen von der römischen Rheinuferstraße nach Westen abzweigte, in unfreundlichen Nebel, um die südlich empfundene, kulturträchtige, romanisierte Mosellandschaft dann mit ihrem "glänzenden Himmel"
in desto heitererem Licht hervortreten zu lassen. Eines erklärenden Wortes bedarfvielleicht die Wendung "an den Ufern der Belger": Tri er und das Gebiet der Treverer gehörte damals zur römischen Provinz Belgica prima.
Im weiteren Verlauf des Gedichts bricht aber bald spontanerEnthusiasmus für die harmonischen, idyllischen Landschaftsbilder
des Moseltales hervor, das Ausonius seinen Wanderer bei Neumagen (Noviomagus) erreichten läßt. Was er, von den Waldem
des Runsrück herkommend, dort erblickt, erinnert ihn in seiner
Schönheit an die ferne Heimat an der Garonne (Garumna):
Alles betörte mich da mit schmeichelnden Bildern, im Ausdruck
meiner strahlenden Heimat Burdigala gleichend an Adel.
Villengiebel, erhöht über sinkende Ujergefilde,
rebenbegrünte Hügel und unten mit stillem Gemurmel
anmutreich die Flut der vorübergleitenden Mosel.
Es versteht sich, daß diese Einführung auf einen hymnischen
Gruß an den Strom und die Kaiserstadt Trier hinausläuft. Gelegentlich wurde kritisch angemerkt, daß Ausonius sich an dieser
Stelle nicht auf eine explizite Schilderung der prachtvollen Kaiserresidenz und ihrer glänzenden Großbauten einläßt, deren Ruinen noch heute Bewunderung erregen. Dagegen aber läßt sich sa77
Igeler Säule. Treidelfahrt auf der Mosel. Nordseite, mittlere Stufe.
gen, daß eine detaillierte Beschreibung zum Exkurs hätte geraten
müssen; Ausonius hat gewiß mit Recht sein Thema im Auge behalten: die Mosel. Zu ihr gehört neben der Landschaftsidylle
auch die höchst nützliche, schon damals lebhafte und bedeutende Moselschiffahrt, die uns in den Kunstdenkmälern der Römerzeit, in den Neumagener Reliefs oder auf dem Sockel der lgeler
Säule, so eindrucksvoll vor Augen geführt wird. Der lebendigen
Genauigkeit der Bildwerke entspricht die präzise Schilderung des
Treidelns bei Ausonius:
Wenn auf den Treidelpfaden nirgends schlaffwird das Schleppseil,
weil das Schiffsvolk spannt mit dem Nacken das Tau an den
Masten ...
Genau so haben auch die Bildhauer den Vorgang dargestellt;
man sollte vor den Reliefs den Text des Ausonius zur Hand haben, um zu beobachten, wie Dichterwort und Bild sich gegenseitig bestätigen.
Ein sprachliches und gegenständliches Kabinettstück exakter
Charakterisierungskunst ist die Einlage über die in der Mosel vorkommenden Fische: 85 Verse von 483 hat Ausonius diesem
Fischkatalog gewidmet; fünfzehn Arten, von der Aesche und Barbe, über Forelle, Neunauge und Lachs, über Barsch, Hecht und
Schleie bis zum mächtigen Wels führt er auf, jeden Typus im Detail beschreibend wie der profundeste Kenner der Materie. Bei allem Streben nach Vollständigkeit, bei aller Fülle verfallt er nicht
ein einziges Mal in den langweiligen Trott bloßer Aufzählung,
denn er verfügt über eine staunenswerte Differenziertheit des
Ausdrucks. Wer das liest, begreift, daß Ausonius von seinen
kunstverständigen Zeitgenossen als souveräner Sprachkünstler
bewundert und gefeiert wurde. Mancher hat nicht glauben wollen, daß ein Literatsogenaue ichthyologische Kenntnisse gehabt
haben könne; doch niemand hat bisher nachzuweisen vermocht,
daß Ausonius sein Wissen aus fremden, aus Spezialquellen bezogen und seine Lesefrüchte nur in Verse gefaßt habe. Wenn der
heutige Angelsportler und Fischer den Moselfischkatalog des
Ausonius liest, mögen ihn nostalgische Empfmdungen überkommen.
78
Vom glitzernden Leben in den klaren Wassern des Flusses wendet sich der Dichter den Reben, Weinbergen und Wmzern zu und
bannt sie in ein heiteres Bild, das eines poetischen Landschaftsfilmes würdig wäre:
Selbst wo am obersten Grat schon der Hang zum Himmelsrand
aufstrebt,
zeigt sich des Flusses Grenzmark mit grünen Reben bewachsen.
Fröhlich betreibt das Volk sein Geschäft, und hurtige Winzer
sputen sich, bald ganz oben am Scheitel, bald unten am Abhang
und wetteifern in närrischen Schreien. Der Wandrer indessen,
unten auf Uferpfaden spazierend, und drüben der Schiffer
singen den säumigen Schaffern ein Neck/ied, als Echo kehrt's
ihnen
wieder vom Fels, vom erschauernden Wald, aus der Tiefe des
Flusses.
Ausonius war Christ, offenbar freilich ein sehr weitherziger.
Der antike Olymp, die ganze Mythologie mit ihrer bunten Gestaltenfülle lebt in seiner Bildungswelt, erfüllt seine Phantasie, seine
Vorstellungen. So belebt er auch die Wasser der Mosel und ihre
Ländliche Villa (villa rustica). Wandmalerei aus Trier. Landesmuseum Trier.
79
Weintransport auf der Mosel. Das sog. Moselschiffvon Neumagen (1. H älfte 3. Jh.
n. Chr.). Trier, Landesmuseum.
Gestade mit Satyrn und Najaden, mit dem bocksftißigen Pan und
tanzenden Nymphen. Man geht wohl nicht fehl, wenn man vermutet, daß Ausonius einheimische Geister und Gottheiten der
Mosellandschaft, die ihm während seines langen Aufenthalts auffielen, mit den ihm vertrauteren Gestalten der antiken Mythenwelt identifizierte.
Aus diesem Fabel- und Geisterreich kehrt der Autor leichtfüßig
und elegant in die Gegenwart und zu ihren Menschen zurück; dabei bemüht er sich, helle, heitere Bilder zu entwerfen, beschreibt
ein Wasserfest auf der Mosel mit einem fröhlichen Wettrudern,
schildert Szenen vom Fischfang mit demNetz und mit der Angel.
Auch da setzen Historie und Mythos der Mittelmeerwelt gelehrte
Glanzlichter auf, zum Vergnügen der Eingeweihten, zur Selbstbespiegelung des Dichters. Und wieder werden die Villen der
Reichen und die aufwendigen Schlösser auf beiden Ufern des
Flusses gerühmt. So hervorragend sind, meint der Dichter, diese
Bauwerke, daß auch die größten, ruhmreichsten Architekten der
Vorzeit und der ganzen Baugeschichte ihnen die gebührende
Anerkennung nicht versagen würden. Wahrlich dithyrambisch
klingt dieser Lobgesang, doch Ausonius darf sich auf eigene Anschauung und Beobachtung berufen, wenn er eine rhetorische
Frage, die er sich selber stellt, auch selbst beantwortet:
Soll ich die Hallen beschreiben am Rande grünwuchernder
Wiesen,
schildern die Dächer, die lastend sich stützen auf zahllose
Säulen,
zeichnen die dampfenden Bäder, auf Stromjitndamente gegründet,
80
wo Vulcanus, heraufgebannt aus kochender Tiefe,
sausende Flammen empor durch hohle Stuckwände wirbelt,
bei verströmender Hitze ballend die eingeschlossenen Dämpfe?
Viele hab' ich gesehn, die, erschöpft vom Schwitzbad, der Wannen
Wasser verschmähten und auch das eifrischende Schwimmbad,
um drüben
sich zu erfrischen in lebendem Wasser, erquickt dort vom Flusse,
schwimmend mit rauschenden Stößen zu zwingen die eiskalte
Strömung.
Das ist wirklichkeitsnah und gut beobachtet, sowohl die Beschreibung der Hypokaustenheizung - Vulcanus bedeutet wie so
oft auch hier nichts weiter als das Feuer - mit den Heizkanälen
der Stuckwände, als auch das Bild des Badegastes in den Thermen, der, vom Schwitzbad erhitzt, sich in das erfrischende Wasser
des benachbarten Flusses wirft und schwimmend die Strömung
bezwingt: hier ersteht ein Stück realen zeitgenössischen Lebens
aus dem römischen Moselland, eingefangen - um nicht zu sagen
eingezwängt- in die altehrwürdige Form des epischen Hexameters. Man sollte diese Verse gelesen haben, ehe man die Wanderung durch die doppelgeschossige Unterwelt der römischen Kaiserthermen in Trier antritt, deren ursprüngliche Konzeption unvollendet blieb.
Daß die Mosel ein großer Fluß, ein Strom ist, bezeugen, wie
Ausonius in seiner Mosella erklärt, ihre zahlreichen - er selbst
sagt übertreibend sogar ihre unzähligen- Nebenflüsse; dabei präsentiert sich der Autor seinem Leser als Kenner nicht nur der
zehn Namen von Flüßchen und Bächen, die der Mosel zustreben,
sondern auch ihrer landschaftlichen Eigenart und ihrer auffallen-
Die Kaiserthermen von Trier. Rekonstruktion des Zustandes um 320 n. Chr.
81
Kaiserthermen von Trier. Ansicht von Südosten.
den Merkmale. Fünfundzwanzig Verse widmet er diesem
Thema:
Wo aber seh' ich ein Ende des Preislieds auf deine grünblaue
Strömung, ein Ende des Rühmens der Meeresrivalin, der Mosel,
da doch weitum, so hier wie dort, unzählige Flüsse
münden in sie! Ihren Laufvermöchten siefreilich zu dehnen,
aber sie haben es eilig, in dir ihren Namen zu löschen.
Denn durch der Prüm und der Nims Zuflüsse gekräftigt, taucht
eilig
82
auch die Sauer - kein Flüßchen unedleren Jfesens - in deine
Wellen sich ein und bringt dir die eingefangenen Bächlein,
adliger so, mit dir, unter deinem Namen, als wenn sie
ungekannt einmündend den Vater, den Ozean, suchte.
Dir, so rasch sie's vermögen, mit kosenden Wassem zu dienen,
drängen die reißende Kyll, die Ruwer, berühmt durch den
Marmor.
Treffliche Fische beleben die Kyll, in eiligem Kreisen
dreht die Ruwer körnerzermalmende Steine und zieht durch
glatte Marmorblöcke die kreischenden Sägen und läßt von
beiden Gestaden ein unablässiges Lärmen vernehmen.
Ungerühmt laß' ich die winzige Lieser, die schmächtige Drohn
und
will um's gelangweilte Rinnsal der Salm mich nicht weiter
bemühen.
Lang schon ruft mich die rauschende Fülle der schiffbaren
Saar mit
reichem Jfellengewande: lange zog sie den Lauf hin,
bis sie dann müd bei der Kaiserstadt doch ihre Mündung
erreichte.
Nicht geringer als sie streift still durchfette Gebreite
Segen begründend die Eltz vorüber an fruchtreichen Ufern.
Tausend andre- wiejeden stärker der eigene Drangführt
- wollen dir angehören; so stark lebt in eilenden Wassem
Hochsinn oder Charakter.
Zwei Stellen bedürfen eines kurzen Kommentars: Die Ruwer sei
durch den Marmor berühmt, erklärt Ausonius. Das könnte mißverstanden werden, denn an der Ruwer gibt es keinen Marmor;
die Erklärung des scheinbaren Widerspruchs bringen die näch-
Die römische Kaiservilla von Konz (Contionacum). Rekonstruktionsversuch.
83
sten Verse: dort heißt es, die Ruwer drehe "körnerzermalmende
Steine", also Mühlsteine, und ziehe kreischende Sägen durch
"glatte Marmorblöcke"; das kann nur bedeuten, daß es an der
Ruwer Werke oder ein Werk gab, in denen importierte Marmorblöcke mit Marmorsägen, die der Fluß trieb, ftir die Verwendung
bei den Monumentalbauten der Kaiserstadt zurechtgeschnitten
wurden. Die "schiflbare Saar" mündet natürlich nicht unmittelbar bei der Kaiserstadt Tri er in die Mosel, sondern einige Kilometer westlich davon bei Conz ( Contionacum); der Dichter gibt nur
die allgemein bekannte geographische Ortsangabe; es wäre kindisch, ihm pedantisch die Kilometer nachzurechnen.
Mit einem erneuten feierlichen Grußwort an den Moselstrom leitet Ausonius über zum Lob der Menschen der Stadt und des Trevererlandes; sie sind nicht nur furchtlose, tüchtige Soldaten, sie
besitzen auch Kultur, lateinische versteht sich, sprechen ein
gutes, flüssiges Latein. Für Kaiser Valentinian I. bringt der Dichter ein artiges, historisch verbrämtes Kompliment an: Rom, so
sagt er, besitze nicht als einzige einen Cato, nicht nur Athen einen
Aristides, das Muster aller Gerechtigkeit. Die Schmeichelei ist
umso eleganter, als eine plumpe Namensnennung vermieden
wird: der Betroffene wußte sehr wohl, wer gemeint war, und die
Leser brauchten nicht zu rätseln, wem die poethisehe Verbeugung galt:
Mosel, sei mir gegrüßt, hohe Mutter der Früchte und Menschen!
Rühmlicher Adel schmückt dich, eine Jugend erprobt auf dem
Schlachtfeld.
Um die Wette bedacht auf die Kunst der lateinischen Rede.
Das sog. Schulreliefvon Neumagen. Trier, Landesmuseum.
84
Feinere Lebensart und auf heiterer Stirn eine frohe
Denkart hat die Natur deinen f1/egekindern verliehen,
nicht das einzige Rom zeigt rühmend die alten Catonen, und
nicht
Aristides allein steht groß da als Wahrer von Recht und
Billigkeit und verleiht dem alten Athen sein Erstrahlen.
Die Verlockung, sich damit auf ein weites, weitreichendes Thema
einzulassen, weist der Dichter jedoch zurück. Später einmal,
meint er, werde Zeit und Muße kommen, im Ruhestand, procul
negotiis, fern dem Glanz äußerer Ehren, über die Männer des römisch gewordenen Landes der Treverer zu sprechen, angefangen
von den einfachen, friedlichen Bauern bis hin zu den Rechtskundigen, Rednern, Gelehrten. Vorerst jedoch gilt es, das Preisgedicht auf die Mosel, diesen Teppich aus Versen, zu vollenden:
Jetzt aber sei mein Webwerk zu Ende gebracht, das Preislied auf
Männer verschoben.
Laßt uns den glücklichen Fluß besingen, der froh durch die
grünen
Fluren hinabzieht, ihn fromm darbringen den Wellen des
Rheinstroms.
Du aber, Rhein, du breite den tiefblauen Saum und dein grünes
Kleid und bemiß deiner Flut neue Breite, denn Brudergewässer
sollen sie mehren! Ihr Hort aber sind nicht allein ihre Wellen,
sondern ihr Herkommen auch von der hohen Kaiserstadt
Mauem,
wo sie vereint im Triumphzug Sohn und Vater erblickten,
Maske eines Flußgottes, vermutlich
Rhenus (2. Jh. n. Chr.).
Köln.
85
als der Feind am Neckarbesiegt war und bei Lopodunum
und bei der Donauquelle, der Latiums Annalen noch fremden:
Unlängst traf dieser Lorbeer ein des zerschmetterten Krieges,
bald wird er neue, andere bringen. Vereint zieht weiter,
drängt in gedoppeltem Zug zur purpumen Meeiflut hinunter.
Fürchte nicht, prächtiger Rhein, geringer an Größe zu scheinen:
Nichts von Neid weiß dein Gast, dir gehörtfür ewig der Name:
Nimm, deines Ruhmes gewiß, deinen Bruder an dich wie ein
Vater!
Noch einmal findet der Leser hier einen Hinweis auf den Alamannenfeldzug Kaiser Valentinians I. von 368/369, auf den der
Herrscher seinenjungen Sohn Gratian und dessen Erzieher mitnahm. Vom Rheinübergang des Kaisers nahe der Neckarmündung war schon die Rede; der Sieg über die Alamannen bei Lopodunum, den heutigen Ladenburg, wird an dieser Stelle zum
erstenmal erwähnt. Wesentlicher scheint die Tatsache zu sein,
daß in diesem Abgesang des Moselgedichts die erste bekannte lyrische Verherrlichung des Rheinstroms vorliegt. Der Anruf an
ihn: "Nimm deinen Bruderstrom an dich wie ein Vater!" mag
wohl an Goethes herrliche Ode Mahomets Gesang erinnern:
"Bruder, nimm die Brüder mit, mit zu deinem alten Vater, zu dem
ew'gen Ozean!" Doch das humanitäre Pathos der Goethezeit
mußte dem damals sechzigjährigen, in der Tradition der antiken
Kultur stehenden Ausonius fremd sein.
In den Schlußversen seines Gedichts deutet Ausonius die Erwartung an, sein Gedicht werde Leser finden, die den Ruhm des Moselflusses - und natürlich auch den des Dichters der "Mosella"in aller Mund bringen würden:
Wird meinem schlichten Gesang des Beifalls Ehre beschieden,
hält man 's für wert, mit ihm zu vertändeln die Stunden der
Muße,
bist du auf aller Lippen, umschmeichelt von fröhlichen Liedern.
Man sieht, der Dichter versteht es, auf elegante Weise auch mit
sich selbst und seiner Eitelkeit zu kokettieren, ein durchaus liebenswürdiger Zug eines ungewöhnlichen Charakters.
86
Bertold K. Weis
Vom Ende des römischen Köln
Wer vom Rheinufer aus an der Südseite des Römisch-Germanischen Museums zum Domplatz hinaufsteigt, erblickt, eingebettet in eine respektable Treppenanlage, auf einer leicht zum Strom
sich neigenden Schräge verlegt, die dunkle Pflasterung der römischen Hafenstraße. Der Straßenbelag stammt aus dem vierten
Jahrhundert. Als diese Steine verlegt wurden, bestand das römische Köln schon rund dreieinhalb Jahrhunderte: Zunächst als
Oppidum Ubiorum, seit der Mitte des ersten Jahrhunderts
n. Chr. als Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Als Sitz des
Statthalters der Provinz Germania Inferior erlangte die Stadt
schon bald bedeutenden Rang. Die archäologische Forschung
hat den imposanten Statthalterpalast unter dem neuen Rathaus
festgestellt, ausgegraben und als Museum eingerichtet. Vom Zugang zu diesem hat Rudolf Pörtner den effektvollen Titel seines
Buches Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit hergenommen. Wie
ein Symbol des Bürgersinnes und Bürgerstolzes wirkte auch die
fast vier Kilometer lange, an die acht Meter hohe, mit neun Toren
und zweiundzwanzig Türmen ausgestattete Stadtmauer. Diese
Anlage wurde sogleich nach der Erhebung des Oppidum Ubiorum zur römischen Bürgerkolonie begonnen.
Gefahren kriegerischer Verwicklungen im Bereich der Provinz
bedrohten die Stadt nur im Verlauf der zweiten Hälfte des ersten
Jahrhunderts n. Chr., als der Kölner Statthalter, Aulus Vitellius,
sich an seinem Amtssitz zum Kaiser hatte ausrufen lassen. Die
darauf folgenden blutigen Auseinandersetzungen zwischen den
römischen Thronprätendenten verleiteten den Bataverfürsten
Iulius Civilis zur Inszenierung eines Aufstandes, der die römische
Herrschaft am Niederrhein ins Wanken brachte. Die Agrippinenser und die Ubier blieben schließlich unter der Herrschaft der
Römer, Iulius Civilis unterlag, der Bataveraufstand brach zusammen. Diese dramatischen Ereignisse spielten sich im Jahre 69/70
n. Chr. ab; Tacitus hat sie meisterhaft beschrieben.
Von diesem Zeitpunkt an sucht man in der folgenden römischen
Geschichtsschreibung den Namen der Colonia der Agrippinenser für lange Zeit vergebens. Eine fast ungebrochene Friedenszeit
von rund 180 Jahren schuf die Voraussetzungen für ein gesundes
Wachstum der Stadt, für wirtschaftliche Blüte und kulturelles Gedeihen. Wirtschaft und Handel auf den Überlandstraßen und auf
dem Strom brachten der Stadt materiellen Wohlstand; repräsentative Bauten und Denkmäler schmückten sie, Kolonnaden be-
87
Römischer Muschelpokal mit Muscheldarstellungen und
Schlangenfadenmuster
(Anfang 4. Jh.). Köln,
Römisch-Germanisches Mu seum.
Römische Faßkanne
aus schwach grüngelbem Glas (4. Jh.).
gleiteten die Straßenzüge. Zahlreiche Handwerksbetriebe
entstanden, die Kölner Glasfabrikation erreichte ein Niveau, das
auch der heutige Betrachter mit Bewunderung erkennt. Der
Rheinhafen, durch eine vorgelagerte Insel geschützt und bereits
zu Beginn des ersten Jahrhunderts n. Chr. angelegt, diente einerseits den militärischen Zwecken der römischen Rheinflotte,
andererseits auch der rasch sich entwickelnden Handelsschiffahrt
auf dem Strom. Auf der Hafeninsel wurden große Hafenspeicher
gebaut, Zeugnisse des U rnfangs und der Bedeutung der Handelsschiffahrt auf dem Rhein in einer Zeit gedeihlichen Friedens.
Ins Rampenlicht der römischen Weltbühne gelangt Köln wieder
in den unruhigen Jahrzenten des dritten Jahrhunderts n. Chr.
Damals wurde das Imperium im Inneren durch den Zerfall der
militärischen Disziplin, durch die Willkür einer zuchtlos gewordenen Soldateska, durch die atemberaubend rasche Aufeinanderfolge der von den Legionen nach Lust und Laune proklamierten und dann wieder umgebrachten Kaiser, durch wirtschaftlichen Niedergang, durch Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
und durch Geldentwertung erschüttert. An den Schicksalsströmen des römischen Reiches, am Rhein, an der unteren Donau,
am Euphrat, wütete der Ansturm geballter feindlicher Kräfte.
Nur ein gefestigter, geordneter Staat und Herrscher mit der vollen Autorität ihres Amtes hätten sie abwehren können.
Jetzt geriet auch das römische Köln in den Schatten einer Gefährdung, mit der es bis zum Ende der Römerzeit zu leben hatte. Im
Jahre 213 hörte man zum erstenmal den Namen des Stammesverbandes der Alamannen. Die Bedrohung, die von ihnen am
Oberrhein für die römischen Gründungen Basel-Augst, Straßburg, Speyer, Worms und Mainz ausging, stellte sich für Köln und
Xanten am Niederrhein alsbald im Zusammenschluß der fränki-
88
sehen Stämme des rechten Rheinufers dar. Um die Mitte des dritten Jahrhunderts stießen Alamannen bis nach Italien vor. Frankenscharen durchzogen plündernd die Provinzen Galliens und
gelangten auf ihren Raubzügen bis nach Spanien. Gegen 260 fiel
die weit vorgeschobene rechtsrheinische Grenzbefestigung der
Römer, der Limes. Der Zusammenbruch seiner Verteidigungsanlagen zwang die römische Rheinpolitik zum Umdenken: Rom
mußte sich künftig eindeutig auf Abwehr und Abschreckung einrichten. Die zahlreichen römischen Vorstöße der Folgezeit über
den Strom hinweg in rechtsrheinische Gebiete sind ebenfalls im
Sinn einer aktiven Defensive zu verstehen.
Wenig später wurde den Agrippinensern unmittelbar vor Augen
geführt, wie gefährdet in diesen Jahrzehnten auch die Reichseinheit war: Postumus, ein Gallier vornehmer Abkunft, General des
Kaisers Gallienus (253-268), ließ sich in Köln von seinen Soldaten
zum Kaiser ausrufen und Saloninus, einen Sohn des legitimen
Herrschers, der ihm dort in die Hände fiel, töten. Der Usurpator
machte sich zum Herrn eines Sonderreiches im Westen, das die
Provinzen Galliens, Germaniens, Britanniens und Teile Spaniens
umfaßte. Damit war die Stadt der Agrippinenser vom übrigen
Reich losgerissen. Postumus, der sich durchaus als Römer
empfand, residierte teils in Köln, teils in Tri er. Er gründete einen
eigenen Senat, ernannte eigene Provinzstatthalter und griff auch
in die Geldwirtschaft mit eigenen Münzprägungen ein. Man hat
seine Goldmünzen zu den schönsten Prägungen der Antike gerechnet; auf der Vorderseite dieser Münzen erscheint das Porträt des
Postumus, teilweise zusammen mit Hercules; in den Münzlegenden werden die Roma aeterna, die Pax Augusta und der Genius
populi Romani genannt, zum Zeichen daftir, daß Postumus sein
westliches Sonderreich als römisches Reich verstanden wissen
wollte. Auch gegen Postumus, wie gegen die legitimen Kaiser so
oft, trat ein Gegenkaiser auf. Postumus besiegte ihn in einer
Schlacht vor den Toren von Mainz (268). Als er sich weigerte, die
Stadt seinen Soldaten zur Plünderung freizugeben, erschlug ihn
die zuchtlose, beutegierige Soldateska. Das Sonderreich des
Postumus bestand unter schwachen Nachfolgern noch bis zum
Jahr 273 fort. Erst Kaiser Aurelianus (270-275) beendete das
erstaunliche Zwischenspiel, dieses Sinnbild der Zerfallstendenzen im Reich, und stellte die Reichseinheit wieder her. Schon ein
Jahr nach Aurelians Tod brach über die linksrheinischen Gebiete
der Römer ein verheerender Frankensturm herein; er sah auch
ftir die Bewohner Köln bedrohlich aus. Kaiser Probus (276-282)
war es, der die Rheingrenze wieder sicherte; die Frankenjedoch
vermochte er nicht ganz vom linken Rheinufer zu verdrängen.
89
Kaiser Postumus.
Römische Goldmünze,
wahrscheinlich in Köln
geprägt.
Viele wurden als Soldaten in das römische Heer aufgenommen,
andere erhielten Siedlerstellen auflinksrheinischem römischem
Boden.
Eine Politik entschiedener Stärke gegenüber den angriffslustigen
germanischen Völkerschaften leitete Kaiser Konstantin (306337) ein. Um das Jahr 310 ordnete er die Instandsetzung der gesamten Befestigungen am rheinischen Limes an. Köln gegenüber
ließ er auf dem rechten Rheinufer durch Soldaten der XXII. Legion das steinerne Kastell Divitia (Deutz) errichten und die Stadt
der Agrippinenser mit diesem durch eine steinerne Brücke verbinden. Gewiß war der Bau des Kastells eine militärische Maßnahme defensiver Natur; sie sollte der Sicherung der Colonia und
der ftir sie hochwichtigen Rheinschiffahrt dienen. Es ist aberwohl
nicht abwegig, wenn man die Errichtung der Brücke und des befestigten Brückenkopfes auch als Demonstration der Stärke und
des Selbstbehauptungswillens versteht, als Drohgebärde gegenüber der germanischen Völkermasse, die unablässig nach Westen
über den Strom drängte. Diese Interpretation dürfte auch einem
Wesenszug dieses Kaisers entsprechen: seinem Berufungs- und
Sendungsbewußtsein. Für die Stadt Köln bedeuteten die Maßnahmen Konstantins eine Stärkung ihrer Verteidigung. Das Fortbestehen der Gefahr konnte aus dem Bewußtsein der Agrippinenser gleichwohl nicht verdrängt werden.
Was ihnen von den Stämmen des freien Germanien auch in Zukunft drohte, erfuhren die Bürger der Colonia nicht allzu lange
nach dem Tod des bedeutenden Herrschers (337). Seit 350 war
der Konstantinsahn Constantius II. (337-361) nach dem Tod sei-
90
ner beiden Brüder Constans und Constantinus Alleinherrscher
des Reiches. Gegen ihn trat als Gegenkaiser der Franke Silvanus
auf. Seine Usurpation war von Constantius II. selbst und seiner
Hofkamarilla provoziert worden. Durch eine tückische Intrige
von einem Hochverratsprozeß bedroht und der sicheren Hinrichtung gewiß, sah Silvanus keinen anderen Ausweg als den Gegenangriff: Am 11. August 355 ließ er sich in Köln von seinen Soldaten zum Augustus ausrufen. Durch ein infam gesponnenes Komplott wurde ein tückischer Meuchelmord an Silvanus organisiert
und alsbald in die Tat umgesetzt. Der schändlich überlistete Gegenkaiser floh vor seinen Mördern in eine Köln er Kirche; die Verfolger zerrten ihn dort heraus und brachten ihn um. So endete der
erste Franke, der nach der Kaiserwürde gegriffen hatte.
Diese schmählichen Vorgänge bildeten nur ein Vorspiel zu
Schrecknissen, wie sie das römische Köln bis dahin nicht erlebt
hatte. Noch im Herbst des Jahres (355), in dem Silvanus ermordet wurde, überrannten die vereinigten Alamannen und Franken
die Befestigungen der Stadt: zum erstenmal fiel die rumreiche
Colonia Claudia Ara Agrippinensium in die Hände germanischer
Eroberer. Ammianus Marcellinus, lateinisch schreibender Grieche aus Antiocheia am Orontes und bedeutendster Historiker des
vierten Jahrhunderts n. Chr., zugleich auch Augenzeuge der
Ereignisse, widmet dem Fall Kölns einen einzigen lapidaren Satz:
"Die (dem Cäsar) überbrachte Nachricht besagte, daß die Colonia Agrippina, eine Stadt von weitreichender Geltung, von den
Barbaren nach hartnäckiger Belagerung erstürmt und zerstört
worden sei." Die von Ammianus so apodiktisch behauptete Zerstörung darf man nicht so buchstäblich nehmen. Die vereinigten
Scharen der Franken und Alamannen plünderten das eroberte
Köln und richteten sicher auch erhebliche Verwüstungen an. Die
Zerstörung etwa der Stadtmauer zu unternehmen, hätte ihr unruhiges Temperament auf eine zu harte Geduldsprobe gestellt. Die
Stadtmauer blieb stehen. Im folgenden Sommer gelang den Römern die in einem früheren Kapitel erwähnte Rückeroberung der
Stadt. Die germanischen Besatzer dürften sie ohne allzu großes
Bedauern aufgegeben haben: das Leben in einer ummauerten
Stadt war ihrem Naturell zuwider. Das Ende der römischen Herrschaft war mit dieser ersten Eroberung also noch nicht gekommen: Die Colonia Agrippina sollte noch ein volles Jahrhundert,
zuletzt freilich in der Position einer umbrandeten Insel, eine römische Stadt bleiben.
Gegen Ende des vierten Jahrhunderts wurde Köln sogar noch
einmal zu einem Ausfalltor gegen die rechtsrheinischen Franken-
91
stämme. Im Sommer 392 unternahm der Magister militum Arbogast, ein heidnischer Franke im römischen Militärdienst, einen
überfallartigen Angriff auf das Gebiet der Franken jenseits des
Stroms. Er verwüstete es so brutal, daß der Gegner sich ihm nicht
einmal zu stellen wagte. Zusammen mit einem inzwischen in
Köln eingetroffenen, von Arbogast selbst eingesetzten Gegenkaiser, dem ehemaligen Rhetorikprofessor Eugenius aus Rom, setzte er eine so ungeheure Streitmacht auf das rechte Rheinufer
über, daß sich Franken und Alamannen ohne Schwertstreich zur
Erneuerung der früher mit den Römern geschlossenen und bald
gebrochenen Verträge gequemten. Die Agrippinenser durften
aufatmen, noch einmal, aber nicht für lange.
Inzwischen war nach dem Tod des Kaisers Theodosius I. (3 79395) die noch von ihm verfügte Teilung des Reiches zwischen seinen Söhnen Arcadius (383-408) und Honorius (393-423) erfolgt.
Honorius, dem die Westhälfte des Reiches zufiel, war beim Tod
des Vaters ein elfjähriger Knabe. Alle wichtigen Entscheidungen,
vor allem das militärische Kommando über die Armeen des
Westreiches, blieben dem Magister militum Stilicho vorbehalten;
ihn hatte noch Theodosius zum Reichsfeldherrn bestellt. Schon
Stilichos Vater, ein Vandale, also ein Barbar, hatte in römischen
Diensten gestanden.
Eine militärische Notmaßnahme Stilichos besiegelte die Preisgabe und den Zusammenbruch der Rh eingrenze. Damals stand der
Einfall Alarichs und seiner Westgoten in Italien bevor. Um ihn
abwehren zu können, zog Stilicho im Jahre 401 zur Verstärkung
seiner eigenen Armee die römischen Legionen vom Rhein ab.
Der Weg über den Strom nach Westen war künftig für die Germanen offen. Ein weithin sichtbares Signal war im folgenden Jahr
(402) die Verlegung der Präfektur der gallischen Provinzen, die
ihren Sitz bisher in Trier gehabt hatte, nach dem fernen Arles.
Der heilige Hieronymus, der das Land von seinem Trierer Aufenthalt her aus eigener Anschauung kannte, zeichnet wenige Jahre später (um 410) ein bedrückendes Bild der Situation. Gallien,
so berichtet er, sei von unübersehbaren Barbarenscharen überflutet. Von den Alpen bis zu den Pyrenäen, vom Ozean bis an den
Rhein treffe man Quaden, Sarmaten, Alanen, Gepiden, Heruler,
Sachsen, Burgunder und Alamannen an. Feste Städte und Gutshöfe auf dem flachen Land würden von ihnen verwüstet. Das
ehedem großartige Mainz sei von ihnen erobert und zerstört, in
einer Kirche der Stadt seien Tausende von Christen erschlagen
worden - er bezieht sich damit auf einen Überfall, den die Alamannen und ihre Verbündeten im Jahre 406 aufMainz und seine
Bischofskirche verübt hatten. Als verwüstet nennt er neben
92
Worms, Speyer und Straßburg die weit im Westen liegenden
Städte Reims, Amiens, Arras, Tournai.
Es mag wie ein Wunder erscheinen, daß inmitten dieser brandenden, mörderischen Fluten das römische Köln sich noch volle
flinfzig Jahre halten konnte, bis es 456 oder 458 - die Zahlläßt
sich nicht genau fixieren- endlich in die Hände der Franken fiel.
Wer von der römischen Bevölkerung Kraft und Mittel besaß,
machte sich rechtzeitig aus der Stadt davon, um auf einer ebenfalls gefahrliehen Flucht in einem weniger bedrohten Winkel des
zusammenbrechenden Reiches eine fragwürdige Sicherheit zu
suchen.
Vom Los der Zurückgebliebenen, die nicht fliehen konnten oder
wollten, vermittelt uns eine gewisse Vorstellung die zeitgenössische Schilderung eines konkreten Einzelschicksals. Sie findet sich
in einem Brief des Priesters Salvianus von Massalia (Marseille).
Dieser interessante Zeitgenosse der Ereignisse wurde vermutlich
in Köln - andere meinen: in Trier - um 400 geboren und kannte
den Ablauf der Geschehnisse, wie seine Schriften zeigen, ziemlich genau, großenteils als Augenzeuge. In einem etwas gezierten, im Stil der zeitgenössischen Rhetorik abgefaßten Empfehlungsschreiben flir einenjungen Verwandten, dem die Flucht aus
dem besetzten Köln und der Gefangenschaft der Franken gelungen war, gibt er den Adressaten seines Briefes, den Mönchen des
Inselklosters Lerin vor der Küste der Cöte d' Azur, folgenden, hier
etwas gerafft wiedergegebenen und gekürzten Bericht:
"Der junge Mann, den ich euch schicke, war in Köln zusammen
mit seinen Angehörigen in Gefangenschaft geraten. Er hatte bei
seinen Kölner Mitbürgern einen geachteten Namen besessen
und stammt überdies aus einer angesehenen Familie. Ich würde
gern mehr zu seinem Lob sagen, wenn er nicht mein Verwandter
wäre. Ich könnte sonst leicht in den Verdacht des Eigenlobs geraten."
"Seine Mutter, eine ehrenwerte Witwe, mußte er in Köln zurücklassen. Wie ich höre, befindet sich diese Frau nun in einer derartigen Notlage, in so schlimmer Bedürftigkeit, daß sie weder die
Möglichkeit hat, in Köln zu leben noch die Stadt zu verlassen,
weil sie nichts besitzt, was zum Lebensunterhalt oder zur Flucht
dienlich sein könnte. Als einzige Erwerbsquelle bleibt ihr die
Möglichkeit, ihr tägliches Brot als einfache Dienstmagd zu verdienen und sich mit ihrer Hände Arbeit bei den Barbarenfrauen
zu verdingen. Obwohl sie durch Gottes Barmherzigkeit den Ketten der Sklaverei entgangen ist und ihrer Rechtsstellung nach
nicht als Sklavin zu gelten hat, muß sie infolge ihrer Mittellosigkeit doch wie eine Sklavin dienen."
93
Porträt einer Frau aus dem römischen Köln. Römisch-Germanisches Museum in
Köln.
"Diese Frau hat, gewiß zu Recht, angenommen, daß ich mir hier
das Wohlwollen einiger heiliger Männer- damit sind die Mönche
gemeint - gewonnen habe. In der Meinung, daß ich, über meine
tatsächlichen Möglichkeiten hinaus noch weit bedeutendere
besitze, hat mir diese Frau denjungen Mann hergesandt, den ich
euch jetzt schicke, in der Zuversicht, daß auf meine Fürsprache
94
und mein Eintreten hin sich die Wohlgeneigtheit meiner Freunde als Hilfe ftir meinen Verwandten erweisen werde."
Ausall den Verzierungen, aus dem Rankenwerk einer eher künstlichen als kunstvollen Sprache tritt tief beeindruckend Bild und
Schicksal einervom Fall der Stadt überraschten, materiell ruinierten Bürgerin des römischen Köln in den Vordergrund. Man darf
annehmen, daß sie zur grundbesitzenden Schicht gehörte, die
durch die fränkische Landnahme alles verlor. Tragweite und Ausmaß des großen historischen Umschwungs zeichnen sich ab; er
ließ nicht nur, wie in dem von Salvianus geschilderten speziellen
Fall, die bisherigen Herren in Knechtschaft, die Wohlhabenden
im Elend versinken, er hob auch ein hochentwickeltes, in einem
halben Jahrtausend gewachsenes, sorgfältig durchorganisiertes
städtisches Gefüge aus den Angeln. Dazu kommt auch der weltanschauliche Aspekt des Vorgangs: Köln war um die Mitte des
fünften Jahrhunderts eine im ganzen durchaus christliche Stadt,
die fränkischen Eroberer hingegen waren, mindestens vorerst
und noch für einige Zeit, Heiden; die Taufe des Frankenkönigs
Chlodwig I. (482-511) durch den Bischof Remigius von Reims
erfolgte erst vierzig Jahre nach dem Fall Kölns, am Weihnachtsfest des Jahres 498.
Wo vom Ende des römischen Köln gesprochen wird, ist auch die
Frage zu stellen, was mit der Stadt, wie sie die römische Zeit hinterlassen hatte, was mit dem Stadtgehäuse, wie man sie genannt
hat, nach der Eroberung durch die Franken geschah. Die Ergebnisse der archäologischen Forschung zeigen, daß Köln bei der
endgültigen Einnahme durch die Franken unzerstört geblieben
war. Die römische Stadt als architektonische Gestalt blieb auch in
der Folgezeit über Jahrhunderte hinweg erhalten. Man kann dieses Weiterbestehen kaum plastischer, bildhafter beschreiben, als
es Hugo Borger, Direktor des Römisch-Germanischen Museums, in seinem Buch über dieAbbilderdes Himmels in Köln getan hat: "Die römische Stadt Colonia Claudia Ara Agrippinensium stand bis zur karolingischen Zeit unvermindert aufrecht.
Aber längst nicht mehr alle Gebäude waren bewohnt. Manches,
wahrscheinlich das meiste, mag als Ruine gelegen haben, auch
von Büschen zugewuchert gewesen sein, Bäume wuchsen dazwischen. Nur die mächtige Stadtmauer mit ihren Toren und Türmen umzog das Ganze wie eh, und auch die Straßen bestanden
weiter. Im römischen Statthalterpalast residierten die fränkischen Teilkönige, wenn sie nach Köln kamen. Darüber aber, wie
die Menschen in den nachrömischen Jahrhunderten in der Stadt
lebten, welche Häuser sie benutzten und wieviele überhaupt in
ihr lebten, wissen wir fast nichts."
95
Dieses Fast-Nichts-Wissen gilt in ähnlicher Weise auch gegenüber der Frage, was sich in diesem Stadtgehäuse in den ersten
Jahrhunderten nach der fränkischen Eroberung bis hin zum frühen Mittelalter ereignet hat. Bedeutet diese Zeitspanne einen
Bruch, eine historische Pause vollnebelhafter Undurchschaubarkeit? Oder besteht, wie mit beachtenswerten Argumenten erklärt
worden ist, über diese Zeit hinweg eine Kontinuität irgendwelchen Grades in der städtischen Organisation? Hugo Borgers
Schilderung einer still dahindämmernden, nur von schattenhaftem Leben durchgeisterten Ruinenstadt "am Rande der Christenheit" läßt eher an einen epochalen Bruch zwischen dem Ende
des spätantiken und der Entstehung des frühmittelalterlichen
Köln denken.
Wie aber haben die römischen Zeitgenossen der geschichtlichen
Szene den Zusammenbruch der Römerherrschaft am Rhein gesehen? Haben sie versucht, seine Ursachen zu erkennen und zu
definieren? Hier sollte man nochmals zu dem bereits zitierten
Salvianus von Marseiiie zurückkehren; in einem unvollendet
gebliebenen Werk mit dem beziehungsreichen Titel De gubernatione Dei (Vom Weltregiment Gottes) formuliert er seine Antwort
auf die Frage, wieso den heidnischen oder häretischen Barbaren
der Sieg über die christlichen Römer zufallen konnte. Warum hat
der Herr der Welt das zugelassen? Mit weit ausholender Argumentation und scharf gliedernder Rhetorik erklärt er - weithin
auch im Stil eines Bußpredigers - den römischen Zusammenbruch als Gericht Gottes, als gerechte Strafe des Himmels für eine haltlose, unaufrichtige, weltlich orientierte, oberflächliche,
weltanschaulich indifferente, im Grunde unchristliche römische
Christenheit. Nicht weil sie bessere Menschen sind, siegen die
Barbaren, denn ihre menschlichen Qualitäten charakterisiert Salvianus mit durchaus abschätzigen Wertattributen: "Die Sachsen
sind grausam", schreibt er, "die Franken hinterhältig, die Gepiden unmenschlich, die Hunnen unzüchtig; kurzum, die Lebensweiseall dieser Barbarenvölker ist die reine Verderbtheit." Warum sie dennoch Sieger blieben? Salvianus Antwort lautet: Das
moralische Defizit der christlichen Römer, ihre Gier nach banalem, flachen, frivolen, verwerflichen Lebensgenuß trägt die
Schuld an der Katastrophe, sie macht die Christen unfahig, ihre
politische Verantwortung zu bedenken und sich ihr zu stellen.
Leidenschaftlich beklagt sich dieser Schriftsteller darüber, daß
seine christlichen Mitbürger unbedenklich und ungescheut den
immer noch bestehenden, aus der heidnischen Vergangenheit
überkommenen Institutionen traditioneller Volksbelustigungen
96
Gladiatorendarstellung auf einem Grabstein (1. Jh. n. Chr.). Köln, Römisch-Germanisches Museum.
anhängen. Zwei ganze Bücher seines Werkes verwendet er zu einer heftigen Invektive gegen den Fortbestand der Circusspiele,
der mörderischen Fechterspiele und blutigen Tierhetzen in den
Arenen der Amphitheater, der leichtfertigen, anstößigen Schauspieldarbietungen in den szenischen Theatern. Die Lust an diesen Vergnügungen sei so unbändig, erklärt Salvianus, daß sie sogar den Besuch der Gottesdienste an hohen Festtagen beeinträchtige: "An jedem Tag, an dem die mörderischen Spiele stattfmden-mag es auch ein kirchlicher Feiertag sein-, kommen
Menschen, die sich als Christen bezeichnen, nicht zur Kirche. Gehen sie aber, weil sie vom Stattfmden der Spiele nicht unterrichtet
sind, zufällig hinein und hören dort, daß es Spiele gebe, verlassen
sie das Gotteshaus wieder. Man verachtet den Tempel Gottes,
um ins Theater zu laufen. Die Kirche wird leer, der Circus voll!"
Unglaublich grotesk erscheint ihm, "daß diese Übelstände aus
den römischen Städten erst verschwunden sind, seit sie unter
dem Gesetz der Barbaren stehen."
Als Folge dieser Einstellung geißelt der Autor den totalen
Schwund politischen Verantwortungsbewußtseins, der sich
selbst bei den Trägern dieser Verantwortung zeige. Als unrühmliches Beispiel fUhrt er namentlich die Bürgerschaft von Trier an,
deren Repräsentanten nach viermaliger Verwüstung ihrer Stadt
nichts anderes zu unternehmen wußten, als den Kaiser um die
Abhaltung von Circusspielen zu ersuchen. Eifernd schwingt da
97
Salvianus die Geißel seiner Vorwürfe: "Circusspiele, Treverer,
verlangt ihr? Und das nach der Verwüstung, der Eroberung, der
Katastrophe, dem Blutvergießen, dem Gemetzel, der Gefangenschaft, nach der Zerstörung eurer so oft verheerten Stadt? Was ist
beweinenswerter als solcher Unverstand, was mehr zu beklagen
als die Verblendung? Ich bekenne, daß ich euch für die allerunglücklichsten hielt, als euch die Vernichtung widerfuhr; doch ich
muß euch als noch viel unglücklicher ansehen, wenn ihr Circusdarbietungen fordert. Ich meinte nämlich, ihr hättet bei den Zerstörungen nur euer Hab und Gut, euer Vermögen verloren, und
ahnte nicht, daß ihr zugleich auch Verstand und Einsicht verloren
hattet." Und er schließt mit dem Verdammungsurteil: "Da dich
drei Zerstörungen nicht zum Besseren bekehren konnten, hast
du es verdient, bei der vierten vollends unterzugehen."
Salvianus schließt dieser Abrechnung mit denTrieremeinen womöglich noch krasseren Bericht an, den man schlecht auf eine
andere Stadt als auf das römische Köln beziehen kann: "Was aber
geschah in einer nahe gelegenen, fast genau so prächtigen Stadt?
Gab es dort nicht denselben Niedergang der Wirtschaft und Moral? Mit anderen Punkten will ich mich gar nicht befassen; doch
nachdem die beiden in dieser Stadt dominierenden, allgemein
verbreiteten Laster, Geldgier und Trunksucht, alles zerstört hatten, wurde der Alkoholismus zu einer so rasenden Sucht, daß
nicht einmal in dem Augenblick, da der Feind schon in die Stadt
eingedrungen war, sich die Ratsherren von ihrem Zechgelage
erhoben. Damit wollte, wie mir scheint, Gott ihnen klar machen,
warum sie untergehen mußten, weil sie die Lebensweise, durch
die sie ins äußerste Verderben geraten waren, noch in der Stunde
ihres Untergangs praktizierten." Er schließt mit dem Resümee:
"Niemand soll sich einbilden, diese Stadt sei erst am Tage ihres
Falles verloren gegangen; wo solche Dinge geschehen konnten,
war die Stadt schon vor ihrem endgültigen Untergang verloren."
Gewiß ist dies vor allem die Bußpredigt eines empörten Theologen, doch gleichwohl nicht bloße Deklamation. Konkrete Beispiele, von denen er als Augenzeuge berichtet, sind auch historische Dokumente. Es möge erlaubt sein, abschließend noch ein
paar Sätze zu zitieren, in denen der Autor sich selbst als Augenzeuge bekannt: "Ich habe selbst gesehen und miterlebt, wie überall Leichen lagen, Männer und Frauen, nackt, verstümmelt, die
Augen der Mitbürger beleidigend, zerfleischt von Raubvögeln
und Hunden. Der Leichengestank wurde zur Pest für die Lebenden. So wurden auch die Überlebenden vom Schmerz über den
Tod der anderen überwältigt."
Es sind Schreckensbilder aus einer zusammenbrechenden, ein-
98
stürzenden Welt, vor die Salvianus seine Leser führt. Darüber
darf man nicht vergessen, daß es sich unter dem Aspekt der Gesamtgeschichte letztlich doch wieder nur um einen vorübergehenden historischen Augenblick und um eine Epochenwende
mit der ganzen wilden Agressivität der neuen Kräfte handelt. Das
Beispiel der Römergründung Köln zeigt, daß die germanische
Eroberung und das Verschwinden der römischen Administration
nicht zugleich das Auslöschen der römischen Stadtgründungen
auf dem linken Rheinufer bedeutet. Nach dem Zerfall der römischen Herrschaft hinterblieben am Rhein keine völlig ausgestorbenen, für die spätere Nachwelt nur noch archäologisch interessanten, ganz und gar menschenleeren Ruinenstädte, wie man sie
in anderen Provinzen des römischen Reiches kennt. Die rheinischen Römerstädte gewannen ihre Bedeutung schließlich auch
unter den neuen, die Zukunft gestaltenden Herren des Landes.
Nach Jahrhunderten stiegen sie erneut zu glänzenden wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Zentren der Rheinlande auf. Die Namen funkeln: Basel, Straßburg, Speyer, Worms,
Mainz und - vielleicht in überwältigendster Lichtftille - das neue
Köln.
Hinweis:
Die flinfBeiträge von Bertold K. Weis über den "Rhein in römischer Zeit" beruhen
aufflinfVorträgen, die der Verfasser in den Jahren 1981-1983 aufRheinkreuzfahrten der Karawane Studienreisen an Bord von MS "AUSTRIA" gehalten hat.
Kölner Rathausgrabung 1953. Freigelegte Mauern des Statthalterpalastes.
99
Alfred Mi/atz
Der rheinische Königsritt
Friedrichs II. von Hohenstaufen
Im Januar des Jahres 1212 traf unter der Leitung der schwäbischen Ritter Anselm von Justingen und Konrad von Ursberg
eine Gesandtschaft in Palermo ein, um dem König von Sizilien
die deutsche Krone anzubieten und ihn aufzufordern, baldigst
über die Alpen zu kommen und den Wirren im Reich, dessen
Kaiser vom Papst gebannt und exkommuniziert war, ein Ende zu
setzen. Nur der junge König Friedrich, gerade erst siebzehnjährig, schien den wenigen deutschen Fürsten, die die Botschaft
veranlaßt hatten, befähigt, dieser Aufgabe nachzukommen.
Denn er war der einzige Sohn des frühverstorbenen Hohenstaufen-Kaisers Heinrich und der sizilischen Erbtochter Konstanze;
in ihm verkörperte sich der Nimbus seiner beiden Großväter, des
unvergessenen Kaisers Friedrich Barbarossa und des Königs
Roger von Sizilien, den schon die Mitwelt den Großen genannt
hatte. Auf ihn waren alle Hoffnungen der Hohenstaufen-Anhänger gerichtet, die von dem letzten Vertreter dieses Hauses die
Wiederherstellung eines kraftvollen Königtums, mit dem der
Anspruch auf die Kaiserwürde untrennbar verbunden war,
erwarteten.
Doch der König zögerte, da nach dem frühen Tod von Vater und
Mutter seine Macht auf der Insel Sizilien gering und in den süditalienischen Festlandsgebieten noch weniger gefestigt war, er
dann auch seine Gemahlin Konstanze und den gerade erst geborenen Sohn Heinrich in Palermo hätte zurücklassen müssen und
schließlich, weil er unter Menschen aufgewachsen war, die nach
der Schreckensherrschaft seines Vaters allen Grund hatten, die
Deutschen zu hassen und eine neue Verbindung Siziliens mit
dem Reich - und sei es nur in der Form einer Personalunion entschieden ablehnten. Er zögerte auch, denn nur ein Jahr zuvor
hatte der deutsche Kaiser, der Welfe Otto IV., ein Sohn Heinrichs
des Löwen, das sizilische Königreich angegriffen, Apulien erobert und verwüstet und war nur durch den Bann des Papstes, der
um jeden Preis die Vereinigung Siziliens mit dem Reich verhindern wollte, gezwungen worden, vom direkten Angriff auf
Palermo, wo bereits die Galeeren zur Flucht nach Afrika bereitgestanden hatten, abzulassen. Es gab also viele Gründe, dem Ruf
der deutschen Fürsten- und waren die Hohenstaufen-Anhänger
überhaupt in der Mehrheit? - nicht Folge zu leisten.
Trotz all dieser Bedenken entschied sich Friedrich dann doch für
100
den Ritt nach Deutschland. Denn in ihm lebte, sicherlich noch
unbewußt, das alte staufisehe Sendungsbewußtsein weiter, und
er war, nach den Worten des Historikers Ernst Kantorowicz,
"durchdrungen von der Schicksalhaftigkeit des an ihn, den
,letzten Übriggebliebenen', ergangenen Rufes". Er setzte sich
über alle vorgebrachten Bedenken hinweg und sogar über die
Tatsache, daß er zwar die arabische, lateinische, griechische und
provenzalische Sprache ebenso gut beherrschte wie das Volgare
Siziliens, aber kein einziges Wort Deutsch verstand oder sprach.
Und er wußte, die Gegebenheiten klug nutzend, die moralische
Macht des Papsttums, das sein früherer Vormund Innozenz III.
gerade zu höchsten Blüte geführt hatte, hinter sich. So ließ er im
März 1212 seinen noch nicht einjährigen Sohn Heinrich zum
sizilischen König krönen, setzte seine Gemahlin Konstanze zur
Regentin ein, bestätigte in Messina dem Papst vertraglich den
sizilischen Lehensstatus sowie das Konkordat seiner verstorbenen Mutter mit allen Privilegien für die römische Kurie und versicherte Innozenz seiner persönlichen Treue, um dessen Hauptbedingung zu erfüllen, daß Sizilien niemals mit dem Reich vereinigt werden dürfe.
Mit nur wenigen Begleitern schiffte sich der Siebzehnjährige in
Messina ein, um über Rom und die Alpen den langen, abenteuerlichen Weg nach Deutschland zu wagen. Eine knabenhafte
Erscheinung, wie alle Zeitgenossen, die ihm nun begegneten,
berichten, mit langem rötlich-blondem Haar, einer klaren Stirn
und strahlenden Augen, in seiner Person Anmut und Selbstsicherheit vereinigend, umgeben vom märchenhaften Glanz seiner sizilischen Heimat - aber von seinen Gegnern als "Zaunkönig" oder "Pfaffenkönig" verspottet.
Zum Legaten, Begleiter und- sicherlich- als Aufpasser hatte ihm
der Papst den Priester Berard von Castacca, seit 1210 Bischofvon
Bari und ab 1213 Erzbischof von Palermo, bestimmt. Doch das
war der erste folgenschwere Irrtum des Menschenkenners
Innozenz. Denn Berard vertrat keineswegs die päpstlichen
Ansprüche, die auf Oberherrschaft über ein erneuertes Kaisertum gerichtet waren, sondern war und blieb die Zeit seines Lebens, bis nach Friedeichs Tode, der treueste und uneigennützigste Anhänger des Staufers, bei allem Gehorsam gegenüber der
Kirche felsenfest der ordnenden Kraft des Reichsgedankens und
der Sendung seines König-Kaisers vertrauend.
Die Schwierigkeiten, denen Friedeich begegnen sollte, wurden
bereits kurz nach der Abfahrt von Messina spürbar. Welfentreue
pisanisehe Galeeren sperrten die Weiterfahrt nach Rom, so daß
der König schon in Gaeta an Land gehen mußt, um von dort
101
Mitte April die Ewige Stadt zu erreichen. Senat und römisches
Volk empfingen ihn mit allen Ehren, die dem künftigen deutschen König - und das heißt dem designierten Kaiser - gebührten. Im Triumph wurde er zum Papstpalast begleitet. Zum ersten
und einzigen Mal stand nun Friedrich vor seinem früheren Vormund: Innozenz 111., ein Mann in reifen Jahren, schmal und
asketisch, ein Diplomat und eine geborene Herrschernatur, auf
der Höhe der erreichten klerikal-imperialen Machtstellung, der
wie nie zuvor das alleinige Schiedsamt über die Welt erstrebte,
und ihm gegenüber der junge Staufer, auf sich allein gestellt, bar
jeder realen Hilfe, doch erfüllt vom Sendungsbewußtsein seines
Hauses, dazu fest entschlossen und bereit, die Faszination seiner
Erscheinung und Herkunft sowie seine schon in Sizilien bewiesene diplomatisch-taktische Begabung einzusetzen, um in
der verworrenen Welt in neuen Formen das antike Kaisertum
wiederaufzurichten. Ein größerer Gegensatz der Charaktere war
nicht denkbar. Aber nicht der erfahrene Papst, der größte Staatsmann, den die Kirche je hervorgebracht hatte, durchschaute den
Jüngling, sondern allein dieser war sich bewußt, wessen er sich
von seinem Gegenüber zu versehen hatte. Wäre es anders gewesen, dann hätte der mächtige Papst dem mittellosen, militärisch und politisch ohnmächtigen Friedrich noch jetzt die
Weiterfahrt nach Deutschland verweigert und die Weltgeschichte wäre ganz andere Wege gegangen.
Nur wenige Tage dauerte der Aufenthalt in Rom. Auf einer
gemieteten genuesischen Galeere wurde die Fahrt fortgesetzt
und ftihrte, unter Umgehung aller pisanischen Sperren, in die
Hafenstadt am Ligurischen Meer. Hier in Genua ehrten Podesta, Klerus und Volk Friedrich als den zukünftigen Kaiser.
Durch fahnengeschmückte Straßen zog der "Knabe aus Apulien", wie man denjungen König in seltsamer Verkennung seiner
Herkunft nannte, zum Palast der kaisertreuen Adelsfamilie der
Doria, wo er dann zehn Wochen ausharren mußte, bis der weite
Weg durch Oberitalien einigermaßen gesichert schien. Zum
Dank erhielten die Genuesen - sie dachten eben doch nur als
Kaufleute, und eine Hand wäscht die andere -wichtige Handelsprivilegien im sizilischen Reich zugesichert. Erst am 15. Juli
konnte zum gefährlichsten Teil des Deutschlandrittes aufgebrochen werden. Doch bereits in der Lombardei stellten sich die
Welfenfreunde dem nur von einer kleinen Begleitmannschaft,
aber nicht von einem Heer - woher sollte es auch kommen? gefolgtenPuer Apuliaeoder wie die deutschen Staufer-Anhänger
auf die Kunde hin zu jubeln begannen- dem Chint von Pulle in
den Weg. Pavia empfing ihn noch mit höchsten Ehren, aber
102
Mailand, das seine Zerstörung durch Friedrichs Großvater
Barbarossa noch nicht vergessen und schon immer an der Spitze
der reichsfeindlichen Partei gestanden hatte, Lodi und Piacenza
hatten Truppen aufgeboten, um den "Zaunkönig" zu fangen.
Fast wäre er den Mailändern am Lambro in die Hände gefallen.
Als er frühmorgens auf einer Furt den Fluß überqueren wollte,
wurde er durch Verrat von ihnen plötzlich aus dem Hinterhalt
angegriffen. Während des Handgemenges gelang es Friedrich
mit nur ganz wenigen Begleitern, auf einem ungesattelten Pferd
den Fluß zu durchschwimmen und auf der anderen Seite das
sichere staufertreue Cremona zu erreichen. Der größere Teil
seiner pavesischen Schutztruppe geriet in die Hände der Mailänder, doch diese mußten sich mit dem billigen Spott begnügen,
daß der "Pfaffenkönig" seine Hosen im Lambro gewaschen habe.
Weiter ging es über Mantua und Verona durch das Etschtal nach
Trient. Da der welfenfreundliche Graf von Tirol den Brenner
sperrte, mußte über unwegsame Pässe nach Westen ausgewichen
werden, um über das Engactin die Bischofsstadt Chur, die bereits
zum Herzogtum Schwaben gehörte, zu erreichen. Auf Veranlassung des Legaten Berard nahm Bischof Arnold den König
freundlich auf und huldigte als Erster dem Staufenerben in
seinem Stammland. Auch der einflußreiche Abt von St. Gallen
trat auf seine Seite und stellte Begleitmannschaft, so daß sich das
Gefolge jetzt auf dreihundert Mann - eine immer noch kleine
Schar - vergrößerte. Doch auch damit war im Grunde nichts
gewonnen. Denn Boten meldeten, daß der mit Bann und Interdikt belegte, aber trotzdem weit überlegene Kaiser Otto IV. sich
mit einem großen Heer dem Bodensee nähere. In oder bei
Konstanz mußte die Entscheidung fallen. Friedrich stand mit
seinem Gefolge vor den verschlossenen Toren dieser Bischofsstadt, und Otto warteteamanderen Ufer des Sees in Überlingen
auf die Schiffe zur Überfahrt. Seine Köche hatte er bereits nach
Konstanz entsandt, um das Siegesmahl für ihn zu richten. Der
Bischof ließ erkennen, daß er seine Tore nur dem rechtmäßigen
König öffnen werde. Vergebens sprachen der Bischof von Chur
und der Abt von St. Gallen für Friedrich. Da trat schließlich der
päpstliche Legat, Bischof Berard von Bari, hervor und verlas
Innozenz' Bann und Ansetzungsdekret gegen den "ehemaligen
Kaiser Otto". Nun wurden die Tore geöffnet, und Friedrich
konnte in die Stadt einziehen. Um drei Stunden, wie ein Chronist
vermerkt, war der Staufer dem Welfen zuvorgekommen, sonst
hätte er niemals Deutschland gewonnen. In fast grotesker
Umkehr der Dinge hatte sich das Blatt gewendet. Der vorgesehene feierliche Empfang galt nicht mehr Otto, sondern Frie103
drich, das von den Köchen des Kaisers zubereitete Festmahl kam
auf die Tafel des Staufererben. Als der Welfe wenig später mit
glänzendem Gefolge vor den Toren erschien, fand er sie verschlossen und mußte, da sein Heer noch am anderen Ufer stand,
schmählich umkehren. Nun erhoben sich in Schwaben überall
die Staufer-Anhänger, und der Kaiser, vom Oberrhein und dann
auch aus Lothringen vertrieben, konnte seine Kräfte erst wieder
im welfentreuen Köln sammeln. Nur zwei Monate waren für
Friedrich seit dem abenteuerlichen Ausritt aus Genua vergangen, aber sein Wagemut und der friedliche Ausgang der Konstanzer Affare hatten ihre Früchte getragen. An ihm war es nun,
auch die noch abseits stehenden deutschen Fürsten für sich zu
gewinnen.
Noch stand deren überwiegende Mehrheit auf der Seite des exkommunizierten Kaisers, und zu Friedrich bekannten sich bisher
außer den Bischöfen von Chur und Konstanz und den Äbten von
St. Gallen und der Reicherrau nur schwäbische Ritter und sein
Vetter, der Herzog von Lothringen. Allerdings hatte Ottos
moralisches Ansehen inzwischen einen schweren Stoß erhalten.
Um dem sich aus Italien nähernden Friedrich zuvorzukommen
und die Schwaben für sich zu gewinnen, hatte er noch im August
1212 rasch die fünfzehnjährige Beatrix, eine Tochter des vier Jahre
zuvor wegen einer Privatrache von Otto von Wittelsbach ermordeten Stauferkönigs Philipp von Schwaben, geheiratet. Doch
diese war schon wenige Wochen nach der Hochzeit verstorben.
Man sprach von Giftmord und lastete nun auch den gewaltsamen
Tod ihres Vaters, durch den Otto der Weg zur Kaiserkrone
geebnet worden war, diesem an. Beweise dafür gab es nicht und
waren sicherlich auch nicht zu beschaffen. Aber von vielen wurde
zumindest der plötzliche Tod der jungen Frau so kurz nach ihrer
Vermählung mit einem vom Papst Gebannten als Zeichen göttlichen Unwillens angesehen.
Seinen ersten Hoftag hielt Friedrich in Basel. Hier huldigte ihm
auch der schwäbische Hochadel, der sich, anders als die Ritter,
bisher abwartend verhalten hatte. Die mächtigen Grafen von
Habsburg und von Kiburg, sowohl in Schwaben als auch im Elsaß
begütert, schlossen sich ihm an. Und der Bischofvon Straßburg
führte dem jungen, noch nicht gekrönten König fünfhundert
Ritter zu, eine wesentliche Verstärkung seiner Streitmacht. Ganz
Südwestdeutschland war jetzt in seiner Hand und Walther von
der Vogelweide, schon immer ein Parteigänger der Staufer,
konnte jubeln: "Sein junger Leib wurd' mächtig und ward großSeht, wie er wächst! Bald ist er Riesen ein Genoß!"
104
Erstes Siegel Kaiser Friedrichs II. (1212).
Rheinabwärts ging jetzt der Zug nach Hagenau, Mittelpunkt der
staufisch-elsässischen Hausgüter und Lieblingspfalz des Großvaters Barbarossa, die dieser groß und imposant ausgebaut hatte,
mit einer nun leeren Kapelle, in der einst die Reichskleinodien
aufbewahrt worden waren, die der Welfe Otto dann 1208 nach der
Ermordung seines Gegners Philipp von Schwaben, Friedrichs
Onkel, nach Aachen bringen ließ. Hagenau, inmitten herrlicher
Wälder und Jagden gelegen, wurde von nun an auch die Lieblingsresidenz des staufiseben Erben, in der er sich in den acht
Jahren seines ersten Deutschlandaufenthalts, soweit es die
örtlich wechselnden Hoftage erlaubten, zumeist aufhielt.
Der erste deutsche Hoftag wurde sogleich, Anfang Oktober 1212,
nur gut ein halbes Jahr nach dem Aufbruch aus Sizilien, in
Hagenau abgehalten. König Ottokar von Böhmen bekannte sich
hier zu Friedrich und bat um Bestätigung seiner Königswürde.
Politisch entscheidend aber wurde der Übertritt Konrads von
Scharfenberg, des bisherigen Kanzlers Ottos und dessen Vorgängers Philipps von Schwaben. Als Bischof von Speyer erhielt
er aus Friedrichs Hand sogleich auch das Bistum Metz zugesprochen. Zweifellos witterte der ehrgeizige, diplomatisch erfahrene Mann die Erfolgschancen, die sich ihm durch seinen
Wechsel zum jungen König boten, dem er nun flir die nächsten
acht Jahre als loyaler Kanzler weiterdiente. Sofort leitete er, dank
guter Beziehungen zum französischen Hof, Verhandlungen mit
König Philipp August ein, die rasch zum Abschluß eines staufisch-französischen Bündnisses führten. Frankreichs Politik
stand in unüberbrückbarem Gegensatz zu England und war
damit auch gegen die dem englischen Königshaus der Plantage105
nets familiär und politisch verbundenen Welfen gerichtet, also
durchaus von eigenen Interessen bestimmt, deckte sich dadurch
aber genau mit Friedrichs eigenen Zielen. Mitte November 1212
wurde in Vaucouleurs an der Maas, nahe der Bischofsstadt Toul,
bei einem Treffen des Staufers mit dem französischen Kronprinzen, dem späteren Ludwig VIII., das Bündnis besiegelt.
Friedrich versprach, ohne ausdrückliche Zustimmung Frankreichs, keinen Friedensvertrag mit seinem Gegner Otto oder
dessen Onkel Johann von England, der dann unter dem Namen
Johann ohne Land in die Geschichte eingegangen ist, abzuschließen. Als Gegenleistung erhielt er von Philipp August die ftir
damalige Zeiten unerhört hohe Summe von zwanzigtausend
Silbermark, ein Betrag, der nicht wenig zur Gewinnung der noch
immer abwartenden Gruppe deutscher Fürsten beitragen sollte.
Nur drei Monate nach seinem Einzug in Konstanz beherrschte
der Staufererbe den ganzen deutschen Süden außer Bayern, von
Burgund über Lothringen und Schwaben bis nach Böhmen hin.
Diesen Erfolg hatte er ohne Schwertstreich, einzig dank seiner
Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung und seinem diplomatischen
Geschick errungen. Am 5. Dezember 1212 konnte er in Frankfurt
die erste große Fürstenversammlung seiner Anhänger abhalten,
auf der noch einmal Ottos Absetzung und Friedrichs Wahl zum
deutschen König verkündet wurde. Vier Tage später fand in
Mainz die feierliche Krönung statt, allerdings mit provisorischen
Insignien, da die echten in der traditionellen Krönungsstadt
Aachen lagen, wo sich der "ehemalige Kaiser'' Otto mit seinen
Anhängern versammelt hatte.
Wiederholt zog Friedrich nun durch die süddeutschen Lande
und hielt Hoftage in Mainz, Augsburg, Nürnberg, Regensburg
und Koblenz. Er lernte die unterschiedlichen Besitz- und Machtinteressen der deutschen Fürsten kennen, verhandelte mit ihnen
und überzeugte sie durch Selbstbewußtsein und Festigkeit des
Auftretens. Auch die deutsche Sprache war ihm nun nicht mehr
fremd. Die jahrelang unbeaufsichtigt gebliebene Hofkammer
wurde kontrolliert, wobei erhebliche Unterschlagungen des
Rentmeisters Wölffiin von Hagenau zutage traten. Der harte
Eingriff des erst Achtzehnjährigen und die strenge Bestrafung
des Schuldigen fanden überall Beachtung. Für den staufiseben
Hausbesitz in Schwaben und im Elsaß wurde nach dem Vorbild
seines Großvaters Roger von Sizilien eine straff zentralisierte
Eigenverwaltung eingerichtet.
Auf dem Reichstag in Eger- wie Hagenau einst eine Reichspfalz
Barbarossas - wurde am Pfingstsonntag 1213 eine Goldene Bulle
verkündet, die Friedrich als Grundgesetz seiner künftigen Herr-
106
schaft über ganz Deutschland und der Abgrenzung zwischen
Königsgewalt und Fürstenmacht verstanden wissen wollte.
Insbesondere die geistlichen Fürsten erhielten bedeutende
erweiterte Rechte. Der König verzichtete auf das Regalien- und
Spolienrecht und auf seine Einwirkung bei Bischofswahlen.
Auch durften sie in kirchlichen Fragen von nun an direkt an den
Papst appellieren. Diesem, den Friedrich noch als seinen
"Schützer und Wohltäter'' bezeichnete, wurden die bereits von
Otto zugestandenen Territorialrechte in Mittelitalien bestätigt.
Die anwesenden weltlichen Fürsten stimmten zu, lediglich der
mächtige Bayernherzog lehnte ab, gab aber ein Jahr später ebenfalls seine Einwilligung.
In Eger wurde auch der Krieg gegen Otto IV. vorbereitet. Der
Welfe war noch immer Herr am Niederrhein, im Herzogtum
Sachsen und in seinen braunschweigischen Stammgebieten. Im
Herbst 1213 zog dann ein staufisches Heer durch Thüringen auf
Magdeburg zu. Doch Otto wich der Entscheidung aus und zog
sich, nachdem er Thüringen verwüstet hatte, in das uneinnehmbare Braunschweig zurück.
Es ist nun fast wie ein Wunder in dieser an Wundern und Zufällen
so überreichen Zeit der Königsfahrt des jungen Friedrich: die
historische Entscheidung zu seinen Gunsten fiel außerhalb der
Reichsgrenzen, ohne daß er selbst oder seine deutschen Anhänger daran beteiligt waren. Im Frühjahr 1214 griffen die Engländer
den französischen Kronbesitz direkt an, und gleichzeitig zog Otto
mit seinem immer noch starken Heer, das er durch die Truppen
der Herzöge von Brabant und Limburg sowie der Grafen von
Jülich und Kleve erheblich vergrößern konnte, zur Unterstützung seines Onkels Johann über den Niederrhein nach Flandern.
Bei Bouvines in der Nähe von Lilie kam es am 27. Juli 1214 zur
Schlacht: auf der einen Seite König Philipp August mit einem
kleinen, dem Gegner weit unterlegenen Heer, auf der anderen
unter Führung Ottos die gewaltige englisch-welfische Streitmacht. Der Kampf war äußerst blutig. Entgegen allen Erwartungen wurde das Heer Ottos bis auf siebenhundert brabantische
Söldner niedergemetzelt. Er selbst wurde durch einen Lanzenstoß vom Pferde geworfen und mußte auf dem seines Knappen
flüchten. Mit diesem Sieg Philipp Augusts war aber nicht nur
Frankreich gerettet, sondern auch die deutsche Frage entschieden. Als äußeres Zeichen dafür sandte der französische König
seinem Verbündeten Friedrich, der noch an der Mosel stand, die
erbeutete kaiserliche Standarte. Otto mußte in das ihm weiterhin
ergebene Köln fliehen, wo er noch ein Jahr aufKosten der Bürger
107
lebte, während seine brabantische Gemahlin dem Würfelspiel
frönte, ohne ihre Spielschulden bezahlen zu können.
Friedrich kehrte von der Mosel nach Worms zurück und sammelte jetzt ein großes Heer, das von den Chronisten begeistert als
das "größte, das man je gesehen hatte" beschrieben wird. Er
eroberte in der Pfalz die feste Reichsburg Trifels, wo sein Vater
einst den englischen König Richard Löwenherz gefangengehalten hatte. Er überquerte die Maas und bedrohte Brabant, dessen
Herzog, Ottos neuer Schwiegervater, jedoch rechtzeitig kapitulierte und einen Sohn als Geisel stellte. Er besiegte den Herzog
von Limburg sowie die Grafen von Jülich und Kleve. Am 23.
September 1214 stand er vor Aachen. Die Bürger verjagtenOttos
Vogt und hießen Friedrich in ihren Mauern willkommen. Binnen
zweier Monate hatte er den ganzen Nordwesten Deutschlands
für sich gewonnen, in der gleichen Zeit war die welfische Macht
zu einem Nichts geworden.
Im November 1214 hielt er abermals Hoftag in Basel. Nur zwei
Jahre waren seit jenem ersten nach dem Konstanz er Abenteuer
vergangen. Aber alles hatte sich gewandelt. Jetzt drängten sich
Fürsten und Vasallen, ihm zu huldigen. Sogar aus dem fernen
Arelat kamen Prälaten und Grafen, um sich ihre Privilegien
bestätigen zu lassen. Seine Stellung in Deutschland war endgültig gesichert, der königlichen Alleinherrschaft des Staufers
stand nichts mehr im Wege.
In einer zeitgenössischen Chronik heißt es nun: "Die Aachener
schrieben dem König Friedrich, er möge friedlich kommen, da
sie bereit seien, ihn als ihren Herrn aufzunehmen. So geschah es,
Legende zur Karte Seite 109:
I Burg Bolanden
2 Kloster Münsterdreisen
3 Kloster Ramsen
4 Kloster Enkenbach
5 Kloster Odemheim
6 Kloster Marienthal
7 Kloster St. Lambert
8 Burg Falkenstein
9 Burg Lichtenburg
10 Burg Nannenstuol
II Burg Wilenstein
12 Burg Hohenecken
13 Burg Beilstein
14 Burg Weidenthai
15 Burg Bimstein
16 Burg Anebos
17 Burg Scharfenberg
108
18 Kloster Eußerthal, BurgRamberg
19 Burg Gutenburg
20 Burg Landeck, Kloster Klingenmünster
21 Burg Neukastell
22 Burg Alt-Scharfeneck
23 Burg Wachtenburg
24 Burg Madenburg
25 Burg Meistersei
26 Burg Kästenburg
27 Kloster Limburg
28 Burg Hardenburg
29 Burg Alt-Leiningen
30 Burg Wegeinburg
31 Burg Herwartstein
32 Burg Alt-Dahn
33 Kloster Hornbach
DIE STAUFER
Saarbruck~n
ZWtlßR
l
STAU FISCI-I E.
BURGEN
•
KLÖ&TE.R
•
STÄDTE
l
BURGEN
!
KI.ÖSTER
0
tJ ~~~
CiJ
~
A STÄDTE
IN ANDEREM BES1T2
109
daß der König Friedrich, umgeben von Fürsten und Würdenträgern des Reichs, mit großer Pracht und Herrlichkeit nach
Aachen kam am Vorabend des Festes des heiligen Jakobus."
Soweit der Bericht über diese tatsächlich nur noch formale
Ladung, denn niemand mehr in Deutschland wagte das Recht
des Königs auf Krönung in der Stadt Karls des Großen zu bestreiten.
Anfang Juli 1215 machte sich Friedrich auf den traditionellen
Königsweg. Zu Schiff ging es zuerst den Rhein abwärts, an den
Bischofsstädten Speyer und Worms vorbei, dessen Herren zu
seinen ersten Huldigern gehört hatten, vorbei an Mainz, dessen
früherer Erzbischof Christian lange Zeit Kanzler, Feldherr,
Berater und persönlicher Freund des Großvaters Barbarossa
gewesen war und die Ehe von Friedrichs Eltern gestiftet hatte,
vorbei an Koblenz und den vielen Zollburgen im mittleren Flußgebiet bis hin nach Sinzig, um auf dem dortigen Königsgut letzte
Rast zu halten. Dann ging es zu Pferd quer durch die Eifel, über
die Tomburg, die als Burg der Pfalzgrafen lange Zeit die Reichsinsignien beherbergt hatte, zum Kloster Kornelimünster vor den
Toren Aachens. Hier ordnete sich das Gefolge zum feierlichen
Einzug in die Krönungsstadt Die frühere provisorische Krönung
in Mainz war vergessen, nur die rechtmäßige in der Pfalzkirche
Karls des Großen, des Erneuerers der abendländischen Reichsidee, zählte. Als dann Erzbischof Siegfried von Mainz als päpstlicher Legat am 25. Juli 1215 Friedrich am Altar salbte, ihm die
Krone Deutschlands auf das Haupt setzte und Zepter, Schwert
und heilige Lanze übergab, wußte dieser, daß er als nunmehriger
deutscher und römischer König das unwiderrufbare Recht erworben hatte, in Rom vom Papst selbst zum Kaiser gekrönt zu
werden und den vollen Titel "Romanorum Imperator et Semper
Augustus" zu führen.
Welche Gedanken mögen den Zwanzigjährigen im Augenblick
der Salbung inmitten allen mystischen Gepränges der Krönung
bewegt haben, als er dann, auf dem Marmorthron Karls des
Großen sitzend, die Huldigung aller weltlichen und geistlichen
Großen des Reiches entgegennahm? Der Knabe, der in seiner
elternlosen Kindheit bitterste Not gelitten hatte und, mißhandelt
von den rauhen Soldaten des kaiserlichen Statthalters Markward
von Anweiler, auf die Mildtätigkeit der Bürger von Palermo
angewiesen gewesen war, der junge sizilianische König, der beinahe vor den Invasionstruppen des Welfen Otto aus seinem Land
hätte fliehen müssen und sich dann heimlich, unter ständiger
Gefärdung des Lebens, nach Deutschland aufgemacht hatte, um
das Erbe des Großvaters und Vaters anzutreten, war nun ohne
110
Bürgerkrieg, fast ohne jeden Waffengang, so als hätte sich alles
von selbst gefügt, der gesalbte und gekrönte deutsche und
römische König, Herr des Reiches, Erneuerer des Kaisertums.
Als Bekräftigung der Tradition, in die er sich bewußt stellte, ließ
er am Tage nach der Krönung die Gebeine Kaiser Karls erheben
und in einen neuen prachtvollen Schrein betten, der in Gold und
Silber gearbeitet war und die Bildnisse aller deutschen Kaiser bis
zu Friedrich selbst in erhabener Reliefarbeit trug. Der Chronist
berichtet, daß Friedrich den schweren Krönungsmantel aus dem
Schatz seines Großvaters Roger, der heute noch in der Wiener
Schatzkammer gezeigt wird, ablegte, einen Hammer nahm und
selbst "vor den Augen aller Anwesenden zusammen mit dem
Meister die Nägel des Schreins" festschlug.
Vergessen war der ehemalige Kaiser Otto, der schon drei Jahre
später, erbittert und erniedrigt, nach selbstauferlegten harten
Bußübungen zur Lösung des Bannes, am 19. Mai 1218 auf der
Harzburg, noch nicht sechsunddreißigjährig, einsam starb.
Noch fünf Jahre nach der Aachener Krönung blieb Friedrich in
Deutschland, schlichtend, ordnend und die königliche Macht
festigend, bis er im August 1220 vom Augsburger Lechfeld nach
Italien aufbrechen konnte, um am 22. November 1220 in Rom
von Papst Honorius 111., dem Nachfolger des bereits 1216 verstorbenen großen Innozenz, zum Kaiser gekrönt zu werden. Als
stupor mundi, das Staunen der Welt, und immutator mirabilis,
wundersamer Verwandler, wie die Zeitgenossen ihn nennen
sollten, trat er nun in den gewaltigen Endkampf zwischen geistlichem Machtanspruch und weltlichem Kaisertum, zwischen
Papst und Reich, ein, der ihn zu großen Triumphen und einsamen Höhen führen sollte, an dessen Ende aber, nach seinem
Tode 1250, die Niederlage beider Gewalten stand, das Papsttum
in die babylonische Gefangenschaft ging und das allumfassende
Reich sich in Nationalstaaten und Territorien auflöste. Er war der
größte, aber auch der letzte abendländische Kaiser.
111
DIE KARAWANE
wird von der Gesellschaft ftir Länder- und Völkerkunde herausgegeben.
Redaktion Peter Albrecht Die Zeitschrift erscheint viermal jährlich, die
vorliegende Nummer 2/3-1984 kostet ftir Einzelbezieher DM 12,50. Jahresabonnement ftir 4 Nummern DM 25,-. An die Mitglieder der Gesellschaft
ftir Länder- und Völkerkunde erfolgt die Auslieferung kostenlos.
Bildnachweis:
Peter Al brecht: Titelbild, S. 5, 6, 12, 40, 78; Kalender 1984 Krusedruck Philippsburg, Blatt März: S. 8; Hans-Jürgen Imiela, Max Slevogt, Verlag G.
Braun, Karlsruhe 1968: S. 11; Landesbildstelle Koblenz: S. 13; Köln er Dombild-Kalender 1984, Verlag Kölner Dom: S. 16; Hugo Borger, Das RömischGermanische Museum Köln, Verlag Georg D. W Callwey München, 1977:
S.17, 28, 88, 94, 97; RudolfLaur-Belart, Führer durch Augusta Raurica, Basel
1978: S. 20, 21; Rheinisches Landesmuseum Bonn: S. 22; Otto Doppelfeld,
Der Rhein und die Römer, Greven Verlag, Köln 1974: S. 26, 27, 33, 79; Verkehrsamt der Stadt Köln: S. 30; Mainz, Geschichte und Entwicklung (Stadtführer), 1967: S. 31; Mittelrheinisches Landesmuseum, Mainz: S. 34; Die
Römer in Baden-Württemberg, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart und Aalen
1976: S. 38, 59, 65; Peter Robert Franke, Römische Kaiserporträts im Münzbild. Aufnahmen von Max Hirmer. Hirmer Verlag München, 1968: S. 41, 43,
67; C.H.V. Sutherland, Münzen der Römer, Ernst Sattenberg Verlag München 1974: S. 48, 70, 90; Otto Paul Wenger, Römische Kaisermünzen, Hallwag
Verlag Bern und Stuttgart, 1975: S. 49; Harald Busch/Gottfried Edelmann/
Willy Zschietzmann, Römische Kunst, Umschau Verlag Frankfurt am
Main, 1968: S. 30, 54; Wolfgang Fritz Volbach/Max Hirmer, Frühchristliche
Kunst, Hirmer Verlag München, 1958: S. 56; Berlin, Staatliche Museen
Preußischer Kulturbesitz, Antikenabteilung: S. 58; Römer am Rhein. Ausstellungskatalog des Römisch-Germanischen Museums Köln, Kunsthalle
Köln, 2. Aufl. 1967: S. 63; Die Römer an Mosel und Saar, Ausstellungskatalog, Verlag Philipp von Zabern Mainz, 1983: S. 68, 81, 83, 84; Landesmuseum
Tri er: S. 69, 73, 74, 75, 82; RudolfPörtner, Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit, Econ Verlag Düsseldorf1959: S. 80, 85; Otto Doppelfeld, Vom unterirdischen Köln, Greven Verlag Köln, 1979: S. 99; Archiv Karawane: S. 105, 109.
Früher erschienene Hefte sind zum Teil noch lieferbar. Bitte verlangen Sie
Verlagsprogramm des Karawane-Verlages.
Reiseprogrammefür Studienreisen und Kreuzfahrten bitten wir beim Büro ft.ir
Länder- und Völkerkunde, 7140 Ludwigsburg, Postfach 909, anzufordern.
112
Herbst-Kreuzfahrt mit
MS "Austria"
CD Rheingaugebirge
Der Rhein von
Basel bis Köln
@ Kea.eratuhl
@ Hunsriick
Kaiserdome und Landschaften
rechts und links des Rheins
Reise-Nr. 84/2-R
vom 06. 10. - 13. 10. 1984
Leitung
Dr. Georg Golla (Kulturgesc hichte): Dr. Wolfgang Hauke (Kunstgeschichte): Dr. Bertold K.
Weis (Alte Geschichte). u. a. Änderungen bleiben vorbehalten.
Reiseprogramm
Samstag, 06. 10. Gegen 18.30 Uhr Einschiffung auf
MS .Austria" in Basel. Begrüßung durch den Kapitän,
Abendessen an Bord. Die Anreise nach Basel kann mit Flug
ab den meisten deutschen Flughäfen bzw. ab Wien oder
mit Bus ab Stuttgart erfolgen.
Sonntag, 07. 10. Frühmorgens Abfahrt des Schiffes
MS .Austria" von Basel nach Breisach. an gegen 07.30
Uhr. Vormittags Busausflug über den Rhone-Rhein-Kanal
nach Kolmar im Oberelsaß, Stadtrundfahrt mit Besuch des
ehemaligen Klosters Unterlinden (Kreuzgang. Museum).
der Altstadt mit alten Bürgerhäusern (Kopfhaus, Pfisterhaus) und dem gotischen Martinsmünster, Mittagessen an
Bord. Nachmittags Spaziergang zum Stephansmünster in
Brelsach. in malerischer Lage auf einem den Rhein steil
überragenden Felsen erbaut (Hochaltar, Fresken). Zeit zur
freien Verfügung. Abendessen an Bord. Abend zur frei en
Vertügung. evtl. Gelegenheit zum Besuch eines Weinlokals
im Kaiserstuhl. Ausreise nach Mitternacht.
Montag, 08. 10. Straßburg an gegen 07.30 Uhr. Kurze
Busfahrt zum Altstadtkern von Straßburg. Stadtrundgang
durch die .Königin der Städte" am Oberrhein mit Besuch
des Münsters und Gang durch die Altstadt mit weiteren.
ausgewählten Besichtigungen. Mittagessen an Bord.
Nachmittag zur freien Verfügung in Straßburg. Ausreise
18,30 Uhr. Kreuzfahrt rheinabwärts nach Speyer, an gegen
23.30 Uhr.
Dienstag, 09. 10. Speyer. Vormittags kurzer Spaziergang zum Kaiserdom von Speyer. eingehende Besichtigung. Zeit zur freien Verfügung, Gelegenheit zum B.esuch
des Weinmuseums oder Gang bis zum Torturm .Aitpörtel".
Ausreise 11.45 Uhr. Mittagessen an Bord. Gegen 14.15 Uhr
Ankunft des Schiffes in Worms in der Pfalz. Stadt der
Reichstage im Mittelalter und eine der ältesten Städte
Deutschlands. Nachmittags Rundgang in Worms mit
Besuch des sechstürmigen romanischen Domes. Gegen
19.00 Uhr Abfahrt des Schiffes nach Mainz, Abendessen an
Bord. Mainz an gegen 21.45 Uhr.
c:
•
Herbst-Kreuzfahrt mit
MS "Austria"
Der Rhein von
Basel bis Köln
Kaiserdome und Landschaften
rechts und links des Rheins
Fortsetzung:
Mittwoch, 10. 10. Mainz. Vormittags Stadtrundgang in
Mainz mit Besuch des nahegelegenen Kaiserdomes, des
Gutenberg-Museums sowie Spaziergang durch die Altstadt. Gegen 13.15 Uhr Ausreise von Mainz. Mittagessen an
Bord. Eltville an gegen 14.15 Uhr. Busausflug zum nahegelegenen Kloster Eberbach, Rundgang und Weinprobe.
Am Spätnachmittag Rückfahrt nach Eltville, Zeit zur freien
Verfügung. Ausreise des Schiffes um 19.00 Uhr. Abendessen an Bord. Rüdesheim an gegen 20.00 Uhr. Abends
freier Landgang in Rüdesheim
Donnerstag, 11. 10. Gegen 08.30 Uhr Abfahrt des Schiffes von Rüdesheim, Kreuzfahrt auf der schönsten, burgenreichen Rheinstrecke: Fahrt durch das .Binger Loch",
vorbei am .Mäuseturm" und den Burgen Rheinstein,
Reichenstein, Sooneck, Heimburg und Fürstenberg nach
Bacharach, an gegen 09.30 Uhr. Freier Landgang in
Bacharach, einem über 1000 Jahre alten, malerischen
Städtchen mit turmreicher Stadtmauer, überragt von der
Ruine der gotischen Wernerkapelle und der Burg Stahleck.
Mittagessen an Bord. Nach dem Mittagessen Fortsetzung
der Rheinkreuzfahrt gegen 14.00 Uhr, vorbei an der
Rheinfeste .Pfalz", an romantischen Städtchen und Burgen, dem Loreley-Felsen sowie Koblenz mit dem .Deutschef\ Eck" und der 1\Aoselmündung bis nach Remagen, an
gegen 18.30 Uhr. Ubernachtung in Remagen. Zeit zur
freien Verfügung.
Freitag, 12. 10. Remagen. Vormittags Spaziergang zur
viertürmigen, gotischen Wallfahrtskirche Apollinaris bei
Remagen. Ausreise 11.30 Uhr, Kreuzfahrt vorbei am
Siebengebirge und an Bonn nach Köln, an gegen 14.30
Uhr. Nachmittags Rundgang zum Kölner Dom, dem größten gotischen Bauwerk nördlich der Alpen sowie Besuch
des Römisch-Germanischen Museums (ausgewählte
Besichtigungen). Abendessen an Bord, Abschlußvortrag.
Abend zur freien Verfügung.
Samstag, 13. 10. Köln. Nach dem Frühstück Ausschiffung. Ende der Kreuzfahrt.
Reisepreis: Ab DM 2.130,Ab Basel bis Köln alles eingeschlossen.
Das Schiff MS "Austria"
gehört der deutschen Reederei KD Köln-Düsseldorf AG,
Köln, die seit vielen Jahren für Rheinkreuzfahrten mit komfortablen, gut geführten Schiffen bekannt ist. Das im Jahre
t971 gebaute Rheinschiff hat ein großes Sonnendeck. mit
Deck- und Liegestühlen, die ohne Gebühr zur Verfügung
stehen, einen kleinen Bord laden, Sauna sowie eine große
Lounge auf dem Oberdeck und eine kleine Bar. Das Schiff
hat 2 Kabinendecks mit insgesamt 192 Betten (96 Kabinen),
wovon wir bei unserer Kreuzfahrt jedoch nur etwa 160 Betten
belegen. Alle Kabinen sind Außenkabinen und haben private Dusche und WC, alle Kabinen haben Unterbetten.
Sämtliche Kabinen haben Teppichboden, Schränke und
Radio sowie Klimaanlage (individuell regulierbar). Es kann
in einer Serie gegessen werden - einer der vielen Vorteile
unserer Kreuzfahrten. Eine freundliche Besatzung sorgt für
das Wohl der Gäste, die Verpflegung entspricht einem guten
internationalen Standard. Technische Daten: Länge
104,60 m, Breite 11,60 m, Höhe über Wasser 7,30 m, 2
Schrauben und Bugpropeller, Radar, Sprechfunk, Funktelefon (DA 46 50 38 994 über Fernamt 010), Wechselstrom
220 Volt.
Bitte fordern Sie das ausführliche Einzelprogramm an.
Karawane Studien-Reisen
Postfach 909 · 7140 Ludwigsburg ·Telefon (07141) 83026