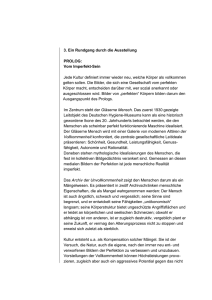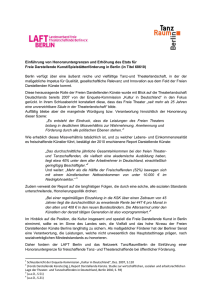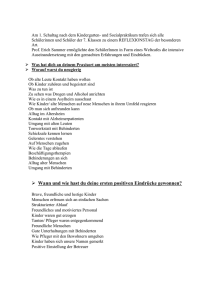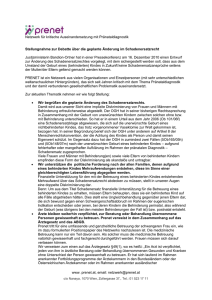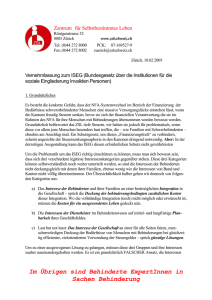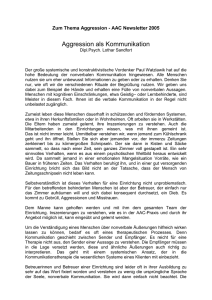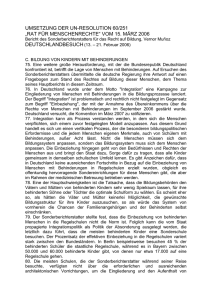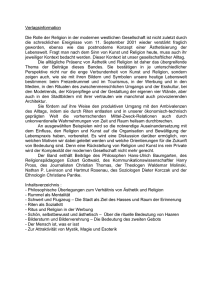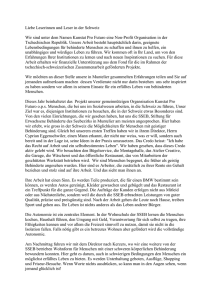Theater für alle, aber nicht von allen? Spannungsfelder und
Werbung

Theater für alle, aber nicht von allen? Spannungsfelder und Perspektiven der Theatervermittlung Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye und Yvonne Schmidt (Bern) Theatervermittlung ist kein einheitlich definierter Begriff. Praktiken, die unter diesem Label laufen sind entsprechend vielfältig und die Grenzen zu Pädagogik, Marketing oder Kunsttheater uneindeutig. Anhand theoretischer Überlegungen von Carmen Mörsch zu den unterschiedlichen Funktionen von Vermittlung wird im Artikel zunächst das Feld der Theatervermittlung abgesteckt. Sodann werden aktuelle Vermittlungsbeispiele aus der Schweiz näher analysiert und auf ihre Spannungsfelder und Potentiale befragt. Gessnerallee Backstage wird dabei als Vermittlungsprojekt mit hauptsächlich reproduktiver Funktion angeführt – es geht dabei vor allem um die Entwicklung neuer Publika. Durch einen Blick auf Theater mit nicht-professionellen Darstellenden wird die Perspektive erweitert. Anhand von Beispielen aus dem Bereich des Theaters mit Behinderten, welches eine grosse Nähe zur sozialen Wirklichkeit aufweist, wird der Vermittlungsdiskurs in einen weiteren Kontext gestellt: Inwiefern kann auch hier von Vermittlung die Rede sein und welche Auswirkungen kann diese Theaterform auf das Theatersystem haben? Es wird konstatiert, dass Vermittlung zuweilen auch die Frage aufwirft, was als legitimes Kunsttheater gelten kann. Vermittlung als wechselseitiger Prozess verstanden kann somit stets die Chance oder das Risiko für die Theaterinstitutionen bergen, sich zu verändern. Läuft der Kunst das Publikum davon? Gibt es vielleicht zu viel, als dass wir uns noch ernsthaft mit ihr auseinandersetzen könnten? Oder hat die Kunst die Öffentlichkeit abgehängt? Auf jeden Fall sieht es ganz so aus, als hätte die Beziehung zwischen Kunst und jenen, für die sie gemacht ist, eine Therapie nötig. Ansätze dazu gibt es unzählige, alle laufen sie unter dem Titel ‘Kulturvermittlung’.1 Pius Knüsel, der Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, diagnostiziert ein Beziehungsproblem zwischen Kunst und Öffentlichkeit, das durch das Wundermittel der Kulturvermittlung geheilt werden könne. Der schillernde Begriff der Kulturvermittlung bietet sich dabei als ideale Projektionsfläche für vielfältige Wünsche und Versprechen unterschiedlicher Akteure an: Kulturvermittlung schützt beispielsweise vor der Überalterung des Publikums, macht fit für die Wissensgesellschaft und ganz nebenbei können dadurch die Subventionen für kulturelle Institutionen legitimiert werden. Der aktuelle Vermittlungsboom – zumindest das verForum Modernes Theater, Bd. 25/1 (2010), 45–63. Gunter Narr Verlag Tübingen mehrte Reden darüber – ist in der Schweiz vor dem Hintergrund des neuen Kulturförderungsgesetzes auf Bundesebene zu verorten.2 Die Pro Helvetia wird darin zur Förderung von Vermittlung beauftragt. Ihre provisorische Vermittlungsdefinition lautet: Unter Kulturvermittlung versteht die Pro Helvetia Aktivitäten, die darauf abzielen, mehr und unterschiedliche Menschen mit Kunst in Berührung zu bringen und der Kunst eine grössere Relevanz im Leben von mehr Menschen zu verschaffen.3 Einerseits wird damit eine quantitative Dimension in den Blick genommen, die auf die Erweiterung und Entwicklung eines Publikums abzielt und einem kulturpolitischen Paradigmenwechsel von der traditionellen Angebotsorientierung hin zur Nachfrageorientierung Rechnung trägt. Andererseits schwingt in der implizierten Frage, inwiefern Kunst für die Gesellschaft relevanter werden kann, eine qualitative Dimension mit. Doch welcher Kunstbegriff ist hier überhaupt im Spiel bzw. steht auf dem Spiel? 46 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Mit Blick auf das zeitgenössische Theaterschaffen4 kann eine Wechselwirkung zwischen künstlerischer Praxis und sozialer Wirklichkeit beobachtet werden: nicht-professionelle Akteure werden auf die Bühnen des Kunsttheaters geholt und Alltagsräume zur Bühne gemacht. Auf unterschiedliche Weise wird in den Bürgerchören eines Volker Lösch, Performance Wettbewerben wie unart oder Inszenierungen im Rahmen der Heimspiel-Initiative verschiedenen Gruppen – häufig solchen, die als marginalisiert markiert sind – auf großen Bühnen hoch institutionalisierter Theater Sichtbarkeit verschafft. Die britische Gruppe Wrights & Sights hingegen will durch die performative Praxis des Gehens im öffentlichen Raum Erkenntnisse generieren und das Theaterhaus Gessnerallee hat sich vorgenommen, Zürich in 12 Installationen, Performances und Rundgängen inmitten der Stadt und in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung zu retten. Durch solche sozialen Kunsttheaterprojekte verschwimmen nicht nur die Grenzen zwischen Theater und Performance, zwischen Theater und Nicht-Theater, sondern auch die lange Zeit als unverrückbar geltenden Grenzen zwischen der Hochkultur des professionellen Theaters und der Soziokultur theaterpädagogischer Arbeit.5 Dieses Spannungsverhältnis zwischen der “Pädagogisierung des Kunsttheaters” einerseits und der “Ästhetisierung des Pädagogischen”6 andererseits geht nicht ohne Grabenkämpfe über die Bühnen. Sobald es um Theater mit nicht-professionellen Darstellenden geht, spielt daher stets die Frage des “Labels” eine wesentliche Rolle, wie Jens Roselt bereits vor einigen Jahren konstatierte: Immer häufiger sieht man (bzw. sehe ich) auf Bühnen Ensembles, die auf Profis ganz verzichten, in denen also Darsteller auftreten, die erkennbar keine körperliche und stimmliche Ausbildung für das Theater haben. Schnell werden diese Ensembles durch die sozialen Gruppen definiert, denen ihre Akteure angehören. Zu denken ist an die Arbeit mit geistig und körperlich Behinderten, das Theater mit Alten, Obdachlosen oder Strafgefangenen. Der Vielfalt an Projekten, Ambitionen, Motivationen und Ergebnissen wird eine solche theoretische Stigmatisierung nicht gerecht.7 Nicht-professionelle Darstellende treten in differenzierten professionellen Kontexten auf. Die von Rimini Protokoll eng gefasste Begriffsdefinition von “Experten des Alltags”8 erscheint deshalb unzureichend, um das Phänomen fernab von Rimini Prokoll zu beschreiben. Während nicht-professionelle Darstellende in Rimini-Produktionen – von Kreuzworträtsel Boxenstopp bis Call Cutta – auf der Skala von Michael Kirby9 tendenziell im Bereich des “Not Acting” angesiedelt sind, sind in avancierten Jugendclubs, Freilichttheater-Produktionen in der Schweiz oder auch im Theater mit behinderten Darstellenden die nicht-professionellen Akteure in einer großen Bandbreite der Darstellung, vom Mitwirken in einem Chor10 bis hin zum komplexen Schauspiel zu erleben. Diese Wechselwirkung zwischen einer Entgrenzung des Kunsttheaters und einer Ästhetisierung des Alltags werfen auf den aktuellen Diskurs der Vermittlung ein anderes Licht. Die Trennungen zwischen Kunst, Vermittlung und Pädagogik werden neu ausgelotet und es stellt sich die Frage, ob der Vermittlungsbegriff auch in anderen Zusammenhängen produktiv gemacht werden könnte, wo er bisher nicht auftaucht. Im Folgenden werden Spannungsfelder, aber auch Perspektiven im Feld der Theatervermittlung aufgezeigt. Aktuelle Vermittlungsdiskurse Aus der Perspektive der Institutionen betrachtet, sind gemäss Carmen Mörsch derzeit vier Diskurse der Kunstvermittlung am Werk: Theater für alle, aber nicht von allen? Der affirmative, reproduktive, dekonstruktive und transformative.11 Sie sind als interdependent zu verstehen und folgen keiner Hierarchie oder chronologisch-historischen Entwicklung. Die Einteilung hilft, um sich einen Überblick im heterogenen Feld der Vermittlung – nicht nur im Bereich von Museen und Ausstellungsinstitutionen – zu verschaffen.12 Im Folgenden orientieren wir uns daher entlang der vier genannten Diskurse, um das spezifische Feld der Theatervermittlung zu skizzieren. Zu den häufigsten Vermittlungsangeboten an institutionalisierten Theatern zählen Einführungen und Publikumsgespräche, die sich an eine bereits interessierte Öffentlichkeit richten. In Einführungen vor Aufführungen werden festgelegte Inhalte von autorisierten Sprechern – in der Regel übernehmen Dramaturgen und Dramaturginnen diese Aufgabe – übermittelt. Die Weitergabe von Wissen ist einseitig; eine Infragestellung der Inhalte ist nicht beabsichtigt. Bei Publikumsgesprächen ist die Interaktion zwar konstitutiver Bestandteil, jedoch ist auch hier meist klar definiert, wer lehrt und wer lernt, wer über Wissen verfügt und wer es entgegennimmt. Diesen Praktiken kann daher eine affirmative Funktion zugeschrieben werden. Eng damit verknüpft sind Vermittlungsangebote mit reproduktiver Funktion. “Der affirmative und der reproduktive Diskurs sind in Bezug auf das von ihnen transportierte Bildungsverständnis beide nicht selbstreflexiv in dem Sinne, dass sie dieses auf seine Machtstrukturen hin befragen.”13 Im Unterschied zum affirmativen Diskurs, bei dem einem Fachpublikum kanonisierte Bildungsinhalte vermittelt werden, steht beim reproduktiven Diskurs allerdings im Fokus, neue Publika zu erschliessen. Unter dem Vorzeichen von Inklusion und Teilhabe werden bisher vom Theater abwesende Öffentlichkeiten anvisiert. In Spielclubs, Workshops oder so genannten Patenklassen kann Theater praktisch erfahren und können vermeintliche Schwellenängste abgebaut werden. Meist richten sich diese handlungsorientierten Angebote an Kinder und Jugendliche, in der Annahme, dass möglichst früh angesetzt werden muss, um ein Publikum von morgen zu gewinnen. Diese reproduktive Funktion ist in kulturpolitischen Argumentationen besonders dominant und wird auch in wissenschaftlichen Publikationen zum Thema hervorgehoben.14 Ein Vermittlungsprojekt, das auf eine Erweiterung des Publikums abzielt, sich aber vor allem an Erwachsene richtet, ist das der Theaterattachés. Es wird derzeit mit Unterstützung der Pro Helvetia an drei Theatern in der Schweiz erprobt – der Comédie de Genève, dem Vorstadttheater Basel und dem Schauspielhaus Zürich – und ist im Museumsbereich bereits etabliert. Die Attachés sind mit dem jeweiligen Theater bekannt und erhalten durch ihre Rolle einen vertieften Einblick in Produktionen des Hauses oder andere sie interessierende Aspekte. In weiterer Folge laden sie eigenständig Gäste ein, um gemeinsam mit ihnen das Theater zu entdecken.15 Im Grunde genommen werden sie dadurch selbst zu Vermittlern oder Multiplikatoren, die dem Theater helfen, in Kontakt mit neuen Publika zu kommen. Je nach Theater werden die Attachés daher auch nach strategischen Gesichtspunkten ausgewählt. So hat das Vorstadttheater Basel bewusst Attachés mit türkischen und kurdischen Migrationshintergrund gesucht, um eine Bevölkerungsgruppe verstärkt anzusprechen, die als abwesend empfunden wird. Aus den spezifischen Zielen der drei Theater erwachsen auch divergierende Umsetzungen. Durch die Attachés sollen am Schauspielhaus Zürich beispielsweise nicht in erster Linie neue Zuschauer, sondern neues Wissen gewonnen werden. Die Attachés werden zu Austauschpartnern des Schauspielhauses, die ihre Bedürfnisse und Wünsche in die Institution einbringen können. Welche Themen beschäftigen sie? Wie wird das Theaterhaus von Aussen wahrgenommen? Ein wechselseitiger 47 48 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Lernprozess wird initiiert: Einerseits erkunden die Attachés das Theater nach ihren Interessen, andererseits wird ihre Stimme in der Institution ernst genommen. Implizite Wissenshierarchien werden aufgehoben und die Möglichkeit zur Veränderung für alle beteiligten Akteure ist gegeben. Dass bei einem solchem Prozess mit Spannungen und Widerständen zu rechnen ist, liegt auf der Hand. Inwiefern die gesteckten Ziele tatsächlich erreicht werden, ist noch nicht erkennbar, da sich das Projekt in Zürich erst in der Konzeptionsphase befindet. In der spezifischen Ausrichtung lässt sich jedoch neben den deutlichen reproduktiven Anteilen, ein transformatives Potential ausmachen. Vermittlungspraktiken mit transformativer Funktion zielen nicht so sehr darauf ab, Öffentlichkeiten an die Institutionen heranzuführen, sondern gehen davon aus, “dass sie selbst – aufgrund ihrer durch lange Isolation und Selbstreferenzialität entstandenen Defizite – an die sie umgebende Welt – z.B. an ihr lokales Umfeld – herangeführt werden müssen”.16 Das Wissen unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure fließt in die Institution ein, die als veränderbar und lernend verstanden wird. Das kann auch Auswirkungen auf den Spielplan haben, wie das Projekt Heimspiel zeigt. Die deutsche Kulturstiftung des Bundes fördert im Rahmen des Heimspiel-Fonds seit 2006 Theaterprojekte an deutschen Stadtund Staatstheatern, “die sich auf künstlerisch herausragende Weise mit der urbanen und sozialen Wirklichkeit der Stadt auseinandersetzen”.17 Durch den Dialog mit der sie umgebenden Wirklichkeit und Bevölkerung sollen die Theater neue Impulse erhalten und sich für andere Publikumsschichten öffnen. Dabei entstehen ganz unterschiedliche künstlerische Arbeits- und Spielformen. So wurden beispielsweise eine Reihe von Projekten mit dokumentarischem Charakter, in denen nicht-professionelle Darstellende bzw. “Experten des Alltags” auftreten realisiert oder der urbane Raum selbst bespielt wird. Bei den Heimspielen vor heimischen Fans wird letztlich eine ganz grundsätzliche Frage aufgeworfen: Welche Rolle können und sollen öffentliche Theater in der Gesellschaft künftig einnehmen? Im wechselseitigen Austausch mit der Öffentlichkeit wird die gesellschaftliche Relevanz von Theater neu verhandelt. Dieser “schleichende Paradigmenwechsel”18 stösst wie eingangs erwähnt auch auf Widerstände, da dabei tradierte Vorstellungen von Hochkultur und künstlerischer Autonomie ins Wanken geraten. Die Aufhebung der Trennlinien zwischen theaterpädagogischer Arbeit und professionellem Theater, zwischen Alltag und Kunst lässt gar die Befürchtung einer “‘Entkunstung’ der Kunst”19 aufkommen. Ob die Initiative des Heimspiel-Fonds nach dem Versiegen der Geldquelle allerdings einen nachhaltigen Einfluss auf die Profile städtischer Theater haben wird, bleibt abzuwarten und ist unter anderem Gegenstand eines bilanzierenden Symposiums, das 2011 in Köln stattfinden wird. Bisher nicht angesprochen wurde die dekonstruktive Vermittlungsfunktion, die im Theater eher selten zu finden ist. Den Institutionen eingeschriebene Machtverhältnisse werden dabei offen gelegt und hinterfragt. Dekonstruktive Vermittlungsformate nehmen oftmals selbst künstlerische Züge an. In performativen Interventionen können beispielsweise Exklusions- und Distinktionsprozesse der Theater verhandelt werden. Ziel ist die Kritik und nicht unbedingt – wie beim transformativen Diskurs angestrebt – die Veränderung der kritisierten Verhältnisse.20 “Fühl dich zu Hause – und dem Theater den Puls!” Bei den “klassischen” Theatervermittlungsformaten wie Einführungen, Publikumsgesprächen oder Workshops war bis anhin selten explizit von Vermittlung die Rede. Theater für alle, aber nicht von allen? Durch die kulturpolitische Aufwertung dieser Praxis und den damit verbundenen Chancen auf Fördergelder, gerät der Begriff jedoch zunehmend auch im Bereich des Theaters im Umlauf.21 Als Golda Eppstein, die schon seit Jahren Theater mit nicht-professionellen Darstellenden macht, mit einem Konzept an das Theaterhaus Gessnerallee Zürich herantrat, war sie zunächst erstaunt, dass alle mit Begeisterung über ihr “Vermittlungsprojekt” sprachen.22 Ihre Praxis hatte sie bis anhin als Theaterpädagogik gekennzeichnet – der Begriff der Kulturvermittlung war ihr lediglich aus der Integrationsarbeit mit Migranten geläufig. Gessnerallee Backstage, das in der Projektskizze als “wilde Mischung von Theatertraining, Aufführungs- und Probenbesuchen und thematischer Auseinandersetzung mit dem Gesehenen”23 umschrieben wird, wurde auch von der Pro Helvetia klar als Vermittlungsprojekt gelabelt und im Rahmen des derzeitigen Förderschwerpunkts Vermittlung mit 10'000 Schweizer Franken unterstützt. Dieses Startkapital war für Golda Eppstein unabdingbar, um das Projekt in der Saison 2008/09 am Theaterhaus Gessnerallee lancieren zu können, da ihr von Seiten der Gessnerallee keine Stelle oder direkte finanzielle Unterstützung gewährt werden konnten.24 Eine Haupteinnahmequelle sind die Mitgliederbeiträge, die daher relativ hoch sind: Der wöchentlich zweistündige Kurs kostet für Erwachsene im Monat 180 Schweizer Franken für Normalverdienende und 150 Schweizer Franken für wenig Verdienende.25 Mit Gessnerallee Backstage möchte Golda Eppstein grundsätzlich theaterinteressierte Menschen erreichen. Nicht nur Menschen, die vorwiegend selber Theaterspielen möchten, sondern auch solche, die angesichts eines breiten und unüberschaubaren Theaterangebots orientierungslos sind. Die eigentlich gerne ins Theater gehen würden, sich aber nicht gut auskennen. Da die meisten Teilnehmenden von Backstage jedoch in erster Linie kommen, um selber Theater zu spielen, muss Golda Eppstein die produktive Verbindung von Spielen und Schauen immer wieder betonen. Denn Backstage will mehr sein als nur ein Theaterkurs: “Als Backstage Mitglied kommst du in den Genuss eines ausgewogenen Menüs, welches ein Theatertraining, Workshops, Begegnungen mit produzierenden Künstlern des Theaterhauses Gessnerallee, Proben- und Aufführungsbesuche beinhaltet.”26 Der Zugang zum zeitgenössischen Theater und Tanz soll in erster Linie über das eigene Spielen erreicht werden. Die praktische Erfahrung steht für die Projektleiterin daher klar im Zentrum. Sie möchte keine theaterpädagogischen Einführungen anbieten, bei denen die Teilnehmenden auf inhaltlicher Ebene an die Aufführungen herangeführt werden. Das wöchentliche Theatertraining richtet sich deshalb thematisch nach den Interessen der Backstage-Mitglieder und ist nicht vom Programm des Theaterhauses Gessnerallee beeinflusst. Bei diesen Trainingskursen wird auf den Prozess des eigenen Theaterspiels fokussiert – Aufführungen vor öffentlichem Publikum werden nicht angestrebt. Das Theaterhaus Gessnerallee hat an dem Projekt Gessnerallee Backstage vor allem die Möglichkeit interessiert, ein neues Publikum zu gewinnen. Bevölkerungsschichten, die bisher noch keinen Kontakt mit dem Theater hatten, sollen durchs eigene Spiel ihre Berührungsängste vor der professionellen Kunst abbauen können. Für Niels Ewerbeck, den Leiter des Theaterhauses Gessnerallee, steht fest, dass lediglich das Publikum der Vermittlung bedarf, nicht die Kunst. Doch die Kunst selbst kann eigentlich darauf verzichten. Denn im Grunde genommen braucht sie keine Vermittlung, wir brauchen sie. Und wir sollten lernen, die Bälle, die uns die Kunst zuwirft, aufzufangen.27 Angesichts eines schwindenden Bildungsbürgertums müsse sich Vermittlung um das 49 50 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Publikum der Zukunft kümmern, ohne dass sich “die” Kunst – hier scheint ein enger Kunstbegriff vorzuherrschen – dafür verändern müsste. Die reproduktive Funktion, die das Projekt für das Theaterhaus Gessnerallee übernehmen kann, wurde auch von der Pro Helvetia erkannt. Die Leiterin der Abteilung Theater der Pro Helvetia, Martha Monstein, hat insbesondere die Frage interessiert, wie Menschen an ein eher experimentelles Theaterprogramm herangeführt werden könnten. Als Pilotprojekt markiert, sollte Backstage hierzu entsprechende Erkenntnisse für die weitere Förder- und Vermittlungspraxis liefern. Die Mitglieder von Gessnerallee Backstage möchten kein neues Publikum generieren. Sie sind gekommen, um Theater zu spielen. Viele berichten von der Schwierigkeit, ein regelmäßiges Angebot auf hohem Niveau für Erwachsene zu finden. Durch die Anbindung an das Theaterhaus Gessnerallee wirkt das Projekt professionell und seriös. Ausserdem ist die Mitgliedschaft zeitlich nicht begrenzt. Die meisten Teilnehmenden haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt ihres Lebens Theater gespielt und haben aus ganz unterschiedlichen Gründen wieder das Bedürfnis danach. Ihre Spielerfahrung korreliert jedoch nicht unbedingt mit häufigen Theaterbesuchen. Eine Problematik, die viele Mitglieder ansprechen, ist, dass sie vor Backstage kaum Leute gekannt hätten, die mit ihnen ins Theater gekommen wären. Vor diesem Hintergrund werden die gemeinsamen Theater- und Probenbesuche sowie Künstlergespräche im Rahmen von Backstage als willkommene, aber nicht unabdingbare Zusätze wahrgenommen. Die Theaterbesuche in der Gruppe erfolgen rund einmal im Monat und werden von Golda Eppstein in Zusammenarbeit mit der Dramaturgie-Abteilung geplant.28 Bevorzugt werden Produktionen, die vor Ort entstehen, da dann die Möglichkeit besteht, schon vorher bei einer Probe dabei zu sein. Allerdings finden Probenbesuche nur selten statt, da die Künstler die Termine kurzfristig wieder absagen oder sich einem Besuch von Anfang an verschließen. Die Teilnehmenden zeigen für dieses Verhalten zwar großes Verständnis, betonen aber auch, wie sehr sie den Austausch schätzen, sofern er denn zustande kommt. Insbesondere Proben zu einem frühen Stadium und nicht erst die Generalprobe können für beide Parteien bei entsprechender Offenheit fruchtbar sein. Publikumsgespräche nach den Vorstellungen finden zwar regelmässig statt, sind jedoch bei den Backstage-Mitgliedern nicht gleichermassen beliebt. Im Unterschied zu den Probenbesuchen fehlt hier der intime Rahmen, da die Gespräche in der Regel öffentlich, d.h. auch für das reguläre Publikum zugänglich sind. Die Problematik der Gespräche liegt in der affirmativen Form: Ein eingeweihtes Publikum redet beispielsweise mit großer Selbstverständlichkeit über die Tradierung von Pathosformeln oder die performative Herstellung von Realitäten. Bei den Backstage-Mitgliedern kommt die Botschaft an, dass sie diese Sprachregister nicht beherrschen und entsprechend fehlt oft der Mut, sich in die Diskussion einzubringen. Wie können inklusive Sprachen für anspruchsvolle Inhalte gefunden werden? Ein erster Schritt läge sicherlich darin, die Problematik zu benennen, sie überhaupt ins Bewusstsein derjenigen zu rücken, die damit Exklusion fördern. Obwohl vordergründig nicht von ihnen beabsichtigt, entdecken die Teilnehmenden durch die gemeinsamen Aufführungsbesuche eine für sie meist unbekannte Theaterform. Sie erhalten dadurch nicht nur Impulse für das eigene Spiel, sondern werden auch zu regelmässigen Gästen des Theaters. Das Ziel der Gewinnung eines neuen Publikums gelingt, denn die meisten Teilnehmenden waren vor Backstage noch nie im Theaterhaus Gessnerallee. So stellt sich die gewünschte Bindung an das Haus her. Jedoch scheint der Theater für alle, aber nicht von allen? Slogan “Fühl dich zu Hause” nur dort zuzutreffen, wo die Bindung über die Theaterbesuche und deren Reflexion hinausgeht. Dies ist beim Backstage-Amateurensemble der Fall, das durch eine eigene Produktion einen Beitrag zum Programm der Gessnerallee leistet. Das Amateurensemble hat sich aus einer Gruppe von Mitgliedern heraus entwikkelt, die irgendwann nicht mehr nur für sich proben, sondern damit auch an die Öffentlichkeit treten wollten. Sie entschieden sich daher eine eigene Produktion unter der Leitung von Golda Eppstein zu entwickeln. Neben dem Spiel ist jeder für einen Bereich nach Wahl wie Technik, Finanzen, Werbung oder ähnliches mitverantwortlich. Dadurch stellt sich auch ein enger Kontakt mit dem Personal des Theaterhauses her. Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Erfahrung im Zuge dieser Zusammenarbeit im Interview folgendermassen: Ich schaue die Gessnerallee manchmal wie ein bisschen Heimat an, also wenn du kommst, fühlst du dich wie ein bisschen zuhause. Weil du ja auch mitmachst. Das Amateurensemble ist den BackstageMitgliedern unter dem Stichwort Ensemblegruppe geläufig. Im offiziellen Sprachgebrauch wird allerdings auf das Präfix “Amateur” wert gelegt. Im Theaterhaus Gessnerallee zeigt man einerseits Verständnis für das Begehren der Gruppe, andererseits scheint man zu fürchten, das eigene Profil könnte verwässern. Eine Abgrenzung zum professionellen Schaffen muss daher klar markiert werden. Dies geschieht nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern auch räumlich, indem die Produktion auf der Probebühne und nicht auf der “großen Bühne” gezeigt wird. Die Aufführungen, die Ende Mai 2010 stattfanden, waren bereits Wochen vorher ausgebucht. Der Gruppe wurde deshalb eine Zusatzvorstellung gewährt. Obwohl der institutionelle Status des Backstage-Ensembles offenkundig nicht be- sonders hoch ist, liegt vielleicht genau in den beobachteten Reibungsprozessen die Möglichkeit zur Entfaltung eines transformativen Potentials. Die Okkupation der Bühnen Parallel zu den skizzierten Vermittlungsbestrebungen der Theaterhäuser findet in theaterpädagogischen Praxen eine zunehmende Professionalisierung und Institutionalisierung statt. Immer häufiger stehen ästhetische Paradigmen des Kunsttheaters im Vordergrund. Diese Projekte, meist unter professioneller künstlerischer Leitung, werden jedoch nicht als “Vermittlung” deklariert, obwohl sie oft ein großes Vermittlungspotential aufweisen. Als Beispiel soll im folgenden Theater mit behinderten Darstellern im Fokus stehen. Stärker noch als in anderen Bereichen des Theaterschaffens mit nicht-professionellen Darstellenden besteht insbesondere in der Theaterpraxis mit geistig Behinderten ein Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Ästhetik. Zudem ist hier eine zunehmende Professionalisierung seit den 1990er Jahren zu beobachten, welche sich u.a. durch eine wachsende Anzahl von Festivals sowie kunstorientierten Projekten äussert. Ist im skizzierten Vermittlungsdiskurs tendenziell die reproduktive Funktion dominant, so entwikkelt sich im kunstorientierten Theaterschaffen mit behinderten Darstellenden durch die zunehmende Professionalisierung ein transformatives Vermittlungspotential auf mehreren Ebenen, welches auf einer wechselseitigen Annäherung von Theaterpädagogik und Theaterkunst basiert. Diese Annäherung zeigt sich auch im umgekehrten Verhältnis von Produkt und Prozess. Im Kunsttheater, in dem in der Regel im Gegensatz zum pädagogischen oder therapeutischen Theater das aufzuführende Produkt im Sinne der “fertigen Inszenierung” als Endziel im Vordergrund steht, spielt der 51 52 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt kreative Prozess, d.h. Probenprozesse oder auch “kollektive Kreativitätsprozesse”,29 eine zunehmend wichtigere Rolle.30 In Lecture Performances, Oral History-Projekten und anderen postdramatischen Theaterformaten sind die Akteure auf der Bühne – unabhängig von ihrer Professionalität – nicht nur Ausführende, sondern eigenverantwortlich am kreativen Prozess beteiligt. Schauspieler inszenieren sich selbst und ihre (Arbeits-) Biografien. Auf den Bühnen der Freien Szene zelebriert beispielsweise She She Pops Vater: Testament die Zur-Schau-Stellung von VaterKind-Verhältnissen,31 nachdem Alvis Hermanis’ dokumentarische Väter-Inszenierung am Zürcher Schauspielhaus und anschliessend auf den Festivalbühnen gefeiert wurde.32 Im institutionalisierten Theater macht Joachim Meyerhoffs Serie Alle Toten fliegen hoch am Wiener Burgtheater von sich reden,33 während insbesondere der zeitgenössische Tanz sowie die Performance-Kunst, von der Andcompany & Co. bis Xavier le Roy, Lecture Performances exerziert. Der Entstehungsprozess wird dabei immer schon mitinszeniert. Ist der Probenraum immer gleichzeitig Erinnerungs- und Gedächtnisraum, wie Annemarie Matzke konstatiert,34 so wird in Formaten mit hohem Anteil an Improvisation erst recht das Verhältnis zwischen den Aggregatzuständen “flüssig” und “fest”35 neu ausgelotet. So ist Theater immer schon Produkt und Prozess zugleich, indem sich flüssige und feste Elemente übereinander blenden. Je höher der Grad der Improvisation während der Aufführung, je lockerer der Inszenierungsrahmen gespannt ist, desto stärker gehen Produkt und Prozess ineinander auf. Die Theaterwissenschaft bezieht, möglicherweise als Konsequenz dieser Aufwertung des Produktionsprozesses, neben der rezeptionsästhetischen Perspektive auf das “fertige” Endprodukt zunehmend auch Proben- und Kreativitätsprozesse in ihre Untersuchungen mit ein und nimmt somit auch die Sicht der Theaterproduzenten in den Blick.36 Indem nicht nur die Regie, sondern auch der Schauspieler in den Fokus rückt und der Diskurs über den Schauspieler um den Diskurs vom Schauspieler über sich selbst erweitert wird, werden Hierarchien aufgebrochen.37 Im “kunstorientierten” Theaterschaffen mit behinderten Darstellern ist anstelle des Prozesses immer mehr das künstlerische Endprodukt in den Vordergrund gerückt. Das Ensemble RambaZamba und das Theater Thikwa in Berlin sowie Theater HORA in Zürich, um nur einige Gruppen im deutschsprachigen Raum zu nennen, arbeiten seit den 90er Jahren unter professionellen Bedingungen mit geistig behinderten Darstellenden, welche durch regelmässige Aufführungspraxis und kontinuierliche stimmliche wie körperliche Trainings unter professioneller Anleitung ihre darstellerischen Fähigkeiten ausbilden. Nicht mehr der (pädagogische oder therapeutische) Prozess, sondern die Aufführung vor einem breiten, kritischen Publikum ist das Ziel. Die Bezeichnungen “Behindertentheater” oder “Zielgruppentheater”, welche eine geschlossene Veranstaltung im privatem Kreis oder sogar den Verzicht auf eine Aufführung implizieren, sind unzutreffend und unter den Theaterschaffenden in diesem Arbeitsfeld verpönt. Diese Akzentverschiebung vom Prozess zum Produkt ist eine Bewegung vom “safe space” der Einrichtungen zum Terrain des “Kunsttheaters”. Theater mit behinderten Darstellenden sucht sich seine Bühne. Doch um in die Spielpläne der institutionalisierten Kunsttheaterszene aufgenommen zu werden, muss sich die Szene selbst institutionalisieren: Durch eine wachsende Anzahl von internationalen Festivals in der deutschsprachigen Theaterlandschaft besetzt diese Szene die mehr oder weniger hoch subventionierten Häuser, so auch in der Schweiz: Vom Theaterhaus Gessnerallee, zum Theater Basel bis zum Schiffbau des Zürcher Schauspielhauses. Während das professionelle Theater im Becken der Theaterpädagogen fischt, Theater für alle, aber nicht von allen? schafft sich das Theater mit behinderten Darstellenden mit unterschiedlichen Strategien auf dessen Bühnen Raum. Dieses institutionelle Transformationspotential und die damit einhergehenden Problematiken zeigt ein Blick auf die Schweizer Festivalszene. Vier Festivals in Basel, Bern, Genf und Zürich zeigen in der Schweiz seit einigen Jahren mit Erfolg Gastspiele “Von solchen und Anderen”.38 Neben zwei kleineren Tanzfestivals in Bern und in Genf wurden zunächst Wildwuchs39 in Basel und dann Okkupation40 in Zürich gegründet. Mit zwei gegensätzlichen Strategien besetzen sie die Bühnen: Als Vorreiter wurde Wildwuchs 2001 in Basel unter der Trägerschaft von örtlichen Vereinen ins Leben gerufen, und ist inzwischen vom lokalen Ereignis in der Kaserne Basel, einem Ort für experimentelle Kunst, zum internationalen Gastspiel-Festival auf den gesamten Stadtraum und dessen Bühnen expandiert. Immer mehr Spielstätten wurden erschlossen, immer mehr Künstler auch ohne Behinderung aus dem Raum Basel beteiligten sich. So vereint Wildwuchs in seiner vierten Auflage 2009 eine vielfältige Bandbreite von nicht-professionellem bis hin zu hoch institutionalisiertem Schaffen in verschiedenen künstlerischen Disziplinen, wobei Kategorisierungen wie “behindert” und “nicht-behindert” überwunden werden. Die NachwuchsPlattform Schaugarten bietet den Gruppen lokaler Freizeit- und Betreuungseinrichtungen die kleine Bühne auf dem Kasernenareal, während in den Theaterhäusern z.B. das koreanische Dance Theatre Chang oder das Flaggschiff dieser Tanzsszene, CandoCo Dance Company, auftreten. Das Festival wächst langsam von innen – mit der Kaserne als Zentrum – nach außen über den ganzen Stadtraum, von Kleinbasel über den Rhein nach Grossbasel. So wurde die Festivalleiterin Sibylle Ott 2009 für dieses Werk mit dem Kulturpreis des Kantons Basel-Stadt ausgezeichnet, worin sich die Anerkennung zeigt. Gastronomiebetriebe, Vereine und Künstler aus Basel gestalten das Festival aktiv mit. In partizipativen Projekten wie der CrossoverPerformance Die schwitzende Löwin riefen die Basler Kult-Frauenband Les Reines Prochaines behinderte und nicht-behinderte Künstler und Künstlerinnen, und jeden, der sich dazu berufen fühlte, dazu auf, mit ihnen eine Performance zu bestreiten. Jeder konnte eine Nummer beisteuern, alles war erlaubt. Theater ohne Grenzen – für alle und von allen. Die Institutionalisierung des Festivals wurde durch die Sponsoren ausgelöst. Bei der dritten Auflage von Wildwuchs 2007 klinkte sich Migros Kulturprozent ein, der grösste private Kulturförderer des Landes. Unabhängig von Wildwuchs hatte man dort das Interesse, eine Plattform zu gründen, um “den Brückenschlag zwischen der Welt des professionellen Tanzschaffens und der Welt von Menschen mit einer Behinderung zu unterstützen”.41 So sind die vier Festivals in Genf, Basel, Bern und Zürich durch die Initiative IntegrART42 von Migros Kulturprozent lose miteinander vernetzt, indem der Sponsor die Schweiz-Tourneen der internationalen TanzCompagnien fördert. Zusammen mit bestehenden örtlichen Theatern und Compagnien entstanden 2007 aufgrund dieser Initiative in Genf das Festival Inside/Outside, in Bern das Community Arts Festival in der Dampfzentrale, die ihren Schwerpunkt auf Tanz legen, sowie Okkupation in Zürich in Kooperation mit dem Theater HORA. Dieses hat seit seinen Anfängen 1989 ein professionelles Theater mit geistig Behinderten in einer eigenen Spielstätte, dem Casinosaal Aussersihl aufgebaut, welches inzwischen als Arbeitsund Ausbildungsstätte anerkannt ist. Sie holten einen erfahrenen Festivalleiter aus Deutschland als künstlerischen Leiter ins Boot, welcher in Deutschland bereits seit Anfang der 1990er Jahre Festivals für Menschen mit und ohne Behinderung veranstaltet. So vernetzt sich die noch immer überschaubare Szene: Von Berlin nach Zürich, über Mainz bis in die pfälzischen Kleinstädte 53 54 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Kaiserslautern und Kirchheimbolanden sind oftmals innerhalb einer Festival-Saison dieselben Künstler und Gruppen zu sehen. Dabei ist im Gegensatz zu Basel in Zürich eine gegenläufige Strategie zu erkennen: Die Okkupation in Zürich verläuft dezentralistisch von außen nach innen und fängt dabei auf den großen Bühnen an. Mit international etablierten Künstlern wie z.B. der Compagnia Pippo Delbono aus Italien, die in ihrem Ensemble neben Obdachlosen, PsychiatriePatienten, Rocksängern, Straßenkünstlern und anderen Menschen mit tendenziell ungewöhnlichen Biografien auch solche mit physischen oder geistigen Behinderungen beschäftigt, oder Mat Fraser & Julie Atlas Muz, die mit polarisierenden Performances mit dem Freakshow-Genre spielen, werden tendenziell etablierte Künstler und Gruppen eingeladen. Okkupation konzentriert sich ausschließlich auf Produktionen aus dem professionellen Bereich, welche abgesehen vom Theater HORA und der Genfer Tanzcompagnie Danse Habile aus dem Ausland kommen. Während in Basel die Kaserne das Festivalzentrum bildet, spielt sich Okkupation an den verschiedenen Spielstätten ab und muss dort mit dem Veranstaltungsangebot konkurrieren. Okkupation sucht die Konfrontation, indem es strategisch die Transformation der Theaterbetriebe erkämpft. Das Konzept fügt sich gut in einen Gastspielbetrieb, wie beispielsweise des Theaterhauses Gessnerallee, dessen sich institutionalisierende und globalisierende Freie Szene sich vom HAU in Berlin, über das FFT in Düsseldorf bis zum Frankfurter Mousonturm tingelt. In Theaterhäusern mit festem Ensemble und Repertoiretheatern ist die nachhaltige Einbindung hingegen schwieriger, da die Produktionsprozesse an die Bedürfnisse behinderter Darstellender angepasst werden müssten. Diese Transformation findet aber (noch) nicht statt. Das Produkt ist zwar kunsttheaterkompatibel, der Prozess jedoch (noch) nicht. Es ist ein Produkt-Prozess-Dilemma. Denn Darsteller mit Behinderung fernab der Festivalzeiten sind selten zu finden. Die Probenzeiten eines Stadttheater-Betriebes sind oft deutlich kürzer, insgesamt werden die Produktionsbedingungen den Bedürfnissen behinderter Menschen nur schwer gerecht. Davon abgesehen, dass die meisten Theater im deutschsprachigen Raum zwar für die Zuschauer, nicht aber für Künstler im Rollstuhl zugängig sind. Zwar hat man erkannt, dass Menschen mit Behinderung als TheaterZuschauer nicht ausgegrenzt werden dürfen. Als Künstler auf der Bühne hingegen sind sie hierzulande wenig präsent.43 Am Werke ist ein Vermittlungsbegriff, der zwar Theater für alle, aber nicht mit allen meint. Aus dieser Problematik resultiert eine Selbstreflexivität, durch welche sich das Theater mit behinderten Darstellenden als Sparte selbst hervorbringt und hinterfragt. Denn eines ist diesen Festivals gemein: Das paradoxe Ziel, dass sie nur existieren, um sich so schnell wie möglich von selbst zu erübrigen, weil Theaterproduktionen mit behinderten Darstellenden selbstverständlicher Bestandteil der Spielpläne etablierter Theaterhäuser werden. Bis dahin bieten die Festivals diesen Theaterprojekten eine Bühne, dienen als Steigbügel, um die etablierten Bühnen zu erklimmen. Dass sich auf dem Weg zu diesem Ziel bereits eine Institutionalisierung und damit die unerwünschte Nebenwirkung der Herausbildung und Manifestierung einer eigenen Sparte vollziehen könnte, zeigt sich auch darin, dass sich vereinzelte Gastspiel-Gruppen nur unter Vorbehalten für die Festivals gewinnen lassen, welche jedoch explizit betonen, keine “Behindertentheater-Festivals” zu sein. Die Namen wie Inside/Ouside, Grenzenlos Kultur oder No Limits sprechen jedoch für sich. Obwohl die Veranstalter bewusst auf die Etikette “Theater mit Behinderten” verzichten, schleicht sich auch in der Berichterstattung in den Medien immer wieder die Bezeichnung “Behindertentheater” ein. Dabei zeigt sich an den Festivals das Unvermögen Theater für alle, aber nicht von allen? eines Konstruktes “Behindertentheater”, welches sämtliche Arten von Behinderungen, sei es körperlich, geistig oder psychisch, unter einem Dach subsumiert.44 Mit anderen Worten: Wieso sollten die Gemeinsamkeiten zwischen einem Gehörlosentheater aus Zürich, dem Theater HORA und den Tiger Lillies größer sein als zwischen beliebigen anderen Theatergruppen und Künstlern? Die sprachliche Stigmatisierung behindert den transformativen Prozess. Die Frage nach dem sprachlichen oder theoretischen Labelling wird akut. Geläufige Bezeichnungen wie “Amateur- oder Laientheater”, ebenso wie der Verweis auf den Hintergrund der Darstellenden, z.B. “Migrantentheater”, “Seniorentheater” oder “Behindertentheater” werden ungenau, wenn die Senioren eines Frankfurter Altenheimes in der Freien Szene des Kunsttheaters mitwirken, Migranten in Volker Löschs Chören auftreten, während gleichzeitig im Kontext des “Behindertentheaters” oder “Laientheaters” professionelle Regisseure am Werk sind und Kooperationen mit der Freien Szene und dem Stadttheater stattfinden. Auch auf der Seite der Kulturförderung sind die Grenzen fließend. Im Hinblick auf das gewählte Beispiel, dem Theater mit behinderten Darstellern, liegt in dieser Problematik ein doppeltes Paradox: Einerseits wurden die Festivals in Basel und Zürich eigens gegründet, um weniger etablierten Künstlern eine Plattform zu bieten. Andererseits ist das Ziel der Anschluss an den “Mainstream”45 einer bestehenden Kunsttheaterszene, welches eine transformative Wirkungsabsicht impliziert. Die daraus erwachsenden Problematiken werden dann im Rahmen der Festivals an Symposien von IntegrART reflektiert: Zuletzt unter dem Motto “All inclusive – Kunst auf neu” wurden in Arbeitsgruppen und Referaten verschiedene Spannungsfelder diskutiert: Der Inklusion und des Zugangs zur Kultur, der ästhetischen Norm und der aktuellen Frage nach Ausbildungsmöglichkeiten und beruflicher An- erkennung für Künstler mit Behinderung. Diese Krisenregulation evoziert gleichzeitig eine Selbstvergewisserung, durch welche sich erst das Selbstverständnis dieser Theaterszene konstituiert. Theater Hora: Menschen! Formen! Innerhalb der Probenprozesse von kunstorientierten Theaterprojekten mit nichtprofessionellen Darstellenden lässt sich ebenfalls ein transformatives Potential feststellen. Immer öfter arbeiten Darstellerinnen mit und ohne Behinderungen in gemeinsamen Produktionen zusammen. Das Projekt Menschen! Formen! von Theater HORA46 greift auf ein heterogenes Ensemble zu: Drei HORA-Ensemblemitglieder, d.h. professionelle Schauspieler mit geistiger Behinderung, vier ProfiSchauspieler ohne Behinderung aus Deutschland und drei geistig behinderte Darsteller ohne Schauspielausbildung aus dem Raum Köln kamen durch ein Casting zusammen.47 In zwei Probenblöcken à sechs Wochen in Köln erarbeiteten sie eine Inszenierung, die im Freien Werkstattheater (FWT) in Köln im Rahmen des Sommerblut Kulturfestivals uraufgeführt, und seitdem in verschiedenen Städten wie Zürich, Bremen und Essen gezeigt wird. Im Blickpunkt stehen die drei Filme Elephant Man von David Lynch, Jeder für sich und Gott gegen alle von Werner Herzog und L’enfant sauvage von François Truffaut, die alle von gesellschaftlichen Aussenseitern und dem Umgang der Gesellschaft mit den Anderen handeln. Auf deren Basis setzte sich die Gruppe mit der Freakshow-Thematik auseinander und entwickelte durch das Mittel der Improvisation die Inszenierung Menschen! Formen!. Die künstlerische Leitung übernahmen der HORA-Leiter Michael Elber, der bereits seit 20 Jahren mit behinderten Darstellenden inszeniert und der Jazz- und Improvisationsmusiker Carl Ludwig Hübsch.48 55 56 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Abb. 1: Das heterogene Ensemble von Menschen! Formen! (v.l.): Freya Flügge, Judith Wilhelmy, Lorraine Meier, Christiane Grieb, Ingmar Krinjar, Peter Keller, Matthias Grandjean, Mirco Monshausen, Nico Randel. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Michael Bause) Alle Beteiligten bringen somit unterschiedlichen Voraussetzungen und Zugänge mit. Mit Unterschieden innerhalb der Gruppe wurde von Anfang an locker umgegangen. “Wir sind alle Schauspieler. Die einen nennen sich 3000er, die anderen 1000er”, erklärt der Darsteller Mirco Monshausen. Wer ein 3000er, wer ein 1000er sei, richte sich nach der Gage. Die Mitglieder des HORA-Ensembles werden von der Schweizerischen Invalidenversicherung bezahlt und können deshalb erwerbsmässig, zumindest 50 Prozent, als Schauspieler arbeiten. Sie verdienen daher lediglich ein Drittel des Monatsgehaltes, müssten aber auch keine Miete zahlen, wie in der Publikumsdiskussion scherzend bemerkt wird. Die Gespräche mit der Regie finden bis zu einem sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt immer im Kollektiv statt, was insbesondere für die nicht-behinderten Schauspieler eine Herausforderung darstellt. Fragen über ihre Funktion und die Aufgabe des Einzelnen innerhalb des künstlerischen Projektes werden akut. “Natürlich kann es passieren, dass der Regisseur rot oder grün verlangt, und die Kollegen liefern lila”, meint eine Darstellerin im Gespräch in einer frühen Probenphase. Vermutlich wird es dann zu großen Teilen an uns liegen, dass am Ende der Theaterabend einen klaren Ablauf hat. Wieviele Markierungen dann fest gesteckt werden und wie viel Improvisation drumherum sein wird, das wird sich sicher mit der Zeit entwickeln. Tatsächlich steht erst in der Schlussphase der Proben das Stück. Die nicht-behinderten Schauspieler müssen lernen, “einfach auf die Bühne zu gehen ohne vorher zu überlegen”. Theater für alle, aber nicht von allen? Nicht nur der Schauspieler, auch der Regisseur hat seine Rolle ein Stück weit an den Nagel gehängt: Für den Regisseur Michael Elber bedeutet diese Art der Theaterarbeit bis zu einem gewissen Grad eine Zurücknahme seiner Funktion. Vielmehr ist er, wie Tim Etchells von Forced Entertainment seine Rolle beschreibt, “Organizer, Framer, Filter” des Geschehens. Die Kontrolle sei unmöglich, sagt er. Stattdessen setze er auf das, was ihm die Darsteller anbieten. “Und da werde ich von den behinderten Darstellern reich beschenkt”. Auf die Frage, wie er ihnen ihre Spielaufgabe vermittelt, entgegnet er: “Es ist unmöglich, ihnen das Stück zu erklären. Aber ich kann darauf bauen, dass sie den Kern, der wichtig ist, kennen aus ihrem Alltag und dadurch verstehen”. Das Verstehen funktioniert durch das Spielen, durch den Vollzug konkreter Handlungen. Fragt man die HORA-Darsteller nach ihrer Rolle im Stück, beginnen sie, zu spielen: “Ich bin der Elephant-Mensch und mein Rücken ist so… und dann so…”. Der HORA-Darsteller Matthias Grandjean demonstriert die Körperhaltung, die er auf der Bühne einnimmt. Dieses Konzept von geteilter Autorschaft in kollektiven Probenprozessen, die in der theaterpädagogischen Praxis Gang und Gebe ist, ist derzeit im Kunsttheater hoch im Kurs. WolfDieter Ernst sieht in der kollektiven Kreativität gar eine Lösung des Paradoxons von Kreativität und Pädagogik, welches er in der Meister-Schüler-Beziehung begründet sieht, in welcher “sich Takt und Kreativität nicht sauber auflösen lassen”.49 Theaterprojekte mit behinderten und nicht-behinderten Darstellenden zeigen aber auch Grenzen des Kollektivitätsgedankens. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern innerhalb von kollektiven Kreativitätsprozessen von Vermittlung die Rede sein kann. Wer wem was vermittelt, ist nicht mehr nachvollziehbar. Durch die Einbindung aller Akteure in den kreativen Prozess ist jedoch tendenziell ein transformatives Potential gegeben, da die Darsteller nicht nur an das Theater herangeführt werden, sondern im Sinne einer geteilten Autorschaft ihre soziale Wirklichkeit in das Theater einbringen. Dabei werden Hierarchien und Arbeitsweisen des Theaters transformiert.50 “Meine Damen und Herren: Ein nackter … ein nackter Mensch! Ein nackter Mensch hier auf der Bühne! Ein geistig behinderter nackter Mensch hier auf der Bühne!” posaunt ein Zirkusdirektor durch einen Schalltrichter. Hinter dem Tüllvorhang erscheint die Silhouette eines Darstellers mit Downsyndrom, nackt und in verkrümmter Haltung zum Publikum. So beginnt die Inszenierung Menschen! Formen!. Die anderen Darsteller umringen ihn, teilweise auf Podesten, alle auf der gleichen Stufe. Etwa eine Stunde später werden sie alle zu Protagonisten einer Freakparade. Ein sehr großer, kahlköpfiger Schauspieler ohne Behinderung neben einer kleinwüchsigen Dame mit Downsyndrom werden als Zwergenmutter und Riesenbaby angepriesen. Die Inszenierung Menschen! Formen! wirft eng gefasste Begriffe von Kunst und Ästhetik auf und richtet sich dekonstruktiv gegen sie. Entstanden ist ein Stück, das die Sichtbarkeit von Behinderung auf der Bühne und die Problematik des Ausgestelltseins selbstreflexiv thematisiert. Wenn Theater vom “safe space” der Einrichtungen in die Kunsttheater-Zone eindringt, ist dies gleichzeitig eine Bewegung in den “public space”. Diese Präsenz von behinderten Menschen, die als soziale Gruppe im Theater als öffentlicher Raum sichtbar wird, ruft die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Ethik hervor. Nicht nur wird die Ästhetik des Kunsttheaters transformiert, indem sie eng gefasste Ästhetikbegriffe hinterfragt und sich in der Freakshow zu einer Ästhetik des Grotesken in ihr Gegenteil verkehrt. Vermittlung wird dann zur Kunst mit dekonstruktiver Funktion, ist gegen Paradigmen der Kunst selbst gerichtet. Das Groteske dient als “Regulationsprinzip innerhalb der 57 58 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Abb. 2: Die Schauspieler Mirco Monshausen, Ilil Land-Boss und Ingmar Skrinjar (v.l.) werden durch Trichter an Armen und Beinen behindert. Die Instrumente dienen als Beschränkung und Erweiterung zugleich. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Michael Bause) ästhetischen Welt”,51 wodurch das Spannungsfeld von Theater und Öffentlichkeit erfahrbar wird. Der Auftritt von Darstellern mit Behinderung evoziert eine der Ästhetik immanente Ethik, die Aistheisis,52 die “eine mit ihrer Konstitution und gesellschaftlichen Ausprägung verbundene Ethik enthält”.53 Aisthesis als Konzept “sinnlicher vermittelter Wahrnehmung als auch im 20. Jahrhundert zu verzeichnende umfassende Ästhetisierung der Alltagswelt”54 impliziert bereits einen wechselseitigen Prozess, welcher über die passive Rezeption hinausgehend als Brücke zum Anderen bzw. zur Welt fungiert. Theater mit behinderten Darstellenden verdeutlicht durch seine Verbindung zur Ethik mehr als andere Theaterformen eine Ästhetik in diesem Sinne, welche durch die Verschränktheit des Körpers mit der Welt, “an der Grenze zwischen Körper und Welt, zwischen Sicht- barem und Unsichtbarem […] erfahrbar”55 wird. Der Körper als “Produkt und Produzent von Gesellschaft”56 sitzt an der Schnittstelle zwischen Theater und Öffentlichkeit. Reaktionen der Öffentlichkeit sind deshalb oft kritisch, wenn behinderte Akteure auf der Bühne in ungewohnten Situationen auftreten. Verhaltenskonventionen, die es z.B. verbieten, über Behinderung zu lachen, werden entlarvt und hinterfragt. Darf man das? – ist schnell die (ethische) Frage. Nach Warstat ist “Gestaltung im therapeutischen Raum […] – idealiter – eine Gestaltung im safe space”.57 Angestrebt werde “eine Liminalität mit möglichst geringem Risiko für die Betroffenen”.58 Bereits das Warm-up bei der Probe mit Atem- und Körperübungen sei ein Schutzmechanismus, um besondere Verletzungen, Gefährdungen und Empfindlichkeiten einzelner Teilnehmer […] Theater für alle, aber nicht von allen? erkennbar [zu machen], so dass der Spielleiter sein Programm gegebenenfalls modifizieren und entschärfen kann. Indem jeder Spieler behutsam an den theatralen Prozess herangeführt wird, sollen Momente der Irritation, der Verunsicherung oder gar des Schocks, wie sie im Kunsttheater des 20. Jahrhunderts immer wieder angestrebt wurden, weitgehend ausgeschlossen werden.59 Inszenierungen wie Menschen! Formen! spielen mit Konventionen, wohl wissend, dass der Kunstraum auch ein öffentlicher ist. Plötzlich tritt Carl Ludwig Hübsch, der auch als Darsteller mitspielt, vor das Publikum: “Sie fragen sich sicher doch schon die ganze Zeit, wer von denen behindert ist und wer nicht?” Der Reihe nach werden die Darsteller an den Pranger gestellt, der Zuschauer wird in die Rolle des Scharfrichters versetzt. Dabei outen sich gleichzeitig zwei Darsteller als schwul, andere vermeintlich “Normale” erweisen sich als “Anormal”. Auch in anderen Szenen wird mit der Visibiliät von Behinderung gespielt. Teile von Blechblasinstrumenten, die als Vehikel des Spiels dienen, kommen als Prothese zum Einsatz, und das in zweifacher Hinsicht: Einerseits werden die nicht-behinderten Schauspieler durch Trichter an Armen und Beinen behindert. Dadurch wird mit Behinderung als ästhetisches Mittel gespielt. Andererseits wird nicht nur mit, sondern auch auf den Instrumenten gespielt. Während die nicht-behinderten Schauspieler im musikalischen Sinne Laien sind, haben die HORAEnsemblemitglieder bereits umfangreiche musikalische Erfahrungen, sind also zumindest semi-professionell. Im Theater als Ereignis kann die Andersartigkeit der Darstellenden aus Sicht der Zuschauer entweder hervorgehoben oder nivelliert werden. Ersteres evoziert eine Existenz im Sinne von “ex-istere”. Dabei spielt nach Goffman die Sichtbarkeit des Stigmas, ebenso wie seine Aufdringlichkeit eine entscheidende Rolle. Die Sichtbarkeit von Behinderung auf der Bühne impliziert dabei eine Teilhabe, die über die Kunst hinausgehend eine gesellschaftliche ist. Das Spannungsfeld zwischen Andersartigkeit und Inklusion in die Gemeinschaft wird auf dem Theater als Brennspiegel verhandelt, indem es die Möglichkeit besitzt, mit ästhetischen Mitteln mit Behinderung umzugehen. Gleichzeitig wird die Schwierigkeit einer Trennung von Theater und sozialer Wirklichkeit und das daraus resultierende transformative Potential von Kunst bewusst. Oder, mit Pius Knüsel gesprochen: Die Öffentlichkeit holt die Kunst wieder ein. Ausblick Versucht man, das aktuelle Feld der Theatervermittlung zu skizzieren, gerät man zunächst mit dem Begriff in Konflikt: Welche Praktiken gehören dazu, welche nicht? Kulturvermittlung umschreibt gemäss Birgit Mandel Aufgaben der Kulturpolitik, des Kulturmanagements und der Kulturpädagogik, denen gemeinsam ist, dass sie Verbindungen herstellen und Durchlässigkeiten schaffen zwischen künstlerischer Produktion und kultureller Rezeption, zwischen Kultur und Gesellschaft, zwischen Kulturinstitutionen und Publikum, zwischen und Kunst und individuellem Rezipienten.60 Das Spektrum ist breit und ergibt sich aus den spezifischen Funktionen, die der Vermittlung zugeschrieben werden. Dabei konnte zunächst festgestellt werden, dass der Diskurs bis anhin stark reproduktiv ausgerichtet ist. So zielen Vermittlungspraktiken in der Regel darauf ab, ein “Publikum der Zukunft” zu gewinnen. Theater – immerhin von allen durch Steuergelder mitfinanziert – soll auch für alle zugänglich sein. Theater mit und von allen ist dagegen nicht unproblematisch und muss besonders gekennzeichnet sein, wie bei dem Amateurensemble des Theaterhauses Gessnerallee deutlich wurde. Die anvisierte 59 60 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt Demokratisierung des Theaters hat demnach nicht unbedingt eine Demokratisierung des Theaterverständnisses zur Folge. Kunst und Vermittlung werden gemeinhin als separate Bereiche betrachtet, wobei zunächst die Kunst da ist und diese in einem weiteren Schritt an ein Publikum vermittelt wird. Vermittlung kann jedoch selbst künstlerische Praxis sein, wie am Beispiel von Theater mit behinderten Darstellenden argumentiert wurde. In kunstorientierten Theaterprojekten mit behinderten Darstellenden, die in der Regel nicht unter dem Label “Vermittlung” laufen und entsprechend auch aus anderen Fördertöpfen gezahlt sind, konnte ein transformatives Potential auf drei Ebenen ausgemacht werden: Erstens institutionell, indem es im Kunsttheater auftreten, in Spielpläne aufgenommen und nicht als eigenes Label betrachtet werden will, zweitens kreativ: indem es in kollektiven Kreativitätsprozessen die Darstellenden am kreativen Prozess beteiligt und damit eine Wechselwirkung zwischen Theater und sozialer Wirklichkeit entsteht, und drittens ästhetisch: indem es die Ästhetik des Kunsttheater hinterfragt, sich dekonstruktiv gegen Kunsttheater richten kann und die Vermittlungsanteile, die jeder Kunst durch die Verbindung zwischen Theater und Öffentlichkeit immanent ist, sichtbar macht. Natürlich sind die angeführten Potentiale nicht generell für Projekte mit behinderten Darstellenden bzw. nicht-professionellen Darstellenden gültig. In Inszenierungen von Volker Lösch oder Rimini Protokoll stellt sich beispielsweise die Frage, welches Demokratieund Emanzipationsverständnis vorherrscht. Werden die Darsteller zu Material degradiert oder ist eine aktive Mitarbeit und Mitbestimmung im Sinne einer geteilten Autorschaft vorgesehen? In Abgrenzung zu solchen Projekten mit partizipativem Charakter scheint sich die Theaterpädagogik für einen enger gefassten Vermittlungsbegriff einzusetzen. Angesichts des Realitätshungers des Gegenwartstheaters warnt etwa die Theaterpädagogin Mira Sack vor zuviel Enthusiasmus. Sie plädiert für einen “pädagogischen Filter”, ohne den Kunstvermittlung nicht auskomme, wenn sie mehr leisten wolle “als nur Stimulans für einen Markt, mehr sein will als nur die Brükke zwischen einem Produkt und seinem Käufer” und kommt zum Schluss: “Vermittlung ohne Pädagogik ist leer, mag einen Bildungsbegriff des Bürgertums bestätigen, taugt aber nicht für den konstruktiven Umgang mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen”.61 Tatsächlich stellt sich die Frage nach einer Notwendigkeit der Pädagogik als Schaltstelle zwischen Kunst und Vermittlung, auch angesichts von erfolgreichen Modellen wie dem bekannten TUSCH-Projekt in Berlin, bei dem Schulen mit Künstlern und Künstlerinnen kooperieren. Ohne die funktionierende Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Künstlern, zwischen Schule und Theater, wären solche Projekte schwer zu realisieren. Wieviel Pädagogik braucht die Vermittlung? Vermittlung ohne Bildungsgedanken ist jedenfalls nicht sinnvoll denkbar. Die Theaterwissenschaft ist erst dabei, das skizzierte Spannungsfeld zwischen Kunsttheater, Vermittlung und Pädagogik zu entdecken. Auch hier werden Abgrenzungsbestrebungen zur Theaterpädagogik laut. Besteht möglicherweise eine Gefahr der Entgrenzung der Theaterwissenschaft, als Folge der Entgrenzung des Kunsttheaters? Nichtsdestotrotz wird nach der Diskussion um Theater mit nicht-professionellen Darstellenden, den “Experten des Alltags”, dem daraus hervorgegangen Authentizitätsdiskurs, welcher die bereits durch das Paradigma der Theatralität und des Performativen eingeleitete Entgrenzung des (Kunst-)Theaters zum Alltag anvisierte, in jüngeren Publikationen die Frage nach Theater als sozialer Kunstform oder auch als kollektiver Prozess62 laut und dabei gleichzeitig hinterfragt.63 Theater für alle, aber nicht von allen? Eine Anbindung des skizzierten Forschungsfeldes an den theaterwissenschaftlichen Diskurs eröffnet spannende Perspektiven, die hier nur angedeutet werden konnten. Der Vermittlungsdiskurs enthält jedoch auch Fallstricke. Schließlich steht die vermeintliche Autonomie der Kunst, auf dem Spiel, althergebrachte Kunstbegriffen müssen neu verhandelt werden. So könnte Vermittlung aus diesem Blickwinkel auch als ein Versuch betrachtet werden, einer sinnentleerten Kunst wieder Inhalt, gesellschaftliche Relevanz zu geben. Der Regisseur Frank Castorf, bekennender RambaZamba-Fan, hat einmal gesagt, das Theater mit Behinderten sei das einzige, das ohne Sinnkrise auskomme. Mit dem Begriff von Vermittlung verhält es sich so wie mit Theater an sich, welches Andreas Kotte als eine opake Kugel beschreibt:64 Je nachdem, aus welcher Position man die Kugel Vermittlung beleuchtet, entsteht ein anderes Bild. 6 7 8 9 10 11 Anmerkungen 1 2 3 4 5 Pius Knüsel. “Beziehungsproblem.” passagen. Kulturmagazin der Pro Helvetia 3 (2009): S. 3. Die Schweizer Bundesverfassung enthält seit 2000 einen Kulturartikel (Artikel 69 BV). Mit dem Kulturförderungsgesetz, das 2012 in Kraft treten wird, soll eine formell-gesetzliche Grundlage zur Umsetzung des Verfassungsauftrags geschaffen werden. Pius Knüsel, “Kulturpolitik und Kulturvermittlung”, Vortrag am Symposium Die Künste zwischen Bildung und Ausbildung am 26.9.2009 an der Hochschule der Künste Bern, S. 6 (unveröffentlichtes Vortragsmanuskript). “Das” zeitgenössische Theaterschaffen ist selbstverständlich ein Konstrukt. An dieser Stelle werden einige Tendenzen vor allem im deutschsprachigen Raum genannt. Ulrike Hentschel. “Übertragen – Übersetzen – Überführen. Drei Modi der Bezugnahme von Theaterpädagogik auf theatrale und gesellschaftliche Wirklichkeiten.” Korrespondenzen. 12 13 14 15 16 17 18 Theater – Ästhetik – Pädagogik. Hg. von Florian Vaßen. Milow, 2010. S. 61. Ulrike Hentschel / Ute Pinkert, “Was tue ich hier und warum?”, Vortrag bei der Ständigen Konferenz Spiel und Theater in Görlitz 2008. Jens Roselt. “Der Schritt vom Wege – Schauspielkunst jenseits der Perfektion.” dramaturgie. Zeitschrift der Dramaturgischen Gesellschaft 1 (2006): S. 32–37. Miriam Dreysse / Florian Malzacher. Experten des Alltags – Das Theater von Rimini Protokoll. Berlin, 2007. Michael Kirby. A Formalist Theatre. Philadelphia, 1987. Der Regisseur Volker Hesse inszenierte beispielsweise im Welttheater Einsiedeln 2007 die Textfassung von Autor Thomas Hürlimann ausschließlich mit nicht-professionellen Darstellenden als eine Choreografie der Massen auf dem Klosterplatz des Klosters Einsiedeln im Kanton Schwyz. Carmen Mörsch. “Am Kreuzpunkt von vier Diskursen: Die documenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation.” Kunstvermittlung II. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Hg. von Carmen Mörsch [et al.]. Berlin/Zürich, 2009. S. 9–33. Auch Carmen Mörsch beschränkt diese Einteilung nicht auf die Bildende Kunst. Vgl. z.B. Carmen, Mörsch. “Watch this Space!: Position beziehen in der Kulturvermittlung. Basistext für die Fachtagung ‘Theater – Vermittlung – Schule’”, http://ipf.zhdk.ch/daten/watch-thisspace_c-morsch.pdf, 23.8.2010. Mörsch 2009, S. 12. Z.B. Karin v. Welck/Margarete Schweizer, Kinder zum Olymp. Wege zur Kultur für Kinder und Jugendliche. Köln, 2004. In der Regel handelt es sich dabei um Freunde, Bekannte, Verwandte oder Arbeitskollegen. Mörsch 2009, S. 10. Kulturstiftung des Bundes, “Heimspiel. Der Fonds zur Förderung von Theaterprojekten im Überblick”, http://www.kulturstiftung-desbundes.de/cms/de/programme/kunst_der_ve rmittlung/heimspiel_1056_91.html, 8.6.2010. Eva Behrendt. “Bildung ist es!” Theater heute Jahrbuch, 2006. S. 18. 61 62 Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye / Yvonne Schmidt 19 Ingrid Hentschel. “Medium und Ereignis – warum Theaterkunst bildet.” Korrespondenzen. Theater – Ästhetik – Pädagogik. Hg. von Florian Vaßen. Milow 2010. S. 43. 20 Mörsch 2009, S. 10–13. 21 Im Bereich der Visuellen Künste hat dieser Prozess schon stattgefunden. Der Begriff der Museumspädagogik ist vielfach durch den Begriff der Kunstvermittlung ersetzt worden. 22 Der folgende Abschnitt beruht auf teilnehmenden Beobachtungen und qualitativen Interviews, die Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye zwischen September 2009 und Februar 2010 führte. 23 Golda Eppstein. Gessnerallee Backstage, unveröffentlichtes Konzept, 2008. S. 4. 24 Die Gessnerallee stellt kostenlos Proberäume zur Verfügung und übernimmt die Kommunikation für das Projekt. Die Infrastruktur und das Personal (vor allem die Techniker) können ferner für Aufführungen der Backstage Gruppen genutzt werden. 25 Entspricht umgerechnet etwa 130 bzw. 108 L. Bei den Kindergruppen, auf die im Folgenden jedoch nicht näher eingegangen wird, liegt der Ansatz mit 100 bzw. 86 L im Monat etwas tiefer. 26 Golda Eppstein, “Theatertraining für Erwachsene”, http://www.eppstein.ch/, 8.6.2010. 27 Niels Ewerbeck, “Warum ich meinen Beruf so liebe.” 20 Jahre Theaterhaus Gessnerallee Zürich. Zürich, 2009. S. 13. 28 Individuelle Theaterbesuche zu reduziertem Preis sind durch einen Mitgliederausweis ebenfalls möglich. 29 Vgl. Hajo Kurzenberger [et al.]. Kollektive in den Künsten. Hildesheim, 2008. 30 Die Dichotomie von Produkt und Prozess ist streng genommen nicht haltbar, da Theater nie ein Produkt, sondern immer transitorischer Prozess ist. 31 http://www.sheshepop.de/produktionen/ testament/, 9.6.2010. 32 Väter, Konzept und Regie: Alvis Hermanis, Uraufführung 22.03.2007, Schauspielhaus Zürich. 33 Alle Toten fliegen hoch, von und mit Joachim Meyerhoff, Serie seit 2007 am Burgtheater Wien. 34 Annemarie Matzke. “Konzepte proben – Probenprozesse in postdramatischen Theaterformen”, Vortrag im Rahmen der Mastertagung Wirkungsmaschine Schauspieler. Vom Menschendarsteller zum multifunktionalen Spielemacher an der Zürcher Hochschule der Künste, 23.04.2010. 35 Aleida Assmann. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München, 1999. 36 Matzke 2010. 37 Tilman Broszat/Sigrid Gareis (Hg.). Global Player, Local Hero. Positionen des Schauspielers im zeitgenössischen Theater, München, 2000 sowie Ole Hruschka. Magie und Handwerk. Reden von Theaterpraktikern über die Schauspielkunst. Hildesheim [etc.], 2005. 38 Wildwuchs 2009, Programmbroschüre. 39 www.wildwuchs.ch, 9.6.2010 40 www.hora-okkupation.ch/, 9.6.2010 41 http://www.kulturprozent.ch/integrart, 2.3.2010. 42 www.integrart.ch/, 10.9.2010. 43 Als der Regisseur Stefan Bachmann in seiner Hamlet Inszenierung 2002 am Königlichen Theater Kopenhagen die Ophelia-Rolle von Christina Knudsen, einer Darstellerin mit Down-Syndrom besetzen wollte, scheiterte dies an den Bedingungen des Theaterapparates und war von polarisierenden Reaktionen in den Medien begleitet, die sich mehrheitlich für die Entscheidung des Theaters positionierten. 44 Petra Kuppers. Disability and Contemporary Performance. Bodies on Edge. London/New York, 2003. 45 Braunreiter, Michaela. “Kultur des Zugangs. Anregungen zum Mainstreaming von Behinderung,” Vortrag im Rahmen des Symposium IntegrART-Symposiums All inclusive – Kunst auf neu, Zürich, Museum für Gestaltung der Zürcher Hochschule der Künste, 18.6.2009. 46 Es handelt sich um eine Koproduktion mit dem FWT Köln und dem Sommerblut Kulturfestival. 47 Der folgende Abschnitt beruht auf teilnehmenden Beobachtungen, qualitativen Interviews und Publikumsdiskussionen, die Yvonne Schmidt im Zeitraum zwischen dem 6. März und 25. Mai 2010 in Köln durchgeführt hat. 48 www.clhuebsch.de/, 9.6.2010. Theater für alle, aber nicht von allen? 49 Wolf-Dieter Ernst. “Takt und Taktlosigkeit. Zum Paradox der Meister-Schüler Beziehung.” double 3 (2009): S. 12–15. 50 Selbstverständlich ist zu bedenken, dass bei Theater mit geistig Behinderten meist die nicht-behinderten Darsteller den Raum bieten, Theater zu spielen. 51 Dominik Jehl. “Ethik und Ästhetik des Grotesken.” Ethik der Ästhetik. Hg. von Christoph Wulf [et al.]. Berlin, 1994. S. 95–103. 52 Vgl. Gernot Böhme. Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. München, 2001. 53 Christoph Wulf [et al.], “Einleitung.” Ethik der Ästhetik. Hg. von Christoph Wulf [et al.]. Berlin, 1994. S. VII–XI. 54 Doris Kolesch. “Ästhetik.” Metzler Lexikon Theatertheorie. Hg. von Erika Fischer-Lichte [et al.]. Stuttgart/Weimar, 2005. S. 6–13. 55 Wulf [et al.] 1994, S. X. 56 Imke Schmincke. Gefährliche Körper an gefährlichen Orten. Eine Studie zum Verhältnis von Körper, Raum und Marginalisierung. Bielefeld, 2009, hier S. 244. 57 Matthias Warstat. “Spielen und Heilen. Zur Theatralisierung des Therapeutischen.” Theatralisierung der Gesellschaft 1: Soziologische 58 59 60 61 62 63 64 Theorie und Zeitdiagnose. Hg. von Herbert Willems. Wiesbaden, 2009. S. 533–547. Warstat 2009, S. 544. Warstat 2009, S. 545. Birgit Mandel, “Vorwort.” Audience Development, Kulturmanagement, Kulturelle Bildung. Konzeptionen und Handlungsfelder der Kulturvermittlung. Hg. von Birgit Mandel. München, 2008, S. 9. Mira Sack, “Konstellationen von Künstlern und Kindern. Ein pädagogischer Blick auf Vermittlungskünste und die Kunst der Vermittlung.” Korrespondenzen. Theater – Ästhetik – Pädagogik. Hg. von Florian Vaßen. Milow, 2010, S. 126. Vgl. Hajo Kurzenberger. Der kollektive Prozess des Theaters. Chorkörper, Probengemeinschaften, theatrale Kreativität. Bielefeld, 2009. Vgl. Matthias Warstat. “Gleichheit – Mitwirkung – Teilhabe: Theatrale Gemeinschaftskonzepte vor und nach 1968.” Politik mit dem Körper. Performative Praktiken in Theater, Medien und Alltagskultur seit 1968. Hg. von Friedemann Kreuder/Michael Bachmann. Bielefeld, 2009. S. 13–26. Andreas Kotte. Theaterwissenschaft. Eine Einführung. Köln [etc.] 2005, S. 63. 63