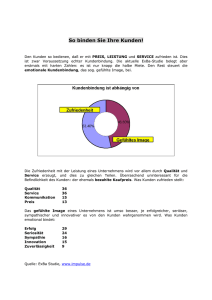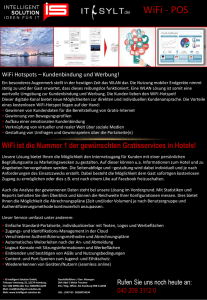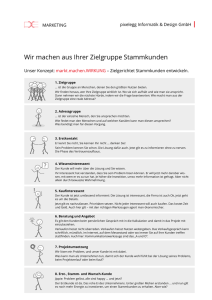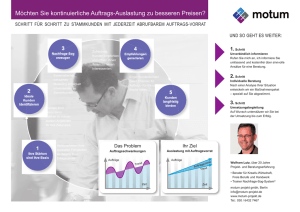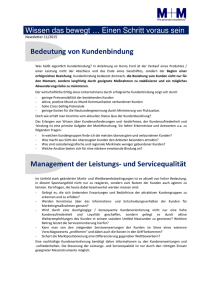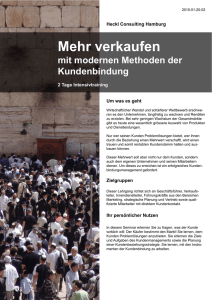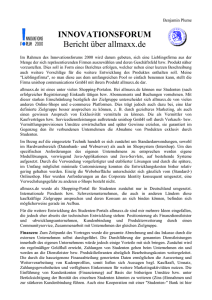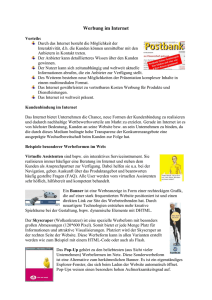HHL – Leipzig Graduate School of Management UNIPLAN
Werbung

HHL – Leipzig Graduate School of Management UNIPLAN LiveTrends 2006 Steuerung des Kommunikationsmix im Kundenbeziehungszyklus Eine branchenübergreifende Befragung von Marketingentscheidern unter besonderer Berücksichtigung der Live Communication Manfred Kirchgeorg Christiane Springer in Kooperation mit UNIPLAN International GmbH & Co. KG Arbeitspapier Nr. 71 2. erw. Auflage Copyright: Lehrstuhl Marketingmanagement Leipzig 2006 Jede Form der Weitergabe und Vervielfältigung bedarf der Genehmigung des Herausgebers I Zusammenfassung Zum dritten Mal hat der Lehrstuhl Marketingmanagement in Kooperation mit der Live Communication Agentur Uniplan International 398 Marketingentscheider in 9 Branchen über den Status quo, die Entwicklung ihrer Kommunikationsstrategie und den integrierten Einsatz von Instrumenten der Live Communication befragt. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Schwerpunkt auf die Ausrichtung der Kommunikationsinstrumente in einzelnen Kundenbeziehungsphasen gelegt. Als Grundlage für diese Analyse wurde die Zusammensetzung der Kundenstruktur der befragten Unternehmen nach Neukunden, Stammkunden und abgewanderten Kunden ermittelt. Branchenübergreifend zählen zwei Drittel der Kunden zu den Stammkunden, sodass der Kundenbindung in zunehmend wettbewerbsintensiveren Märkten eine erfolgskritische Bedeutung zukommt. Die vorliegenden Ergebnisse geben Auskunft darüber, wie Unternehmen ihre Kommunikationsinstrumente in den einzelnen Kundenbeziehungsphasen aussteuern. Live Communication-Instrumente wie Messen und Events erlangen dabei einen besonderen Stellenwert bei der Stammkundenbindung. Allerdings wird auch deutlich, dass viele Unternehmen ihr Kommunikationsbudget noch nicht effizient aussteuern, nach der Devise „klassische Werbung für alle“. Spezifische Hinweise liefert die Studie auch zum Einsatz von Live Communication-Instrumenten im Multi-Channel-Mix, um einen Überblick über die Einbeziehung aller Customer Contact Points zu erlangen. Differenzierte Auswertungen zu Effizienzsteigerungspotenzialen von Messen als Marketinginstrument der Markenhersteller und Anregungen über Messekonzepte der Zukunft vertiefen die Diskussion. Summary For the third time, the Department of Marketing Management has conducted a survey in cooperation with the live communication agency Uniplan International. 398 marketing managers from 9 different industries have been interviewed to find out about the status quo and the development of their communication strategy as well as their use of live communication instruments. In this survey the main focus has been on the adoption of communication instruments in several phases of customer relations. The analysis was based on the classification of the clients of the interviewed companies into new customers, regular customers and lost customers. Concerning a crosssectoral view, two-thirds can be seen as regular customers. So, in highly competitive markets customer loyalty is a matter of special importance and crucial for the success of a company. The results show how companies use and control their communication instruments effectively in several phases of customer relations. Live communication instruments such as trade fairs and events achieve special importance in the field of regular customer loyalty. Nevertheless, it is also obvious that many com- II panies do not control their communication budget effectively and therefore act according to the slogan “classical advertising for all”. For an overview of the use of all customer contact points, the study provides specific details for using live communication instruments in a multi-channel-mix. Differentiated analyses concerning the efficiency increase in potentials for trade fairs as marketing instruments deepen the discussion. III Inhaltsverzeichnis Seite Abbildungsverzeichnis ................................................................................................ V Tabellenverzeichnis................................................................................................... VI Abkürzungsverzeichnis............................................................................................. VII 1. 2. 3. Herausforderungen der Markenkommunikation im Kundenbeziehungszyklus ... 1 1.1 Kundenstatus und Kundenbeziehungszyklus als Informationsgrundlage der integrierten Kommunikation............................................... 1 1.2 Potenziale von Live Communication im Kundenbeziehungszyklus .......... 2 1.3 Zielsetzung und Bezugsrahmen der Untersuchung ................................. 5 Analyse der empirischen Befunde der Untersuchung......................................... 8 2.1 Stichprobenzusammensetzung und Erhebungsdesign ............................ 8 2.2 Analyse der unternehmens- und branchenspezifischen Kundenstruktur.. 9 2.3 Effektivität des unternehmens- und branchenspezifischen Kommunikationsmix im Kundenbeziehungszyklus ..................................13 2.4 Analyse der unternehmens- und branchenspezifischen Budgetverteilung und Entwicklung von Live Communication-Instrumenten im Kommunikationsmix ...........................................................................18 2.5 Analyse des unternehmens- und branchenspezifischen Stellenwertes von Live Communication-Instrumenten im Multi-Channel-Management .21 2.6 Analyse der unternehmens- und branchenspezifischen Durchführung von Erfolgskontrollen bei Live Communication-Instrumenten..................24 Profilierungspotenziale von Messen und Events ...............................................28 3.1 Austauschbarkeit als Profilierungsproblem von Messen und Events ......28 3.2 Analyse der Differenzierungsdimensionen von Messen und Events .......29 3.3 Bedeutung und Entwicklung von Messen................................................32 IV 3.4 Analyse von Messekonzepten der Zukunft..............................................34 4. Sonderauswertung: Einsatz von Live Communication-Instrumenten zur Weltmeisterschaft 2006.....................................................................................37 5. Zusammenfassung und Ausblick.......................................................................39 Literaturverzeichnis ................................................................................................... IX Anhang ....................................................................................................................XVI V Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Problemzonen und Abschmelzverluste im Kundenbeziehungszyklus..4 Abbildung 2: Bezugsrahmen der Studie UNIPLAN LiveTrends 2006........................6 Abbildung 3: Zusammensetzung des Befragungssamples .......................................9 Abbildung 4: Kundenstruktur des Gesamtdurchschnitts .........................................10 Abbildung 5: Kundenstruktur in verschiedenen Marktphasen .................................12 Abbildung 6: Kundenstruktur der Branchen ............................................................13 Abbildung 7: Eignungsgrad der Kommunikationsinstrumente in unterschiedlichen Kundenbeziehungsphasen....................................15 Abbildung 8: Budgetanteil für Marketing-Kommunikation am Gesamtumsatz.........18 Abbildung 9: Erfolgskontrolle des Gesamtdurchschnitts .........................................26 Abbildung 10: Erfolgskontrolle der Branchen ............................................................27 Abbildung 11: Austauschbarkeit von Messeauftritten und Eventinszenierungen ......28 Abbildung 12: Differenzierungsdimensionen von Messeauftritten.............................30 Abbildung 13: Differenzierungsdimensionen von Eventinszenierungen....................31 Abbildung 14: Zukunftsbedeutung von Messen als Vertriebsschiene .......................33 Abbildung 15: Anforderungen an Messekonzepte der Zukunft .................................35 Abbildung 16: Imagebedeutung und Marketingaktivitäten der WM 2006 ..................38 VI Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Zusammenfassung der Phasenkonzepte zu Austauschbeziehungen ..3 Tabelle 2: Branchenspezifischer Eignungsgrad der Kommunikationsinstrumente in unterschiedlichen Kundenbeziehungsphasen ............16 Tabelle 3: Branchenspezifische Entwicklung der Budgetverteilung für Marketing-Kommunikation (2005-2008) .............................................19 Tabelle 4: Branchenspezifischer Einsatz der Vertriebskanäle und Zukunftsbedeutung der Messen als Vertriebskanal ...........................23 VII Abkürzungsverzeichnis Abb. Abbildung Aufl. Auflage B2B Business to Business B2C Business to Consumer bspw. beispielsweise bzgl. bezüglich bzw. beziehungsweise Diss. Dissertation Dr. Doktor € Euro e.V. eingetragener Verein erw. erweitert et al. et alii evtl. eventuell d.h. das heißt f. folgende ff. fortfolgende GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft HHL Handelshochschule Leipzig Hrsg. Herausgeber i.d.R. in der Regel Jg. Jahrgang KG Kommanditgesellschaft LC Live Communication VIII Mio. Millionen Mrd. Milliarden MW Mittelwert n Stichprobengröße No. Number Nr. Nummer Prof. Professor S. Seite Tab. Tabelle TV Television u.a. unter anderem UAP Unique Advertising Proposition überarb. überarbeitet USP Unique Selling Proposition v.a. vor allem vgl. vergleiche Vol. Volume vollst. vollständig vs. versus z.B. zum Beispiel ZFP Zeitschrift für Forschung und Praxis z.T. zum Teil 1 1. Herausforderungen der Markenkommunikation im Kundenbeziehungszyklus 1.1 Kundenstatus und Kundenbeziehungszyklus als Informationsgrundlage der integrierten Kommunikation Neben der Neukundengewinnung erhält die Bindung von Stammkunden in etablierten Märkten einen herausragenden Stellenwert. In den 90er Jahren hat die Kundenbindungseuphorie vielfach einen Automatismus von Kundenbindung und Profitabilitätssteigerung propagiert.1 Verkannt wurde dabei, dass es den Stammkunden so nicht gibt. Vielmehr ist sorgfältig nach den Ertragspotenzialen zwischen A-, B- und CKunden zu segmentieren.2 Kundenbindungsinstrumente, die sich für A-Kunden lohnen, können bei C-Kunden eine Fehlinvestition darstellen. Somit gilt es, die effizientesten Wege zu unterschiedlichen Stammkundensegmenten zu finden. Marketingentscheider stehen heute vor der Herausforderung, Kommunikation und Vertrieb gezielt auf die einzelnen Phasen im Kundenbeziehungszyklus auszurichten.3 Ein kundenspezifischer Einsatz der Kommunikationsinstrumente im Kundenbeziehungszyklus erfordert zunächst eine Unterteilung des Kundenportfolios nach dem jeweiligen Beziehungsstatus der Kunden bzw. danach, in welcher Beziehungsphase sich die Kunden gegenüber dem Unternehmen bzw. einer Marke befinden. Im Marketingmanagement bilden Kundensegmentierungen eine elementare Voraussetzung zur differenzierten Marktbearbeitung. Hierbei erfolgt vielfach eine Segmentierung nach soziodemographischen, verhaltensbezogenen oder psychographischen Merkmalen. Ergänzt werden diese Analysen durch umsatz- und deckungsbeitragsbezogene ABC-Analysen, die Auskunft darüber geben, in welchem Ausmaß spezifische Kundensegmente einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Mit der zunehmenden wissenschaftlichen Diskussion von Ansätzen des Beziehungsmarketings erfolgte eine weiterführende Vertiefung der Kundensegmentierung durch die Berücksichtigung einzelner Beziehungsphasen.4 So fand bspw. die soziodemographische Kundensegmentierung vielfach als statische Analyse Verwendung. Da der Status des Kunden im Beziehungszyklus jedoch grundlegenden Veränderungen unterworfen ist, sind die Unternehmen in der Pflicht, eine dynamische Kundenanalyse zugrunde zu legen. Mit modernen CRM-Ansätzen wird eine Kundensegmentbearbeitung unter Berück1 2 3 4 Vgl. Reichheld, F./Sasser, E. (1990), S. 105ff. Vgl. u.a. Reinartz, W./Kumar, V. (2002), S. 86ff.; Krafft, M./Götz, O. (2006), S. 343ff.; Blattberg, R. C./Deighton, J. (1996), S. 136ff.; Georgi, D. (2005), S. 237ff. Zur integrierten Einbeziehung von Kommunikations- und Vertriebskanälen siehe z.B. Payne, A./Frow, P. (2005), S. 172ff. Vgl. Georgi, D. (2005), S. 237. Zu den Merkmalen des Kundenbeziehungszyklus siehe z.B. Bruhn, M. (2001), S. 49; Stauss, B. (2006), S. 424ff. 2 sichtigung des Kundenbeziehungsstatus möglich. Trotz der technischen Voraussetzungen werden in vielen Branchen und Unternehmen entsprechende Ansätze jedoch nicht entsprechend genutzt und die notwendigen Kundendaten nicht erfasst und ausgewertet. Payne und Frow plädieren dafür, die Möglichkeiten der CRM-Ansätze auch für eine abteilungsübergreifende Kundenbearbeitung effizienter einzusetzen: „... to help companies avoid the potential problems associated with a narrow technological definition of CRM“.5 Liegen entsprechende Kundenstrukturanalysen vor, so ergeben sich daraus wertvolle Hinweise für die Optimierung des Kommunikationsmix. Nach dem Anspruch der integrierten Kommunikation6 sollten diese Informationen in den Planungsprozess einfließen, um eine inhaltliche, formale und zeitliche Integration aller Kommunikationsinstrumente und Customer Contact Points zu erzielen. Es ist zu vermuten, dass über die Steuerung der Kommunikationsaktivitäten im Kundenbeziehungszyklus Ansatzpunkte für Optimierungspotenziale aufgezeigt werden können. Somit widmet sich die vorliegende Untersuchung insbesondere der Fragestellung, ob und in welcher Form Unternehmen ihre Kommunikationsaktivitäten bereits auf den Kundenstatus im Beziehungszyklus ausgerichtet haben. 1.2 Potenziale von Live Communication im Kundenbeziehungszyklus In zunehmend gesättigten Märkten sind die Potenziale zur Gewinnung von Erstkäufern ausgereizt. Damit sind die Marketingaktivitäten auf die mehr oder weniger loyalen Wiederkäufer zu konzentrieren. I.d.R. sind Wiederkäufer je nach Branche, Produktkategorie und Wiederkaufzyklus mit den Marken und ausgewählten Anbietern vertraut. Loyale Wiederkäufer bilden bei einem Anbieter die Stammkundenstruktur. Geben sie ihre Anbieter- und Markenloyalität auf, dann werden sie zu Wechselkäufern und das von ihnen neu ausgewählte Unternehmen kann diese Wechselkäufer als Neukunden und in der Folge als Erstkäufer registrieren. Aus der Unternehmenssicht ist es wichtig, die potenziellen und aktuellen Kunden im Beziehungszyklus zu erfassen, um darauf aufbauend eine kunden- und phasenspezifische Ausrichtung der Marketinginstrumente vornehmen zu können. Wie einleitend dargelegt, ist zu erwarten, dass die Bindung profitabler Kunden an das Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dabei ist es offensichtlich, dass ein potenzieller Neukunde anders anzusprechen ist, als ein Kunde, der bereits mehrmals beim Unternehmen gekauft hat und an der gezielten Inanspruchnahme 5 6 Payne, A./Frow, P. (2005), S. 174. Vgl. Bruhn, M. (2005), S. 103ff. 3 von zusätzlichem Produktservices oder Cross-Sellingangeboten interessiert ist. Eine Investition in eine Kampagne, die auf die Erhöhung des Bekanntheitsgrades einer Marke ausgerichtet ist, wäre für Stammkunden nicht effizient. Hier sind andere Ziele zur Kundenbindung anzustreben. Zur Identifizierung von Kundenbeziehungsphasen werden in der Literatur unterschiedliche Konzepte vorgestellt, die die Entwicklung von Kundenbeziehungen im Zeitablauf beschreiben (vgl. Tabelle 1). Sie unterscheiden sich in der Phasenabgrenzung, im Differenzierungsgrad der Phase und in ihrer theoretischen Begründung. Teilweise basieren die Phasenabgrenzungen auf käuferverhaltenstheoretischen Modellen. Beziehungsphasen Autor Ford (1980) Prerelationship Early Development Frazier (1983) Initiation Implementation Review Dwyer et al. (1987) Awareness Exploration Hentschel (1991) Kennenlernen Homburg/ Daum (1997) Long Term Final Expansion Commitment Dissolution Vertiefung Routine Infragestellung Kenntnisnahme Frühe Entwicklung Späte Entwicklung Höchste Einbindung Diller (1995) Vorbeziehung Start Penetration Reife Jung (1999) Suche Vereinbarung Anpassung/ Kontrolle Beendigung Stauss (2000) Anbahnung Sozialisation + Gefährdung Wachstum + Gefährdung Reife + Gefährdung Degeneration Kündigung Abstinenz Bruhn (2001) Anbahnung Sozialisation Wachstum Reife Gefährdung Auflösung Abstinenz Schmitz (2001) Anbahnung Stabilisierung Auflösung Riesenbeck/ Perrey (2004) Bekanntheit Vertrautheit Engere Auswahl Kauf Loyalität Tabelle 1: Krise/ Trennung Rückgewinnung Zusammenfassung der Phasenkonzepte zu Austauschbeziehungen7 Greift man den von Riesenbeck und Perrey verwendeten Funnel-Ansatz8 auf, so lassen sich angelehnt an dem AIDA-Wirkungsmodell9 die in der Abbildung 1 darge7 8 9 Quelle: in Anlehnung an Lorbeer, A. (2003), S. 59. Vgl. Riesenbeck, H./Perrey, J. (2005), S. 116ff. Vgl. u.a. Bauer, H. H. et al. (2006), S. 259. 4 stellten Kundenbindungsphasen unterscheiden. Neukunden eines Anbieters müssen zunächst die Marke und den Anbieter kennen, bevor sich ein Markenimage herausbilden kann, das die Phase der Vertrautheit beschreibt. Die im relevanten Set befindlichen Marken werden von den potenziellen Neukunden mehr oder weniger präferiert und schließlich wird die Kaufentscheidung auf der Grundlage einer präferierten Marke getroffen. Somit wird der Neukunde zum Erstkunden und durch den Wiederkauf zum Stammkunden. Z Zielgruppenanteil i e lg ru p p e n a n te i l 100 % B e ka n n Bekanntheit h e it V e r tr a u th e it Vertrautheit P r ä fe re n z Präferenz K au f Kauf L o y a li tä t Loyalität W ie d e r ka uf B in d u n g s - Beziehungsphasen p h a s en Abbildung 1: Problemzonen und Abschmelzverluste im Kundenbeziehungszyklus10 Vielfach werden Abschmelzverluste bei den in der Abbildung 1 gekennzeichneten Phasen beobachtet, sodass hier eine besondere Gefahr der Unterbrechung des Kundenbeziehungszyklus vorliegt. Im Rahmen eines Kundenbindungsmanagement sind diese Phasen und Bindungslücken11 zu identifizieren, um mit entsprechenden Marketingmaßnahmen den Abschmelzverlusten vorzubeugen. Insbesondere die Erhöhung der Verbundenheit erfordert Instrumente, die eine emotionale und multisensuale Ansprache des Kunden ermöglichen. In einer durch Informationsüberlastung12 geprägten Kommunikationssituation wird die Kontaktaufnahme und die Kommunikation im Kundenbeziehungszyklus erschwert, sodass der Wahl von geeigneten Instrumenten eine besondere Bedeutung zukommt. In diesem Zusammenhang können Instrumente der Live Communication einen besonderen Beitrag zur Kundenbindung leisten, der über die klassische Kommunikation vielfach nicht erzielt werden kann. 10 11 12 Quelle: Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S.1. Zu den Bindungsursachen siehe u.a. Bruhn, M./Homburg, C. (2005), S. 10ff.; Stauss, B. (2006), S. 424ff. Vgl. u.a. Wiedmann, K.-P. et al. (2000), S. 16f.; Bork, T. A. (1994), S. 57f. 5 Darüber hinaus ist Live Communication der einzige Kanal, bei dem alle Sinnesorgane der Zielgruppe zur Verankerung der Markenerlebnisse angesprochen werden können. Die Aufnahme der Informationen aus der Umwelt erfolgt über sensorische Systeme, den so genannten Rezeptorsystemen, d.h. über den Tast-, Geschmacks-, Geruchs-, Gehör- und Gesichts-, sowie den Gleichgewichtssinn.13 Da das Markenbild im Gedächtnis multimodal abgespeichert werden kann, ist es für den Erfolg im Markt wesentlich, das Zusammenwirken von mehreren, gleichzeitig eingesetzten Reizmodalitäten zu nutzen.14 1.3 Zielsetzung und Bezugsrahmen der Untersuchung Vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen wurde zum dritten Mal im Herbst 2005 in Kooperation mit dem Unternehmen UNIPLAN International eine Befragung bei 400 Marketingentscheidern in 9 Branchen initiiert und durchgeführt. Neben Fragestellungen, die für einen Längsschnittvergleich mit den Studien15 der Vorjahre repliziert wurden, ist die aktuelle Befragung insbesondere auf die differenzierte Erfassung des Kommunikationsmix in einzelnen Kundenbindungsphasen sowie auf die vertiefte Analyse von Messen und Events ausgerichtet worden. Im Einzelnen sind Fragenkomplexe zu folgenden Themen einbezogen und operationalisiert worden: Status quo der Kundenstruktur Effizienz des Kommunikationsmix im Kundenbeziehungszyklus Bedeutung von Live Communication im Kommunikationsmix Differenzierungspotenziale von Live Communication-Instrumenten Optimierungspotenziale beim Einsatz von Live Communication-Instrumenten Live Communication im Multi-Channel-Mix Kontrolle des Kommunikationserfolges beim Einsatz von Live CommunicationInstrumenten Die Ergebnisse der Studie dienen einerseits der Vertiefung der Grundlagenforschung, die am Lehrstuhl Marketingmanagement seit zwei Jahren im Rahmen einer eingerichteten Forschungsstelle „Live Communication“ im Competence Center Media Management betrieben wird. Andererseits sollen die Erkenntnisse Marketingent13 14 15 Vgl. Domnick, I. (2005), S. 15f. Vgl. Schütz, P. (2001), S. 150.; Esch, F.-R. (2005), S. 280. Vgl. Kirchgeorg, M./Klante, O. (2003a).; Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a). 6 scheidern: zentrale branchenübergreifende und -spezifische Benchmarkinformationen zur Planung ihrer Markenkommunikation liefern Hilfestellungen zur Optimierung des Einsatzes von Live CommunicationInstrumenten im Kundenbeziehungszyklus geben und Trendinformationen für die strategische Ausrichtung der Kommunikationsaktivitäten bereitstellen. In der Untersuchung werden auch spezifische Themen des Einsatzes der Live Communication-Instrumente Messen und Events erfasst. Damit sind die Ergebnisse ebenso für Unternehmen der Messewirtschaft von hoher Relevanz. So können differenzierte Aussagen über die Gründe für die zunehmende oder abnehmende Attraktivität von Messebeteiligungen sowie über die Ausrichtung der zukünftigen Generation von Messen erlangt werden. Die systematische Einbindung der zu untersuchenden Themenkomplexe und Variablen zeigt der managementorientierte Bezugsrahmen in Abbildung 2. Situation Verhalten Output Budget 11, 12 Marktsituation 26 Absatzkanäle 6 Kommunikations- Kundenstatus 3 Instrumente im Kundenbeziehungszyklus 4, 5, (13) Live Comunication7, 8, 9, Instrumente 17, 18 Erfolgskontrolle Nummern kennzeichnen die jeweiligen Fragen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 10 Maßnahmen zur Effektivitätssteigerung 15, 16 UnternehmensPerformance 22, 25 14 Soziodemographie (Entscheidungsträger, Branche, etc.) 1, 2, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28 Abbildung 2: Bezugsrahmen der Studie UNIPLAN LiveTrends 2006 Es wurde von der Annahme ausgegangen, dass Branchenzugehörigkeit, Marktsituation, Markenrelevanz, Markenziele, Kundenstruktur und Unternehmensressourcen den Kommunikationsmix wesentlich im Hinblick auf Budgetverteilung und Instrumenteeinsatz beeinflussen. Die eingesetzten Kommunikationsinstrumente leisten in Ab- 7 hängigkeit der im Unternehmen vorherrschenden Kundenstruktur einen unterschiedlichen Beitrag zur Unternehmensperformance, was sich in der Beurteilung ihrer Effektivität und Effizienz widerspiegelt. Der Ablauf der Kommunikationsplanung und die Instrumenteintegration beeinflussen wiederum die Erfolgswirkungen des Kommunikationsmix und liefern auch Ansatzpunkte zur Optimierung des Einsatzes von Live Communication-Instrumenten. Mit Hilfe des Bezugsrahmens können wissenschaftlich fundierte Fragestellungen und Hypothesen über die Ausgestaltung des Kommunikationsmix im Kundenbindungszyklus sowie den Einsatz spezifischer Live Communication-Instrumente analysiert werden. Angesichts des im Jahr 2006 in Deutschland stattfindenden Megaevents „Fußballweltmeisterschaft“ wurde in der aktuellen Studie eine Sonderauswertung zu diesem Themenkomplex vorgenommen. 8 2. Analyse der empirischen Befunde der Untersuchung 2.1 Stichprobenzusammensetzung und Erhebungsdesign Zur fundierten branchenbezogenen Analyse der aufgezeigten Fragestellungen wurden in neun Branchen 398 führende Unternehmen und deren verantwortliche Manager im Bereich Marketing und Kommunikation befragt. Folgende Branchen wurden in die Untersuchung einbezogen: Automotive High Tech/ Telecommunication Fashion/ Lifestyle Industry Finance Supplier Food/ Beverages Touristik Health Jene Unternehmen, die sich trotz branchenbezogener Vorauswahl nicht den vorgegebenen Branchenkategorien zuordnen ließen, wurden in der Sammelkategorie „Sonstige“ zusammengefasst. Die Feldarbeit erfolgte von August bis September 2005 durch TNS Infratest Holding GmbH & Co. KG.16 Insgesamt wurden 2000 Unternehmen zur Mitwirkung an der Befragung kontaktiert, so dass mit einer Beteiligungsquote von 20% eine gute Resonanz erzielt werden konnte. Abbildung 3 stellt die Zusammensetzung des Befragungssamples im Überblick dar. Von der Unternehmensgröße sind umsatzstarke Großunternehmen deutlich überdurchschnittlich in der Untersuchung vertreten, denn immerhin weisen 36,6% einen Umsatz von über 1 Mrd. € aus. Aber auch mittelständische Unternehmen werden durch das Untersuchungssample repräsentiert. Hinsichtlich des Geschäftstyps ließen sich 22,6% dem Konsumgüter- (B2C) und 40,5% dem Investitionsgüterbereich (B2B) zuordnen, während 36,8% in beiden Bereichen ihre Produkte anbieten. Angesichts des umfassenden Befragungssamples liefert die Studie sowohl für verschiedene Branchen wie auch für Groß- und mittelständische Unternehmen fundierte Analysen sowie interessante Benchmark- und Trendinformationen. 16 Für die telefonischen Interviews wurde jeweils ein Zeitumfang von 30 bis 45 Minuten veranschlagt. 9 Gesamtstichprobe n = 398 Geschäftstyp Hauptsitz Deutschland Ausland 67,8% 32,2% B2C B2B Mischform 22,6% 40,5% 36,8% Branche Automotive Fashion/ Lifestyle Finance Food/ Beverages Health High Tech/ Telecommunication Industry Supplier Touristik Sonstige 9,8% 10,8% 10,8% 11,6% 11,1% 14,8% 11,6% 7,8% 7,3% 4,5% Umsatz bis 50 Mio. € über 50 bis 200 Mio. € über 200 bis 500 Mio. € über 500 bis 1 Mrd. € mehr als 1 Mrd. € 17,0% 22,2% 20,1% 4,1% 36,6% Mitarbeiter bis zu 200 über 200 bis 500 über 500 bis 1000 mehr als 1000 26,9% 14,1% 9,3% 49,7% Position Inhaber, Geschäftsführer 5,3% Vorstand Marketing/ Kommunikation 5,0% Bereichsleiter Marketing/ Kommunikation 59,2% Sonstige 30,5% Zuständigkeit Gesamtunternehmen Geschäftsbereich/ Marke 61,6% 38,4% Abbildung 3: Zusammensetzung des Befragungssamples 2.2 Analyse der unternehmens- und branchenspezifischen Kundenstruktur Vor dem Hintergrund eines zunehmenden internationalen Wettbewerbs und gesättigter Märkte wird deutlich, dass die Kundenorientierung für die Unternehmen in der heutigen Zeit einen besonderen Stellenwert besitzt.17 Eine intensive Kundenstrukturanalyse liefert den Marketingmanagern wichtige Hinweise für eine gezielte Marktund Kundenbearbeitung. Die Neukundengewinnung durch Abwerbung der Kunden von den Konkurrenten wird in gesättigten Märkten zunehmend erschwert, da die Konkurrenzintensität steigt und jeder Anbieter die Kunden verstärkt umwirbt. Andererseits wirken die Angleichung der Produktqualitäten und die zunehmende Austauschbarkeit der Produkte dem Kundenbindungsgedanken entgegen. Infolgedessen nehmen Kundenloyalitäten in gesättigten Märkten vielfach ab. Dies führt dazu, dass die Unternehmen z.T. vergeblich einen Großteil der Werbeanstrengungen investieren, um Wechselkäufer von den vermeintlichen Vorzügen des eigenen Produktprogramms zu überzeugen.18 Hingegen werden die Potenziale des bestehenden Kundenstamms oft unterschätzt. Die 17 18 Vgl. Zellner, G. (2003), S. 1. Darüber hinaus werden auch der Wertewandel im Kaufverhalten und der Technologiewandel für eine stärkere Hinwendung zum Thema Kundenbindung angeführt. Vgl. dazu Joho, C. (1996), S. 47ff.; Oevermann, D. (1996), S. 59ff.; Peter S. I. (1997), S. 1ff. Vgl. Kunz, H. (1996), S. 15. 10 Folge: Eine teure Neukundengewinnung geht zu Lasten der Pflege von profitablen Stammkunden.19 Allerdings zeigt heute eine Vielzahl von Analysen, dass die Gleichung „Stammkunde = profitabler Kunde“ nicht immer aufgeht20. Nicht jeder umworbene Stammkunde ist auch ein profitabler Kunde. Hier sind moderne Kundenbindungsansätze gefordert, durch eine Stammkundensegmentierung zielgruppenspezifische Kommunikationsaktivitäten21 zu steuern, um die Effizienz der Marketingmaßnahmen zu erhöhen.22 In der vorliegenden Untersuchung wurde der Kundenbeziehungsstatus durch die prozentuale Verteilung der gesamten Kundenanzahl nach Erstkunden, Stammkunden und abgewanderten Kunden erfasst (vgl. Abbildung 4). Der Stammkundenanteil liegt bei den befragten Unternehmen bei 74,2%.23 18% der Kundenbasis werden als Neukunden eingestuft. Die Kundenabwanderungsrate liegt bei 7,8%. „Wenn Sie einmal alle Kunden Ihres Unternehmens bzw. Ihres Geschäftsbereiches in Deutschland im Jahr 2004 betrachten, wie teilt sich Ihr Kundenstamm auf die drei Gruppen Neu- und Stammkunden sowie abgewanderte Kunden auf?“ 74,2% 18,0% 7,8% Neukunden Stammkunden Abgewanderte Kunden 2005 n max = 238 Abbildung 4: Kundenstruktur des Gesamtdurchschnitts Damit ist nahezu die Hälfte der Neukundengewinnungen notwendig, um abgewanderte Kunden zu ersetzen. Hier wird von den Unternehmen gern vernachlässigt, dass 19 20 21 22 23 Es ist nachgewiesen worden, dass sich eine Kundenbeziehung i.d.R. profitabler entwickelt, je länger sie andauert. Vgl. dazu Reichheld, F./Sasser, W. (1990), S. 111. Vgl. u.a. Reinartz, W./Kumar, V. (2002), S. 86ff.; Krafft, M./Götz, O. (2006), S. 343ff.; Panzer, J. (2003), S. 120ff. Diller definiert Kundenbindung als ein System von Aktivitäten des Anbieters zur Verbesserung des Transaktionsgeschehens, die zu positiveren Einstellungen der Kunden und daraus resultierender Bereitschaft zu Folgekäufen führt. Vgl. dazu Diller, H. (1996), S. 83f. Vgl. Bruhn, M./Georgi, D. (2005), S. 591ff.; Payne, A./Frow, P. (2005), S. 167ff. Dieses Ergebnis wird auch durch die Studie „Kundenmonitor Deutschland“ bestätigt, die nachweisen konnte, dass erstmals seit vier Jahren die Kundenbindung der deutschen Verbraucher wieder zunimmt. Vgl. dazu Service Barometer (Hrsg.) (2005). 11 die Kundenrückgewinnung erheblich kostengünstiger als die Neukundengewinnung ist.24 Die Ergebnisse zeigen ein typisches Bild für gesättigte Märkte, in denen die Neukundenpotenziale in hohem Maße ausgeschöpft und Unternehmen auf ihre Stammkunden angewiesen sind. Für die Zahleninterpretation ist es sinnvoll, folgende Fragestellungen zu prüfen: Ist die Kundenbindung mit der Kundenzufriedenheit gleichzusetzen? Ergeben sich bzgl. der Markt- und Unternehmensentwicklung Unterschiede in der Kundenstruktur? Und wie setzt sich die Kundenstruktur in den einzelnen Branchen zusammen? In einer Vielzahl von Veröffentlichungen wurde ein positiver Einfluss der Kundenzufriedenheit auf die Kundenbindung nachgewiesen.25 Grundsätzlich lässt sich auch als gemeinsamer Nenner dieser Studien festhalten: Je zufriedener ein Kunde ist, desto loyaler wird er sich verhalten und desto weniger Ressourcen werden für seine Bindung an den Anbieter benötigt.26 Allerdings lässt sich die implizite Annahme, dass zufriedene Kunden auch gebundene Kunden seien und somit durch ihr Verhalten zu einer Ertragssteigerung des Unternehmens beitragen, nicht allgemeingültig bestätigen. Vielmehr wurde festgestellt, dass hohe Wechselquoten auch trotzt guter Zufriedenheitswerte eintreten können.27 Die Erklärung hierfür ergibt sich durch eine Reihe von moderierenden Variablen wie Produktinvolvement, Wettbewerbsumfeld, Produkteigenschaften, Anbieteraktivitäten und Käufereigenschaften.28 Damit wird deutlich, dass der hohe Stammkundenanteil der befragten Unternehmen in der LiveTrends-Studie keine Garantie für zufriedene und profitable Kunden sein muss. Hierfür wäre eine Segmentierung der Stammkunden nach ihrem Customer Live Time Value und ihrer Zufriedenheit hilfreich. Des Weiteren ergeben sich aus der Betrachtung von Marktentwicklung und Unternehmenserfolg zusätzliche Rückschlüsse für die Interpretation der Kundenstruktur (vgl. Abbildung 5). Es ist bekannt, dass bei geringerem Marktwachstum der Einsatz von Kundenbindung als strategisches Marketinginstrument wichtiger wird, weil die Kosten der Neukundenakquisition steigen.29 Überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen, die in stark wachsenden Märkten agieren, haben einen geringeren Neukunden- und abgewanderten Kundenanteil. Dafür steigt der Neukunden- und abgewanderte Kundenanteil – auf Kosten eines sinkenden Stammkundenanteils – bei jenen Unternehmen, die ihre Unternehmensentwicklung als unterdurchschnittlich erfolgreich einstufen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass erfolgreiche Unter24 25 26 27 28 29 Die Kostenrelation liegt bei etwa 1:3 bis 1:4. Vgl. dazu Heun, F. W. (2002), S. 20f. Vgl. Homburg, C. et al. (1998), S. 93ff. Vgl. Homburg, C./Rudolph, B. (1995), S. 43ff. Vgl. Venohr, B./Zinke, C. (1998), S. 154. Vgl. Homburg, C. et al. (1998), S. 100f. Vgl. Kunze, K. (2000), S. 42. 12 nehmen es verstehen, ihre Stammkunden zu pflegen und überdurchschnittlich profitabel auszuschöpfen. Eine erhöhte Kundenfluktuation und der Ersatz von abgewanderten Kunden durch Neukundenakquisition wirken sich hingegen auf die Erfolgsentwicklung der Unternehmen eher negativ aus. Umsatz, Elastizität Entstehung Wachstum Reife bzw. Stagnation Zeit Rückgang Marktentwicklung** 47 4 5,2% 11,8% 3 73 9,8% 2 17,5% 2 6,2% 18,7% 62 8,1% 15,5% 19,3% 73,8% 56 8,2% 20,2% 3 36 92 1 6,9% 72,8% 83,0% 4 6 8,7% 26,3% 8 12,5% 30,0% 5 57,5% 65,0% Neukunden 71,6% 76,4% 75,1% 5 Unternehmenserfolg* 1 5 Stammkunden * 1 = deutlich besser als der Markt bis 5 = deutlich schlechter als der Markt ** 1 = stark wachsend bis 5 = stark rückläufig 11,2% 35,0% 53,8% Abgewanderte Kunden 2005 n max = 238 Abbildung 5: Kundenstruktur in verschiedenen Marktphasen Betrachtet man die Kundenstruktur der befragten Unternehmen branchenbezogen (vgl. Abbildung 6), so wird nochmals deutlich, welche besondere Bedeutung der Stammkundenbindung heute zukommt. Der Stammkundenanteil liegt zwischen knapp 60% in der Automotive-Branche und 80% in der Health-Branche. Die Grenzen der Neukundengewinnung werden in vielen Branchen sichtbar, v.a. in der Healthund Food-Branche mit einem Neukundenanteil unter 15%. Dafür hält sich in diesen 13 27,7% 24,7% 24,6% 7,5% 5,9% 6,8% 74,7% 74,5% 73,7% 77,5% 79,7% 80,2% 17,2% 17,2% 16,9% 15,0% 14,4% 13,0% Food & Beverages 70,0% 9,4% Supplier 67,8% 8,3% Industry Goods 59,8% 8,1% High Tech 5,4% 12,5% Fashion- / Lifestyle 7,5% Finance 100% Touristik Branchen der abgewanderte Kundenanteil in Grenzen. Dieser ist im Vergleich dazu in der Automotive-Branche fast doppelt so hoch. 80% 60% 0% Neukunden Stammkunden Health 20% Automotive 40% Abgewanderte Kunden 2005 n max = 238 Abbildung 6: Kundenstruktur der Branchen Fest steht, erfolgreich werden in Zukunft nur die Marketing-Verantwortlichen sein, die alle Wege zum Kunden kennen und effizient miteinander kombinieren. Im Kundenbeziehungszyklus darf kein „Customer Touch Point“ außer Acht gelassen werden, insbesondere dann nicht, wenn es um die Bindung profitabler Stammkunden geht. Fazit: Die Stammkunden prägen in allen Branchen die Kundenstruktur, während die Neukundengewinnung zunehmend Grenzen erfährt. Angesichts des zunehmenden Kundenwettbewerbs und der Sättigungserscheinungen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, das Potenzial ihrer Stammkunden optimal auszuschöpfen. Der Einsatz der effizientesten Kommunikationsinstrumente zum richtigen Zeitpunkt im Kundenbeziehungszyklus avanciert hierbei zum zentralen Erfolgsfaktor. 2.3 Effektivität des unternehmens- und branchenspezifischen Kommunikationsmix im Kundenbeziehungszyklus Der Stellenwert der Kommunikation im Rahmen des Marketingmix hat sich aufgrund der Veränderung von Marktstrukturen und Wettbewerbsbedingungen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich entwickelt – von der Phase der unsystematischen Kommunikation in den 1950er Jahren bis hin zur Phase der Dialogkommunikation 14 seit dem Jahr 2000.30 Durch die steigende Anzahl der Medien erweist sich die Auswahl an Gestaltungsoptionen des Kommunikationsprozesses als komplexe Problemstellung, die hohe Anforderungen an das Marketingmanagement und die Mediaplanung stellt.31 Angesichts der enormen Diskrepanz zwischen Informationsangebot und Informationskonsum erlangt die Beantwortung der Frage, welche Kommunikationsmedien mit welchen Botschaften effektiv und effizient eingesetzt werden können, eine essenzielle Bedeutung. Das Problem der Effizienz stellt sich in der Kommunikationspolitik von Unternehmen als Intramediavergleich dar, d.h. die Gegenüberstellung von alternativen Maßnahmen innerhalb eines Kommunikationsinstrumentes unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten („To do the things right“). Im Gegensatz dazu ergibt sich das Problem der Effektivität für die Unternehmen als Intermediavergleich, d.h. in der Frage nach der Wahl der geeigneten Kommunikationsinstrumente für die Marktkommunikation („To do the right things“).32 Bereits die Studie Uniplan LiveTrends 2004/2005 bestätigte hinsichtlich des Effektivitätsaspektes einen deutlichen Trend: Im Verlauf des Kundenbeziehungszyklus entfalten die Kommunikationsinstrumente ihre Zielwirkung in unterschiedlichem Umfang.33 Während die Klassische Kommunikation beim Aufbau des Bekanntheitsgrades führend ist, sind Abschmelzverluste34 in den späteren Beziehungsphasen kaum zu verhindern. Hier entfalten die Live Communication-Instrumente ihre zielgerechte Wirkung. Zur Präzisierung dieser fundierten Erkenntnisse wurden die Marketingmanager in der aktuellen Studie gebeten, den Eignungsgrad35 von sechs Kommunikationsinstrumenten (Klassische Werbung, Messebeteiligung, Neue Medien, Promotionaktivitäten, Events und Direktmailings) für die Erreichung vier verschiedener Marketing- und Kommunikationsziele des Kundenbeziehungszyklus (Erhöhung der Markenbekanntheit, Aufbau von Markenvertrauen, Erhöhung des Abverkaufs, Stärkung der Kundenbindung) einzuschätzen. 30 31 32 33 34 35 Vgl. z.B. Schleuning, C. (1994); Bruhn, M. (2005), S. 71f.; Petersen, A. (2005), S. 167ff. Die steigende Anspruchshaltung an die Kommunikation ergibt sich u.a. durch die Grenzen des Produktwettbewerbs, sodass in vielen Branchen ein Übergang vom Produkt- zum Kommunikationswettbewerb feststellbar ist. Vgl. dazu ebenda, S. 71. Vgl. Lasslop, I. (2003), S. 8f. Vgl. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S. 14ff. Abschmelzverluste treten zum einen beim Übergang von der Markenbekanntheit zur Vertrautheit auf, weil die Erfahrbarkeit der Markenwelt und die Demonstration der Markenqualität zur Herausbildung einer Markenpräferenz gewährleistet sein müssen. Zum anderen entstehen Abschmelzverluste beim Übergang vom Kauf zur Loyalität, wenn es darum geht, den Kontakt zum Kunden zu pflegen und ihn an das Unternehmen und die Marke zu binden. Vgl. dazu ebenda, S. 2. Der Eignungsgrad wurde auf einer 4er-Skala gemessen: „sehr gut geeignet“, „gut geeignet“, „weniger geeignet“ und „gar nicht geeignet“. 15 Das Ergebnis bestätigt (vgl. Abbildung 7), dass für 86% der befragten Unternehmen die Klassische Werbung das Instrumente-Ranking beim Ziel „Erhöhung der Markenbekanntheit“ dominiert. Diese Überlegenheit verliert sie jedoch schon beim „Aufbau von Markenvertrauen“, da der Eignungsgrad der Events und Messebeteiligung ebenbürtig eingeschätzt wird. In den weiteren Phasen des Kundenbeziehungszyklus wird die Klassische Werbung dann von den anderen Instrumenten geradezu „durchgereicht“. Bei der „Erhöhung des Abverkaufs“ werden die Promotionaktivitäten anderen Instrumenten vorgezogen. Diese Rolle übernehmen die Events anschließend bei der „Stärkung der Kundenbindung“. „Inwieweit sind folgende Kommunikationsinstrumente für Ihr Unternehmen bzw. für Ihren Geschäftsbereich dazu geeignet, die folgenden Marketing- bzw. Kommunikationsziele – Erhöhung der Markenbekanntheit, Aufbau von Markenvertrauen, Erhöhung des Abverkaufs und Stärkung der Kundenbindung – zu erreichen?“ Erhöhung der Markenbekanntheit 100% 100% Aufbau von Markenvertrauen -29,7% Erhöhung des Abverkaufs -25,0% Stärkung der Kundenbindung -36,0% -33,7% 86,4% geeignet 80% 80% 70,9% 67,1% 67,0% 65,6% 60% 60% 73,0% 71,9% 77,6% 74,5% 68,9% 56,7% 65,0% 54,8% 50,0% 67,9% 66,3% 59,8% 59,2% 48,5% 48,0% 52,3% 45,5% 40% 40% 43,9% 38,5% 20% 20% nicht geeignet 0% 0% 20% -20% 40% -40% 13,6% 29,1% 32,9% 33,0% 34,4% 26,9% 28,1% 43,3% 60% -60% 22,4% 25,6% 31,1% 32,1% 33,7% 34,9% 45,2% 40,2% 50,0% 52,0% 40,8% 51,5% 47,7% 54,5% 56,1% 61,5% 80% -80% Klassische Werbung Messebeteiligung Neue Medien Promotionaktivitäten Events Direktmailings 2005 n max = 372 Abbildung 7: Eignungsgrad der Kommunikationsinstrumente in unterschiedlichen Kundenbeziehungsphasen Die Überlegenheit des am häufigsten gegenüber dem am wenigsten eingesetzten Kommunikationsinstrumentes pro Ziel ergibt sich aus der Differenz des Eignungsgrades36. Hier wird deutlich, dass es den Marketingmanagern bei der „Erhöhung des Abverkaufs“ und der „Stärkung der Kundenbindung“ leichter fällt, eine klarere Differenzierung vorzunehmen als in den ersten beiden Kundenbeziehungsphasen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dieses Ergebnis branchenspezifisch unterschiedlich ausfällt. Aus diesem Grund sind in Tabelle 2 die besten (+) und schlechtesten (-) 36 Explizit wurde der Eignungsgrad nicht gemessen. Allerdings ist anzunehmen, dass die am häufigsten genannten Kommunikationsinstrumente in der jeweilige Kundenbindungsphase in ihrer Eignung höher eingestuft werden als die am wenigsten eingesetzten Instrumente. 16 Kommunikationsinstrumente und die Differenz des Eignungsgrades (in %) pro Ziel für alle Branchen zusammengefasst dargestellt. Erhöhung der Aufbau von Erhöhung des Stärkung der Markenbekanntheit Markenvertrauen Abverkaufs Kundenbindung + + Differenz - + Differenz - + Differenz - Differenz - Gesamt + Klass. Werbung - Direktmailings 29,7% + Klass. Werbung - Neue Medien 25,0% + Promotionaktivit. - Neue Medien 36,0% + Events - Klass. Werbung 33,7% Automotive + Klass. Werbung - Direktmailings 38,5% + Events - Promotionaktivit. 28,2% + Direktmailings - Messebeteiligung 39,6% + Direktmailings - Klass. Werbung 43,6% Touristik + Neue Medien - Messebeteiligung 14,3% + Klass. Werbung - Promotionaktiv. 25,9% + Direktmailings - Events 34,6% + Direktmailings - Messebeteiligung 31,5% Finance + Klass. Werbung - Direktmailings 37,7% + Klass. Werbung - Messebeteiligung 44,3% + Direktmailings - Messebeteiligung 43,5% + Events - Promotionaktiv. 31,9% Fashion + Klass. Werbung - Direktmailings 29,7% + Klass. Werbung - Neue Medien 29,7% + Promotionaktivit. - Neue Medien 59,6% + Events - Neue Medien 34,8% High Tech + Neue Medien - Direktmailings 39,7% + Events - Direktmailings 41,7% + Promotionaktiv. - Klass. Werbung 25,0% + Events - Klass. Werbung 55,4% Industry + Klass. Werbung - Direktmailings 30,3% + Messebeteiligung - Direktmailings 45,9% + Promotionaktiv. - Neue Medien 37,0% + Messebeteiligung - Klass. Werbung 54,4% Supplier + Klass. Werbung - Direktmailings 33,6% + Events - Neue Medien 43,7% + Promotionaktiv. - Neue Medien 33,2% + Events - Klass. Werbung 58,7% Food + Klass. Werbung - Neue Medien 44,4% + Klass. Werbung - Neue Medien 40,0% + Promotionaktiv. - Neue Medien 64,0% + Promotionaktiv. - Neue Medien 37,8% Health + Klass. Werbung - Neue Medien 40,2% + Klass. Werbung - Neue Medien 63,2% + Klass. Werbung - Neue Medien 54,3% + Messebeteiligung - Neue Medien 32,5% Tabelle 2: Branchenspezifischer Eignungsgrad der Kommunikationsinstrumente in unterschiedlichen Kundenbeziehungsphasen Auf diese Weise wird auch deutlich, dass die Einschätzung des besten (am häufigsten eingesetzt) und schlechtesten (am wenigsten eingesetzt) Kommunikationsinstrumentes in den Branchen unterschiedlich ausfällt. Hier verhalten sich nur die Fashionund Supplier-Branche weitestgehend durchschnittskonform. Zur „Erhöhung der Markenbekanntheit“ plädieren die Entscheidungsträger der Touristik- und High TechBranche für die Neuen Medien. Beim „Aufbau von Markenvertrauen“ setzen die Automotive-, Supplier-, High Tech- und Industry-Branche auf Events und Messebeteiligungen. Bei der „Erhöhung des Abverkaufs“ bewerten die Automotive-, Touristik- und Finance-Branche den Einsatz von Direktmailings als zielführend. Die Health-Branche setzt dagegen vorrangig Klassische Werbung ein. Und für die abschließende Phase des Kundenbeziehungszyklus nutzen die Automotive- und Touristik-Branche weiter- 17 führend die Direktmailings zur „Stärkung von Kundenbindung“, während die FoodBranche die Promotionaktivitäten einsetzt und die Industry- und Health-Branche die Messebeteiligungen den Events vorziehen. Demzufolge wird die Effektivität der vorgegebenen Kommunikationsinstrumente in den verschiedenen Phasen des Kundenbeziehungszyklus von den Branchen äußerst unterschiedlich eingestuft. Insofern ist vor Pauschalaussagen über eine Aussteuerung des Kommunikationsmix zu warnen.37 Da ein erfolgreiches Marketing den Kunden über alle Phasen beim Kauf einer Marke begleiten soll, sind die MarketingRessourcen entlang des Kundenbeziehungszyklus bedarfsgerecht einzusetzen. Die Kundenstruktur der befragten Unternehmen – mit einem hohen Anteil an Stammkunden – macht deutlich, wie bedeutend die Phase „Stärkung der Kundenbindung“ geworden ist. Insbesondere in Zeiten, in denen die Märkte zunehmend ihre Sättigungsgrenzen erreichen und viele Unternehmen unter einem hohen Kosten- und Ertragsdruck stehen, ist es wichtig, Kundenbindung und Kundenintegration als strategische Faktoren für zukünftigen Markterfolg anzuerkennen und zu nutzen. Hier werden branchenübergreifend Live Communication-Instrumente, wie Messen und Events, den Neuen Medien und der Klassischen Werbung vorgezogen. Die Erfahrbarkeit von Produkt- und Markenleistungen durch eine persönliche Begegnung und einer aktiven Einbeziehung der Kunden dient sowohl der authentischen als auch emotionalen Verankerung der Marke bei der Zielgruppe. Fazit: Die Kunst der effizienten Bindung von Kunden erfordert ein differenziertes Vorgehen im Kundenbindungszyklus. Gerade in wettbewerbsintensiven Märkten gewinnt die Aussteuerung der richtigen Kommunikationsinstrumente im Kundenbindungszyklus eine besondere Relevanz. Dabei sind auch die Kundenkontakte durch die Vertriebskanäle bei der Kommunikationsplanung zu berücksichtigen. Während die Klassische Werbung als Treiber der Markenbekanntheit eingesetzt werden kann, so verliert sie, wenn es um die Stärkung der Kundenbindung geht. Events und Messen punkten bei Erstkontakten, Vertrauensaufbau und Kundenbindung und avancieren zu „Allround-Instrumenten“ im Kundenbeziehungszyklus 37 Ansonsten ist mit gravierenden Fehlallokationen von Marketingressourcen und erheblichen Einbußen bei der Kommunikationswirkung zu rechnen. Vgl. dazu Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S. 16. 18 2.4 Analyse der unternehmens- und branchenspezifischen Budgetverteilung und Entwicklung von Live Communication-Instrumenten im Kommunikationsmix In Deutschland geht man insgesamt von einem Kommunikationsmarkt mit einem Volumen von über 60 Mrd. € aus.38 Dieser wird – nach Aussage von Prognos – in den kommenden Jahren weiter stark anwachsen.39 Diese Entwicklungstendenz wird auch in der aktuellen Uniplan LiveTrends 2006-Studie bestätigt. Betrachtet man vorerst die Höhe des Gesamtbudgets für Marketing-Kommunikation (vgl. Abbildung 8), so zeigen die Befragungsergebnisse, dass die Unternehmen durchschnittlich 8,7% des Umsatzes für Marketing-Kommunikation investieren. Allerdings variiert der Umsatzanteil bei den befragten Unternehmen sehr stark – von 1% bis über 20%. „Auf wie viel Prozent des Umsatzes beläuft sich Ihr Gesamtbudget für Marketing-Kommunikation?“ Gesamtbudget* für Kommunikation Unternehmen kumuliert >20,0% 14 6,7% 10,0% - 20,0% 16 14,4% 5,0% - 10,0% 56 41,3% 2,5% - 5,0% 59 69,7% ≤ 2,5% 63 100,0% * gemessen am Umsatzanteil 2005 n max = 208 Abbildung 8: Budgetanteil für Marketing-Kommunikation am Gesamtumsatz Die relativ hohen Kommunikationsbudgets gemessen am Gesamtumsatz erhöhen den Zwang der Entscheidungsträger zur Rechenschaftslegung, inwieweit die Budgets tatsächlich effizient eingesetzt sind. Eine Reihe von Studien belegt, dass viele Unternehmen mit der Wirkung ihrer Kommunikations- und Marketingmaßnahmen nicht zufrieden sind.40 Mehrheitlich wird geäußert, dass mit den bestehenden Etats 38 39 40 Die Nettowerbeeinnahmen erfassbarer Werbeträger beliefen sich in Deutschland auf etwa 19,3 Mrd. EUR im Jahre 2003. Zu dieser Zahl sind die Aufwendungen für andere Kommunikationsinstrumente, wie Verkaufsförderung, Public Relations, Direct Marketing, Sponsoring usw. hinzugerechnet worden. Vgl. dazu Bauer Media KG (Hrsg.) (2005), S. 28.; Bruhn, M. (2005), S. 74f. Vgl. DIW/Prognos (Hrsg.) (1995), S. 142. Vgl. Manager Bilanz (Hrsg.) (2002), S. 32. 19 die Wirksamkeit sogar verdoppelt werden könnte.41 Scheinbar hat der Ausspruch: „Die Hälfte des Budgets für Kommunikation ist umsonst – nur welche?“42 nicht an Aktualität verloren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Kommunikationsbudgets für Maßnahmen gekürzt werden, sobald deren Werthaltigkeit nicht mehr offensichtlich ist. Für die Unternehmen stellt sich daher nicht nur die Frage, ob sie ihre Kommunikation ausweiten sollen, sondern auch wie sie mit den bestehenden Mitteln effektiver umgehen können. Aus diesem Grund wurden die Unternehmen direkt gefragt, wie sich ihr Budget für Marketing-Kommunikation in 2005 prozentual auf die folgenden Kommunikationsinstrumente verteilt und um wie viel Prozent sich das Budget für diese Instrumente im Jahr 2008 verändern wird. Die Entwicklung der Budgetverteilung ist in Tabelle 3 zusammenfassend dargestellt. Klassi- Messe- sche beteili- Werbung 2005 Promoti- 2008 gung 2005 2008 on- SponsoPublic Direkt- Neue Relations mailings Medien Events ring- aktivitäten 2005 2008 aktivitäten 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 Gesamt 28,2% 15,5% 14,0% 10,5% 10,1% 9,1% 7,5% 5,1% Automotive 38,9% 17,1% 6,4% 12,1% 8,0% 7,7% 5,9% 3,9% Touristik 26,4% 8,3% 7,9% 9,8% 14,2% 14,1% 16,6% 5,8% Finance 44,0% 5,0% 4,0% 9,4% 7,1% 15,1% 6,6% 6,6% Fashion 27,4% 14,9% 20,3% 9,3% 11,0% 6,1% 4,9% 6,3% High Tech 20,2% 18,9% 9,9% 14,2% 11,5% 12,4% 8,8% 5,4% Industry 25,2% 24,4% 14,3% 9,0% 9,7% 6,4% 9,2% 1,7% Supplier 19,9% 19,1% 11,3% 16,7% 10,0% 5,8% 9,5% 5,8% Food 32,8% 10,7% 29,2% 6,3% 7,9% 9,4% 5,0% 5,8% Health 25,5% 13,0% 12,9% 8,1% 13,5% 15,0% 6,3% 4,0% Legende: Tabelle 3: 41 42 Steigerungsrate < 0,8 0,8 ≤ Steigerungsrate ≤ 1,2 1,2 < Steigerungsrate ≤ 1,6 2008 Steigerungsrate > 1,6 Branchenspezifische Entwicklung der Budgetverteilung für Marketing-Kommunikation (2005-2008) Vgl. Friedrichsen, M./Konerding, J. (2003), S. 31. Vgl. Kiene, G. (2003), S. 1. 20 Im Gesamtdurchschnitt zählen zu den budgetstärksten Instrumenten – wie auch schon im Vorjahr43 – die Klassische Werbung, Messebeteiligung und Promotionaktivitäten. Diese Instrumente werden nach Aussage der befragten Unternehmen auch in den kommenden drei Jahren nicht an Stabilität im Kommunikationsmix einbüßen. Nur in der Fashion-, Supplier- und Food-Branche werden die Promotionaktivitäten in Zukunft geringer eingesetzt. Ebenso reduziert die Food-Branche ihr Budget für Messebeteiligungen. Jeweils ein Zehntel des Gesamtbudgets wird für Events, Public Relations und Direktmailings ausgegeben. Abweichend vom Gesamtdurchschnitt gehören die Direktmailings in der Finance- und Health-Branche zu den budgetstärksten Instrumenten. Für diese Instrumente wird es in den meisten Branchen eine gleichbleibende bis wachsende Entwicklung bis 2008 geben. Die einzige Ausnahme ist die FinanceBranche, die ihre Aktivitäten im Bereich Public Relations reduzieren möchte. Auf absolutem Wachstumskurs befinden sich die Neuen Medien. Über alle Branchen hinweg wird davon ausgegangen, dass der Anteil in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Einige Studien gehen sogar davon aus, dass die OnlineKommunikation die Klassische Werbung in den nächsten fünf Jahren überholen wird.44 Allerdings muss mit solchen Prognosen vorsichtig umgegangen werden, denn die Daten der letzten beiden LiveTrends-Studien zeigen, dass es einen Unterschied zwischen Erkenntnis und Verwirklichung gibt. So liegen die durchschnittlichen Budgetanteile in 2005 weiterhin unter 10%, obwohl schon in der Studie Uniplan LiveTrends 2004/2005 ein außerordentlicher Bedeutungsschub für die kommenden Jahre vorausgesagt wurde. Die Unternehmen reagieren also recht verhalten, wenn es darum geht, neue Trends bei der Budgetverteilung zu berücksichtigen. In der Tourismus-Branche dagegen gehören die Neuen Medien bereits zu den budgetstärksten Instrumenten. Das schlechte Abschneiden der Sponsoringaktivitäten bei der Effektivitäts- und Effizienzbewertung in der Studie Uniplan LiveTrends 2004/200545 bestätigt sich bei der Budgetverteilung. Nur ein Fünftel des Gesamtbudgets wird für dieses Instrument von den befragten Unternehmen vorgesehen. Dennoch wird die Zukunft der Sponsoringaktivitäten innerhalb der Branchen sehr kontrovers diskutiert. So erlebt das Instrument durch das Engagement der Fashion-, High Tech- und Industry-Branche geradezu ein Comeback, während sich die Finance- und Supplier-Branche dieser Euphorie nicht anschließen können. 43 44 45 Vgl. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S. 8. Vgl. Bauer Media KG (Hrsg.) (2006), S. 22. Vgl. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S. 17f. 21 Interessant bei dieser Auswertung ist, dass die Marketingmanager davon ausgehen, dass die Budgets für Marketing-Kommunikation in den nächsten 3 Jahren steigen werden. So wird mit durchschnittlich 14,9% mehr Budget gerechnet. V.a. die Touristik-, Health- und High Tech-Branche werden ihre Budgets erhöhen. Nur die FoodBranche geht von kaum steigenden Budgets aus. Damit ließe sich nur in dieser Branche ein Budgetshifting aus den Zahlen für 2005 und den Prognosen für 2008 ableiten. Die Interpretation ließe sich jedoch nicht für den Gesamtdurchschnitt verallgemeinern. Um die bestehenden Budgets gezielter einsetzen zu können, sind umfassende Steuerungssysteme unumgänglich.46 Erst durch eine kontinuierliche Erfolgskontrolle werden die Unternehmen in der Lage sein, Kommunikationsmaßnahmen mit niedriger Effektivität zu identifizieren und zu eliminieren. Fazit: Die Unternehmen reagieren recht verhalten, wenn es darum geht, neue Trends bei der Budgetverteilung zu berücksichtigen. So nimmt die Klassische Werbung – gemessen an der aktuellen Budgetverteilung – weiterhin in allen Branchen einen Leitcharakter ein und Live Communication-Instrumente gehören branchenübergreifend zu den Top 3 der budgetstärksten Instrumente. Die Neuen Medien dagegen werden bei der Budgetverteilung ihrem Wachstumspotenzial noch nicht gerecht. Für das Jahr 2008 haben die Unternehmen höhere Budgets für ihren Kommunikationsmix veranschlagt. 2.5 Analyse des unternehmens- und branchenspezifischen Stellenwertes von Live Communication-Instrumenten im Multi-Channel-Management Die Diskussion um Multi-Channel-Konzepte hat im letzten Jahrzehnt eine besondere Bedeutung erlangt.47 Zunehmende Sättigungserscheinungen auf den etablierten Märkten und eine damit einhergehende Verschärfung des Wettbewerbs und ein zu beobachtendes Multi-Channel-Kaufverhalten führte zu der Frage, inwieweit im Vertrieb wirklich alle vom Kunden gewünschten Kontaktpunkte bereitgestellt werden, um einer Abwanderungsgefahr entgegenzuwirken. Die klassische Abgrenzung zwischen den Marketingmix-Bereichen Distributions- und Kommunikationspolitik ist unter dem Blickwinkel der Optimierung von Customer 46 47 Vgl. Piwinger, M./Porák, V. (Hrsg.) (2005), S. 25. Vgl. u.a. Wegener, M. (2004), S. 197ff.; Specht, G./Fritz, W. (2005), S. 216ff.; Grimm, S./Röhricht, J. (2003), S. 355. 22 Contact Points nicht mehr zielführend. Kunden werden durch eine Anzeige auf ein Unternehmen aufmerksam, sie informieren sich per Internet und bestellen per E-Mail weitere Informationen. Schließlich gehen sie in den stationären Handel oder auf eine Messe um ein Produkt anzuschauen und bestellen es dann per Internet. Dieses kunden- und angebotsinduzierte Verhalten verdeutlicht, dass Multi-Channel-Strategien für eine erfolgreiche Marktbehauptung in vielen Märkten unumgänglich sind. Die große Herausforderung besteht darin, durch gezielte Kundensegmentierung die effizientesten Vertriebs- und Kommunikationskanäle zu wählen, d.h. Kunden mit einem hohen Ertragspotenzial sind anders in einem Multi-Channel-Konzept einzubinden als Stammkunden, deren Erfolgspotenzial sehr begrenzt ist. Um die Verbindung zwischen Vertriebs- und Kommunikationskanälen explizit zu berücksichtigen, wurde in der vorliegenden Studie eine erste Bestandsaufnahme dazu gemacht, welche Kanäle die befragten Unternehmen für den Vertrieb ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen nutzen. Hier lassen sich kaum branchenübergreifende Verallgemeinerungen ableiten, vielmehr ist je nach Branche und Produktkategorie die Ausrichtung von Vertrieb und Kommunikation unterschiedlich ausgeprägt. Eines wird allerdings deutlich: Innerhalb der Branchen werden zunehmend Multi-ChannelKonzepte verwirklicht und der Online-Kanal gewinnt nahezu in allen Branchen eine zunehmende Relevanz. Betrachtet man einige ausgewählte Branchen differenzierter, so gibt die Tabelle 4 sehr interessante Aufschlüsse über den Status quo und sich abzeichnende Entwicklungstendenzen. Im Bereich Food und Fashion dominiert der Einzelhandel und z.T. der Großhandel als Vertriebskanal. Gemessen an den Kommunikationsbudgets setzen die Hersteller mit diesem Channel-Schwerpunkt im Bereich der Kommunikationsinstrumente auf Klassische Werbung und Promotionaktivitäten. Public Relations sowie Messebeteiligungen befinden sich dagegen zunehmend unter Druck (vgl. die ausgewiesenen Anteil zur Zukunftsbedeutung der Messe). Die Erklärung hierfür ist nicht monokausal. Die dramatisch fortschreitenden Konzentrationstendenzen im Lebensmittelhandel und im Fashionbereich sowie die Zunahme der so genannten „vertikalen Filialisten“ und neuer Postenanbieter (wie Aldi, Tchibo u.a.) führen dazu, dass der Treffpunkt Messe für diese Großabnehmer im B2B-Bereich an Attraktivität verliert. Hersteller müssen sich ihren Key-Account-Kunden heute sehr intensiv widmen und angesichts der Handelsmacht und Volumina werden Ordergeschäfte weniger auf Messen als vielmehr in Jahresgesprächen und individuellen Einkaufsgesprächen verhandelt. Auf der Endverbraucherseite zeigen Shopperanalysen im Bereich der FMC-Kategorien (Fast Moving Consumer Goods), dass z.T. 80% der Shopper sich erst vor dem Verkaufsregal für eine Marke entscheiden. Die Motivation des Handelspartners für POS-Promotions und der Markenauftritt im Outlet avanciert damit zu ei- 23 nem zentralen Erfolgsfaktor. Die zunehmende Bedeutung von Instore-Promotions und Events direkt am POS unterstreichen diese Aussage. Klass. Per- Bedeutung Stationärer Versand-/ LC- Digitaler Vertrieb Vertrieb sönlicher der Messen Vertrieb Großhandel Verkaufsfilialen Haus- zu HausVerkauf Kataloge Telefonverkauf Online-Dienste Teleshopping Events Messen abnehmend zunehmend max n Automotive n 55,3% 41,1% 10,9% 42,5% 28,1% 53,9% 7,1% 48,4% 65,4% -20,6% +11,3% = 38 60,5% 28,9% 68,4% 5,3% 52,6% 5,3% 57,9% 2,6% 55,3% 65,8% -15,4% +5,1% Touristik n = 29 44,8% 19,2% 55,2% 6,9% 72,4% 58,6% 89,7% 17,2% 62,1% 69,0% -24,1% +10,3% Finance n = 42 9,8% 4,9% 78,6% 47,5% 7,1% 35,7% 85,4% 7,1% 50,0% 47,6% -4,8% +16,7% Fashion n = 43 93,0% 48,8% 52,4% 7,1% 62,8% 25,6% 34,9% 2,4% 41,9% 69,8% -30,0% +7,5% High Tech n = 59 67,8% 67,8% 27,6% 5,3% 40,7% 39,0% 63,8% 15,5% 55,2% 74,6% -22,8% +10,5% Industry n = 46 37,8% 48,9% 30,4% 13,3% 56,5% 26,1% 54,3% 6,5% 47,8% 78,3% -6,5% +15,2% Supplier n = 31 61,3% 66,7% 29,0% 3,3% 60,0% 10,0% 43,3% 3,2% 41,9% 54,8% -30,0% +6,7% Food n = 46 93,5% 93,5% 26,7% 2,2% 15,2% 21,7% 26,1% 4,3% 43,5% 67,4% -31,1% +6,7% Health n = 44 59,1% 93,0% 16,3% 7,1% 34,1% 29,5% 40,9% 6,8% 36,4% 54,5% -27,3% +15,9% Tabelle 4: = 378 max max max max max max max max max 48 59,4% Anzahl Gesamt in Zukunft Einzelhandel Vertrieb Branchenspezifischer Einsatz der Vertriebskanäle und Zukunftsbedeutung der Messen als Vertriebskanal Auch mit Blick auf die weiteren Branchen bleibt festzuhalten, dass zukünftig die Veränderungsdynamik in den Vertriebskanalstrukturen Auswirkungen auf die Kommunikationskanäle hat und durch notwendige Multi-Channel-Strategien die Abstimmungserfordernisse zwischen Vertrieb und Kommunikation in erheblichem Maße zunehmen werden. Die integrierte Kommunikation greift zu kurz, wenn Kommunikation und Vertrieb nicht abgestimmt sind. Live Commmunication-Instrumente eröffnen in Vertriebskanälen neue Formen der Kundenbegegnung und -bindung. 48 Die Zukunftsbedeutung der Messen als Vertriebskanal ist in Form von Nettoeffekten zunehmender und abnehmender Bedeutung abgebildet. 24 Fazit: Die klassische Trennung des Marketingmix in Kommunikations- und Vertriebsbzw. Absatzkanalpolitik, die sich auch in unterschiedlichen organisatorischen Zuständigkeiten in Unternehmen niederschlägt, darf einer abgestimmten, auf den Kundenstatus ausgerichteten Kundenkommunikation nicht entgegenwirken. Die Abstimmung von Vertriebs- und Kommunikationskanälen bestimmt deshalb zunehmend den Markenerfolg. Das Potenzial von Live Communication für Multi-Channel-Strategien und ECR-Initiativen wird zunehmend von den Unternehmen erkannt und genutzt. 2.6 Analyse der unternehmens- und branchenspezifischen Durchführung von Erfolgskontrollen bei Live Communication-Instrumenten Im Kern verkörpert die Kontrolle des Kommunikationserfolges eine Abfolge von SollIst-Vergleichen zwecks Abweichungsanalyse und Auswertung für nachfolgende Planungen.49 Sowohl die Zielsetzung, Strategien, Maßnahmen und die Art und Weise ihrer Realisation sollten somit ständig auf dem Prüfstand stehen.50 Dabei wird die Kontrolle der Entwicklungsschritte in der Vorbereitung, der laufenden Realisation und des Ergebnisses der einzelnen Kommunikationsmaßnahmen unterschieden. In der Studie Uniplan LiveTrends 2004/2005 wurde ermittelt, dass nur jedes zweite Unternehmen regelmäßige Erfolgskontrollen beim Einsatz von Kommunikationsmaßnahmen durchführt, wobei die Größe oder die Branche der Unternehmen keine signifikante Rolle spielen. Die praktizierten Methoden der Erfolgskontrolle von Kommunikation sind insgesamt stark einzeldisziplinär geprägt und weisen damit lediglich Teilaspekte der Gesamtkommunikation eines Unternehmens aus.51 Während es für viele Instrumente, wie der Klassischen Werbung oder dem Internet, durchaus bewährte Messverfahren gibt, verlässt man sich bei Messen, Events und Promotions wohl eher auf das Bauchgefühl. Als Gründe für die mangelnde Überprüfung der Maßnahmen wurden fehlende Verfahren sowie Zeit- und Kostenersparnisse angeführt. Wird der Erfolg geprüft, so sind die eingesetzten Controlling-Methoden meist wenig professionell. Von den Unternehmen, die angaben, regelmäßig ihren Erfolg zu prüfen, ziehen bspw. über 90% der 387 befragten Unternehmen in 2004 v.a. Kontaktzahlen und „subjektive Einschätzungen“ für die Messung heran.52 49 50 51 52 Vgl. Kiene, G. (2003), S. 11ff. Vgl. Ehrmann, H. (2004), S. 349. Vgl. Piwinger, M./Porák, V. (Hrsg.) (2005), S. 47. Vgl. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S. 26. 25 Damit wird ein gravierendes Controlling-Defizit deutlich, das Fehleinschätzungen fördert und zu falschen Konsequenzen in der Budgetverteilung führt. So verwundert es bspw., dass die Klassische Werbung – beim Blick auf den Gesamtdurchschnitt – bei der Budgetverteilung sowohl in 2005 als auch in 2008 den größten Anteil erzielen wird, obwohl die Kundenbindung, Markentreue und Wiederkaufsrate zu den Zielen gehören, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen.53 Betrachtet man die Kommunikation phasenspezifisch54, so spricht sich die Mehrheit der befragten Unternehmen dafür aus, dass sich die Klassische Werbung v.a. zur Erhöhung der Markenbekanntheit eignet. Nur knapp 6% der Unternehmen schätzen die Eignungsqualität der Klassischen Werbung, wenn es um die Stärkung der Kundenbindung geht. Gerade bei einem durchschnittlichen Stammkundenanteil von 74,2% und einer stagnierenden Marktentwicklung, die 39,9% der befragten Unternehmen wahrnehmen, hätte man bei der Klassischen Werbung eine andere Platzierung im Budgetranking erwartet. Starre Denkmuster sorgen für risikoaverses Verhalten bei der Budgetfestlegung und verhindern immer noch wichtige Weichenstellungen. Uniplan LiveTrends 2006 fragte in diesem Jahr weiter nach, ob die Budgets für Erfolgskontrollen schon von Projektbeginn an eingeplant werden und wie viel Prozent des Budgets für die Erfolgskontrolle vorgesehen sind. Die Hälfte der befragten Unternehmen plant ein festes Budget für die Erfolgskontrolle ein. Davon berücksichtigen zwei Drittel der befragten Unternehmen bis zu 5% ihres Budgets. Durchschnittlich sind es sogar 6,6%, da es einige wenige „VorzeigeUnternehmen“ gibt, die mehr als 10% ihres Budgets für die Erfolgskontrolle vorsehen. Auf die Live Communication bezogen, heißt das: Misst ein Unternehmen den ROI einer Leitmesse, so investiert es gerade einmal 10.000 € für das Monitoring und damit einen Bruchteil dessen, was der gesamte Markenauftritt kostet. Hier bestehen eindeutig noch Optimierungspotenziale. Die Ausführungen sind in Abbildung 9 zusammengefasst dargestellt. 53 54 Bauer Media KG (Hrsg.) (2005), S. 5. Siehe dazu die Ausführungen in Kap. 2.3. 26 „Planen Sie von Projektbeginn an ein festes Budget für die Erfolgskontrolle mit ein?“ „Wie viel Prozent Ihres Budgets planen Sie für die Erfolgskontrolle ein?“ „Welchen Betrag würden Sie für die Erfolgskontrolle einer Leitmesse maximal ausgeben?“ max. Betrag für die Erfolgskontrolle einer Leitmesse Budgetanteil für die Erfolgskontrolle 5,5% 33,7% 31,3% bis 5.000 € 15,4% 5.000 - 10.000 € 35,4% 10.000 - 15.000 € 42,7% nein ∅ Budgetanteil von 6,6% ja 57,3% 15.000 - 25.000 € 13,2% 25.000 - 35.000 € 35.000 - 50.000 € über 50.000 € 45,4% Budgetanteil von bis zu 2,5% Budgetanteil größer 2,5% bis 5% Budgetanteil größer 5% bis 10% Budgetanteil größer 10% 2005 n max = 163 Abbildung 9: Erfolgskontrolle des Gesamtdurchschnitts Die branchenbezogene Analyse zeigt: Die Supplier-, Industry- und AutomotiveBranche verwenden den geringsten Budgetanteil für die Erfolgskontrolle (vgl. Abbildung 10). In der Supplier-Branche wird sogar mehrheitlich angegeben, dass kein festes Budget von Projektbeginn an eingeplant wird. Zur „Ehrenrettung“ der AutomotiveBranche muss angemerkt werden, dass fast die Hälfte aller Marketingmanager zumindest für die Erfolgskontrolle von Leitmessen ein überdurchschnittliches Budget von 15.000 bis 25.000 € vorsieht. Hierfür verwenden die Entscheider der IndustryBranche mehrheitlich nur ein Budget bis 10.000 €, merken allerdings selbst an, dass sie sowohl bei der konsequenten Dokumentation der Messegespräche, als auch bei der Bewertung der Messekontakte nach A/B/C-Kunden, Potenziale zur Effizienzsteigerung haben. Die Fashion- und Health-Branche gehören zu den Branchen, die einen überdurchschnittlichen Budgetanteil von über 10% für die Erfolgskontrolle vorsehen. In der Health-Branche wird von fast einem Zehntel der Unternehmen sogar ein Budget über 50.000 € für die Erfolgskontrolle der Leitmessen angesetzt. Daher sehen sie auch in der Dokumentation der Messegespräche und in der Bewertung der Messekontakte weniger Effizienzsteigerungspotenziale als der Durchschnitt. 27 „Wie viel Prozent Ihres Budgets planen Sie für die Erfolgskontrolle ein?“ 38,4% 54,6% 16,7% 41,6% 42,9% 26,1% 24,0% 31,8% Budgetanteil von bis zu 2,5% Budgetanteil größer 2,5% bis 5% Budgetanteil größer 5% bis 10% Budgetanteil größer 10% 41,7% Supplier Health 0% 42,9% Automotive 30,8% 13,6% 20,0% 52,0% 46,2% 27,3% 4,0% 60,9% 38,4% Finance 36,3% 4,3% 8,7% 42,8% 28,6% Fashion- / Lifestyle 20% 4,8% 9,5% 21,4% 15,4% 60% 40% 7,1% Industry Goods 18,2% 7,7% 7,7% Touristik 80% 15,4% Food & Beverages 18,2% High Tech 100% 2005 n max = 398 Abbildung 10: Erfolgskontrolle der Branchen Ein professionelles Management erfordert einen anderen Umgang mit dem Thema Erfolgskontrolle. Es kann immer noch beobachtet werden, dass offensichtlich eine gewisse Scheu vor dem Wort Kontrolle existiert.55 Erfolgskontrolle hat das Image eines überflüssigen Kostenfaktors. Doch die Marketingmanager sollten diese nicht als Maßnahme betrachten, die ausschließlich Geld kostet und Fehler aufdecken will, sondern als eine Anregungsfunktion, mit der sich Geld sparen lässt. Nur so wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess in der Zielerreichung in Gang gesetzt. Fazit: Erfolgreiche Markenführung wird an der effektiven und effizienten Erreichung der angestrebten Ziele gemessen. Trotz der wachsenden Bedeutung der strategischen und operativen Markensteuerung fehlt es bisher an leistungsfähigen Ansätzen einer integrativen Kontrolle des Kommunikationserfolges. Nur etwa jedes zweite Unternehmen sieht es als Notwendigkeit an, für diese Kontrolle von Projektbeginn an ein festes Budget bereitzustellen, wenngleich ein früh angedachtes Konzept der Erfolgskontrolle ein erster Schritt zur gezielten Effizienzsteigerung ist. 55 Vgl. Ehrmann, H. (2004), S. 349. 28 3. Profilierungspotenziale von Messen und Events 3.1 Austauschbarkeit als Profilierungsproblem von Messen und Events Bereits in der Studie Uniplan LiveTrends 2004/2005 betonten die Marketingmanager den Stellenwert der Live Communication zur Demonstration von Markenqualitäten und zur erlebnisorientierten Darstellung von Markenwelten. Drei Viertel aller Marketingmanager halten die Live Communication für einen geeigneten Kanal zur Wettbewerbsdifferenzierung. Doch die Ergebnisse bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück und signalisieren erhebliche Optimierungspotenziale. Denn auf die Frage, ob die Marketingmanager Messeauftritte bzw. Eventinszenierungen am Markt mehr oder weniger für austauschbar halten, antworteten nahezu zwei Drittel der Befragten, dass sich die Messeauftritte in ihrer Branche gleichen.56 Bei Events sind 62% dieser Meinung (vgl. Abbildung 11). „Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage über die Wahrnehmung und Inszenierung zu: Im Grunde genommen sind viele Messeauftritte bzw. Eventinszenierungen am Markt mehr oder weniger austauschbar.“ Messeauftritte Eventinszenierungen 8,1% 7,9% 21,7% 19,2% 30,5% 27,2% 42,4% 42,9% stimme voll und ganz zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu 2004 n max = 387 Abbildung 11: Austauschbarkeit von Messeauftritten und Eventinszenierungen Damit haben die Unternehmen ihr wichtigstes Ziel verfehlt, sollten doch gerade Live Communication-Instrumente zur Wettbewerbsdifferenzierung genutzt werden. „Messeauftritte von der Stange“57 scheinen somit im extremen Widerspruch zur geforderten „Uniqueness“ in der Markenführung zu stehen. Die Einzigartigkeit kann erreicht 56 57 Auch andere Studien, wie z.B. die repräsentative Studie Messe- und Kommunikationsbau in Deutschland 2005, belegen, dass Messe- und Kommunikationsbauten in Deutschland noch nicht in ausreichendem Maße markenadäquat sind. Die Marke als Maßstab baulicher Umsetzung wird somit in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Vgl. Holtmann Messe+Event GmbH et al. (Hrsg.) (2005), S. 4. Vgl. Zanger, C. (2003), S. 1073.; Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a), S. 19f. 29 werden, wenn die Gestaltungselemente der Messeauftritte und Eventinszenierungen konsequent aus der Markenstrategie und den Zielen der Unternehmen abgeleitet werden. Nur auf diese Weise lassen sich Markenbotschaften glaubhaft zum Kunden transportieren. Dabei können im Vergleich zu Print-, TV oder Hörfunkmedien bei der Live Communication alle Sinnesorgane der Zielgruppe angesprochen werden.58 Die Inszenierung von Infomotion59 und die Verankerung von Markenerlebnissen auf Messen und Events wird durch die übergreifende Ansprache multisensualer Reize, d.h. visueller60 (wie Bilder Formen, Farben, Licht), auditiver (wie Musik, Geräusche, Sprache), taktiler (wie Oberflächen, Böden), olfaktorischer (wie Gerüche), gustatorischer (wie Geschmack) und thermaler Ausprägung (wie Temperaturbedingung) ermöglicht.61 Dies impliziert, dass sich die Unternehmen in Zukunft mit einer stärkeren Multisensorischen Markenführung auseinandersetzen sollten. Die systematische Übersetzung der Markenwerte in alle Sinneskanäle bietet verbesserte Differenzierungsoptionen im Sinne einer Unique Advertising Proposition (UAP).62 Letztlich entscheidet jedoch die Umsetzung eines ganzheitlichen und authentischen Markenerlebnisses über alle Kundenberührungspunkte hinweg signifikant über den Erfolg oder Misserfolg der Unternehmenskommunikation. 3.2 Analyse der Differenzierungsdimensionen von Messen und Events Die Differenzierung bezeichnet ganz allgemein den Prozess der Unterscheidung. Für Unternehmen bedeutet dies, im Positionierungs-/ Wahrnehmungsraum so nahe wie möglich am Ideal der Zielgruppe und idealerweise zugleich so weit wie möglich entfernt von den Konkurrenzmarken zu sein.63 Erreichbar wird diese Alleinstellung u.a. durch das Besetzen einer strategischen Nische, die Einbeziehung neuer Eigenschaftsdimensionen und die Schaffung eines psychologischen Zusatznutzens. 58 59 60 61 62 63 Lindstrom äußert sich in seinem aktuellen Buch brand sense wie folgt: „Wenn Marken sich in Zukunft die Loyalität der Konsumenten verschaffen und erhalten wollen, brauchen sie eine Strategie, die alle Sinne anspricht.“ Vgl. dazu Lindstrom, M. (2005), S. 7. Infomotion bedeutet die Vermittlung von Information mittels Emotionen. Vgl. dazu Erber, S. (2000), S. 132ff. Drei Viertel aller Informationen werden über die Augen wahrgenommen. Vgl. dazu ebenda, S. 135. Vgl. Thiemer, J. (204), S. 168; Hensel, C. (2005), S. 196f. Die Einzigartigkeit der Kommunikationsstrategie (UAP) sollte dem Kunden den einmaligen Produktnutzen im Sinne der Unique Selling Proposition (USP) vermitteln. Vgl. Meffert, H. (2000), S. 711. Vgl. Herrmann, S. (2005), S. 169. Soberman dagegen relativiert die Bedeutung der Differenzierung, da seiner Meinung nach alle Beteiligten nur über unvollkommene Informationen in der Realität verfügen. Er kommt daher zu der Einschätzung, dass die Differenzierung möglicherweise keine profitable Strategie ist und Ressourcen vergeudet. Vgl. dazu Soberman, D. A. (2003), S. 130ff. 30 Uniplan LiveTrends 2006 ist der Frage nachgegangen, welche Kriterien geeignet sind, um sich vom Messeauftritt bzw. von der Eventinszenierung des Wettbewerbers zu unterscheiden. Für die Verbesserung der Profilierungswirkungen eines Messestandes rückt nach Ansicht der befragten Unternehmen der Mensch in den Mittelpunkt. Je motivierter und qualifizierter das Standpersonal ist und je glaubwürdiger die Markenbotschaft kommuniziert wird, um so größer sind die Chancen eine besondere Atmosphäre auf dem Stand herzustellen, in der sich die Besucher wohlfühlen können (vgl. Abbildung 12). Wer es also schafft, eine besondere „Standatmosphäre“ auszulösen, macht aus einem Messeauftritt ein unverwechselbares Messeerlebnis. Der „Hardware“ des Standes, d.h. der Architektur oder Produktpräsentation wird derzeit eine eher geringe Differenzierungswirkung zugesprochen. „Welche der folgenden Messeparameter eignen sich zur Differenzierung Ihrer Messebeteiligungen gegenüber anderen Wettbewerbern?“ MW Atmosphäre auf dem Stand (1,8) Wissen des Standpersonals (1,6) Kommunikation der Markenbotschaft (1,9) Standort in der Halle (1,8) Corporate Design (1,9) Standarchitektur (2,0) Produktpräsentation (2,0) Markenimage der Veranstaltung (2,1) begleitende Kommunikation (2,2) Vernetzung der K.-Instrumente (2,2) Standaufteilung (2,4) Multimediale Medieninszenierung (2,5) Showprogramm (2,7) kein (4) -80% -60% 4 gering (3) -40% -20% hoch (2) 0% 20% 40% 2,5 60% 80% 100% 1,5 1 2005 n Abbildung 12: MW sehr hoch (1) max = 199 Differenzierungsdimensionen von Messeauftritten Bei der Einschätzung der Profilierungswirkungen einer Eventinszenierung wird als erstes ebenfalls die Atmosphäre auf der Veranstaltung genannt. Die Kommunikation der Markenbotschaft und das Erleben der Markenwelt am richtigen Ort ist den Unternehmen hierbei zur Differenzierungswirkung wichtiger als die Einladung prominenter Gäste oder der Einsatz von Hostessen (vgl. Abbildung 13). 31 „Welche der folgenden Eventparameter eignen sich wie gut zur Differenzierung Ihrer Eventinszenierungen gegenüber anderen Wettbewerbern?“ MW Atmosphäre auf der Veranstaltung (1,7) Kommunikation der Markenbotschaft (1,9) Location (2,0) Erleben der Markenwelt (2,0) Markenimage der Veranstaltung (2,0) Produktpräsentation (2,0) Dekoration und Ausstattung (2,1) Vernetzung der Komm.-Instrumente (2,2) Bewirtung und Catering (2,4) Showprogramm (2,5) Multimediale Medieninszenierung (2,5) Prominente Gäste (2,6) Einsatz von Hostessen (2,7) kein (4) -80% -60% 4 gering (3) -40% -20% hoch (2) 0% 20% 40% 2,5 60% 80% 100% 1,5 1 2005 n Abbildung 13: MW sehr hoch (1) max = 193 Differenzierungsdimensionen von Eventinszenierungen Wenn die Atmosphäre für die Unternehmen sowohl bei Messeauftritten als auch bei Eventinszenierung eine so wesentliche Rolle zur Differenzierung darstellt, so gilt es diese im Folgenden näher zu analysieren: Atmosphäre wird als Stimmung verstanden, die von der äußeren Umgebung vermittelt und von der Zielgruppe subjektiv empfunden wird. Als charakteristisches und abgrenzendes Merkmal zugleich gegenüber Emotionen, Gefühlen, Motiven und Bedürfnissen ist die Ungerichtetheit anzuführen, was bedeutet, dass Stimmungen nicht auf ein bestimmtes Objekt gerichtet sind.64 Zur näheren Begriffsbeschreibung lässt sich die Studie von Becker (1988) heranziehen, der 72 Adjektive auf ihre Güte untersuchte und nach mehreren Faktorenanalysen zu folgender Dimensionseineinteilung von Stimmungen kam: Aktiviertheit vs. Deaktiviertheit, gehobene vs. gedrückte Stimmung und emotionale Gereiztheit vs. Ausgeglichenheit.65 Da die Stimmungsforschung in der Psychologie erst seit gut zwei Jahrzehnten und im Marketing erst seit kurzem verstärkt betrieben wird, sind die Erkenntnisse auf diesem Gebiet z. T. noch recht rudimentär. Die zentrale und inzwischen gesicherte Erkenntnis lautet jedoch, dass der Erfolg marketingpolitischer Beeinflussung in einem nicht zu unterschätzenden Ausmaß von der Stimmung der Zielgruppe abhängt.66 Stimmungen beeinflussen nicht nur das Wahrnehmen, Speichern und Erinnern, sie 64 65 66 Vgl. Nufer, G. (2002), S. 122. Vgl. Becker, P. (1988), S. 345ff.; Piesinger, E. (2003), S. 5. Vgl. Silberer, G. (1999), S. 131; Nufer, G. (2002), S. 122. 32 können selbst auch als Information dienen.67 Damit wird das Ergebnis der LiveTrends 2006-Studie zu den Differenzierungsdimensionen auf Messen und Events bestätigt. Auch wenn die hohe Austauschbarkeit zeigt, dass die Unternehmen derzeit noch Probleme haben, ihre Markenbotschaft stimmungsvoll zu kommunizieren. Wird im Messe- und Event-Marketing bei der direkten und persönlichen Interaktion zwischen Aussteller und Besucher neben der zielgruppenspezifischen Ansprache auf eine positive Atmosphäre geachtet, können einzigartige und nachhaltige Markenassoziationen geprägt werden. Fazit: Die Mehrzahl der Messeauftritte und Eventinszenierungen sind austauschbar. Die Möglichkeiten zur Differenzierung werden bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Messestand- und Eventgestaltung und -technik stellen dabei jedoch nur unterstützende Elemente dar. Im Vordergrund steht die glaubwürdige Vermittlung von Fachund Sozialkompetenz des Standpersonals und der Markenbotschaft für die Schaffung einer optimalen Standatmosphäre. Das zielgruppenspezifische Eingehen auf die Messe- und Eventbesucher stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. 3.3 Bedeutung und Entwicklung von Messen Die Messewirtschaft nimmt im weltweiten Vergleich in Deutschland eine Sonderrolle ein. Von den global führenden Messen der einzelnen Branchen finden nach Aussage des AUMA-Verbandes gegenwärtig zwei Drittel in Deutschland statt. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet dies: Jährlich werden rund 154 internationale Messen und Ausstellungen mit über 160.000 Ausstellern und knapp 10 Mio. Besuchern durchgeführt.68 Es ist daher wenig überraschend, dass die Unternehmen den Messebeteiligungen einen hohen Stellenwert beimessen. Im Budgetranking belegen sie – wie schon im Vorjahr – den zweiten Platz nach der Klassischen Werbung. Damit zählt die Messebeteiligung auch weiterhin zu einem der wichtigsten Instrumente im Kommunikationsmix. Über zwei Drittel der Marketingmanager stuft die Bedeutung von Messen als Vertriebsschiene in der Zukunft als gleich bleibend hoch ein (vgl. Abbildung 14). Für 20,6% der befragten Unternehmen – v.a. aus der Food- und High Tech-Branche – 67 68 Vgl. Nufer, G. (2002), S. 123. Vgl. AUMA Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (Hrsg.) (2005), S. 14. 33 fällt diese Vorhersage negativ aus. 11,3% der befragten Unternehmen – v.a. aus der Finance-, Health- und Industry-Branche – rechnen indessen mit einer Bedeutungszunahme der Messen. „Wird in Zukunft die Bedeutung von Messen als Vertriebsschiene für Ihr Unternehmen zunehmen, gleich bleiben oder abnehmen?“ „Worin sehen Sie die wichtigsten Gründe für die Zunahme bzw. Abnahme?“ (offene Abfrage) Gründe für die Abnahme: 20,6% 11,3% - Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht Gründe für die Zunahme: - Internationalisierung von Messen schreitet voran - Messekosten sind zu hoch - Emotionalisierung lässt sich durch Eventcharakter erreichen - Messe-Effektivität ist nicht vorhanden - Messbarkeit ist schwierig - Bekanntheitsgrad lässt sich erhöhen - direkter Kundenkontakt bereits vorhanden - Kundennähe ist möglich - direkter Kundenkontakt ist möglich - Bedeutung alternativer Kommunikationsinstrumente wächst - Pflege und Gewinnung von Kunden ist möglich - Messeziele werden nicht erreicht - (ausschließlich) Image- und Präsenzpflicht 68,1% - Attraktivität von Messen sinkt - Besucherzahlen auf Messen sinken - Demonstration von Image- und Markenstärke - Abverkauf lässt sich erhöhen - Abverkauf auf Messen ist rückläufig abnehmen Abbildung 14: max gleich bleiben zunehmen 2005 n = 398 max Zunahme: n = 44 max Abnahme: n = 80 Zukunftsbedeutung von Messen als Vertriebsschiene Ihre Beliebtheit ist maßgeblich auf ihre Multifunktionalität zurückzuführen, d.h. mit Messen können Aussteller und Besucher eine breite Palette an Zielen im Kundenbeziehungszyklus ansteuern. Sie dienen der Kundengewinnung ebenso wie der Kundenpflege und -bindung. Damit avancieren sie zu einem „Allround-Instrument“ für das Management von Kundenbeziehungen. Dennoch steht die Messebeteiligung wegen ihres relativ hohen Kosten- bzw. Budgetanteils bei vielen Unternehmen auf dem Prüfstand. Nicht zuletzt führt die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit dazu, dass Unternehmen einer erhöhten Komplexität und Fragmentierung bei der Festlegung ihres Messeveranstaltungsportfolios ausgeliefert sind. So werden in zunehmendem Maße auch mit Unterstützung der deutschen Messegesellschaften im Ausland, wie z.B. China, neue Branchenmessen angeboten. Damit stellt sich die Frage, inwieweit bestehende Leitmessen ihre Position noch behaupten können oder ob substitutiv oder ergänzend neue Messeveranstaltungen zur Markterschließung in das Portfolio aufzunehmen sind.69 Gleichzeitig steht die Messe als Kommunikationsinstrument im Wettbewerb mit einer Vielzahl anderer Kommunikationsinstrumente. Die Herausforderung wird in den kommenden Jahren darin bestehen, Lösungen für das Effizienzproblem zu finden, um sich auch 69 Vgl. Kirchgeorg, M. (2005), S. 96f.; Kirchgeorg, M./ Springer, C. (2005b), S. 36ff. 34 weiterhin gegen alternative Kommunikationsinstrumente durchsetzen zu können. Fazit: Über zwei Drittel der Marketingmanager stuft die Bedeutung von Messen im Kommunikationsmix als gleich bleibend hoch ein. Die Stärken werden v.a. darin gesehen, einen internationalen Markteintritt zu ermöglichen und den direkten Kundenkontakt zu intensivieren. Als Herausforderung gilt es, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu harmonisieren, in denen kritische Stimmen den Hauptgrund für eine Konsolidierung der Messen sehen. 3.4 Analyse von Messekonzepten der Zukunft Die Messe hat sich im Laufe der Jahrhunderte in mehreren Entwicklungsstufen70 – von der Tauschmesse zur Warenmesse, von der Mustermesse zur Fachmesse – zu einem multifunktionalen Marketing- und Kommunikationsinstrument moderner Prägung entwickelt. Messen sind Marktplattformen und damit Spiegel nationaler und internationaler Märkte. Derzeit befindet sich die Messewirtschaft u.a. durch Globalisierungseinflüsse in einem Strukturwandel. Weltweit entstehen zahlreiche neue Messeplätze, etablierte Messen bauen ihre Ausstellungsfläche und Infrastruktur weiter aus und Messen wechseln im In- und Ausland den Veranstaltungsort. Diese Veränderungen auf Aussteller- und Besucherseite beschleunigen den Veränderungsdruck traditioneller Messekonzepte.71 Deshalb ist es für alle Beteiligten wichtig, sich den Anforderungen an Messekonzepte der neuen Generation zu stellen, um adäquat auf diese Veränderungen reagieren zu können. Die Mehrheit der befragten Unternehmen wünscht sich weniger neue, sondern eine Weiterentwicklung bestehender Messekonzepte. Der künftige Messe-Mehrwert besteht in einer zielgruppenorientierten und professionellen Messekommunikation aller Beteiligten (vgl. Abbildung 15). Der Trend, dass sich die Messegesellschaften vom Flächenanbieter zu einem kundenorientierten Servicedienstleister entwickeln, entspricht der von den Ausstellern geforderten Zielgruppenorientierung. Die Messen können Aussteller und Besucherzielgruppen nur erfolgsversprechend identifizieren, wenn sie in enger Abstimmung mit Ausstellern, Verbänden und Multiplikatoren eine zielgerechte Positionierung einer Messe definieren, konzipieren und umsetzen72. 70 71 72 Zur Geschichte der Messen vgl. auch Rodekamp, V. (2003), S. 5f. Vgl. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005b), S. 37. Vgl. u.a. Schraudy, K. (2003), S. 491; Witt, J. (2003), S. 506ff.; Grimm, C. (2004), S. 39ff.; Robertz, G. (1999), S.42ff. 35 „Wie müsste die 'neue Generation’ von Messen ihrer Meinung nach aussehen? Welche Chancen sollten Messegesellschaften und Aussteller besser nutzen?“ (offene Abfrage) Fokussierung auf Zielgruppen 7,4% Nutzung des Eventcharakters 5,2% Mehr Messemarketing/ Messewerbung 4,5% 4,0% Stärkere Profilierung / Positionierung Verbesserung der Infrastruktur 3,8% Reduktion der Kosten 3,6% Konzentration der Messen Mehr Service für Aussteller Stärkere Kundenorientierung 3,3% 2,6% 2,4% 2005 n max = 221 Abbildung 15: Anforderungen an Messekonzepte der Zukunft Den Messenveranstaltern kommt somit die Aufgabe zu, die richtigen Anbieter und Nachfrager eines Marktes zusammenzubringen und die Rahmenbedingungen für ein effektives und effizientes Marktgeschehen zu schaffen. Je mehr es gelingt, aus einer Messe eine „Messe-Marke“ mit eindeutiger Positionierung zu machen, desto größer sind die Zukunftschancen.73 Vom Veranstalter wird darüber hinaus verlangt, dass er den Ausstellern neben der temporär gemieteten Immobilie Marketingunterstützung bietet, d.h. weg vom bloßen Flächenvermieter hin zum Anbieter von integrierten Kommunikationsleistungen und zum verlässlichen „Partner des Kunden“. Zur Aufklärung über professionelles Messemarketing gehört auch, dass der Veranstalter seine Aussteller-Kunden mit auf Messemarketing und -kommunikation spezialisierten Fachleuten in Verbindung bringt. In gleicher Weise sind die Fachleute gefordert, die Messekonzepte weiterzuentwickeln. Agenturen und Messebauer müssen in der Lage sein, das „Gesamtbild“ zu sehen und mit entsprechenden Spezialisten zusammen zu arbeiten. Eine wirkungsvolle Architektur in Kombination aller anderen Gestaltungselemente ist Kommunikation per se. Das Hallen- und Standambiente und die direkte und persönliche Interaktion für ein aktives Erlebnis der Zielgruppe wird zukünftig mehr Beachtung erfahren müssen. Der Erfolg von Messen wird zukünftig mehr denn je durch das abgestimmte Zusammenspiel von Messeveranstaltern, Ausstellern, Agenturen und Besuchern im nationalen wie im internationalen Kontext bestimmt. Trotz des postulierten Umbruchs, mit 73 Vgl. Kirchgeorg, M./Klante, O. (2003b), S. 365ff.; Peters, M./Scharrer, S. (2003), S. 549ff.; Sasserath, M./Daly, N./Wenhart, C. (2003), S. 529ff. 36 dem sich die Messebranche auseinander setzen muss, kann die wirtschaftliche Zukunft verheißungsvoll sein. Fazit: Von Messen der zukünftigen Generation wird eine verstärkte Zielgruppenfokussierung erwartet. Sowohl in der Themensetzung, Ansprache als auch in der Positionierung wird der Zielgruppenbezug verstärkt gefordert. Dieser Anspruch beinhaltet große Herausforderungen für die Messegesellschaften zwischen Fokussierung und Fragmentierung der Messethemen die richtige Balance zu finden. Dies kann nur erreicht werden, wenn Messegesellschaften sich zukünftig auf die Anforderungen der Aussteller- und Besuchergruppen intensiv einstellen. Das Thema Kundenorientierung und „Verstehen des Ausstellergeschäftes“ avancieren somit zukünftig zu zentralen Erfolgsfaktoren des Messegeschäftes. 37 4. Sonderauswertung: Einsatz von Live Communication-Instrumenten zur Weltmeisterschaft 2006 Aus einer Vielzahl von Bewerbern erhielt Deutschland am 6. Juli 2000 durch das Exekutivkomitee des Fußballweltverbandes (FIFA) den Zuschlag für die Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2006. Die WM ist eines der herausragensten Sportereignisse in der Welt und bietet Deutschland als Ausrichtungsland die seltene Chance, sich der breiten Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Die Spiele werden weltweit live übertragen und ziehen wie kaum ein anderes Sportereignis die globale mediale Aufmerksamkeit auf sich. Nach aktuellen Schätzungen erreicht die WM mit sämtlichen Spielen etwa 388 Millionen TV-Zuschauer. 3,5 Millionen Zuschauer in den Stadien werden zur WM erwartet, davon 1,5 Millionen aus dem Ausland. Des Weiteren werden 15.000 Journalisten aus aller Welt aus Deutschland berichten.74 Deutschland tritt als Gastgeber mit dem WM-Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ an. Gastlichkeit und Freundlichkeit sind keineswegs die primären Dimensionen, die das Deutschlandbild bisher prägten. Eher werden Attribute wie Gewissenhaftigkeit, Organisationstalent und Fleiß im Ausland eher als deutsche Tugenden gesehen. Die WM kann das Image der Marke Deutschland deutlich „aufpolieren“. Schubkraft erlangt das Motto jedoch nur, wenn alle Austragungsstädte sowie letztlich die Bundesbürger bis hin zu den öffentlichen Institutionen als Gastgeber mit ihren Aktivitäten gezielt auf das Motto „einzahlen“. 83% der befragten Unternehmen sehen hierfür gute Vorzeichen, denn sie schätzen die Bedeutung der Weltmeisterschaft hinsichtlich des Imagegewinnes für Deutschland hoch bis sehr hoch ein.75 Zu den wichtigsten Instrumenten, die von den Unternehmen spezifisch für die Fußballweltmeisterschaft genutzt werden, zählen Events, gefolgt von Promotion und klassischer Werbung (vgl. Abbildung 16). Das heißt, hier setzen sich die Live Communication-Instrumente gegen die klassischen Kommunikationsinstrumente durch. 74 75 Die sozio-ökonomischen Auswirkungen der WM 2006 auf die Stadt Leipzig wurden im Sommersemester 2005 in einem Praxisprojekt am Lehrstuhl Marketingmanagement der HHL – Leipzig Graduate School of Management in Zusammenarbeit mit dem WM-Büro der Stadt Leipzig analysiert. Auch andere Studien bestätigen, dass die Weltmeisterschaft vor allem als gute Werbung für Deutschland angesehen wird. Vgl. dazu u.a. Voeth, M. (2001), S. 14f. 38 „Welche Bedeutung hat die Weltmeisterschaft 2006 hinsichtlich des Imagegewinnes für Deutschland? Wenn Sie das WM-Thema aufgreifen, so nennen Sie uns bitte die 3 wichtigsten Marketingaktivitäten, die Sie durchführen werden.“ (offene Abfrage) 1,8% 15,2% 35,0% Ranking der wichtigsten Marketingaktivitäten zur Weltmeisterschaft 2006: 1. Events 2. Promotion/ POS-Aktivitäten 3. Klassische Werbung 48,0% stimme voll und ganz zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu Abbildung 16: Imagebedeutung und Marketingaktivitäten der WM 2006 2005 n max = 394 39 5. Zusammenfassung und Ausblick Die Studie UNIPLAN LiveTrends 2006 repräsentiert das Meindungsbild von 398 Marketingmanagern aus neun Branchen zum Status Quo, den Entwicklungsperspektiven, den Planungsprozessen sowie den Erfolgswirkungen von Live CommunicationInstrumenten. Im Folgenden liefern 8 Thesen einen zusammenfassenden Überblick über die Schlüsselergebnisse der Studie. These 1: Stammkundenbindung erlangt in gesättigten Märkten besondere Priorität Die Stammkunden prägen in allen Branchen die Kundenstruktur, während die Neukundengewinnung zunehmend Grenzen erfährt. Angesichts des zunehmenden Kundenwettbewerbs und der Sättigungserscheinungen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, das Potenzial ihrer Stammkunden optimal auszuschöpfen. Der Einsatz der effizientesten Kommunikationsinstrumente zum richtigen Zeitpunkt im Kundenbeziehungszyklus avanciert hierbei zum zentralen Erfolgsfaktor. These 2: Kommunikationsmix ist spezifisch im Kundenbindungszyklus auszusteuern Die Kunst der effizienten Bindung von Kunden erfordert ein differenziertes Vorgehen im Kundenbindungszyklus. Gerade in wettbewerbsintensiven Märkten gewinnt die Aussteuerung der richtigen Kommunikationsinstrumente im Kundenbindungszyklus eine besondere Relevanz. Dabei sind auch die Kundenkontakte durch die Vertriebskanäle bei der Kommunikationsplanung zu berücksichtigen. Während die Klassische Werbung als Treiber der Markenbekanntheit eingesetzt werden kann, so verliert sie, wenn es um die Stärkung der Kundenbindung geht. Events und Messen punkten bei Erstkontakten, Vertrauensaufbau und Kundenbindung und avancieren zu „AllroundInstrumenten“ im Kundenbeziehungszyklus. These 3: Live Communication-Instrumente gehören zu den budgetstärksten Kommunikationsinstrumenten Die Unternehmen reagieren recht verhalten, wenn es darum geht, neue Trends bei der Budgetverteilung zu berücksichtigen. So nimmt die Klassische Werbung – gemessen an der aktuellen Budgetverteilung – weiterhin in allen Branchen einen Leit- 40 charakter ein und Live Communication-Instrumente gehören branchenübergreifend zu den Top 3 der budgetstärksten Instrumente. Die Neuen Medien dagegen werden bei der Budgetverteilung ihrem Wachstumspotenzial noch nicht gerecht. Für das Jahr 2008 haben die Unternehmen höhere Budgets für ihren Kommunikationsmix veranschlagt. These 4: Kommunikationsmix und Multi-Channel-Strategie im Vertrieb sind zur Optimierung des Kundenkontaktes zu koordinieren Die klassische Trennung des Marketingmix in Kommunikations- und Vertriebs- bzw. Absatzkanalpolitik, die sich auch in unterschiedlichen organisatorischen Zuständigkeiten in Unternehmen niederschlägt, darf einer abgestimmten, auf den Kundenstatus ausgerichteten Kundenkommunikation nicht entgegenwirken. Eine Abstimmung von Multi-Channel-Strategie und Kommunikationsmix ist notwendig. Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen Tendenzen auf, dass sich Veränderungen in der Vertriebskanalgestaltung auch Auswirkungen auf den zukünftigen Einsatz von Kommunikationsinstrumenten. These 5: Erfolgskontrolle wird auf Low-Budget-Niveau vernachlässigt Erfolgreiche Markenführung wird an der effektiven und effizienten Erreichung der angestrebten Ziele gemessen. Trotz der wachsenden Bedeutung der strategischen und operativen Markensteuerung fehlt es bisher an leistungsfähigen Ansätzen einer integrativen Kontrolle des Kommunikationserfolges. Nur etwa jedes zweite Unternehmen sieht es als Notwendigkeit an, für diese Kontrolle von Projektbeginn an ein festes Budget bereitzustellen, wenngleich ein früh angedachtes Konzept der Erfolgskontrolle ein erster Schritt zur gezielten Effizienzsteigerung ist. These 6: Atmosphäre gilt als wichtigster Differenzierungsfaktor auf Messen und Events Die Mehrzahl der Messeauftritte und Eventinszenierungen sind austauschbar. Die Möglichkeiten zur Differenzierung werden bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Messestand- und Eventgestaltung und -technik stellen dabei jedoch nur unterstützende Elemente dar. Im Vordergrund steht die glaubwürdige Vermittlung von Fach- und So- 41 zialkompetenz des Standpersonals und der Markenbotschaft für die Schaffung einer optimalen Standatmosphäre. Das zielgruppenspezifische Eingehen auf die Messeund Eventbesucher stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. These 7: Messebeteiligungen behaupten sich im Kommunikationsmix Über zwei Drittel der Marketingmanager stuft die Bedeutung von Messen im Kommunikationsmix als gleich bleibend hoch ein. Die Stärken werden v.a. darin gesehen, einen internationalen Markteintritt zu ermöglichen und den direkten Kundenkontakt zu intensivieren. Als Herausforderung gilt es, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu harmonisieren, in denen kritische Stimmen den Hauptgrund für eine Konsolidierung der Messen sehen. These 8: Zielgruppenfokussierung als Anforderung von Messen der neuen Generation Von Messen der zukünftigen Generation wird eine verstärkte Zielgruppenfokussierung erwartet. Sowohl in der Themensetzung, Ansprache als auch in der Positionierung wird der Zielgruppenbezug verstärkt gefordert. Dieser Anspruch beinhaltet große Herausforderungen für die Messegesellschaften zwischen Fokussierung und Fragmentierung der Messethemen die richtige Balance zu finden. Dies kann nur erreicht werden, wenn Messegesellschaften sich zukünftig auf die Anforderungen der Aussteller- und Besuchergruppen intensiv einstellen. Das Thema Kundenorientierung und „Verstehen des Ausstellergeschäftes“ avancieren somit zukünftig zu zentralen Erfolgsfaktoren des Messegeschäftes. IX Literaturverzeichnis AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (Hrsg.) (2005): Bilanz – Die Messewirtschaft 2004/2005, Bergisch-Gladbach 2005. Bauer H. H./Stokburger G./Hammerschmidt M.(2006): Marketing Performance - Messen, Analysieren, Optimieren, Wiesbaden 2006. Bauer Media KG (Hrsg.) (2005): MedienExpertenPanel – Zukunftsvisionen, 2. Welle, November 2005, Hamburg 2005. Bauer Media KG (Hrsg.) (2005): Konjunktur und Werbung 2005, Hamburg 2005. Bauer Media KG (Hrsg.) (2006): Konjunktur und Werbung 2006, Hamburg 2006. Becker, P. (1988): Skalen für Verlaufsstudien der emotionalen Befindlichkeit, in: Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie, Heft 35, S. 345369. Blattberg, R. C./Deighton, J. (1996): Manage Marketing by the Customer Equity Test, in: Harvard Business Review, Vol. 74, Nr. 4, S. 136-144. Bork, T. A. (1994): Informationsüberlastung in der Unternehmung – eine Mehrebenenanalyse zum Problem information overload aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Frankfurt am Main 1994. Bruhn, M. (2001): Relationsship Marketing – Das Management von Kundenbeziehungen, München 2001. Bruhn, M. (2005): Unternehmens- und Marketingkommunikation – Handbuch für ein integriertes Kommunikationsmanagement, München 2005. Bruhn, M./Georgi, D. (2005): Wirtschaftlichkeit des Kundenbindungsmanagement, in: Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbindungsmanagement, 5. Aufl., Wiesbaden, S. 589-619. Bruhn, M./Homburg, C. (2005): Kundenbindungsmanagement – eine Einführung, in: Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbindungsmanagement, 5.Aufl., Wiesbaden 2005, S. 1-37. Diller, H. (1995): Kundenlebenszyklus, in: Marketing Newsletter, Nr. 4, S. 1-4. X Diller, H. (1996): Kundenbindung als Marketingziel, in: Marketing ZFP, Heft 2, 2. Quartal 1996, S. 81-94. DIW/Prognos (Hrsg.) (1995): Künftige Entwicklung des Mediensektors – Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Basel, Berlin 1995. Domnick, I. (2005): Probleme sehen – Ansichtssache – Wahrnehmung von kartographischen Darstellungen als visuelle Kommunikationsmittel in der Entwicklungszusammenarbeit, Berlin 2005. Ehrmann, H. (2004): Marketing-Kontrolle, 4. Aufl., Ludwigshafen (Rhein) 2004. Erber, S. (2000): Eventmarketing – Erlebnisstrategien für Marken, Landsberg/Lech 2000. Esch, F.-R. (2005): Moderne Markenführung – Grundlagen, Innovative Ansätze, Praktische Umsetzungen, 4. vollst. überarb. und erw. Aufl., Wiesbaden 2005. Friedrichsen, M./Konerding, J. (2003): Abschlussbericht zur Studie „Integrierte Kommunikation“, Flensburg 2003. Georgi, D., (2005): Kundenbindungsmanagement im Kundenbeziehungszyklus, in: Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbindungsmanagement, 5. Aufl., Wiesbaden, S. 229-249. Grimm, C. (2004): Möglichkeiten und Grenzen des Beziehungsmarketing im Messewesen, Nürnberg 2004. Grimm, S./Röhricht, J. (2003): Die Multichannel Company – Strategien und Instrumente für die integrierte Kundenkommunikation, Bonn 2003. Hensel, C. (2005): Der Einfluss von Erlebnissen auf den Kaufentscheidungsprozess – am besonderen Beispiel der Industriegütermessen, Aachen 2005. Hermann, S. (2005): Corporate Sustainability Branding – Nachhaltigkeits- und stakeholderorientierte Profilierung von Unternehmensmarken, Wiesbaden 2005. Heun, F. W. (2002): Verlorene Kunden zurückholen, in: sales Business, Heft Dezember 2002, S. 20-22. Holtmann Messe+Event GmbH et al. (Hrsg.) (2005): Messe- und Kommunikationsbau in Deutschland 2005 – repräsentative Umfrage unter 238 Unterneh- XI mern und Marketingentscheidern von Mai bis August 2005, Hannover, Berlin, Frankfurt am Main 2005. Homburg, C./Giering, A./Hentschel, F. (1998): Der Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung, in: Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbindungsmanagement – Grundlagen, Konzepte, Erfahrungen, Wiesbaden 1998, S. 81-112. Homburg, C./Rudolph, B. (1995): Wie zufrieden sind Ihre Kunden tatsächlich?, in: Harvard Business Manager, 1/1995, S. 43-50. Jeker, K. (2002): Das Bindungsverhalten von Kunden in Geschäftsbeziehungen – Theoretische und empirische Betrachtung der Kundenbindung aus Kundensicht, Bern et al. 2002. Joho, C. (1996): Ein Ansatz zum Kundenbindungsmanagement für Versicherer, Bern 1996. Kiene, G. (2003): Erfolgsmessung von Marketing, Verkauf und PR – mit Beispielen aus der Mediabranche, Reinbek 2003. Kirchgeorg, M. (2005): Auslandsmessen öffnen die Tür für internationale Geschäfte, in: Absatzwirtschaft, 48 Jg., Nr. 10, S. 96-97. Kirchgeorg, M./Klante, O. (2003a): Trendbarometer Live Communication 2003 - Stellenwert und Entwicklung von „Live Communication“ im Kommunikationsmix – eine Analyse auf Grundlage einer branchenübergreifenden Befragung von Marketingentscheidern in Deutschland, Forschungsbericht, Kerpen, Leipzig 2003. Kirchgeorg, M./Klante, O. (2003b): Strategische Messemarketing, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement - Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S. 365390. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005a): Uniplan LiveTrends 2004/2005 – Effizienz und Effektivität in der Live Communication – eine Analyse auf Grundlage einer branchenübergreifenden Befragung von Marketingentscheidern in Deutschland, Arbeitspapier Nr. 67, Leipzig, Kerpen 2005. Kirchgeorg, M./Springer, C. (2005b): Messen ohne Zukunft?, in: marketingjournal, Heft 1-2, 2005, S. 36-40. XII Krafft, M. (2002): Kundenbindung und Kundenwert, Heidelberg 2002. Krafft, M./Götz, O. (2006): Der Zusammenhang zwischen Kundennähe, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung sowie deren Erfolgswirkungen, in: Hippner, H./Wilde, K. D. (Hrsg.): Grundlagen des CRM, 2. Aufl., Wiesbaden, 325-356. Kunz, H. (1996): Beziehungsmanagement – Kunden binden nicht nur finden, Freiburg 1996. Kunze, K. (2000): Kundenbeziehungsmanagement in verschiedenen Marktphasen, Wiesbaden 2000. Lasslop, I. (2003): Effektivität und Effizienz von Marketing Events - Wirkungstheoretische Analyse und empirische Befunde, Wiesbaden 2003. Lindstrom, M. (2005): Brand sense – build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound, New York 2005. Lorbeer, A. (2003): Vertrauen in Kundenbeziehungen, Wiesbaden 2003. Manager Bilanz (Hrsg.) (2002): Marketing und Kommunikation – steigende Kosten, sinkende Wirkung, Heft Oktober 2002, S. 29-33. Meffert, H. (2000): Marketing – Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung – Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele, 9. überarb. und erw. Aufl., Wiesbaden 2000. Nufer, G. (2002): Wirkungen von Event-Marketing – Theoretische Fundierung und empirische Analyse, Wiesbaden 2002. Oevermann, D. (1996): Kundenbindungsmanagement von Kreditinstituten, München 1996. Panzer, J. (2003): Dynamische Kundenbewertung zur Steuerung von Kundenbeziehungen, Diss., Leipzig 2003. Payne, A./Frow, P. (2005): A Strategic Framework for Customer Relationship Management, in: Journal of Marketing, Vol. 69, No. 4, S. 167-176. Peter, S. I. (1997): Kundenbindung als Marketingziel – Identifikation und Analyse zentraler Determinanten, Wiesbaden 1997. XIII Peters, M./Scharrer, S. (2003): Dach- und Einzelmarkenstrategien von Messeunternehmen, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S. 549-557. Petersen, A. (2005): Dialogmarketing International: Übergreifende Trends aus Konsumentensicht, in: Krafft, M. et. al. (Hrsg.): Internationales Direktmarketing – Grundlagen, best practice, Marketingfakten, Wiesbaden 2005, S. 167191. Piesinger, E. (2003): In the Mood – eine Untersuchung zum Mood Management in der Fernsehnutzung, Universität München 2003. Piwinger, M./Porák, V. (Hrsg.) (2005): Kommunikations-Controlling – Kommunikation und Information quantifizieren und finanziell bewerten, Wiesbaden 2005. Reichheld, F./Sasser, W.E. (1990): Zero Defections: Quality Comes to Services, in: Harvard Business Review, Vol. 68, S. 105-111. Reichheld, F./Sasser, W.E. (1991): Zero-Migration – Dienstleister im Sog der Qualitätsrevolution, in: Havard Business Manager, 13. Jg., IV. Quartal 1991, S. 108-116. Reinartz, W./Kumar V. (2002): The Mismanagement of Customer Loyalty, in: Harvard Business Review, Vol. 80, No. 7, S. 86-95. Riesenbeck, H./Perrey, J. (2005): Mega-Macht Marke – Erfolg messen, machen, managen, 2. Aufl., Wiesbaden 2005. Robertz, G. (1999): Strategisches Messemanagement im Wettbewerb, Wiesbaden 1999. Rodekamp, V. (2003): Zur Geschichte der Messen in Deutschland und Europa, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement - Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S. 5-13. Sasserath, M./Daly, N./Wenhart, C.(2003): Die Bedeutung von Markenführung für Messen, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S. 529-548. XIV Schleuning, C. (1994): Dialogmarketing – Theoretische Fundierung, Leistungsmerkmale und Gestaltungsansätze, Ettlingen 1994. Schraudy, K. (2003): Produktentwicklung in der Messeindustrie, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement - Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S. 489501. Schütz, P. (2001): Die Macht der Marken – Geschichte und Gegenwart, Diss., Universität Regensburg 2001. Service Barometer (Hrsg.) (2005): Kundenmonitor Deutschland, http://www.wuv.de/studien/archiv/042005/939/summary.html. in: Silberer, G. (1999): Die Stimmung als Werbewirkungsfaktor, in: Marketing ZFP, Heft 2, 1999, S. 131-148. Sobermann, D. A. (2003): The Role of Differentiation in Markets driven by Advertising, in: California Management Review, Vol. 45, No. 3, S. 130-146. Specht, G./Fritz, W. (2005): Distributionsmanagement, 4. Aufl., München 2005. Stauss, B. (2000): Perspektivenwandel – Vom Produkt-Lebenszyklus zum Kundenbeziehungszyklus, in: Thesis, Nr. 2, S. 15-18. Stauss, B. (2006): Grundlagen und Phasen der Kundenbeziehung - Der Kundenbeziehungs-Lebenszyklus, in: Hippner, H./Wilde, K. D. (Hrsg.): Grundlagen des CRM, 2. Aufl., Wiesbaden, S. 421-442. Thiemer, J. (2004): Erlebnisbetonte Kommunikationsplattformen als mögliches Instrument der Markenführung – dargestellt am Beispiel der Automobilindustrie, Diss., Universität Kassel 2004. Venohr, B./Zinke, C. (1998): Kundenbindung als strategisches Unternehmensziel – vom Konzept zur Umsetzung, in: Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbindungsmanagement – Grundlagen, Konzepte, Erfahrungen, Wiesbaden 1998, S. 152-168. Voeth, M./Klein, A./Liehr, M. (2001): Akzeptanz und Einstellungen gegenüber dem Sportereignis „WM 2006“ – Ergebnisse einer empirischen Basisstudie, Arbeitspapier Nr. 2, Duisburg 2001. XV Wegener, M. (2004): Erfolg durch kundenorientiertes Multi-Channel-Management, in: Riekhof, H.-C. (Hrsg.): Retail Business in Deutschland, Wiesbaden 2004, S. 197-218. Wiedmann, K.-P./Walsh, G./Polotzek, D. (2000): Informationsüberlastung des Konsumenten – Stand der Forschung, Konzept und Messung, Hannover 2000. Witt, J. (2003): Bedeutung von Non-Space-Produkten im Messewesen, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement - Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S. 503-511. Zanger, C. (2003): Beurteilung des Erfolgs von Messeevents, in: Messen als Instrument der Live Communication, in: Kirchgeorg, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Messemanagement - Planung, Durchführung und Kontrolle von Messen, Kongressen und Events, Wiesbaden 2003, S.1071-1090. Zellner, G. (2003): Leistungsprozesse im Kundenbeziehungsmanagement - Identifizierung und Modellierung für ausgewählte Kundentypen, Diss., Universität St. Gallen 2003. XVI Anhang Anhang 1: Fragebogen der Untersuchung..............................................................XVII XVII Anhang 1: Fragebogen der Untersuchung Einführung Frage 1: Zunächst habe ich eine Frage zu Ihrer Funktion im Unternehmen. Sind Sie hinsichtlich der Planung und des Einsatzes von Kommunikationsinstrumenten für das Gesamtunternehmen oder für einen Geschäftsbereich zuständig? - Ja - Gesamtunternehmen - Geschäftsbereich - Nein - Sonstiges Frage 2: Welche Position haben Sie im Unternehmen inne? - Inhaber \ Eigentümer - Geschäftsführer - Vorstand Marketing \ Kommunikation - Bereichsleiter Marketing \ Kommunikation - Sonstiges Kundenbeziehung Frage 3: Wenn Sie einmal alle Kunden Ihres Unternehmens bzw. Ihres Geschäftsbereiches in Deutschland im Jahr 2004 betrachten, wie teilt sich Ihr Kundenstamm auf die drei Gruppen Erst- und Stammkunden sowie abgewanderte Kunden auf? Bitte sagen Sie mir in etwa die prozentuale Verteilung Ihres Kundenstamms für ... - Erstkunden - Stammkunden - Abgewanderte Kunden Frage 4: Wenn Sie sich alle Kommunikationsinstrumente vor Augen führen, die Ihr Unternehmen bzw. Ihr Geschäftsbereich nutzt. Welches ist aus Ihrer Sicht das wichtigste XVIII Kommunikationsinstrument bzw. ist am besten geeignet, um die folgenden Marketing- bzw. Kommunikationsziele zu erreichen? Wie ist das mit dem Ziel ... - Steigerung der Markenbekanntheit - Aufbau von Markensympathie und Markenvertrauen im Vorfeld des Kaufes - Direkte Erhöhung des Abverkaufs der Marke - Stärkung der Kundenbindung Frage 5: Inwieweit sind die folgenden Kommunikationsinstrumente für Ihr Unternehmen bzw. für Ihren Geschäftsbereich dazu geeignet, die folgenden Marketing- bzw. Kommunikationsziele zu erreichen. Bitte geben Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von (1) sehr gut geeignet, (2) gut geeignet, (3) weniger geeignet bis (4) gar nicht geeignet ab. Wie ist das mit ... - Klassischer Werbung bzw. Medienwerbung (z.B. TV-Spots, Anzeigen, Radio) - Neuen Medien (wie Internet und Multimedia) - Promotion Aktionen bzw. Verkaufsförderung - Events (wie Kundenevents, Roadshows) - Messebeteiligungen - Direktmailings Distribution Frage 6a: Welche Vertriebskanäle setzen Sie für den Absatz Ihrer Produkte bzw. Leistungen ein? - Haus-zu-Haus-Verkauf - Großhandel - Einzelhandel - Verkaufsfilialen - Kataloge - Telefonverkauf - Teleshopping - Online Dienste bzw. Internet - Events - Messen XIX Frage 6b: Wie teilt sich Ihr Umsatz in Deutschland in etwa auf Ihre Absatzkanäle auf? - Haus-zu-Haus-Verkauf] - Großhandel - Einzelhandel - Verkaufsfilialen - Katalog - Telefonverkauf - Teleshopping - Online Dienste / Internet - Events - Messen Messen Frage 7: Wird in Zukunft die Bedeutung von Messen als Vertriebsschiene für Ihr Unternehmen zunehmen, gleich bleiben oder abnehmen? - zunehmen - gleich bleiben - abnehmen Frage 8: Worin sehen Sie die wichtigsten Gründe für die Zunahme? Worin sehen Sie die wichtigsten Gründe für die Abnahme? Frage 9: Wie müsste die "neue Generation" von Messen ihrer Meinung nach aussehen? Welche Chancen sollten Messegesellschaften und Aussteller besser nutzen? Frage 10: In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass bei Messebeteiligungen Kundenkontakte nicht optimal vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden. Ich werde Ihnen jetzt unterschiedliche Maßnahmen vorlesen, um Kundenpotenziale vor und nach einer Messebeteiligung besser abzuschöpfen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie die mögliche Effizienzsteigerung der entsprechenden Maßnahme als sehr hoch, hoch oder gering einschätzen oder ob aus Ihrer Sicht keine Effizienzsteigerung zu erwar- XX ten ist. Wie ist das durch die Maßnahme ... - Exakte Festlegung von Zielvorgaben für Messekontakte bzw. Kundenkontakte - Zielgerichtete Einladung der Besucher im Vorfeld der Messe - Konsequente Dokumentation der Messegespräche auf dem Stand - Gespräche bzw. Dialog mit Stammkunden auf der Messe - Akquisitionsgespräche mit Erstkunden auf der Messe - Vereinbarung von Messe-Nach-Terminen auf dem Stand - Bewertung bzw. Tracking der Messekontakte nach A/B/C Kunden - Auftragsvergabe nach der Messe (also das Nachmessegeschäft)" Kommunikationsbudget Frage 11: Auf wie viel Prozent des Umsatzes Ihres Unternehmens bzw. Ihres Geschäftsbereichs in Deutschland beläuft sich Ihr Gesamt-Budget für Marketing-Kommunikation im Geschäftsjahr 2005? - …% Frage 12: Wie verteilt sich im Jahr 2005 Ihr Budget für Marketing-Kommunikation prozentual in etwa auf die folgenden Kommunikationsinstrumente? Ich werde die Instrumente zunächst einmal vorlesen und Sie dann bitten, das gesamte Kommunikationsbudget auf die von Ihnen genutzten Instrumente so zu verteilen, dass sich in der Summe 100 % ergibt. - Neue Medien - Public-Relations - Events - Direktmailing - Promotionaktivitäten - Klassische Werbung - Sponsoringaktivitäten - Messebeteiligungen Frage 13: Und wenn Sie jetzt einmal an das Jahr 2008 denken. Bitte schätzen Sie jeweils, um wie viel Prozent die jeweiligen Instrumente wachsen oder schrumpfen werden. Bitte XXI legen Sie für Ihre Bewertung die vermutete Budgetentwicklung Ihres Unternehmensoder Geschäftsbereiches zugrunde, d.h. wenn Sie insgesamt von einem GesamtBudgetwachstum ausgehen, dann ergibt sich nun in der Gesamtsumme eine Zahl von mehr als 100%. Wie wird sich das Budget ändern für ... - Neue Medien - Public-Relations - Events - Direktmailing - Promotionaktivitäten - Klassische Werbung - Sponsoringaktivitäten - Messebeteiligungen Frage 14a: Planen Sie bei der Budgetierung der Kommunikationsmaßnahmen Ihres Unternehmens bzw. Ihres Geschäftsbereiches von Projektbeginn an ein festes Budget für die Erfolgsmessung mit ein? - Ja - Nein Frage 14b: Wie viel Prozent Ihres Budgets planen Sie für die Erfolgskontrolle Ihrer Kommunikationsmaßnahmen ein? - …% Frage 14c: Welchen Betrag würden Sie für die Erfolgskontrolle einer Leitmesse im Geschäftsjahr 2005 in ihrem Unternehmen bzw. Ihren Geschäftsbereich maximal ausgeben? - bis 5.000 Euro - 5.000 bis 10.000 Euro - 10.000 bis 15.000 Euro - 15.000 bis 25.000 Euro - 25.000 bis 35.000 Euro - 35.000 bis 50.000 Euro - über 50.000 Euro XXII Differenzierungspotenzial Frage 15: Welche der folgenden Messeparameter eignen sich zur Differenzierung Ihrer Messebeteiligungen gegenüber anderen Wettbewerbern? Bitte denken Sie an die wichtigsten Messeaktivitäten Ihres Unternehmens oder Geschäftsbereiches in Deutschland. Sagen Sie mir jeweils, ob Sie das Differenzierungspotenzial der folgenden Parameter als sehr hoch, hoch oder gering einschätzen bzw. ob es nach Ihrer Ansicht kein Differenzierungspotenzial gegenüber dem Wettbewerb gibt. Wie ist das mit … - dem Wissen des Standpersonals - der Standarchitektur - dem Corporate Design - einer Produktpräsentation - der Standaufteilung - dem Standort in der Halle - multimedialer Medieninszenierung - einem Showprogramm - begleitender Kommunikation - der Vernetzung der Kommunikationsinstrumente - dem Markenimage der Veranstaltung - der Atmosphäre auf dem Stand - der Kommunikation der Markenbotschaft Frage 16: Welche der folgenden Eventparameter eignen sich wie gut zur Differenzierung Ihrer Event-Inszenierungen gegenüber anderen Wettbewerbern. Bitte denken Sie wiederum an die wichtigsten Eventaktivitäten Ihres Unternehmens oder Geschäftsbereiches in Deutschland. Sagen Sie mir jeweils, ob Sie das Differenzierungspotenzial der folgenden Parameter als sehr hoch, hoch oder gering einschätzen bzw. ob es nach Ihrer Ansicht kein Differenzierungspotenzial gegenüber dem Wettbewerb gibt. Wie ist das mit ... - dem Einsatz von Hostessen - der Location - der Dekoration bzw. Ausstattung - der Produktpräsentation - der Bewirtung bzw. dem Catering XXIII - prominenten Gäste - multimedialer Medieninszenierung - dem Showprogramm - der Vernetzung der Kommunikationsinstrumente - dem Erleben der Markenwelt - der Kommunikation der Markenbotschaft - dem Markenimage der Veranstaltung - der Atmosphäre auf der Veranstaltung Trends Frage 17: Bitte sagen Sie mir für die folgenden Statements, wie stark diese für Ihr Unternehmen bzw. Ihren Geschäftsbereich in den kommenden Jahren zutreffen werden. Bitte nutzen Sie hiefür wieder die Skala "trifft voll und ganz zu", "trifft eher zu", "trifft eher nicht zu" oder "trifft überhaupt nicht zu". - "Wir erwarten zunehmenden Konkurrenz durch asiatische Anbieter." - "Wir haben uns auf den soziodemographischen Wandel bereits eingestellt." - "Die Bedeutung der Unternehmensmarken wird in Zukunft steigen." - "Die Kaufzurückhaltung stellt uns vor neue Herausforderungen." - "Wir expandieren auf attraktiven Auslandsmärkten (z.B. in Asien, in Osteuropa) " Frage 18a: Wenn Sie das Thema "Weltmeisterschaft" nächstes Jahr in Ihrer Kommunikation aufgreifen, so nennen Sie uns bitte die 3 wichtigsten Marketingaktivitäten, die Sie durchführen werden. Frage 18b: Welche Bedeutung hat die Weltmeisterschaft hinsichtlich des Imagegewinnes für Deutschland? Würde Sie sagen … - sehr hohe Bedeutung - hohe Bedeutung - geringe Bedeutung - sehr geringe Bedeutung Soziodemographie XXIV Frage 19: Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an? - Automotive (Automobilhersteller) - Supplier (Automobilzulieferer) - Finance (Banken und Versicherungen) - Health (Chemie und Pharma) - Food & Beverages (Nahrungsmittel und Genussmittel) - Fashion \ Lifestyle (Bekleidung, Textil) - Industry Goods (Metallverarbeitung, Maschinenbau, Elektroindustrie) - High Tech (Hardware, Software, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation) - Touristik (Hotels, Fluglinien, Autovermietungen) Frage 20: Wie hoch wird der Umsatz in Ihrem Verantwortungsbereich in 2005 voraussichtlich sein? - …€ Frage 21: Befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland oder im Ausland? - Deutschland - Ausland Frage 22: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen? - bis zu 100 Beschäftigte - 101-200 Beschäftigte - 201-300 Beschäftigte - 301-400 Beschäftigte - 401-500 Beschäftigte - 501-750 Beschäftigte - 751-1.000 Beschäftigte -1.000 Beschäftigte und mehr Frage 23: Wie entwickelt sich Ihr Unternehmen bzw. Ihr Geschäftsbereich im Vergleich zum XXV Markt? Würden Sie sagen… - deutlich besser als der Markt - etwas besser als der Markt - auf Marktniveau - etwas schlechter als der Markt - deutlich schlechter als der Markt Frage 24: Und wie entwickelt sich der Markt aus Ihrer Sicht? Würden Sie sagen ... - stark wachsend - etwas wachsend - stagnierend - etwas rückläufig - stark rückläufig Frage 25: Liegt der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens bzw. Ihres Verantwortungsbereiches … - eher im b2c Bereich - eher im b2b Bereich - eher in beiden Bereichen Frage 26: Sofern Sie mehrere Marken führen, verwenden Sie bei der Kommunikation ausschließlich ihre … - Dachmarke - Produktmarken - beides Damit sind wir am Ende der Befragung angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme und Ihre Kooperationsbereitschaft. Frage 27: Wenn Sie an der Zusendung eines Summary der Ergebnisse der Untersuchung interessiert sind, möchte ich Sie jetzt bitten, mir Ihre Anschrift mitzuteilen. Diese Anga- XXVI ben werden getrennt von Ihrem Interview aufgenommen, so dass die Anonymität Ihrer Aussagen selbstverständlich gewährleistet ist. - Ja - Nein Frage 28: Und wären Sie evtl. auch bereit, im nächsten Jahr an einer Folgestudie mitzuwirken? Wir würden Sie in diesem Fall bei Wiederholung der Studie im nächsten Jahr wieder anrufen. - Ja - Nein