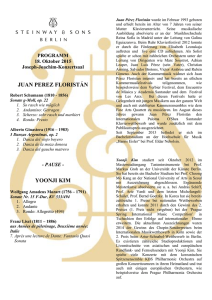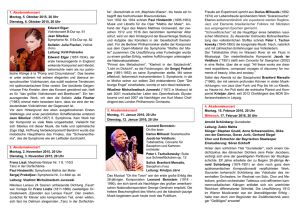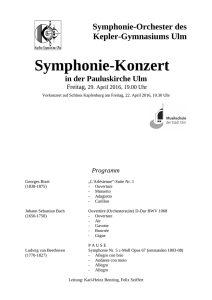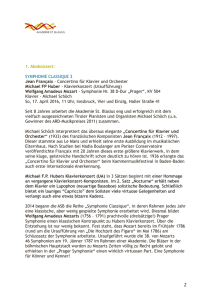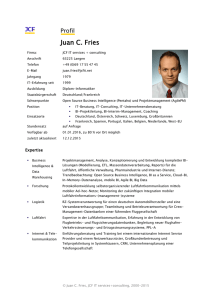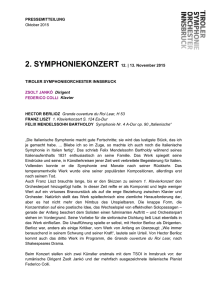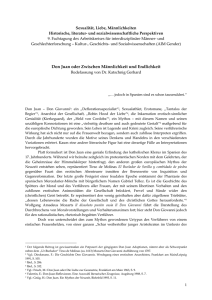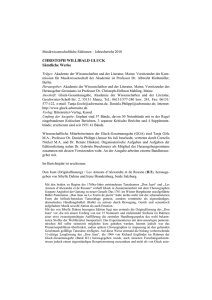prokofjew - Münchner Philharmoniker
Werbung

PROKOFJEW Auszüge aus »Romeo und Julia« STRAUSS »Don Juan« TSCHAIKOWSKY Symphonie Nr.6 »Pathétique« GERGIEV, Dirigent Donnerstag 24_09_2015 20 Uhr Von uns für München! Alle, die München lieben, werden sich für diese Schmuck-Idee begeistern: Der München Stadtring und die dazu passenden Anhänger, gefertigt aus Silber 925/– mit zauberhaften typischen Münchner Motiven in vielen Farben aus hochwertiger Hightech Ceramic. Jeder Ring € 129,– Jeder Anhänger € 89,– Ledercollier € 25,– TRAURINGHAUS · SCHMUCK · JUWELEN · UHREN · MEISTERWERKSTÄTTEN J. B. F R I D R I C H G M B H & CO. KG · S E N D L I N G E R ST R ASS E 1 5 · 8 033 1 M Ü N C H E N T E L E FO N 0 89 26 0 8 0 3 8 · W W W. F R I D R I C H . D E SERGEJ PROKOFJEW »Romeo und Julia« Ballett in drei Akten mit einem Prolog und einem Epilog nach William Shakespeare op. 64 Fünf Auszüge: 1. »Die Montagues und Capulets« 2. »Julia als junges Mädchen« 3. »Pater Lorenzo« 4. »Masken« 5. »Romeo am Grabe Julias« RICHARD STRAUSS »Don Juan« Tondichtung (nach Nicolaus Lenau) für g ­ roßes Orchester op. 20 PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKIJ Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 »Symphonie pathétique« 1. Adagio – Allegro non troppo 2. Allegro con grazia 3. Allegro molto vivace 4. Finale: Adagio lamentoso VALERY GERGIEV Dirigent Das Konzert am 24. September 2015 wird von Mezzo aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. 118. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 Pjotr Kontschalowskij: Sergej Prokofjew (1934) Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 3 »Ihre Lieder, meine Lieder« WOLFGANG STÄHR LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN SERGEJ PROKOFJEW (1891–1953) »Romeo und Julia« Ballett in drei Akten mit einem Prolog und Epilog nach William Shakespeare op. 64 Geboren am 11. (23.) April 1891 auf Gut Sonzowka (Gouvernement Jekaterinoslaw / Ukraine); gestorben am 5. März 1953 in Moskau (am selben Tag wie Josef Stalin). ENTSTEHUNG Fünf Auszüge: 1. »Die Montagues und Capulets« 2. »Julia als junges Mädchen« 3. »Pater Lorenzo« 4. »Masken« 5. »Romeo am Grabe Julias« 1934 hatte das Leningrader Mariinskij-­ Theater Prokofjew mit einer Ballettkomposition nach William Shakespeares Liebes­ tragödie »Romeo und Julia« beauftragt, deren Partitur in den Jahren 1935/36 nach einem von Prokofjew gemeinsam mit Leo­nid M. Lawrowskij und Sergej Radlow verfassten Ballettlibretto entstand. Die nach stalinistischen »Säuberungen« Ende 1934 eingesetzte neue Theaterleitung annullierte den Vertrag, und auch am Moskauer ­Bolschoi-Theater wollte keine Aufführung zustande kommen. Um die »Romeo und Julia«-­Musik wenigstens im Konzertsaal zu Gehör zu bringen, stellte sie Prokofjew 1936/37 dem Moskauer und Leningrader Publikum in Form von Ballettsuiten vor. Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 4 URAUFFÜHRUNG(EN) »DER STÄHLERNE« Ballett: Am 30. Dezember 1938 in Brünn / Tschechoslowakei im (alten) Stadttheater, heute: Mahenovo Divadlo (Orchester, Solisten und Corps de Ballet des Stadttheaters Brünn; Choreographie: Ivo Váňa Psota; Ausstattung: Václav Skruzný). 1. Suite op. 64a: Am 24. November 1936 in Moskau (Dirigent: George Sebastian); 2. Suite op. 64b: Am 15. April 1937 in Leningrad (Dirigent: ­Jewgenij Mrawinskij); 3. Suite op. 101: Am 8. März 1946 in Moskau, sechs Jahre nach der sowje­tischen Erstaufführung von Prokofjews Balletts am 11. Januar 1940 in Leningrad (Dirigent: Wladimir Degtjarenko). Vor mehr als einem halben Jahrhundert, am 5. März 1953, starb der weise und geliebte Führer des sowjetischen Volkes, der Lehrer der Werktätigen in der ganzen Welt, der größte Feldherr, die Koryphäe der Wissenschaft, der treue Kampfgenosse und Erbe Lenins, der beste Freund aller Kinder und wie sonst noch seine Ruhmestitel lauteten: Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin, »der Stählerne«. Eine viertägige Staatstrauer bestimmte das Leben in Moskau. Tausende und aber Tausende drängten in die katastrophal überfüllten Straßen der Stadt. In den Menschenmassen eingeschlossen fand sich auch der Dichter Jewgenij Jewtuschenko, der hilflos mit ansehen musste, wie eine junge Frau neben ihm gegen eine Ampel prallte. »Eine jähe Bewegung der Menge drückte mich eng an das Mädchen. Hören konnte ich nichts, doch ich spürte mit meinem ganzen Körper, wie ihre zarten Knochen an dem Pfosten zersplitterten«, erzählte Jewtuschenko. »Der Anblick ihrer wahnsinnig hervorquellenden blauen Kinderaugen ging über meine Kraft. Die Menge schob mich weiter, und als ich wieder hinschaute, war nichts mehr von dem Mädchen zu sehen... Über fünfhundert Menschen wurden im Gedränge erdrückt, tot getrampelt oder gegen Verkehrssignale und Lastwagen gepresst und zermalmt. Wie die alten Skythenkönige zog Stalin sein ­eigenes Volk mit sich ins Grab.« DUPLIZITÄT DER TODESTAGE Am selben Tag, dem 5. März 1953, ja fast zur selben Abendstunde starb in Moskau Sergej Sergejewitsch Prokofjew. Sein Sarg wurde im Zentralen Haus des Komponistenverbandes aufgebahrt. Wenige Freunde Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 5 Sergej Prokofjew mit seiner ersten Frau Lina und den beiden Söhnen Swjatoslaw und Oleg (1936) Prokofjew berichtet Linas Familie von seiner erfolgreichen Konzertreise in die Sowjetunion (1932) Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 6 nur, denen es gelang, sich unerschrocken den Weg gegen den Strom der zu Stalin pilgern­ den Massen zu bahnen, nahmen ­Abschied. David Oistrach spielte den ersten und dritten Satz der Violinsonate in f-Moll, die Prokofjew ihm gewidmet hatte; ­Swjatoslaw Richter legte, da keine Blumen zu bekommen waren, einen Kiefernzweig am Sarg nieder. Tags darauf zog die kleine, aber mutige Trauergemeinde auf Umwegen zum Friedhof, vorbei an Straßensperren, Panzern und Soldaten. Dmitrij Schostakowitsch erwies dem Verstorbenen die letzte Ehre. Aber auch Edison Denissow, Gennadij­Roschdestwenskij, Lazar Berman und Mstislaw Rostropowitsch kamen zu dem einsamen, unbeachteten Begräbnis. Prokofjews erste Frau aber, die spanische Sängerin Carolina Codina, fehlte an jenem traurigen Tag, sie wusste nicht mal, dass ihr Mann gestorben war. Denn zur selben Zeit verbüßte sie eine Haftstrafe mit Zwangsarbeit bei 50 Grad unter dem Gefrierpunkt in einem sibirischen Lager, in das sie unter erfundenen Spionagevorwürfen verschleppt worden war. EXISTENTIELLES HEIMWEH Warum nur war Sergej Prokofjew aus der Emigration freiwillig in die Sowjetunion zurückgekehrt, in Stalins Sowjetunion ? Prokofjew sei »schrecklich egoistisch« gewesen, betont Mstislaw Rostropowitsch, und habe sich für nichts interessiert als den Erfolg seiner Werke: »Er wusste, seine Komponistenkarriere würde in seiner Heimat glanzvoller sein als im Ausland. Davon war er überzeugt.« Und als diese Überzeugung der Ernüchterung wich, war es bereits zu spät. Ein geradezu existentielles Heimweh, bestärkt noch von den Reisen und umjubelten Gastspielen im nachrevolutionären Russland, dem Wiedersehen mit alten Freunden, mit Stätten der Kindheit und J ­ ugend, hatte Prokofjew zu dem Entschluss geführt, das unstete Dasein im Westen aufzugeben und sich mit seiner Familie in ­Moskau niederzulassen – eine Entscheidung, die im Mai 1936 in die Tat umgesetzt wurde. »Die Luft der Fremde bekommt meiner Inspiration nicht, weil ich Russe bin, und das Un­bekömmlichste für einen Menschen wie mich ist es, im Exil zu leben«, bekannte Prokofjew. »Ich muss zurück. Ich muss mich wieder in die Atmosphäre meines Heimatbodens einleben. Ich muss wieder wirkliche Winter sehen und den Frühling, der ausbricht von einem Augenblick zum andern. Ich muss die russische Sprache in meinem Ohr widerhallen hören, ich muss mit den Leuten reden, die von meinem eigenen Fleisch und Blut sind, damit sie mir etwas zurückgeben, was mir hier fehlt: ihre ­Lieder, meine Lieder.« Aber Prokofjew war nicht allein »schrecklich egoistisch«, er zeigte sich obendrein blind für die Realität, von Grund auf unpolitisch und naiv in einem kaum vorstellbaren Grade. Mit seiner unreflektierten Begeisterung für die Jubel­meldungen des heroischen Aufschwungs in Stalins Reich sei er allen auf die Nerven gegangen, erinnerte sich sein jüngster Sohn Oleg. Hätte ihn die Entstehungs- und Aufführungsgeschichte seines Balletts »Romeo und Julia« nicht eines Besseren belehren müssen ? SÄUBERUNGSWELLEN Ende 1934 hatte sich Prokofjew in Leningrad mit dem Direktorium des Staatlichen Akademischen Theaters für Oper und B ­ allett (wie das Mariinskij-Theater ab 1920 hieß) getroffen, um über ein gemeinsames Projekt zu verhandeln. Ursprünglich hatte er zwar eine Oper nach Puschkins »Hauptmannstochter« erwogen, doch ließ er sich Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 7 Galina Ulanowa als Julia und Michail Gabowitsch als Romeo in einer Produktion des Moskauer ­Bolschoi-Theaters (1946) Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 8 auch für das Vorhaben eines neuen Balletts gewinnen. Sogar »Tristan und Isolde« und »Pelléas et Mélisande« kamen gesprächsweise als mögliche Stoffe in Betracht, aber schließlich akzeptierte Prokofjew einen Vorschlag des Regisseurs und Shakespeare-­ Kenners Sergej Radlow, eine Ballettmusik zu »Romeo und Julia« in Angriff zu nehmen. Nachdem jedoch am 1. Dezember 1934 der Leningrader Parteisekretär Sergej Kirow in seinem Büro ermordet worden war, erhielt das Staatliche Akademische Theater nicht nur einen neuen Namen (Kirow-Theater), sondern auch eine neue künstlerische ­Leitung, die dann prompt das von dem ungeliebten avantgardistischen Regisseur Radlow initiierte »Romeo und Julia«-Ballett zu Fall brachte. Stalin nahm das Kirow-­Attentat zum willkommenen Anlass für eine Säuberungswelle von grenzenlosem Terror, mit der er die Partei disziplinierte, Oppositionelle verhaften und hinrichten ließ, die W ­ issenschaft entmündigte und die Kunst ideologisch maßregelte – indem etwa die »Prawda« mit ihrem berüchtigten Artikel »Chaos statt Musik« Dmitrij Schostakowitschs Oper »Lady Macbeth« brandmarkte und von den Spielplänen verdrängte. Es spricht, entgegen der offiziellen Version, vieles dafür, dass Stalin selbst es war, der Kirows E ­ rmordung befahl, da er in ihm einen Konkurrenten vermutete. VERBANNTE URAUFFÜHRUNG Unbeirrt von diesen Vorgängen reiste ­Prokofjew im Frühjahr 1935 wieder in die Sowjetunion, um mit Radlow ein Szenarium für das Ballett zu formulieren. Und da jetzt das Moskauer Bolschoi-Theater sein Interesse an »Romeo und Julia« bekundete, hielt Prokofjew nichts mehr davon ab, mit der Komposition zu beginnen, die er im Sommer und Herbst 1935 mit euphorischem Arbeits­eifer zu Papier brachte. Zunächst traf das neue Stück am BolschoiTheater durchaus auf Zustimmung – lediglich Radlows und Prokofjews »Idee«, die Handlung mit einem glücklichen Ende zu krönen (»Im letzten Akt sollte Romeo eine Minute früher kommen und Julia noch lebend vorfinden«), wurde nach heftigem Protest einer Revision unterzogen. Als dann freilich die Proben anfingen, taten sich die Tänzer mit der ihnen unvertrauten Musik Prokofjews dermaßen schwer, dass die Einstudierung bald schon abgebrochen und die geplante Premiere abgesagt wurde. So fand die Uraufführung nicht in der Sowjetunion, sondern am 30. Dezember 1938 im mährischen Brünn statt – Prokofjew war gar nicht erst angereist. MISSTRAUEN DER TÄNZER Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Leningrader Kirow-Theater doch noch bereit erklärt, eine Produktion des Balletts zu wagen. Aber aus den Erinnerungen des ­Choreographen Leonid Lawrowskij wissen wir, dass sich das Moskauer Debakel beinahe wiederholt hätte: »Viel Zeit, Kraft und Geduld kostete es, um das Misstrauen der Darsteller gegen die Musik Prokofjews zu beseitigen.« Das Verhältnis zwischen dem Komponisten und den Tänzern war äußerst gespannt. Galina Ulanowa, die Interpretin der Julia, antwortete auf die Frage, ob ihr das Ballett gefalle: »Fragen Sie Lawrowskij, er hat mir befohlen, diese Musik zu lieben.« Und Prokofjew beklagte sich beim Choreographen: »Sehen Sie denn nicht, dass sie sich gegen die Musik bewegt ?« Es wirft ein Schlaglicht auf das seit Jahren isolierte und von internationalen Entwicklungen abgeschnittene Musikleben der Sowjetunion, in den Aufzeichnungen der Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 9 Ulanowa nachzulesen, mit welchem Unbehagen die Compagnie am Kirow-Theater auf dieses zeitgenössische Ballett reagierte: »Die Proben waren in vollem Gange, und immer noch störte uns die eigenartige Instrumentierung, ihr kammermusikalischer Charakter. Auch der ungewöhnliche und fortwährend wechselnde Rhythmus war hinderlich und schuf unzählige tänzerische Schwierigkeiten. Mit einem Wort, wir waren solche Musik nicht gewohnt, hatten geradezu Angst vor ihr.« Zur Überraschung der Mitwirkenden wurde die Leningrader Premiere am 11. Januar 1940 dann doch zu einem großen und anhaltenden Erfolg. Zwei Wochen zuvor hatte das Orchesterkollektiv noch versucht, die Absetzung des Balletts zu erzwingen. al der »öffentlichen Selbstbezichtigung« blieb ihm nicht erspart. In seinen letzten, von schwerer Krankheit überschatteten Lebensjahren war Prokofjew den Schikanen einer omni­präsenten Kulturbürokratie fast wehrlos ausgesetzt. Und deshalb verlangte es Mut, im März 1953 nicht dem toten Diktator zu huldigen, sondern Abschied zu nehmen von einem Komponisten, der, nach den Worten Alfred Schnittkes, »ein Musterbeispiel« gegeben hatte, »wie man Mensch bleibt in einer Gegenwart, die dies beinahe unmöglich machte«. KOMPOSITIONSKUNST UND MENSCHLICHKEIT Heute, mehr als fünf Jahrzehnte nach Prokofjews Tod, gilt die auf den Bühnen der Welt wie im Konzertsaal gleichermaßen beheimatete Musik zu »Romeo und Julia« als Inbegriff seiner Kompositionskunst, die sich vor allem durch kraftvolle, reliefartige Melodik, thematische Plastizität, aggressive, oftmals ostinate Motorik und eine enorme Weite des orchestralen Klangraumes auszeichnet. »Dazu lebt in seinen Melodien die Urwüchsigkeit des russischen Liedes, eine freie und ausdrucksvolle Art des Singens«, urteilte der Komponist Aram Chatschaturjan. Nichts aber konnte Prokofjew davor bewahren, nach dem Krieg, als die Partei wieder die Zeit fand, sich der Kulturpolitik zuzuwenden, zum »Volksfeind« und Repräsentanten der »westlichen Dekadenz« erklärt zu werden. Der heimgekehrte Emigrant musste ohnmächtig erdulden, dass seine Werke willkürlich verboten wurden. Und selbst das demütigende Ritu- Sergej Prokofjew: »Romeo und Julia« 10 Anarchismus in Tönen STEPHAN KOHLER LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN RICHARD STRAUSS (1864–1949) »Don Juan« Tondichtung (nach Nicolaus Lenau) für ­großes Orchester op. 20 Geboren am 11. Juni 1864 in München; gestorben am 8. September 1949 in Garmisch-­ ­Partenkirchen. ENTSTEHUNG Das in Deutschland vor allem durch Mozarts »Don Giovanni« und Molières »Dom Juan« verbreitete »Don Juan«-Thema beschäftigte den jungen Richard Strauss während seiner Münchner und Weimarer Kapellmeister-­Zeit vor allem im Hinblick auf eine opernhafte Behandlung des Stoffes. Während er für seine zuletzt nicht realisierte »Don Juan«-Oper zahlreiche literarische Vorbilder bemühte, beschränkte er sich bei seiner gleichnamigen einsätzigen »Ton­dichtung«, die den Opernversuchen vorausging, auf Nikolaus Lenau (eigentlich ­Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, 1802–1850) und dessen 1843/44 entstandene »Dramatische Szenen«. Inspiriert von L ­ enaus »Don Juan« brachte der Komponist im Mai 1888 im K ­ losterhof der Kathedrale San ­Antonio zu Padua (»Il Santo«) die ersten Skizzen zu Papier, die er Richard Strauss: »Don Juan« 11 nach Beendigung seines Italien-­Aufenthalts in München zielstrebig zu einer »symphonischen Dichtung« ausarbeitete. Bereits am 30. September 1888 war in München die Partiturreinschrift vollendet. WIDMUNG »Meinem lieben Freunde Ludwig Thuille«: Der Komponist Ludwig Thuille (1861 Bozen – 1907 München) gehörte in jungen Jahren zum engsten Freundeskreis um Richard Strauss und wirkte später als Kompositions­ lehrer an der Königlichen Akademie der Tonkunst in München. URAUFFÜHRUNG Am 11. November 1889 in Weimar im 2. Abonnementskonzert der Weimarer Hofkapelle im Großherzoglichen Hoftheater (Großherzogliche Hofkapelle unter Leitung von Richard Strauss). VOM FREIHEITSANSPRUCH DES ROMANTISCHEN GENIES An Richard Strauss schieden sich schon ­immer die Geister. Im Gefolge der »Frank­ furter Schule« um Theodor W. Adorno warf man dem Komponisten des »Rosenkavalier« publikumswirksame Effekthascherei, oberflächliches Virtuosentum und auf den puren finanziellen Erfolg schielende Geschäftstüchtigkeit vor. Aber auch heute gibt es nicht wenige Musiker – wie etwa die Dirigenten Michael Gielen oder Nikolaus Harnoncourt – , die den Werken von Richard Strauss »mangelndes Ethos« vorwerfen oder sie als »Musik ohne Moral« brandmarken. Etwas boulevardesker drückte sich Christoph von Dohnányi aus, als er vor einigen Jahren das Bonmot zum Besten gab, Strauss’ Musik erinnere ihn manchmal an »Vergnügungsstätten« wie das Bordell: Solange man drin sei, amüsiere man sich prächtig. Komme man heraus, schäme man sich der zuvor genossenen Freuden abgrundtief... Vieles spricht dafür, dass – wie schon bei Adorno – das Unbehagen an der Musik von Richard Strauss zurückgeht auf ein ganz anderes Unbehagen: nämlich das an Vita und Person des Komponisten. Hier wiederum spielt Strauss’ vor allem in späteren Jahren gegen alles »Moderne« zu Felde ziehende und politisch nicht unbedingt republikanische Gesinnung eine entscheidende Rolle. Richtig ist, dass für den Komponisten der Tondichtung »Don Juan« das von revolutionsgeschulten Künstlern wie Berlioz ererbte egomanische Selbstverständnis und die unbedingte künstlerische Freiheit stets mehr zählten als die Einhaltung demokratischer Pflichten. Die Lektüre anarchistischer Philosophen wie Max Stirner oder John Henry Mackay, dazu Strauss’ früh einsetzende Nietzsche-Begeisterung, Richard Strauss: »Don Juan« 12 schienen nicht so sehr politischem oder ­p hilosophischem Informationsbedürfnis entsprungen, sondern blieben stets rückgekoppelt an den absolut gesetzten Freiheitsanspruch des romantischen Genies. VON WAGNER ZU BERLIOZ, VON SCHOPENHAUER ZU NIETZSCHE Der Zeitabschnitt, in dem Strauss die philo­sophischen Prämissen seiner späteren Lebensführung und künstlerischen Ideo­logie am intensivsten reflektierte, ja ­nachgerade erst aufzuspüren begann, ist ziemlich deckungsgleich mit dem halben Dezennium, das er Anfang der 1890er J ahre als Großherzoglich-Weimarischer ­ Hofkapellmeister in der Stadt Goethes verbrachte, gleichzeitig langjähriges Wirkungszentrum seines großen Vorbilds Franz Liszt. In W ­ eimar entwickelte sich Strauss vom ­bedingungslosen Anhänger der Wagner-­ S chule zum solipsistischen Querdenker, vom Verfasser »symphonischer Dichtungen« im Gefolge Berlioz’ und Liszts zum Opernkomponisten und nicht zuletzt vom Schopenhauer-Leser, wie er es in einem Brief an Cosima Wagner selbst­ ironisch formulierte, zum »NietzscheBruder«. Ein ­unübersehbarer thematischer Leitfaden durch die Weimarer Jahre ist dabei die Beschäftigung mit dem »Don Juan«-Thema, das beinahe den Stoff zu Strauss’ erster Oper geliefert hätte, wäre es nicht im W ­ iderstreit der philosophischen Systeme, die der junge Komponist damals hin- und herwälzte, dem Nietzsche-Ansatz seines selbstverfassten ersten Operntextes »Guntram« zuletzt dann doch noch unterlegen. Im Winterhalbjahr 1892/93 hatte Strauss auf seiner großangelegten Griechenland-, Ägypten- und Süditalien-Reise Nietzsches Werke erstmals genau gelesen, obwohl ihn Freunde und Familie »vor allen möglichen Dämonen und Einflüssen: Stirner, Nietzsche und so manche ungenannte« schon frühzeitig gewarnt hatten. In der späten Abhandlung »Aus meinen Jugend- und Lehrjahren« aber gibt der 70-jährige unumwunden zu: »Als ich in Ägypten mit Nietzsches Werken bekannt geworden, dessen Polemik gegen die christliche Religion mir besonders aus dem Herzen gesprochen war, wurde ich in meiner seit dem fünfzehnten Jahre unbewussten Antipathie gegen diese Religion, die den Gläubigen von der eigenen Verantwortung für sein Tun und Lassen (durch die Beichte) befreit, bestärkt und begründet !« Eltern und Familie hatten mit ihren Befürchtungen also doch nicht so Unrecht gehabt, zumal der Biograph und wichtigste Exeget Max Stirners (1806–1856), der schottische Dichter und »Anarchist« John Henry Mackay (1864–1933), seit kurzem zum Freundeskreis des Komponisten gehörte. DON JUAN ALS ATHEIST, ANARCHIST UND »ABSOLUTER EGOIST« Strauss hatte den gleichaltrigen Schriftsteller im März 1892 kennen gelernt; Mackays im Vorjahr erschienener, politisch provozierender Roman »Die Anarchisten« erregte damals großes Aufsehen. In einem Brief an den Vater wird berichtet, er habe »die reizende Bekanntschaft eines schottischen Dichters John Mackay gemacht, großer Anarchist und Biograph des Berliner Philosophen Max Stirner, des bedeutendsten Antagonisten Schopenhauers und des C ­ hristentums, des Vertreters des absoluten Egoismus, des Verfassers von >Der Einzige und sein Eigentum< !« Offenbar hatte Mackay dem Komponisten die Lektü- Richard Strauss: »Don Juan« 13 Leopold Graf von Kalckreuth: Richard Strauss (um 1890) Richard Strauss: »Don Juan« 14 re von Stirners Hauptwerk von 1845 empfohlen; ob Strauss sie konsequent zu Ende führte, ist nicht bekannt. Immerhin beschäftigte ihn Stirners Idee vom eigenen Ich als der einzigen Realität des mensch­ lichen Lebens über einen längeren Zeitraum und regte ihn zu Entwürfen zu einer »Don Juan«-Oper an, die weitgehend unbekannt blieben: »DON JUAN I« 1. Akt: Don J. in den Gluten der Sinnlichkeit, Vertreter des absoluten Egoismus, des unbeherrschten Ichtums (Stirner ?), schönen Frauen nachjagend, wird er von einer 16 Jahre älteren Frau (X.), die von rasender Leidenschaft zu ihm erfaßt ist, unwillkürlich angezogen; ihr näher kommend, weicht er von unbezwinglicher Scheu ergriffen, von ihr zurück und eilt anderen Weibern nach; unter anderem auch einem schönen, aber ganz verworfenen Geschöpf (Y.), das ebenfalls in frühester Jugend verführt, nur in Sinnlichkeit wühlend, die wahre Liebe nicht an sich erfahren hat. Diese Liebe erwacht allmählich in ihr durch die Leidenschaft für Don Juan. Schluß des I. Aktes, daß X. (vielleicht durch einen in philosophischer Lebensanschauung absoluten Antagonisten (A.) des Don J.’schen Ichtums, einen »Pessimisten« (Schopenhauer, Christus)) erfährt, daß Don Juan ihr Sohn ist. Die Leidenschaft für Don Juan ist jedoch in ihr bereits zu so grauenhaftem Wahnsinn gesteigert, daß sie nichtsdestoweniger nach der Vereinigung mit ihm strebt. 2. Akt: Don Juan unterliegt der Verführung seiner Mutter und vereinigt sich mit ihr. Nachher gesteht sie im Taumel der Liebesglut, gleichsam um diese ideell bis zum höchsten Wahnsinn zu steigern, ihm, daß sie seine Mutter ist. Er, sein eigen Spiegelbild in dieser grauenhaften Verzerrung erblickend (nachdem er seine Mutter erwürgt hat), zur Erkenntnis der furchtbaren Schuld der Individuation gekommen, will in furchtbarstem Schrecken über sich sich selbst den Tod geben, erkennt aber (vielleicht durch die dazwischentretende Y. (?)) den Tod nicht als die Strafe, die er ersehnt, sondern als Erlösung und beschließt, leben zu bleiben, um der furchtbaren Buße willen, die er sich auferlegt: nie mehr ein Weib zu berühren; der Buße fortwährender Entsagung, wo sein ungebändigter Naturtrieb nach Befriedigung drängt. 3. Akt: Der büßende Don Juan, im schaudervollsten Kampf mit seinen furchtbarsten Trieben (erkennt in der Aufopferung der Y. die wahre Liebe), wird von den ihn wegen der Ermordung seiner Mutter verfolgenden Schergen (dabei vielleicht A., der Don Juan’s Mutter unerwidert geliebt hat, u. ihren Tod rächen will) erschlagen. Er fleht um sein Leben, denn er will leben, um zu büßen, und empfindet den ihn von seinen Qualen erlösenden Tod als schrecklichste Strafe. GEFÄHRLICHE NÄHE ZU DA PONTE UND MOZART Im selben Monat, in dem dieses Szenarium entstand, notierte sich der Komponist aus Stirners »Der Einzige und sein Eigentum« die folgende Passage: »Wenn Ich dich hege und pflege, weil Ich dich lieb habe, weil Mein Herz an dir Nahrung, Meine Bedürfnisbefriedigung findet, so geschieht es nicht um eines höheren Wesens willen, dessen geheiligter Leib du bist, nicht darum, weil Ich ein Gespenst, d. h. einen erscheinenden Geist in dir erblicke, sondern aus egoistischer Lust: du selbst mit deinem Richard Strauss: »Don Juan« 15 Wesen bist Mir werth, denn dein Wesen ist kein höheres, ist nicht höher und allgemeiner als du, ist einzig wie du selber, weil du es bist.« Und als ob sich Strauss an dieser Stelle des ­Nikolaus Lenau-Bezugs seiner Tondichtung »Don Juan« von 1888 erinnerte, fügte er kommentierend hinzu: »Dagegen Lenau: >Die Einzle kränkend, schwärm’ ich für die Gattung... < « Zwischen Lenau und Stirner unsicher hinund herpendelnd werden Lesefrüchte wie diese von einem zweiten »Don Juan«-­ Szenarium gefolgt, das das Inzest-Motiv des ersten Entwurfs zwar beibehält, nun aber vom Beischlaf mit der Mutter (Ödipus-­ Motiv) auf Unzucht mit der eigenen Tochter überträgt. Mit der 2-Aktigkeit rückt hier Strauss dem dramaturgischen Modell von Mozarts »Don Giovanni« sehr viel näher als im ersten Szenarium. Neu hinzu kommt die stoffgeschichtlich bedeutsame KirchhofSzene – eine weiteres Moment der Annäherung an Mozart und da Ponte, das sich aber zuletzt als deutliche Hemmschwelle für die geplante Umsetzung in Musik erwies: Zu Mozarts berühmter Komthur-Szene wollte Strauss dann doch nicht in Konkurrenz ­treten. »DON JUAN II« Er liebt nicht seine Mutter, sondern seine Tochter (16 Jahre alt, in vollster Unschuld) 1. Akt: Maskenball, Don Juan erhält von einer Maske eine Rose, den letzten Gruß einer an gebrochenem Herzen gestorbenen Geliebten. Er lernt seine Tochter (Maria) hier kennen, von deren Reizen bestrickt er ihr verführend naht; ihr aber näher kommend, weicht er, von unbezwingbarer Scheu ergriffen, von ihr zurück und eilt anderen Weibern nach, darunter Y., einem ganz verworfenen Geschöpf. Seine Tochter wird von Elvira, Don Juan’s verlassener Geliebten, gewarnt, die dazwischen kommt (Don Juan außer sich, hat denn die Hölle sich wider mich verschworen, mir alle alten Lieben auf den Hals zu hetzen). Er vertauscht seine Maske mit Leporello, und hängt ihm Elvira auf. 2. Akt: Kirchhof mit der Statue des Com­ thurs und dem Grab von Mariens Mutter. Liebesscene mit Donna Anna (nach Puschkin), nachdem Don Juan dem Leporello die Erwiderung des Comthurs erzählt hat und die Verführung der Anna in ihrem Schlafzimmer als Oktavio. Nachher Frevel an der Statue des Comthur, die er höhnt, daß sie das r­ uhig geschehen habe lassen, und lädt den Comthur zum Abendessen ein. Leporello und er glauben zu sehen, daß die Statue mit dem Kopf nickt. Don Juan aber beruhigt sich, daß im Licht des Mondes seinem aufgeregten Blut ihm dies nur vorgespiegelt hat; als beide den Kirchhof verlassen wollen, naht Maria, die sich verspätet hat, um das Grab ihrer Mutter zum ersten Mal zu sehen. Hier Scene mit Ermordung der Maria, nachdem er sie als seine Tochter erkannt hat. Zum Schluß des 2. Aktes vielleicht Y. BLEIBENDE PRÄGUNG DURCH ­NIKOLAUS LENAU Für seine »Don-Juan«-Experimente wurde Strauss von vielen Freunden mit Textlieferungen und Anregungen versorgt. So schickte ihm Marie Ritter, die Nichte seines väterlichen Freundes Alexander Ritter, Ausgaben von Molières »Dom Juan« und Puschkins »Steinernem Gast«. Mit Puschkin allerdings war Strauss, wie die Erwähnung des russischen Dichters im zweiten Entwurf beweist, seit längerem bereits vertraut. Dennoch: Alle Versuche, die »Don Richard Strauss: »Don Juan« 16 Juan«-Oper unter Zuhilfenahme von literarischen Ideen Nietzsches, Stirners oder Puschkins zu verwirklichen, scheiterten. Letztlich siegte die Tondichtung über die nachfolgenden Opernentwürfe und legitimierte die Wahl ihres literarischen Vorbilds, der »Drama­tischen Szenen« Nikolaus Lenaus, noch nachträglich. Wie diese Wahl zustande kam, liegt nichtsdestoweniger im Halbdunkel: wir wissen wenig, was Strauss zur Lenau-Lektüre in dieser frühen Zeit veranlasst haben könnte. Paul Heyses Drama »Don Juans Ende«, das Strauss mit seinem »Mentor« Hans von ­Bülow in Frankfurt gesehen hatte, mag die Beschäftigung mit dem »Don Juan«- Thema ausgelöst, ohne sie aber nachhaltig beeinflusst zu haben. Immerhin vergingen nach dem Frankfurter Theaterbesuch drei Jahre, bis der Komponist im Mai 1888 im Klosterhof der Kathedrale San Antonio zu Padua (»Il Santo«) die ersten Skizzen zu Papier brachte, die er nach Beendigung seines U ­ rlaubsaufenthalts zielstrebig zu einer »symphonischen Dichtung« ausarbeitete. Bereits am 30. September 1888 hatte Strauss die Partiturreinschrift vollendet, der er – gleichsam als Motto – einige beziehungsvoll ausgewählte Verse aus Lenaus »Don Juan«-Dichtung voranstellte. »SPIEL DER INTELLIGENZ GEGEN DAS GEFÜHL« Auch Cosima Wagner diskutierte in einem Brief an Richard Strauss die Herkunft des »Don Juan«-Themas bei ihrem Schützling, fragte sich nach der Motivation seiner Stoffwahl und fand für sich die folgende Antwort: »Mir ist es in Ihrem >Don Juan< erschienen, als ob mehr das Gebaren Ihrer Personen Sie eingenommen hätte, als wie dass die Personen selbst zu Ihnen gesprochen hätten. Das nenne ich eben das Spiel der Intelligenz gegen das Gefühl. Es ist sehr schwer, über solche Dinge sich zu äußern, und mir selbst erscheint alles, was ich ­Ihnen da sage, als recht thörig, weil ungenügend. Vielleicht hilft mir ein Gleichnis; ich denke mir, dass die Gestalt dem Künstler entsteht wie dem Pygmalion das Bildnis, und dass aus der leidenschaft­ lichen Teilnahme an diesem Bildnis mit dem Segen der Schönheit die Bewegung wird. Schon die Wahl Ihres Stoffes zeigt das Vorwiegen der Intelligenz. Mit dem Lenau’ schen >Don Juan<, der aus Überdruß der Langeweile sich ergibt, haben Sie gewiß nicht empfunden; aber der Vorwurf hat Sie interessiert, und es ist Ihnen eine Menge dabei eingefallen, welche Sie mit erstaunlicher Sicherheit geordnet haben.« Cosima Wagner hat hier hellsichtig analysiert, was sich im Denken und Fühlen des jungen Komponisten damals abspielte: Während der Arbeit an »Don Juan« wurde es Strauss zunehmend bewusst, in welche Richtung er die Musik und ihre Inhalte weiter­entwickeln wollte. An Hans von Bülow schrieb er im August, einen Monat vor Vollendung der »Don Juan«-Partitur: »Eine ­Anknüpfung an den Beethoven der >Coriolan<-, >Egmont<-, >Leonore III<-Ouvertüre, der >Les Adieux<, überhaupt an den letzten Beethoven, dessen gesamte Schöpfungen nach meiner Ansicht ohne einen poetischen Vorwurf wohl unmöglich entstanden wären, scheint mir das Einzige, worin eine Zeit lang eine selbständige Fortentwicklung unserer Instrumentalmusik noch möglich ist: Will man ein in Stimmung und konsequentem Aufbau einheitliches Kunstwerk schaffen, und soll dasselbe auf den Zuhörer plastisch einwirken, so muß das, was Richard Strauss: »Don Juan« 17 Dirigierposen des jungen Richard Strauss (um 1890) Richard Strauss: »Don Juan« 18 der Autor sagen wollte, auch plastisch vor seinem geistigen Auge geschwebt haben. Dies ist nur möglich infolge der Befruchtung durch eine poetische Idee, mag dieselbe nun als Programm dem Werke beigefügt werden oder nicht.« IMAGINÄRES THEATER MIT ­MITTELN DER MUSIK Außer den der Partitur »beigefügten« Lenau-­Versen erhielt »Don Juan« kein weiteres, die Musik determinierendes »Programm«; nichtsdestoweniger ist den minutiös ausgearbeiteten Skizzenbüchern zu entnehmen, dass Strauss bei der Komposition einem verbal formulierten Formverlauf folgte, dem unübersehbar Züge eines dramatisch zugespitzten Librettos eignen: »Wonne-­Thema auf Cis-Dur-Cantilene, die mit dem Eintritt der Erschöpfung von dem 1. Don Juan-Thema unterbrochen wird in den Bratschen, anfangs diese durchklingt. Mit einem Ruck fährt er auf: mit einem kühnen Sprung des 1. Themas auf die C-Dominante; von da in einem leichtfertigen Thema weiter, von dem es in immer tolleres Treiben geht. ­Lustiges Gejauchze, unterbrochen von Schmerzensund Wonneseufzern. Durchführung. Nach Fortissimo höchster Steigerung: plötzliche Ernüchterung. Englisch Horn öde; die Liebes- und Freuden-­Themen klingen planlos durch­einander, unterbrochen von neuen Sehnsuchts- und Wonneschauern. Endlich schließt sich ein neues Liebesmotiv sehr schwärmerisch und zart an...« in den Jahren vor »Guntram« und »Feuersnot« nur die Bühne der eigenen Phantasie sein konnte. Von den erzielten Fortschritten gegenüber früheren Werken wie »Aus Italien« oder »Macbeth« schien der Komponist selbst am meisten überrascht. So heißt es in einem Brief an seinen Vater, geschrieben unmittelbar im Anschluss an die erste Orchesterprobe des »Don Juan« zur Weimarer Uraufführung vom 11. November 1889: »Alles klingt famos und kommt prächtig heraus, wenn es auch scheußlich schwer ist. Die armen Hornisten und Trompeter taten mir wirklich leid. Die bliesen sich ganz blau, so anstrengend ist die Geschichte. Der Klang war wundervoll, von einer riesigen Glut und Üppigkeit, das Ganze wird hier einen Mordseffekt machen. Besonders schön klang die Oboenstelle in G-Dur mit den vierfach geteilten Kontra­bässen, die geteilten Celli und Bratschen, alles mit Sordinen, auch die Hörner alle mit Sordinen, das klingt ganz magisch, ebenso die Katerstelle mit dem Harfen-­ Bisbigliando und den Bratschen-Ponticellis. Ein Glück, daß das ganze Ding nicht eigentlich difficil ist, sondern nur sehr schwer und anstrengend.« Als »Einakter ohne Worte« ist die symphonische Dichtung die notwendige Vorstufe zur später fehlgeschlagenen »Don Juan«Oper. Talent, Befähigung und Arbeitsweise drängten den Komponisten schon in diesem frühen Stadium zur Bühne – auch wenn es Richard Strauss: »Don Juan« 19 »Don Juan« NIKOLAUS LENAU Den Zauberkreis, den unermesslich weiten, Von vielfach reizend schönen Weiblichkeiten Möcht’ ich durchzieh’n im Sturme des Genusses, Am Mund der Letzten sterben eines Kusses. O Freund, durch alle Räume möcht’ ich fliegen, Wo eine Schönheit blüht, hinknien vor Jede Und, wär’s auch nur für Augenblicke, siegen. Ich fliehe Überdruss und Lustermattung, Erhalte frisch im Dienste mich des Schönen, Die Einzle kränkend, schwärm’ ich für die Gattung. Der Odem einer Frau, heut Frühlingsduft, Drückt morgen mich vielleicht wie Kerkerluft. Wenn wechselnd ich mit meiner Liebe wandre Im weiten Kreis der schönen Frauen, Ist meine Lieb’ an jeder eine andre, Nicht aus Ruinen will ich Tempel bauen. Ja ! Leidenschaft ist immer nur die neue; Sie lässt sich nicht von der zu jener bringen, Sie kann nur sterben hier, dort neu entspringen, Und kennt sie sich, so weiß sie nichts von Reue. Wie jede Schönheit einzig in der Welt, So ist es auch die Lieb’, der sie gefällt. Hinaus und fort nach immer neuen Siegen, Solang der Jugend Feuerpulse fliegen ! Es war ein schöner Sturm, der mich getrieben, Er hat vertobt, und Stille ist geblieben. Steintot ist alles Wünschen, alles Hoffen; Vielleicht ein Blitz aus Höh’n, die ich verachtet, Hat tödlich meine Liebeskraft getroffen, Und plötzlich ward die Welt mir wüst, umnachtet; Vielleicht auch nicht; – der Brennstoff ist verzehrt, Und kalt und dunkel ward es auf dem Herd. Von Richard Strauss der Partitur seiner Tondichtung »Don Juan« vorangestellte Textauszüge aus Nikolaus Lenaus gleich­namigem Vers­epos (1843/44, Fragment) Das Vorwort zur Partitur 20 Psychogramm als symphonische Idee REGINA BACK PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKIJ (1840–1893) Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 »Symphonie pathétique« 1. 2. 3. 4. Adagio – Allegro non troppo Allegro con grazia Allegro molto vivace Finale: Adagio lamentoso LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 25. April (7. Mai) 1840 in ­Wotkinsk (Wjatka / Ural); gestorben am 25. Oktober (6. November) 1893 in St. Peters­burg. ENTSTEHUNG Am 4. Februar 1893 begann der Komponist während einer Reise nach Odessa (Ukraine) eine Symphonie in h-Moll zu skizzieren, der er zunächst den Titel »Programm-Symphonie« geben wollte, ohne Details des »Programms« je zu ver- raten; am 24. März hatte Tschaikowskij die Particellskizze in seinem Haus in Klin bei Moskau beendet, am 12. August 1893 war die Instrumentation fertiggestellt; der Drucktitel »Symphonie pathétique« geht auf einen Einfall von Modest Tschaikowskij, den Bruder des Komponisten zurück, dessen ersten Vorschlag »Symphonie tragique« Tschaikowskij abgelehnt hatte. WIDMUNG »À Monsieur Wladimir Davidoff« (auf dem Manuskript); Wladimir Lwowitsch Davidow (1871–1906), genannt »Bobyk«, war der Neffe des Komponisten und in seinen letzten Lebensjahren neben Tschaikowskijs Bruder Modest sein engster Vertrauter. URAUFFÜHRUNG Nach einer Voraufführung durch die Orchesterklasse des Moskauer Konservatoriums unter Leitung seines Direktors Wassilij ­Iljitsch Safonow erfolgte die erste öffentliche Aufführung am 16. (28.) Oktober 1893 in St. Petersburg (Orchester der »Russischen Musikgesellschaft« unter Leitung von Pjotr Iljitsch Tschaikowskij). Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 21 »WIE EINE BOTSCHAFT AUS DEM REICH DER TOTEN« Im Mai 1893, wenige Monate vor der Uraufführung seiner 6. Symphonie, reiste Pjotr Iljitsch Tschaikowskij anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Cambridge nach England. Der USDirigent Walter Damrosch berichtete in seinen Memoiren, die 1923 erschienen, von den Feierlichkeiten: »Am Abend wurde im Speise­saal des College ein großes Bankett gegeben, und durch einen glücklichen Zufall wurde ich neben Tschaikowskij platziert. Er erzählte mir bei Tisch, dass er soeben eine neue Symphonie vollendet habe, die sich ihrer Form nach von allen, die er je geschrieben habe, unterscheide. Ich fragte ihn, worin denn dieser Unterschied bestehe, und er antwortete: >Der letzte Satz ist ein Adagio, und das gesamte Werk hat ein P ­ rogramm.< >Erzählen Sie mir doch das ­Programm<, drang ich in ihn. >Nein<, sagte er, >das werde ich niemals erzählen. Aber ich werde Ihnen die erste Partitur und die Orchesterstimmen schicken, sobald Jürgenson, mein Verleger, sie fertiggestellt hat.< Wir trennten uns in der Erwartung, uns schon im kommenden Winter in Amerika wiederzusehen. Doch, ach, im Oktober traf das Kabel ein, das seinen Tod durch Cholera verkündete, und nur wenige Tage darauf kam ein Paket aus Moskau an, das die Partitur und die Orchesterstimmen seiner Symphonie Nr. 6, der >Pathétique<, enthielt. Es war wie eine Botschaft aus dem Reich der Toten.« Die Rezeptionsgeschichte von Tschaikows­ kijs 6. Symphonie ist denn auch von Anfang an mit dem Tod des Komponisten verknüpft gewesen, da nur wenige Tage zwischen der Uraufführung des Werks und dem überraschenden Ableben Tschaikowskijs lagen. Doch nicht nur die äußeren Umstände legen eine solche Interpretation nahe, auch die innere Dimension und der musikalische Charakter der Symphonie bringen eine gewisse Todesnähe und Todessehnsucht zum Ausdruck, die für sich selbst sprechen. »MEINE BESTE KOMPOSITION« Dass Tschaikowskij schon seit vielen Jahren immer wieder unter großen Selbstzweifeln und Depressionen gelitten hatte und ihn der Gedanke an das Ende seiner Tage zeitweise nicht mehr schrecken konnte, geht aus zahlreichen Briefen an Freunde hervor. So schrieb er am 30. Januar 1890 an den mit ihm befreundeten Komponisten Aleksandr Glasunow: »Ich befinde mich in einem sehr rätselhaften Stadium auf dem Wege zum Grabe. Es geht etwas Merkwürdiges, Unbegreifliches in mir vor. Etwas wie Lebensüberdruss hat mich ergriffen; ich fühle zeitweise wahnsinnigen Kummer, aber nicht jenen Kummer, in welchem ein neuer Aufschwung der Liebe zum Leben keimt, sondern etwas Hoffnungs­loses, Finales und – wie immer in einem >­Finale< – auch etwas Banales ! Zugleich aber eine furchtbare Lust zum Schreiben. Einerseits merke ich, dass mein Lied ausgesungen ist, andererseits drängt es mich unüberwindlich, dasselbe Leben fortzusetzen oder ein neues Lied zu beginnen.« Aus einer ähnlich widersprüchlichen Motivation heraus entstand drei Jahre später die 6. Symphonie, wie Tschaikowskij in ­einem Brief vom 11. (23.) Februar 1893 seinem Neffen Wladimir Dawidow berichtete, der später auch zum Widmungsträger des Werkes wurde: »Während der Reise kam mir die Idee zu einer neuen Symphonie, diesmal einer programmatischen, allerdings mit einem solchen Programm, dass es Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 22 für alle ein R ­ ätsel bleiben wird – mögen sie es erraten. Die Symphonie wird schlicht >Programm-­Symphonie< (Nr. 6) heißen. Das Programm ist durch und durch subjektiv, und nicht selten habe ich während meiner Wanderungen, als ich sie in Gedanken komponierte, bitterlich geweint. Jetzt nach der Rückkehr habe ich mit den Skizzen begonnen. Die ­Arbeit geht so feurig, so schnell voran, dass der erste Satz in weniger als vier Tagen ganz fertig war und die übrigen Sätze in meinem Kopf schon klar ausgeprägt sind. Die Hälfte des dritten Satzes ist auch schon fertig. Der Form nach wird diese Symphonie viel Neues bieten, unter anderem wird das Finale kein lärmendes Allegro, sondern im Gegenteil ein sehr lang gedehntes Adagio sein. Du kannst Dir nicht vorstellen, welche Dankbarkeit ich empfinde, seit ich mich überzeugt habe, dass meine Zeit noch nicht abgelaufen ist und ich noch arbeiten kann.« bin sehr stolz auf diese Symphonie und glaube, es ist meine beste Komposition.« Der Elan des Beginns ließ indessen bald nach, und am 20. Juli (1. August) 1893 heißt es an Tschaikowskijs Bruder Modest: »Je weiter ich mit der Instrumentierung komme, desto mehr Schwierigkeiten habe ich mit ihr. Vor zwanzig Jahren habe ich das mit höchster Geschwindigkeit hinter mich gebracht, ohne irgendetwas dabei zu denken, und es kam gut heraus. Nun bin ich ängstlich geworden, mir meiner Sache nicht mehr sicher. Heute saß ich den ganzen Tag über (nur) zwei Seiten; nichts kommt tatsächlich so heraus, wie ich es gern hätte. Doch natürlich macht die Arbeit Fortschritte.« Nur wenige Wochen später hatte Tschaikowskij das Werk vollendet, und mit dem Kompositionsabschluss war in ihm auch die künstlerische Überzeugung gereift, etwas besonders Gutes geschaffen zu haben; folglich schrieb er im August 1893 an seinen Bruder Anatol: »Ich Bis heute ist immer wieder die Frage nach Tschaikowskijs plötzlichem Tod nur einen Monat später und in direkter Folge der Uraufführung seiner 6. Symphonie laut geworden. Modest Tschaikowskij hatte bereits wenige Tage nach dem Ableben seines Bruders die Nachricht verbreitet, dieser sei an Cholera verstorben. Doch erst in den letzten Jahren haben sich die Hinweise vermehrt, dass es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver gehandelt habe, das die wahren Gründe verschleiern und vor allem den Ruf der Familie schützen sollte: 1981 wagte die russische Musikwissenschaftlerin Alexandra Orlowa zu argumentieren, dass ein »Femegericht« Tschaikowskij aufgrund seiner homosexuellen Veranlagung zum Selbstmord verurteilt habe. Daraufhin habe Tschaikowskij seinem Leben mit Gift ein Ende gesetzt. Das Bekanntwerden der (damals ehrenrührigen) Vorwürfe hät- EIN REQUIEM ? Von besonderem Interesse ist freilich der Briefwechsel, den Tschaikowskij während der Komposition an seiner 6. (und letzten) Symphonie mit dem Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch führte, weil er ein besonderes Licht auf den Charakter des Werks wirft. Der Großfürst hatte bei Tschaikowskij angefragt, ob er nicht die Bühnenmusik zu Alexej Apuchtins Schauspiel »Requiem« schreiben wolle. Tschaikowskij lehnte den Auftrag in einem Brief vom 21. September 1893 mit der Begründung ab: »Mich verwirrt ein wenig der Umstand, dass meine letzte Symphonie, die soeben fertig geworden ist, besonders das Finale, von einer Stimmung durchdrungen ist, die derjenigen eines Requiems sehr nahe kommt.« Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 23 Eine der letzten Photographien des Komponisten, aufgenommen im Frühjahr 1893 in Charkow (Ukraine) Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 24 te ohne Zweifel den Ruf und das künstlerische Ansehen des Komponisten ruiniert. GLANZVOLLE KARRIERE Seit der Uraufführung seines Klavierkonzerts im Oktober 1875 war Tschaikowskij im In- und Ausland rasch bekannt geworden. Nicht zuletzt seine Orientierung an westeuropäischen Vorbildern, die im Hinblick auf das kompositorische Handwerk für ihn wegweisend geworden waren, hatte wesentlich dazu beigetragen. Damit grenzte sich der Komponist deutlich von seinen Kollegen ab, denn im Gegensatz zu den ­Mitgliedern des sogenannten »Mächtigen Häufleins« – Milij Balakirew, Cesar Cui, ­M odest Mussorgskij, Alexander Borodin und Nikolaj Rimskij-Korsakow – , die eine akademische Musiklehre ablehnten und sich stärker an russischen Vorbildern orientierten, vertrat Tschaikowskij die Ansicht, dass eine fundierte akademische Ausbildung und die Kenntnis der Musikgeschichte grundlegende Voraussetzungen für einen guten Komponisten bilden. Seine musikalische Ausbildung verfolgte Tschaikowskij infolgedessen mit großer Konsequenz: Ursprünglich hatte er auf Wunsch seines Vaters Jura studiert und 1859 eine Stelle als Verwaltungssekretär im Justizministerium von St. Petersburg angetreten. Als Anton Rubinstein 1862 in derselben Stadt das erste russische Konservatorium gründete, entschied sich Tschaikowskij endgültig für die musika­ lische Laufbahn und schrieb sich in die ­Kompositionsklasse ein. Auf Empfehlung Rubinsteins wurde Tschaikowskij, der sein Studium gerade beendet hatte, 1866 sogleich als Professor für Harmonielehre nach Moskau berufen, wo Rubinsteins Bruder Nikolaj ebenfalls ein Konservatorium ins Leben gerufen hatte. Seine ersten unter Opuszahlen verzeichneten Werke – nahezu ausschließlich kleinere Stücke für Klavier – entstanden in dieser Zeit. Opern wie »Eugen Onegin« oder »Pique Dame«, die Ouvertüre »Romeo und Julia«, das Ballett »Nussknacker«, das Streich­ sextett »Souvenirs de Florence« und die Reihe der sechs Symphonien begründeten schon zu Lebzeiten des Komponisten Tschai­kowskijs internationalen Ruhm, und zahlreiche Reisen führten ihn in der Folge in die USA, nach Frankreich, ­Italien und Deutschland. »BRAVO, PATHÉTIQUE !« Nach der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Cambridge war Tschaikowskij im Juni 1893 wieder nach Russland zurückgekehrt, um die Vorbereitungen zur Uraufführung seiner 6. Symphonie am 16. (28.) Oktober in St. Petersburg zu treffen. Zwei Tage nach der Premiere des Werks, das eher verhalten aufgenommen wurde, schrieb er an seinen Verleger Jürgenson, die Symphonie sei »nicht abgelehnt worden, aber sie hat etwas Bestürzung hervorgerufen. Ich bin auf dieses Stück so stolz, wie ich noch nie auf irgendeine andere Komposition stolz gewesen bin.« Der große Erfolg der Symphonie setzte freilich erst mit der zweiten Aufführung am 6. (18.) November 1893 ein, wenige Tage nach der Beisetzung Tschaikowskijs. »Das Publikum verstand das Werk nicht gleich« – so der Komponist Nikolaj Rimskij-Korsakow – , »weil es ihm nicht genügend Aufmerksamkeit schenkte, wie das einige Jahre vorher auch mit der 5. Symphonie Tschaikowskijs der Fall gewesen war. Mir scheint, dass erst der plötzliche Tod des Komponisten und das Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 25 Nikolaj Kusnezow: Pjotr Iljitsch Tschaikowskij im Jahr seines Todes (1893) Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 26 Gerede, welches im Anschluss daran entstand, unter anderem die Berichte angeblicher schlimmer Vorahnungen, zu denen die Menschheit so leicht neigt und die man mit der düsteren Stimmung des letzten Satzes der Symphonie in Verbindung brachte, die Aufmerksamkeit und die Sympathien des Publikums auf das schöne Werk lenkten.« Für den Beinamen »Pathétique« indes hatte nicht der Komponist selbst, sondern sein Bruder Modest verantwortlich gezeichnet, der dem wenig überzeugten Komponisten zunächst den Titel »Symphonie tragique« vorgeschlagen hatte. »Ich verließ das Zimmer und ließ Pjotr Iljitsch unentschlossen zurück« – so sein Bericht vom 17. (29.) Oktober, dem Tag nach der Uraufführung. »Dann schoss mir der Titel >pathétique< durch den Kopf. Ich ging zu ihm zurück – ich erinnere mich daran, als sei es erst gestern gewesen – , stand im Türrahmen und stieß das eine Wort aus: >Pathétique<. >Exzellent, Modja, bravo, pathétique !< « »TRAGIK« ALS MOTTO Den Hinweis auf das ausgewiesen »Pathetische« der Komposition konzedierte Tschaikowskij gern; das »Programm« freilich, von dem er während des Entstehungsprozesses immer wieder gesprochen hatte, blieb sein Geheimnis. Jedoch auch ohne Kenntnis eines detaillierten Programms ist es nicht schwer, die hier zum Ausdruck gebrachte Weltanschauung nachzuempfinden. Schon mit der düsteren Schwere der »Adagio«-Einleitung zum ersten Satz wird der Charakter des Werks festgelegt: Sowohl das h-Moll-Sekundmotiv im Fagott, das als Motto des ganzen Satzes fungiert, als auch der chromatisch absteigende Lamento-Bass in den tiefen Streichern ste- hen als klassische Topoi für »Trauer« und »Klage«. Im folgenden »Allegro non troppo« wird das düstere, verzweiflungsvolle Motto der Einleitung zum Kopfmotiv des Hauptthemas eines Sonatenhauptsatzes umgedeutet. Zahlreiche starke Temposchwankungen ­legen bereits in der Exposition den dramatischen, innerlich zerrissenen Charakter des Satzes fest. Das zweite Thema, das durch ein Bläsersignal angekündigt wird, ist als weit ausgreifende Kantilene der Streicher formuliert, die mit großer, expressiver Geste alle Merkmale des Sehnsüchtigen und Erhabenen in sich trägt. Der Seitensatz, der das Thema über der charakteristischen Hornbegleitung mehrmals wiederholt, grenzt sich dabei als eigenständige, mit großer Kadenz abgeschlossene Episode vom Vorangegangenen ab. Die dramatische Durchführung, die mit einem Fortissimo-Schlag abrupt einsetzt, ist von aufwühlenden Streicherfigurationen und absteigenden Blechbläserskalen geprägt. Der tröstliche H-Dur-Posaunenchoral, ein Zitat aus der orthodoxen Totenliturgie, bleibt jedoch episodisch begrenzt und führt nur zu einer Scheinreprise, die mit chromatisch absteigenden Skalen und Klage­sekunden den Topos der Trauer erneut ­heraufbeschwört. Eine versöhnliche, tröstliche Coda bringt mit aufsteigenden ­Kadenzfloskeln in den Holzbläsern Frieden und Ruhe und damit die musikalische A ntwort auf die vorangegangenen Ver­ zweiflungen. AUSFLÜCHTE Der zweite Satz, »Allegro con grazia«, ist als dreiteilige Liedform angelegt. Die einschmeichelnde Streichermelodie aus auf- Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 27 Programmzettel der Uraufführung vom Oktober 1893 Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 28 steigenden Skalen ist einem Walzer nachempfunden, der aber im 5/4-Takt notiert ist. Mit großer Würde und Grazie überspielt die Kantilene dabei den aus den Fugen geratenen Takt. Im Mittelteil allerdings klingt wieder die verzweifelte Stimmung aus der Durchführung des ersten Satzes an; der pochende Viertelpuls in der Pauke gemahnt an das drohende Schicksal, dem selbst der fröhliche Tanzreigen nicht entgehen kann. Der dritte Satz, »Allegro molto vivace«, gibt sich zunächst als flüchtiges Scherzo. Mit seinen flirrenden Streicherfigurationen erinnert er unzweifelhaft an die »Ronde de Sabbat« aus Hector Berlioz’ »Symphonie fantastique«. Das staccato vorgetragene, hüpfende Thema in Form eines aufgelösten Akkords in den Oboen und Klarinetten wird mehrmals variiert und erfährt dabei eine Steigerung, die durch zwischengeschaltete kürzere Episoden zusätzlich kontrastiert wird. Trompetensignale und ein Trommelwirbel kündigen den Höhepunkt des Satzes an, auf dem das »pathetisch« ausgeformte Thema schließlich in der Apotheose erscheint. ZERKLÜFTETES ENDE Die ungeheure Schlusswirkung, die das Ende der Symphonie gleichsam vorwegnimmt, bleibt nicht ohne Folgen für das Kommende und auch für das Werk als ­Ganzes. Denn streng genommen tauscht Tschaikowskij die beiden letzten Sätze in der Abfolge aus, und so folgt nun das üblicherweise an dritter Stelle figurierende Adagio als »Finale« der Symphonie – ein Verfahren, das später bei Werken mit ähnlich ausgeprägter Thematik beredte Nachfolger gefunden hat, so etwa in Gustav Mahlers 9. Symphonie von 1910, Béla Bartóks 2. Streichquartett von 1917 und Alban Bergs »Lyrischer Suite« von 1926. Die Streicher eröffnen dieses »Adagio ­lamentoso« mit einer ausgreifenden, hochexpressiven Geste. Das diatonisch absteigende Thema, dessen einzelne Töne auf verschiedene Streichergruppen aufgeteilt sind, steht symbolisch für die Sinnlosigkeit von sog. »Kraftanstrengungen« – denn der satztechnische Kunstgriff ist ohne Mitlesen der Partitur gar nicht wahrnehmbar. Das ­Thema, auf dem das Finale im wesentlichen beruht, wird mehrfach variiert – die syn­ kopische Begleitung der Hörner steigert sich dabei bis hin zu bedrohlichen »Schicksalsschlägen« der Bläser. Die zahlreichen Generalpausen und extremen ­Tempowechsel, die die ohnehin immer kraftloser werdenden Aufschwünge noch mehr bremsen, bewirken eine »Zerklüftetheit«, die dem Psychogramm eines Sterbenden entnommen sein könnte. Dem Signal der gestopften P­osaunen nebst Tuba – dem klassischen Topos zur Darstellung des »Letzten Gerichts« – folgt nochmal ein Bläserchoral, bevor der Satz mit einem tiefen Orgelpunkt der Kontra­ bässe, dem Sinnbild für Ausweglosigkeit, im vierfachen Pianissimo verklingt. »Mit dem langsamen Finale ohne äußere Effekte« – so deutet es Dorothea Redepenning – »hat Tschaikowskij seine persönliche Haltung zum Tod formuliert; in der Geschichte der Symphonie fand er damit eine einzigartige Lösung der Finalgestaltung, wie sie seit Beethovens >Neunter< zum P ­ roblem geworden war. Diese Idee der Symphonie als eine Art >Psychogramm< oder als Spiegel einer Weltanschauung ist ein A ­ spekt, den kein anderer russischer Symphoniker des 19. Jahrhunderts aufgegriffen hat.« Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: 6. Symphonie h-Moll 29 Valery Gergiev DIRIGENT In Moskau geboren, studierte Valery Gergiev zunächst Dirigieren bei Ilya Musin am Leningrader Konservatorium. Bereits als Student war er Preisträger des Herbert-­ von-Karajan-Dirigierwettbewerbs in Berlin. 1978 wurde Valery Gergiev 24-jährig Assistent von Yuri Temirkanov am Mariinskij-­ Theater, wo er mit Prokofjews Tolstoi-­ Vertonung »Krieg und Frieden« debütierte. 2003 dirigierte Gergiev als erster russischer Dirigent seit Tschaikowskij das Saisoneröffnungskonzert der New Yorker Carnegie Hall. Valery Gergiev leitet seit mehr als zwei Jahr­ zehnten das legendäre Mariinskij-Theater in St. Petersburg, das in dieser Zeit zu einer der wichtigsten Pflegestätten der russischen Opernkultur aufgestiegen ist. Darüber hinaus ist er Leiter des 1995 von Sir Georg Solti ins Leben gerufenen »World Or­ chestra for Peace«, mit dem er ebenso wie mit dem Orchester des Mariinskij-Theaters regelmäßig Welttourneen unternimmt. Von 2007 an war Gergiev außerdem Chefdirigent des London Symphony Orchestra, mit dem er zahlreiche Aufnahmen für das hauseigene Label des Orchesters einspielte. Valery Gergiev präsentierte mit seinem Mariinskij-Ensemble weltweit Höhepunkte des russischen Ballett-und Opernrepertoires, Wagners »Ring« sowie sämtliche Symphonien von Schostakowitsch und Prokofjew. Mit dem London Symphony Orchestra trat er regelmäßig im Barbican Center London, bei den Londoner Proms und beim Edinburgh Festival auf. Zahlreiche Auszeichnungen begleiteten seine Dirigenten­karriere, so z. B. der Polar Music Prize und der Preis der All-Union Conductor’s Competition in Moskau. Ab der Spielzeit 2015/16 ist Valery Gergiev neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Die Künstler 30 Verwechslung ausgeschlossen DIE DNS DER MÜNCHNER PHILHARMONIKER BEWAHRUNG DES FEUERS STATT ANBETUNG DER ASCHE Wir stehen zu dem, was wir sind; zu unserem Repertoire und zu unse­ rem Klang. Manche sagen, er ist einzigartig. Fest steht: er ist in über hundert Jahren gereift. Die legendären Uraufführungen Gustav Mahlers, eine lange ­Bruckner-Tradition, große Dirigentenpersön­ lichkeiten wie Sergiu Ce­libidache – die Begeisterung für dieses historische Erbe steckt in jedem einzelnen unserer Konzerte. Und das hört man. HEUTE SCHON HUNGRIG AUF MORGEN AUS ZUHÖREN WIRD ERLEBEN Wir wollen, dass jedes Konzert zu einem einzig­ artigen Erlebnis wird – für Sie und für uns. Einzigartigkeit beinhaltet immer auch Ecken und Kanten. Und die sind menschlich. Erst dadurch, dass jeder Musiker seine eigene Persönlichkeit in das Orchester einbringt, entstehen Emotionen und letztlich ein Klang, der unverwechselbar ist. Wir sind stolz auf diesen eigenen Charakter. Und das fühlt man. Selbstverständnis Wir sind offen für Neues. Die Lebendigkeit und Frische in der Pflege des symphonischen Repertoires ist unser ständiger Anspruch. Denn wer als Orchester wachsen will, muss aufgeschlossen sein gegenüber neuen Formen musikalischer Praxis und Veranstaltungsformaten abseits gelernter Wege. Neues entdecken und die Begeisterung fürs Alte immer wieder zu entfachen – das ist unser Auftrag. Überall in der Stadt. Und das sieht man. NEUGIER EMOTION TRADITION 32 Alles bleibt neu DIE MÜNCHNER PHILHARMONIKER IM NEUEN GEWAND Jeder einzelne Ton in einem Stück erzeugt Schallwellen Alle Töne zusammen ergeben ein komplettes Stück (in unserem Beispiel Gustav Mahlers 8. Symphonie) Sicher haben Sie sich auch schon gefragt, was die Form auf dem Cover unseres Programmheftes bedeutet. Die Antwort: Alles. Was sich zunächst etwas merkwürdig anhört, lässt sich ganz einfach erklären. Auf der Suche nach einem moderneren Erscheinungsbild stößt man irgendwann immer auf einen entscheidenden Punkt: Was unterscheidet uns eindeutig von anderen Orchestern? Was ist das Besondere an den Münchner Philharmonikern? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel: unser Klang. Was also wäre naheliegender als unser Logo einfach selbst zu spielen? Doch wie wird aus Klang ein Bild? Um das zu erklären, braucht es etwas Physik, einen Computer und eine einfache aber effektive Idee. Klangbilder 33 Töne sind Schallwellen. Spielt man mit einem Instrument einen Ton, so wird die Luft um das Instrument in Schwingung versetzt. Diese wellenförmige Druckänderung gelangt bis an unser Trommelfell, was dann auch wieder in Schwingungen versetzt wird. So können wir den Ton »hören«. hohem Wiedererkennungswert. Vereinfachen wir das ganze ein wenig – allerdings ohne den ursprünglichen Kern zu verlieren. Analog zu unseren Grundwerten »Tradition, Emotion & Neugier« teilen wir das Stück in drei Teile Die stark vereinfachte Form des Stückes ergibt die neue Logo-Form der Münchner Philharmoniker Will man diese Schwingungen sichtbar machen, geht es nicht ohne Technik: ein Oszilloskop übersetzt die Schwingungen in ein Bild mit Wellenlinien. Wir nehmen dazu einfach einen Computer. Programme ermög­ lichen dann eine bildliche Darstellung eines ganzen Musikstücks. (Abb. 1 & 2) »TRADITION, EMOTION & NEUGIER – AUCH IM LOGO« Teilen wir also unser Gebilde – analog zu Tradition, Emotion, Neugier – in drei Teile. (Abb. 3) Anschließend »füllt« man diese 3 Teile komplett aus und erhält so eine extrem reduzierte Version der ursprünglichen W ellenform – die neue Logo-Form der ­ Münchner Philharmoniker. (Abb. 4) Leider eignet sich diese komplexe und ­zackige Form nicht wirklich als Logo mit Klangbilder 34 Bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären: Welches Stück der Münchner Philharmoniker eignet sich am besten für das Logo? Was wird gespielt? Auch hier war die Antwort schnell gefunden: ebenfalls alles. Die Vielfältigkeit im Repertoire des Orchesters ermöglicht ein variables Logo. Und obwohl sich die Form je nach gespieltem Stück immer neu gestaltet, bleibt das Logo dennoch vor allem eins: einzigartig!­­­­­ Gustav Mahler Symphonie Nr. 8 Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 9 Anton Bruckner Symphonie Nr. 4 Sergei Prokofiew »Romeo & Julia« Maurice Ravel »La Valse« Gustav Mahler Symphonie Nr. 2 Klangbilder 35 IMPRESSUM Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Lektorat: Stephan Kohler Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Color Offset GmbH Geretsrieder Str. 10 81379 München TEXTNACHWEISE Wolfgang Stähr und Regina Back schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler stellte dem Orchester seinen Text zum Abdruck in diesem Programmheft zur Verfügung; er verfasste auch die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Das literarische Vorwort zu Strauss’ »Don Juan« (aus Nikolaus Lenaus gleichnamigem Versepos) zitieren wir nach dem Wortlaut des Erstdrucks der Or- chesterpartitur; Druckfehler und andere Irrtümer wurden stillschweigend bereinigt. Künstlerbiographie (Gergiev): Nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. BILDNACHWEISE Abbildungen zu Sergej Prokofjew: Sergej Prokofjew, Aus meinem Leben – Sowjetisches Tagebuch 1927, Zürich / St. Gallen 1993; Israel V. Nestyev, Prokofiev – Der Künstler und sein Werk, Stanford – London 1961. Abbildungen zu Richard Strauss: Strauss Archiv München (SAM), Sammlung Stephan Kohler. Abbildungen zu Pjotr Iljitsch Tschaikowskij: Alexander Poznansky, Tschaikowskijs Tod: Geschichte und Revision einer Legende Mainz – Zürich 1998; Herbert Weinstock, Peter Iljitsch Tschaikowskij, Adliswil / Lottstetten 1993. Künstlerphotographie (Gergiev): Marco Borggreve Impressum TITELGESTALTUNG »Im Zentrum steht das Logo, die Theaterbühne. Wie ein Trauerkranz umkreist die Bühne komplexes Geflecht, viel Streit, Ablehnung und Umwege. Die Farbe Schwarz dominiert als Symbol für die düstere Zeit der StalinÄra und das viele Leid, Zensur und die Duplizität der Todestage. Das Lurex®, glänzende Elemente im Kern des Objekts, soll die Genialität der Musik andeuten, die zu Prokofjews Zeit noch nicht erkannt wurde. Die filigran abstehenden Arme bringen tänzerische Bewegung in das Textilobjekt.« (Robert Kis, 2015) DER KÜNSTLER Robert Kis ist freischaffender Textilkünstler und präsentiert seine Textilobjekte, Kostümskulpturen und Weichplastiken in Ausstellungen und Bühnenprojekten. Die filigran genähten und befüllten Objekte, pendeln zwischen Wandschmuck, bespielbarem Liegeobjekt und Tragbarkeit am Körper. Beim berühren der Textilskulpturen ist eine intensive Wahrnehmung möglich und löst die Distanz zwischen Betrachter und Kunstobjekt auf. www.robertkis.de 36 Mittwoch 30_09_2015 20 Uhr a Donnerstag 01_10_2015 20 Uhr k4 Freitag 02_10_2015 20 Uhr d GUSTAV MAHLER Symphonie Nr. 6 a-Moll »Tragische« SEMYON BYCHKOV Dirigent Samstag 17_10_2015 19 Uhr g4 Montag 19_10_2015 20 Uhr f RICHARD WAGNER Ouvertüre zu »Rienzi« »Wesendonck-Lieder« für Sopran und Orchester PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKIJ Symphonie Nr. 4 f-Moll op. 36 ANDRIS POGA Dirigent PETRA LANG Sopran Sonntag 11_10_2015 15 Uhr Montag 12_10_2015 10 Uhr »RISTORANTE ALLEGRO« Das philharmonische Musical LUDWIG WICKI Dirigent MARGIT SARHOLZ UND WERNER MEIER Buch, Musik, Realisation RUTH-CLAIRE LEDERLE Regisseurin RAINER BARTESCH Arrangeur und Co-Komponist CHRISTOF WESSLING Bühnenbildner SIGRID WENTER Kostümbildnerin BJÖRN B. BUGIEL Choreograph HANSI ANZENBERGER JANA NAGY CAROLINE HETÉNYI CONSTANZE LINDNER BENJAMIN SCHOBEL CHARLOTTE I. THOMPSON ANNA VEIT ALEXANDER WIPPRECHT Schauspielerinnen und Schauspieler Vorschau DAS ORCHESTER DER STADT In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit WEITER HÖREN Freunde und Förderer DAS FESTIVAL DER MÜNCHNER PHILHARMONIKER — GASTEIG Freitag 13_11_2015 ERÖFFNUNGSKONZERT VALERY GERGIEV Samstag 14_11_2015 12 STUNDEN MUSIK EINTRITT FREI Sonntag 15_11_2015 PROKOFJEW–MARATHON VALERY GERGIEV MPHIL.DE 3 M FÜ U TA R SI GE AL K LE ’15 ’16 DAS ORCHESTER DER STADT