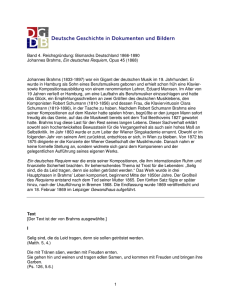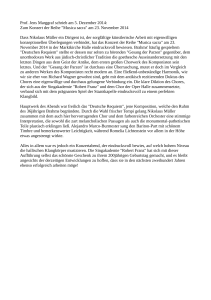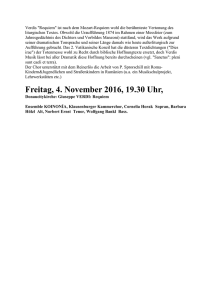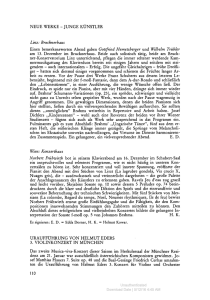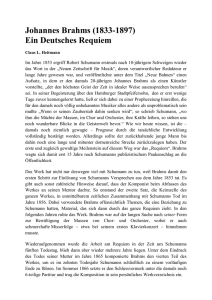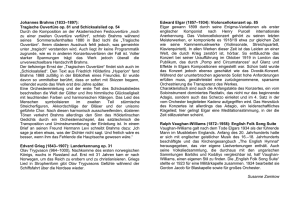Werkbeschreibung - Figuralchor
Werbung

„ … EUER HERZ SOLL SICH FREUEN UND EURE FREUDE SOLL NIEMAND VON EUCH NEHMEN.“ JOHANNES 16,22 Überlegungen zu Johannes Brahms‘ „Ein Deutsches Requiem“ nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester (Orgel ad lib.) op.45 Brahms‘ „Deutsches Requiem“ hat mit der aus der katholischen Kirche bekannten Totenmesse lediglich gemeinsam, daß es sieben Sätze umfaßt, ansonsten steht es quer zur Gattung: seine Sprache ist nicht lateinisch, sondern deutsch; und Brahms folgt nicht dem in der katholischen Liturgie vorgegebenen Text, sondern er wählt Bibelstellen aus, die er in einer bestimmten Reihenfolge anordnet und so sein ganz persönliches Verhältnis zu Sterben und Tod dem Hörer preisgibt. Das Werk hat eine lange Entstehungsgeschichte, die mit leidvollen persönlichen Erlebnissen des Komponisten in Beziehung zu sehen ist. Während der fünfzehn Jahre, in denen ihn die Arbeit an dem Requiem beschäftigte, mußte er 1854 den Selbstmordversuch seines Freundes und Förderers Robert Schumann miterleben, sowie in den zwei folgenden Jahren dessen Krankheit und Tod. In diese Zeit fiel eine Phase der Entfremdung mit Clara Schumann, mit der Brahms gut befreundet war. 1865 starb seine Mutter, die ihm sehr viel bedeutet hatte. Außerdem beschäftigte ihn – der sich politisch nie geäußert hatte, aber trotz allem das Zeitgeschehen intensiv verfolgte – der 1866 beginnende Krieg zwischen Preußen und Österreich. Brahms hatte in dieser Zeit immer wieder an dem Requiem gearbeitet, hatte aber zwischen 1861 und 1865 die Komposition zugunsten von a-cappella-Chorwerken zurückgestellt. Nun nahm er die Arbeit wieder auf und sandte die fertigen Sätze an Clara Schumann. Er schrieb ihr dazu, daß er überlege, „ … eine Art deutsches Requiem …“ zu komponieren. Sie ermutigte ihn, weiterzumachen: „ Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.“ Erst ein Jahr später entschloß sich Brahms, einige der bis dahin fertiggestellten Sätze einem größeren Publikum vorzustellen und er hatte dabei schon im Vorfeld mit dem Unverständnis seiner Zeitgenossen zu kämpfen: bei der ersten Aufführung 1867 in Wien erklangen nur drei Sätze seines Requiems, verbunden mit Musik aus Franz Schuberts „Rosamunde“. Und die eigentliche Uraufführung am Karfreitag 1868 in Wien erlebte das Werk auch nicht in der vom Komponisten erwünschten Form, sondern es wurde mit Teilen aus Bachs Matthäuspassion und Händels Messias ergänzt. Auch in Bremen, wo das Requiem positiv aufgenommen und das Konzert wiederholt werden mußte, traute man ihm keinen eigenständigen Wert zu und ließ zusätzlich noch die Sopranarie „Wie nahte mir der Schlummer“ aus Carl Maria von Webers „Freischütz“ erklingen. Brahms sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, in seinem Requiem fehle der Gedanke an den Erlösungstod Jesu Christi, das Ganze sei nicht religiös genug für ein Requiem. Ein Jahr zuvor schon hatte ihn sein Freund Karl Reinthaler mit dem Pauluszitat gewarnt: „Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel.“ Brahms reagierte zunächst nicht auf die Kritik des Freundes, aber sie schien ihn wohl nachdenklich gemacht zu haben. Auch nach der Uraufführung arbeitete er weiter an seinem Requiem und schrieb im Mai 1868 den Satz „Ihr habt nun Traurigkeit“, im Gedenken an seine Mutter. Die nun sieben Sätze wurden am 18. Februar 1869 in Leipzig aufgeführt. Das war eine doppelte Premiere: nicht nur erklang das Requiem zum ersten Mal in seiner heutigen Form, mit dieser Aufführung trat auch der neu gegründete Leipziger Gewandhauschor zum ersten Mal öffentlich auf. Die katholische Totenmesse spiegelt in ihren Texten das Glaubensverständnis des Mittelalters: das Konzil von Trient hatte 1545 den Ablauf der Liturgie festgelegt, die einzelnen Teile des Requiems waren schon früher entstanden. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf dem „dies irae“: Angst vor dem Fegefeuer, ewiger Verdammnis und Furcht und Schrecken vor dem Jüngsten Gericht. Im Gegensatz dazu steht Brahms mit der Auswahl seiner Texte, die er zum Teil auch aus dem Neuen Testament nimmt. Statt Furcht, Angst und der flehentlichen Bitte „Libera me“ stehen hier neben der Klage um die Vergänglichkeit allen Seins Trost und Freude im Mittelpunkt. Immer wieder weisen die Textstellen darauf hin, sei es der Vers aus den Seligpreisungen der Bergpredigt („Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“), oder auch die Worte aus Jesaja 66, 13: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Die Schrecken des Jüngsten Gerichts haben keinen Platz in Brahms‘ Komposition. Ungewöhnlich ist auch Brahms‘ Auffassung vom „ewigen Leben“, das seiner Ansicht nach in der Erinnerung der Lebenden liegt: sein Requiem schließt mit den Worten aus der Offenbarung des Johannes: „Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.“ Kein Verweis auf das Jenseits, allein der über-lebende Mensch steht im Mittelpunkt dieses Werkes. Kein Bittgebet für die Toten, sondern eine Totengedenkfeier für die Lebenden, die sich mit dem Verlust eines geliebten Menschen abfinden müssen. Daß aber Trost nur dem gegeben wird, der das tiefste Leid durchmessen hat, das macht Brahms‘ Musik deutlich: Wie aus dem Nichts steigt der erste Klang auf: tiefe Streicher entfalten sich über lang gehaltenen Tönen der Hörner und weichen dann dem Chor, der ebenfalls wie aus der Ferne einsetzt: „Selig sind, die da Leid tragen.“ Weite, zum Teil ungewöhnliche Intervalle bewirken eine Stimmung, die von Sehnsucht und Hoffnung getragen ist: das irdische Leid ist real, aber darauf sollen Trost und Freude folgen, so ist es versprochen. Der zweite Satz gehört zu den ältesten Teilen der Kompostion: um 1855 hatte Brahms an mehreren Werken gleichzeitig gearbeitet, darunter war ein Konzert für zwei Klaviere. Brahms hat dieses Konzert nicht vollendet, stattdessen hat er die einzelnen Sätze in anderen Kompositionen eingearbeitet, einer davon wurde zum „Totentanz“ seines Requiems. Die Jesaja-Worte „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ werden in starrem unisono deklamiert, dessen Unerbittlichkeit durch die folgenden Jakobus-Verse aufgelockert wird, bevor der erste Teil wiederholt wird. Durch diese Düsternis bricht ein jäher Lichtstrahl: „Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit“. Nun leuchtet in der Musik Freude und Zuversicht strahlend auf. Der dritte Satz wendet sich weg vom Allgemeinen: die Solostimme lenkt den Blick auf inneres Reflektieren über das persönliche Ende des einzelnen Menschen. Der Chor steht hier ebenfalls für das Individuum, er hat keinen Trost parat. Hier findet die Furcht jedes einzelnen Menschen vor dem Tod ihren Ausdruck: „Nun, Herr, wes soll ich mich trösten?“ Aber die Antwort ist bald gefunden: „Ich hoffe auf dich.“ Der vierte Satz gibt einen Blick in das Paradies frei. Mit „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ folgt auf die erschütternde und aufwühlende Musik der beiden vorausgegangenen Sätze ein idyllisch-entrücktes Klangbild. Darauf folgt quasi eine Stimme aus dem Himmel: der Solosopran singt Worte des Trostes und der Freude. Wie verklärt schwebt die Melodie, fern von Erdenschwere und Schmerz, und die dreimalige Wiederholung des Wortes „wiedersehen“ ist wie ein Versprechen. Im sechsten Satz flackern Furcht und Schrecken noch einmal auf, Pauken und Posaunen erinnern an das „dies irae“ der Totenmesse. Der Solobariton kündigt die Verwandlung an: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.“ Der „Klang der letzten Posaune“ ist aber nicht das Signal für den Sturz in die ewige Nacht, sondern die Ankündigung der Auferstehung. Dieser Satz endet mit einer feierlichen Lobpreisung des Herrn. Der letzte Satz nimmt die Seligpreisungen aus dem ersten Satz wieder auf. Die heftige Bewegung der Musik kommt hier zur Ruhe und eine heitere Gewißheit stellt sich ein, daß die Verheißung von Frieden und Seligkeit sich erfüllen wird. Das Werk schließt, wie es begonnen hat: mit dem verschwebenden Klang „selig“. Die Uraufführung des Werkes war nicht besonders glücklich verlaufen, auch bei den vorausgegangenen Aufführungen einzelner Teile hatte es Probleme gegeben: 1867 in Wien hatte der Pauker sich seinem Part so intensiv hingegeben, daß er im dritten Satz alle anderen übertönte und das Publikum außerordentlich irritierte. Der Musikkritiker Eduard Hanslick schrieb über diese Aufführung, er hätte „die Empfindungen eines Passagiers“ gehabt, „der im Schnellzug einen Tunnel durchrasselt“. Trotz aller anfänglicher Schwierigkeiten und Mißverständnisse hat Brahms‘ Requiem aber sehr schnell sein Publikum gewonnen: in den zehn Jahren nach seiner kompletten Uraufführung ist es allein im deutschsprachigen Raum über hundert Mal aufgeführt worden. Der in Wien lebende Hamburger hat sich mit seinem Werk durchgesetzt: diese Musik ist sowohl Ausdruck tiefster Trauer als auch größter Hoffnung: daß da kein Ende sein möge, sondern die Liebe ewig währt. Wetzlar, im Oktober 2009 Gisela Lutzenberger