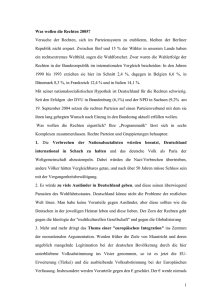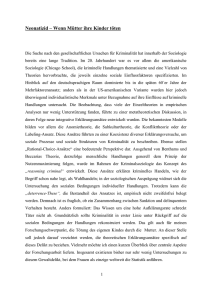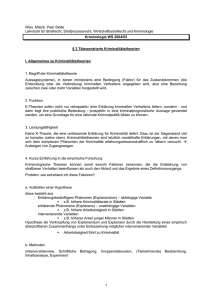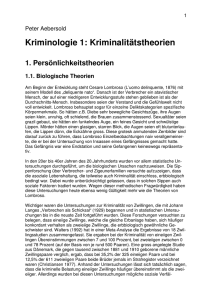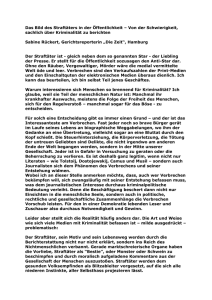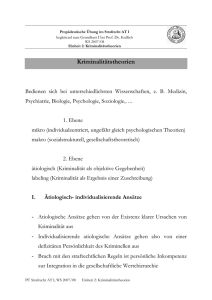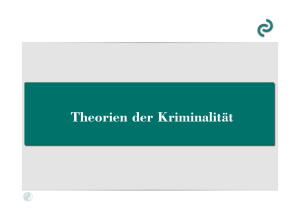Kriminologie 1 - Juristischen Fakultät Basel
Werbung

1 Peter Aebersold Kriminologie 1: Kriminalitätstheorien 1. Persönlichkeitstheorien 1.1. Biologische Theorien Am Beginn der Entwicklung steht Cesare Lombroso (L’uomo delinquente, 1876) mit seinem Modell des „deliquente nato“. Danach ist der Verbrecher ein atavistischer Mensch, der auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen geblieben ist als der Durchschnitts-Mensch. Insbesondere seien der Verstand und die Gefühlswelt nicht voll entwickelt. Lombroso behauptet sogar für einzelne Deliktskategorien spezifische Körpermerkmale. So hätten z.B. Diebe sehr bewegliche Gesichtszüge, ihre Augen seien klein, unruhig, oft schielend, die Brauen zusammenstossend. Sexualtäter seien grazil gebaut, sie hätten ein funkelndes Auge, ein feines Gesicht und schwülstige Lippen. Mörder hätten einen glasigen, starren Blick, die Augen seien oft blutunterlaufen, die Lippen dünn, die Eckzähne gross. Diese grotesk anmutenden Zerrbilder sind darauf zurück zu führen, dass Lombroso Einzelbeobachtungen naiv verallgemeinerte, die er bei der Untersuchung von Insassen eines Gefängnisses gemacht hatte. Das Gefängnis war eine Endstation und seine Gefangenen keineswegs repräsentativ. In den 20er bis 40er Jahren des 20.Jahrhunderts wurden vor allem statistische Untersuchungen durchgeführt, um die biologischen Ursachen nachzuweisen. Die Sippenforschung über Verbrecher- und Zigeunerfamilien versuchte aufzuzeigen, dass die asoziale Lebenshaltung, die teilweise auch Kriminalität einschloss, erbbiologisch bedingt war. Dabei wurde unberücksichtigt gelassen, dass in solchen Sippen auch soziale Faktoren tradiert wurden. Wegen dieser methodischen Fragwürdigkeit haben diese Untersuchungen heute ebenso wenig Gültigkeit mehr wie die Theorien von Lombroso. Wichtiger waren die Untersuchungen zur Kriminalität von Zwillingen, die mit Johann Langes „Verbrechen als Schicksal“ (1929) begannen und in statistischen Untersuchungen bis in die neuste Zeit fortgeführt wurden. Diese Forschungen versuchten zu belegen, dass eineiige Zwillinge, welche die gleiche Erbanlage haben, sich häufiger konkordant verhalten als zweieiige Zwillinge, die erbbiologisch gewöhnliche Geschwister sind. Walters (1992) hat in einer Meta-Analyse die Ergebnisse von 18 Zwillingsstudien zusammengefasst. Sie ergaben bei der Kriminalität von eineiigen Zwillingen Übereinstimmungen zwischen 7 und 100 Prozent, bei zweieiigen zwischen 0 und 78 Prozent (auf der Basis von je rund 500 Paaren). Eine gross angelegte Studie aus Dänemark, die gegen tausend zwischen 1881 und 1910 geborene männliche Zwillingspaare verglich, ergab, dass bei 35,2% der 325 eineiigen Paare und bei 12,5% der 611 zweieiigen Paare beide Brüder jemals im Strafregister verzeichnet waren (Christiansen 1977). Anhand der Untersuchungen lässt sich tatsächlich sagen, dass die kriminelle Belastung eineiiger Zwillinge häufiger übereinstimmt als die zweieiiger. Allerdings wurden bei diesen Untersuchungen mögliche soziale Verfäl- 2 schungs-Faktoren ausser Acht gelassen. Es ist nicht auszuschliessen, dass die soziale Umwelt auf eineiige Zwillinge, die sich stärker gleichen, auch anders reagiert als auf zweieiige, die wie gewöhnliche Geschwister unterschiedlich aussehen. Die jüngste statistische Forschungsrichtung versucht genetische Einflüsse mit der Adoptionsforschung nachzuweisen. Dabei wird die Entwicklung von Söhnen verfolgt, die getrennt von den Eltern aufwachsen. Es wird versucht, Verhaltens-Konkordanzen zu ihren leiblichen und ihren sozialen Vätern festzustellen. Mednick/ Gabriell/ Hutchings (1987) haben 14'000 zwischen 1924 und 1947 in Dänemark durchgeführte Adoptionen ausgewertet. Die Studie ergab, dass die Verurteilungsraten der Adoptierten stärker mit derjenigen der biologischen Eltern als mit jener der Adoptiveltern übereinstimmten. Waren nur die Adoptiveltern verurteilt worden, wiesen 13,5 % ihrer Söhne ebenfalls Verurteilungen auf. Wenn nur die leiblichen Eltern vorbestraft waren, wurden 20 % ihrer Söhne ebenfalls verurteilt. Mit 24,5 % erreichten die verurteilten Söhne den höchsten Wert, wenn beide Eltern vorbestraft waren. Die Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden, scheint somit für einen Adoptierten grösser zu werden, wenn er einen verurteilten biologischen Vater hat. Mögliche soziale Einflussfaktoren konnten auch hier nicht völlig ausgeschaltet werden. Zudem sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen relativ gering, so dass wir von einer Prädisposition, aber kaum von einem kausalen Zusammenhang sprechen können. Abgesehen von statistischen Übereinstimmungen wurde und wird auch nach biologischen Einzelfaktoren gesucht, die Delinquenz beeinflussen. Einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion gibt die Arbeit von Nadine Hohlfeld, Moderne Kriminalbiologie, Bern 2002, und die Zusammenfassung von Lee Ellis im European Journal of Criminology, Vol.2(3), 2005, 287ff. Zunächst wurde in der 2.Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Zusammenhang zwischen chromosomaler Konstitution und Kriminalität vermutet. Diese Diskussion lief seit den 60er Jahren unter dem Schlagwort des „Mörderchromosoms“, nachdem man herausgefunden hatte, dass der achtfache Frauenmörder Richard Speck aus Chicago eine XYY-Chromosomen-Aberration (überzähliges Y-Chromosom) aufwies. Man vermutete danach, dass Gewalttäter häufig an einer der Chromosomenanomalien XXY (Klinefelter-Syndrom) und insbesondere XYY litten. Klein-Vogler/Haberland (1974) verglichen das Vorkommen der Anomalien bei Kriminellen mit dem bei einer Kontrollgruppe aus der Durchschnittbevölkerung und stellten fest, dass unter den Kriminellen fast 11 %, unter den Nichtkriminellen nur 3 % eine Anomalie aufwiesen. Spätere Untersuchungen (Jörgensen 1981) bestätigten diese Ergebnisse nicht. Unter Strafgefangenen ist die XYY-Anomalie nicht häufiger als in der Gesamtbevölkerung. Amerikanische Studien deuten trotz gewisser psychischer Auffälligkeiten sogar auf eine verminderte Aggressionsneigung von XYY-Männern hin (Ysabel Rennie 1978). Auch das Klinefelter-Syndrom dürfte in keinem ursächlichen Zusammenhang zur Kriminalität stehen (Sorensen/Nielsen 1984). Zudem wurde in den Fällen, wo Anomalie-Belastete tatsächlich wegen Straftaten verurteilt und danach untersucht wurden, nie überprüft, wie weit die intellektuellen Beeinträchtigungen und psychischen Auffälligkeiten, die mit den Chromosomen-Anomalien verbunden sind, bewirken, dass die Betroffenen eher entdeckt und überführt werden. Bezeichnend ist das riesige Medienecho, das die Chromosomen-Anomalien damals auslösten – heute spricht niemand mehr vom „Mörderchromosom“. 3 Eine andere Forschungsrichtung befasst sich mit dem Einfluss körpereigener Substanzen. Die kriminologische Forschung hat sich vor allem auf zwei Bereiche konzentriert, auf Sexualhormone, insbesondere das Hormon Testosteron, und auf Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Bezüglich Testosteron ist nachgewiesen, dass es zumindest bei Tieren einen Zusammenhang zwischen diesem Hormon und aggressivem Verhalten gibt. Untersuchungen an Gewalttätern haben aber keine eindeutigen Ergebnisse erbracht. Zum Teil wurde ein schwacher, zum Teil ein mässiger Zusammenhang festgestellt, zum Teil auch gar kein Zusammenhang. Keine Studie ergab eine starke Korrelation (Rubin 1994,244). Angesichts dieser Daten muss offen bleiben, ob und wie weit Testosteron kriminelle Aggressivität beeinflusst. Unterschiedlich sind die Ergebnisse bezüglich der Neurotransmitter (Botenstoffe, die Signale von einem Neuron zum andern senden und damit Verhalten, Stimmungen und Emotionen steuern). Am sichersten nachgewiesen ist der Einfluss von Serotonin (Hohlfeld 219). Serotonin hat einen beruhigenden und angstmindernden Effekt, es spielt eine wichtige Rolle bei der Impulskontrolle. Personen, die unter einem niedrigen Serotoninspiegel leiden, neigen deshalb zu impulsivem und gewalttätigem Verhalten und sind weniger als andere in der Lage, über mögliche Folgen ihres Handelns zu reflektieren. Defizite im Serotonin-Haushalt können genetisch bedingt sein, aber auch durch negative Umwelteinflüsse verursacht werden. Widersprüchlich sind die Ergebnisse zu Dopamin und Noradrenalin. Zwar besteht ein Zusammenhang mit aggressivem Verhalten. Wie weit aber gewalttätiges Verhalten auf eine Überproduktion dieser Stoffe zurückgeführt werden kann, ist noch nicht völlig geklärt (Curran/Renzetti 1994,71ff.). Ein Zusammenhang mit impulsiver Aggressivität besteht zudem bei strukturellen oder funktionalen Hirndefiziten. Er wurde zuerst entdeckt an Hand der charakterlichen Veränderungen bei Personen, die entsprechende Verletzungen erlitten hatten. Eine Rolle spielen Defizite im Bereich des Stirnhirns (präfrontaler Cortex), des Schläfenlappens (Temporalcortex) und der limbischen Region im basalen Vorderhirn. Eine Verminderung der Aktivität des Frontalhirns als Folge von Läsionen oder Fehlentwicklungen führt zu einer erhöhten Risikobereitschaft, zu gesteigerter Impulsivität und zu rücksichtslosem Verhalten. Eine gestörte Hirnentwicklung kann zwar genetisch bedingt sein, sie kann aber auch während der Schwangerschaft resp. nach der Geburt oder später durch negative Umwelteinflüsse verursacht sein. Ausgehend von der Hirnforschung wird neuerdings das Strafrecht von einzelnen Hirnforschern (Wolf Singer, Gerhard Roth) grundsätzlich in Frage gestellt: Weil es neurobiologisch keinen freien Willen gebe, könne auch nicht von einer Verantwortlichkeit im Sinne der Schuld ausgegangen werden, die annehme, der Mensch hätte sich auch anders verhalten können. Damit ist der Determinismus-Streit neu entbrannt, stellt Jürgen Habermas fest. Jener Streit war vor rund 50 Jahren mit dem Ergebnis beigelegt worden, dass zwar von einem „freien“ Willen keine Rede sein kann (weil alle Entscheidungen durch die genetische Ausstattung, die Lebensgeschichte, das Unbewusste, durch Emotionen und durch soziale Einflüsse geprägt sind), dass aber dennoch ein beschränkter Freiraum bestehe, innerhalb dem Menschen sich entscheiden können: „Ich kann nur meine eigene Freiheit erfahren, das Problem der Freiheit an sich hat keinen Sinn“, schrieb Albert Camus in „Der Mythos des Sisyphos“. An diesen Spielraum knüpft nicht nur das Strafrecht an, er liegt auch vielen präventiven Massnahmen zu Grunde, etwa wenn wir Kontrollen verstärken, Videoüberwachungen vorsehen oder Tabaksteuern erhöhen, und mit diesen Massnahmen nachweislich das Verhalten der Menschen beeinflussen. Ein Paradigma-Wechsel im 4 Strafrecht ist deshalb nicht geboten. Dass jedes Denken, Handel und Empfinden im Hirn eine Entsprechung hat, lässt sich im Sinne der Korrelation nicht bestreiten, doch ist damit noch nicht entschieden, was Ursache und was Wirkung ist. Statistisch nachgewiesen ist ein Zusammenhang zwischen Delinquenz und dem Attention Deficit Hyperactivity Syndrom (ADHS). Diese im Volksmund mit „Zappelphilipp“ umschriebene Störung wurde in der Schweiz früher fälschlicher Weise „POS“ genannt. Ob die Überrepräsentanz bei Delinquenz und andern Verhaltensauffälligkeiten direkt auf die Krankheitssymptomatik zurückzuführen ist oder indirekt mit den Reaktionen und Benachteiligungen zusammenhängen, die solche Patienten erfahren, ist noch nicht geklärt (ausführlicher Bericht: Vertone/Ströber, KrimBull2/2001, 5ff.). Auch wenn unter Delinquenten ADHS-Betroffene stärker vertreten sind, als es der Verteilung in der Bevölkerung entspricht, heisst das aber keineswegs, dass ADHS zwangsläufig zur Delinquenz führen müsste. Zudem verliert sich die Symptomatik meistens in der spätern Pubertät. Die Frage, ob man Kriminalität quasi „essen“ könne, wurde vereinzelt in den USA untersucht. Es ist nicht auszuschliessen, dass einzelne delinquente Entwicklungen durch falsche Ernährung und eine dadurch bedingte Vergiftung des Körpers mit bestimmten Stoffen mitverursacht sind. Als Stoffe, die mit Delinquenz in Zusammenhang gebracht wurden, werden Milch, Vitamin B1, Zucker und Blei genannt (Schauss 1980). In Deutschland versuchte Hafer (1990) nachzuweisen, dass eine Überernährung mit Phosphaten, die sich in der täglichen Nahrung finden, zu einer zerebralen Dysfunktion und in der Folge häufig zu Verhaltensstörungen führe. Schliesslich wird auch ein Zusammenhang mit Herzfrequenzen vermutet: Ein zu langsamer Herzschlag bewirkt eine ungenügende Aktivierung des Nervensystems. Das Erregungsniveau der Hirnrinde ist vermindert, nach einer Stimulation wird das Ausgangsniveau schneller wieder erreicht. Die betroffene Person spürt dadurch eine Leere, einen Spannungszustand, der sie nach Abenteuer, nach einem „Kick“, suchen lässt. Personen mit übermässigem Reizhunger werden in der Literatur als „sensationseekers“ (Zuckermann 1994) bezeichnet. Kritik der biologischen Ansätze Die meisten Ergebnisse sind empirisch nicht genügend gesichert, teilweise handelt es sich um kleine Untersuchungen mit schwacher Repräsentativität oder fehlenden Vergleichsgruppen. Zudem wird oft Kriminalität und Aggression gleichgesetzt, was methodisch fragwürdig ist. Unbestritten ist, dass genetisch bedingte Faktoren wie Körperbau, Intelligenz, Temperament sich als Prädispositionen für bestimmte Deliktsarten auswirken können. Der energiegeladene, aber nicht überaus intelligente Muskelmann wird sicher eher zum Dreinschlagen neigen als der feingliedrige, schwächliche Intellektuelle. Der extravertierte, geistig wendige Pykniker wird, wenn er delinquiert, am ehesten Betrüge verüben, der introvertierte, wenig sportliche, aber hochintelligente Jus-Student eher Computerdelikte. Auszuschliessen ist, dass Kriminalität durch die Erbmasse oder durch andere biologische Faktoren unabänderlich determiniert sein kann. Selbst dort, wo Prädispositionen wahrscheinlich oder - wie bei der Konstitution, beim Energie- oder Aggressions- 5 potenzial - sogar evident sind, sind sie nie schicksalhaft, in dem Sinne, dass sie auch ohne biografische Einwirkungen und ohne soziale und gesellschaftliche Einflüsse notwendigerweise Kriminalität zur Folge haben müssten. Auch in den Fällen, wo belastende Faktoren gehäuft auftreten und damit eine Prädisposition begründen, gelten regelmässig folgende zwei Einschränkungen: 1. Es gibt immer eine grosse Zahl von Kriminellen, die den betreffenden Faktor nicht aufweisen. 2. Es gibt in allen Fällen eine viel grössere Zahl von Personen, für die der Faktor zutrifft, die aber nicht kriminell sind. Denken Sie an den Faktor mit der stärksten Prävalenz: das männliche Geschlecht. So richtig es ist, dass Männer häufiger Delikte begehen (wobei ungeklärt ist, wie weit das biologisch bedingt ist), so sicher ist es falsch, Mann-Sein als Kriminalitätsursache zu bezeichnen oder gar vom „kriminellen Geschlecht“ zu sprechen. Auffallend ist das grosse Interesse der Öffentlichkeit und der Medien an biologischen Theorien. Das dürfte einerseits damit zusammenhängen, dass solche Erklärungen die Gesellschaft, die Sozialkontrolle und die Erziehung entlasten. Andererseits verstärken sie die Distanz zwischen den „Normalen“ und den als pathologisch verstandenen Kriminellen (warum ein Bedürfnis nach einer solchen Abgrenzung besteht, versucht die Sündenbocktheorie zu erklären, s.u.). Kriminalpolitisch legitimieren biologische Theorien konservative und repressive Reaktionsansätze. Weil biologische Defizite überhaupt nicht oder höchstens medikamentös oder operativ behandelt werden können, bleiben als mögliche Rezepte medizinische Behandlungen, totale Überwachung, selective incapacitation (durch Verwahrung oder Todesstrafe), Eugenik. Halten wir fest: Den geborenen Verbrecher gibt es nicht. Biologische Faktoren können Prädispositionen begründen, die zusammen mit Umwelteinflüssen Delinquenz auslösen können. Es braucht immer zusätzliche Einwirkungen, damit eine Person kriminell wird. 1.2. Psychiatrische Theorien Schon früh wurde versucht, Kriminalität mit besondern Persönlichkeitsmerkmalen und insbesondere mit psychiatrischen Krankheitsbildern in Beziehung zu setzen. Einerseits wurde der Einfluss von Psychosen, Oligophrenien und Psychopathien untersucht, andererseits wurde nach kriminalitätshemmenden resp. kriminalitätsfördernden Faktoren in den Bereichen Temperament, Motivation, Intellekt und Selbstbild geforscht. Die untersuchten Persönlichkeitsbereiche erwiesen sich allerdings als wenig trennscharf, und oft blieb offen, ob die Defizite Ursache oder Folge des delinquenten Verhaltens waren. Zudem wiesen die Untersuchungen methodische Schwächen auf, z.B. mangelnde Repräsentativität der Stichproben, fehlende Vergleichsdaten aus der Durchschnittsbevölkerung, unscharfe Begriffe. Die früher vertretene Annahme, verminderte Intelligenz bis hin zur Oligophrenie führe zu vermehrter Kriminalität, lässt sich heute nicht mehr halten. Es gibt zwar Delikte, 6 die häufiger von Minderbegabten begangen werden, z.B. Brandstiftungen und gewaltlose Sexualdelikte, doch gleicht sich das mit einer Untervertretung bei andern Straftaten aus. Die geringere Durchschnittsintelligenz von Strafgefangenen ist eher auf das höhere Entdeckungsrisiko „dummer“ Täter zurückzuführen als auf eine tatsächliche Höherbelastung intelligenzgeminderter Personen. Dagegen gibt es nach neuern Untersuchungen ein erhöhtes Risiko für Gewaltdelikte von Schizophrenen, sowohl im Vergleich mit andern psychisch Kranken als auch mit Gesunden (Nedopil 2000). Allerdings ist zu beachten, dass die Delinquenzrate Schizophrener in hohem Masse von der Qualität und Intensität ihrer Betreuung und Versorgung abhängig ist (Kaiser 2000). Ausgehend von den USA haben persönlichkeitsorientierte Kriminalitätserklärungen vor allem zur Erklärung von Gewaltdelinquenz in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Diese knüpfen an die Erkenntnis an, dass eine kleine Gruppe von Intensivtätern für einen Grossteil schwerer Delikte verantwortlich und durch Strafe kaum beeinflussbar ist. Die meisten dieser Täter leiden an Persönlichkeitsstörungen mit ähnlichen Charakteristiken. Um sie identifizieren und einheitlich diagnostizieren zu können, wurde das Konzept der dissozialen oder antisozialen Persönlichkeit entwickelt. Dieses fand zum Teil Eingang in die internationalen psychiatrischen Klassifikationssystem ICD-10 (bei uns am meisten verbreitet) und DSM-IV, zum Teil wurden spezielle Definitionen entwickelt (Soziopathy nach Hervey Cleckley, Psychopathy nach Robert D.Hare). Untersuchungen an kriminellen „psychopaths“ ergaben gehäuft Unregelmässigkeiten im präfrontalen Cortex, in dem affektiv-emotionale Reaktionen reguliert werden. Unterschiede zeigten sich vor allem in der Hippocampusgrösse der beiden Gehirnhälften. Der Hippocampus spielt eine wichtige Rolle für das Langzeitgedächtnis und als Kontrollinstanz der Gedanken und Wünsche. Allerdings zeigten die Vergleichsuntersuchungen von Raine (2004), dass die Hippocampus-Asymmetrie nur bei erfolglosen (kriminellen) „psychopaths“ festzustellen war, nicht aber bei erfolgreichen (nichtkriminellen oder nicht erwischten) „psychopaths“. (s. Folien) Psychopathielehre von Kurt Schneider (überholt) Psychopathie ist eine angeborene Charakterabnormität und deshalb nicht behandelbar. Psychopathen sind „moralische Idioten“, die zu differenzierten Empfindungen nicht fähig sind. Dennoch gelten sie als zurechnungsfähig. ICD-10 ICD-10 ist ein psychiatrisches Klassifizierungssystem, das sich international durchgesetzt hat (in den USA wird häufiger das vergleichbare System DSM-IV verwendet). ICD-10 beschränkt sich darauf, Symptomen zu beschreiben, die eine Vereinheitlichung der Definitionen und damit eine präzisere Diagnostik ermöglichen sollen. Ätiologische Erklärungen werden nicht angestrebt. Die Persönlichkeits-Störungen gelten teilweise als korrigierbar. In Gutachten wird ICD-10 als Standard verwendet. Beispiel: F-60.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung (s. Folien) 7 Kritik am Konzept der dissozialen Persönlichkeit Von einer Kriminalitätstheorie erwartet man, dass sie den Bezug zu einer Ursache herstellt. Das Konzept der dissozialen Persönlichkeit verzichtet darauf, sondern beschränkt sich darauf, die Symptome einheitlich zu beschreiben: Dissozialität liegt dann vor, wenn eine Person sich dissozial verhält. Über die Ursachen und Entstehungsbedingungen der Störung ist damit nichts ausgesagt. Das Konzept ist zirkulär, nach dem Muster: Das Bauchweh ist darauf zurückzuführen, dass der Unterleib weh tut. Das Konzept ist präziser als die Schneidersche Typologie, dennoch trügt der Eindruck eines einheitlichen Krankheits- oder Störungsbilds. Die Grenzen bleiben relativ unscharf, die scheinbar deskriptiven Beschreibungen sind teilweise wertend und moralisierend (z.B. oberflächlicher Charme, krankhaftes Lügen, keine Emotionen und gefühllos). Die eingeschränkte Behandelbarkeit auf Grund vermuteter genetischer Ursachen fördert eine therapeutische Gleichgültigkeit. Diese Tendenz ist vor allem in den USA spürbar. In Wahrheit kann über Behandlungs-Chancen erst eine Aussage gemacht werden, nachdem eine Behandlung versucht wurde. Die abwertende Umschreibung und der therapeutische Defaitismus können sich für die Betroffenen als Stigma auswirken, das ihre Chancen zusätzlich verschlechtert. Das Konzept entlastet die Gesellschaft, indem es soziale Ursachen ausblendet. Es definiert die Betroffenen als andersartige Wesen und erfüllt damit eine SündenbockErwartung. Es fördert tendeziell eine repressive Kriminalpolitik im Sinne der selective incapacitation. Dass die persönlichkeitsgestörten Menschen, die für ihr Anderssein eigentlich nichts können, dennoch als schuldfähig (oder zumindest als teilweise zurechnungsfähig) eingestuft werden, ist widersprüchlich. Der Wert des Konzepts liegt in der international vereinheitlichten Diagnostik. Es hat zudem die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass gegenüber gemeingefährlichen Tätern gezielte Behandlungs- oder Verwahrungsmassnahmen durchgeführt werden können. 1.3. Tiefenpsychologische Ansätze Die tiefenpsychologischen Theorien beruhen auf der Entdeckung des Unbewussten durch Siegmund Freud. Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell geht von drei psychischen Instanzen und ihrem Zusammenspiel aus: Das Es ist wird durch Triebbedürfnisse und unbewusste Triebenergien angetrieben (bedeutsam für die Kriminologie z.B. Sexualtrieb, Zerstörungstrieb). Das Über-Ich ist als Kontrollinstanz der moralische Zensor (was wir im Alltag als „Gewissen“ bezeichnen, allerdings mit starken unbewussten Anteilen). Das Ich vermittelt zwischen den Triebforderungen des Es und den moralischen Ansprüchen des Über-Ichs, es entscheidet über das Handeln und das Selbstbild der Person. Nach Freuds Verständnis werden Menschen als triebhaft-asoziale, polymorph-perverse Wesen geboren. Danach entscheiden die Erziehung und die frühkindliche Entwicklung über die Ausbildung des Über-Ichs und 8 den vom einzelnen Menschen im Rahmen der Ich-Werdung gefundenen Ausgleich zwischen den Instanzen Es und Über-Ich, und damit über die Fähigkeit zur sozialen Anpassung. In einer gesunden Entwicklung lernt der Mensch, die Triebimpulse des Es zu beherrschen und in der Auseinandersetzung mit dem Über-Ich ein steuerndes Ich aufzubauen. Kriminelle dagegen weisen Ich-Schwächen oder Ich-Störungen auf, entweder auf der Basis von unbewussten Konflikten zwischen verdrängten Triebregungen des Es und einem überstarken Über-Ich (neurotische Kriminalität, unerwartete Trieb-Durchbrüche), oder auf der Grundlage einer Es-Dominanz bei zu schwachem Über-Ich (verwahrlosungsbedingte Kriminalität, dissoziales Syndrom). Freud selbst befasste sich nur am Rande mit Kriminalität. Im Rahmen seiner Neurosen-Theorie beschrieb er insbesondere den Verbrecher aus Schuldbewusstsein, der Straftaten begeht, um durch die Bestrafung eine Entlastung seiner aus einem überstrengen Über-Ich resultierenden Schuldgefühle zu erreichen (Beispiele: Delinquenten, die unbewusst dafür sorgen, dass sie erwischt werden). Alexander/Staub (1929) entwickelten eine erste psychoanalytische Typologie: Sie unterschieden den „neurotischen Kriminellen“, der aus Schuldbewusstsein handelt (überstarkes Über-Ich) vom „Verbrecher mit kriminell geprägtem Ich“, dem es an Über-Ich-Steuerung fehlt (Gewohnheitsverbrecher ohne Gewissen). Weiterentwickelt wurde diese Variante in der Theorie des dissozialen Syndroms (De Boor 1977, Böllinger 1983), die ähnliche Phänomene erklärt wie die Psychopathie-Lehre. Alfred Adler, ein Schüler Freuds, gründete mit der sog. Individualpsychologie eine eigenständige tiefenpsychologische Schule. Darin wird die Kriminalität auf das Machtstreben zurückgeführt. Das Individuum suche in seinem Verhalten den aus dem Gefühl der eigenen Schwäche resultierenden Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren. Die Kompensation ermögliche viele gesellschaftlich wertvolle Leistungen, könne sich aber in Überkompensationen auch sozial negativ äussern, etwa in Straftaten (z.B. Wirtschaftsdelikte in Konkurrenzsituationen). Kritik der tiefenpsychologischen Erklärungen Die tiefenpsychologischen Erklärungen erschöpfen sich im Gegensatz zu den psychiatrischen Theorien nicht in phänomenologischen Beschreibungen, sondern suchen nach kausalen Deutungsmustern, die an die unbewusste Dynamik des Seelenlebens anknüpfen. Allerdings sind die Instanzen dieser Dynamik und die dazu gehörigen Begriffe einer exakten Überprüfung im Sinn des empirischen Rationalismus nicht zugänglich. Es, Ich und Über-Ich lassen sich nicht präzis operationalisieren, nicht objektiv feststellen und nicht messen. Die tiefenpsychologischen Ansätze können folglich nicht prospektiv erklären, unter welchen Voraussetzungen eine Person kriminell wird, sondern nur retrospektiv deuten und interpretieren, welche innerpsychische Dynamik zu einem bestimmten Verhalten geführt hat. Die Theorien sind deshalb nicht ursachenbezogene Erklärungsmodelle, sondern ergebnisbezogene Deutungsmodelle. Dennoch ist es das Verdienst der Tiefenpsychologie, dass sie unbewusste Motive, frühkindliche Konflikte und familiäre Deprivationen ins Blickfeld gerückt hat. Begriffe wie Über-Ich, Gewissen, Schuldbewusstsein und Strafbedürfnis sind gleichzeitig Anknüpfungspunkte für absolute und relative Straftheorien. 9 Die Tiefenpsychologie hat aus diesen Elementen auch eine sozialstrukturelle Theorie entwickelt, genannt Sündenbocktheorie oder Psychologie der strafenden Gesellschaft. Die Sündenbocktheorie (Theodor Reik, Geständniszwang und Strafbedürfnis, 1947; Paul Reiwald, Die Gesellschaft und ihre Verbrecher, 1948; Eduard Naegeli, Das Böse und das Strafrecht, 1966 Helmut Ostermeyer, Strafrecht und Psychoanalyse, 1972) Die Sündenbocktheorie versucht zu erklären, warum die Gesellschaft die Bestrafung Krimineller zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse braucht. Sie gehört eigentlich zu den sozialstrukturellen Theorien, soll aber wegen des Herkunft aus der Tiefenpsychologie in diesem Zusammenhang diskutiert werden. 3.Buch Moses, Kapitel 16, Vers 16ff.: Die Kinder Israels luden alle Übertretungen, mit denen sie sich versündigt hatten, auf einen lebendigen Ziegenbock und jagten ihn in die Wüste, „dass also der Bock alle ihre Missetaten auf sich nehme und in die Wildnis trage“. Dem Sündenbock wurde somit die Schuld der Gesellschaftsmitglieder zur kollektiven Entlastung aufgeladen. Die Hypothese beruht auf der Triebtheorie von Freud, wonach Triebe, die im Erziehungsprozess unterdrückt werden, latent wirksam bleiben und nach einer Ersatzbefriedigung suchen. Diese kann darin bestehen, „seine eigene unbewusste Schuld auf den ... Kriminellen zu projizieren“, Ostermeyer 1972,33). Dessen Bestrafung entlastet von eigener Sünde, ist verschleierte Selbstbestrafung. Sie hilft damit, die eigenen kriminellen Antriebe unter Kontrolle zu halten. Nach dieser Theorie braucht die Gesellschaft die Kriminellen, um ihre aggressiven Affekte abreagieren zu können. Das Strafrecht ist demnach ein Mittel kollektiver Aggressionsabfuhr. Dass es solche Mechanismen gibt, wurde besonders deutlich in Gesellschaften, in denen Kriminalität im traditionellen Sinne fast ausgemerzt war (Beispiele: China unter Mao, Quäker in den USA, vgl. Erikson, Die widerspenstigen Puritaner, 1978). In solchen Situationen müssen Hexen oder politische Abweichler die Rolle der Sündenböcke übernehmen, wobei dort besonders deutlich wird, dass ihrem „Fehlverhalten“ gesellschaftliche Projektionen zugrunde liegen. Aber auch in unserer Gesellschaft werden ähnliche Phänomene sichtbar, etwa in aggressiven Bestrafungswünschen gegenüber Sexualdelinquenten, wobei Personen oft nach besonders harten Bestrafung rufen, die Mühe haben, entsprechende Antriebe in sich selbst zu unterdrücken. Vor diesem Hintergrund wird auch erklärbar, warum Teile der Bevölkerung sich nicht auf verstehende Kriminalitäts-Erklärungen einlassen können. Solche Personen brauchen den Kriminellen als eine Projektionsfläche, die mit ihrem bewussten Selbst nichts zu tun hat. Die (erlaubte) Aggressionsabfuhr ist nur möglich, solange der Kriminelle (oder der Fremde) ein Monster bleibt, in das man sich nicht einfühlen kann. Kritik der Sündenbockhypothese 10 Es gibt solche Mechanismen, aber sie reichen zweifellos nicht aus, um alle Strafbedürfnisse zu erklären. Das Strafrecht ist sicher nicht nur kollektive Aggressionsabfuhr, vor allem dort nicht, wo es versucht, private Rache und Fehde zu kontrollieren und zu ersetzen. Zudem führt eine verabsolutierte Sündenbocktheorie zu einer Schuldverlagerung. Der Kriminelle wird zum Opfer einer aggressiven Gesellschaft; seine Verantwortung würde damit neutralisiert und bagatellisiert. 1.4. Sozialisations- / Lern-Theorien Sozialpsychologische Theorien stellen den Übergang her zwischen den bisher dargestellten individuellen und den folgenden gesellschaftlichen Erklärungen, die Schnittstelle zwischen Mikro- und Makro-Theorien. Sie verstehen Kriminalität als Ergebnis personenbezogener Entwicklungsprozesse und der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner sozialen Umwelt und gehören deshalb immer noch zu den Persönlichkeitstheorien. Sozialpsychologische Untersuchungen Sozialpsychologische Untersuchungen erforschen die Zusammenhänge zwischen Erziehungsdefiziten, Sozialisationsverläufen und Verhaltensmustern einerseits und delinquentem Problemverhalten andererseits. Allerdings ist damit noch nichts über die Ursachen ausgesagt. Die Auffälligkeiten können durch gestörte oder verzögerte Entwicklungen, durch tiefenpsychologische Symptombildung, durch soziales Lernen, durch anomische Situationen oder andere Mechanismen verursacht sein. Die erforschten Zusammenhänge, die im Folgenden zusammengefasst werden, sind deshalb keine eigentlichen Theorien, sondern Risiko-Konstellationen, bei deren Vorliegen sich delinquente Gefährdungen mit grösserer Wahrscheinlichkeit ungünstig auswirken. Untersucht wurden und werden vor allem die folgenden Zusammenhänge: Risiken in der Familie: Keine oder nur unbedeutende Korrelationen bestehen zu strukturellen Familienmerkmalen (Scheidung, Alleinerziehung, Haushaltgrösse) und zu sozio-ökonomischen Variablen (Einkommen, Beruf, Arbeitslosigkeit der Eltern). Deutlich ausgeprägt sind dagegen die Zusammenhänge zu funktionalen Merkmalen (Familienklima, Harmonie, Wärme) und zum Erziehungsverhalten (Erziehungsstil, Aggression, Inkonsistenz). Delinquente Jugendliche erfahren mehr Streit, Ablehnung und Vernachlässigung. Sie werden häufiger lieblos, übermässig streng oder gleichgültig behandelt und erleben weniger Anregung und Förderung, aber oft auch weniger klar kommunizierte Grenzziehungen. Misshandlungen und sexuelle Übergriffe kommen überdurchschnittlich oft vor. Besonders negativ wirkt sich eine inkonsistente Erziehung aus, die z.B. zwischen Überstrenge und laissez-faire oder zwischen heftigen Liebesbezeugungen und extremer Ablehnung hin und her schwankt. Multiproblem-Milieu: Wo sich solche Merkmale häufen und mit ausserfamiliären Merkmalen wie Armut, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit sowie schlechten Wohnverhältnissen (die allein nicht ausschlaggebend sind) einhergehen, erhöht sich das Delinquenzrisiko deutlich. Jugendliche aus prekären Verhältnissen haben regelmäs- 11 sig Diskontinuität in beziehungsmässiger, familiärer, örtlicher und/oder schulischer Hinsicht erlebt und deshalb keine stabile innere Struktur aufbauen können. Zusätzlich verstärkt wird das Delinquenzrisiko, wenn die Familie in einer desintegrierten, verwahrlosten oder gewalttätigen Nachbarschaft lebt. Solche Probleme zeigen sich besonders in den USA oder in Frankreich, wo die Segregation von Wohnquartieren und die Slumbildung weiter als in der Schweiz verbreitet sind. Schulische Faktoren: Keine Rolle spielen die Klassengrösse, die baulichen Voraussetzungen sowie Lage und Grösse des Schulhauses. Wichtig sind dagegen das Klassenklima, ein kompetentes, einfühlsames und konsequentes Lehrkraft-Verhalten, die Betonung schulischer und gesellschaftlicher Werte sowie angemessene Partizipationsformen (Lösel/Bliesener 2004,14). Die von Kassis in Basler Schulen durchgeführte Untersuchung hat z.B. gezeigt, dass im gleichen Schulhaus Klassen mit einem hohen und solche mit einem geringen Gewaltpotenzial zu finden sind. Das Ausmass der Gewaltbereitschaft hängt nicht vom Anteil an Ausländer-Kindern ab, wohl aber erhöht es sich, wenn in einer Klasse viele Kinder sind, die von ihrer persönlichen Entwicklung her zu Aggression neigen. Eine klare Gefährdung besteht, wenn feindliche Einstellungen zur Schule, Schulschwänzen, schlechte Beziehungen zu den Lehrpersonen, chronische Leistungsschwierigkeiten und Schulabbrüche auftreten. Peer-Gruppen: Besonders bedeutsam ist der Einfluss von Peer-Gruppen. Aggressive und delinquente Jugendliche schliessen sich häufig Cliquen an, in denen deviante und gewalttätige Einstellungen und Aktivitäten vorherrschen. In der Interaktion mit den Gleichaltrigen werden aggressive Verhaltensmuster, Delinquenz, SubstanzenKonsum und ein auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ausgerichteter Lebensstil gefördert. Es besteht insofern eine Wechselwirkung, indem Jugendliche, die zu Gewalt und Delinquenz neigen, entsprechende Peer-Gruppen aussuchen und mitprägen, durch diese aber auch wieder in ihren Einstellungen und Haltungen bestärkt werden. Migration: Die Verpflanzung in eine andere Umgebung ist für Kinder und Jugendliche eine schwierige Situation, auch wenn es sich nur um einen Umzug handelt. Das gilt z.B. auch für Kinder von schweizerischen Rückkehrern. Der Wechsel wird umso belastender, je mehr sich die neue Umwelt unterscheidet und je weniger die Betroffenen dafür gerüstet sind. Dennoch meistern die meisten Kinder und Jugendlichen solche Situationen nach einiger Zeit ohne Verhaltensauffälligkeiten, weil sie von ihren Beziehungspersonen gestützt und begleitet werden. Kleinere Kinder und Heranwachsende schaffen den Wechsel leichter. Bei Jugendlichen ist eine Krise dann wahrscheinlich, wenn die Beziehungspersonen die Unterstützungsfunktion nicht oder nicht genügend wahrnehmen, wenn die Jugendlichen frühere Erlebnisse nicht verarbeiten konnten, oder wenn sie gewaltlegitimierende Einstellungsmuster (sog. MachoDenken) und aggressive Verhaltensdispositionen mitbringen. Die dadurch verursachten Krisen münden oft in, Aggressivität, Delinquenz oder Drogenkonsum. Kritik: Die sozialpsychologischen Untersuchungen zeigen statistische Zusammenhänge (Korrelationen) auf, ohne etwas über die Wirkungszusammenhänge auszusagen. Für kausale Erklärungen muss auf die andern Theorien zurückgegriffen werden. Wichtig sind die erforschten Zusammenhänge vor allem für die Prävention. 12 Lerntheorien Lerntheorien gehen davon aus, dass abweichendes Verhalten genauso erlernt wird wie konformes Verhalten. Lernen ist dabei umfassend im Sinne des sozialen Lernens zu verstehen, nicht in einer eingeschränkt kognitiven Bedeutung wie im Schullernen. Unterschiedliche Auffassungen vertreten die einzelnen Varianten darüber, wie der Lernvorgang abläuft (klassische, operante Konditionierung, Beobachtungslernen, Lernen am Modell) und welche zusätzlichen Bedingungen massgeblich sind. 1. Nach dem Modell der klassischen Konditionierung wird soziales Verhalten durch Angstreaktionen erworben, analog zum Hund von Pawlow. Abweichendes Verhalten kann eine Folge misslungener Konditionierungs-Prozesse sein, oder es kann eine gezielte Erziehung zur Kriminalität stattfinden, z.B. durch Eltern, die ihre Kinder zu Delikten abrichten, oder im Knast, soweit er sich als „Schule des Verbrechens“ auswirkt. Klassische Konditionierung liegt auch unserer Erwartung zugrunde, die Bestrafung habe zur Folge, dass ein unerwünschtes Verhalten künftig vermieden werde. Im übrigen aber wird gegen die klassischen Konditionierung eingewendet, sie vernachlässige die Motivation des lernenden Individuums und sei deshalb zu reaktiv-reflexartig. Eine Lerntheorie, die sich hauptsächlich auf klassische Konditionierung stützte, war die Konditionierungstheorie von Eysenck. Sie gilt heute als überholt. 2. Nach dem Modell von Skinner (1953) sprechen wir von operanter Konditionierung, wenn nach dem Prinzip von trial and error am Erfolg gelernt wird. Skinner wies in Tierversuchen nach, dass Versuchstiere Verhaltensweisen kreativ entwickeln, wenn diese zum gewünschten Ziel führen. Beim Menschen kann dieses Lernen zusätzlich durch den Willen gesteuert sein. Weil der Erfolg in einer illegal erworbenen Belohnung liegen kann, führt das Ausbleiben von Strafe bei erfolgreichen Delikten zu einer Fortsetzung des abweichenden Verhaltens. Ein Beispiel dafür ist das Kind, das beim Stehlen nicht erwischt wird und diese Handlung deshalb wiederholt. Umgekehrt wird in der Verhaltenstherapie, die bei der Behandlung von Delinquenten häufig eingesetzt wird, eine Gegenkonditionierung angestrebt, indem konformes Verhalten belohnt wird. Gleichzeitig sollen kriminelle Denkmuster und Verhaltensweisen verlernt werden. 3. Die sozial-kognitive Lerntheorie Banduras (1979) geht davon aus, dass Verhalten, und insbesondere illegale Verhaltensweisen weniger durch persönliche Erfahrung als durch Beobachtung Anderer und durch Bewertung der sich für jene Personen ergebenden positiven oder negativen Konsequenzen erworben werden. Wir sprechen vom Lernen am Modell oder Imitationslernen. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei Bezugspersonen wie Eltern, Idole, Identifikationsfiguren in Peer-Gruppen und Medienvorbilder. Im AntiAggressivitäts-Training nach Jens Weidner, wie es beispielsweise im Basler Aufnahmeheim praktiziert wird, ist es deshalb wichtig, dass in die Konfrontation des Täters mit seinem aggressiven Verhalten (auf dem sog. „heissen Stuhl“) auch Jugendliche einbezogen sind, die sich selbst aggressiv verhalten haben oder hatten. Wie wirksam das Modell-Lernen ist, zeigt sich auch in der Werbung, die sich solche Effekte gezielt zu Nutzen macht. Im Unterschied zur Konditionierung erfasst die sozial-kognitive Theorie den Lernvorgang nicht nur 13 als reaktive Prägung, sondern als einen Prozess der Selbststeuerung, worin die Person ihr Verhalten im Hinblick auf eigene Werte und antizipierte Folgen ausbildet und gestaltet. 4. Soziologische Lerntheorien gehen vor allem auf Sutherland (seit 1924) zurück: In der Theorie der differentiellen Assoziationen oder differentiellen Kontakte hat er gemeinsam mit Cressey auf Lernprozesse hingewiesen, die innerhalb abweichender Gruppen stattfinden. Danach sind kriminogene Lernvorgänge umso wahrscheinlicher, je früher, länger, intensiver und häufiger „Assoziationen“ (d.h. Verbindungen, Kontakte und Interaktionen) mit sozial abweichenden Personen und Umgebungen stattfinden. Gelernt werden nicht nur Motive, sondern auch Techniken des abweichenden Verhaltens. Sutherland (1974) erläutert das an folgendem Beispiel: „In einem Gebiet mit hoher Delinquenzrate wird ein ungezwungener, geselliger, aktiver und kräftiger Junge sehr wahrscheinlich mit den andern Jungen in der Nachbarschaft in Kontakt kommen, delinquentes Verhalten von ihnen lernen und ein Gangster werden.“ Der gleiche Junge würde in einer andern sozialen Umgebung Mitglied einer Pfadi-Gruppe und in der Folge nicht in delinquentes Verhalten verwickelt. Weiterentwickelt wurde der Ansatz in der Theorie der differentiellen Identifikation (Glaser), welche sich auf die Rolle von Identifikationsfiguren abstützt. Kritik der Lerntheorien Lerntheorien erklären nicht alle Kriminalitätsformen: Insbesondere auf Trieb- und Affektverbrechen lassen sie sich nur sehr beschränkt anwenden. Sie können zudem nicht begründen, warum es überhaupt zu abweichenden Wertorientierungen und delinquenten Vorbildern kommt. Vor allem werden Lernvorgänge zu mechanisch und schematisch erfasst: Individuelle Unterschiede der Lernmotivation und der Lernfähigkeit werden zu wenig berücksichtigt. Die Theorien erklären nicht, warum der eine Jugendliche in der gleichen Konstellation kriminelle Vorbilder sucht, der andere aber nicht. Insbesondere die Theorie der differentiellen Kontakte lässt sich angesichts der grossen Vielfalt sozialer Kontakte kaum empirisch überprüfen. 1.5. Kontrolltheorien Kontrolltheorien, Halttheorien oder Theorien der sozialen Bindung beruhen auf der Annahme, ein stark geknüpftes Netz sozialer Bindungen, Beziehungen und Verantwortlichkeiten trage zur Verhinderung von Delinquenz bei. Die sich daraus ergebenden Kontrollen können innere (verinnerlichte) oder äussere (externe) Kontrollen sein. Je mehr sie fehlen, gelockert oder gestört werden, desto wahrscheinlicher werden Delinquenz oder andere Formen abweichenden Verhaltens (Sucht, Dissozialität, Dekompensation). Mit den Kontrolltheorien findet ein Perspektiven-Wechsel statt: Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Ansätzen fragen sie nicht danach, warum Menschen sich aus- 14 nahmsweise abweichend verhalten, warum sie delinquieren, sondern danach, warum sie das nicht tun, warum sie sich meistens konform verhalten. Erklärungsbedürftig ist die Normtreue, nicht die Abweichung. Diese Optik ist vom Menschenbild Freuds beeinflusst (s.o.), das die Natur des Menschen als triebhaft-asozial einstuft. Erst durch die Erziehung und die dadurch vermittelten äussern und innern Begrenzungen kann ein soziales Wesen geformt werden. Einen ersten Kontroll-Ansatz hat Reckless (1961) mit seiner Halttheorie formuliert. Er differenziert dabei zwischen dem Selbstkonzept als innerem Halt und den Beziehungsankern des äussern Halts (Familie, Gruppen, soziale Ordnung). Abweichendes Verhalten wird auf fehlenden innern oder äussern Halt zurückgeführt. Je schwächer der innere Halt ist, desto stärker muss der äussere Halt dieses Defizit kompensieren und umgekehrt. Fehlt es an beidem, ist abweichendes Verhalten besonders wahrscheinlich. In neuerer Zeit wird mit dem Begriff Kontrolltheorien vor allem der Name Hirschi assoziiert (vgl. auch das Kapitel über postmoderne Theorien und die dort ausführlich referierte Theorie der low self-control von Gotfredson/Hirschi). Hirschi ging schon in seinen früheren Arbeiten (1974) davon aus, dass Menschen Straftaten begehen, wenn sie nicht durch Bindung an gesellschaftliche Konventionen daran gehindert werden. Er differenzierte die Einbindung in die Gesellschaft und unterschied dabei folgende Elemente: 1. attachment to others (emotionale Beziehung zu andern Menschen, die sich in Rücksichtnahme und Empathie auswirkt) 2. commitment to achievement (Leistungsorientierung und damit zusammenhängende Ambitionen und positive Selbsteinschätzung) 3. involvement in conventional activities (Einbindung in konforme Tätigkeiten wie Arbeit oder Studium) 4. belief in the moral validity of rules (Glaube an die Verbindlichkeit gesellschaftlicher Regeln) Je schwächer diese Bindungen bei einem Menschen ausgestaltet sind, desto wahrscheinlicher wir nach Hirschi Delinquenz. Auch der Inhalt der Bindung spielt eine Rolle: Personen, die hedonistischen, materiellen, individualistischen Werten verpflichtet sind, delinquieren häufiger als solche, die sich nach traditionellen, idealistischen oder gemeinschaftsbezogenen Werten ausrichten (Hermann, Werte und Kriminalität 2003). Kritik der Kontrolltheorien Die mit den Kontrolltheorien vermittelte Erklärung ist tautologisch, nach dem Muster: Das Auto schleudert, weil es zu wenig Boden-Haftung (Halt) hat. Die eigentlichen Ursachen werden ausgeblendet. Die entscheidende Frage wäre ja, warum das Auto zu wenig Haftung hat: Liegt es an abgefahrenen Pneus, am Strassenbelag, an einer ungünstigen Beladung, an einem Konstruktionsfehler, am Fahrverhalten ? Folge davon ist, dass die Theorie nur eine Wahrscheinlichkeit feststellen, aber nicht erklären kann, warum der Einzelne sich deviant verhält. Vor allem kann sie nicht begründen, warum Personen unter den genau gleichen Bedingungen sich ganz unterschiedlich entwickeln und verhalten können. Viele Individuen werden trotz massiven Defiziten bezüglich sozialer Bindungen nicht straffällig, und umgekehrt begehen auch 15 Personen mit optimaler Einbindung Delikte, wenn auch vielleicht vorsichtiger und mehr im Verborgenen. Obwohl Kontrolltheorien an der Person ansetzen und deshalb zu den Persönlichkeitstheorien gezählt werden, stellen sie, vor allem mit dem Bezugspunkt der externen Kontrollen den Übergang zu den nachfolgend behandelten sozialstrukturellen Theorien her. 2. Sozialstrukturelle Theorien Soziologische Kriminalitätstheorien wollen nicht das Verhalten einzelner Individuen erklären, sondern Einflüsse auf gesellschaftlicher Ebene beschreiben, die Abweichung im statistischen Sinn beeinflussen oder determinieren. Es werden gesellschaftliche Bedingungen herausgearbeitet, unter denen Kriminalität vermutlich gehäuft auftritt, ohne dass gesagt werden kann, bei welcher Person das der Fall sein wird. Die hier referierten Ansätze liegen deshalb nicht im Mikro-, sondern im MakroBereich. 2.1. Die französische soziologische Schule des 19.Jhs. Die Vorläufer der soziologischen Auseinandersetzung mit abweichendem Verhalten sind die Vertreter der französischen Schule des 19.Jahrhunderts, die recht global die „Gesellschaft“ für Kriminalität verantwortlich machten: « Tout le monde est coupable excepté le criminel » (Tarde, 1893) « Die Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient » (Lacassagne, 1901). Marx hatte schon 1842 die politische Einseitigkeit der Strafgesetzgebung kritisiert und die kapitalistische Gesellschaftsordnung für das Entstehen der VermögensKriminalität verantwortlich gemacht. Noch konkreter führte Engels in seiner Schrift „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ (1845) die Kriminalität auf den Kapitalismus zurück und verstand insbesondere den Diebstahl als eine anarchische und unproduktive Form des Klassenkampfs. Das marxistische Verständnis wurde im 20.Jahrhundert von Herbert Marcuse in seiner Randgruppenstrategie wieder aufgenommen. Im Rahmen seiner Neubeurteilung des marxistischen Geschichtsverständnisses kam Marcuse zur Erkenntnis, das Proletariat, das Marx als Motor einer politischen Veränderung angenommen hatte, sei in der Zwischenzeit vereinnahmt, konsumorientiert, „eindimensional“ geworden (One Dimensional Man, 1964). Als Träger einer gesellschaftlichen Erneuerung kämen deshalb am ehesten Randgruppen in Frage: Das waren einerseits die Studenten, die das Privileg hatten, ausserhalb dieser eindimensionalen Gesellschaft zu stehen, andererseits die unfreiwilligen Aussenseiter, die Marx noch als „Lumpenproletariat“ verstanden hatte. Allerdings müssten Letztere zuerst lernen, ihre individuell-chaotische Auflehnung durch den kollektiv-geordneten Klassenkampf zu ersetzen. Diese Politi- 16 sierung sollte durch die Studenten geleistet werden. Deshalb begannen die Angehörigen der Studentenbewegung in den 68-Jahren, sich um Aussenseiter zu kümmern, z.B. um Kriminelle oder Heimzöglinge, mit dem Ziel, diesen ein politisches Bewusstsein zu vermitteln und sie für den gemeinsamen Kampf für eine gerechtere Gesellschaft zu gewinnen. Allerdings zeigte sich schon bald, dass diese Politisierung nicht funktionierte, und sie wurde deshalb nach wenigen Jahren wieder aufgegeben. Marcuse selbst hat die Randgruppenstrategie später widerrufen. 2.2. Die Anomie-Theorie Die Anomie-Theorie war im 20.Jahrhundert der in der Wissenschaft am meisten diskutierte sozialstrukturelle Ansatz. Der Begriff Anomie bezeichnet einen gesellschaftlichen Zustand von Norm- oder Gesetzlosigkeit; er stammt aus dem Griechischen und wurde schon von Luther (1527) und von Hobbes (1698) verwendet. Der bedeutende französische Sozialwissenschaftler Emile Durkheim führte ihn Ende des 19. Jahrhunderts in die Soziologie ein, um die soziale Wirklichkeit in Gesellschaften mit schnellem Wandel zu beschreiben. Danach verlieren in Zeiten sozialer Umwälzungen die zuvor geltenden Normen und Kontrollen ihre Gestaltungskraft. Die Menschen fühlen sich orientierungslos. Weil die bisherigen gesellschaftlichen Einschränkungen nicht mehr wirksam sind, neigen die Menschen zu Ansprüchen, die nicht erfüllt werden können. Die Orientierungslosigkeit und die Bedürfnisfrustration bewirken eine Zunahme der Kriminalität. In dieser Annahme zeigt sich ein Zusammenhang mit den Kontrolltheorien. Am deutlichsten hat Durkheim das Konzept der Anomie in seinem 1897 erschienen Buch über den Selbstmord herausgearbeitet. Er unterscheidet darin zwischen dem individualistischen sowie altruistischen Selbstmord einerseits, die beide durch individuelle Motive und Verläufe erklärbar sind, und dem anomischen Selbstmord andererseits, den er auf das fehlende Korsett sozialer Normsysteme zurückführt. Den Grund für das Ausbleiben gesellschaftlicher Steuerungen sieht Durkheim vor allem in den durch die Wirtschaft verursachten Schrumpfungs- und Expansionsprozessen. Dadurch werde das ausbalancierte System der gesellschaftlichen Bedürfnisse und der Möglichkeiten ihrer Befriedigung gestört und als Folge ein normatives Vakuum verursacht. Eine für die Kriminologie und insbesondere für die amerikanische Kriminalsoziologie bedeutsame Weiterentwicklung hat die Anomie-Theorie durch Robert Merton erfahren (Social Structure and Anomy, 1938 und 1957, deutsch auszugsweise in Sack/König, Kriminalsoziologie, 1968, S.283ff.). Merton knüpft konkreter als Durkheim an die nordamerikanische GesellschaftsStruktur an und benennt als Konflikt, der die Anomie bewirkt, den Widerspruch zwischen den kulturell vorgegebenen Zielen und den sozialstrukturellen Mitteln zu ihrer Verwirklichung. Das kulturell vorgegebene Ziel lässt sich für die USA als american way of life umschreiben, als Leben in Wohlstand, Luxus und Sorglosigkeit. Dieser Zustand ist angeblich für alle erreichbar, wenn sie nur wollen. Für die unbeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten bürgt der Mythos "vom Tellerwäscher zum Millionär". Wenn man die Lebensläufe, die angeblich für diesen Mythos stehen, genauer unter- 17 sucht, zeigt sich jedoch, dass es sich durchwegs um Legenden handelt: Entweder waren die Leute schon vorher reich, oder sie haben ihren Reichtum mit kriminellen oder zumindest dubiosen Mitteln erworben. In Wahrheit fehlten den wenig Begüterten auch in den USA die strukturellen, rechtlich anerkannten Mittel, um die gesellschaftlich vorgegebenen Ziele zu erreichen. Insbesondere trifft das für Strassenjugendliche, Unterschicht-Angehörige und Einwanderer zu. Die Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen Ideal und den beschränkten Zugangs-Chancen bewirkt Anomie und wird als Erklärung für die zunehmende Vermögenskriminalität in der Wohlstandsgesellschaft angesehen. Einfach ausgedrückt: Benachteiligte Menschen, die realisieren, dass sie das ihnen vorgegaukelte Ziel Reichtum mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Arbeitskraft nicht erreichen können, streben das gleiche Ziel mit unerlaubten Mitteln an. Erleichtert wird das durch die Moral der amerikanischen Gesellschaft, für die in erster Linie der Erfolg zählt, und die wenig danach fragt, wie ein solcher Erfolg zustande gekommen ist. Entscheidend ist also die Inkongruenz zwischen den Zielen und den Mitteln: Obwohl die traditionelle indische Gesellschaft z.B. stärker hierarchisch gegliedert ist, gibt es diesen Widerspruch dort nicht, weil ein Aufstieg gar nicht möglich ist: Wer in einer untern Kaste geboren ist, bleibt sein Leben lang darin, und hat deshalb gar kein Interesse daran, jemals eine höhere Kaste zu erreichen. Zurück zur amerikanischen Gesellschaft: Delinquenz ist nur eine von mehreren Reaktionen auf die anomische Situation. Merton beschreibt idealtypisch fünf verschiedene Anpassungsmuster auf die Kluft zwischen Zielen und Mitteln: 1. Konformität: Ziele und Mittel werden akzeptiert, die betroffenen Personen reduzieren die Ziele oder geben sich mit einer Teilerreichung zufrieden. 2. Innovation: Die Ziele werden akzeptiert, aber mit illegitimen Mitteln angestrebt, z.B. Diebstahlskriminalität. 3. Ritualismus: Die Ziele werden aufgegeben, die institutionellen Mittel aber beibehalten (Routine, Resignation). 4. Rückzug (Apathie): Sowohl die Ziele als auch die Mittel werden abgelehnt, z.B. Aussenseiter, Asoziale, Süchtige. 5. Rebellion: Ziele und Mittel werden bekämpft, z.B. mit politisch motivierter Kriminalität. Kritik der Anomie-Theorie Trotz der scheinbaren Evidenz auf theoretischer Ebene ist die empirische Bestätigung eher schwach. Das hängt nicht zuletzt mit den vagen, stark verallgemeinernden und deshalb schwer zu operationalisierenden Begriffen zusammen. Die Anomie-Theorie in der Fassung von Merton bezieht sich schwerpunktmässig auf die Vermögenskriminalität der Unterschicht. Die Kriminalität der Mächtigen gerät kaum ins Blickfeld. Schwer zu erklären sind zudem Gewalt-, Sexual- und Verkehrskriminalität sowie die Unterschiede zwischen Mann und Frau sowie zwischen Stadt und Land. Die kulturellen Ziele und Mittel werden nur allgemein umschrieben; zudem wird ein einheitliches Wert- und Normensystem zugrunde gelegt, das für die ganze Gesellschaft verbindlich sein soll. Mag das für die nordamerikanische Gesellschaft des frühen 20.Jahrhunderts noch in Ansätzen gegolten haben, so müssen wir in der 18 heutigen komplexen Gesellschaft, und ganz besonders in Europa, vom Nebeneinander konkurrierender Wertsysteme ausgehen. Auch die verhaltenspsychologische Differenzierung zwischen Konformität, Innovation, Ritualismus und Rückzug vermag den Erklärungsnotstand der Mertonschen Theorie nicht zu beseitigen. Denn sie gibt auf die entscheidende Frage keine Antwort: Unter welchen strukturellen Bedingungen wird welcher individuelle Anpassungsmodus gewählt? Die Annahme der Zielerreichung mit unzulässigen Mitteln ist allein keine aussagekräftige Erklärung. Aktueller ist die Anomie-Theorie in der von Durkheim begründeten Form. Deren Elemente und Begriffe finden sich in fast allen modernen Diskussionen und Ansätzen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kulturwandel. Das Konzept der Anomie bleibt deshalb aktuell. 2.3. Subkulturtheorien 1. Theorie der delinquenten Subkultur (Cohen) Das Konzept der delinquenten Subkultur wurde von Whyte (1943) entwickelt. Er beobachtete, dass Slums in amerikanischen Städten keineswegs so desorganisiert waren, wie man zuvor vermutet hatte. Vielmehr seien sie durch eine eigenes subkulturelles Normensystem geregelt und strukturiert. Dieses Normensystem befinde sich teilweise im Widerspruch zu den Wertbegriffen der herrschenden Gesellschaft, sei jedoch geeignet, die Ordnung in der Subkultur im Rahmen einer eigenen Hierarchie zu gewährleisten und die Verhaltensweisen der Mitglieder zu steuern. Subkulturen sind somit immer abhängig von einer Hauptkultur, ihre Mitglieder müssen sich mit den Erwartungen beider Kulturen auseinandersetzen. Cohen (1955) hat gestützt darauf Werte und Verhaltensweisen von Jungen aus der Mittelschicht im Unterschied zu solchen aus der Unterschicht untersucht. Er stellte fest, dass die Unterschicht-Jugendlichen gegenüber den gesellschaftlichen Werten und Zielen ambivalente Einstellungen entwickelten: Sie hielten sie zwar nach wie vor für erstrebenswert, nahmen aber im Hinblick auf die Schwierigkeit der Erreichbarkeit Veränderungen vor. Weil sie realisierten, dass sie die gesellschaftlich vorgegebenen Ziele nicht erreichen konnten, befanden sie sich in einer anomischen Situation. In der Auseinandersetzung damit entwickelten sie laut Cohen unterschiedliche Anpassungsmuster: Die Reaktion, sich mit der gegebenen Situation resignativ abzufinden Die Reaktion, an den vorgegebenen Zielen trotz der ungünstigen Ausgangslage festzuhalten Die Ablehnung der vorgegebenen Ziele zugunsten eines eigenen subkulturellen Systems von Werten und Normen. Subkulturen sind nach Cohen kollektive Reaktionen auf ungleiche Situationen, für die eine herrschende Kultur keine zureichende Lösungen zur Verfügung stellt. Daraus entsteht eine Statusfrustration, die durch den Zusammenschluss von Personen mit den gleichen Anpassungsschwierigkeiten kompensiert werden kann. Innerhalb einer solchen Gruppe bilden sich mit der Zeit übereinstimmende Normen und Werte heraus, die vom gesellschaftlichen System abweichen, den Mitgliedern Status verleihen und bestimmte Formen abweichenden Verhaltens rechtfertigen. 19 Die Subkultur entlastet von Schuldgefühlen und rechtfertigt Aggressionen gegen jene, die für die Benachteiligung der Subkultur-Mitglieder verantwortlich scheinen. Cohen unterscheidet unterschiedliche Varianten von delinquenten Subkulturen, von der Strassengang bis zur halbprofessionellen Diebstahls-Subkultur, doch ist diese Typisierung stark auf amerikanische Verhältnisse zugeschnitten. Das gilt auch für die ausgiebig erforschte und breit diskutierte Subkultur des Gefängnisses, vgl. Harbordt, Die Subkultur des Gefängnisses,1972. Als Beispiel, wo die Ausprägung einer Subkultur bei uns besonders deutlich sichtbar ist, sei die Drogensubkultur erwähnt. 2. Kulturkonflikt-Theorie Die Kulturkonflikt-Theorie geht auf Sellin (1938) zurück. Sie wurde am Beispiel der amerikanischen Einwanderungsphänomene entwickelt. Sie knüpft daran an, dass in Einwanderergruppen und kulturellen Minderheiten Werte und Normen bestehen, die von denen des Einwanderungslandes abweichen. Diese Abweichungen verstricken die Mitglieder in Normkonflikte. Solche Konflikte sollen angeblich auch Kriminalität verursachen, wenn die Divergenzen besonders krass seien. Das leuchtet allerdings nur in den eher seltenen Fällen ein, wo die unterschiedlichen Verhaltensvorschriften direkt strafrechtliche Normen betreffen, wie z.B. bei der Blutrache. Sonst aber besteht gegenüber den amerikanischen Befunden der Verdacht, dass der angebliche Kulturkonflikt ideologisch verschleiert, worum es wirklich geht, nämlich um politische und ökonomische Benachteiligung. In Europa wird die Kulturkonflikt-Theorie deshalb skeptisch beurteilt, umso mehr, als bei den Gastarbeitergruppen der ersten Generation durchwegs keine höhere Kriminalitätsbelastung festgestellt wurde als bei der nach Alter und Geschlecht vergleichbaren einheimischen Bevölkerung. In einzelnen Ländern, insbesondere in Deutschland, wurde dagegen eine höhere Belastung der zweiten Generation festgestellt. Das weist darauf hin, dass weniger der äussere Widerspruch zwischen unterschiedlichen Verhaltenserwartungen massgeblich ist, sondern der innere Konflikt, der als Orientierungslosigkeit und Statusunsicherheit umschrieben werden kann. Dafür ist aber nicht der Kulturkonflikt massgeblich, sondern je nach Land die sozialstrukturelle Benachteiligung in den Bereichen Einkommen, Beruf, Ausbildung, Wohnung und soziale Kontrolle. In der Schweiz haben mehrere Untersuchungen, insbesondere die des Bundesamtes für Statistik (zur Staatszugehörigkeit von Verurteilten, 1996) keine erhöhte Kriminalitätsbelastung der ansässigen ausländischen Wohnbevölkerung ergeben. Für die hohen Anteile an den Verurteilungen (ca. 50 %) sind hauptsächlich Personen ohne Schweizer Wohnsitz und Asylsuchende verantwortlich. Zudem müssen, um reale Vergleiche zu erhalten, reine Ausländerdelikte (illegale Einreise etc.) ausgesondert und die Gruppen bezüglich Alter und Geschlecht ausgeglichen werden. Eine tatsächlich höhere Belastung weisen die Asylsuchenden auf. Nach einer Untersuchung von Eisner/Niggli/Manzoni (Asylmissbrauch durch Kriminelle oder kriminelle Asylsuchende? 1999) hängt das sowohl mit der Situation im Heimatland, der Behandlung in der Schweiz, einer grösseren Kontrollintensität als auch mit Asylmissbrauch durch einzelne Kriminelle zusammen. Jugendliche aus der zweiten Generation treten in der Schweiz nur unter bestimmten Voraussetzungen stärker als andere kriminell in Erscheinung: Höher belastet sind vor allem Jugendliche, die erst in der Pubertät in die Schweiz gekommen sind, und insbesondere solche, die aus Ländern oder Gegenden stammen, wo die soziale Ord- 20 nung vor Ort nicht tragfähig war. Eisner (in Neue Kriminalpolitik 4/98,11ff.) hält dazu fest: „So ist einer der am besten gesicherten Befunde der vergleichenden Gewaltforschung, dass Gewaltdelikte in jenen Ländern häufig sind, wo wirtschaftliche Rückständigkeit, grosse soziale Ungleichheiten, instabile staatliche Strukturen sowie gewalttätige Konflikte zusammentreffen:“ Neben diesen importierten Belastungen spielen aber auch Gründe eine Rolle, die mit der Lebenssituation solcher Jugendlicher in der Schweiz zusammenhängen: „Hierbei können wir zunächst vom allgemeinen Befund der kriminologischen Forschung ausgehen, dass ..... Gewalt unter jenen gesellschaftlichen Gruppen häufig ist, bei denen sich Armut, soziale Randlage, Perspektivenlosigkeit sowie die Brüchigkeit von familiären und gemeinschaftlichen Netzwerken zu einem Gefüge sozialer Desintegration verbinden. Dabei zeigen Analysen zur Lebenssituation immigrierter Jugendlicher, dass gerade sie in weit überdurchschnittlichem Ausmass von diesen Dynamiken betroffen sind.“ Alles spricht dafür, dass die erhöhte kriminelle Belastung einzelner Gruppen von immigrierten Jugendlichen wesentlich handfestere Ursachen hat als das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen. In der Sprache der Kriminalitätstheorien werden Erklärungen, die der Anomietheorie, der Halttheorie, der Sozialisationstheorie und dem labeling approach entnommen sind, den Phänomenen viel eher gerecht. Die Berufung auf den angeblichen Kulturkonflikt dient in diesem Zusammenhang eher der Vernebelung der wahren Ursachen. 3. Neutralisationstechniken In einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Subkulturansätzen steht die von Sykes und Matza (1957) formulierte Theorie der Neutralisationstechniken. Sie knüpft an die Rechtfertigungen an, mit denen Straftäter ihre Taten legitimieren. Dadurch gelingt es ihnen, die Motivationswirkung, die von den gesellschaftlichen Verboten ausgeht, zu neutralisieren. Die Neutralisierung ermöglich die Begehung von Straftaten ohne Schuldgefühle und ohne Beschädigung der eigenen Identität. Sykes/Matza unterscheiden fünf Typen von Neutralisierungstechniken: 1. Das Leugnen der Verantwortlichkeit, indem die Tat dem Zufall oder einem unglücklichen Umstand zugeschrieben wird. 2. Das Verneinen eines Schadens, indem z.B. bei einem Vermögensdelikt angenommen wird, das Opfer spüre den Verlust gar nicht. 3. Das Opfer wird eines Fehlverhaltens beschuldigt, so dass die eigene Tat als eine Art Notwehr erscheint. 4. Die moralische Herabsetzung des Opfers, womit sich die Tat als gerechte Bestrafung darstellt. 5. Die Berufung auf übergeordnete ethische Richtlinien, wie etwa die abweichenden Normen einer Herkunftskultur oder einer Subkultur. Als aktuelles Beispiel lässt sich das anführen, was wir als „pädophile Propaganda“ bezeichnen. Pädophile Täter rechtfertigen sexuelle Übergriffe auf Kinder regelmässig damit, dass sie aus Kinderliebe gehandelt und den Kindern etwas Gutes angetan hätten. Sie verweisen auf andere Kulturen wie etwa die alten Griechen, wo Sexualität mit Kindern alltäglich gewesen sei und beschuldigen unsere Gesellschaft der Rückständigkeit: So, wie in den letzten Jahrzehnten die Homosexualität und das Konkubinat entkriminalisiert worden sei, werde in absehbarer Zeit auch die „Kinderliebe“ 21 normalisiert werden. Im Lichte dieser Ideologie werden sexuelle Übergriffe zu Liebestaten, für die man sich nicht schuldig zu fühlen braucht. Im Straf- und Massnahmenvollzug haben Neutralisierungstechniken eine enorme Bedeutung. Fast jeder Verurteilte legt sich solche Rechtfertigungen zurecht. Falls eine Therapie durchgeführt wird, ist es eines der zentralen Themen, die neutralisierenden Rechtfertigungen zu durchbrechen und abzubauen. Eine Kriminaltherapie kann erst dann Wirkung entfalten, wenn der Täter lernt, die volle Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, und empathisch zu erkennen, welchen Schmerz er dem Opfer zugefügt hat. Kritik der Subkulturtheorien Die Kulturkonflikttheorie (2.) wird in Europa mehrheitlich als ideologisch und verschleiernd abgelehnt. Neutralisierungstechniken (3.) werden zwar oft durch Subkulturen vermittelt, spielen aber auch im Rahmen anderer Theorien eine Rolle. Gegensteuerung ist wichtig für die Prävention und für die Behandlung von Straftätern. Mit der eigentlichen Subkulturtheorie (1.) ist, wenn überhaupt, nur ein beschränkter Ausschnitt der Kriminalität erklärbar. Sie ist zudem stark auf die Verhältnisse in den USA zugeschnitten, denken wir etwa an Streetgangs. Wahrscheinlich ist die Subkultur weitgehend eine reaktive Anpassung an eine deprivative Situation, mit dem Ziel, diese zu neutralisieren, d.h. mehr eine Folge als eine Ursache. Die Mitglieder bleiben auf die Hauptkultur bezogen und übernehmen nur für eine begrenzte Zeit die Werte und Normen der Subkultur. Dafür spricht auch die sog. U-Kurve, die Stanton Wheeler für den Anpassungsverlauf in der Gefängnis-Subkultur festgestellt hat: Demnach übernehmen Gefangene in der Mitte ihrer Haft am ausgeprägtesten Subkulturnormen. Je näher aber die Entlassung rückt, desto stärker orientieren sie sich wieder an der Aussenwelt. Die wirklichen Gründe für das Entstehen von Subkulturen liegen in ChancenUngleichheit, Armut, Anomie oder, wie bei der Drogenszene, in einer AusschlussPolitik. 2.4. Theorie der differentiellen Gelegenheiten In der Theorie der differentiellen Gelegenheiten haben Cloward und Ohlin (1960, deutsch in Sack/König 1968) Elemente der Anomietheorie, der Subkulturtheorie und der Theorie der differentiellen Kontakte zu einem Ansatz verknüpft, der sich mit den unterschiedlichen Zugangs-Chancen zu illegitimen Mitteln und kriminellen Gelegenheiten befasst. Cloward (1968,320) schreibt dazu, die Anomietheorie in der Fassung von Merton unterstelle fälschlicherweise, dass „illegitime Mittel frei verfügbar sind – so, als wenn der Einzelne, nachdem er zum Schluss gekommen ist, dass man auf legitime Weise zu nichts kommt, sich einfach den illegitimen Mitteln zuwendet, die leicht greifbar zur Verfügung stehen, unabhängig von der Stellung innerhalb der sozialen Struktur“. Diese Zweifel an der Zugänglichkeit decken sich mit der alltäglichen Erfahrung, wonach es kaum möglich ist, einfach so und ohne besondere Ressourcen eine erfolgreiche abweichende Karriere zu beginnen. Selbst um als Strassendealer Drogen zu verkaufen, benötigt man entsprechende Kenntnisse und den Zugang zur 22 Drogenszene. „Der self-made-Dieb, dem die Kenntnis der Methoden, sich vor Verfolgung zu schützen ..... mangelt, wird schnell im Gefängnis landen“ (Cloward 321). Noch mehr gilt dies für Einbrecher oder Trickdiebe, die darüber hinaus Techniken, Kenntnisse der Infrastruktur und Hehlernetze benötigen. Und wer im grossen Stil veruntreuen will, muss zuerst eine entsprechende Stellung in der Hierarchie eines Wirtschaftsunternehmens erlangen. Auch die Verfügbarkeit illegitimer Mittel ist deshalb abhängig von Zugangs-Chancen, die nur begrenzt verfügbar und je nach Position in der sozialen Struktur unterschiedlich zugänglich sind. Ob eine Person in einer anomischen Situation sich illegalen Mitteln zuwendet, hängt deshalb auch davon ab, wie weit ihr die Voraussetzungen dazu zur Verfügung stehen. Dem tragen Kontrolltheorien insofern Rechnung, indem sie die Zugangs-Möglichkeiten zu delinquenten Techniken als ein Element der äussern Kontrolle definieren. Kritik der Theorie der differentiellen Gelegenheiten Die Zugangs-Chancen sind als solche kein Grund, warum eine Person kriminell wird, aber sie können eine wesentliche Voraussetzung sein, warum in einer Krisen- oder einer Versuchungssituation ein krimineller und nicht ein anderer Weg gewählt wird. Deshalb wird in der Prävention darauf geachtet, die Verfügbarkeit illegitimer Mittel einzuschränken. In der Drogenpolitik wird diesem Grundsatz Rechnung getragen, indem grosse Szenen und Ansammlungen vermieden werden sollen. Durch dezentrale Angebote soll zwar der Zugang zu Konsumdrogen für schwerst Abhängige ermöglicht werden, doch sollen andere Personen von diesen Plätzen möglichst ferngehalten werden. Sobald ein grosser Umschlagsplatz entsteht, entfaltet dieser eine Sogwirkung, die sich nicht mehr kontrollieren lässt. Diese Erfahrung musste Zürich anfangs der 90er-Jahre mit seiner verfehlten Politik der offenen Drogenszenen am Platzspitz und am Letten machen. 2.5. Delinquency areas (sog. ökologische Theorie) Die sog. ökologische Theorie befasst sich mit der räumlichen Verteilung und den örtlichen Entstehungsbedingungen der Kriminalität. Die Theorie hat mit Ökologie im heutigen Sinne nichts zu tun. Sie ist auch nicht zu verwechseln mit der später zu behandelnden ökonomischen Theorie. Der Ansatz der delinquency areas geht zurück auf die Chicago-Schule und ist mit den Autoren Shaw und McKay verknüpft. Die beiden untersuchten kriminelle Banden und deren Aufenthaltsorte. Dabei zeigte sich, dass sich ein Grossteil der kriminellen Taten in Stadtkernen, Geschäftsvierteln, Industriezonen und andern Gebieten mit reduzierter sozialer Kontrolle ereignete. Daraus abgeleitet entwickelten Shaw und McKay eine Theorie der geografischen Verbreitung von Kriminalität. Weltweit zeigt sich, dass Kriminalität in Städten stärker vertreten ist (Stadt-/LandGefälle), und dass unter den Städten Gross-Städte überproportional betroffen sind. Auch innerhalb der Stadtgebiete gibt es grosse Unterschiede, indem sich die Kriminalität auf wenig bewohnte Gebiete mit reduzierter sozialer Kontrolle konzentriert- 23 konzentriert. Die ungleiche Verteilung bedeutet nicht, dass Bewohner der entsprechenden Gebiete grundsätzlich krimineller wären, vielmehr gibt es eine doppelte Sogwirkung, indem Personen, die bereit sind, Delikte zu begehen, sich teilweise in der Nähe solcher Gebiete ansiedeln, und andere, die weiter entfernt wohnen, diese delinquency areas gezielt aufsuchen, um dort zu delinquieren. In Basel konzentriert sich zum Beispiel die geografische Verteilung von Gewaltdelikten auf die Grossbasler Innenstadt, das Matthäus- und Clara-Quartier sowie die Umgebung des Bahnhofs (s. Manuel Eisner, Das Ende der zivilisierten Stadt,1997). Eine aktuelle Anwendung dieser Erkenntnisse, die in der heutigen Prävention eine erhebliche Bedeutung hat, ist die Theorie der sozialen Desorganisation. Sie befasst sich mit dem Verlust von Gemeinschaftskontrolle und mit der sozialen Entsolidarisierung in gefährdeten Stadtgebieten und Wohngegenden. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass eine intakte Struktur sozialer Netze und persönlicher Bezugssysteme Kriminalität verhindert, während umgekehrt der Zerfall sozialer Verbindungen Kriminalität fördert. Die Theorie beruht auf der Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Sozialkontrolle. Primäre Kontrolle wird wahrgenommen durch die soziale Umgebung, die Nachbarschaft und allgemeine Netzwerke, sekundäre dagegen durch spezialisierte Instanzen wie Polizei oder Bewachungsdienste. Primäre Kontrolle ist präventiv wirksamer als sekundäre. Der bekannteste Ansatz ist in diesem Zusammenhang die broken-windowsHypothese von Wilson/Kelling. Sie nimmt an, dass äussere Zeichen von Unordnung in einer Umgebung, wie zerbrochene Fensterscheiben, unbenutzte Häuser, Graffiti an den Wänden, herumliegende Abfälle, zerstörte Strassenlampen, veraltete Plakate etc., die Quartierverbundenheit aushöhlen und die primäre Kontrolle schwächen. Bewohner solcher Gebiete neigen dazu, sich in ihre Häuser zurückzuziehen und für den öffentlichen Raum keine Verantwortung mehr zu übernehmen. Gleichzeitig wirkt die Vernachlässigung des öffentlichen Raums als Einladung für zwielichtige Subkulturen, wie Prostitution, Drogenhandel, Alkoholszenen. Die „physische Unordnung“ wird zunehmend zur „sozialen Unordnung“. Die Identifikation der ursprünglichen Bewohner mit ihrem Quartier nimmt ab, ihre Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld schwindet. Viele wandern in der Folge ab, ihr Platz wird zunehmend von dissozialen oder kriminalitätsgeneigten Personen eingenommen. Die selektive Abwanderung ist zuletzt der Grund für den Zerfall der Wohngegend. Nach der broken-windows-Hypothese führt die äussere Vernachlässigung einer Stadtgegend nicht nur zur sozialen Verwahrlosung, sondern auch zu einem kriminellen Umschlag und damit zur Zunahme schwerer Kriminalität. Wer das verhindern will, sollte nach dem Prinzip „wehret den Anfängen“ bereits bei den ersten Symptomen der Vernachlässigung ansetzen. Das ist der Grundgedanke der sog. zero-toleranceKonzeption, die in der US-amerikanischen Kriminalpolitik und Kriminalprävention eine grosse Bedeutung erlangt hat. Danach werden bereits die ersten, früher noch als vernachlässigbar eingeschätzten Zeichen von disorder mit praktischen, verwaltungsrechtlichen, polizeilichen und repressiven Mitteln entschieden bekämpft. Kritik der deliquency-areas-Ansätze Der ökologische Ansatz gibt Aufschlüsse über die Verteilung der Kriminalität, die für die Prävention und den Einsatz der polizeilichen Kräfte wesentlich sind. Er liefert aber keine Erklärung für die Entstehung der Kriminalität. 24 Die broken-windows-Hypothese hat einen unbestrittenen Kern, indem sie auf die Bedeutung der Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier und die damit zusammenhängende primäre Sozialkontrolle hinweist. Die Aufrechterhaltung der physischen und sozialen Ordnung in einem Stadtgebiet hat zweifellos eine präventive Wirkung. Das Entfernen von Schmierereien und Graffitis und das Beseitigen von Abfällen ist deshalb nicht nur aus ästhetischen Überlegungen sinnvoll. In der radikalen Form der zero-tolerance-Strategie steht die empirische Bestätigung aber nach wie vor aus. New York feiert zwar mit viel Publizität den Erfolg dieser Politik, doch hatten in der gleichen Zeit auch andere Städte einen vergleichbaren Rückgang der Kriminalität, die keine zero-tolerance-Politik praktiziert haben (vgl. Ortner/Pilgram/Steinert, Die Null-Lösung,1998). 2.6. Theorien der Kriminalitätsentwicklung Die bis anhin referierten Theorien gingen von einer Querschnittsbetrachtung aus. Diese statische Analyse soll nachfolgend ergänzt werden durch eine geschichtliche Verlaufsbetrachtung, welche die Kriminalitätsbewegung epochenspezifisch in der Abhängigkeit von unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beschreibt. Als mögliche Einflussfaktoren kommen politische Verhältnisse, wie Krieg oder Diktatur, wirtschaftliche Bedingungen, wie Wohlstand oder Krisen, soziale Faktoren, wie Arbeitslosigkeit oder Armut, sowie kulturelle Entwicklungen, wie Wertewandel und Veränderung der Familienstrukturen in Betracht (vgl. Dieter Hermann, Werte und Kriminalität, 2003). 1. Zusammenhang mit politischen Systemen Allgemein gilt, dass die klassische Kriminalität in Kriegszeiten zurückgeht. In Deutschland wurde vor dem geschichtlichen Hintergrund des Dritten Reichs vielfach angenommen, die individuellen Delikte seien durch kollektive Übergriffe und Kriegsverbrechen kompensiert worden, so dass von einer realen Abnahme keine Rede sein könne (Kaiser). Für die Schweiz traf das im 2.Weltkrieg aber nicht zu, und dennoch waren die Kriminalitätszahlen auch in der Schweiz rückläufig. Eine Erklärung dürfte deshalb eher in dem durch die Bedrohung gestärkten Gemeinschaftsgefühl und in den fehlenden Gelegenheiten zu suchen sein (die Schweizer Männer waren mehrheitlich an der Grenze im Aktivdienst). In Diktaturen ist die registrierte Kriminalität geringer als in freiheitlichen Staaten. Das gilt sowohl für die ehemaligen sozialistischen Länder als auch für Militärdiktaturen. Das tiefe Niveau lässt sich auf die verschärfte soziale Kontrolle zurückführen. Allerdings breiten sich in solchen Staaten die Korruption, der Schwarzhandel und die Kriminalität der Mächtigen aus, die in den Statistiken jedoch nicht erscheinen. In der oft zitierten Aussage von Liszts, eine gute Sozialpolitik sei die beste Kriminalpolitik, wird die Vermutung angesprochen, eine kompensatorische Sozialgesetzgebung sei geeignet, Kriminalität zurückzudrängen. In der Gegenwart müssen wir allerdings feststellen, dass der Sozialstaat, der für die ärmeren Teile der Bevölkerung 25 zweifellos eine verbesserte Lebenssituation bewirkt hat, diesen Effekt nicht einmal bezüglich der Vermögensdelikte hat. Auf die Frage, warum das so ist, komme ich noch zurück. Insgesamt sind die Wechselbeziehungen zwischen Kriminalität und politischen Systemen zu wenig erforscht. Verlässliche Aussagen sind deshalb nicht möglich. 2. Wirtschaftliche Verhältnisse Vor allem im 19.Jahrhundert wurde die Kriminalität als eine vorwiegend ökonomisch bedingte Erscheinung angesehen. So wurde in Bayern von 1835-1861 ein direkter Zusammenhang zwischen dem Roggenpreis und der Vermögenskriminalität nachgewiesen, wobei jeder Sechser, um den das Getreide im Preis anstieg oder sank, einen Diebstahl pro 1000 Einwohner mehr oder weniger zur Folge hatte. Noch Ende de 19.Jahrhunderts konnten eindeutige Zusammenhänge zwischen Lebensmittelpreisen und Kriminalitätszahlen ermittelt werden. Seit der Zeit nach dem 1.Weltkrieg verloren sich aber solche Zusammenhänge. In der zweiten Hälfte des 20.Jahhunderts setzte sich dann im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum und der im gleichen Zeitraum zunehmenden Kriminalität das Schlagwort der Wohlstandkriminalität durch, wobei die Erklärung wohl nicht im Wohlstand als solchem, sondern in den kulturellen Veränderungen zu suchen sein dürfte. In den 70er und 90er-Jahren haben dann Krisen wieder eine kriminologische Bedeutung erlangt. Ein Zusammenhang wurde lange auch mit der Arbeitslosigkeit vermutet. Bis zum 2.Weltkrieg bestand eine entsprechende Korrelation, seither lässt sich aber keine Entsprechung mehr feststellen. Zwar scheinen Erwerbslose überproportional an Kriminalität beteiligt, doch weist ein Teil von ihnen, vor allem Langzeit-Arbeitslose, gehäuft Sozialisationsdefizite auf. Auf diese sind vermutlich sowohl die Delinquenz als auch die Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Bei den andern Betroffenen scheint die Arbeitslosigkeit eher Konformität als Delinquenz zu fördern. Ergebnis: In den heutigen industriellen Gesellschaften entwickeln sich die Kriminalitätsraten zunehmend unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. 3. Kultureller Wandel Als soziokultureller Wandel werden die Veränderungen der sozialen Normensysteme Religion, Moral und Recht sowie der sie vermittelnden Instanzen Erziehung, Familie, Schule, Kirche, Politik und Medien bezeichnet. Dazu gehören auch die gewandelten Lebensformen, Konsumgewohnheiten und Freizeitverhalten. Besonders bedeutsam ist der rasche Wandel in der Familie und damit zusammenhängend in der primären Sozialisation. Einkindfamilien, Einelternfamilien und Patchworkfamilien sind in kurzer Zeit zum Normalfall geworden. Im Ausmass, wie die Prägung durch die Religion zurückgegangen ist, hat die Mediensozialisation an Bedeutung zugenommen. Der soziale Wandel führt zu Veränderungen im Wertsystem, in den Beziehungen, in der Arbeitswelt, er wird im Erleben Vieler verschärft durch den technologischen Wandel, die Migration, die Bedrohung durch den Arbeitsmarkt und durch die Globalisierung. Viele Menschen vermögen sich den schnellen Wechseln nicht konfliktfrei anzupassen, oder sie erleben sie als Stress und Überforderung, viele erleben eine Sinnkrise. Traditionelle Stützen wie Familie, Kirchen, Gemeinden, Vereine oder eine intakte so- 26 ziale Umgebung verlieren an Bedeutung oder fallen aus. Bei vielen jüngern Menschen lassen sich eindeutige Wertdefizite feststellen. Nach einer anomietheoretischen Interpretation im Sinne des ursprünglichen Ansatzes von Durkheim steigt mit den dadurch verursachten Gefühlen der Verlorenheit, des „no future“, der Orientierungs- und der Perspektivelosigkeit auch die Bereitschaft zur Delinquenz und zur Gewalt. Kriminalität dient unter diesen Voraussetzungen als Mittel zur Bewältigung von Lebenssituationen, die als Überforderung erlebt werden. Gleichzeitig sind im Wohlfahrts-Staat, vor allem vermittelt durch die Medien, auch die Ansprüche und die Erwartungen bezüglich ihrer sofortigen Erfüllung gestiegen. Hedonistische Konsumerwartungen und irreale Karriere-Aspirationen haben eine Kluft zwischen der erhofften und der tatsächlichen Bedürfniserfüllung zur Folge. Die Diskrepanz zwischen den subjektiven Vorstellungen und den objektiven Gegebenheiten bewirkt Frustration, Statusunsicherheit und Entwurzelung: Traditionelle Wertsysteme büssen ihre Überzeugungskraft ein, bestehende Normen werden in Frage gestellt, das Gemeinwesen verliert an Stabilität. Nicht der Wohlfahrts-Staat als solcher, sondern dessen Unfähigkeit, die Balance zwischen den geweckten Bedürfnissen und ihrer Erfüllung herzustellen und angesichts des rasanten Wandels genügend Sicherheit zu gewährleisten, ist das Problem. Als Folge wächst die Entwurzelung und die Bereitschaft zur Normübertretung. Die Anomie führt nicht nur zu einer Einbusse an internen, sondern auch an externen Kontrollen. Kritik der Entwicklungstheorien Die Zusammenhänge sind nur im Rahmen einer historischen Analyse interpretierbar. Vielfach fehlen die entsprechenden Daten, um Wechselbeziehungen verlässlich beurteilen zu können. Am ehesten besteht ein Zusammenhang mit dem Kultur- und Wertewandel. Diese Interpretation knüpft an die Anomietheorie (im Sinn von Durkheim) und an die Kontrolltheorie an. Auch sie ist nicht exakt messbar und kann deshalb als spekulativ angesehen werden. Auch liegt das Missverständnis nahe, es handle sich um eine neue Version von Kulturpessimismus. Das trifft jedoch nicht zu: Sozialer Wandel kann durchaus einen Gewinn an Freiheit, an Chancen und an ökonomischen Möglichkeiten zur Folge haben. Das Problem liegt nicht im Wandel als solchem, sondern in der Geschwindigkeit des Wandels. Zu schnelle gesellschaftliche Veränderungen führen zur Verunsicherung und damit zu einem Verlust an Stabilität. Ein Preis, der für einen zu raschen Wandel bezahlt werden muss, ist eine Zunahme von Kriminalität. Im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse des Wandels muss dieser Preis einbezogen werden. 3.Kriminalisierungstheorie (labeling approach) (auch Stigmatisierungsansatz, Etikettierungsansatz oder interaktionistische Theorie genannt) Im Gegensatz zu den bisher erörterten Theorien, die abweichendes Verhalten als Folge bestimmter persönlicher Merkmale oder als Auswirkung gesellschaftlicher Konstellationen begreifen, versteht der labeling approach Kriminalität als KunstProdukt gesellschaftlicher Definitions- und Zuschreibungsprozesse. Kriminell ist folg- 27 lich nicht eine deskriptiv beschreibbare Eigenschaft, sondern eine askriptive Ausgrenzungskategorie. Dazu ein klassisches Zitat: „Ich meine vielmehr, dass gesellschaftliche Gruppen abweichendes Verhalten dadurch schaffen, dass sie Regeln aufstellen, deren Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert, und dass sie diese Regeln auf bestimmte Menschen anwenden, die sie zu Aussenseitern abstempeln. Von diesem Standpunkt aus ist abweichendes Verhalten keine Qualität der Handlung, die eine Person begeht, sondern vielmehr eine Konsequenz der Anwendung von Regeln durch andere und der Sanktionen gegenüber einem „Missetäter“. Der Mensch mit abweichendem Verhalten ist ein Mensch, auf den diese Bezeichnung erfolgreich angewandt worden ist; abweichendes Verhalten ist Verhalten, das Menschen so bezeichnen.“ Das Zitat stammt von Howard S.Becker, einem der Urväter des labeling approachs, auf den auch der Begriff zurückgeht. Sein Buch „Outsiders“ erschien in der Originalausgabe 1963, in der deutschen Übersetzung („Aussenseiter“) 1973. Der labeling approach geht auf die sozialpsychologische Theorie des symbolischen Interaktionismus zurück, indem er Kriminalität als Ergebnis eines Interaktions-Prozesses zwischen dem Individuum und den Instanzen der sozialen Kontrolle versteht. 3.1. Elemente und Begriffe Der labeling approach führte Ende der 60er / Anfang der 70er Jahre zu einem Paradigma-Wechsel in der Kriminologie. Er war in den folgenden Jahren der meistdiskutierte Ansatz. Er interpretierte im Gegensatz zu allen frühern Ansätzen die gesellschaftliche Definition und Reaktion nicht mehr als Korrektiv, als Gegenkraft zu der vorausgegangenen Devianz, sondern als deren Ursache: Erst durch die Reaktion verfestigt sich die Abweichung, erst durch die Zuschreibung entsteht die abweichende Identität. Dabei wird unterschieden zwischen primärer und sekundärer Devianz. Die primäre Devianz ist die Abweichung im Vorfeld der gesellschaftlichen Reaktion. Sie wurde im ursprünglichen labeling approach, gestützt auf die ersten damals bekannt gewordenen Dunkelfelduntersuchungen, als zufällig, ubiquitär verteilt und nicht besonders erklärungsbedürftig angesehen. Durch die gesellschaftliche Reaktion entsteht dann aber die Abstempelung (Etikettierung, Stigmatisierung), die dem Abweichenden das label (Etikett) „kriminell“ überstülpt. Das damit verbundene Fremdbild übernimmt die so definierte Person nach dem Prinzip der self-fullfilling-prophecy in ihr Selbstbild. Sie beginnt sich so zu verhalten, wie es die gesellschaftliche Zuschreibung von ihr erwartet. Damit ist die entscheidende sekundäre Devianz erreicht. Untersuchungen zur self-fullfilling-prophecy zeigen, dass es solche Mechanismen wirklich gibt. Das Bild und die damit verbundenen Erwartungen, wie die soziale Umgebung eine Person wahrnimmt, beeinflussen deren Selbstbild und damit auch ihr Verhalten. So wurden in einem Schulexperiment den Lehrern bestimmte Schüler als besonders begabt dargestellt. Die Auswahl der Schüler stützte sich angeblich auf einen Test, war aber in Wirklichkeit ausgelost worden. Bei einer Nachkontrolle hatten sich die Leistungen der positiv etikettierten Schüler tatsächlich signifikant verbessert. Nehmen wir als erfundenes Beispiel Max: Er ist ein mässiger Schüler, manchmal frech, er streitet sich oft mit seiner Schwester, im Fussball ist er Torhüter, er liest Har- 28 ry Potter und spielt gerne Gameboy. Eines Tages wird er beim Klauen eines Kleincomputers erwischt und wegen Diebstahls bestraft. Die Art der Reaktion stempelt ihn als Dieb ab. Die Wahrnehmung seiner Umgebung fokussiert sich auf diese Zuschreibung. Er ist nicht mehr der Junge mit all den genannten Eigenschaften, sondern der „Dieb“. Kollegen ziehen sich zurück, sie laden ihn nicht mehr ein. Lehrer beobachten ihn misstrauisch, sie kontrollieren ihn vermehrt und trauen ihm weniger zu. Seine Chancen verschlechtern sich dadurch. Er schliesst sich mit andern Kollegen zusammen, die ebenfalls Delikte begangen haben. Er lernt von ihnen, dass Klauen nichts Schlimmes ist, man sollte sich nur nicht erwischen lassen. Wenn er stiehlt, tut er ohnehin nichts Anderes, als was seine Umgebung von ihm erwartet. Er übernimmt die Rolle, die ihm zugeschrieben wird, und macht das Fremdbild zum Selbstbild. Damit ist das entscheidende Stadium der sekundären Devianz erreicht. Ein klassisches Beispiel einer solchen Rollenzuschreibung und -übernahme hat Claus Roxin anhand der Biografie des Schriftstellers Karl May in der Schweizerischen Zeitschrift für Strafrecht beschrieben (ZStR 95/1978,1ff.). 3.2. Theorie der sekundären Abweichung Edwin Lemert (Social Pathology,1951) misst der primären Abweichung (Straftaten vor der ersten Reaktion) keine besondere Bedeutung zu, weil fast alle Jungen irgendwann Straftaten begingen, ohne dass sich dies in ihrem Lebenslauf nachteilig auswirke, so lange sie nicht sanktioniert würden. Entscheidend sei daher die offizielle Reaktion. Erst sie setze den Prozess der sekundären Abweichung in Gang, die stigmatisierend wirke und eine feindselige Haltung gegenüber der Gemeinschaft verursache. Allerdings betont Lemert, dass die soziale Reaktion je nach Ausgestaltung und Akzeptanz auch eine Hilfe sein könne. Eine negativ abstempelnde Wirkung ist deshalb nicht zwangsläufig mit jedem Eingriff verbunden. Dies führt zu der Forderung, Reaktionen und Sanktionen so auszugestalten, dass eine stigmatisierende Beeinflussung möglichst vermieden wird. 3.3. Theorie der kriminellen Karriere Schon Lemert (a.a.O.,S.71) beschreibt den Ausbildungsprozess einer abweichenden Identität in der Abfolge von primärer Devianz, Reaktion, gescheiterter Normalisierung, neuer (sekundärer) Devianz, verschärfter Reaktion und Übernahme einer devianten Rolle in aufeinanderfolgenden Stufen: 1. Ursprüngliche Abweichung 2. Negative gesellschaftliche Reaktion 3. Weitere abweichende Handlungen 4. Härtere Reaktion 5. Trotzhaltung, Übernahme der zugeschriebenen Rolle, Delikte 6. Verschärfte Sanktionen 7. Verfestigung der devianten Identität und endgültige Übernahme des abweichenden Status. 29 Mit ähnlichen Interaktionsmodellen arbeitet die Theorie der kriminellen Karriere. Sie geht davon aus, dass sich eine delinquente ähnlich wie eine konforme Karriere in der Auseinandersetzung zwischen Aktion und Reaktion herausbildet. Quensel hat ein Karrieremodell mit acht Phasen entwickelt, in dem „die delinquente Entwicklung als Folge eines sich wechselseitig hochschaukelnden Interaktions-Prozesses zwischen dem Jugendlichen und seiner sozialen Umgebung unter dem Einfluss der staatlichen Sanktionsinstanz“ beschrieben wird (in E.Naegeli, Strafe und Verbrechen,1976,S.21ff.). Goffman hat in seinem klassischen Werk „Stigma“ (1967) herausgearbeitet, mit welchen Techniken Personen, die von den unterschiedlichsten Stigmata betroffen sind, die „beschädigte Identität“ bewältigen und ihr Verhalten darauf einstellen. Das Karrieremodell von Becker, entwickelt am Beispiel von Marihuana-Rauchern (in: Outsiders,1963), nähert sich bereits dem radikalen labeling-Ansatz an, weil er die Abweichung nicht als Eigenschaft des Verhaltens, sondern ausschliesslich als Folge der Etikettierung versteht. 3.4. Der radikale labeling approach Der aus den USA stammende Ansatz wurde in Deutschland vor allem von Sack in einer radikalen soziologischen Version weiterentwickelt. Gestützt auf die damaligen Ergebnisse der Dunkelfeldforschung ging er davon aus, dass Straftaten normal und gleichmässig verteilt seien (Ubiquitätsthese). Deshalb beruhe die registrierte Kriminalität nicht auf Verhaltensweisen der Täter, sondern sei das Ergebnis von Definitionsprozessen durch die strafrechtlichen Kontrollinstanzen. Die Selektion der registrierten Delikte aus der Gesamtmenge der begangenen Delikte erfolge nicht gleichmässig oder nach der Schwere, sondern verzerrend, insbesondere zum Nachteil von sozial schwachen Tätern. Deshalb sei die Analyse der Definitions- und Selektionsmechanismen die vornehmste Aufgabe der Kriminologie. Der radikale labeling approach klammert die Frage nach den Ursachen völlig aus, er ist deshalb keine Kriminalitätstheorie, sondern eine reine Kriminalisierungstheorie. Der radikale labeling approach ist damit der Wegbereiter für die „Kritische“ oder „Radikale Kriminologie“, die anknüpfend an Foucault (Überwachen und Strafen, 1976) den Strafrechtsapparat als Herrschaftsinstrument versteht. Sie befasst sich ausschliesslich mit Kriminalisierung und interpretiert diese als Disziplinierung von Normabweichenden. Die Kritische Kriminologie will den ideologisch verschleierten Herrschaftsaspekt des Kriminaljustizsystems entlarven. Sie lehnt die konventionelle Kriminologie als Teil dieser Verschleierung ab (Taylor/Walton/Young, Critical Criminology,1975; Bussmann/Kreissl, Kritische Kriminologie in der Diskussion,1996). Kritik der Kriminalisierungstheorie Die Ubiquitätsthese, wonach die primäre Devianz gleichmässig verteilt und deshalb kriminologisch nicht interessant sei, hat sich als falsch erwiesen. Alle seither durchgeführten Dunkelfelduntersuchungen zeigen zum Einen, dass es eine kleine Gruppe 30 von Intensivtätern gibt, die für eine grosse Zahl von Delikten und insbesondere von schweren Delikten verantwortlich sind (dies bestätigt auch die Schweizer Rekrutenbefragung, auf die im Skript 2 näher eingegangen wird). Wenn solche Täter irgendwann erwischt werden, ist das weder dem Zufall noch einem selektiven Vorgehen der Kontrollinstanzen zuzuschreiben. Abgesehen von den durch die Intensivtäter begangenen Delikten gilt die breite Streuung auch nur bezüglich leichterer Verstösse. Der Satz, „es ist normal, als Jugendlicher Delikte zu begehen, aber nicht normal, dabei erwischt zu werden“, trifft zwar zu, soweit es sich um Straftaten wie Diebstähle, Verkehrsdelikte oder Tätlichkeiten handelt. Schwere Verbrechen sind dagegen auch in der primären Delinquenz nicht gleichmässig, nicht ubiquitär verteilt. Es gibt benennbare Gründe, warum ein bestimmter Jugendlicher ein solches Delikt begeht, die meisten andern aber nicht. Deshalb sind ursachenbezogenen (ätiologische) Erklärungen auch vor dem Einschreiten der Kontrollinstanzen von kriminologischem Interesse. Der labeling approach versagt bei der Erklärung von mutwilliger oder affektgesteuerter Gewalt. Damit kann er gerade zur Interpretation aktueller Gewaltformen wenig beitragen, z.B. Skinheads-Gewalt, Übergriffe von Hooligans, politisch motivierte Gewalt. Auch bei andern Kriminalitäts-Phänomenen leistet der labeling approach wenig, z.B. Wirtschaftskriminalität, Verkehrskriminalität, organisierte Kriminalität, geringerer Frauenanteil (auch in der primären Devianz). Der Ansatz ist deshalb entgegen dem vor allem in Deutschland lange behaupteten Alleinvertretungsanspruch nicht in der Lage, Delinquenz umfassend zu erklären. Diesen Einschränkungen zum Trotz bleibt der dem labeling approach zu Grunde liegende Gedanke ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen kriminologischen Denkens. Der labeling approach hat den Blick dafür geschärft, dass Erklärungen der Kriminalität ohne Einbezug der Definitionsprozesse und Kontrollmechanismen unvollständig und einseitig bleiben. Die Kriminologie darf die soziale Kontrolle nicht ausser Acht lassen, wenn sie Kriminalitätsursachen benennen will. Das zeigen in der Geschichte etwa die Kriminalfälle Sokrates von Athen, Jesus von Nazareth oder die Hexenprozesse, in der Neuzeit Verfahren gegen Abweichler, die aktuelle Drogengesetzgebung, die Strafbarkeit der Dienstverweigerung oder das, was wir als symbolisches Strafrecht bezeichnen. Aus dem Entweder-Oder zwischen traditionellen Ansätzen und dem Kriminalisierungsansatz ist heute ein Sowohl-Als-auch geworden. Der Kriminologie kommt gegenüber dem Strafrecht eine kritische Funktion zu. Sie hat die Aufgabe zu prüfen, wie weit strafrechtliche Definitionen dem Anspruch genügen, sozialschädliches Verhalten zu verhindern, und ob die Rechtsanwendung alle Bevölkerungsgruppen gleich behandelt. Sie muss sich kritisch äussern, wenn Normen erlassen werden, die nur der Beruhigung der Bevölkerung dienen, wenn Strafverfolgung einseitig zum Nachteil bestimmter Gruppierungen betrieben wird, oder wenn sich bestimmte Sanktionen als kontraproduktiv erweisen. Eine besondere Bedeutung haben interaktionistische Ansätze zur Erklärung von kriminellen Karrieren und zum Verständnis von chronifizierten Entwicklungen, z.B. im Rahmen der sog. Prisonisierung. Solche sekundäre Anpassungsverläufe sind immer nur aus dem Wechselspiel von Aktion und Reaktion nachvollziehbar. 31 4. Mehrfaktorenansätze Als Ergebnis des bisherigen Überblicks über die monokausalen, eindimensionalen Kriminalitätstheorien lässt sich Folgendes festhalten: • Keine dieser Theorien kann alle Formen von Kriminalität erklären. Die meisten haben Defizite bezüglich Verkehrskriminalität, Sexualdelikten, irrationalen Gewaltdelikten, Verteilung Mann-Frau. Andere können einzelne dieser Phänomene plausibel machen, versagen aber gegenüber andern Kriminalitätsformen. • Selbst im „Treffer“-Bereich genügt eine monokausale Theorie nicht zur Erklärung eines individuellen Verbrechens: In der Entstehungsgeschichte sind immer verschiedene Einflüsse wirksam. • Soweit sich Zusammenhänge empirisch tatsächlich bestätigen lassen, ergeben sich daraus immer nur Wahrscheinlichkeitssaussagen, nie Feststellungen über Kausalbeziehungen. Was liegt vor diesem Hintergrund näher, als verschiedene Ansätze oder Einflussfaktoren zu kombinieren und sie zu einer multifaktoriellen Erklärung zusammen zu fassen ? Schon früh gab es solche Versuche, allerdings fällt auf, dass vor allem Kriminologen mit juristischem Hintergrund zu derartigen Kombinations-Ansätzen neigten. Bis vor wenigen Jahren setzten sie sich aber dem Hohn und Spott der meisten sozialwissenschaftlich ausgerichteten Kollegen aus. Mehrfaktoren-Ansätze wurden als eklektisches Rosinenpicken , als Ausdruck von Theorielosigkeit, als Verursacher von Datenfriedhöfen oder schlicht als unwissenschaftlich verschrien. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Perspektiven erklären? In der sozialwissenschaftlich orientierten Kriminologie, vor allem in der Kriminalsoziologie, wurden bis in die 80er-Jahre des 20.Jahrhunderts wahre Glaubenskriege geführt. Die konkurrierenden Schulen verabsolutierten den jeweils eigenen ätiologischen Ansatz und sprachen sich gegenseitig die Berechtigung ab. Sie erhoben den Anspruch, allein im Besitz der wahren Erkenntnis zu sein, obwohl empirisch schon lang das Gegenteil evident war. Vor diesem Hintergrund erschienen Anhänger von Mehrfaktoren-Ansätzen als üble Verräter, wenn sie theoretische Elemente, die sich angeblich ausschlossen, miteinander kombinieren wollten. Der Grund, warum in der Kriminalsoziologie lange Zeit Grabenkämpfe vorherrschten, die praktisch wenig Nutzen brachten, liegt meines Erachtens in der damals vorherrschenden Praxisferne dieses Wissenschaftszweigs, vor allem in den USA und in Deutschland. Ich habe in den 70er-Jahren einen Verurteilten zu einem deutschen Kriminologen-Kongress mitgenommen, den ich in der Strafanstalt kennen gelernt hatte. Der Mann hatte sich im Selbststudium in die Kriminologie eingearbeitet und wünschte sich sehnlich, einmal an einem solchen Kongress teilzunehmen und die Leute, deren Theorien er gelesen hatte, persönlich zu erleben. Mein Angebot, ihn als meinen Assistenten einzuführen, schlug er aus, er wollte sich mit seiner wahren Identität vorstellen. Von Anfang an wurde er zur grossen Attraktion der Tagung. Viele Teilnehmer hörten nicht mehr den Vorträgen zu, sondern scharten sich in grossen Trauben um meinen Gast. Auf dem Heimweg erzählte er mir, die Kriminalexperten hätten sich darum so sehr für ihn interessiert, weil sie nach eigener Aussage noch nie zuvor mit einem leibhaftigen „Kriminellen“ ein Gespräch geführt hatten. 32 Teilweise lagen dieser Praxisferne nicht nur Berührungsängste oder mangelnde Gelegenheiten zu Grunde, sondern eine ausgesprochen feindliche oder gar phobische Einstellung gegenüber der Strafjustiz. Ein allerdings kleiner gewordener Teil der kriminalsoziologischen Zunft spricht auch heute noch dem Strafrechtsapparat jegliche Existenzberechtigung ab. Eine der theoretischen Grundlagen dafür findet sich im sog. Abolitionismus, der auf der Basis einer anti-etatistischen Grundhaltung die Abschaffung des Strafrechts fordert und den strafrechtlichen Kontrollapparat durch andere Konfliktregelungsmechanismen ersetzen will (vgl. Thomas Mathiesen, Die lautlose Disziplinierung,1985). Vermutlich wegen ihrer Ausbildung hatten juristisch ausgebildete Kriminologen zu allen Zeiten ein weniger distanziertes Verhältnis zur Strafrechtspraxis. Zwar ist es seit dem labeling approach unbestritten, dass sich die Kriminologie auch kritisch mit dem Kotrollapparat auseinandersetzen muss. Darin ist ein Konfliktpotenzial angelegt, die Kritik wird oft abgelehnt oder nicht verstanden. Manchmal ist sie vielleicht auch nicht berechtigt. Nach meinem Verständnis sollte die Kritik an den strafrechtlichen Kontrollinstanzen aber auf dem Boden eines solidarischen Grundverständnisses stehen. Die Solidarität liegt in den gemeinsamen kriminalpolitischen Zielsetzungen. Kriminologie soll mit ihrem kritischen Erfahrungswissen zu einer rationalen Kriminalpolitik beitragen. Sie soll ermöglichen, die Machtmittel der Kontrolle möglichst effizient einzusetzen und sie gleichzeitig auf das notwendige Minimum zu beschränken. Den Personen, die der Kontrolle unterliegen, müssen ein faires Verfahren und die Einhaltung von Menschenrechten garantiert werden. Kriminologie soll zur Versachlichung in der Auseinandersetzung mit Kriminalitäts-Problemen beitragen, sowohl in der Strafrechtspraxis als auch in der Gesellschaft. Ein solches Grundverständnis finde ich auch bei aufgeklärten Praktikern, ich hoffe, Sie werden ebenfalls zu diesem Teil der Praxis gehören, wenn Sie einmal im Berufsleben stehen. Vor diesem Hintergrund ist das Interesse an ätiologischen Theorien vor allem auf ihre praktische Anwendbarkeit fokussiert. Wenn das Ergebnis des eingangs dargestellten Überblicks sich so darstellt, dass mehrere Theorien nachweisbar Zusammenhänge ansprechen, aber keine allein zur Erklärung genügt, liegt es auf der Hand, verschiedene Ansätze pragmatisch zu verbinden. Diese an sich simple Einsicht hat sich neuerdings auch in der Kriminalsoziologie durchgesetzt, und Mehrfaktorenansätze sind damit salonfähig geworden. 4.1. Vorläufer Der Grundgedanke einer Vereinigungstheorie ist nicht neu. Als Ahnvater der multifaktoriellen Ansätze gilt Ferri (1896), der wichtigste Schüler von Lombroso. Im Gegensatz zu diesem berücksichtigte er in seinen Untersuchungen neben anthropologischen Merkmalen auch soziale Faktoren. Gestützt auf diese Konzeption hat von Liszt seine in der Folge einflussreiche Anlage-Umwelt-Theorie formuliert. Dieser Ansatz wurde später in den kriminologischen Werken der Juristinnen und Juristen Exner (1949), Mezger (1951), Mannheim (1965), Kaufmann (1971) und Brauneck (1974) übernommen und weiterentwickelt. 33 4.2. Empirisch ausgerichtete Mehrfaktorenansätze Im Gegensatz zu den anschliessend erläuterten theorieverbindenden MehrfaktorenAnsätzen sprechen wir von empirisch ausgerichteten Mehrfaktorenansätzen, wenn unter Verzicht auf eine forschungsleitende Verbrechenstheorie eine Vielzahl persönlicher und sozialer Daten von Untersuchungspersonen auf ihre statistische Übereinstimmung mit kriminellem oder nichtkriminellem Verhalten geprüft wird. Die festgestellten Korrelationen bilden gleichzeitig die Grundlage für die Entwicklung statistischer Prognoseverfahren. In der Anfangsphase wurden methodisch anfechtbare retrospektive Untersuchungsverfahren gewählt, später ging man zu anspruchsvolleren prospektiven Methoden über, insbesondere zu so genannten Kohortenstudien. Pionier dieser Entwicklung war das amerikanische Ehepaar Glueck, das seit 1930 mehrere empirische Untersuchungen zur Ermittlung kriminologisch relevanter Merkmalskombinationen durchgeführt hat. Die bekannteste und umfassendste Forschungsarbeit wurde 1950 unter dem Titel „Unraveling Juvenile Deliquency“ veröffentlicht. Die Gluecks haben darin 500 delinquente und 500 nichtdelinquente Jugendliche auf 402 Merkmale hin überprüft. Sie haben aus den Ergebnissen eine statistische Prognosemethode entwickelt, die sich in spätern Überprüfungen allerdings als nicht besonders aussagekräftig erwiesen hat. In der Tradition solcher Querschnitts-Erhebungen steht auch die schweizerische Rekrutenbefragung, über die ich im Rahmen der Dunkelfelduntersuchungen (Skript 2) noch eingehender berichten werde. Weil reine Querschnittsuntersuchungen in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind, wurden seit den 70er-Jahren weltweit sog. Kohortenstudien durchgeführt. In diesen Untersuchungen verfolgte man die Legalentwicklung ganzer Geburts- oder SchulJahrgänge über einen längern Zeitraum hinweg. Bekannt sind vor allem die Philadelphia Birth Cohort Study (Wolfgang 1972) und die Cambridge-Study (West 1973). Folgende Erkenntnisse lassen sich als Ergebnis der Kohortenstudien festhalten: 1. Die Episodenhaftigkeit des überwiegenden Teils der Jugenddelinquenz; 2. Das Bestehen einer kleinen Gruppe hoch belasteter Täter, in Philadelphia wurden z.B. 61,7 % aller Delikte von 6,3 % der beobachteten Jugendlichen begangen; 3. Einzelne Merkmale wie Gewalterfahrung, Erziehungsdefizite, kriminelles Elternhaus, Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und verschiedenartige Delinquenz weisen signifikante Korrelationen auf; 4. Dennoch erlauben diese Merkmale keine genügen zuverlässige Identifizierung künftiger Intensivtäter (im Hinblick auf eine in der Cambridge Study angestrebte frühzeitige selective incapacitation). 4.3. Die Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung Der Mehrfaktorenansatz von Göppinger (Der Täter in seinen sozialen Bezügen, 1983) unterscheidet sich von der rein statistischen Methodik der Kohortenstudien dadurch, dass sowohl bei der kriminellen Gruppe als auch bei der (abgesehen von 34 der Delinquenz gleich zusammengesetzten) Vergleichs-Stichprobe differenzierte individuelle Befragungen durchgeführt und gestützt darauf Einzelfallbefunde erarbeitet wurden (je 200). Das daraus entwickelte Konzept des „Täters in seinen sozialen Bezügen“ geht von einem an der konkreten Täterpersönlichkeit orientierten Kriminalitätsverständnis aus. Mit der Definition von „kriminorelevanten“ und „kriminoresistenten“ Verhaltensmustern wurden Grundlagen für die Prognose und die Behandlung gelegt. Analysiert wurden sowohl das Sozialverhalten im Lebenslängsschnitt, die aktuelle Situation im Lebensquerschnitt, die Werthaltung (gemessen an Interessen und Grundintentionen) sowie die Entwicklung der Delinquenz bis zur letzten Tat. Gestützt auf die statistische Auswertung wurden idealtypische Verhaltensmuster erarbeitet, in denen sich die kriminelle Gruppe (K) und die Durchschnittsgruppe (D) signifikant unterscheiden. Das heisst aber nicht, dass diese Merkmale bei allen Angehörigen der entsprechenden Gruppe vorhanden gewesen wären. Deshalb kann auch nicht von einzelnen Mustern auf eine kriminelle Gefährdung oder Nichtgefährdung geschlossen werden. (s.Folien zum Freizeit- und Berufsbereich) Besonderes Interesse verdient der Deliktsbereich. Danach ist die Wahrscheinlichkeit späterer Straffälligkeit dann erhöht, wenn bestimmte Erscheinungsformen bezüglich deliktischer Handlungen vorliegen. Im Hinblick auf eine mögliche kriminelle Weiterentwicklung sind Delikte im Jugendalter (die bei nahezu allen Jugendlichen vorkommen) dann als eher belanglos einzustufen, wenn sie aus einer Spielsituation heraus ihren Anfang nehmen gemeinschaftlich oder unter einem Gruppendruck begangen werden eine einfache Tatausführung aufweisen (z.B. einfache Wegnahme oder Ausnutzen einer günstigen Gelegenheit) eine einmalige Verfehlung darstellen oder während einer zeitlich beschränkten Phase erfolgen. Dagegen besteht die Gefahr einer kriminellen Verfestigung, wenn die Jugenddelikte planmässig und überlegt begangen werden, mit einer zielstrebigen Tatausführung, die Hindernisse überwinden muss oder mit raffinierten Täuschungen einhergeht darauf abzielen, eine spezifische Schwäche des Opfers auszunutzen eine Vielseitigkeit erkennen lassen, indem sie verschiedenen Deliktsgruppen angehören oder bei gleicher Deliktsgruppe unterschiedliche Tatausführungen aufweisen über einen längern Zeitraum hinweg auftreten. 4.4. Desistance-Forschung Ein neuer Ansatz ist die sog. Desistance-Forschung. Sie untersucht, was dazu beiträgt, dass Delinquenten aus der Kriminalität herausfinden. Sie ist im Gegensatz zu den Rückfalluntersuchungen nicht vergangenheits-, sondern zukunftsbezogen. Sie knüpft nicht an das Versagen der untersuchten Personen an, sondern an ihre Res- 35 sourcen, an ihre Fähigkeiten. Damit liefert sie der Kriminalprävention und insbesondere dem Straf- und Massnahmenvollzug Hinweise, wie der Ausstieg aus der Kriminalität unterstützt werden kann. Untersuchungen über den Abbruch von delinquenten Karrieren machen deutlich, dass die Distanzierung meistens nach dem Modell des „Abgewöhnens“, d.h. verbunden mit Rückfällen, vor sich geht. Das ist ein ähnlicher Verlauf, wie ihn auch andere Menschen erleben, wenn sie feste Gewohnheiten verändern wollen, etwa das Rauchen, ein Freizeitverhalten oder Essgewohnheiten. Rückfälle sind deshalb längst nicht immer negativ zu bewerten, sie können durchaus Symptom einer Veränderungsdynamik sein. In ihrer Tübinger Desistance-Studie haben Stelly/Thomas 56 Mehrfachtäter untersucht, die durchschnittlich 22,5 Monate Jugendstrafe verbüsst hatten. Die Probanden wurden im Verlauf von 6 Jahren dreimal befragt. Die Mehrzahl von ihnen konnte als erfolgreiche „Abbrecher“ eingestuft werden. Zum Ausstieg hatten beigetragen eine durch den Reifungsprozess ermöglichte kognitive Neuorientierung, die Änderung des Selbstbildes, die Integration durch Arbeit und Partnerschaft sowie der Wegfall von problematischen Familienkonstellationen und von Drogenabhängigkeiten. Der Abbruch krimineller Karrieren gelingt in der Regel nicht auf Anhieb, er ist meistens mit Rückfällen verbunden. Die Autoren halten als Ergebnis fest, „dass bei den meisten jugendlichen Mehrfachtätern eine Reintegration möglich und wahrscheinlich ist“. Deshalb sollten Interventionen darauf ausgerichtet sein, die Chancen der Täter auf soziale Teilhabe zu verbessern. Wichtig seien Angebote zur Bildung und zur beruflichen Qualifizierung, therapeutische Interventionen (Drogenentzug, Verhaltenstherapie), soziale Trainingsprogramme und Hilfen zur Alltagsbewältigung (z.B. Wohnraumvermittlung, Schuldensanierung). Die Förderungsmassnahmen sollten sich weniger an den Defiziten, sondern an den Ressourcen orientieren und Unterstützungsfaktoren aus dem Umfeld einbeziehen. In den Zusammenhang der Desitance-Forschung gehören insbesondere die Lebenslauf-Untersuchungen, die aus dem Rückblick Schlüsse auf die Prognose zulassen. Ausgangspunkt für die berühmteste derartige Untersuchung waren die zuvor erwähnten Forschungen, die das Ehepaar Sheldon und Eleanor Glueck in den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführt hatte: Laub/Sampson (Shared Beginnings, Divergent Lives, 2003) haben die 500 ehemals schwer delinquenten Jugendlichen, die unterdessen über 70 Jahre alt waren, nachuntersucht und festgestellt, dass ein kleinerer Teil kriminell geblieben war, ein grösserer Teil aus der Kriminalität ganz herausgefunden hatte, und ein Teil sog. Zick-zack-Karrieren erlebt hatten. Mit den Kenntnissen, die damals verfügbar gewesen waren, hätte sich die weitere Entwicklung nicht voraus sagen lassen. Denn diese hing nicht von vergangenheitsbezogenen Faktoren ab, sondern vom weitern Verlauf, vor allem von der sozialen Integration und der Motivation der Betroffenen. Als hilfreich für einen Ausstieg erwiesen sich eine Lebenspartnerschaft, eine befriedigende Arbeit und der Militärdienst. Laub/Sampson haben daraus eine „age-graded theory of social control“ abgeleitet, wonach es für jeden Lebensabschnitt auf die Qualität der Bindungen zu den jeweils wichtigen Institutionen der informellen sozialen Kontrolle ankommt. Eine ähnliche Untersuchung, ausgehend von den Exploranden der Tübinger Jungtäter-Untersuchung, haben Stelly/Thomas in Deutschland erarbeitet (Kriminalität im Lebenslauf, 2005). Ihre auch im Internet zugängliche Arbeit kommt nicht nur zu vergleichbaren Ergebnissen, sondern vermittelt auch einen guten Überblick über den weltweiten Stand der Lebensverlauf-Forschung. 36 4.5. Theorie verbindende Ansätze In den zuvor behandelten empirisch ausgerichteten Ansätzen wird auf der Basis vieler Vergleichsdaten versucht, deskriptiv Unterschiede zwischen Kriminellen und Nichtkriminellen herauszuarbeiten. Die statistisch erarbeiteten Aussagen weisen einerseits auf Theoriedefizite hin, andererseits vernachlässigen sie gesellschaftliche Einflüsse und solche der Verbrechenskontrolle. Deshalb werden in neuerer Zeit Versuche unternommen, die beschreibenden Darstellungen in ein umfassenderes Erklärungsmodell zu integrieren und zu diesem Zweck bestehende Kriminalitätstheorien miteinander zu verbinden. Ein Beispiel ist die von Günther Kaiser entwickelte Theorie unterschiedlicher Sozialisation und Sozialkontrolle. Er verbindet die Kontrolltheorie von Hirschi mit einem Sozialisationskonzept und erklärt damit, wie Bindungen zustande kommen und aufrecht erhalten werden. Abweichendes Verhalten ist auf Defizite im Sozialisationsprozess zurückzuführen, die eine Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte und Normen verhindern. Durch spätere Erfahrungen und durch Reaktionen der Sozialkontrolle werden die defizitären Bindungen verfestigt. Lebenslauftheorien, z.B. von West/Farrington, bauen auf biografischen Analysen auf. Sie verstehen Kriminalität als einen vorwiegend auf Interaktionen beruhenden Entwicklungsprozess im Lebenszyklus eines Menschen. Eine solche „Entwicklungskriminologie“ versucht zu erklären, warum Menschen erstmalig deviant werden, ihre Delinquenz beibehalten und schliesslich zu Kriminellen werden, aber kriminelle Karrieren oft auch wieder abbrechen. Eine entscheidende Rolle spielt die Intensität der sozialen Bindungen und die dynamische Wechselwirkung zwischen Delinquenz und Reaktion. In diese Interpretation sind Elemente der empirischen Ansätze, der Bindungstheorie, der Kontrolltheorie und des interaktionistischen Ansatzes eingeflossen. Kritik der Mehrfaktorenansätze Die traditionelle, gegenüber den heutigen Kombinationsansätzen kaum mehr berechtigte Kritik wurde schon einleitend erwähnt. Heute ist unbestritten, dass die empirischen Mehrfaktorenansätze wichtige Beiträge zum Verständnis der Kriminalität und der delinquenten Entwicklung geleistet haben. Allerdings unterliegen sie der Gefahr, sich zu sehr auf das delinquente Individuum zu konzentrieren und Einflüsse der Gesellschaft und der Sozialkontrolle auszublenden. Die anschaulichen deskriptiven Merkmale erwecken leicht den Eindruck, es handle sich um präzise diagnostische Kriterien. In Wirklichkeit sind sie bloss idealtypische Konstellationen, die statistisch häufig mit Kriminalität korrelieren. Trotz der Anschaulichkeit sind sie wenig trennscharf. Die einzelnen Merkmale haben wenig prognostische Aussagekraft, und selbst wenn sie gehäuft auftreten, lassen sie nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zu. Die Theorie verbindenden Ansätze sind bisher blosse Rahmentheorien, die es ermöglichen, unterschiedliche Erklärungen zu integrieren. Es fällt auf, dass biologische Ansätze bisher kaum einbezogen werden, obwohl sie im Rahmen einer integrativen Theorie sicher einen Aussagewert hätten. 37 5. Neue, „postmoderne“ Ansätze Die Bezeichnung „postmodern“ stammt von Kunz. Sie umschreibt kein klar abgegrenzte oder in sich geschlossene Kategorie. Eigentlich handelt es sich um moderne Theorien, die mit dem bisherigen theoretischen Instrumentarium relativ frei umgehen, verschiedene Ansätze miteinander verbinden oder Anleihen in andern Disziplinen machen. Eine dieser Theorien (Gottfredson/Hirschi), die ein besonders grosses Echo gefunden hat, möchte ich zum Schluss näher behandeln und gemeinsam diskutieren. 5.1. Ökonomische Theorie Die ökonomische Theorie stellt eine Übertragung volkswirtschaftlicher Denkansätze auf die Kriminalitätsentstehung dar. Sie geht davon aus, Kriminalität sei das Ergebnis einer rationalen Kosten-Nutzen-Analyse, mit welcher der Täter die Vor- und Nachteile des kriminellen Verhaltens einerseits und des legalen Verhaltens andererseits gegeneinander abwägt (rational choice). Die Theorie geht zurück auf den USamerikanischen Ökonomen Gary S.Becker (Ökonomische Erklärung menschlichen Verhaltens,1993). Gestützt auf Beckers Ansatz hat Petra Wittig auch in Deutschland eine ökonomische Interpretation vorgelegt (Der rationale Verbrecher,1993). Wittig schreibt (S.176): „Der ökonomische Denkansatz in der Kriminologie sucht die Antwort auf die Frage, warum Menschen Verbrechen begehen, nicht in besondern Persönlichkeitsmerkmalen oder Umweltbedingungen. Statt dessen wird in Anlehnung an den Homo-Oeconomicus-Idealtyp der neoklassischen Ökonomie auch Kriminalität als nutzenmaximierendes und damit rationales Entscheidungsverhalten erklärt. Wir haben uns daran gewöhnt, normtreues Verhalten als die Regel und kriminelles Verhalten als erklärungsbedürftige Ausnahme zu betrachten. Ganz anders die ökonomische Kriminalitätslehre: Für sie ist Verbrechen eine ökonomische Aktivität, die – wie auch konforme Verhaltensweisen – den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegt.“ Als Verbrechensnutzen werden die Vorteile und Befriedigungen verstanden, nach denen der homo oeconomicus in jeder Situation strebt. Als Verbrechenskosten fallen die Wahrscheinlichkeit und Empfindlichkeit einer möglichen Bestrafung ins Gewicht. Der Ansatz ist verwandt mit der Straftheorie der negativen Generalprävention, die heute allerdings kritisch beurteilt wird. Er zielt vor allem auf die Kriminalitätsformen ab, denen ein rationales Kalkül des Täters zugrunde liegt. Das ist insbesondere in der Vermögens-, Wirtschafts- und Umweltkriminalität sowie in der organisierten Kriminalität der Fall. Kritik der ökonomischen Theorie Die Kriminalitätsformen, denen eine „rational choice“ zugrunde liegt, treten in der Strafjustiz und erst recht im Strafvollzug, selten in Erscheinung, weil kalkulierende Täter (die es sicher gibt) auch, und sogar vor allem, das Risiko einplanen, erwischt 38 und überführt zu werden. Ist ihnen dieses Risiko zu hoch, sichern sie sich ab, durch Delegation, mit juristischer Hilfe oder durch organisatorische Tarnung (z.B. die Drahtzieher, des Drogenhandels, die nie vor Gericht erscheinen). Im Strafvollzug landen überwiegend Täter, die ihre Delikte so ungetarnt oder so „dumm“ begehen, dass sie leicht überführt werden können. Das hat weniger mit einer Minderintelligenz zu tun, sondern mehr damit, dass sich in ihrer Delinquenz unbewusste Konflikte oder irrationale Motive auswirken: Affekte, Emotionen, Fehlleistungen, Sucht, Machogehabe, Zwänge. Schon vom Delikt her haben folgende Straftaten grosse irrationale Anteile: Brandstiftungen, Sexualdelikte, zwanghaft begangene Delikte, Amoktaten sowie viele Gewalt- und Drogendelikte. Aber auch bei scheinbar geplanten Straftaten spielen irrationale Einflüsse sehr oft eine wichtige Rolle. So machten die Täter des Zürcher Postraubs, des grössten Raubdelikts, das es in der Schweiz je gab (53 Millionen Franken Beute), z.B. folgende „Fehler“: Sie traten unmaskiert zum Überfall an und konnten dank den Überwachungs-Kameras identifiziert werden. Der Anführer „verlor“ am Ort des Geschehens sein Foto mit seinen Fingerabdrücken drauf. Sie liessen weitere 17 Millionen am Tatort zurück. Mehrere Täter warfen nach dem Raub mit Geld um sich, weshalb sie sofort den Verdacht auf sich zogen. Selbst dort, wo Täter noch am ehesten rational handeln, im Bereich der Wirtschaftskriminalität, spielen sehr oft irrationale Motive eine Rolle, z.B. Ehrgeiz, Statusdenken, Konkurrenzdruck, Wunsch nach Rettung eines Familienunternehmens, Gruppenkonformität, Sehnsüchte. All diese irrationalen Antriebe und unbewussten Einflüsse blendet die ökonomische Theorie aus. Sie kann deshalb einen Grossteil der Delikte nicht oder nicht genügend erklären. Mit der Fixierung auf „rational choice“ dreht sie das Rad der wissenschaftlichen Erkenntnis in die Zeit zurück, bevor Siegmund Freud das Unbewusste entdeckt hatte. Die Kritik am Kriminalitätsbild stimmt überein mit der generellen Kritik am „homo oeconomicus“: Dieses von Ökonomen verwendete Konstrukt ist nichts als das Zerrbild eines berechnenden Wesens, das immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Gefühle, Liebe, idealistische Motive, Sehnsüchte, das Verlangen nach Anerkennung und nach Zugehörigkeit finden in diesem Menschenbild keinen Platz. 39 5.2. Theorie der Kontrollbalance Die Theorie der „Control Balance“ wurde von Charles Tittle entwickelt (1995). Die Kontrollbalance eines Menschen ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen dem Ausmass seiner Kontrollausübung über andere und dem Mass der Kontrolle, der er selbst unterworfen ist. Personen in einflussreicher Stellung verfügen über einen Kontrollüberschuss, indem sie mehr Kontrolle ausüben als erdulden. Personen in niedriger sozialer Stellung unterliegen einem Kontrolldefizit, weil sie überwiegend fremder Kontrolle unterworfen sind. Beide Formen der Unausgeglichenheit, das ist die überraschende Aussage, begünstigen Kriminalität. Kontrolldefizite lösen Gefühle der Ohnmacht und Selbstwertprobleme aus. Zur Kompensation dieser Schwächen begeht das Individuum Gewaltdelikte, die ihm kurzfristig 40 einen Kontrollüberschuss vermitteln, oder Vermögensdelikte, die sein Defizit vermindern. Kontrollüberschüsse korrumpieren. Die Erfahrung, dass andere sich unterordnen, verleitet dazu, die als selbstverständlich erlebte Machtfülle auszunutzen. Unterordnung wird bedingungslos erwartet. Bleibt sie aus, kann eine Person mit Kontrollüberschuss sehr ungehalten reagieren. So kommt es zum Gewaltausbruch, wenn der Ehemann ein Haar in der Suppe findet. Kritik Die Theorie ist originell, aber recht spekulativ und kaum operationalisierbar. Lange nicht alle Menschen, die Kontrolldefizite aufweisen (das dürfte die Mehrheit sein), begehen deswegen Delikte. Sonst müssten die Deliktsraten wesentlich höher sein. Und auch die Personen mit Kontrollüberschüssen dürften kaum alle delinquieren. 5.3. Theorie der re-integrativen Beschämung Der australische Kriminologe John Braithwaite hat eine Theorie vorgelegt (in Crime, Shame and Reintegration,1989), die in der Tradition der Kontrolltheorien das Ausbleiben delinquenter Handlungen erklären will, gleichzeitig aber auch Möglichkeiten einer wirksameren Reaktion auf Kriminalität aufzeigt. Die Schamtheorie enthält sowohl Elemente einer Kriminalitäts- als auch einer Straftheorie. Sie rückt die Missbilligung gegenüber dem Straftäter und die von diesem empfundene Scham ins Zentrum und entspricht damit der Forderung nach Emotionalisierung des Strafrechts. Es ist deshalb kein Wunder, dass sie in den USA besondere Beachtung gefunden hat. Scham ist eine Emotion, die sich als psychische Reaktion auf ein Verhalten einstellt, das der Konvention widerspricht oder als amoralisch empfunden wird. Dem individuellen Schamgefühl entspricht auf der gesellschaftlichen Ebene die Beschämung des Täters (shaming), die durch die Missbilligung der Tat und durch die Bestrafung angestrebt wird. Die Verurteilung erfolgt heute emotionslos, professionell, routinemässig und trotz der öffentlichen Gerichtsverhandlung in den meisten Fällen diskret. Hier setzt die Theorie von Braithwaite an: Die Ächtung kriminellen Verhaltens könne dadurch verstärkt werden, dass die Gesellschaft die Beschämung des Täters nachhaltiger zum Ausdruck bringe. Die Beschämung sei dann am effektivsten, wenn sie durch viele Mitglieder der Gesellschaft und dem Täter ins Auge blickend vollzogen werde. Solange die Beschämung delegiert und emotionslos erfolge, verfehle sie ihre kriminalpräventive Wirkung. Allerdings genügt der negative Aspekt der Beschämung nicht, sonst wirke sie stigmatisierend im Sinne eines gesellschaftlichen Degradierungsprozesses. Die Beschämung muss deshalb mit Zeremonien der symbolischen Wiedereingliederung (reintegration) verbunden sein, die ebenfalls im direkten Kontakt erfolgen sollen. Die Wiedereingliederungs-Zeremonie, die sich an das Beschämen anschliesst, vollzieht sich typischerweise in der Geste des Verzeihens, entsprechend der christlichen Devise „hasset die Sünde, aber liebet den Sünder“. Nach Kunz (§19,10) ähnelt das reintegrative Beschämen der Konfliktbewältigung innerhalb urchristlicher Gemeinschaften. Alle Menschen seien herausgefordert, moralisch Flagge 41 zu zeigen, der Toleranz gegenüber Abweichungen Grenzen zu setzen und sich an der Wiedereingliederung Straffälliger zu beteiligen. Kritik Beschämende Strafpraktiken sind nicht Neues. In Europa schlugen sie sich vor allem in Form des Prangers nieder (noch heute am Basler Rathaus sichtbar). Neu ist an der Theorie, dass das tendenziell stigmatisierend wirkende shaming verknüpft wird mit der Gegenbewegung der Reintegration. Allerdings dürfte ein solches Konzept vor allem in relativ homogenen, von einem einheitlichen Wertsystem getragenen Gesellschaften oder Gruppierungen wirksam sein, in denen die Loyalität zur Gemeinschaft den individuellen Interessen vorgeht. Das könnte z.B. mit ein Grund sein für die niedere Kriminalitätsrate in Japan. Ob das Konzept in einer heterogenen, komplex zusammengesetzten und individualistisch ausgerichteten Gesellschaft wie der unsern Wirkung entfalten kann, ist zu bezweifeln. Positiv schätze ich ein, dass die Theorie der Tendenz entgegenwirkt, KriminalitätsProbleme an Spezialisten zu delegieren. An Stelle von permissivem Zusehen und Nichtstun spricht sie die Gesellschaftsmitglieder auf ihre Mitverantwortung für die Einhaltung der Normen und für den Umgang mit straffälligen Menschen an. Dadurch ist sie geeignet, die sinnvolle Forderung nach vermehrter primärer Sozialkontrolle (hinsehen statt wegschauen) zu unterstützen, anstatt im Sinne der sekundären Sozialkontrolle nach immer mehr Polizei zu rufen. Allerdings ist es gefährlich, dieses Ziel mit den Mitteln der Emotionalisierung und der moralischen Verurteilung anzustreben. Solche Mechanismen des kollektiven Schuldvorwurfs können leicht zu einem aggressiven Ausleben von Vorurteilen und Projektionen ausarten. Denken wir etwa an Situationen, wo das Opfer der Beschämung Mitglied einer von der Mehrheit abgelehnten Nationalität, Religion, Rasse oder Volksgruppe ist. Das Beschämungskonzept ist einseitig, indem es sich ausschliesslich mit der externen Kontrolle durch Beschämung befasst und die interne Kontrolle vernachlässigt, die durch die Entwicklung einer eigenen moralischen Haltung und die Entstehung der darauf bezogenen Scham gekennzeichnet ist. Die soziale Kontrolle reduziert sich auf einen fremdbestimmten Vorgang, dem sich der Übeltäter passiv zu unterziehen hat. Zudem bleibt die Beschämung dort wirkungslos, wo sich Kriminelle in Folge von Skrupellosigkeit, kriminellem Über-Ich, chronifizierter Abweichung oder Zugehörigkeit zu Subkulturen oder kriminellen Organisationen gar nicht auf ein Schamgefühl ansprechen lassen. 5.4. Anpassung an Stress-Situationen Die von David Rowe entwickelte “Adaptive Strategy Theory“ (in: Hawkins, Delinquency and Crime,1996) knüpft an neue Gewaltformen an, z.B. von Skinheads, Neonazis, Chaoten, Hooligans, Schlägertrupps. Neben diesen meist kollektiv begangenen Gewaltanwendungen können auch Autoraser, Vergewaltiger und Täter häuslicher Gewalt eine ähnliche Motivation aufweisen. Solche Delikte werden oft von Personen 42 begangen, die äusserlich integriert sind und keine krankhaften Störungen aufweisen. Die Theorie nimmt an, die Gewaltanwendung diene dazu, psychische StressSituationen zu bewältigen, die in der Spannung zwischen dem im Alltag empfundenen Konformitätsdruck einerseits und dem Bedürfnis nach Abenteuer und Dominanz andererseits angelegt sind. Solche Täter empfinden oft eine innere Leere, ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Sie suchen nach dem „Kick“, nach der Sensation, nach dem Extremerlebnis, das ihnen eine Erfahrung der Überlegenheit über Andere vermitteln soll. Entscheidend ist somit der positive Erlebnisinhalt, den die Verübung der Straftat vermitteln kann. Die Möglichkeit, in die Rolle des Bösen zu schlüpfen und sie für einen Moment auszukosten, das Erleben der Allmacht gegenüber dem Opfer, die Lust am Bösen sei „Balsam für die Seele“ (Kunz §16,22). Allein schon der Gedanke an die böse Tat verleihe ein Gefühl der Autonomie und Ungebundenheit. Verstärkt wird diese Tendenz durch Medienvorbilder und Gewalt rechtfertigende Neutralisierungstechniken. Möglicherweise spielen auch biologische Dispositionen eine Rolle, etwa eine tiefe Herzfrequenz oder ein niederer Serotonin-Spiegel. Kritik Der Ansatz sprengt das Muster konventioneller Kriminalitätsverständnisse insofern, als diese defizit-orientiert sind. Das gilt selbst für die Kontrolltheorie, für die es in der Natur des Menschen liegt, Delikte zu begehen. Dennoch gelingt es im Normalfall, die Menschen durch innere und neuere Kontrollen zu einem sozialen Verhalten zu motivieren. „Die Annahme, dass Kriminalität Genuss verschaffe und wegen dieses Genusses verübt werde, hat so gar nichts von der moralinsauren Ernsthaftigkeit, die Kriminalitätstheorien ansonsten anhaftet“ (Kunz §16,23). Die Lust am Bösen, die der Erklärung zu Grunde liegt, ist allerdings empirisch weder erklärbar noch messbar. 5.5. Situative Ansätze (vgl. Grundriss Killias 2002, Kapitel 7) Die bisher dargestellten Ansätze gehen von Gründen aus, die in der Person oder in der Gesellschaft angelegt sind. Situative Ansätze knüpfen dagegen daran an, dass beliebige Personen durch günstige Gelegenheiten in Versuchung geführt werden können. Der Volksmund spricht einen solchen Zusammenhang mit dem Satz „Gelegenheit macht Diebe“ an, im christlichen Gebet wird ausdrücklich darum gebeten, vor Versuchungssituationen verschont zu bleiben. So sehr der Gedanke in der Alltagswahrnehmung verankert ist, so sehr hatte und hat er es schwer, sich in der Kriminologie durchzusetzen. Situative Erklärungen wurden lange Zeit als oberflächlich und banal angesehen. Den Präventionsbemühungen, die auf dieser Ebene ansetzten, z.B. Viedeo-Überwachungen oder Alarmanlagen, wird vorgeworfen, sie führten bloss zu einer Verlagerung. Ein verwandter Ansatz ist in der Viktimologie das lifestyle-Modell von Hindelang/Gottfredson/Garofalo, das annimmt, das Risiko, Opfer von Straftaten zu werden, nehme zu, je häufiger eine Person mit potenziellen Tätern zusammentreffe und sich an entsprechenden Orten aufhalte (s.Viktimologie). Der routine-activity-Ansatz geht davon aus, dass es zu einer Straftat kommt, wenn ein potenzieller Täter auf ein geeignetes Tatobjekt trifft, das nicht geschützt ist (Felson 1998). Die Gelegenheit zu Delikten hängt deshalb stark mit den Alltagsroutinen 43 der potenziellen Opfer zusammen. Laut Cohen & Land erklären die Alltagsgewohnheiten und die Veränderungen, die sie im Laufe der Zeit erfahren, die Schwankungen in der Kriminalitätsentwicklung besser als Theorien, die bei der Person des Täters oder bei gesellschaftlichen Bedingungen ansetzen. So stiegen in den USA Einbrüche zeitgleich mit der Zunahme von Einpersonen-Haushalten und mit der wachsenden Bedeutung ausser-häuslicher Freizeitaktivitäten an (Cohen/Felson 1979). Weltweit bewirkte die Einführung der Lenkradschlösser eine Verminderung der Autodiebstähle. Die Tatsache, dass die Häufigkeit von Einbrüchen oder Fahrzeugentwendungen von der Zahl der verfügbaren Tatobjekte abhängt, lässt es präventiv als sinnvoll erscheinen, Wohnhäuser, Autos und Velos besser zu sichern. Clarke/Mayhew haben eine Taxonomie entwickelt, aus der sich eine Art Inventar von einfach zu bewerkstelligenden Präventionsmöglichkeiten ergibt. Ausgangspunkt ist die Annahme, die Häufigkeit der Deliktsbegehung hänge ab von der Anzahl verfügbarer Tatobjekte, von ihrer Attraktivität und Zugänglichkeit, von den mit der Deliktsbegehung verbundenen Risiken und von den Alternativen, die potenziellen Tätern zur Verfügung stehen. Dementsprechend setzen ihre Präventionsstrategien auf folgenden Ebenen an: Sicherung der Tatobjekte (target hardening), durch Schlösser, technische Verstärkungen und andere Schutzmassnahmen Beseitigung von Tatobjekten (target removal), z.B. durch bargeldlosen Verkehr Ausschalten von Tatmitteln: Eingeschränkter Zugang zu Schusswaffen, erschwerte Erhältlichkeit von Farbsprays, Verbot von ultraschnellen Autos, automatische Bremssysteme, auf Alkohol reagierende Wegfahrsperren Reduktion der Gewinnaussichten (reducing the pay-off), z.B. durch Massnahmen gegen Hehlerei und Geldwäscherei Verstärkte Überwachung durch Polizei, Wachpersonal, andere Angestellte, Publikum und technische Hilfsmittel (z.B. Video-Überwachung) Koordinierte Planung (environmental management): in diesem Zusammenhang wird z.B. die verbesserte Koordination von Schliessungs-Zeiten in der Nacht mit den Betriebszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel genannt. Kritik der situativen Ansätze Gegen situative Ansätze wird seit langem eingewendet, sie bewirkten keine Verhinderung, sondern bloss eine Verlagerung von Kriminalität. Tatentschlossene Täter würden die Delikte, deren Begehung am einen Ort erschwert sei, an einem andern Ort begehen, wo weniger Hindernisse bestünden. Damit würde die Sicherheit der einen, die sich die teuren Sicherheitsvorkehren leisten könnten, auf Kosten der andern erkauft, die sich nicht im gleichen Mass schützen könnten. Zudem entstehe eine Sicherheitshysterie, die das in der Bevölkerung verbreitete Unsicherheitsgefühl anheize. So sicher es Delikte gibt, die aus einem klaren Tatentschluss und einer längern Vorbereitung heraus entstehen (und deshalb so oder so ausgeführt werden), so sicher gibt es aber andere, die aus dem Moment heraus und vor allem deshalb verübt werden, weil sich eine günstige Gelegenheit bietet. Das zeigen die weit verbreiteten Diebstähle am Arbeitsort: Sie werden überwiegend von Personen begangen, die sonst nicht deliktisch auffallen. Situative Massnahmen bewirken nicht generell und in 44 allen Fällen eine örtliche Verlagerung. Deshalb ist das Ziel, den Zugang zu kriminellen Gelegenheiten zu erschweren, sicher gerechtfertigt. Allerdings muss man sich bewusst halten: Sicherheitsmassnahmen bewirken in denjenigen Fällen meistens keinen Verhinderungs-Erfolg, wo Delikte auf einem verfestigten Entschluss, einem Zwang oder einem psychisch abnormen Motiv beruhen. 5.5. Konzept der Selbstkontrolle (Gottfredson/Hirschi) Das Konzept der Selbstkontrolle (Gottfredson/Hirschi, A General Theory of Crime, 1990) ist in den USA die meistdiskutierte Kriminalitätstheorie der letzten Jahre. Sie tritt mit einem universellen Anspruch auf und will Kriminalität historisch, geografisch und kriminologisch umfassend erklären. Der Ansatz fusst auf der utilitaristischen Sozialphilosophie von Jeremy Bentham (1748-1832). Diese versteht die Natur des Menschen als bestimmt durch das Streben nach Vergnügen und nach Vermeidung von Schmerzen. Mit diesem hedonistischen Kalkül steuere der Mensch sein Verhalten so, dass es ihm möglichst viel Spass und möglichst wenig Einschränkungen bringt. Ein solches Menschenbild liegt auch der ökonomischen Theorie zu Grunde, mit der das Konzept von Gottfredson/Hirschi viele Berührungspunkte hat. Die Theorie besagt zusammengefasst, dass objektive Gelegenheiten in Verbindung mit geringer Selbstkontrolle zu abweichendem Verhalten disponieren. Die objektiven Gelegenheiten (opportunity perspective) sind durch das Fehlen externer Kontrollen definiert. Die Selbstkontrolle ergibt sich aus der Selbststeuerung auf Grund eines Kosten-Nutzen-Kalküls. Die Theorie enthält auch Annahmen darüber, wie die Selbstkontrolle erworben wird. Verbrechen findet statt, wenn (B x E+) > (S x E-) ist. B = Belohnung, E+ = Wahrscheinlichkeit der Belohnung, S = Sanktionshöhe, E- = Sanktionswahrscheinlichkeit (s. die abgegebene Zusammenfassung auf Grund der Darstellung in Siegfried Lamnek, Neue Theorien abweichenden Verhaltens, 2.A.1997, 120-167). Fragen zur Diskussion • • • • Welches Welt- und Menschenbild liegt der Theorie zu Grunde ? Was kann die Theorie leisten, wo liegen ihre Stärken und Schwächen ? Welche Kriminalitätsformen lassen sich damit erklären, welche nicht ? Welche Konsequenzen ergeben sich für Prävention, Gesetzgebung, Strafverfolgung, Gerichtspraxis, Strafvollzug ? 45 Kritik des Selbstkontrolle-Konzepts Das hohe Abstraktionsniveau vertuscht die Simplizität der Erklärung und die fehlende Konkretisierung. Die Argumentation ist weitgehend zirkulär, nach dem Muster: Das Auto schleudert, weil es zu wenig Bodenhaftung hat. Andererseits ist die Theorie breit anwendbar und nicht auf einzelne Deliktsformen beschränkt. Das Weltbild ist konservativ und von einer puritanischen Ethik geprägt. Das menschliche Ideal ist der disziplinierte WASP. Das Menschenbild ist das des homo oeconomicus (s. ökonomischer Ansatz), wobei immerhin anerkannt wird, dass Delikte oft spontan, unüberlegt oder unter dem Einfluss von Drogen begangen werden. Die Entwicklung der Selbstkontrolle hängt vor allem von der Erziehung im Elternhaus ab, weniger von der Schule, von Medien, Peer-Gruppen oder gesellschaftlichen Einflüssen. Damit wird die Erklärung individualisiert und den Eltern der Schwarze Peter zugeschoben. Das Bild der Erziehung ist durch Beaufsichtigung und Bestrafung geprägt, nicht durch Vorbild und Belohnung. Der Zuschreibungs- und Reaktions-Aspekt fehlt. Die Verantwortung liegt allein beim handelnden Individuum. Dessen Selbstkontrolle lässt sich vor allem in der Familie beeinflussen. Generalprävention und Gerichtspraxis werden nicht als motivierend verstanden. Kriminalpolitik beschränkt sich auf die Verhinderung von Gelegenheiten und die Realisierung eines dichten Kontrollnetzes. Peter Aebersold 2007 [email protected]