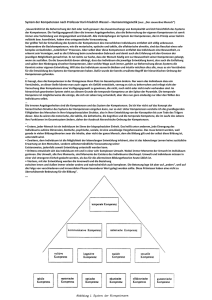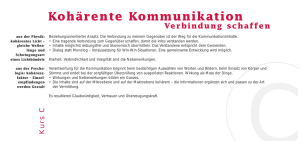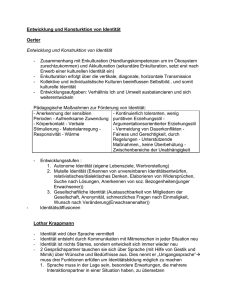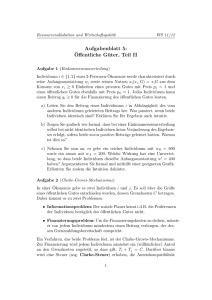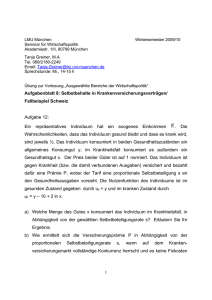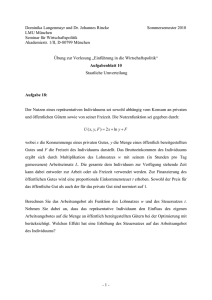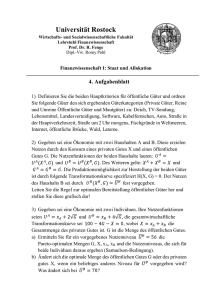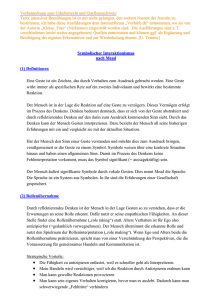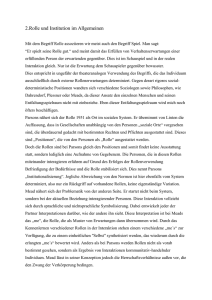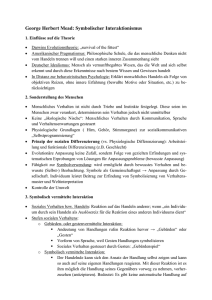IDENTITÄT UND MACHT Eine theoretische Auseinandersetzung mit
Werbung

IDENTITÄT UND MACHT Eine theoretische Auseinandersetzung mit der Soziologie gesellschaftlichen Außenseitertums DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) am Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften der FernUniversität in Hagen vorgelegt von BERNHARD FISCHER aus Ludwigshafen am Rhein Diese Arbeit wurde von Herrn Professor Dr. Dr. Abels, Lehrgebiet Soziologie I der FernUniversität Hagen, betreut. 2 Inhaltsverzeichnis 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.3.1. 2.6.4. 2.6.5. 2.6.6. 2.7. 2.8. Vorwort Identitätsentwicklung in der psychoanalytischen Theorie Eriksons Persönliche und soziale Identität in der Psychoanalyse Der Weg zur „gesunden“ Persönlichkeit Identitätsdiffusion und negative Identität Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft Wissenschaftstheoretische Betrachtungen und kritische Anmerkungen Identität als Sozialisationsergebnis in der strukturfunktionalen Theorie Die Bedeutung der Familie als gesellschaftliche Instanz der Wertevermittlung Handlungsalternativen und Motivation zu angepasstem Verhalten Der normativ orientierte Akteur – Homo Sociologicus Zur Kritik der strukturfunktionalistischen Sozialisationstheorie Die strukturfunktionale Perspektive zur Abweichung Die Bezugnahme auf die Anomietheorie Mertons Die Ziel-Mittel-Diskrepanz Konformistische Anpassung Innovative Anpassung Desintegration und Jugendgewalt Ritualistische Anpassung Rückzug Rebellion Die formelle Analyse der Devianz Desintegrationstheorem 8 17 20 22 25 29 31 38 40 45 51 56 59 61 64 67 67 68 75 76 77 78 84 3 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 4 Identität im interpretativen Paradigma – das Individuum als Subjekt Die Theorie des Selbst - einführende Bemerkungen zu George Herbert Mead Kommunikation, Identität und Gesellschaft Die Ontogenese der Identität Innen- und Außenperspektive sowie theoretische Einwände Identitätsprobleme Weiterentwicklung des Identitätskonzeptes im Rahmen des interpretativen Paradigmas Identität und ihre Präsentation in der Soziologie Goffmans Identität und Fassade Gefährdete Darstellung und Identität Die Theorie des Abweichens Identität und „Stigma“ Diskreditierbare Menschen Etikettierung Abweichung als Folge gesellschaftlicher Normsetzung Diskreditierte Menschen Identität und das Problem des „doppelten als-ob“ Die horizontale Perspektive der sozialen Identität Die vertikale Perspektive der personalen Identität Die Antinomie der Paradigmen Der Habitus als Identitätskonzept Der „Kleinbürger“ – Außenseiter und dennoch Mehrheitsmitglied? Identitätsentwicklung im Einklang mit der sozialen Umwelt – die dogmatischen Positionen der klassischen Theorielinien Ethik und Gesellschaft 88 88 89 93 96 100 109 112 114 119 124 125 126 132 135 142 156 157 159 165 168 179 187 188 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9. 9.1. 9.2. 10. Die ethische Konstruktion der Identität (G.H. Mead) Die soziale Konstruktion der Ethik (E. Durkheim) Institutionen Institutionen und Unterdrückung Institutionen und Identität Macht Die Macht der Symbole (P. Bourdieu) Die symbolisch erzeugte Legitimität von Ausgrenzung Negatives symbolisches Kapital Die vorklinische Phase Totale Institutionen Sozialer Wandel durch Umwertung der Kapitalien Legitimationsprobleme Hysteresiseffekte Das „postmoderne" Selbst – die Krise der Identität Literaturliste 191 194 200 205 208 210 214 218 230 232 233 236 238 240 245 257 5 6 „Die Welt hat die Freiheit verkündet, besonders in letzter Zeit, aber was sehen wir denn in dieser ihrer Freiheit? Nichts als Sklaverei und Selbstmord! Denn die Welt sagt: ‚Du hast Bedürfnisse, also befriedige sie auch, denn du hast ja dieselben Rechte wie die angesehensten und reichsten Leute. Scheue dich bloß nicht, sie zu befriedigen, sondern vermehre sie lieber noch, - das ist die gegenwärtige Lehre der Welt. Eben darin sehen sie die Freiheit. Was ergibt sich als Folge aus diesem Recht auf Vermehrung der Bedürfnisse? Bei den Reichen Vereinsamung und geistiger Selbstmord, bei den Armen aber Neid und Totschlag, denn die Rechte hat man zwar gegeben, aber die Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse nicht überwiesen. (...) Und da ist es denn auch kein Wunder, dass sie, statt wahrhaft frei zu werden, nur in Sklaverei geraten, und statt der Bruderliebe und der Einigkeit der Menschen zu dienen, im Gegenteil der Absonderung und Vereinsamung verfallen.“ (aus Dostojewski: „Die Brüder Karamasoff“, Sechstes Buch: Ein russischer Mönch) 7 Vorwort Am 26.April 2002 ist ein 19-jähriger Mann in Erfurt in seine ehemalige Schule während der dort anhängigen Abiturprüfungen eingedrungen und hat siebzehn Menschen erschossen und sich anschließend selbst das Leben genommen. Sofort nach der Tat hat in Deutschland die Debatte über gesellschaftliche Versäumnisse eingesetzt. In der Folge wurden Verschärfungen des Waffenrechts, Maßnahmen gegen Gewaltdarstellungen in den Medien und gegen Aggressivität an den Schulen diskutiert. Die kritische Öffentlichkeit war sich sehr schnell darin einig, dass es damit aber nicht sein Bewenden haben kann, dass also ein singulärer gesetzgeberischer Akt im Bereich des Waffenrechtes und eine freiwillige Selbstbindung der Medien nicht ausreichen, das Problem der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen in den Griff zu bekommen. Die soziologische Fachdiskussion hat sich schon seit Längerem ausgiebig mit der Gewaltthematik befasst1. In diesen Ansätzen wird stets vor den Wirkungen der Medien, insbesondere im Hinblick auf grenzenlose Gewaltszenarien in trivialen Actionfilmen gewarnt. Es ergeht aber auch der sorgenvolle Hinweis der Fachleute auf die Tatsache, dass es nichts in der Lebenswelt der jungen Menschen gibt, was den negativen Einfluss solcher Medien kompensieren könnte, so dass sie Gefahr laufen, den nur virtuellen Charakter solcher Medienprodukte nicht zu durchschauen und der in ihnen kommunizierten Wirklichkeitsdeutung eine universelle Gültigkeit beizumessen. Diese Darstellungen propagieren eine Ethik der Gewalt und des Rechts des Stärkeren, im günstigsten Fall noch eine Einteilung der Welt in „Gut“ und „Böse“, wobei nicht immer die Guten gewinnen. Die Tatsache, dass es kein Regulativ beim Medienkonsum gibt, ist dem Umstand geschuldet, dass soziale Bindungen in den Familien, die eine zuverlässige innere Orientierung des jungen Menschen gewährleisten könnten, schwächer geworden sind. Und es trifft nicht mehr nur junge Menschen aus belasteten Milieus, deren Delinquenz man gerne mit hinlänglich bekannten Theorien über abweichendes Verhalten erklärt. Diese Entwicklung hat Zugang in den Bereich der Mittelschichten gefunden, 1 8 so z.B. Heitmeyer 1992 wie die Bluttat von Erfurt zeigt. So ist der Tatort, das GutenbergGymnasium in Erfurt, als „gute Schule“ bekannt. In unmittelbarer Nachbarschaft des Bundesarbeitsgerichtes ist diese Schule und ihr Umfeld weit von jenen sozialen Brennpunkten entfernt, aus deren Umfeld ansonsten eine solche Gewalthandlung erwartet worden wäre. Entsprechend rekrutiert sich die Schülerschaft, aus deren Mitte der Täter kam, eher aus den bürgerlichen Schichten der Stadt. Es ist also keinesfalls zu erwarten gewesen, dass ausgerechnet an dieser Schule siebzehn Menschen zu Gewaltopfern eines Schülers werden. Von dem Täter ist bekannt geworden, dass er zwar als intelligent galt, sich aber renitent gegenüber den Lehrern verhielt, weshalb er kurz vorher der Schule verwiesen wurde. Er soll bei seinen Großeltern gelebt haben. Ansonsten waren keine Auffälligkeiten über ihn bekannt gewesen. Man kann sogar unterstellen, dass der ehemalige Schüler bis zu seiner Tat ein absolut „normales“ Leben führte, das keinerlei Anlass zur Aufmerksamkeit bot: Schulversagen ist weit verbreitet, und der Täter hätte sogar noch eine Möglichkeit gehabt, den bisher versäumten Schulabschluss nachzuholen. Auch die Tatsache, dass der Täter nicht bei seinen Eltern lebte, ist nicht ungewöhnlich. Immerhin war er schon volljährig und konnte daher durchaus seine eigene Lebensführung gestalten. Der Umstand, dass er keinen oder wenig Kontakt zu seinen Eltern hatte, ist keiner besonderen Erwähnung wert, denn es ist nicht mehr unnormal, dass Familien in Deutschland auseinanderbrechen und Sprachlosigkeit unter den Familienmitgliedern herrscht. Und damit bin ich bei einer Problematik unserer Gesellschaft angelangt, der Deutung von Normalität, bzw. der Frage, was als normale Handlungs- oder Seinweise angesehen werden kann und wie daraus folgend gesellschaftliche Abweichung definiert wird, das heißt ein Sein oder ein Handeln, das Normalitätskriterien verletzt. Zu den bekanntesten Konzepten, die diese Unterscheidung in systematischer Weise gewährleisten, gehören die von Goffman analytisch unterschiedenen drei „Stigmatypen“, nämlich „physische Deformationen“, „individuelle Charakterfehler“ sowie 9 „phylogenetische Stigmata“2. Goffman hat das Gemeinsame der Stigmatypen herausgestellt, indem er Folgendes schrieb: „Ein Individuum, das leicht im gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird. Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten.“3 Ein wesentlicher Teil des Außenseitertums in unserer Gesellschaft ist immer noch mit dem Stigmakonzept erfasst. Und dennoch ist festzustellen, dass es Menschen gibt, die sich subjektiv als Außenseiter empfinden, obwohl sie kein sozial wahrnehmbares Zeichen tragen, das sie wie ein Stigma zu Außenseitern machen könnte. Und so wie ihnen geht es immer mehr Gesellschaftsmitgliedern. Das ihnen Gemeinsame ist die Tatsache, dass sie zu Außenseitern geworden sind, weil sie zunehmend außerhalb sozialer Zusammenhänge leben, weil in zunehmendem Maße gesellschaftliche Institutionen, die Inklusion und Zugehörigkeit und damit auch Wertebezug und gesellschaftliche Moral vermittelten, an Bedeutung verloren haben. Die scheinbare Normalität dieses Zustandes liegt darin begründet, dass die Zahl der Betroffenen immer mehr zunimmt. So kann man z.B. feststellen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche außerhalb „funktionierender“ Familien aufwachsen. Immer mehr Erwachsene arbeiten in unsicheren und temporären Beschäftigungsverhältnissen, die ein hohes Maß an Flexibilität fordern und soziale Unsicherheit beinhalten. Immer mehr Menschen können dauerhafte und stabile Partnerschaften nicht mehr durchhalten. Diese Umstände machen den Normalitätsbegriff so ambivalent, denn je mehr Menschen unter diesen Unsicherheitsbedingungen leben, in ihnen sozialisiert werden, desto eher können die Aussagen der Soziologie zu angeblich „normalen“ Identitätsentwürfen unglaubwürdig werden, denn die Identität einer Person ist „deren Interpretation der eigenen Existenz in der Gesell2 3 Goffman 1963, S. 12f. Goffman 1963, S. 13 10 schaft“4, und wenn die gesellschaftlichen Bedingungen für die Bildung und für das Durchhalten einer Identität nicht mehr vorliegen, kann es auch keine Identität im klassischen Sinne geben. Vor dem Hintergrund dieser Normalitätsproblematik der soziologischen Theorie möchte ich folgende Thesen formulieren: • Es gibt in der fortgeschrittenen Moderne keine universale und verbindliche Wirklichkeitsdeutung, die eine objektive Unterscheidung von normalem im Gegensatz zu abweichendem Sein oder Tun zulässt. • Insofern ist eine Definition gesellschaftlichen Außenseitertums problematisch. Die diesbezüglichen Aussagen der klassischen Theorien der Soziologie (z.B. der Stigmaansatz von Erving Goffman, die Etikettierungstheorie von Howard Becker oder die Anomietheorie von Robert Merton) erscheinen nur noch als hilfreiche Konstruktionen zur Beschreibung idealtypischer Handlungsbedingungen im Sinne abweichenden versus konformistischen Handelns. Sie beschreiben indes nicht die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Gesellschaften der fortgeschrittenen Moderne, die durch eine Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten und gesellschaftlich lizenzierten Seinsweisen gekennzeichnet ist. • Das Fehlen gesellschaftlicher Normalitätsdeutungen ist jedoch nicht mit einer generellen Verbesserung der Lebenssituation der Menschen verbunden. Außenseitertum und gesellschaftliche Marginalisierung lassen sich zwar nicht mehr, wie früher, an bestimmten und abgrenzbaren gesellschaftlichen Gruppen festmachen. Vielmehr ist es so, dass eine Vielfalt von Lebensformen nebeneinander existieren und sich – eine ökonomische Basis vorausgesetzt - auch verfestigen können. Bei dieser Vielfalt gibt es keine Besonderheit des Körpers, des Charakters, der Herkunft, der Einstellung usw., die, sofern sie nicht einem Legalitätsprinzip entgegensteht, weitgehend problemlos existieren könnte. Innerhalb einer Gruppe Gleichartiger ist das, was ihre Mitglieder im Verhältnis zur Majorität besonders sein lässt, „normal“. Die Gruppenmitglieder laufen keine Gefahr, gesellschaftlich sanktioniert zu werden, wenn sie ihre 4 Schimank 2002, S. 15 11 Besonderheit nach außen bekennen. Dies gilt umso weniger, je ausgeprägter das ökonomische Potenzial der Gruppe bzw. ihrer Mitglieder ist. Mit diesem letzten Gedanken spreche ich ein Phänomen an, das in den klassischen Theorien über gesellschaftliche Außenseiter von untergeordneter Bedeutung ist. Ich bin bei der Rezeption der Schriften Pierre Bourdieus auf die Bedeutung jedweden Kapitals für die gesellschaftliche Positionierung von Individuen und Gruppen gestoßen. Dabei habe ich erkannt, dass in unserer Gesellschaft eine, wie auch immer geartete Außenseitereigenschaft, ein Stigma, an Schärfe und Bedeutsamkeit einbüßt, wenn ihr Träger über genügend Kapital verfügt, um möglichen gesellschaftlichen Sanktionen zu begegnen. Allerdings ist diese Sicherheit ziemlich prekär und im Wesentlichen an den Besitz gesellschaftlicher Macht gebunden. Sobald die Kapitalien schwinden, und das kann bereits erfolgen, wenn nur eine ideologische Neubewertung z.B. des kulturellen Kapitals einsetzt, wird sich die als überwunden geglaubte Stigmaeigenschaft in den Handlungsbezügen der Individuen wieder manifestieren. Die Geschichte kann viele Bespiele liefern, bei denen Emanzipationsprozesse wieder rückgängig gemacht wurden. Die Bildung der Identität ist in einen gesellschaftlichen Kontext gestellt. Dabei geht es um die Übernahme gesellschaftlicher Handlungsmuster mit der Zielsetzung, das Individuum selbst zu einem handlungsfähigen Gesellschaftsmitglied werden zu lassen. Die klassischen Autoren hatten eine recht statische Vorstellung von Gesellschaft, die auf der Grundlage scheinbar unveränderlicher Werte funktionierte, und eine „Identität im Sinne von Einzigartigkeit, Wahrhaftigkeit und Konsequenz“5 hervorbrachte. Damit konnte das Individuum auch in krisenhaften Umbrüchen einheitlich und handlungsfähig bleiben und in verschiedenen Situationen unverwechselbar und konsistent handeln. Die Menschen der fortgeschrittenen Moderne sind jedoch keine ausschließlichen Rollenträger, die ein bestimmtes, eine gesellschaftlich geprägte Identität generierendes Verhal5 Abels 2001 (Bd. 2), S. 230 12 tensrepertoire abspulen. Ihre Lebenswelt unterliegt vielmehr einer fortwährenden Dynamik, und das Individuum, das soziale Anerkennung begehrt, muss auf der Hut sein, dass es die konkreten Erwartungen immer richtig deutet. Und da die Gesellschaft nicht statisch ist, kann auch die individuelle Antwort des Individuums nicht immer dieselbe sein. Die Identität kann nur problemlos existieren, wenn das Individuum seine persönlichen Züge, die sich als persönliche Identität artikulieren, in ein Arrangement mit den sozialen Zumutungen bringt. Man kann das als ein dynamisches, sich immer wieder selbst stabilisierendes Gleichgewichtssystem ansehen. Krappmann hat dies auch als „balancierende Identität“ bezeichnet. Das Herstellen der Balance liegt in der Fähigkeit begründet, einerseits den sozialen Anforderungen gerecht zu werden und somit ein akzeptiertes Gesellschaftsmitglied zu sein, andererseits seinem eigenen Bedürfnis nach Einzigartigkeit und Authentizität Rechnung zu tragen. Dies allein ist schon eine schwierige Aufgabe, der sich das Individuum zu stellen hat. Sie wird jedoch noch dadurch erschwert, dass dem Individuum der fortgeschrittenen Moderne keine einheitlichen Erwartungen gegenübertreten. Vielmehr ist es ein Zeichen der Zeit, dass die Gesellschaft mit ihren Anforderungen und Erwartungen uneinheitlich erscheint. Und wenn dies noch immer nicht genug wäre, so ist noch zusätzlich festzustellen, dass immer mehr Individuen, die unter diesen Bedingungen sozialisiert wurden, keine Gewissheit besitzen, welche der von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Verhaltensoptionen die Richtige wäre. Eine haltgebende Erziehung, in der Werte vermittelt werden und die auf der Basis sozialer und emotionaler Absicherung erfolgt, haben sie nämlich nicht erfahren, weil sie, wie schon erwähnt, ihre Erfahrungen außerhalb sozialer Zusammenhänge (wie z.B. Familien, Verwandtschaftsnetzwerken, kirchlichen Jugendorganisationen) machen mussten. 13 Die Institutionen, die in der Lage sind, Stabilität zu vermitteln, wie die Familie, haben an Bedeutung verloren, so dass die Sozialisation vieler Menschen unter keinen günstigen Vorzeichen geschieht. Der Verlust an Stabilität ist auch ein Kennzeichen der Erwachsenenwelt. Viele Menschen leben zunehmend vereinzelt. Sie erleben ihr Dasein als zum großen Teil fremdbestimmt und sind gezwungen, ihr Leben ausschließlich nach den Dispositionen ihrer Erwerbsarbeit auszurichten. Viele Menschen müssen noch um das geringste Maß an mitmenschlicher Zuwendung kämpfen, da prinzipiell nichts mehr selbstverständlich, nichts mehr beständig ist. So gesehen betrachte ich den vereinzelten Menschen als den Außenseiter der fortgeschrittenen Moderne. Stigmata im klassischen Sinn haben an Relevanz verloren, weil in dieser Gesellschaft der unausgesprochene Konsens besteht, dass jegliche Abweichung irgendwie „normal“ sei und nicht weiter störe. Wenn Menschen ehedem, durch irgendwelche biographischen Handikaps, in Bezug auf ihre soziale Selbstverwirklichung benachteiligt waren (z.B. weil sie „nichtehelich“ geboren wurden), so sind solche Stigmata in den Zeiten der fortgeschrittenen Moderne vergleichsweise bedeutungslos geworden. Wie ein massiver Befreiungsschlag hat die Pluralisierung und Vervielfältigung gesellschaftlicher Werteoptionen dazu geführt, die Kontingenz moralischer Urteile hervorzuheben. Immer mehr Menschen bekennen sich zu bestimmten Einstellungen, Haltungen, aber auch Gebrechen, die ihnen in früheren Zeiten, noch vor zehn Jahren vielleicht, zu Ausgrenzung und Marginalisierung verholfen hätten. Dies konnte aber nur gelingen, weil sich der Außenseiter tendenziell außerhalb der imperativen Ordnungsfunktion sozialer Institutionen bewegt. Der Preis, den er oft genug zu zahlen hat, ist neben der allgemeinen Verunsicherung im Hinblick auf mögliche Lebensrisiken die Vereinsamung. Nicht jeder, der von solchen Entwicklungen betroffen ist, neigt zu solchen drastischen Reaktionen wie der Täter von Erfurt. Gewalthandlungen sind auch eher typisch für bestimmte jugendliche Subkulturen. Aber andere Reaktionsformen sind weit verbreitet und würden für sich schon genügen, um unter eine von 14 Goffmans Stigmakategorien zu fallen, am ehesten wahrscheinlich in die Kategorie, der „individuellen Charakterfehler“. Sie sind aber, da sie so häufig auftreten und in manchen Fällen vielleicht sogar so erwünscht sind (nach der Maxime, dass ein „Spleen“ nicht schaden kann, sondern dazu geeignet ist, den Menschen erst interessant zu machen), absolut „normal“ geworden. Die Gesellschaft hat sich an solche Entwicklungen gewöhnt und duldet es, dass z.B. anlässlich von „Love-Parades“ Menschen im öffentlichen Raum ein Verhalten zeigen, das ihnen noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit bis hin zu Haftstrafen eingebracht hätte. Von ihrer ursprünglichen Intention sollen diese Auftritte den Nonkonformismus und die Originalität der Beteiligten in ihrem subkulturell geprägten Lebensstil einer verblüfften Öffentlichkeit unter Beweis stellen. Aber die schiere Masse der Beteiligten macht deutlich, dass es sich um nichts weniger als um Originalität und Einzigartigkeit handelt, die im Rahmen solcher Veranstaltungen paradiert wird. So scheitert der Wunsch nach Einzigartigkeit kläglich an der unausgesetzten Bereitschaft der Gesellschaft, Einzigartiges zu kopieren und zu vermassen. Leider ist es aber nicht so, dass die Überwindung von Stigma als Instrument der Exklusion dazu beitragen würde, dass die Gesellschaft keine Außenseiter mehr hätte. Die Kriterien, die Menschen zu Außenseiter werden lassen, haben sich gewandelt und orientieren sich fast ausschließlich an materiellen Gesichtspunkten. Dies ist die Folge des relativen Bedeutungsverlustes moralisch determinierter Werte und damit einhergehend der Schwächung gesellschaftlicher Institutionen: die Schwächung der inkludierenden Institutionen hat es mit sich gebracht, dass immer mehr Menschen zu Außenseitern werden. Im ersten Teil des folgenden Textes findet sich der Versuch, anhand verschiedener theoretischer Ansätze zu erforschen, was das Kennzeichnende von Außenseiteridentitäten ist. Dabei handelt es sich zunächst um klassische Konzepte, die in nahezu dogmatischer Weise gelingende Identitätsentwicklung in einen Zusammenhang von Konformität mit gesellschaftlichen Vorgaben stellen. Dies gilt für die psychoanalytische Theorie Eriksons und die identitätstheoretischen Aspekte der strukturfunktionalis15 tischen Theorie von Parsons. Dies gilt auch für die Sozialisationstheorie George Herbert Meads, jedoch mit der Einschränkung, dass Mead dem Individuum einen Rest an Individualität zugesteht, der als Persönlichkeitsinstanz des „Ich“ die Gewähr dafür liefert, dass gesellschaftliche Vorgaben und individuelle Regungen nicht absolut deckungsgleich sind. Die klassischen Identitätskonzepte sind vielfach von anderen Autoren aufgenommen und vor dem Hintergrund verschiedener Weiterentwicklungen in der theoretischen Diskussion reformuliert worden. Ich habe exemplarisch auf theoretische Aussagen von Merton (hinsichtlich des Zusammenhanges von Identität und abweichendem Verhalten), Goffman (hinsichtlich der Identitätskonzepte aus der interaktionistischen Perspektive und damit verbundene Stigmakonzepte) und Krappmann (hinsichtlich des Konzeptes der balancierenden Identität als Identitätserfordernis in der Moderne) Bezug genommen. Die Habitustheorie von Bourdieu liefert einen alternativen Erklärungsansatz für die Übernahme von Vorgaben der sozialen Umwelt in das Selbstkonzept des Individuums. Sie widerspricht damit interaktionistischen Postulaten, wonach das Individuum in Reaktion und Antizipation der Folgereaktionen seine Identität fortwährend neu entwirft und liefert damit eine Erklärung, weshalb Individuen einen Außenseiterstatus, der sich in ihrem Bewusstsein verfestigt hat, oft nicht überwinden wollen, obwohl sie es möglicherweise könnten. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Perspektive der gesellschaftlichen Einflussnahme auf die Identitäten der Gesellschaftsmitglieder vertieft. Sozialisation bedeutet eine Prägung des Individuums nach gesellschaftlichen (Wert)vorgaben. Dies geschieht in Institutionen. Und wenn diese Prägung nicht problemlos verläuft, etwa über Mechanismen der Internalisierung, wie Parsons und Mead behaupten, erfolgt die Anwendung von Machtmitteln. Da sich jedoch die Pluralität von Bewertungen als Perspektive in der fortgeschrittenen Moderne durchsetzt, sind die Mechanismen der Aufrechterhaltung einer einheitlichen gesellschaftlichen Ordnung und damit der Generierung integrierter Identitäten geschwächt. 16 1. Identitätsentwicklung in der psychoanalytischen Theorie Eriksons Die klassische Psychoanalyse ist nicht nur eine theoretische Konzeption zur Erforschung des psychischen Apparates und des Zusammenspiels seiner Instanzen sowie eine therapeutische Methode zur Behandlung von Neurosen und Psychosen. Die psychoanalytische Theorie beinhaltet auch ein theoretisches Sozialisationsmodell, soweit es um die phasenweise Genese des seelischen Apparates geht. Dabei wird die Triebenergie im Laufe der Entwicklung zunehmend moduliert, so dass am Ende, mit der Ausbildung des „Über-Ich“, die natürliche Triebhaftigkeit einer inneren Instanz begegnet, die die Werte und Normen der Gesellschaft repräsentiert und dem Individuum Triebverzicht gebietet. Das Modell einer phasenbezogenen Entwicklung des Individuums (orale, anale, genitale Phase, Latenz und Adoleszenz) wird auch in Eriksons Sozialisationstheorie benutzt. Im Vergleich zum Sozialisationsmodell in der klassischen Psychoanalyse folgt in der psychoanalytischen Theorie Eriksons die Entstehung von Ich-Identität zwar ebenfalls einem innerpsychischen Prozess, der jedoch nachhaltiger von kulturspezifischen Gegebenheiten und gesellschaftlichen Beeinflussungen geprägt ist. Somit ist diese Theorie nicht rein psychoanalytisch, denn die soziologische Komponente der psychischen Beeinflussung behält ihre Bedeutung, wenn auch nur in dem Sinne, dass sie den vorhandenen endogenen Potentialen eine bestimmte Richtung gibt. Von dieser äußeren Beeinflussung im Sinne von Werten und Normen hängt es auch ab, ob sich ein Individuum regelrecht entwickelt, oder ob es zum gesellschaftlichen Außenseiter wird. Erikson geht davon aus, dass das menschliche Leben in acht Phasen unterteilt ist, die jeweils verschiedene Lebensabschnitte mit den für sie spezifischen psychosozialen Merkmalen umfassen. Die Lebensabschnitte sind durch bestimmte Aufgaben gekennzeichnet. Erikson beschreibt sie auch als Krisen, die Wandel und Veränderung zeitigen. Diese phasenbezogene Folge des Lebens- 17 zyklus wird von Erikson in einem „epigenetischen Diagramm“ zusammengefasst.6 Die folgende tabellarische Darstellung habe ich um die von Erikson so genannten „Tugenden“ ergänzt, das heißt um die Qualifikationen, die das Individuum erwirbt, wenn es die phasenspezifische Krise erfolgreich bewältigt, sowie die Handlungsorientierung, die das Individuum als phasenspezifische Fähigkeit erlernen muss: Phase Krisen Säuglingsalter, entspricht der oralen Phase Kleinkindalter, entspricht der analen Phase Spielalter, entspricht der infantil-genitalen Phase Schulalter, entspricht der Latenzzeit Urvertrauen gegen Misstrauen Autonomie gegen Scham und Zweifel Initiative gegen Schuldgefühl Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl Adoleszenz, entspricht der Pubertät Frühes Erwachsenenalter, entspricht der Genitalität Erwachsenenalter Identität gegen Identitätsdiffusion Intimtität gegen Isolierung Reifes Erwachsenenalter Generativität gegen Selbstabsorption Integrität gegen Lebensekel Tugenden/psychosoziale Handlungsorientierungen Hoffnung (gegeben bekommen und geben) Wille (halten und lassen) Zielstrebigkeit (tun und „tun als ob“) Tüchtigkeit (etwas „Richtiges“ machen, etwas mit anderen zusammen machen) Treue (wer bin ich, und wer bin ich nicht) Liebe (sich im anderen verlieren und finden) Fürsorge (schaffen und versorgen) Weisheit (sein, was man geworden ist und wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird) Bis zur fünften Phase entsprechen die von Erikson postulierten Lebensphasen den psychosexuellen Entwicklungsstufen der psychoanalytischen Entwicklungstheorie Freuds. Als krisenhaft erweisen sich jeweils die phasenspezifisch bedeutendsten Entwicklungsprobleme, deren Lösung im günstigen Fall zu der Überwindung der bisherigen Phasenzugehörigkeit und dem Erreichen eines neuen Niveaus führt. Bei de Levita heißt es mit Bezug auf diesen Entwicklungsprozess, der zum Erwerb der IchIdentität führt, dass „jede neue Fähigkeit des Kleinkindes nicht nur eine undifferenzierte ‚Funktionslust‘ involviert, sondern dass damit die Verbindung zwischen dem Kind und der Gesellschaft 6 vgl. Erikson 1959, S. 151 und 214f. 18 fester geknüpft wird.“7 Dies ist der sozialisationstheoretische Gehalt der Entwicklungstheorie Eriksons. Die Identitätsgenese des Menschen ist eine wesentliche Herausforderung der fünften Phase, der Adoleszenz. Sie baut dabei auf davorliegende Entwicklungsphasen auf. Identitätsbildung ist ein Ergebnis des Erreichens einer bestimmten Stufe einer ontogenetischen Entwicklungsfolge. Erikson schreibt über diesen Zusammenhang Folgendes: „(Mit „Ich-Identität“) sollte ein spezifischer Zuwachs an Persönlichkeitsreife angedeutet werden, den das Individuum am Ende der Adoleszenz der Fülle seiner Kindheitserfahrungen entnommen haben muss, um für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüstet zu sein.“8 Jede der zu durchlaufenden Phasen ist durch die Auseinandersetzung des Individuums mit seiner sozialen Umwelt bestimmt, also durch die Dialektik endogener (psychosexueller) und exogener (psychosozialer) Faktoren. Somit kann sich Identität, wenn sie am Ende der Adoleszenz geschaffen wurde, in späteren Lebensphasen wandeln, aber immer auf der Grundlage des als Ergebnis der Adoleszenz gebildeten Identitätsentwurfs. Damit wird die sozialisationstheoretische Dimension der Theorie deutlich: Identität ist unter anderem abhängig von den äußeren sozialisatorischen Einflüssen auf das Individuum und den damit verbundenen Konflikten, den Selbstidentifikationen mit wichtigen Bezugspersonen und der Art, wie Problemlösungsstrategien angeeignet und soziale Verhaltensmuster verinnerlicht werden, die dazu führen, dass das Individuum, dessen Identitätsgenese „erfolgreich“ im Sinne der Theorie verlaufen ist, als Mitglied der Gesellschaft integrierbar ist. Im Unterschied zu der klassischen psychoanalytischen Theorie sind die exogenen Faktoren der sozialen Umwelt zumindest gleichwertig. Ohne sie nimmt der Entwicklungsprozess nicht den gewünschten Verlauf bzw. kommt zum Stillstand, oder es erfolgt sogar eine Regression. Während Freud die Entwicklung der Persönlichkeit in den ersten Lebensphasen als quasi somatisch induzierten Automatismus beschrieben hat, ist von Erikson die Bedeutung der sozialen Umwelt in besonderer Weise hervorgehoben worden. 7 8 de Levita 1965, S. 71 Erikson 1959, S. 123 19 Ein weiterer Unterschied zur Psychoanalyse Freuds liegt darin begründet, dass Erikson erkannt hat, dass die menschliche Persönlichkeit im Laufe ihrer Entwicklung nicht an einem bestimmten Punkt stehen bleibt, sondern dass es bis ins Alter Weiterentwicklungen gibt, die stets in Auseinandersetzung und Wechselwirkung mit der sozialen Umwelt stattfinden. 1.1. Persönliche und soziale Identität in der Psychoanalyse Erikson unterscheidet zwischen persönlicher Identität und sozialer bzw. Gruppen-Identität. Bei dem Konzept der persönlichen Identität handelt es sich um die „unmittelbare Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und der damit verbundenen Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen.“9 An diesem Zitat wird deutlich, wie hoch Erikson den Einfluss der sozialen Umwelt auch auf den psychischen Apparat des Individuums gewichtet. Im engeren Sinne manifestiert sich die soziale Komponente der Identität in der Mitgliedschaft in einer Gruppe und den damit verbundenen Identifikationen auf der Seite des Individuums und den sozialen Erwartungen auf der des Kollektives. Diesen Zusammenhang bezeichnet Erikson als „soziale oder Gruppen-Identität“. Dafür steht das folgende Zitat: „Menschen, die derselben Volksgruppe angehören, in derselben geschichtlichen Zeit leben oder auf dieselbe Art und Weise ihr Brot verdienen, werden auch von gemeinsamen Vorstellungen von gut und böse geleitet. Diese Vorstellungen spiegeln in unendlicher Variation das Unbegreifbare des historischen Wandels wider, und dennoch nehmen sie für die Ich-Entwicklung jedes Einzelnen in Gestalt der herrschenden soziologischen Modelle und Leitbilder von Gut und Böse sehr konkrete Formen an.“10 Erikson teilt eine soziologische Annahme, die auf Durkheim zurückgeht, wonach die Gruppe oder das Kollektiv als gesellschaftliche Institution, in der Menschen mit einem Teil ihrer Identität geprägt werden, von wesentlicher Bedeutung ist, kurz: Identitätsbildung geschieht im Kollektiv. Das Kollektiv induziert eine bestimmte Haltung, die von Durkheim als Kollektivbewusstsein bezeichnet wurde. Ohne späteren 9 Erikson 1959, S. 18 Erikson 1959, S. 11 10 20 Ausführungen dazu in dieser Arbeit vorgreifen zu wollen, sei an dieser Stelle Folgendes angemerkt: das Kollektivbewusstsein ist die „Summe der sozialen Vorstellungen“11, die für die Gesellschaftsmitglieder handlungsleitend sind. Sie sind die Grundlage gesellschaftlicher Ordnung und damit auch der Sozialisationsinhalte, die im Prozess der Identitätsgenese von maßgeblicher Bedeutung sind. Die Elemente des Kollektivbewusstseins entstehen aus der Erfahrung der Solidarität, die sich Gesellschaftsmitglieder entgegenbringen müssen, wenn sie in einer arbeitsteiligen Welt überleben wollen. So wachsen die Menschen in gesellschaftliche Strukturen hinein, die ihnen vorgegeben sind. Ihre Erziehung erfolgt in ausdrücklicher Beachtung und Respektierung gesellschaftlicher Vorgaben. Erikson bezeichnet diesen Erziehungsprozess als „Erziehung zur Gruppen-Identität“ und als „die Art und Weise, wie eine Gruppe ihre grundlegenden Formen der Organisierung von Erfahrung“ dem Individuum vermittelt.12 Und bei de Levita liest man über die Funktion der Gruppen-Identität: „Solange eine Gruppenidentität dazu in der Lage ist, die verschiedenen und widersprüchlichen Elemente der Kultur zu ‚decken‘, kann das Individuum seinem Leben durch seine Teilhabe an der Gruppenidentität einen Sinn geben, durch die es geformt wird und die es formen hilft, die es von seinen Eltern empfangen hat und seinen Kindern weitergeben wird. Wenn die Gegensätze und Widersprüche so groß werden, dass die Identität, weil sie keine synthetische Funktion mehr hat, verkümmern muss, folgt eine Existenzkrise mit Abwendung von der Realität.“13 Die Gesellschaft prägt aufgrund spezifischer sozialer Gegebenheiten die Interaktionsformen der Gesellschaftsmitglieder und definiert die sozialen Rollen. Die Gesamtheit dieser Strukturprinzipien umfasst die Gruppen-Identität des Kollektivs. Die Erziehung, die dazu beiträgt, das Individuum im Sinne dieser Gruppen-Identität zu sozialisieren, orientiert sich an den von dem Kollektiv definierten Werten. Folglich ist die Reproduktion dieser gesellschaftlichen Definitionen im Handeln des Individuums „eine erfolgreiche Variante einer Gruppenidentität“, 11 vgl. Abels 2001, Bd. 1, S. 130 Erikson 1959, S. 15 13 de Levita 1965, S. 70 12 21 die „im Einklang mit der Raum-Zeit und dem Lebensplan der Gruppe steht (aus der) das heranwachsende Kind ein belebendes Realitätsgefühl ableiten können (muss).“14 Solche Konzepte werden in anderen Theorien ähnlich beschrieben, worauf ich weiter unten noch zu sprechen komme. 1.2. Der Weg zur „gesunden“ Persönlichkeit Nach Eriksons Theorie ist die Entwicklung zu diesem positiven Identitätszustand (Erikson bezeichnet ihn auch als Kennzeichen einer „gesunden Persönlichkeit“) durch ein allmähliches Reifen und der damit verbundenen allmählichen Überwindung der bisher maßgeblichen Identifikationen aus der Kindheit geprägt. Der daraus resultierende Zuwachs an Kompetenzen ist von krisenhaften Entwicklungen begleitet, die nach der psychoanalytischen Theorie mit dem Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe vorerst enden. Dabei werden ältere Identifikationen und Problemlösungsmuster scheinbar unbrauchbar, neue Verhaltensmodi und Strategien werden ausprobiert und handlungsleitend. Dieser Verlauf wird als „Ich-Wachstum durch Krisenbewältigung“ bezeichnet. Erikson schreibt dazu: „Das menschliche Wachstum soll hier unter dem Gesichtspunkt der inneren und äußeren Konflikte dargestellt werden, welche die gesunde Persönlichkeit durchzustehen hat, und aus denen sie immer wieder mit einem gestärkten Gefühl innerer Einheit, einem Zuwachs an Urteilskraft und der Fähigkeit hervorgeht, ihre Sache ‚gut zu machen‘, und zwar gemäß den Standards derjenigen Umwelt, die für diesen Menschen bedeutsam ist.“15 Der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, der durch das „Niemandsland“16 der Adoleszenz führt, ist von einer physiologischen und psychologischen Metamorphose des Individuums begleitet, aus der auch eine veränderte Positionierung in der Gesellschaft folgt: „in der Pubertät werden alle Identifizierungen und alle Sicherungen, auf die man sich früher verlassen konnte, erneut in Frage gestellt, und zwar wegen des raschen Körperwachstums, das sich nur mit dem in der frühen Kindheit vergleichen lässt und dem sich jetzt die gänzlich neue Eigenschaft 14 Erikson 1959, S. 17 Erikson 1959, S. 56 16 Erikson 1959, S. 208 15 22 der physischen Geschlechtsreife zugesellt. Der wachsende und sich entwickelnde Jugendliche ist nun, angesichts der physischen Revolution in ihm, in erster Linie damit beschäftigt, seine soziale Rolle zu festigen.“17 Die Rollenfindung des jungen Menschen bedeutet in den hochentwickelten Gesellschaften, dass Jahre des Lernens und Geschultwerdens einsetzen, bevor eine endgültige gesellschaftliche Rollenfestlegung erfolgt. In dieser Zeit darf der junge Mensch mit verschiedenen Rollen experimentieren, damit seine soziale Entwicklung möglichst optimal verläuft. Gesellschaftliche Erwartungen, die einengend wirken könnten, treten in den Hintergrund. So schreibt Erikson: „Die einzelnen Kulturen gestatten und die einzelnen jungen Menschen brauchen eine mehr oder weniger anerkannte Karenzzeit zwischen Kindheit und Erwachsenenleben, institutionalisierte psychosoziale Moratorien, während welcher ein nunmehr endgültiger Rahmen für die ‚innere Identität‘ vorgezeichnet wird. (...) Man kann diese Periode als ein psychosoziales Moratorium bezeichnen, während dessen der Mensch durch freies Rollen-Experimentieren sich in irgendeinem der Sektoren der Gesellschaft seinen Platz sucht, eine Nische, die fest umrissen und doch wie einzig für ihn gemacht ist. Dadurch gewinnt der junge Erwachsene das sichere Gefühl innerer und sozialer Kontinuität, das die Brücke bildet zwischen dem, was er als Kind war, und dem, was er nunmehr im Begriff ist zu werden; eine Brücke, die zugleich das Bild, in dem er sich selber wahrnimmt, mit dem Bilde verbindet, unter dem er von seiner Gruppe (...) erkannt wird.“18 Diese Synthese ist die Basis für die Ich-Identität. Wenn dieses Experimentieren damit endet, dass der junge Mensch es vermag, sich in seiner sozialen Umwelt einen zu ihm passenden Platz zu erobern, wenn er also am Ende der Adoleszenz in einen Zustand gelangt ist, der ihm das Gefühl von Gleichheit und Kontinuität im Umgang mit den Anderen und in Bezug auf seine eigene Person verspüren lässt, erfährt er ein positives „Identitäts-Gefühl“. Dazu schreibt Erikson: „(Das Selbstgefühl) erstarkt zu der Überzeugung, dass das Ich wesentliche Schritte in Richtung auf eine greifbare kollektive Zukunft zu machen lernt und sich zu einem defi17 18 Erikson 1959, S. 106 Erikson 1959, S. 137f. 23 nierten Ich innerhalb einer sozialen Realität entwickelt. Dieses Gefühl möchte ich ‚Ich-Identität‘ nennen.“19 Das Erreichen dieses Zustandes gilt Erikson als Voraussetzung dafür, dass aus dem Individuum eine „gesunde Persönlichkeit“ wird. Die Funktion der Ich-Identität für das Individuum liegt darin, dass das mit ihr verbundene positive Identitätsgefühl als Voraussetzung für psychisches Wohlbefinden anzusehen ist, und diesem entspricht auch die Chance zu sozialer Eingebundenheit: „Psychologisch gesprochen ist eine allmählich sich anreichernde Ich-Identität das einzige Bollwerk gegen die Anarchie der Triebe wie gegen die Autokratie des Gewissens, das heißt der grausamen Gewissensstrenge, die das innere Residuum der einstigen Unterlegenheit des Kindes gegenüber seinen Eltern ist. Jeder Verlust an Identitätsgefühl setzt das Individuum wieder seinen alten Kindheitskonflikten aus.“20 In Anlehnung an die klassische Psychoanalyse könnte man „IchIdentität“ im Sinne Eriksons auch als den Besitz einer funktionierenden Ich-Instanz innerhalb des psychischen Apparates deuten. Freud hat dies als Voraussetzung für psychische Gesundheit und Stabilität definiert, da nur damit übermäßige Impulse des Es und des Über-Ich zurückgehalten werden können und eine problemlose Interaktion in der Gesellschaft möglich erscheint. Denn nur wenn das Individuum dieses positive Identitätsgefühl besitzt, kann es eine höhere Entwicklungsstufe erklimmen und zu für ein Menschenleben so wesentlichen und wichtigen sozialen Leistungen wie psychosozialer (nicht notwendig sexueller) Intimität und Vertrautheit mit Lebenspartnern, Familienmitgliedern und Freunden fähig sein. Die Identitätsbildung ist letztlich ein gesellschaftlicher Prozess, und das Individuum, das eine Ich-Identität im Sinne Eriksons besitzt, vereinigt seine psychischen Impulse mit gesellschaftlichen Forderungen in Abhängigkeit von den Möglichkeiten und Impulsen, den Freiräumen aber auch den Zwängen, die die Gesellschaft ihm gibt. 19 20 Erikson 1959, S. 17 Erikson 1959, S. 112f. 24 1.3. Identitätsdiffusion und negative Identität Im Rahmen seiner psychoanalytischen Studien beschreibt Erikson nicht nur die positiv verlaufende Identitätsentwicklung. Erikson hat auch als Therapeut negative Verläufe systematisch beschrieben, um Therapieansätze entwickeln zu können. Als negative, normabweichende Persönlichkeitsentwicklungen werden von Erikson insbesondere zwei Zustände benannt. Bei dem einen handelt es sich um eine komplexe Symptomatik, die mit dem Begriff Identitätsdiffusion zusammengefasst wird. Die andere Variante der negativen Identitätsentwicklung bildet die Hinwendung zu einer negativen Identität. Erikson beschreibt die Identitätsdiffusion als „vorübergehende oder dauernde Unfähigkeit des Ichs zur Bildung einer Identität“ sowie als „Zersplitterung des Selbstbildes (...), ein Verlust der Mitte, ein Gefühl von Verwirrung und in schweren Fällen die Furcht vor völliger Auflösung.“21 Dieser Zustand kann durch eine Überforderung des Individuums durch widersprüchliche und daher belastende Verhaltens- und Rollenerwartungen seiner Umwelt bewirkt sein: „Ein Zustand akuter Identitätsdiffusion wird gewöhnlich manifestiert, wenn der junge Mensch sich vor eine Häufung von Erlebnissen gestellt sieht, die gleichzeitig von ihm die Verpflichtung zur physischen Intimität (...), zur Berufswahl, zu energischer Teilnahme am Wettbewerb und zu einer psychosozialen Selbstdefinition fordern.“22 Die psychosoziale Überforderung, zumal wenn gesellschaftliche Haltungen disparat erscheinen, kann eine integrative Ich-Synthese und Identitätsbildung erschweren oder unmöglich machen. Nach dem Kernkonflikt „Identität gegen Identitätsdiffusion“23 folgt der Konflikt „Intimität gegen Isolierung“24. Diesen Zusammenhang beschreibt Erikson folgendermaßen: „Dass viele unserer Patienten ihren Zusammenbruch in einer Lebensphase erleiden, die eigentlich mehr dem frühen Erwachsenenalter als der späten Adoleszenz angehört, erklärt sich aus der Tatsache, dass oft erst der Versuch, sich in eine intime Freundschaft oder Riva21 Erikson 1959, S. 154 Fußnote 6 Erikson 1959, S. 155 23 Erikson 1959, S. 150f. Feld V/5 24 ebd. Feld VI/6 22 25 lität oder auch in sexuelle Intimität und Liebesverhältnisse einzulassen, die latente Schwäche der Identität enthüllt. Ein wirkliches ‚Engagement‘ an andere ist das Ergebnis und zugleich die Prüfung der festumrissenen Selbst-Abgrenzung. Wo sie noch fehlt, hat der junge Mensch gelegentlich ein eigentümliches Gefühl von Spannung, als ob ein solches Probe-Engagement zu einer Fusion und damit zum Verlust von Identität führen könnte. Daraus folgt eine krampfhafte innere Zurückhaltung, ein vorsichtiges Vermeiden von Verpflichtungen.“25 Erikson bezeichnet diesen Zusammenhang auch als Identitäts-Problem und meint damit, dass „die Entwicklung psychosozialer Intimität nicht möglich ist ohne ein gesichertes Identitätsgefühl.“26 Neben der Unfähigkeit zur Intimität zeigt sich auf dieser psychoanalytisch-individualistischen Ebene die Diffusion der Zeitperspektive.27 Sie ist gekennzeichnet durch den Verlust des Zeitgefühls und Verlangsamung aller Lebensvollzüge und der Tendenz zur „Fristgewinnung durch Unterlassung“, die jeglicher sozialen Rollenerwartung zuwiderläuft.28 Weiterhin zeigt sich nach Erikson eine Diffusion des Werksinnes, die sich in einer Arbeitslähmung äußert29: „Patienten mit schwerer Identitätsdiffusion leiden regelmäßig auch an einer akuten Störung ihrer Leistungsfähigkeit, und zwar entweder in der Form, dass sie unfähig sind, sich auf irgendwelche Arbeit zu konzentrieren, oder in Gestalt einer selbstzerstörerischen, ausschließlichen Beschäftigung mit irgendwelchen einseitigen Dingen.“30 Und an anderer Stelle schreibt Erikson: „Die extreme Arbeitslähmung ist die logische Folge eines starken Minderwertigkeitsgefühls; in Fällen der Regression bis zum Ur-Misstrauen erstreckt es sich auf alles, was man mitbekommen hat. Dieses Minderwertigkeitsgefühl entspricht natürlich fast niemals einem wirklichen Mangel an Begabung, sondern eher den unrealistischen Forderungen eines Ich-Ideals, das nur durch Allmacht oder Allwissen zu befriedigen wäre. Es kann aus der Tatsache entsprungen sein, dass das Individuum in seiner un25 Erikson 1959, S. 156f. Erikson 1959, S. 186 27 Erikson 1959, S. 150f Feld V/1 28 vgl. Erkson 1959, S. 159f. 29 Erikson 1959, S. 150f. Feld V/4 30 Erikson 1959, S. 161 26 26 mittelbaren sozialen Umwelt keinen Platz für seine wahren Gaben findet.“31 Aus diesen Beobachtungen ist der Schluss zu ziehen, dass eine Entwicklung, die zu keiner geglückten Überwindung des phasenspezifischen Problems der fünften Phase führt, neben den psychischen Problemen auch einen problematischen Eingang in ein eigenverantwortliches Leben als erwachsenes Gesellschaftsmitglied mit sich bringt. Jedenfalls können die zuletzt beschriebenen Defizite eine optimale Erfüllung der Rollenerwartungen verhindern. Eine Person, deren Identitätsentwicklung nicht „zu sich selbst“ führt, die es nicht vermocht hat, das zu erkennen, was sie ist und was ihr zusagt, wird es auch schwer haben, selbst wenn ihr ein psychosoziales Moratorium gewährt wird, einen für sie passenden Platz in der Gesellschaft zu finden. Dies gilt vor allem bei der Suche nach der passenden Berufsrolle und einer passenden Partnerschaftsrolle. Eine andere Variante negativer Identitätsentwicklung bildet die Hinwendung zu einer negativen Identität. Bei diesem Sachverhalt geht es nicht darum, dass das Individuum „nur“ Probleme mit einer von der Gesellschaft zugedachten Identität hat, die sich als behandlungsbedürftige Identitätsdiffusion manifestiert. Vielmehr handelt das Individuum auf der Grundlage eines Identitätskonzeptes, das ihm von seiner sozialen Umwelt gerade nicht zugedacht wurde. Das Individuum erwählt sich eine Identität als gesellschaftlicher Außenseiter: „(die Patienten) wählen eher eine negative Identität, das heißt eine Identität, die pervers nach denjenigen Rollen und Identifikationen greift, die ihnen in kritischen Entwicklungsstadien als höchst unerwünscht und gefährlich und doch bedrohlich naheliegend gezeigt worden waren.“32 Erikson beschreibt Fälle aus seiner therapeutischen Praxis, bei denen er die Hinwendung zu negativer Identität beobachtet hat und bemerkt, dass in besonderem Maße junge Menschen von einer solchen Entwicklung betroffen sind, die an den übertriebenen Erwartungen ihrer Eltern gescheitert sind. Die Wahl einer negativen Identität, etwa als Prostituierte oder als 31 32 Erikson 1959, S. 184f. Erikson 1959, S. 165f. 27 Drogenkonsument, ist nach Eriksons Ansicht Ausdruck einer „Rachsucht“ gegenüber den Eltern. Das Individuum rächt sich an seinen Eltern, weil es genau zu dem wird, wovor es von seinen Eltern stets gewarnt wurde. Oft geht dieser Entwicklung ein jahrelanges Bemühen voraus, es den Eltern oder der Familie irgendwie recht zu machen, bis zu einem Punkt, an dem das Individuum merkt, dass ihm die notwendigen Eigenschaften für dieses aufgestülpte Identitätskonzept fehlen, und es im Hinblick auf die Erwartungen seiner Familie resigniert: „Solche rachsüchtigen Entscheidungen zugunsten einer negativen Identität stellen natürlich den verzweifelten Versuch dar, mit einer Situation fertig zu werden, in welcher die vorhandenen positiven Identitätselemente einander aufheben.“ Denn unter solchen Bedingungen ist es leichter, „ein Identitätsgefühl aus der völligen Identifikation mit dem von der Umwelt am wenigsten Gewünschten oder Erwarteten zu gewinnen, als um ein Realitätsgefühl in jenen Rollen zu kämpfen, die zwar von der Umwelt anerkannt, aber dem Patienten mit seinen inneren Reserven nicht erreichbar waren.“33 Der therapeutische Ansatz wird in Eriksons Arbeit um einen sozialpsychologischen Aspekt erweitert, da Erikson beschreibt, wie sich die Hinwendung zu negativer Identität auch im Rahmen von Gruppenprozessen vollziehen kann. Das Individuum kann sich bestimmte sozial abweichende Ideen, Ideale und Ideologien aneignen und dabei auf Menschen stoßen, die seine Haltungen teilen. Wenn sich das Individuum mit den Zielen bestimmter abweichender Gruppierungen identifiziert und in ihnen aufgenommen wird, spricht Erikson von der Aneignung einer „negativen Gruppenidentität“, die er sogar als „bösartig“ bezeichnet.34 Gemeint ist die Mitgliedschaft in bestimmten subkulturellen Cliquen und Banden, die Zugehörigkeit zu bestimmten Milieus und die Übernahme der dort propagierten Gesinnung. Erikson bezeichnet diese Gruppen als „Pseudo-Gesellschaften“, die auf ihre Art und Weise es erreichen wollen, ihren Mitgliedern so etwas wie ein verlängertes psychosoziales Moratorium zu ermöglichen. Jedenfalls ersparen sie ihren Mitgliedern, dass sie 33 34 Erikson 1959, S. 167 Erikson 1959, S. 209 28 sich als „einsame Leidende“ in ihrer Identitätslosigkeit verlieren: es wird eine Konstituierung einer Identität angeboten. Diese ist jedoch abweichend von dem, was von der Gesellschaft mit ihren vorherrschenden Wertstrukturen erwartet wird. 1.4. Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft Eriksons Theorie geht über den psychoanalytischen Ansatz hinaus, denn er fragt nach den Strukturbedingungen der sozialen Umwelt und deren Wirkung auf die Identitätsbildung des Menschen. So ist bei Erikson Folgendes zu lesen: „Es könnte sein, dass die Beziehung zwischen den Wertsetzungen und Institutionen der Kulturen einerseits und den Mechanismen der IchSynthese andererseits doch eine systematischere ist und dass, jedenfalls vom psychosozialen Gesichtspunkt aus, die grundlegenden sozialen und kulturellen Prozesse nur als das gemeinsame Bemühen der erwachsenen ‚Iche‘ betrachtet werden kann, durch vereinte Organisationsleistung ein Maximum konfliktfreier Energie in einem sich wechselseitig stützenden psychosozialen Gleichgewichtssystem zu schaffen und zu erhalten. Nur eine solche Organisation ist imstande, dem jungen Ich bei jedem Entwicklungsschritt einen festen Halt zu geben.“35 Die Entwicklung des Individuums orientiert sich an der Bewältigung der psychosozialen Krisen. Das Individuum kann die positiven Qualitäten der Persönlichkeitsentwicklung (z.B. Intimität, Generativität und Integrität) aber nur in sozialen Zusammenhängen erwerben. Damit sind z.B. soziale Verbindungen wie Partnerschaft, Elternschaft und Familie gemeint. In der Isolation kann das Individuum die Tugenden der Lebensphasen jedenfalls nicht erreichen. In diesen sozialen Verbänden werden gesellschaftlichen Werte vermittelt, die von Erikson als „grundlegend und universal“36 bezeichnet werden. Dazu zählt er Liebe, Glaube, Wahrheit, Recht, Ordnung und Arbeit. Die verschiedenen Generationen, wie sie vor allem in den Familien zusammenkommen und miteinander interagieren, können einander im Idealfall davor bewahren, dass ihre jeweiligen psychosozialen Krisen negative Verläufe nehmen, dass also an35 36 Erikson 1959, S. 197f. vgl. Erikson 1959, S. 199 29 statt Identität eine Identitätsdiffusion greift, anstatt Intimität Isolierung, anstatt Generativität Selbstabsorption und anstatt Integrität der Lebensekel: „So braucht die ältere Generation die jüngere genauso, wie die jüngere von der älteren abhängig ist; und es scheint, als sei es gerade diese Wechselseitigkeit der Entwicklung von älteren und jüngeren Generationen, in der bestimmte grundlegende und universale Werte (...) mit ihrer ganzen Abwehr-, Kompensations- und Schöpferkraft, als wichtige gemeinsame Leistungen der individuellen Ich-Entwicklung und des sozialen Prozesses entstehen.“37 Erikson misst der Familie bzw. familienähnlichen Strukturen, in denen mehrere Generationen vertreten sind, eine besondere Bedeutung bei, zum einen, weil in dieser sozialen Struktur alle Beteiligten die Chance haben, ihre jeweiligen psychosozialen Krisen zu einem positiven Abschluss zu bringen, und zum anderen, weil in dieser sozialen Struktur die Weitergabe universaler gesellschaftlicher Werte erfolgt. In diesem Zusammenhang kommt eine dritte Perspektive zum Tragen, nämlich die Bedeutung der psychosozialen Entwicklung der Individuen für die Gesellschaft: „Es müssen sinnvolle Korrespondenzen zwischen den institutionalisierten Werten und den großen Krisen der Ichentwicklung bestehen, damit eine Gesellschaft ein Maximum konfliktfreier Energie für ihre besondere Gruppenidentität zur Verfügung hat.“38 Die Individuen werden also in Familien oder vergleichbaren sozialen Strukturen auf der Grundlage universaler gesellschaftlicher Werte sozialisiert. Die Gesellschaft wiederum ist darauf angewiesen, dass in ihr Individuen leben, die die universalen Werte der Gesellschaft verwirklichen. Nur auf dieser Basis erscheint Erikson ein weitgehend konfliktfreies Zusammenleben der Menschen möglich. Erikson zeigt sich in seinen Schriften von der Rechtmäßigkeit der Wertestrukturen der Gesellschaft überzeugt. Gleichwohl ist Erikson kritisch genug, den Zusammenhang von Wertorientierung und Identität als zumindest problematisch zu begreifen. Dies ergibt sich aus folgendem Zitat: „Bei der Suche nach den gesellschaftlichen Werten, die die Identität lenken, trifft man auf 37 38 Erikson 1959, S. 198f. Erikson 1959, S. 199f. 30 das Problem der Aristokratie, in der weitesten Bedeutung des Wortes, die die Überzeugung einschließt, dass die Besten eines Volkes regieren und dass diese Regierung das Beste in einem Volk entwickelt. Wenn der Jugendliche nicht zynisch oder apathisch werden soll, muss er auf seiner Suche nach einer Identität sich irgendwo überzeugen können, dass diejenigen, die empor gekommen sind, auch die Verpflichtung der Besten auf sich nehmen, nämlich die Ideale der Nation zu verkörpern.“39 Dennoch geht er davon aus, dass die Erziehung in der amerikanischen Gesellschaft grundsätzlich ihr sozialisatorisches Ziel erreicht, und zwar die wertbezogene Qualifizierung des Individuums zur Teilnahme an den gesellschaftlichen Prozessen. 1.5. Wissenschaftstheoretische Betrachtungen und kritische Anmerkungen Während die klassische Psychoanalyse abweichende Handlungstendenzen hauptsächlich mit aberranten Triebstrukturen oder ungelösten Konflikten der seelischen Instanzen, die zu psychotischen oder neurotischen Tendenzen führen, expliziert, bezieht Erikson mögliche Ursachen mit ein, die außerhalb des Individuums begründet sind, also einen gesellschaftlichen Ursprung haben. Erikson argumentiert in diesem Zusammenhang in einer Weise, die von soziologischen Theorien über soziale Abweichung verwendet wird, die als „interaktionistisch“ bezeichnet werden. Kennzeichnend für diese Theorien ist deren subjektorientierter Ansatz, das heißt, dass eine ausdrückliche Bezugnahme auf handelnde Individuen in einer sozialen Welt erfolgt. Deren mögliche soziale Abweichung wird nicht mit triebtheoretischen Besonderheiten o.ä. begründet, sondern ausschließlich mit bestimmten Interaktionsstrukturen. So nimmt Erikson bei seinem Identitätskonzept ausdrücklich auf G. H. Mead, dem Begründer dieser theoretischen Tradition Bezug40. Über jugendliche Außenseiter schreibt Erikson Folgendes: „Viele Jugendliche kommen mit der übernommenen, ihnen durch die unerbittliche Standardisierung der amerikanischen Jugend aufgezwungenen Rolle nicht zurecht und flüchten: lassen 39 40 Erikson 1959, S. 113f. vgl. Erikson 1959, S. 188 31 Schule oder Arbeitsplatz im Stich, bleiben nächtelang fort oder verkriechen sich in ausgefallene oder unzugängliche Stimmungen. (...) So mancher Jugendliche, der von seiner Umgebung zu hören bekommt, er sei ein geborener Strolch, ein komischer Vogel oder Außenseiter, wird erst aus Trotz dazu.“41 Der interaktionistische Aspekt der Theorie Eriksons liegt in dem aus dem „labeling approach“ ableitbaren Konzept, wonach die Devianz, die von einem Individuum praktiziert wird, eine Konsequenz der Anwendung von Regeln und Sanktionen auf den Täter ist und damit zusammenhängend der These, wonach man zum Außenseiter durch das gesellschaftliche Umfeld gemacht wird, sobald man erkennbar gegen bestimmte Erwartungen verstößt. Damit liegt ein Teil der theoretischen Aussagen, die Erikson im Zusammenhang mit der Entstehung von Außenseiteridentitäten trifft, scheinbar außerhalb psychoanalytischer Erklärungszusammenhänge, denn die ausschließlich soziale und interpretative Rekonstruktion gesellschaftlicher Zuweisungen, die eine Zuschreibung einer Außenseiteridentität bewirkt, ist mit endogenen Ursachen im Sinne psychischer Dysfuktionalität nicht zu erklären. Diese gehen vielmehr davon aus, dass Abweichung eine Folge einer Anomalie im Funktionsprozess des seelischen Apparates darstellt. Eine normativ-psychoanalytische Erklärung von Abweichung orientiert sich also an Kriterien, die objektiv gegeben sind und nicht sozial konstruiert werden. Es muss aber bewusst bleiben, dass erst eine Störung der endogenen Entwicklungsabläufe dazu führt, dass soziale Beeinflussungen dafür maßgeblich sein können, dass ein Individuum ein abweichendes Verhalten zeigt. Ein Mensch mit einer labilen Identitätsstruktur kann sich schwer gegen ungünstige soziale Bedingungen behaupten und ist in stärkerem Maße gefährdet, deviant zu werden, als ein Individuum mit einer stabilen Persönlichkeit. Erikson geht in seiner weiteren Argumentation auf Konzepte der Selbstetikettierung aufgrund der Zuschreibung bestimmter negativer Eigenschaften ein. Wenn negative äußere Zuschreibungen auf eine labile Identität, die nicht aufgrund eines konstruktiven 41 Erikson 1959, S. 110 32 Entwicklungsprozesses in sich ruht, treffen, werden diese äußeren Konzepte in die eigene Identität aufgenommen und von dem Individuum anerkannt, was einer Verfestigung einer Außenseiterposition gleichkommt und daher für diese Thematik von besonderer Relevanz ist: „Sowohl in psychotherapeutischen Behandlungen als auch in sozialen Reformbestrebungen enthüllt sich immer wieder die traurige Wahrheit, dass in jedem auf Unterdrückung, Ausstoßung und Ausbeutung beruhenden System der Unterdrückte, Ausgestoßene und Ausgebeutete unbewusst an das negative Leitbild glaubt, das zu verkörpern er von der herrschenden Gruppe gezwungen wird.“42 Bei diesen Gedanken hatte Erikson die Judenverfolgung in Europa in den dreißiger und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Sinne, die er als Zeitzeuge miterlebte und die ihm, nicht zuletzt, da er selber der nicht-eheliche Sohn einer jüdischen Mutter war, der in die USA emigrierte, ein massives Bewusstsein für die Nöte einer Existenz als gesellschaftlichem Außenseiter vermittelt hat. So spricht er von einer „jüdischen Identität“, deren „negatives Bild, (...) so wie es ein Julius Streicher gezeichnet hatte, kaum schlimmer sein kann (...) als das Bild, das mancher Jude von sich selbst in sich trägt.“43. Zusammenfassend kann man feststellen, dass Ich-Identität als Integrationsleistung der Persönlichkeit zu begreifen ist. Sie steht am Ende der krisenhaften Entwicklung der Identitätsgenese, in der das Individuum in der Auseinandersetzung mit seinen organisch begründeten Entwicklungsprozessen und den damit korrespondierenden sozialen Erwartungen steht. Letztere gerinnen im Laufe der Entwicklung des Individuums als Ergebnis wertbezogener Erziehungserfahrungen zu sozialen Rollen und gewinnen somit zunehmend an Bedeutung. Umgekehrt ist zu vermuten, dass Desintegration der Identität dazu beiträgt, dass ein Individuum zum gesellschaftlichen Außenseiter wird. Denn aufgrund seines Versagens, die Integration gesellschaftlicher Ansprüche in der Persönlichkeit zu erreichen, entsteht ein Zustand, in dem die persönliche und die soziale (Gruppen-)Identität auseinanderfallen. Dann droht anstatt 42 43 Erikson 1959, S. 29 Erikson 1959, S. 30 33 einer positiven Identitätsentwicklung eine Identitätsdiffusion bis hin zur Annahme einer negativen Identität mit all den Konsequenzen, die eine Teilhabe an den gesellschaftlichen Prozessen erschweren. So wird nach Eriksons Theorie das Individuum zum gesellschaftlichen Außenseiter. Der „Automatismus“ der Identitätsentwicklung, der gewissen Verläufen, ob konformistisch oder deviant, eine Zwangsläufigkeit unterstellt, ist in dieser Theorie unübersehbar. Eriksons Theorie ist daher nicht ohne Kritik geblieben. Zu den gravierendsten Kritikpunkten zählt, dass Erikson die Differentiale des sozioökonomischen Umfeldes, in denen Kinder und Jugendliche sozialisiert werden, nicht ausreichend berücksichtigt. So wird der Eindruck erweckt, als wären die sozioökonomischen Randbedingungen in ihren je spezifischen Auswirkungen gleichsam unbeachtlich und eine Entwicklung zur Normalität oder Devianz jeweils gleichermaßen möglich. Dadurch wird eine Gesetzmäßigkeit der Normalitätsentwicklung unterstellt, die, wenn das Individuum an derselben scheitert, dazu führt, dass das Scheitern stets nur mit der Unzulänglichkeit seines psychischen Apparates erklärt werden kann und niemals mit den Widersprüchen der Gesellschaft selbst. Auf eine andere Schwachstelle weist Krappmann hin, derzufolge Eriksons Identitätskonzept zu einseitig auf Konformität ausgerichtet sei und nicht genug berücksichtige, dass es bisweilen für eine gesunde Identitätsentwicklung auch erforderlich sein kann, dass man gegen gesellschaftliche Erwartung verstößt. So schreibt Krappmann Folgendes: „Gewiss wünscht Erik H. Erikson nicht eine starre Identitätsstruktur, die es dem Individuum unmöglich macht, auf sich verändernde Verhältnisse einzugehen. Aber er grenzt sein Identitätskonzept programmatisch nur gegen die Gefahr der Identitätsdiffusion ab, nicht gegen die der Starrheit.“44 In der Tat hat Erikson die Möglichkeit einer zu konformistischen Identitätsausprägung nicht thematisiert. Eine Person, deren Identität eine extrem konformistische Ausprägung besitzt, ist nicht in der Lage, Ambivalenzen und Widersprüche auszuhalten und gegebenenfalls im Dienste der eigenen Identität zu nutzen: „Erik44 Krappmann 1969, S. 91 34 sons Identitätskonzept weist auf keine Kraft hin, die Verhältnisse mitzugestalten. Es läuft letztlich auf Unterwerfung unter die herrschenden Verhältnisse hinaus.“45 Die Erkenntnis, dass sich das Individuum im Umgang mit den gesellschaftlichen Widersprüchen als flexibel erweisen muss, legt ein anderes Konzept von Ich-Identität nahe, als ein solches, das sich als distanz- und widerspruchslos im Verhältnis zur Gruppenidentität bzw. zur Gesellschaft per se erweist. Vielmehr kann ein Individuum gerade aus seiner Abweichung von gesellschaftlichen Erwartungen ein hohes Maß an Persönlichkeitsstärke beziehen und die psychosozialen Krisen konstruktiv bewältigen. Auf diese Zusammenhänge werde ich weiter unten im Rahmen der Diskussion zur Identitätsbehauptung nochmals eingehen. Eine andere Kritik hängt mit der theoretischen Fortentwicklung der kognitiven Psychologie zusammen. Dabei ist besonders die Theorie über Entwicklung moralischer Urteile von Lawrence Kohlberg hervorzuheben, die sich mit der handlungsleitenden Funktion der Entwicklungsstufen des moralischen Urteils befasst. Kohlberg geht davon aus, dass einhergehend mit der somatischen und der kognitiven Entwicklung des Menschen, eine sozialisationsgebundene Moralentwicklung besteht. Kohlberg postuliert drei Niveaus mit je zwei Stufen der Moralentwicklung: - ein vormoralisches Niveau, mit einer hedonistischen Orientierung; - ein konventionell-konformistisches Niveau mit einer Orientierung an wichtigen Partnern in Primärgruppen oder an den moralischen Geboten der Gesellschaft; - ein postkonventionelles Niveau mit vorherrschender Orientierung an Prinzipien, „die zwischen den Betroffenen entweder im Sinne eines Sozialkontraktes vereinbart oder unter Anlegung bestimmter Gerechtigkeitsgrundsätze autonom konstruiert werden.“46 45 46 Krappmann 1969, S. 92 Montada 1982, S. 752 35 Im Falle des vormoralischen Niveaus wird eine als moralisch unbedenkliche anzusehende Entscheidung nur durch den Wunsch nach Vermeidung drohender Strafen, der Angst vor mächtigen Autoritäten oder dem Zusammengehen mit eigenen Interessen begründet. Diese Orientierung ist nach Kohlbergs Auffassung typisch für Kinder, die noch nicht im Pubertätsalter sind. Die moralische Orientierung des zweiten Niveaus (konventionell-konformistisch) ist auf die Interessen wichtiger Sozialpartner und auf das übergreifende soziale System gerichtet: „Die Erfüllung eines gegebenen Ordnungs- und Rechtssystems, das die Rechte, Pflichten und Ansprüche aller regelt, wird zum obersten Gebot.“47. Das postkonventionelle Niveau liefert die Orientierung, die dazu geeignet ist, soziale Beziehungen und Systeme, deren moralische Gebote und insbesondere deren Herrschaftsverhältnisse kritisch zu hinterfragen. An den Ansprüchen der kognitiven und subjekttheoretischen Psychologie gemessen, kommt der „gesunde“ Persönlichkeitstyp im Sinne Eriksons, also jener Mensch, der eine erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung genommen hat, nicht über das konventionell-konformistische Niveau hinaus, da er ja gesellschaftliche Bewertungen unhinterfragt übernimmt und die möglicherweise damit zusammenhängenden Konflikte in krisenhaften Phasen immer im Interesse der Gesellschaft bewältigt. Vor diesem Hintergrund lässt sich feststellen, dass das Individuum, das eine „gesunde“ Identitätsentwicklung im Sinne Eriksons durchlaufen hat, als in moralischer Hinsicht nicht sehr reflektiert und viel zu unkritisch im Umgang mit gesellschaftlichen Widersprüchen angesehen werden muss. Auf diese kann das Individuum nur mit einer als pathologisch beschriebenen Identitätsentwicklung reagieren. Aber sind es nicht immer genau diejenigen gewesen, die sich um den Preis ihrer sozialen Integrität gegen gesellschaftliche Verhältnisse aufgelehnt haben und denen im Nachhinein ein hohes Maß an Moralität zugebilligt wurde? Andererseits kann man aus psychoanalytischer Sicht behaupten, dass mit der Ausbildung der Über-Ich-Instanz 47 Montada 1982, S. 753 36 der gesellschaftliche Standpunkt internalisiert wird und die gesellschaftskonforme Handlung somit zum eigenen Antrieb wird. Damit wird die Bedeutung gesellschaftlicher Sanktionen relativiert, weil die Sanktionsinstanz im Individuum selbst wirkt. Vor dem Hintergrund dieser Dialektik wird jedoch erneut deutlich, wie zweifelhaft die Theorie Eriksons gerade im Hinblick auf gesellschaftliche Widersprüche erscheint. 37 2. Identität als Sozialisationsergebnis in der strukturfunktionalen Theorie Die strukturfunktionale Theorie ist wesentlich von dem amerikanischen Soziologen Talcott Parsons entwickelt worden. Dabei geht es um die systematische Rekonstruktion der Bedeutung und Auswirkung sozialer Phänomene als Komponenten der Gesellschaft. Diese wird als ein sich selbst regulierendes System beschrieben, welches von den Wechselwirkungen der jeweils aufeinander bezogenen Strukturelemente geprägt ist. Jede Handlung der Gesellschaftsmitglieder hat eine funktionale Bedeutung für das System und ist in übergreifende Systemzusammenhänge eingebettet. Es gibt verschiedene Systemebenen (personales System, soziales System und kulturelles System), die jeweils eigene Systemprobleme besitzen, sich jedoch im Verhältnis einer Interdependenz befinden. So kann die Bildung von Identität nach der strukturfunktionalistischen Theorie in diesen interdependenten Systemzusammenhängen thematisiert werden: 1. als ontogenetische Entwicklungsfolge des Individuums als personalem System, 2. unter dem sozialisatorischen Einfluss des sozialen Systemes, in dem das Individuum lebt, 3. geprägt durch die gesellschaftlichen Werte und Normen des jeweiligen kulturellen Systems. Parsons stützt sich bei der Explikation des Sozialisationsprozesses auf die psychoanalytische Entwicklungstheorie von Freud: aus den primären Bedürfnissen des Kindes im Sinne einer motivationalen Energiequelle werden erste Objektbeziehungen, die sich wiederum im Verlauf der Sozialisation, unter dem Einfluss der sozialen Umwelt, zu sekundären Bedürfnisdispositionen bzw. Handlungsmotiven entwickeln. Die Bedürfnisse, die eine Folge der organischen Triebenergie sind, werden sozial überformt und gestaltet. In dieser Aussage weicht Parsons von Freuds triebtheoretischer Konzeption der „Es“-Instanz ab und macht damit das Primat des gesellschaftlichen Einflusses auf das Individuum deutlich. Der Entwicklungsprozess der Sozialisation wird auch von Parsons als eine Phasenfolge begriffen, wobei er das Phasen38 modell der klassischen Psychoanalyse in sein Theoriekonzept implementiert. Dabei erfolgt während der ersten Entwicklungsphasen (orale, anale, ödipale/genitale Phase) eine zunehmende Verinnerlichung kognitiver Elemente auf der Grundlage von bereits jeweils vorher internalisierten motivationalen Strukturen und emotionalen Objektbeziehungen. Im Verlaufe dieses Prozesses werden die wichtigsten Motive und Einstellungen geprägt und dabei die Verinnerlichung sozialer Objekte und die Internalisierung sozialer Werte und Normen vorgenommen. Die Psychoanalyse definiert diesen Prozess als die Konstitution der Ich-Instanz des Kindes und den Aufbau des Über-Ichs. Parsons bezeichnet diese Phase als „primäre Sozialisation“. In dem Entwicklungsabschnitt von der Latenzphase bis zur Adoleszenz erfolgt die Internalisierung von Objekten, Motiven und Einstellungen. Dabei entwickeln sich kognitive Kategorien und Begriffe. Parsons bezeichnet die Phase als „sekundäre Sozialisation“. Die Dynamik der ontogenetischen Entwicklung ergibt sich aus dem Zuwachs von Kompetenzen, wobei dieser Zuwachs jeweils phasengebunden in krisenhaften Entwicklungen kulminiert und eine Reorganisation auf höherer Ebene mit sich bringt. Parsons beschreibt diese Entwicklungfolge als: „first, that of disturbance of a previous stable state; second, that of integration into a new ‘plateau‘ state.“48 Die Stabilität der oralen Phase wird erschüttert durch den Zuwachs autonomer Selbstkontrolle des Kindes über seinen Körper: „This phase of the process, we presume, leads up to a new relatively stable plateau in which the child comes to play a more autonomous role in interaction with the mother.”49 Diese Autonomie führt zu einer besonderen Zuneigung zur Mutter, die sich von der der frühen Mutter-Kind-Symbiose der oralen Phase dadurch unterscheidet, dass das Kind die Mutter aktiv liebt. Dieser Stabilität der Beziehung folgt die ödipale Phase, als Reaktion auf die erlebte Gefährdung der Liebe zur Mutter durch die Rivalität mit dem Vater. Ihre Lösung erfolgt vorerst in der Latenz „as the assumption of a new level of integration in the family of orientation as a system in which an independent and 48 49 Parsons und Bales 1955, S. 42 Parsons und Bales 1955, S. 43 39 autonomous role is played not only toward mother, but toward father and siblings.”50 Schließlich endet auch die Latenzphase mit einer Krise, wonach das Kind im Rahmen der Entwicklung auch Bezüge außerhalb des partikularen familiären Systems finden muss. Dies ist gleichzusetzen mit dem Fortgang der sekundären Sozialisation: neue Erwartungen werden an das Individuum herangetragen, neue Rollen und damit neue Komponenten der Identität des Individuums. 2.1. Die Bedeutung der Familie als gesellschaftliche Instanz der Wertevermittlung Die sozialen Kontakte mit Eltern und Geschwistern, die das Interaktions- und Rollensystem der Gesellschaft repräsentieren, sind grundlegend für die beginnende Entwicklung eigener Handlungsstrukturen im psychischen System des Kindes. Parsons hebt die zentrale Bedeutung der Familie als Sozialisationsinstanz hervor: „the human personality is not ‘born’ but must be ‘made’ through the socialization process that in the first instance families are necessary. They are ‘factories’ which produce human personalities.”51 Das Kind verinnerlicht die sich komplementär ergänzenden Interaktionssysteme; die eigenen Handlungen und die seiner sozialen Umwelt werden zu wechselseitigen Interaktionszusammenhängen, aus denen sich gegenseitige Verhaltenserwartungen ergeben. Dies ist die Grundlage sich stabilisierender reziproker Verhaltenserwartungen im Sinne fester Rollenbezüge: „there are the expectations which concern and in part set standards for the behavior of the actor, who is taken as the point of reference; these are the ‘role-expectations‘. (...) A role then is a sector of the total orientation system of an individual actor which is organized about expectations in relation to a particular interaction context, that is integrated with a particular set of value-standards which govern interaction with one or more alters in the appropriate complementary roles.”52 50 Parsons und Bales 1955, S. 44 Parsons und Bales 1955, S. 16 52 Parsons 1951, S. 38f. 51 40 In den Rollen, die von Kiss als „Interaktionsverdichtung“ im Sinne von „Schaltstellen zwischen Individuum und Gesellschaft“53 bezeichnet werden, manifestieren sich gesellschaftliche Erwartungen, wie z.B. Wertorientierungen des kulturellen Systems. Für Parsons sind Werte „an element of a shared symbolic system which serves as a criterion or standard for selection among the alternatives of orientation which are intrinsically open in a situation.”54 Eine Rolle erfolgreich auszufüllen bedeutet, sowohl äußerlich als auch innerlich den Erwartungen und damit Werten der Gesellschaft entsprechend zu handeln: „A role is only possible as a unit of an integrated system of social interaction in so far as, the incumbent internalizes the value system which is constitutive of the relevant collectivity or other subsystem and held in common by its members.”55 Die Familie ist ein solches soziales Subsystem der Gesellschaft. Sie bringt dem Individuum gesellschaftliche Werte nahe: „The family then has a value-system which is a differentiated derivate of the common value system of the society as a whole, but which defines its system-goals and norms in a relatively specialized way relative, for instance, to a business firm, a political organization or a church.”56 So sind verbindliche Erwartungen und damit auch, in ihrer handlungsbezogenen Verdichtung, entsprechende Rollenstrukturen bereits in der Kernfamilie ausgeprägt. Parsons beschreibt vier idealtypische Status-Rollen in der Familie: Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Es erfolgt dabei eine funktionale Differenzierung, die von Parsons folgendermaßen beschrieben wird: „the structure of the nuclear family can be treated as a consequence of differentiation on two axes, that of hierarchy or power and that of instrumental vs. expressive function.”57 Parsons ordnet die familialen Rollen in einer Vier-Felder-Matrix an und sieht in Bezug auf die Familie, wie bei allen anderen 53 vgl. Kiss 1973, S. 176 Parsons 1951, S. 12 55 Parsons und Bales 1955, S. 167f. 56 Parsons und Bales 1955, S. 163 57 Parsons und Bales 1955, S. 45 54 41 sozialen Systemen, die Notwendigkeit, in Abgrenzung von der jeweiligen Systemumwelt, sich bestimmten systemimmanenten Problemen zu stellen, um das System am Leben zu erhalten. Diese Systemprobleme sind: - Adaption, das heißt Anpassung an die Systemumwelt, Bereitstellung von Ressourcen - Goal-Attainment, das heißt Anstreben, Verwirklichen der Ziele des Systems - Integration, das heißt Verknüpfung der Systemkomponenten und Kontrolle des Zusammenhalts - Latent pattern maintenance, das heißt Aufrechterhaltung und Bewahrung der Grundstruktur. Aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Aufgaben bildet sich die Kurzbezeichnung dieses Konzeptes, das von Parsons entwickelte „AGIL-Schema“, das Geltung im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit aller sozialen Systeme besitzen soll. Die Vier-Felder-Matrix, die die Funktionen der Familienmitglieder und deren Handlungsorientierungen wiedergibt, sieht folgendermaßen aus: Superior + (Power) Inferior – (Power) Instrumental Priority Expressive Priority Instrumental Superior Expressive Superior Father (husband) Instrumental Inferior Mother (wife) Expressive Inferior Son (brother) Daughter (sister) (Quelle: Parsons, Family..., S.46) „Instrumentalität“ im Sinne der o.a. Matrix beinhaltet eine Leistungs- und Problemlösungsorientierung, die mit der Rolle des Mannes einhergeht. Auf dieser Seite der Matrix sind der idealtypische Vater und der idealtypische Sohn angesiedelt: sie arbeiten Hand-in-Hand (unter der Präpotenz des Vaters) an der Lösung der materiellen und sozialen Zielsetzungen der Familie als sozialem System. Bezogen auf ihre Funktionen im „AGIL“Schema repräsentieren die männlichen Familienmitglieder 42 sowohl die A-(Problemlösungs-)Funktion: Anpassung an die Systemumwelt, Bereitstellung von Ressourcen, als auch die G(Problemlösungs-) Funktion: Zielerreichung. „Expressivität“ obliegt den weiblichen Mitgliedern der Familie. Nach Parsons’ Deutung besteht ihre Funktion darin, die von den Männern sekurierten materiellen und sozialen Mittel so einzusetzen, dass das soziale System der Familie Bestand hat und sich zu reproduzieren vermag. Die Rolle der Mutter ist von Dominanz geprägt. Parsons bezeichnet sie als „expressive virtuoso“ und „cultural expert.“ Die Tochter hat ihr und all den anderen in der Familie zu gehorchen. Ihre Rolle ist „willing and accomodating person“ und „loyal member.” Aus der Problemlösungsperspektive fällt den weiblichen Familienmitgliedern die I- und L-(Problemlösungs-)Funktion zu, das heißt Integration im Sinne von Zusammenfügen und Zusammenhalten der Systemkomponenten und Aufrechterhaltung und Bewahrung der Organisationsstrukturen des Systems. Die strukturfunktionalistische Theorie betont, innerhalb der Logik des normativen Paradigmas, die Beeinflussung des Entwicklungsprozesses „von Außen“. Es sind gesellschaftliche Werte und Normen und die hinter ihnen stehenden Sanktionsmechanismen, die sich zu gesellschaftlichen Normalitätserwartungen verdichten und unter Bezugnahme auf ein gesellschaftliches Rollensystem über Rollendefinitionen den Sozialisationsprozess maßgeblich beeinflussen. Parsons versteht Gesellschaft als ein vielfältiges System, dessen Mitglieder mehrere Rollen besitzen: „With increasing emphasis recent analytical work has borne in upon us the extreme importance of the fact that any large-scale social system (a society) should be considered not in a ‘monolithic‘ way, but as an intricate network of interdependent and interpenetrating subsystems. This has been one of the most important contributions of the concept of the role, to throw into relief the fact that the same individual participates in many social systems, not merely one; he has multiple roles.”58 58 Parsons und Bales 1955, S. 36 43 Aus der Perspektive des gesellschaftlichen Systems vollzieht sich der Rollenerwerb auf der Grundlage einer Allokation gesellschaftlicher Aufgaben in Form von Rollen. Das bedeutet zunächst, dass die Gesellschaftsmitglieder an die gesellschaftlichen Rollen herangeführt werden, soweit sie ihnen nicht „automatisch“ zufallen, wie z.B. die Geschlechtsrollen. Der Zuteilungsprozess erfolgt im Rahmen der Sozialisation und ist darauf gerichtet, dass die nachwachsenden Gesellschaftsmitglieder derart sozialisiert werden, dass sie sukzessive frei werdende soziale Rollen und gesellschaftliche Positionen von der älteren Generation übernehmen und positiv ausfüllen können. Als Aufgabe von Erziehung und Sozialisation betrachtet Parsons die Übernahme des Standpunktes des kulturellen Systems (das heißt die Werte und aus diesen abgeleitet die Normen der Gesellschaft) über das soziale System der Familie in das personale System des zu sozialisierenden Individuums. Man kann es auch so formulieren: Die Bildung der Persönlichkeit vollzieht sich, indem das Individuum immer mehr in das gesellschaftliche System integriert wird, indem es zunehmend mehr Rollen übernimmt. Parallel zu seinem physiologischen und kognitiven Entwicklungsprozess stehen immer mehr gesellschaftliche Erwartungen dem Individuum gegenüber und wandeln sich entsprechend seiner ontogenetischen Entwicklung. Da dies jedoch ein zweiseitiger Prozess ist, ist darauf hinzuweisen, dass sich umgekehrt auch dem Individuum immer mehr Möglichkeiten bieten, die seine Lebenswelt zunehmend ausweiten und die Enge und partikulare Strukturierung des Lebens in der Familie mit einer universaleren Orientierung ersetzen: „as he grows up, his changing place in the society resembles the successively widening waves which radiate from his initial position in his family of orientation. The process is inherently time-bound (...) He cannot participate in wider circles until he has fullfilled certain of the conditions official participation in the narrower ones.”59 59 Parsons und Bales 1955, S. 37 44 2.2. Handlungsalternativen und Motivation zu angepasstem Verhalten Parsons hat die Handlungsorientierungen, die Menschen besitzen können, in ein System gebracht. Er geht davon aus, dass kulturelle Wertorientierungen sich in den alternativen Handlungsmustern (pattern variables) niederschlagen. Diese werden allmählich im Verlauf der Sozialisation zu den für die Individuen maßgeblichen, von gesellschaftlichen Werten determinierten Orientierungsalternativen des Handelns, die sich aus den sozialen Rollen und deren Kontexten ergeben. In der Theorie handelt es sich um Alternativen, die sich auf der Handlungsebene auf einem Kontinuum wiederfinden. Parsons benennt fünf zueinander gehörende Variabeln, die jeweils alternative Endpunkte des Kontinuums darstellen. 1. Affektivität oder affektive Neutralität (handelt das Individuum in einer persönlichen Rolle, z.B. als Vater/Mutter oder Freund/Freundin, oder handelt es als Träger einer Berufsrolle, z.B. als Polizist) 2. Kollektivorientierung oder Selbstorientierung (handelt das Individuum im Interesse einer Gruppe, z.B. als Mitglied eines religiösen Ordens, oder nur in eigenem Interesse, z.B. als Kaufmann mit Gewinninteresse). 3. Partikularismus oder Universalismus (handelt das Individuum in einer Rolle, die seine Persönlichkeit nur teilweise umfasst, oder die umfassend ist, wie z.B. eine Berufsrolle im Gegensatz zu einer Mutterrolle) 4. Diffusität oder Spezifität (handelt das Individuum in undefinierten Interaktionszusammenhängen oder innerhalb fester Interaktionsstrukturen, wie z.B. geselliges Beisammensein im Gegensatz zu einer Arbeitssitzung) 5. Traditionelle Zuschreibung oder tatsächliches Leistungsverhalten (handelt das Individuum z.B. in seiner Berufsrolle als Priester oder als Akkordarbeiter). Die unterschiedlichen Handlungsorientierungen ergeben sich aus den sozialen Zusammenhängen, in denen das Individuum sozialisiert wurde, und dem aktuellen sozialen Zusammenhang, in dem sich das Ergebnis dieser Sozialisation zu bewähren hat. Man kann das mit Kiss als „funktional erforderliche Rollenerfüllung“ bezeichnen, deren Qualität von dem Ergebnis 45 der Wahl einer passenden Alternativlösung abhängt. Diese Wahl wird von den verinnerlichten Wertmustern beeinflusst, die sich im Persönlichkeitssystem nicht nur im Sinne einer Adaption an vorwaltende gesellschaftliche Handlungsorientierungen niederschlagen. Sie wirken auch auf die Emotionen des Individuums. Hinsichtlich der Bedeutungsfolge der pattern variables gibt es eine aufsteigende Rangfolge, die mit der sozialisatorischen Entwicklung des Individuums konvergiert und der Funktionalität des sozialen Systems dient. So kann man eine „Tendenz ausmachen, nach der Orientierungsalternativen letztlich entschieden werden sollen: damit das soziale System funktioniert, müssen partikulare in universelle, zuschreibende in leistungsbezogene, spezifische in diffus-allgemeine, affektive in neutrale und selbstbezogene in kollektive Orientierungen umgewandelt werden!“ 60 Man kann also feststellen, dass es der Gesellschaft dient, wenn die in ihr lebenden Individuen im Verlauf ihres Sozialisationsprozesses z.B. eine partikularistische Orientierung hinter sich lassen können und einen weiteren Horizont bei ihrem Handeln einbeziehen. Auf diese Weise handeln Gesellschaftsmitglieder auf der Grundlage gemeinsamer Werte und kommen in umfassender Weise den Erwartungen nach, die die Gesellschaft an sie richtet. In Ergänzung dazu erfolgt die Eingliederung des Individuums in die Gesellschaft nach Parsons’ Ansicht in der Art, dass der Sozialisationsprozess eine Motivation zur Integration erzeugt. Dies erfolgt, indem auf den Sozialisationprozess gerichtete Mechanismen sich ergänzen. So schreibt Parsons: „The first task is to set up a classification of the motivational mechanisms of the social system and to relate this systematically to the mechanisms of personality.“61 Als Mechanismen des personalen Systems, die die Sozialisation des Individuums gewährleisten, benennt Parsons Lernen, Verteidigung und Anpassung. Dazu schreibt er: „Learning is defined broadly as that set of processes by which new elements of action-orientation are acquired by the actor, new cognitive orientations, new values, new objects, new expressive 60 61 Abels 2001 Band 2, S. 142 Parsons 1951, S. 203 46 interests.”62 Parsons formuliert an dieser Stelle den Gedanken, dass das Lernen ein lebenslanger Prozess ist. Der Sozialisationsprozess ist also nicht nur auf die frühen Phasen des Lebens beschränkt: „Learning is not confined to the early stages of the life cycle, but continues throughout life.“63 Zum Verteidigungs-Mechanismus schreibt Parsons: „The mechanisms of defense are the processes through which conflicts internal to the personality, that is between different need-dispositions and sub-systems of them, are dealt with.” Damit verweist Parsons auf die Konflikte zwischen den seelischen Instanzen, die in der klassischen Psychoanalyse in sozialisationstheoretischer Hinsicht überwunden werden, wenn es der “Ich”- Instanz gelingt, Impulse des “Es” und des „Über-Ich“ solange zurück zu drängen oder zu modifizieren, bis eine gesellschaftlich erlaubte Form der Triebabfuhr möglich ist. Parsons zielt in seiner Argumentation auch auf einen sozial erlernbaren Umgang mit den „need-dispositions“, denn: „In the cases of complete resolution of such conflicts the mechanisms of defense merge into those of learning.“64 Der Anpassungsmechanismus umfasst die Prozesse, „by which the individual actor deals with elements of strain and conflict in his relation to objects, that is to the situation of action.”65 Wenn ein Individuum negative Erfahrungen macht - Parsons spricht von Spannungen und Konflikten - dient es der sozialen Integration, wenn das personale System diesen Mechanismus der Anpassung beherrscht, der darin zum Tragen kommt, dass die negativen Affektionen, die mit der Frustrationssituation einher gehen, irgendwann überwunden sein werden und das Individuum auch eine affektive Anpassung an seine Situation erreicht. Die Beherrschung der von Parsons benannten Mechanismen ist eine grundsätzliche Voraussetzungen für die soziale Integration des Individuums. Wenn sie nicht beherrscht werden, kann dies nur zur Folge haben, dass sich das Individuum außerhalb des sozialen Systems stellt, das heißt wiederum diejenigen Mecha- 62 Parsons 1951, a.a.O Parsons 1951, a.a.O. 64 Parsons 1951, a.a.O. 65 Parsons 1951, a.a.O. 63 47 nismen des sozialen Systems, die seine gesellschaftliche Integration verheißen, für sich nicht nutzbar machen kann. Die „need-dispositions“ sind eine bestimmte Motivation zu einem bestimmten Handeln im Interesse von letzlich körperlich definierten Bedürfnissen. Deren soziale Modifikation beinhaltet unter Verwendung der o.a. Mechanismen ein Überführen der ursprünglichen und ungeformten Impulse in sozial akzeptable Regungen, so dass das Individuum bei der Übernahme gesellschaftlicher Rollen nicht scheitern kann, weil abweichende Motivationen „verlernt“, abgewehrt und angepasst werden. Somit ist der Sozialisationsprozess mit der allmählichen Übernahme gesellschaftlicher Wertsysteme in die individuelle Bedürfnisstruktur zu erklären: „The central focus of the process of socialization lies in the internalization of die culture of the society into which die child is born. The most important part of this culture from this focal point consists in die patterns of value which in another aspect constitute die institutionalized patterns of the society.”66 Die Sozialisation des Individuums, die die gesellschaftskonforme Modifikation seines personalen Systems umfasst, befähigt und motiviert dieses zur Integration in das soziale System und seine Einbindung in die sozialen Mechanismen, die für die Zuteilung sozialer Rollen verantwortlich sind. Das gelingt aber nur, wenn das Individuum die Spielregeln der Gesellschaft verinnerlicht hat und sie insoweit auch akzeptiert und in seinem Handeln reproduziert. Diese Spielregeln sind wiederum im Rahmen der Erziehung und Ausbildung als gesellschaftliche Werte und Normen vermittelt worden und finden ihren Niederschlag in der Definition der sozialen Rollen. Kiss schreibt über den Zusammenhang von Sozialisation und Wertebezug: „Die Grundannahme des strukturfunktionalistischen Ansatzes basiert also auf dem ‚Willen zur Ordnung‘: So wie das Individuum ein originäres Interesse an der Stabilisierung seiner Beziehung zur Umwelt hat, hat auch ‚das System‘ ein originäres Interesse daran, sich funktionsfähig gestalten zu können. Das System setzt ‚standards‘ als Wegweiser für den geordneten Verlauf zwischenmenschlicher Beziehungen und 66 Parsons und Bales 1955, S. 17 48 Wertmuster als ‚Leitbilder‘ für die Chance der Internalisierbarkeit gewünschter Zielorientierungen. Angesichts der Grundannahme eines anthropologisch verstandenen und universal gültigen Strebens aller Menschen nach einem biologischen und normativen Gleichgewichtszustand müsste individueller ‚Wille‘ zu einer zieltendierten Handlung führen, die ‚normalerweise‘ die Übereinstimmung mit den kollektiv gesetzten Wertmaßstäben sucht.“67 Die Wertmuster des kulturellen Systems werden mit Hilfe des Sozialisationsprozesses, der zu ihrer Internalisierung führt, für das Individuum akzeptierbar und damit problemlos handlungsleitend, selbst wenn sie Handlungsfolgen erzwingen, die zunächst den Interessen des Individuums entgegenstehen. In die Bedürfnis- und Motivationsstruktur des Individuums werden im Verlauf des Sozialisationsprozesses alle primären organischen Bedürfnisse und Antriebe des Individuums vollständig integriert und damit auch die vollständige Integration des Persönlichkeitssystemes in das Sozialsystem erreicht. Hier überlagern sich mithin die Systemebenen des personalen und des sozialen Systemes. Und aufgrund des Gratifikationsinteresses des Kindes wird es zunehmend wahrscheinlich, dass gesellschaftlich erwünschtes Verhalten auftritt, so dass schließlich mit fortschreitender Sozialisation des Individuums dieser funktionale Verhaltensmodus zur ausschließlichen Verhaltensdisposition wird. Nach der Theorie verbleibt also kein Rest: Bedürfnisdispositionen werden mit Hilfe der sozialen Objektsysteme kanalisiert. In ihnen gehen die Wertorientierungen und auch die internalisierten Rollenmuster auf. Somit sind auch die normativen Verhaltenserwartungen der Rollenstruktur des sozialen Systems eingebunden und integriert, und der Vergesellschaftungsprozess erfolgt letztlich umfassend; sein Ergebnis wird von Parsons als „modaler Persönlichkeitstyp“ bezeichnet. Der modale Persönlichkeitstyp ist jener, der den Rollenerwartungen optimal nachzukommen vermag und die gesellschaftlichen Werte am besten verinnerlicht hat. Aus dieser Perspektive beziehen gesellschaftliche Institutionen ihre Stabilität, wenn sie darauf ver67 Kiss 1973, S. 165f. 49 trauen können, dass die kollektive Akzeptanz der gesellschaftlichen Werte, die sich auf der Handlungsebene in Verhaltenserwartungen übersetzen, gleichsam automatisch zu einer Befolgung der Werte und Normen führt, ohne dass es besonderer Kontroll- und Sanktionsmaßnahmen bedarf. Stabilität im Sinne von Identität bezieht aus diesem Prozess jedoch auch das Individuum selbst: Internalisierte Werte leiten das Individuum relativ stabil durch sein Leben. Sie gewährleisten selbst unter wechselnden und inkonsistenten Handlungsbedingungen eine Kontinuität des Selbst, ein inneres Richtmaß, an dem es sein Handeln orientieren kann. Somit werden Werte und Normen und die damit zusammenhängenden Rollenerwartungen zur Grundlage des Handelns. Wenn diese internalisiert sind, sind sie auch die verinnerlichten Kontrollmechanismen, die dem Individuum Konformität gebieten und Devianz verbieten, und zwar unabhängig von der konkreten Handlungssituation. Eine „soziokulturelle Persönlichkeit“ ist dann entstanden, wenn das Individuum gesellschaftlich integriert ist und in Konformität mit gesellschaftlichen Werten im gesellschaftlichen Arbeitsprozess involviert ist und diesen z.B. in einem neuen familiären Rahmen reproduziert. Dies gelingt nur, wenn die interagierenden Individuen die kulturell vorgegebenen Werte in ihren sozialen Zusammenhängen verwirklichen und dabei selbst eine individuelle Kontinuität in der Befolgung und Einhaltung der Werte aufrechterhalten, wenn sie also eine Identität gewonnen haben. Im Folgenden wird ein theoretisches Modell eines Individuums vorgestellt, das in umfassender Weise gesellschaftlichen Erwartungen nachkommt, indem es seine verschiedenen Rollen in adäquater Weise spielt. Das Konzept des Homo sociologicus ist somit ein theoretisches Modell des Rollenträgers, das wesentliche Aussagen der strukturfunktionalistischen Rollentheorie beinhaltet. 50 2.3. Der normativ orientierte Akteur – Homo sociologicus Das normative Paradigma behauptet, dass Menschen auf der Grundlage Ihrer Rollen handeln und sich in gesellschaftlichem Sinne bewähren, wenn sie dies möglichst konform tun. Die strukturfunktionalistische Theorie hat die Integration der Motivationsstrukturen personaler Systeme in die Strukturen aus Werten, Normen und Rollen der sozialen Systeme behauptet. Dahrendorf hat eine idealtypische Konzeption eines Akteurs entworfen, der sich ausschließlich als Träger von Rollen definiert. Allerdings ist der Homo sociologicus nicht in dem Maße mit dem System seiner Rollen konform, wie dies von Parsons behauptet wird. Vielmehr erlebt er die gesellschaftliche Wirklichkeit als eine „ärgerliche Tatsache“68, denn „Ethik, Moral, Recht, Wahrheit einerseits, personale Motivstrukturen andererseits kongruieren keineswegs selbstverständlich in einer Art prästabilisierter Harmonie.“69 Dahrendorf nimmt ausdrücklich darauf Bezug, dass Zugehörigkeiten zu bestimmten sozialen Kategorien nicht nur Halt und Orientierung vermitteln, sondern auch als Zwänge erlebt werden können: „Soziale Rollen sind ein Zwang, der auf den einzelnen ausgeübt wird – mag dieser als eine Fessel seiner privaten Wünsche oder als ein Halt, der ihm Sicherheit gibt, erlebt werden. Dieser Charakter von Rollenerwartungen beruht darauf, dass die Gesellschaft Sanktionen zur Verfügung hat, mit deren Hilfe sie die Vorschriften zu erzwingen vermag. Wer seine Rolle nicht spielt wird bestraft, wer sie spielt, wird belohnt, zumindest nicht bestraft.“70 Dem Homo sociologicus begegnet die Gesellschaft mit einer Fülle von Erwartungen. Wenn er diesen Erwartungen nicht gerecht wird, reagiert die Gesellschaft mit Sanktionen. Je nachdem, wie erheblich Konformität gewichtet wird, bemisst sich auch das Maß an Verbindlichkeit. Und damit korreliert auch die Härte der Sanktion. - Muss-Erwartungen besitzen das höchste Maß an Verbindlichkeit. Ihnen nachzukommen ist zumeist gesetzlich kodifiziert. Ihnen nicht nachzukommen, löst Sanktionsmechanis68 Dahrendorf 1958, S. 17 Schimank 2002, S. 16 70 Dahrendorf 1958, S. 36 69 51 men des Gesetzes und der Rechtsinstitutionen aus. Diese Erwartungen werden von Muss-Vorschriften getragen. Diese sind „der harte Kern jeder sozialen Rolle; sie sind nicht nur formulierbar, sondern ausdrücklich formuliert; ihre Verbindlichkeit ist nahezu absolut; die ihnen zugeordneten Sanktionen sind ausschließlich negativer Natur.“71 - Soll-Erwartungen besitzen ein geringeres Maß an Verbindlichkeit. Ihnen nachzukommen bildet jedoch die Basis für eine gesellschaftliche Akzeptanz, als Voraussetzung dafür, um überhaupt im sozialen Leben, wie z.B. in der Berufswelt bestehen zu können. Das Individuum, das den Soll-Erwartungen seines Rollensystems nicht nachkommt, wird mit sozialem Ausschluss sanktioniert. Umgekehrt hat das Individuum die Chance, nicht nur sozial integriert zu sein, wenn es den Erwartungen gerecht werden kann. Es kann auch noch die Sympathie seiner sozialen Umwelt erlangen, z.B. als eine Person, die sich „anständig zu benehmen weiß“. - Kann-Erwartungen besitzen keine Verbindlichkeit. Wer ihnen entspricht, spielt die „Kür“ des sozialen Handelns aus und erntet dafür Anerkennung seiner sozialen Umwelt. Wer den Kann-Erwartungen nicht entspricht, muss mit keinen manifesten negativen Sanktionen rechnen. Umgekehrt ist es so, dass ein Mensch, der in seinen verschiedenen Rollen immer nur das Allernötigste tut, kein soziales Fortkommen erwarten kann. Der Homo sociologicus handelt rollenkonform, um nicht negativ sanktioniert zu werden. Er hat über den Erziehungsprozess die Werte der Gesellschaft internalisiert, so dass es ihm grundsätzlich möglich ist, rollenkonform zu handeln. Das geht sogar soweit, dass es in der Regel keiner besonderen Sanktionen bedarf, um rollenkonform zu handeln. Den Muss-Erwartungen entspricht das Individuum in der Regel quasi automatisch. Und da, wo es dies nicht tut, folgt die Sanktion zumeist aufgrund einer verinnerlichten Bestrafungsinstanz. Der personifizierte Homo sociologicus, er soll hier als „Studienrat Schmidt“ benannt sein, würde es sich nie erlauben, betrunken im Unterricht zu erscheinen. Und sollte dies aus Indolenz doch mal geschehen, so wäre 71 Dahrendorf 1958, S. 37 52 er, wenn die Sanktion nicht von außen käme, von gewaltigen Gewissensbissen geplagt und gepeinigt. Diese verinnerlichte gesellschaftliche Instanz wirkt höchst funktional und ist insofern völlig in Übereinstimmung mit strukturfunktionalen Aussagen. Und dennoch ist auf einen Unterscheid hinzuweisen. Der Homo sociologicus internalisiert den Standpunkt der Gesellschaft nicht in dem Maße, dass es zu einer gänzlich bruchlosen Assimilation der Persönlichkeit mit der Gesellschaft käme. Wenn dies so wäre, hätte sich Studienrat Schmidt mit großer Wahrscheinlichkeit selbst beim zuständigen Oberschulamt ob seines Vergehens angezeigt, um dem Standpunkt der Gesellschaft Genüge zu tun. Vielmehr zeichnet sich Homo sociologicus dadurch aus, dass er fortwährend in der Gefahr ist, mit Rollenkonflikten kämpfen zu müssen. Dies ist für ihn der Preis der Konformität und der Hintergrund der Dahrendorfschen Feststellung, dass Gesellschaft eine ärgerliche Tatsache sei. So gesehen überwindet dieses Akteurmodell strukturfunktionalistische Identitätskonzepte. Nach der strukturfunktionalistischen Theorie handelt das Individuum grundsätzlich rollenkonform. Gemäß der oben referierten Kritikpunkte kann dies aber nur dann ohne Probleme möglich sein, wenn - Rollenerwartungen verschiedener Bezugsgruppen ohne weiteres miteinander vereinbar sind; - Erwartungen der verschiedenen Rollen, die eine Person besitzt, ohne weiteres miteinander vereinbar sind; - die Rollenerwartungen hinreichend klar definiert sind; - die Person über ausreichende Ressourcen verfügt, um ihre Rollen angemessen spielen zu können; - die Rolle mit den persönlichen Interessen, Bedürfnissen und Zielen der Person vereinbar ist.72 Die ersten beiden Perspektiven wurden bereits weiter oben bei der Vorstellung des Akteurmodells Homo sociologicus angesprochen. Wenn die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, liegt bei dem Individuum ein Rollenkonflikt vor: „Ein für 72 vgl. Schimank 2000, S. 55 53 die Untersuchung der Sozialstruktur von Gesellschaft besonders wichtiger Bereich der Rollenanalyse liegt in der Ermittlung von Erwartungskonflikten innerhalb sozialer Rollen (intra-role conflict). (...) In diesen Fällen kennen verschiedene Bezugsgruppen (...) widersprüchliche Erwartungen, die den Träger der Position vor eine unlösbare Aufgabe stellen und daher einerseits zu einem sozialen Strukturwandel zwingen, andererseits aber, solange ein solcher Wandel nicht eintritt, jeden Träger der Position zum ‚Gesetzesbrecher’ machen bzw. von den Bezugsgruppen keineswegs beabsichtige Verhaltensweisen hervorbringen (...).“73 Der intra-role conflict liegt vor, wenn die verschiedenen Segmente einer Rolle miteinander konfligieren, wenn man z.B. in der Rolle des Lehrers mit antagonistischen Erwartungen der Schulleitung einerseits, der Schüler andererseits und schließlich der Eltern konfrontiert ist. Eine andere Kategorie von Rollenkonflikten liegt da vor, „wo auf eine Person mehrere Rollen mit widersprechenden Erwartungen entfallen. Solche Konflikte zwischen Rollen (inter-role conflict) sind strukturell vor allem dann wichtig, wenn sie nicht auf der zufälligen Wahl von Individuen, sondern auf Gesetzlichkeiten der Positionszuordnung beruhen.“74 Die Konflikte manifestieren sich immer dann, wenn eine Person zwei oder mehrere Rollen mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen besitzt. Dies trifft z.B. den Familienvater, der gleichzeitig Lehrer ist und von dem erwartet wird, einen Klassenausflug durchzuführen, der zeitlich nur in der Woche stattfinden kann, in der auch seine Tochter Geburtstag hat. Rollenkonflikte werden meistens so gelöst, dass den Erwartungen der jeweils mächtigeren Bezugsgruppe gefolgt wird. Das bedeutet jedoch, dass in dem Rollensegment bzw. der Rolle, die im Bezug zu der schwächeren Gruppe oder Person steht, die bestimmte Erwartungen an das Individuum richten, den Erwartungen bewusst und vorsätzlich nicht entsprochen wird. Rollenkonflikte zwingen das Individuum zu einem Handeln, das es nach der strukturfunktionalistischen Theorie streng genommen gar nicht geben dürfte. Das Individuum hat Rollen nicht nur 73 74 Dahrendorf 1958, S. 76ff. Dahrendorf 1958, S. 77 54 gezwungenermaßen anzunehmen und gemäß eines Funktionalitätserfordernisses zu spielen: das Individuum ist vielmehr gezwungen, seine Rollen zu gestalten. So schreibt Schimank: „Die Auseinandersetzung mit den möglichen Komplikationen des Rollenhandelns, die immer dann auftreten, wenn mindestens eine der aufgeführten Voraussetzungen des strukturfunktionalistischen Rollenmodells nicht gegeben ist, fordert dem Akteur also kreative Eigenleistung des ‚role making’ ab.“75 Dies bedeutet, dass das Individuum von bestimmten Erwartungen seiner sozialen Umwelt abweicht, um dennoch in ihr bestehen zu können, dass sich das Individuum der umfassenden Definitionsmacht der Gesellschaft entwindet. Das ist eine kreative Eigenleistung, die dazu verhilft, das Dogma des normativen Paradigmas, nämlich des außengeleiteten und restlos sozial determinierten Menschen zu überwinden. Schimank weist darauf hin, dass die zunehmende Komplexität der Gesellschaft eine Zunahme von Intra- und Inter-Rollenkonflikten mit sich bringt. Dies ist mit der zunehmenden Widersprüchlichkeit der normativen Ordnung der Gesellschaft begründet. Immer öfter sind Menschen in der Situation, dass gesellschaftliche Erwartungen nicht mehr kompatibel sind. So sollen Eltern für ihre Kinder da sein und ihnen familiäre Geborgenheit vermitteln. Gleichzeitig sollen sie potente Konsumenten sein, die in der Lage sind, ein hohes Maß sozio-ökonomischer Leistungsfähigkeit aufzuweisen. Dies geht aber nur, wenn sie ihre Arbeitskraft, auch die der Frauen, umfassend und flexibel ausschöpfen. Dies wiederum geht zu Lasten der familiären Strukturen. Eine weitere Bedingung, die ein zunehmendes Maß an rolemaking erfordert, ist die zunehmende Rollendifferenzierung in der postmodernen Gesellschaft: „Sowohl die Anzahl als auch die Verschiedenartigkeit der gesellschaftlich vorhandenen Rollen ist immer größer geworden. Während in vormodernen Gesellschaften eher diffuse, kaum getrennte Gemengelagen unterschiedlichster Betätigungen in wenigen Rollen konzentriert waren, tendieren moderne Gesellschaften zu immer spezialisierteren Rollen.“76 75 76 Schimank 2000, S. 55 Schimank 2000, S. 65 55 Diese spezialisierteren Rollen stehen in immer größerem Antagonismus zu anderen Rollen und die standardisierten Korrekturmöglichkeiten der Gesellschaft erfassen die Vielzahl der möglichen neuen Komplikationen nicht mehr. Insofern ist der Akteur selbst gefragt, der das Funktionieren und das Zusammenspiel seiner Rollen und Rollensegmente mit den Strukturen seiner sozialen Umwelt managen muss. Hierzu bedarf es des Erlernens besonderer Fähigkeiten, wie Empathie, Frustrationsund Ambiguitätstoleranz sowie Takt und Geduld: „Soziale Kompetenzen dieser Art sind es, die die Person in die Lage versetzen, soziale Ordnung nicht länger bloß als gleichsam mechanische Anwendung fertiger Regeln zu exekutieren, sondern situativ intersubjektiv herzustellen.“77 Dies steht in scheinbarem Gegensatz zum strukturfunktionalistischen Rollenmodell. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass es noch immer eine Fülle von Rollenerwartungen gibt, denen man nicht nur folgen muss, sondern auch folgen darf. Damit ist gemeint, dass Normierungen in der Gesellschaft nach wie vor in großer Zahl existieren und die Individuen bei ihren Handlungserfordernissen entlasten. Somit ist Dahrendorfs These von der „ärgerlichen Tatsache“, die die Gesellschaft darstellen soll, indem sie das Individuum nur mit einengenden Rollenerwartungen konfrontiert, relativiert. Es ist für das Individuum durchaus von Nutzen, wenn sein Leben über Rollenerwartungen strukturiert ist und es seine soziale Identität nicht ständig von neuem rekonstruieren muss. 2.4. Zur Kritik der strukturfunktionalistischen Sozialisationstheorie Habermas hat bei seiner Kritik an der strukturfunktionalistischen Rollentheorie einen interaktionistischen Standpunkt eingenommen. Die von Parsons behauptete Übereinstimmung zwischen Wertorientierungen und Rollennormen einerseits und Bedürfnisdispositionen andererseits bezeichnet er als „Integrationstheorem“, dem er eine Gültigkeit abspricht, denn: „empirisch besteht eher Anlass zu der Annahme, dass in allen bisher bekannten Gesellschaften ein fundamentales Missverhältnis zwi77 Schimank 2000, S. 66 56 schen der Masse der interpretierten Bedürfnisse und den gesellschaftlich lizenzierten, als Rollen institutionalisierten Wertorientierungen bestanden hat. Unter dieser Voraussetzung gilt das ‚Repressionstheorem’: Dass vollständige Komplementarität der Erwartungen nur unter Zwang, auf Basis fehlender Reziprozität, hergestellt werden kann.“78 Die Kongruenz von Wertorientierungen und Rollennormen einerseits und Bedürfnissen andererseits, die nach Parsons‘ Ansicht als Ergebnis eines gelungenen Sozialisationsprozesses entsteht, wäre eigentlich nur dann denkbar, wenn das Individuum restlos in den gesellschaftlichen Strukturen aufgeht. Dies erscheint nur dann möglich, wenn sich entweder gesellschaftliche Bedingungen und individuelle Bedürfnisstruktur niemals ändern oder sich zueinander in einem Verhältnis ständiger Isomorphie bewegen. Diese Annahme erscheint in höchstem Maße unrealistisch. Zur weiteren Kritik wendet sich Habermas gegen die Unterstellung Parsons‘, dass die Rollenerwartungen der Interaktionspartner aufgrund gemeinsamen Sozialisationserlebens in derselben gesellschaftlichen Formation jeweils übereinstimmten. Habermas bezeichnet dies als „Identitätstheorem“ und wendet dagegen ein, dass „die Ebenen der Rollendefinition und der Rolleninterpretation auseinander(ge)halten (werden müssen, Anmerkung des Verfassers). Empirische und sprachphilosophische Gesichtspunkte sprechen für die Geltung eines Diskrepanztheorems: eine vollständige Definition der Rolle, die die deckungsgleiche Interpretation aller Beteiligten präjudiziert, ist allein in verdinglichten, nämlich Selbstrepräsentation ausschließenden Beziehungen zu realisieren.“79 Die interaktionistische Perspektive lässt keinen Zweifel, dass in interaktiven Rollenbeziehungen „spontane Ich-Leistungen und aktive Rolleninterpretationen“80 an der Tagesordnung sind. Die Festschreibung von Rollenstrukturen in den Interaktionen, die eine Komplementarität der jeweiligen Erwartungen unterstellt, erscheint unrealistisch. 78 Habermas 1973b, S. 125 Habermas 1973b, S. 126 80 ebd. 79 57 Schließlich wendet sich Habermas gegen die theoretische Annahme der vollständigen Verinnerlichung gesellschaftlicher Wertorientierungen und Rollenerwartungen durch die Individuen, so als würde die Erfüllung des Gesollten zu einem Bedürfnis des Individuums. Mit dieser Annahme Parsons’ ist die Komplementarität von Bedürfnissen und gesellschaftlichen Werten sichergestellt, so dass – rein theoretisch – das Individuum gar nicht anders als rollenkonform handeln kann. Dieses Konzept wird von Habermas als „Konformitätstheorem“ bezeichnet. So schreibt Habermas: „Das Konformitätstheorem ist vor allem von Goffman kritisiert worden. Denn normenkonformes Verhalten ist nicht einfach eine Verkörperung des normativen Gehalts auf der Ebene beobachtbaren Verhaltens im Sinne einer Projektion von einer Ebene auf die andere. Vielmehr hängt es vom Grad und von der Art der Internalisierung ab, wie das handelnde Subjekt selbst zu seinen Rollen sich verhält.“81 Damit ist gemeint, dass nach der interaktionistischen Sicht Rollennormen mit unterschiedlicher Intensität internalisiert werden, so dass es durchaus auch Rollendistanz bei gleichzeitiger Rollenerfüllung geben kann: „Autonomes Rollenspiel setzt beides voraus: die Internalisierung der Rolle ebenso wie eine nachträgliche Distanzierung von ihr.“82 Die von Habermas so bezeichneten Theoreme der strukturfunktionalistischen Sozialisationstheorie (das „Integrations-, Identitäts- und Konformitätstheorem“) unterstellen „einen Normalfall eingespielter Interaktion, der in Wahrheit ein pathologischer Grenzfall ist (...)“, denn „die volle Komplementarität der Erwartungen und des Verhaltens“ sei „nur um den Preis der Unterdrückung von Konflikten zu erzwingen“ (...), die „Deckung von Definition der Rolle und Interpretation der Handelnden“ sei (...) „nur um den Preis des Verzichts auf Individuierung zu erreichen“, und die „Abbildung der Norm auf der motivationalen Ebene verinnerlichter Rollen“ sei „nur um den Preis einer zwanghaft automatischen Verhaltenskontrolle“ zu verwirklichen.83 81 Habermas 1973b, S. 126f. Habermas 1973b, S. 127 83 ebd. 82 58 Nach meiner Ansicht stellt Habermas dennoch nicht in Frage, dass Sozialisation in gesellschaftlichen Institutionen, das heißt Rollensystemen, dazu führen kann, dass bestimmte gesellschaftliche Wertstrukturen internalisiert werden. Ob sie im Handeln des Individuums implementiert werden (können), ist eine andere Frage. Jedenfalls kann nicht bestritten werden, dass Gesellschaftsmitglieder in der Regel zumindest versuchen, sich so zu verhalten, dass eine zielgerichtete Evolution ihrer Identität und gesellschaftlichen Integration möglich ist. Da diese Versuche nicht immer erfolgreich sind, haben die Individuen die psychischen und sozialen Kosten ihres Versagens zu tragen, und das ist eine Fragestellung, mit der sich Parsons nicht auseinandergesetzt hat. Ich sehe sie jedoch ansatzweise in der Anomietheorie von Merton beantwortet: Menschen versuchen sich demnach wertkonform zu verhalten, weil sie gesellschaftliche Werte durchaus verinnerlicht haben. Da ihnen dies jedoch nicht vollständig gelingt, weil die Gesellschaft ihnen die Möglichkeiten dazu nicht gibt, sind sie dazu bereit, deviante Verhaltensweisen zu realisieren. Darauf werde ich weiter unten zurückkommen. 2.5. Die strukturfunktionale Perspektive zur Abweichung Zum Verständnis der Parsonsschen Sozialisationstheorie ist es wichtig anzumerken, dass die Ausrichtung von Verhalten in direktem Zusammenhang zum Willen des Individuums stehen soll. Das heißt, konformes Verhalten entsteht nicht nur, weil das Individuum möglicherweise verinnerlicht hat, dass es sich konform verhalten soll. Das Verhalten soll ihm auch in irgendeiner Weise dienlich sein. Soweit Abweichung vorliegt, trifft sie auf soziale Kontrollen, die darauf gerichtet sind, in negativer Weise zu sanktionieren und konformes Verhalten zu gratifizieren. Dies ist in der Sozialisationsphase die effektivste Methode, gesellschaftliche Sollgeltungen in individuelle Bedürfnisdispositionen zu transformieren. Abweichung ist in der strukturfunktionalen Theorie eher ein Randphänomen, wie z.B. Krankheit, das einem von Parsons unterstellten anthropologischen Grundbedürfnis nach Integration und Konformität entgegensteht. So schreibt Kiss: „Generell kann gesagt werden, dass nach systemtheoretischem Verständnis ab59 weichendes Verhalten aus der Nichtangepasstheit der motivationalen Orientierung an die Systembedürfnisse und speziell an die Rollenerwartungen resultiert, das Spannungen im Hinblick auf den gleichgewichtigen Verlauf eingefahrener Interaktionsbeziehungen hervorruft.“84 Von alltäglichen Interaktionssituationen nimmt Parsons an, dass es sich um einen stabilen interaktiven Prozess handelt, der sich grundsätzlich in einem Gleichgewicht befindet und dazu neigt, sich nicht zu verändern. Dazu gehört: „the interaction is integrated with a normative pattern of value-orientation, both ego and alter, that is, have internalized the value pattern.” Die Internalisierung der Wertmuster, die für alle an der Interaktion Beteiligten unterstellt wird, ist die Grundlage des Funktionierens der Interaktion: „such an interaction system is characterized by the complementarity of expectations, the behavior and above all the attitudes of alter conform with the expectations of ego und vice versa.” Aus dieser Situation heraus analysiert Parsons das Entstehen von Devianz: „Let us assume that, from whatever source, a disturbance is introduced into the system, of such a character that what alter does leads to a frustration, in some important respects, of ego’ s expectation-system vis-a-vis alter.”85 Devianz wirkt sich aus, wenn Erwartungen im Rahmen der Interaktion durch die handelnden Personen durchbrochen werden. Welche Erwartungen können damit gemeint sein? Nach Wiswede unterscheidet Parsons drei Aspekte des Erwartungssystems86: a) Erwartungen werden Bestandteil der Bedürfnisstruktur und verlangen nach Befriedigung. b) Erwartungen schließen Zuneigung zu Personen als einem libidobezogenen Objekt ein. c) Erwartungen sind wertmäßig internalisiert, Normverletzung führt zu Frustration. Damit korrespondieren drei Lösungs- bzw. Anpassungsmöglichkeiten für den Fall der Abweichung: ad a) Anpassung der Bedürfnisstruktur wie z.B. Verdrängung, 84 Kiss 1973, S. 170 Parsons 1951, S. 252 86 vgl. Wiswede 1973, S. 46 85 60 Versagung, Triebverzicht. ad b) Übertragung auf ein neues Objekt der Zuneigung. ad c) Umdefinieren der Wertorientierungsmuster, mit denen sich die abweichende Person nicht mehr im Einklang befindet. Dies wären „glatte“ Lösungen, die eine Wiederherstellung der Homöostase, gegebenenfalls in einer neuen Sozialbeziehung, bewirken könnten. Aber auch andere Ausgänge sind möglich: „Es könnte z.B. sein, dass die Zuneigung bestehen bleibt, dass sie aber gestört ist. Diese Ambivalenzbeziehung impliziert einen emotionalen Konflikt. Es entsteht eine ambivalente Motivationsstruktur, wobei das perzipierende Individuum die ‚Kosten‘ des Konflikts zu tragen hat.“87 Letztlich kommt es in solchen Fällen darauf an, mit der ambivalenten motivationalen Struktur umzugehen, indem immer nur eine Seite betont wird. Je nachdem, ob die negative Seite oder die positive Seite verdrängt wird, nennt Parsons dies „conformative“ oder „alienative need-disposition.“88 So impliziert die konforme Komponente zwanghafte Konformität, Ritualismus, krankhafte Sorgfalt usw.; die deviante Komponente bedeutet ein Überwiegen der negativen Seite, das heißt Ablehnung konformer Verhaltensmuster. Daraus ergeben sich verschiedene Formen abweichenden Verhaltens. 2.6. Die Bezugnahme auf die Anomietheorie Mertons Parsons bezieht sich zur weiteren Explikation ausdrücklich auf Mertons Anomietheorie: „What Merton calls ‘conformity’ is clearly what we here mean by the equilibrated condition of interactive system without conflict on either side or alienative motivation. Merton’s ’innovation’ and ‘ritualism’ are our two compulsively conformative types, while ‘rebellion’ and ‘retreatism’ are clearly the two alienative types.”89 Schematisch sind diese Zusammenhänge folgendermaßen dargestellt: 87 Wiswede 1973, S. 46 Parsons 1951, S. 254 89 Parsons 1951, S. 257f. 88 61 Activity Passivity Conformative Dominance Compulsive Performance Orientation (Mertons Innovationskonzept, Anmerkung des Verfassers ) Compulsive Acquiescence in Status Expectations (Mertons Ritualismuskonzept, Anmerkung des Verfassers) Alienative Dominance Rebelliousness (Mertons Rebellionskonzept, Anmerkung des Verfassers) Withdrawal (Mertons Rückzugskonzept, Anmerkung des Verfassers) Quelle: Parsons 1951, S. 257 Mit der Bezugnahme auf Mertons Anomietheorie wird auch im Rahmen der strukturfunktionalen Theorie der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Werten und Außenseitertum deutlich. Merton schreibt in der Einleitung zu Teil II seines Buches „Soziologische Theorie und soziale Struktur“ über das dortige Kapitel 4 („Sozialstruktur und Anomie“)90, dass dort „die theoretische Orientierung des funktionsanalytischen Sozialwissenschaftlers, der das sozial abweichende Verhalten genauso als ein Produkt der sozialen Strukturen ansieht wie das konformistische Verhalten“91, gezeigt wird. Er bringt damit zum Ausdruck, dass die funktionale Analyse die soziale Struktur als „etwas Aktives“ ansieht, die zwar Handlungspositionen beschränkt, aber auch Neues hervorzubringen vermag. Er wendet sich ausdrücklich gegen einen biologistischen Determinismus von Abweichung und Außenseitertum, wie er z.B. von Cesare Lombroso propagiert wurde („der geborene Verbrecher“) oder auch in der etwas differenzierteren Weise der Psychoanalyse. Mit biologistisch-psychoanalytischen Erklärungsansätzen sind nach Mertons Ansicht die Variabilität und die sozialen Entstehungszusammenhänge abweichenden Verhaltens nicht zu erklären: „Stattdessen versucht (der Funktionalismus, Anmerkung des Verfassers) zu bestimmen, wie die soziale und kulturelle 90 91 Merton 1995, S. 127ff. Merton 1995, S. 117 62 Struktur Druck zu sozial abweichendem Verhalten auf Menschen in unterschiedlichen Positionen in dieser Struktur erzeugt.“92 Merton bewog die Einsicht, dass Abweichung durch eine Störung der sozialen Ordnung verursacht sein könnte, die von Durkheim als Anomie bezeichnet wurde. Dabei ist für Merton von besonderem Erkenntnisinteresse, „warum die Häufigkeit des abweichenden Verhaltens in unterschiedlichen Sozialstrukturen variiert, und wie es kommt, dass in unterschiedlichen Sozialstrukturen Abweichungen in unterschiedlicher Gestalt und nach unterschiedlichen Mustern auftreten.“93 Merton sieht den Ansatz zu der Analyse der vorwaltenden sozialen und kulturellen Ursachen in der Tatsache, dass „soziale Strukturen ausgesprochenen Druck auf bestimmte Personen in der Gesellschaft ausüben, sich eher nichtkonform als konform zu verhalten.“94 Je höher der Druck in einer bestimmten sozialen Gruppe ist, desto höher ist die zu erwartende Devianzrate, und zwar nicht etwa in der Folge einer abweichenden Triebstruktur, was die o.a. biologistischen Ansätze nahelegen, sondern weil die Menschen auf die soziale Lage, in der sie sich befinden, einfach so reagieren, wie es ihnen in ihrer aktuellen Lebenssituation am naheliegendsten erscheint. Der Druck zu abweichendem Verhalten resultiert nach Mertons Ansicht aus der allgemeinen, intersubjektiv geteilten Orientierung auf die kulturell definierten Ziele hin: „Diese Ziele sind mehr oder weniger integriert (...) und grob in einer bestimmten Wertehierarchie geordnet. In unterschiedlichem Maße mit Gefühl und Bedeutung besetzt, bilden die herrschenden Ziele den Bezugsrahmen der Ansprüche. Sie sind das, was ‚erstrebenswert‘ ist.“95 Die Ziele, die solchermaßen mit dem Wertesystem einer Gesellschaft zusammenhängen, mit ihm konvergieren, leiten sich aus diesem im Sinne einer Verhaltensorientierung sozial sanktionierter, kulturell typisierter und psychisch internalisierter Standards selektiver Orientierung in einem soziokulturellen Bereich ab. 92 ebd. Merton 1995, S. 127 94 ebd. 95 Merton 1995, S. 128 93 63 Für Merton gehört zu den Zielen zuvörderst materieller Erfolg. 2.6.1. Die Ziel-Mittel-Diskrepanz Die Grundannahme der Theorie besteht in einer soziokulturellen Dissoziation zwischen kulturellen Zielen und institutionalisierten Mitteln der Zielerreichung. Unter diesen Bedingungen können Menschen abweichende Verhaltensmuster wählen, um kulturelle Zielvorgaben in ihrem Verhalten zu verwirklichen. Merton führt in seiner theoretischen Begründung aus, dass das Erreichen kultureller Ziele an bestimmte Regeln (Sitten, Institutionen) gekoppelt ist. Diese Regeln beziehen sich auf die Möglichkeiten der legitimen Zielerreichung und dienen somit der Festlegung der zulässigen Verfahren zur Erreichung der Ziele. Daher ist ein weiteres Element (neben den Zielen) die Kontrolle und Regulierung und Definition der zulässigen Formen der Zielerreichung. In integrierten Gesellschaften (z.B. unter der Bedingung allgemeinen materiellen Wohlstandes) ist die Zielerreichung mit den gesellschaftlich lizenzierten Mitteln möglich. Dann besteht ein Gleichgewicht, wenn die mit beiden Arten des kulturellen Zwanges (das heißt Zielorientierung und Mittelkontrolle) konform gehenden Individuen daraus Befriedigung beziehen, dass sie zum einen Chancen haben, die Ziele zu erreichen, und weiters dennoch die institutionell akzeptierten Methoden der Zielerreichung einhalten können. Merton schreibt dazu: „Die von der Anpassung an die institutionellen Ziele gelegentlich (...) geforderten Opfer müssen durch Belohnungen kompensiert werden.“96 Viele möglicherweise effizientere Verfahren, die Ziele zu erreichen, sind aus dem institutionellen Bereich des erlaubten Verhaltens ausgeschlossen. Die Wahl der Mittel hat sich nach den Normen zu richten - sie ist insoweit durch institutionalisierte Normen eingeengt.97 Die Gesellschaft schränkt jedoch bisweilen die Möglichkeit der Zielerreichung weitgehend ein, so dass es für einige Mitglieder fast unmöglich wird, die kulturell definierten Ziele zu erreichen. Wenn aber die Erreichung der kulturell vorgegebenen Ziele als besonders wichtig angesehen wird, wenn dies zur Voraussetzung 96 97 Merton 1995, S. 130 vgl. Wiswede 1973, S. 41 64 für soziale Anerkennung und Aufstieg gemacht wird und gleichzeitig die Zielerreichung nicht möglich erscheint, geraten die Menschen unter den Druck, unter Umständen auch illegitime Mittel zur Zielerreichung anwenden zu müssen. Ein gesellschaftlicher Zustand, in dem die beschriebenen Dissoziationsbedingungen bestehen, wird von Merton als Anomie bezeichnet. Dies bedeutet „a breakdown in the cultural structure, occurring particularly when there is an acute disjunction between the cultural goals and the socially structured capacities of members of the group to act in accord with them.”98 Merton entwirft aus heuristischen Gründen idealtypische Gesellschaftskonzeptionen, wobei die im Rahmen der Anomietheorie interessanteste Konzeption eine Gesellschaft darstellt, in der eine extrem starke Betonung bestimmter Ziele ohne eine entsprechende Betonung der institutionellen Verfahren vorliegt. So formuliert Merton seine Hauptthese: „anomales Verhalten (ist) soziologisch ein Symptom der Dissoziation von kulturell vorgeschriebenen Ansprüchen und sozial strukturierten Wegen zur Realisierung dieser Ansprüche.“99 Für Merton ist eine solche Konstellation in den USA gegeben: „Die heutige amerikanische Kultur scheint sich jenem Extremtypus zu nähern, bei dem ohne entsprechende Akzentuierung der institutionellen Mittel, ein sehr starker Akzent auf bestimmten Erfolgszielen liegt.“100 Somit besteht ein Konflikt, eine Dissoziation, zwischen den sich aus den kulturellen Werten ableitenden Zielen und den damit verbundenen sozialen Ansprüchen und den sozio-ökonomischen Möglichkeiten, genauer: dem beschränkten Zugang benachteiligter sozialer Schichten zu den zugelassenen Mitteln der Zielerreichung. Daraus entsteht der Gesellschaftstypus der nicht- oder wenig integrierten Gesellschaft. Die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen sind schier unbegrenzt. Aber zumindest für die Angehörigen der benachteiligten Sozialschichten sind die Erfolgschancen beeinträchtigt. Gleichwohl bewirken die kulturellen Zielvorgaben, dass die Mitglieder der schlechtintegrierten Gesellschaften mit Erwartungen konfrontiert werden, die sowohl das Recht als auch die Pflicht 98 Merton 1957, S. 162 Merton 1995, S. 130 100 Merton 1995, S. 131 99 65 betonen, an der Erfolgsorientierung, selbst angesichts wiederholter Rückschläge, unbedingt festzuhalten. Jegliche Sozialisationsinstanz (Elternhaus, Schule, Hochschule usw.) wirkt kräftig mit, wenn es darum geht, die maßgeblichen Wertorientierungen aufzupolieren. Diese unbedingte positive Betonung der Bereitschaft zur Pflichterfüllung (im Sinne einer unausgesetzten Zielorientierung) ist mit einem nachdrücklichen Hinweis auf drohende Sanktionen gekoppelt, die das Individuum ereilen, das erkennbar seine Bemühungen zurücknimmt. Merton deutet solche kulturellen Axiome folgendermaßen: 1. Alle, denen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position die volle Chancengleichheit versagt bleibt, haben ihre Kritik von der sozialen Struktur weg und auf das eigene Selbst hin zu lenken. 2. Die gesellschaftliche Machtstruktur ist aufrecht zu erhalten, indem Individuen in den unteren sozialen Schichten zur Identifizierung nicht mit ihresgleichen, sondern mit jenen „ganz oben“ veranlasst werden. 3. Alle, die mit dem kulturellen Diktat des nicht nachlassenden Ehrgeizes nicht konform gehen, werden unter Konformitätsdruck gesetzt, indem ihnen mit dem Entzug der Vollmitgliedschaft in der Gesellschaft gedroht wird.101 Als Folge dieser Grundsätze sieht Merton die Möglichkeit, dass innerhalb der benachteiligten Bevölkerungsgruppen abweichende Verhaltensweisen entstehen: „It is only when a system of cultural values extols virtually above all else, certain common success-goals for the population are large while the social structure rigorously restricts or completely closes access to approved modes of reaching these goals for a considerable part of the same population, that deviant behavior ensues on a large scale.”102 Merton entwirft eine Typologie der individuellen Anpassung. Deren schematische Darstellung sieht folgendermaßen aus: 101 102 66 vgl. Merton 1995, S. 134 Merton 1957, S. 146 Anpassungsformen 1. Konformität 2. Innovation 3. Ritualismus 4. Rückzug 5. Rebellion kulturelle Ziele institutionelle Mittel + + – – +– + – + – +– Quelle: Merton, 1995, S.135 2.6.2. Konformistische Anpassung Der konformistische Anpassungsmodus impliziert die Akzeptanz sowohl der Ziele als auch der institutionellen Mittel und Methoden zur Zielerreichung. Individuen, die diese Form der Zielerreichung praktizieren, sind grundsätzlich nicht davon bedroht, Außenseiter zu werden. Merton stellt fest, dass in dem Maße, in dem eine Gesellschaft stabil und integriert ist, dieser Konformitätstypus die üblichste Form der Anpassung bildet: „Das Netzwerk der Erwartungen, aus dem jede soziale Ordnung besteht, wird von jenem Modalverhalten ihrer Mitglieder getragen, das in der Konformität mit den etablierten, wenngleich vielleicht langfristig wandelbaren kulturellen Mustern besteht.“103 Fraglich bleibt nur, inwieweit ein Individuum in einer schlecht integrierten Gesellschaft, insbesondere im Falle der Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppierung, diesen Anpassungsmodus erträgt. 2.6.3. Innovative Anpassung Die Individuen, die den innovativen Anpassungsmodus praktizieren, akzeptieren einerseits vorwaltende kulturelle Ziele und erstreben deren Erreichung. Andererseits praktizieren sie im Hinblick darauf abweichendes Verhalten. Die innovative Anpassung liegt dann vor, wenn sich der Einzelne die kulturelle Betonung des Ziels zu eigen macht, ohne die institutionellen Normen, die die Mittel und Wege zur Zielerreichung bestimmen, gleicher- 103 Merton 1995, S. 136 67 maßen zu verinnerlichen.104 Dieser Anpassungsmodus bildet den klassischen Fall des Mertonschen Anomiekonzeptes: In ihm finden sich all jene Formen abweichenden Verhaltens, die von Menschen praktiziert werden, die mit ihrer gegenwärtigen sozialen Situation unzufrieden sind, diese überwinden möchten, jedoch wenig oder keine gesellschaftlich lizenzierten Mittel besitzen, dies zu verwirklichen. Ich subsumiere unter diese Kategorie all jene Außenseiter, die zu einer Gruppe oder einer Gesellschaft bzw. zu einer bestimmten Lebensform dazugehören wollen, denen jedoch die Zugehörigkeit verweigert wird, weil es ihnen eines bestimmten dahingehend qualifizierenden Merkmals gebricht. Dies allein schon macht sie zu Außenseitern. Wenn sie dann noch abweichendes Verhalten praktizieren, gewinnt ihr Außenseiterstatus einen anderen Charakter: aus dem Nicht-Besitz eines qualifizierenden Merkmales wird durch abweichendes Verhalten ein Stigma, wenn die soziale Umwelt von der Abweichung Notiz nimmt und sich daran stört. Als Beispiel soll hier die Verhaltensabweichung bestimmter Jugendlicher thematisiert werden, die ein spezifisches Verständnis gesellschaftlicher Ziele besitzen und diese mit falschen Methoden zu erreichen versuchen. 2.6.3.1. Desintegration und Jugendgewalt Heitmeyer stellt die These auf, dass Desintegration des Individuums eine zentrale Bedeutung für Gewaltphänomene hat. Heitmeyer ist der Ansicht, dass junge Menschen in der postmodernen Gesellschaft gleich in mehrfacher Hinsicht desintegriert sind, d.h. von der Einbindung in gesellschaftliche Institutionen herausgelöst. Diese Auflösungsprozesse betreffen: 1. die Auflösung von Beziehungen zu anderen Personen oder Institutionen; 2. die Auflösung der faktischen Teilnahme an gesellschaftlichen Institutionen; 3. die Auflösung der Verständigung über gemeinsame Norm- und Wertvorstellungen. 104 68 vgl. Merton 1957, S. 141 Die Auflösung von Integrationszuständen kann bisweilen als Befreiung empfunden werden. Sie ist es indes dann nicht, wenn „eingelebte, aber nicht mehr befriedigend erlebte Formen der Sozialintegration durch keine adäquaten neuen Formen abgelöst werden. Dies bedeutet Ausgrenzung und Vereinzelung.“105 Heitmeyer beschreibt, wie die sozialisatorischen Rahmenbedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft von Modernisierungsfolgen geprägt sind, die eine zunehmende Individualisierung der Gesellschaftsmitglieder mit sich bringen. Gerade mit Blick auf Heranwachsende können solche Entwicklungen nur als sehr ambivalent beurteilt werden, denn einerseits verheißt die Lösung von sozialen Institutionen, wie z.B. der Familie, eine Befreiung von Festlegungen und Kontrollen. Die Verantwortung für das Handeln des Individuums ist aber in vollem Umfang diesem zugerechnet und damit auch die Handlungsfolgen: „(Die) Ausweitung von Entscheidungsfreiheit hat den Preis des Verlustes der Sorglosigkeit eines kindlichen Alltags.“106 Zwar wird die Gestaltbarkeit des individuellen Lebensweges größer. Aber der Zwang, etwas gestalten zu müssen und dabei nicht auf den Rückhalt stabiler Vergemeinschaftungsformen zurückgreifen zu können, bedeutet auch ein höheres Maß an Gefährdung. Eine negative Folge solcher Entwicklungen für Jugendliche sieht Heitmeyer in dem Entstehen besonderer Desintegrationspotentiale, die nach seiner Ansicht zunehmende Gewalt erklären können. Typische Erscheinungsformen sind: a) Auflösung von Beziehungen zu anderen Personen und Lebenszusammenhängen, b) Auflösung der Verständigung über gemeinsame Wert- und Normvorstellungen, c) Auflösung der faktischen Teilnahme an gesellschaftlichen Institutionen. ad a) Desintegrationspotentiale finden sich vor allem in den Familien aufgrund zunehmender Instabilität der Beziehungen. Ehedem selbstverständliche Zugehörigkeiten lösen sich auf. Damit einher 105 106 Heitmeyer 1992, S. 77 Heitmeyer 1992, S. 78 69 gehend verändern sich auch die Interaktionsstrukturen: „Die affektive, expressive Gewalt in den Familien unter anderem durch physische Attacken durch Väter hat eher abgenommen, während die instrumentelle, rationale Gewalt eher zugenommen hat.“107 Diese Umgangsformen beziehen sich auf irgendwelche instrumentell konstruierte Verhaltens- bzw. Leistungsstandards, dazu gehören unter anderem: 1. leistungsabhängige Zuwendung 2. willkürliche, stimmungsabhängige Beziehungen 3. materialistische Zuwendung („Freikaufen von sozialemotionalen Anstrengungen“) 4. Zuwendung unter bestimmten Zeitvorbehalten. Weiter schreibt Heitmeyer: „In diesen instrumentalistischen Umgangsweisen wird deutlich, dass es neben den offenen auch verdeckte Desintegrationspotentiale gibt, denn hinter den Fassaden ‚äußerlicher‘ Intaktheit verbergen sich Auflösungen sozialer Beziehungen, da instrumentalistische Umgangsweisen auf die Verfügung über andere hinauslaufen, und nicht auf die Anerkennung des anderen und seiner Integrität.“108 Neben den familieninternen Desintegrationspotentialen erweisen sich Veränderungen in der demographischen Struktur der Gesellschaft als zusätzlich desintegrierend. Dazu zählt Heitmeyer die Tatsache, dass Kinder heute in zunehmendem Maße in geschwisterlosen, großelternlosen, verwandtschaftslosen Kernfamilien aufwachsen, die eine relativ isolierte und kontaktarme Sozialisationsumwelt darstellen. Ein weiteres Desintegrationspotential stellen für Heitmeyer Trennungs- und Verlustängste im Fall von Scheidungsfamilien dar. Schließlich ist noch ein inkonsistentes Elternverhalten maßgeblich, das keine regelhaften Erziehungsmaßstäbe erkennen lässt. Die Flexibilisierung der Arbeitswelt fordert heute die Bereitschaft, sein Leben nach den Bedürfnissen der Erwerbsarbeit bzw. des Arbeitsmarktes auszurichten und Kinder in den zunehmend kontingent anfallenden arbeitsfreien Phasen zu be107 108 70 ebd. ebd treuen. Somit wird Betreuung und Fürsorge für Kinder zu einem Gut, dessen sie sich nicht mehr sicher sein können. Heitmeyer folgert daraus, dass es eine Tendenz zur „Ent-gesellschaftung“ gibt. Die Labilität der sozialen Beziehungssysteme untergräbt Verlässlichkeit und Stabilität: „Neue Freiräume lassen sich aber ohne Verlässlichkeit nicht ‚genießen‘, sondern sind angstbesetzt. Angst aber muss in einer auf Durchsetzung getrimmten Gesellschaft zunehmend verborgen werden.“109 Vor allem die männlichen Jugendlichen verbergen ihre Ängste hinter einer Fassade des Cool-Seins und bedienen sich dabei der Mitgliedschaft einer Gruppe. Gewalthandlungen Jugendlicher sind in erster Linie in einem Gruppenkontext zu beobachten, da die Gruppenzugehörigkeit das Maß an Sicherheits- und Souveränitätsempfinden vermittelt, das dem vereinzelten Jugendlichen so sehr fehlt. ad b) Labile Sozialbeziehungen, sind dadurch gekennzeichnet, dass signifikante Bezugspersonen einen Vorbildcharakter verlieren. Diese Entwicklung flankiert den Individualisierungsprozess der fortgeschrittenen Moderne. Durch eine zunehmende Subjektivierung der Lebenswelt wird eine Bindung an Traditionen, Milieus, Glaubensvorschriften usw. immer schwächer. Damit schwindet aber auch das Bewusstsein für übergeordnete Wertstrukturen. Das Desintegrationspotential liegt also in der Ambivalenz einer Entwicklung, die bei einer Ausweitung der Freiheitsgrade ein Ansteigen kollektiver Verständigungsdefizite mit sich bringt. ad c) Letzteres muss zunächst nicht heißen, dass es zu einer Reduktion von Interaktionen käme. Heitmeyer konstatiert eher das Gegenteil. Demnach steigt die Anzahl der sozialen Kontakte, aber es vermindert sich ihre Intensität. Die Gefahr der Vereinzelung besteht dann, wenn die Chance zu kollektiven Gemeinsamkeiten aufgrund der Verständigungsdefizite sinkt. In der Folge entsteht 109 Heitmeyer 1992, S. 79 71 eine zunehmende Distanz zu gesellschaftlichen Institutionen, wie Vereinen und organisierten Jugendgruppen. Desintegrationspotentiale müssen nicht gleich in Desintegrationserfahrungen umschlagen. Wenn man bestimmte soziale Kontexte überwunden hat, kann man das als ein hohes Maß an Befreiung erleben, zumal sich oft neue soziale Zusammenhänge ergeben, die das drohende Desintegrationserleben auffangen und kompensieren. Aber Desintegrationspotentiale können sich zu manifesten Desintegrationserfahrungen wandeln, vor allem, wenn die Desintegration zu Vereinzelung und sozialer Unsicherheit führt. Heitmeyer nennt als typische Beispiele EinKind-Familien oder Ein-Eltern-Familien. Viele Jugendliche versuchen die drohende Bindungslosigkeit mit der Zugehörigkeit zu Gleichaltrigengruppen zu kompensieren. Heitmeyer unterscheidet jedoch zwischen Gleichaltrigengruppen, die er auch „Wir-Gruppen“ nennt, die sich durchaus durch kollektive Aktivitäten auszeichnen und denen „ansatzweise ein zeitbegrenzter sozialer Verankerungsversuch“110 gelingt. Davon grenzt er die Gleichaltrigenszene in den Städten ab, in denen kein „Wir“-Bewusstsein im Sinne einer kollektiven organisierten Identitätskonzeption entstehen kann. Statt dessen werden in diesen sozialen Systemen „industriewirtschaftliche Prämissen“111 reproduziert, indem die gesellschaftlichen Konsumwertorientierungen (z.B. „Markenklamotten“) hoch gehalten werden und das Individuum zum Außenseiter wird, das im Hinblick auf die Verwirklichung von Konsumzielen versagt. Was besonders desintegrativ wirkt, ist der Umstand, dass die das System tragenden Werte grundsätzlich auch von den Jugendlichen geteilt werden, insbesondere Werte, die Durchsetzungsfähigkeit, soziale Kompetenz und Konsumfähigkeit beinhalten. Hier zu versagen ist gerade für männliche Jugendliche und junge Männer eine schmerzhafte und enttäuschende Erfahrung. Desintegration wird von Jugendlichen nach der Maßgabe ihres Bildungsniveaus verarbeitet. Vor allem bei Jugendlichen mit niedrigem Bildungsniveau herrscht ein Gefühl, „mit dem Rücken zur Wand“ zu stehen. Die Folge ist eine „Wir“-Suche in sozialen Verbänden Gleichartiger. In diesen Gruppen, das macht 110 111 72 Heitmeyer 1992, S. 80 ebd. sie sozial bedenklich, herrscht eine verminderte individuelle Kritikbereitschaft, da ein Druck zur kollektiven Solidarität in ausdrücklicher Orientierung an den gemeinsam getragenen Selbstbehauptungszielen herrscht. So schreibt Heitmeyer weiter: „Bei der Gruppe mit niedrigem Bildungsgrad, in der Selbstbehauptung dominiert, geht es häufig um Anschluss an die Konsumwelt, das heißt, es liegen vor allem im weitesten Sinne konsumistische Motive vor. Anschluss heißt auch Statussuche, um derentwillen Werte und Normen, die offiziell noch hochgehalten werden, verletzt bzw. überschritten werden.“112 Dies ist die Rekapitulation des klassischen Konzeptes der Anomietheorie Mertons: Die Suche nach gesellschaftlichem, konsumistisch definiertem Anschluss beinhaltet die Bejahung bestimmter gesellschaftlicher Wertorientierungen, nämlich das Gebot, stets über ausreichende ökonomische und soziale Mittel zu verfügen, um den gesellschaftlichen Konsumimperativen folgen zu können. Das Ganze mündet in einem unbewussten Bedürfnis nach Selbstbehauptung und Durchsetzung. Da die Gesellschaft vor allem den Jugendlichen aus der Unterschicht, die oft genug in den Sozialisationsinstanzen der gesellschaftlichen Auslese versagt haben, die Möglichkeiten zur Selbstbehauptung und Durchsetzung verweigert, bleibt ihnen scheinbar nichts anderes übrig, als sich in Gruppierungen zu organisieren, die diesen Mangel zu kompensieren scheinen, da sie plötzlich eine Macht entwickeln, und zwar als Gruppe, die sich gegen bestimmte gesellschaftliche Außenseiter richtet und die deshalb so heikel ist, weil sie sich illegitimer Methoden, nämlich krimineller Gewalt, bedient. Die Labilität familiärer Bezüge und der Mangel an sozialer Orientierung im Rahmen gesellschaftlich lizenzierter Institutionen bringt eine zunehmende Indifferenz in Bezug auf moralische Kategorien mit sich. Heitmeyer beschreibt in diesem Zusammenhang einen Stufenprozess, der von Gewaltbilligung über Gewaltbereitschaft hin zu Gewalttätigkeit führt. Bei diesem Prozess ist zu bedenken, dass der Verlust sozialer Beziehungen auch ein Verschwinden von Verantwortlichkeit mit 112 ebd. 73 sich bringt. In einer Situation, in der Menschen fehlen, denen man sich moralisch verbunden fühlt, fallen auch die inneren Barrieren für unmoralisches Handeln: „Wenn es dem einzelnen gleichgültig ist, was andere von ihm denken, dann wird bereits Gewalt (…) in das eigene Handlungsspektrum einbeziehbar, um (...) sich selbst zu behaupten.“113 Aus dieser Kombination der Erfahrungen der Aushöhlung von Werten und Normen im Sinne einer Verbreitung einer „utilitaristisch-kalkulativen“ Orientierung und der Erfahrungen der „anomischen Ziel-Mittel-Diskrepanz“ im Sinne der Mertonschen Anomietheorie kann es nach Heitmeyer zu einer Verdichtung von Tendenzen der Gewaltbilligung zu Gewaltbereitschaft kommen. Um den theoretischen Bezug zu Parsons Sozialisationstheorie wieder aufzugreifen, kann man bezüglich dieser Jugendlichen feststellen, dass die Internalisierung bestimmter gesellschaftlicher Wertmuster, wie z.B. Solidarität, Rücksicht, Fürsorge, im Rahmen der Sozialisation nicht erfolgt ist. Andere Wertorientierung wurden jedoch sehr wohl verinnerlicht, jene, deren gesellschaftliches Gratifikationspotential unmittelbar erfahren werden kann und gerade in den benachteiligten Schichten so rar ist: Macht, Reichtum, Durchsetzungsfähigkeit, Erfolg. Heitmeyer schreibt daher: „Wir haben es daher auf der einen Seite (...) mit der Aushöhlung durch Ökonomisierung zu tun und auf der anderen Seite mit einer immer schärferen Aufpolierung der schon genannten Werte wie Erfolg, Durchsetzung, Stärke. An der Etablierung der beiden Prozesse wirken Jugendliche nicht mit, sondern setzen sich nur damit auseinander, was sie vorfinden und suchen – zum Teil erheblich unter Erwartungsdruck stehend, nach Anschluss und Aufstieg.“114 Schließlich folgert Heitmeyer, dass aus dieser Anomiesituation heraus Gewaltbilligung entstehen kann, die sich bei Vorliegen zusätzlicher Antezedenzbedingungen zu Gewaltbereitschaft bzw. Gewalttätigkeit verdichtet. Die soziale Abweichung, die von Heitmeyer beschrieben wurde, manifestiert sich in Gruppen. In Ergänzung dazu soll noch 113 114 74 Heitmeyer 1992, S. 81 ebd. darauf hingewiesen werden, dass Merton selbst eine Konzeption einer „sozialen Ansteckung“ aus den Folgen gesellschaftlicher Anomie entwickelt hat.115 Er entwirft dabei ein Szenario, wonach das abweichende Verhalten „nicht nur die Individuen, die es als erste (erfolgreich, Anmerkung des Verfassers) praktizieren (betrifft), sondern in gewissem Maße auch die anderen Individuen, mit denen sie im System in einer Wechselbeziehung stehen.“116 Weiter schreibt Merton, dass eine Zunahme abweichenden, aber erfolgreichen Handelns die Legitimität institutioneller Normen tendenziell schwächt, mit der Folge, dass die bestehende Anomie des jeweiligen sozialen Systems verstärkt wird und andere Individuen auf diesen Zustand ihrerseits mit abweichendem Verhalten reagieren: „Auf diese Weise sind Anomie und zunehmende Devianzraten als Faktoren anzusehen, die sich im Prozess der sozialen und kulturellen Dynamik wechselseitig beeinflussen, und zwar mit kumulativ zerstörerischen Folgen für die normative Struktur, sofern nicht Kontrollmechanismen aufgeboten werden, die dem entgegensteuern.“117 2.6.4. Ritualistische Anpassung Die ritualistische Anpassung beinhaltet die Aufgabe hochgesteckter kultureller Ziele (z.B. es im Leben zu „etwas“ zu bringen) oder die Reduktion dieser Zielorientierung bis zu einem Punkt, ab dem die Ansprüche erfüllbar werden. Dabei werden die institutionellen Normen nahezu zwanghaft weiter verfolgt. Die Menschen, die Merton mit seinem Konzept der ritualistischen Anpassung beschreiben wollte, zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus Angst vor Frustrationen und Misserfolgen nur kleinere Ziele verfolgen. Der Konkurrenzkampf und die relative Labilität eines erreichten Status führen zu akuter Statusangst, die die Menschen vorsichtig und risikoscheu werden lässt. In der Folge wird in routinehafter Weise ein Minimum an sozialen Verpflichtungen abgespult, um den Rollenerwartungen wenigstens gerecht zu werden. 115 Merton 1995, S. 171ff. („der soziale Prozess als Bindeglied zwischen Anomie und abweichendem Verhalten.“) 116 Merton 1995, S. 172 117 Merton 1995, S. 172f. 75 Für Merton ist die ritualistische Anpassung „jener Anpassungsmodus, bei dem Menschen, indem sie diese Ziele aufgeben und sich umso zäher an die gesicherten Abläufe und institutionellen Normen klammern, individuell und privat den Gefahren und Frustrationen zu entgehen suchen, die ihnen der Konkurrenz um die wichtigsten kulturellen Ziele inhärent scheinen.“118 Was macht diese Menschen zu gesellschaftlichen Außenseitern? Es ist Weigerung, sich ständig aufs Neue in einem Konkurrenzkampf bewähren zu müssen, die offenkundige Ablehnung einer gesellschaftlichen Moral, die darauf gerichtet ist, dass man nur dann ein akzeptables Gesellschaftsmitglied ist, wenn man zu den Gewinnern zählt. Es ist die Kapitulation vor einer gesellschaftlichen Erwartung, derzufolge ein bestimmtes Ziel gegebenenfalls trotz wiederholter Rückschläge, und wenn es sein muss, ein Leben lang, zu verfolgen sei. Merton bezweifelt, dass hier gesellschaftlich relevante Abweichung vorliegt. Das Verhalten ist nach außen hin nicht das kulturell bevorzugte, aber dennoch institutionell erlaubt. 2.6.5. Rückzug Der Rückzug als Anpassungsmodus kann uneingeschränkt zur Explikation von Außenseiterphänomenen benutzt werden. Es ist eine Anpassung an gesellschaftliche Verhältnisse, die vollständig als widersprüchlich gedeutet werden. Dahinter steht die Ablehnung der kulturellen Ziele und der institutionellen Mittel, diese zu erreichen. Die Mitglieder dieser Gruppe gehören genaugenommen in die Gesellschaft, aber nicht zu ihr. Merton bezeichnet sie als „richtige Außenseiter“. Und dazu gehören für ihn z.B. Psychotiker, Autisten, Vagabunden, Tramps, Alkoholiker, Junkies usw. – im Grunde genommen all jene, die die Schwelle der Sichtbarkeit ihres sozialen Mangels überschritten haben und der Gesellschaft unerwünschte Eigenschaften präsentieren. Dieser Anpassungsmodus findet Anwendung bei den Individuen, die unfähig oder unwillig sind, legitime oder illegitime Mittel zur Zielerreichung zu praktizieren, bzw. bereits versucht haben, 118 76 Merton 1995, S. 145 ihre Ziele mit legitimen oder illegitimen Mitteln zu erreichen, aber auch hierin gescheitert sind. Die daraus folgende Unzufriedenheit schlägt sich im Sinne eines intrapersonalen Konfliktes nieder: „Einmal steht die verinnerlichte moralische Verpflichtung zur Einhaltung der institutionellen Mittel und Wege in Widerspruch zu dem Druck zum Rückgriff auf unerlaubte (aber vielleicht zum Ziel führende) Mittel, und außerdem sind dem Einzelnen die Mittel und Wege, die sowohl legal als auch erfolgreich sind, versperrt. (...) Der Konflikt wird gelöst, indem beide auslösenden Elemente aufgegeben werden, die Ziele und die Mittel.“119 Das ist der Typus abweichenden Verhaltens, der von den etablierten Mitgliedern der Gesellschaft am meisten verachtet wird. Die bisher diskutierten Verhaltensabweichungen und Außenseiterpositionen kommen in der öffentlichen Beurteilung allesamt besser weg: dem Innovationisten billigt man eine Lebenstüchtigkeit zu, die man mit der Formel „man darf alles, sich nur nicht erwischen lassen“ umschreiben kann. Ritualisten lässt man für gewöhnlich in Ruhe, solange sie keinen allzu großen Schaden für das soziale System anrichten. Zur Not werden sie in den vorgezogenen Ruhestand geschickt. Von diesen unterscheidet sich der „Retreatist“, indem er die Ziele nicht teilt, und von jenen unterscheidet er sich, indem er die Mittel nicht anwendet. Er ist also ein unproduktiver Passivposten, dessen Daseinsberechtigung nur darin gesehen werden kann, dass seine bloße Existenz zur Hebung von Moral und Selbstachtung der übrigen, konformistischeren Gesellschaftsmitglieder beiträgt, indem er „vorführt, was mit einem Menschen geschieht, der die herrschenden Ideale ablehnt und mit Verachtung straft.“120 2.6.6. Rebellion Der Anpassungsmodus „Rebellion“ zeichnet sich dadurch aus, dass eine Entfremdung von herrschenden Normen und Zielen vorliegt. Aber während der „Retreatist“ zwar auch die kulturellen Vorgaben ablehnt, so unterscheidet er sich doch dadurch von dem „Rebellen“, indem er sie durch nichts ersetzt. Der „Rebell“ hingegen will eine andere Sozialstruktur schaffen: 119 120 Merton 1995, S. 148 Merton 1995, S. 149 77 „Rebellion bedeutet eine echte Umwertung, bei der die direkt oder stellvertretend erlebte Frustration zur vollkommenen Absage an die früher hochgeschätzten Werte führt.“121 Im Gegensatz zu dem Innovationstypus, bei dem es ja bisweilen auch um Veränderungen des sozialen Systems gehen kann, ist das Vorgehen in dieser Kategorie volitional, das heißt, dass es im Wesentlichen intellektuell bzw. ideologisch motiviert ist. Merton fährt daher fort: „Wenn das Institutionensystem als die Barriere angesehen wird, an der die Befriedigung der legitimen Ansprüche scheitert, ist damit der Boden für die Rebellion als Anpassungsreaktion bereitet. Soll daraus ein organisiertes politisches Handeln werden, muss nicht nur der herrschenden Gesellschaftsstruktur die Gefolgschaft verweigert, sondern diese auch auf neue Gruppen übertragen werden, die im Besitz eines neuen Mythos sind.“122 2.7. Die formelle Analyse der Devianz Die Bezugnahme auf Mertons Anomietheorie im Rahmen der strukturfunktionalen Theorie über Abweichung war erforderlich, da Mertons Anomiekonzept von Parsons als Erklärung für die Motivation zu abweichendem Verhalten verwendet wird: „This classification is of interest, not only because of its direct derivation from the analysis of the interaction paradigm, but because it restates, from the motivational point of view, in essentials the classification put forward some years ago by Merton in his wellknown paper on Social Structure and Anomie.”123 Auf dieser Grundlage können nunmehr weitere Ausführungen zu Parsons’ komplexen Überlegungen bezüglich sozialer Abweichung erfolgen. Zunächst unterscheidet Parsons zwischen aktiver und passiver Devianz, die sich jeweils im Rahmen von Interaktionsprozessen manifestiert. Bei der aktiven Devianz besteht ein größeres Maß an Initiative und mehr Kontrolle über den Interaktionsprozess (hierzu zählen in der Terminologie von Merton „Innovation“ und „Rebellion“). 121 Merton 1995, S. 150f. Merton 1995, S. 151 123 Parsons 1951, S. 257 122 78 Bei der passiven Variante von Abweichung fehlt die o.a. Initiative und Definitionsmacht (hierzu zählen die Konzepte „Ritualismus“ und „Rückzug“). Die Matrix, die Devianz nach den Dimensionen Aktivität/ Passivität versus Konformität/Entfremdung aufschlüsselt, wurde weiter oben bereits vorgestellt. Hinzuzufügen ist noch, dass die Aktivitätsdimension der Zielorientierung bei Merton entspricht, wohingegen die passive Dimension den Nachdruck auf Mittel/Methoden i.S. von Merton setzt. Eine dritte Unterscheidung wird von Parsons noch eingeführt, und zwar die der Bezugnahme auf soziale Objekte (z.B. Personen) oder auf Normen: „the possibility of differentitation between focussing on one or the other of the two fundamental components of the interactive system beside ego´s own needdisposition system, namely alter as a person, i.e. a social object and the normative pattern which integrates their interaction.“124 Die Integration der Dimensionen Konformität/Entfremdung, Aktivität/Passivität und soziale Objekte/Normen zeigt Parsons in der nächsten Matrix. Damit entwickelt Parsons ein schematischtabellarisches Instrument, mit dem sämtliche Formen von Abweichung und Devianz (in Anlehnung, aber auch Erweiterung des Anomiekonzeptes von Merton) erklärbar sein sollen: Conformative Dominance Alienative Dominance Activity Compulsive Performance Orientation Focus on Social Focus on Norms Objects Dominance Compulsiv Enforcement Rebelliousness Aggressiveness toward Social Objects Passivity Compulsive Acquiescence Focus on Social Focus on Norms Objects Submission Perfectionistic Observance (Merton’s ritualism) Withdrawal Compulsive Evasion Independence Independence Quelle: Parsons 1951, S.259 Wenn die Konformitätskomponente (conformative dominance) überwiegt und die Entfremdungskomponente (alienative dominance) unterlegen ist, liegt erzwungene Konformität vor (compulsive conformity). 124 Parsons 1951, S. 258 79 Im umgekehrten Fall liegt erzwungene Entfremdung (compulsive alienation) vor. Die Gründe für diese Bezeichnungen liegen darin, dass ego nicht nur unter der inneren Zerrissenheit aufgrund der Beziehung mit alter leidet, sondern auch noch aufgrund des inneren Konfliktes in seinem eigenen Bedürfnissystem: ego hat zwar ein negatives Gefühl gegenüber alter, aber auch ein machtvolles Bedürfnis, seine Beziehung zu alter zu erhalten, und auch zu dem maßgeblichen normativen Muster. Ego muss sich bemühen, seine negativen Gefühle nicht zu äußern, die Beziehung nicht zu gefährden. Um also das Verhältnis nicht weiter zu stören, wird zwanghaft konform agiert. Zwanghafte Ablehnung erfolgt indes, wenn ego unbedingt verhindern will, dass seine Position nach der Entfremdungskomponente aufgeweicht wird. In diesen zwanghaften Verhaltensmustern sieht Parsons einen Teufelskreis im Sinne der Genesis abweichender Identitäten, wie z.B. in den Fällen der Psychopathologie, Neurosen und Kriminalität. Zusammenfassend folgende fiktive Fallkonstellation: Es möge der Fokus des Konfliktes auf der sozialen Norm (dem normativen Muster) liegen unter der Aktivitätsbedingung und bei Dominanz von Konformität: Ego empfindet den zwanghaften Willen, Normerwartungen gegenüber alter zu verschärfen und praktiziert perfektionistische Observanz. Dabei kann ego auch einen zwanghaften Leistungsdruck bei sich selbst entwickeln: damit wäre z.B. das soziale „Psychogramm“ eines gnadenlosen Vorgesetzten entworfen. Parsons beschreibt in „Sozialstruktur und Persönlichkeit“ einen Typus passiver Devianz, der für die Außenseiterthematik dieser Arbeit fruchtbar herangezogen werden kann: Krankheit. Wie schon Merton festgestellt hat, sind „richtige“ Außenseiter unter der Rückzugsbedingung als Anpassungsalternative zu finden. Folglich gilt auch bei dem oben dargestellten Schema, dass Kranksein einzuordnen ist: 1. unter der Bedingung der Dominanz von Abweichung (Alienative Dominance) als eine passive Form des Verhaltens, 2. der Fokus bzw. der Akzent der Abweichung liegt auf dem Verhältnis zu den sozialen Objekten. 80 Parsons bezeichnet diesen Verhaltensmodus als „Compulsive Independence“. Er begründet dies folgendermaßen: „Das strukturelle Muster der Krankheit sollte den drei Kriterien der Entfremdung, Passivität und Objektorientierung zufolge somit als ein Fall „zwanghafter Unabhängigkeit“ (hier Compulsive Independence)125 betrachtet werden. Zwanghafte Unabhängigkeit kann hier als ein Phänomen verstanden werden, das eine Reaktionsbildung gegen tieferliegende Abhängigkeitsbedürfnisse enthält.“126 Das Ziel seiner Arbeit ist „der Versuch, die soziokulturellen Definitionen von Gesundheit und Krankheit (...) im Lichte der amerikanischen Werte zu untersuchen.“127 Parsons geht davon aus, dass es „ein relativ kohärentes, geschlossenes und im ganzen stabiles, gesellschaftlich institutionalisiertes Wertsystem in Amerika gibt.“128 Dieses Wertesystem wird von ihm auch als „instrumentaler Aktivismus“ bezeichnet: „Instrumental bedeutet in diesem Zusammenhang, dass weder die Gesellschaft als Ganzes noch irgendeiner ihrer Aspekte (etwa der Staat) zu einem ‚Zweck an sich‘ erhoben, sondern als instrumental für ‚lohnende‘ Dinge betrachtet werden.“129 Nach Parsons sind in der amerikanischen Gesellschaft folgende Werte besonders betont: Aktivismus, Weltlichkeit und Instrumentalismus.130 Unter Aktivismus versteht er, „dass die Gesellschaft in Bezug auf ihre Situation oder Umwelt an der Beherrschung ihrer Umwelt im Namen von Idealen und Zielen orientiert sein soll.“131 Das heißt: die Zielrichtung soll nicht auf Anpassung an unbefriedigende Verhältnisse gerichtet sein. Mit Weltlichkeit meint Parsons, dass „der Bereich der primär als positiv bewerteten Tätigkeiten in praktischen, weltlichen Zielen liegt, nicht in Kontemplation usw.“132 125 Parsons 1951, S. 259 Parsons 1964, S. 359 (in der Fußnote) 127 Parsons 1964, S. 323 128 Parsons 1964, S. 299f. 129 ebd. 130 vgl. Parsons 1964, S. 348 131 Parsons 1964, S. 349 132 ebd. 126 81 Und unter Instrumentalismus versteht Parsons einen ungebrochenen Optimierungswillen: „(Es) gibt eine unbegrenzte Perspektive möglicher Verbesserung, die des ‚Fortschritts‘, der das Ideal verwirklicht, indem er sich Schritt für Schritt in der wünschenswerten Richtung bewegt.“133 Die von Parsons diskutierten Wertorientierungen kulminieren somit gewissermaßen in einer Leistungsorientierung – Leistung ist ja auch Element der fünften und damit „ranghöchsten“ pattern-variable. Parsons bemerkt außerdem, dass nicht nur Leistung an sich positiv zu bewerten ist, sondern auch die Bedingungen dafür, dass diese Leistung überhaupt möglich ist. Dazu zählt er „Freiheit“, als „das Fehlen unnötig hinderlicher Beschränkungen“ und „Chancen“ als „Strukturierung positiver Möglichkeiten.“134 Diese Orientierung führt nach Parsons Ansicht zu einer stetigen Optimierungsdynamik gesellschaftlicher Prozesse: „Der Aktivismus unserer Werte erhellt, dass wir nicht eine statische, unveränderliche Gesellschaft positiv bewerten, sondern vielmehr eine Gesellschaft, die sich ständig in einer progressiven Richtung wandelt, das heißt in Übereinstimmung mit unseren zentralen Werten (...). Wir schätzen Stabilität, aber Stabilität im Wandel, nicht totale Stagnation.“135 Vor diesem Hintergrund definiert Parsons psychische Krankheit im Zusammenhang mit sozialer Rollenerfüllung, das heißt der Tatsache, dass von dem Individuum in seinem gesellschaftlichen Umfeld erwartet wird, dass es die von seiner (Berufs)Rolle definierten Leistungen erbringt: „Da für die direkte gegenseitige Durchdringung von sozialen Systemen und Persönlichkeit die Ebene der Rollenstruktur im Mittelpunkt liegt, wird psychische Krankheit durch die Unfähigkeit zum Problem, die sozialen Rollenerwartungen zu erfüllen.“136 Krankheit sei zwar ein Zustand des Individuums, aber auf der Ebene des sozialen Systems wird „dieser Zustand für beide Seiten, sowohl für den Kranken, als auch für die anderen, mit denen er innerhalb der sozialen Rollenbeziehung in Kontakt steht, manifest und 133 Parsons 1964, S. 349f. ebd. 135 Parsons 1964, S. 299f. 136 Parsons 1964, S. 325 134 82 problematisch.“137 Dabei geht es um die Erfüllung bestimmter Rollenerwartungen, das heißt um „die Fähigkeit, in solche Beziehungen einzutreten, und die mit derartigen Zugehörigkeiten verbundenen Erwartungen zu erfüllen.“138 Parsons spricht von Mechanismen, die die Anpassung des Individuums an komplexe soziale Situationen im sozialen System ermöglichen, und wenn die Anpassungsmechanismen zusammenbrechen, kann psychische Krankheit eine Möglichkeit für das Individuum sein, auf die Spannungen zu reagieren, denen es im Laufe des sozialen Prozesses unterworfen ist. Gegen die Werte des „instrumentalen Aktivismus“ verstößt Krankheit als Seinsweise des Menschen. Wer nicht gesund ist, kann die geforderte und erwartete Leistung nicht erbringen. Er verstößt gegen die Werte des kulturellen Systems, verletzt die Rollenerwartungen des sozialen Systems und wird damit zum gesellschaftlichen Außenseiter. Parsons verkennt nicht, dass das Leben in den westlichen Gesellschaften der Moderne komplex geworden ist und größere Anforderungen an das Individuum gestellt werden. Aber: „Die Motivation, über psychische oder psychosomatische Bahnen in die Krankheit auszuweichen, hat sich verstärkt und damit die Bedeutung wirksamer Mechanismen zur Kontrolle dieses Ausweichens.“139 Auch ist „Krankheit kein wünschenswerter Zustand, sondern ein Zustand, der so rasch wie möglich überwunden werden muss.“140 Und weiter: „Wie Durkheim am Beispiel des Verbrechens klar machte, ist die Auffassung der Krankheit als eines illegitimen Zustandes deshalb von größter Bedeutung für die Gesunden, weil sie ihre eigenen Motivationen, nicht krank zu werden, verstärkt und damit verhindert, dass Muster abweichenden Verhaltens übernommen werden.“141 Krankheit wird also von Parsons deutlich als Abweichung stigmatisiert. Sie kann „motivationsmäßig wie bakteriologisch ‚ansteckend‘ sein.“142 Zwar besteht gewissermaßen ein gesellschaftliches Moratorium für die „wirklich“ Kranken, in dem Sinne, dass der Kranken137 ebd. ebd. 139 Parsons 1964, S. 353 140 Parsons 1964, S. 347 141 ebd. 142 Parsons 1964, S. 346 138 83 stand als Status akzeptiert wird, in dem eine „legitime Grundlage für die Befreiung des kranken Individuums von normalen Rollen- und Aufgabenverpflichtungen“143 zuzugestehen ist, aber der Kranke hat, ganz im Sinne der o.a. amerikanischen Werte, alles zu tun, um den Krankenstand zu überwinden und mit den behandelnden Institutionen aktiv auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Mit seiner Abhandlung über Krankheit hat Parsons deutlich gemacht, wie nach seinen Vorstellungen ein Individuum trotz einer Beeinträchtigung ein vollwertiges Gesellschaftsmitglied bleiben kann: wenn Krankheit oder ein vergleichbares Handikap vorliegt, soll dies nach Möglichkeit überwunden werden. Nach Parsons Ansicht gehört es nicht zu den möglichen Handlungsoptionen eines Individuums, sich mit einer Beeinträchtigung abzufinden, die das Individuum an der Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen hindert. Eine solche Haltung steht im Widerspruch zu dem, was dem Individuum im Rahmen seiner Sozialisation nahegebracht wurde. Die Menschen, die in einem solchen Zustand leben müssen, weil sie krank oder alt oder behindert sind, können daher eine Divergenz zwischen dem, was sie tatsächlich sind, und dem, was sie nach den Vorstellungen einer leistungs- und jugendorientierten Gesellschaft sein sollten, empfinden. Eine theoretische Annäherung an diese Desintegrationserfahrung führt zu einer zentralen Hypothese dieser Arbeit. 2.8. Desintegrationstheorem Die Theorien Eriksons und Parsons’ entsprechen einander in ihrer positiven und apologetischen Orientierung an den Wertstrukturen der modernen amerikanischen Gesellschaft. Sie sind insofern „normativ“, als sie eine Entwicklungsfolge im positiven Sinne thematisieren, die sich an gesellschaftlichen Wertsetzungen orientiert. Diese Theorien erhalten insoweit sogar einen ideologischen Anstrich, weil sie eindeutig Stellung beziehen: eine ontogenetische Entwicklung, die normabweichend verläuft, wird als negativ gekennzeichnet. Weiterhin ist für beide Theorien bedeutsam, dass die Individuen im Verlauf ihrer Persönlichkeitsentwicklung wenig Autonomie 143 84 Parsons 1964, S. 345 besitzen. Sie entwickeln sich aufgrund ontogenetischer Prozesse, die mit ihrer körperlichen Reifung konvergieren. In Ergänzung dazu wirken sich, bei Erikson weniger, bei Parsons mehr, die Umwelteinflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung aus. Im Falle eines negativen Verlaufes der Persönlichkeitsentwicklung ist in beiden Theorien eine Desintegration der Identität beschrieben worden, denn Identität als Ergebnis eines Sozialisationsprozesses stellt letztlich eine Integrationsleistung dar. Erikson ist davon ausgegangen, dass sich die „gesunde Persönlichkeit“ in einem Zusammenhang von Kollektivität und Zugehörigkeit wiederfindet, dass sie also in ihrer eigenen Identität die Werte und Ziele des Kollektivs reproduzieren kann. Eine integrierte Identität stellt das Gegenteil der zersplitterten Identität eines Menschen dar, dessen Entwicklung nicht zu einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe führte, dessen Identitätsentwicklung somit negativ endete. Auch Parsons geht davon aus, dass am Ende einer gelungenen Sozialisation die Integration der Subsysteme des Individuums (organisches System und psychisches System) in die übergeordneten Systemzusammenhänge des sozialen und des kulturellen Systems (in der Reihenfolge Körper-IndividuumFamilie-Gesellschaft) steht. Diese Integrationsleistung vollzieht sich über die Rollenbezüge des Individuums mit dem Ziel, letztlich eine integrierte Persönlichkeit zu werden, die eine einheitliche Identität besitzt. Nach der Theorie vollzieht sich über den Sozialisationsprozess gleichsam automatisch eine Assimilation der Bedürfnisdispositionen an die gesellschaftlichen Vorgaben, was sich zum Beispiel in einer reibungslosen Komplementarität der Verhaltenserwartungen interagierender Individuen äußert. Diese Komplementarität ist jedoch gefährdet, wenn die motivationale Orientierung nicht ausreichend an die Systembedürfnisse angepasst ist: Rollenerwartungen werden nicht so erfüllt, wie es erwartet wird, weil ihre motivational fundierten Entsprechungen im personalen System fehlen. Wenn jedoch Identität nach der strukturfunktionalistischen Theorie eine Reifikation der maßgeblichen Rollenbezüge ist, wenn sie sich also ausschließlich aus der Entsprechung der motivationalen Struktur des personalen 85 Systems mit den Erwartungen des sozialen Systems und den Wertsetzungen des kulturellen Systems ableiten lässt, so bedeutet dieser Mangel an systembezogener Entsprechung zum einen ein Mangel an Integration der für das Individuum maßgeblichen Systemebenen in seiner Handlungsorientierung, und weiters ein Mangel an, letztlich von sozialen Rollen definierter, Persönlichkeitsqualität, das heißt von Identität im Sinne eines umfassenden Rollenderivates. Auch Parsons muss die Gefährdung seiner Identitätskonzeption erkannt haben. In einem Aufsatz, der 1968 veröffentlich wurde, schreibt er Folgendes: „die Tatsache, dass Rollenpluralismus an Bedeutung gewinnt, bedeutet, dass die Individuen mehr zentrifugalen Kräften ausgesetzt sind, weil an jede Rollenverpflichtung je eigene Erwartungen, Belohnungen und Verpflichtungen geknüpft sind. Für die Persönlichkeit wird es unerlässlich, ein angemessenes Niveau der Integration dieser einzelnen Komponenten herzustellen.“144 Der weitere Schluss liegt nahe: wenn dieses Niveau nicht erreicht wird, gebricht es dem Individuum jener „Integrität“, die im Zusammenhang mit Parsons’ Konzeption von Identität steht, und dies bedeutet für die Person einen Verlust ihrer „Fähigkeit, nicht nur kognitiv konsistent, sondern als Handelnder und als Objekt in all ihren Hauptlebensbereichen integriert zu sein, sowohl in ihren verschiedenen Rollen, wie auch in den Kontexten, die nicht angemessen unter soziologischen Gesichtspunkten analysiert werden können.“145 Mit diesem Zitat ist eine Thematik angesprochen, auf die ich später nochmals zurückkommen werde, die die Schwierigkeiten der Identitätsgewinnung in der fortgeschrittenen Moderne beinhaltet. Das Desintegrationstheorem, das ich bisher nur im Zusammenhang normativ orientierter Theoriestränge belegen kann, lässt sich auch aus anderen Theorien herauslesen. Im nächsten Abschnitt befasse ich mich daher mit den theoretischen Aussagen zur Identitätsentwicklung, die dem sogenannten interpretativen Paradigma in der Soziologie zugerechnet werden 144 145 86 Parsons 1968, S. 73 Parsons 1968, S. 78 und den daraus ableitbaren Aussagen zu Abweichung und Außenseitertum. 87 3. Identität im interpretativen Paradigma – das Individuum als Subjekt Den theoretischen Konzeptionen des normativen Paradigmas stehen die subjektivistischen Ansätze gegenüber. Diese kann man als eine „theoretische Erkenntnisweise verstehen, die sich ausschließlich auf subjektive Gegebenheiten bezieht, das heißt auf Praktiken, Wahrnehmungen, Intentionen oder kognitive Repräsentationen, wie sie der praktischen Erfahrung sozialer Akteure unmittelbar gegeben sind.“146 Das subjektivistische Konzept korrespondiert mit dem „interpretativen Paradigma“, welches von Wilson folgendermaßen definiert wird: „Nach dem interpretativen Paradigma können (...), im Unterschied zum normativen Paradigma, Situationsdefinitionen und Handlungen nicht als ein für allemal explizit oder implizit getroffen und festgelegt angesehen werden. (...) Vielmehr müssen Situationsdefinitionen und Handlungen angesehen werden als Interpretationen, die von den an der Interaktion Beteiligten an den einzelnen ‚Ereignisstellen‘ der Interaktion getroffen werden, und die in der Abfolge von ‚Ereignisstellen‘ der Überarbeitung und Neuformulierung unterworfen sind.“147 Es gibt nach diesem Erklärungsmodus also keine prävalenten übereinstimmenden Situationsdefinitionen; ein Abspulen innerer oder äußerer Handlungsanleitungen findet nicht statt. Im Vordergrund steht vielmehr die Dynamik eines interpretativen Interaktionsprozesses, der z.B. im Symbolischen Interaktionismus seinen Ausdruck darin findet, dass die Identität des Individuums letztlich Resultat einer sozialen Konstruktion ist. 3.1. Die Theorie des Selbst – einführende Bemerkungen zu George Herbert Mead Die Arbeiten Meads sind durch die in Amerika im ausgehenden 19. Jahrhundert entstandene philosophische Lehre des Pragmatismus beeinflusst, deren Credo es war, dass sich das Wesen des Menschen in seinem Handeln offenbart. Das Denken und Entscheiden des Menschen wird nach dem Nutzen des sich daraus ergebenden Verhaltens beurteilt. Vor diesem Hintergrund 146 147 88 Schwingel 1995, S. 35 Wilson 1973, S. 61 grenzte sich Mead von zwei psychologischen Theorien, die zu der Zeit konzipiert wurden, deutlich ab. Es handelt sich dabei um den Behaviorismus und die Psychoanalyse. Mead wandte sich gegen elementare Aussagen dieser Lehren, soweit sie die kognitive Bedeutung des menschlichen Verhaltens ignorierten und im menschlichen Verhalten nichts als nur die Abfolge von Reaktionen auf äußere Reize oder eine mechanistische Triebabfuhr sahen. Mead indessen erarbeitete in seiner Lehre ein reines Subjektmodell des Menschen, in dem er ein aktiv handelndes und vernunftbegabtes Individuum erkannte. Zu Meads Argumentation gegen den Behaviorismus schreibt Abels: „Mead erklärte die tätige Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Welt mit einer spezifisch menschlichen Fähigkeit, die er Geist nennt. Sie besteht darin, signifikante Symbole zu schaffen und zu verwenden. Diese Fähigkeit, die das Verhalten steuert, ist in sozialen Prozessen entstanden und wird in sozialen Prozessen immer wieder bestätigt.“148 Dazu gehört auch die Ablehnung der Annahme einer Determination menschlichen Verhaltens durch unbewusste seelische Vorgänge, wie sie als Grundannahme der Psychoanalyse gelten: „Wo er den Begriff des Bewusstseins oder der inneren Erfahrung zuließ, band er ihn an objektiv sichtbares Verhalten in konkreten sozialen Prozessen und nicht an eine innere, subjektive Welt.“149 Diese pragmatistische Sichtweise erteilt jeglichem Determinismus, unter dem das Handeln des Menschen stehen soll, eine Absage. Insoweit sie das Individuum zum Herrn des Geschehens erhebt, gibt sie dem Menschen als handelndem Subjekt die Autonomie zurück, die ihm der Behaviorismus und die Psychoanalyse abgesprochen haben. 3.2. Kommunikation, Identität und Gesellschaft Meads grundlegende sozialpsychologische Position zur Sozialisation und Identitätsgenese beinhaltet, dass Menschen sich gegenüber Tieren dadurch auszeichnen, in einer Welt zu leben, die sich ihren Gedanken und Sinnen über symbolische Bedeutungen erschließen. Diese symbolischen Bedeutungen werden intersubjektiv im Wege der Kommunikation übermittelt; 148 149 Abels 1997b, S. 13 Abels 1997b, S. 14 89 eine lexikalische Definition des Begriffes „Kommunikation“150 impliziert, dass es sich dabei um die „nachrichtliche Übertragung bzw. Signalisierung von sozial signifikanten Bezugsinhalten oder Symbolen (handelt)“. Kommunikation wird von Mead als „Grundprinzip der gesellschaftlichen Organisation“151 bezeichnet. Sie vollzieht sich im Wesentlichen im Medium der Sprache; diese ist „die höchstentwickelte Form der Kommunikation. In der Sprache sind die kollektiven Erfahrungen einer Gesellschaft gespeichert. Sie ist Träger intersubjektiv geteilten Wissens und versorgt uns mit den Erklärungen für Situationen, wie wir sie normalerweise erleben.“152 Sprache ist das spezifisch menschliche Zeichensystem und insofern von herausragender Bedeutung, als sie intersubjektiv geteiltes Wissen über das gemeinsame Leben in einer sozialen Umwelt zu transportieren vermag und dabei die Abstraktion von der konkreten Situation, dem „Hier und Jetzt“ der Lebenswelt erlaubt. Sie verfügt noch zusätzlich über die Kapazität, Informationselemente zu transportieren, die aufgrund ihres informellen Charakters mit anderen Medien, wie z.B. der Schrift, kaum vermittelbar sind. Dabei denke ich an den spezifischen Informationsgehalt, den die Modulation der Stimme oder der Sprachgeschwindigkeit oder die Anwendung rhetorischer Stilmittel (z.B. Pausen) bewirken kann. Sprache ist dazu fähig, „eine Fülle von Phänomenen zu vergegenwärtigen, die räumlich, zeitlich und gesellschaftlich vom Hier und Jetzt abwesend sind. Genauso kann sie weite Bereiche subjektiver Erfahrung und subjektiv gemeinten Sinnes im Hier und Jetzt objektivieren. Kurz gesagt, durch die Sprache kann eine ganze Welt in einem Augenblick ‚vorhanden‘ sein.“153 Über die Sprache erschließen sich die Menschen ihre Welt, und zwar nicht nur die den Einzelnen umgebende (soziale) Umwelt, sondern auch sich selbst. Mead schreibt dazu Folgendes: „Der Einzelne erfährt sich – nicht direkt, sondern nur indirekt – aus der besonderen Sicht anderer Mitglieder der gleichen gesellschaftlichen Gruppe oder aus der verallgemeinerten Sicht 150 z.B. Deutsch 1963 vgl. Mead 1934, S. 299 152 Abels 1997b, S. 19f. 153 Berger und Luckmann 1966, S. 39f. 151 90 der gesellschaftlichen Gruppe als ganzer, zu der er gehört. Denn er bringt die eigene Erfahrung als einer Identität oder Persönlichkeit nicht direkt oder unmittelbar ins Spiel, nicht indem er für sich selbst zu einem Subjekt wird, sondern nur insoweit, als er zuerst zu einem Objekt für sich selbst wird, genauso wie andere Individuen für ihn oder in seiner Erfahrung Objekte sind; er wird für sich selbst nur zum Objekt, indem er die Haltungen anderer Individuen gegenüber sich selbst innerhalb einer gesellschaftlichen Umwelt oder eines Erfahrungs- und Verhaltenskontextes einnimmt, in den er ebenso wie die anderen eingeschaltet ist. Die Bedeutung der ‚Kommunikation‘ liegt in der Tatsache, dass sie eine Verhaltensweise erzeugt, in der der Organismus oder das Individuum für sich selbst zum Objekt werden kann.“154 Das Individuum erfährt nach dieser Theorie, über den Umweg der Kommunikation mit anderen, die Sachverhalte über seine Person, die für die Entwicklung eines Gefühles für sich selbst maßgeblich sind. Das Individuum erfährt sich selbst sozusagen mit den Augen der Anderen, aufgrund dieser Erfahrung gewinnt es eine Bewusstheit seiner selbst als Voraussetzung für seine Identität. Die im kommunikativen Prozess gewonnene individuelle Identität bezieht sich immer auf die soziale Umwelt, denn es zeigt sich, dass „eine (...) etwas mitteilende Person die Haltung des anderen Individuums genauso einnimmt, wie sie sie beim anderen hervorruft. Sie befindet sich selbst in der Rolle der anderen Person, die sie auf diese Weise anregt und beeinflusst. Indem sie diese Rolle der anderen übernimmt, kann sie sich auf sich selbst besinnen und so ihren eigenen Kommunikationsprozess lenken. Diese Übernahme der Rolle der anderen ist für die Entwicklung der kooperativen Gesellschaft wichtig. Die unmittelbare Wirkung dieser Übernahme einer Rolle liegt in der Kontrolle, die der Einzelne über seine eigenen Reaktionen ausüben kann.“155 Auf diese Weise, also über die Kommunikation, sieht sich ego selbst in den Augen alters. Insoweit erfolgt eine wechselseitige Verständigung über Perspektiven und Rollen der Interaktionspartner.156 Dabei offen154 Mead 1934, S. 180 Mead 1934, S. 300f. 156 vgl. Abels 1997b, S. 22 155 91 baren sie in ihrem Handeln, wie sie sich selbst und die anderen sehen. Sie handeln auf der Grundlage subjektiver Theorien und Antizipationen über das Denken und Handeln des jeweils Anderen. Dieses Denken im Kontext der Erfahrung seiner selbst und der anderen ist die Voraussetzung für jene Selbstbewusstheit, aus der sich Identität ableitet. Gesellschaftsmitglieder mit gesellschaftlich geprägter Identität, die auf der Grundlage gegenseitiger Verhaltenserwartungen handeln, generieren überdauernde Handlungsstrukturen, die eine Grundlage für ein stabiles gesellschaftliches Miteinander sind. So entfaltet Mead aus dem Gedanken des KommunikationsIdentitätszusammenhanges auch eine Theorie der Gesellschaft als kommunikative Konstruktion denkender Individuen. Die sozialen bzw. kommunikativen Handlungsstrukturen, die von zeitlicher Dauer sind und in identitätsgenerierender Weise die Persönlichkeitsentwicklung der Individuen beeinflussen, können den Charakter von Institutionen haben. Sprache selbst ist eine Institution, die eine Festlegung bezüglich bestimmter sinnhaft determinierter Sachverhalte darstellt, an die sich die Individuen zu halten haben, wenn sie sie nutzen, von ihr profitieren wollen. Mead teilt die anthropologische Überzeugung, wonach die Bildung von Institutionen im Allgemeinen und Sprache im Besonderen, als wesentliche Voraussetzung für menschliche Gesellschaftsformationen anzusehen ist. So schreibt er: „Die Entwicklung der Sprache, insbesondere des signifikanten Symbols, ermöglicht es, dass diese externe gesellschaftliche Situation in das Verhalten des Einzelnen hereingenommen wird. Daraus leitet sich die enorme Entwicklung ab, die für die menschliche Gesellschaft typisch ist, die Möglichkeit, zukünftige Reaktionen der Individuen vorauszusehen, und die vorwegnehmende Anpassung an sie durch den Einzelnen.“157 Über die Sprache erwerben die Individuen nicht nur eine Identität. Auf dieser Grundlage sind sie auch dazu in der Lage, an den gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben, als Gesellschaftsmitglieder überhaupt eine Lebensgrundlage zu erlangen. 157 92 Mead 1934, S. 230f. 3.3. Die Ontogenese der Identität Der ontogenetische Prozess der Entwicklung von Identität vollzieht sich zunächst als allmähliche Hereinnahme der Rollen und Standpunkte und Erwartungen, der signifikanten Anderen im Bewusstseins- und Handlungshorizont des Individuums. Die signifikanten Anderen sind dem engeren sozialen Umfeld des Kindes zugehörig. Diese Rollenübernahme vollzieht sich im „play“ und manifestiert sich in der spielerischen Übernahme der Rollen konkreter Menschen, die in dem frühen Erfahrungshorizont des Kindes prävalent sind. Gleichzeitig konkretisieren sich im Bewusstsein des Kindes die Erwartungen der begrenzten sozialen Umwelt, so dass sich, neben dem ursprünglich vorhandenen, gleichsam „natürlichen“ Identitätselement (Abels bezeichnet es als „impulsives Ich“158) dem von Mead so genannten „I“, erste „me’s“ konstituieren: „Das ‚I‘ reagiert auf die Identität, die sich durch die Übernahme der Haltungen anderer entwickelt. Indem wir diese Haltungen übernehmen, führen wir das ‚me‘ ein und reagieren darauf als ein ‚I‘.“159 Und an anderer Stelle heißt es: „das ‚I‘ ist die Reaktion des einzelnen auf die Haltung der Gemeinschaft, so wie diese in seiner Erfahrung aufscheint.“160 Das „I“ und das „me“ haben jeweils qualitativ unterschiedlichen Anteil an der Identität: „Beide sind im Prozess (des Verhaltens, Anmerkung des Verfassers ) getrennt, gehören aber so wie Teile eines Ganzen zusammen. Sie sind nicht identisch, da das ‚I‘ niemals ganz berechenbar ist. Die Identität ist im Wesentlichen ein gesellschaftlicher Prozess, der aus diesen beiden unterscheidbaren Phasen besteht.“161 Es ist einleuchtend, dass die Haltungen der Gemeinschaft, die ihren Niederschlag in der Entwicklung und der Ausprägung der „me’s“ finden, umfangreicher werden, je weiter die Sozialisation des Individuums fortschreitet. Dabei werden die signifikanten Anderen allmählich zahlreicher und deren Erwartungen weiter und polymorpher. 158 vgl. Abels 1997b, S. 33f. Mead 1934, S. 217 (aus Gründen der Verständlichkeit wähle ich abweichend von der deutschen Übersetzung die amerikanischen Originalbezeichnungen für die Instanzen der Persönlichkeit) 160 Mead 1934, S. 240 161 Mead 1934, S. 221 159 93 Schließlich verlässt das Kind den engen Bereich der Kernfamilie und wird in weitere soziale Zusammenhänge eingebunden. Mead hat dieses Stadium paradigmatisch mit dem Begriff „game“ belegt. Damit macht er deutlich, dass das Kind die Rollen aller im Wettspiel Beteiligten in sich organisieren und verinnerlichen und sie gleichzeitig in sein Handlungskonzept einbeziehen muss. Der Vergleich mit dem Wettkampf steht für die Situation des Individuums, das nach der Phase der primären Sozialisation aus der Herkunftsfamilie und deren Ubiquitätsanspruch heraustritt und sich den Erwartungen und Anforderungen der Institutionen im Rahmen der weiteren Sozialisation stellen muss.162 Mead beschreibt dies so: „Der grundlegende Unterschied zwischen dem ‚play‘ und ‚game‘ liegt darin, dass im Letzteren das Kind die Haltung aller anderen Beteiligten in sich haben muss. Die vom Teilnehmer angenommenen Haltungen der Mitspieler organisieren sich zu einer gewissen Einheit, und diese Organisation kontrolliert wieder die Reaktion des Einzelnen.“163 Eine wichtige Konsequenz der Verinnerlichung der Rollen der im gesellschaftlichen Prozess beteiligten Individuen mit ihrer Komplexität ist schließlich die Übernahme der gesellschaftlichen Position in das Bewusstsein des Individuums. So schreibt Mead: „Die organisierte Gemeinschaft oder gesellschaftliche Gruppe, die dem Einzelnen seine einheitliche Identität gibt, kann ‚der verallgemeinerte Andere‘ genannt werden.“164 Er ist, nach den signifikanten Anderen, jene Instanz, die das Individuum mit handlungsleitenden Soll-Anforderungen im Sinne von Werten und Normen der Gesellschaft, soweit sie nicht schon im Rahmen der primären Sozialisation vermittelt wurden, versorgt. Diese manifestieren sich in den Erwartungen, denen sich das Individuum gegenübersieht, wenn es im Rahmen der sekundären Sozialisation gesellschaftliche Rollen übernimmt: „Der generalisierte Andere ist die Summe der generellen Erwartungen aller, oder um es in einer anderen Theoriesprache zu sagen: es sind die Normen und Werte der Gesellschaft, die in einer bestimmten Situation oder Rolle relevant sind. Die Gesellschaft 162 vgl. Mead 1934, S. 194 Mead 1934, S. 196 164 ebd. 163 94 ist der umfassende generalisierte Andere.“165 Das Ziel der Sozialisation ist es, dass das Individuum die Erwartungen, die sich in dem generalisierten Anderen bündeln, in sein Verhaltensrepertoire übernimmt, um ihnen gemäß als Mitglied der Gesellschaft zu agieren: „Damit ein menschliches Wesen eine Identität im vollen Sinn des Wortes entwickeln kann, genügt es nicht, dass es einfach die Haltungen anderer Menschen gegenüber sich selbst und untereinander innerhalb des menschlichgesellschaftlichen Prozesses einnimmt und diesen Prozess als Ganzen nur in dieser Hinsicht in seine individuelle Erfahrung hereinbringt: es muss ebenso, wie es die Haltungen anderer Individuen zu sich selbst und untereinander einnimmt, auch ihre Haltungen gegenüber den verschiedenen Phasen oder Aspekten der gemeinsamen gesellschaftlichen Tätigkeit oder der gesellschaftlichen Aufgaben übernehmen, in die sie als Mitglieder einer organisierten Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe alle einbezogen sind; (...) Dieses Hereinholen der weitgespannten Tätigkeit des jeweiligen gesellschaftlichen Ganzen oder der organisierten Gesellschaft in den Erfahrungsbereich eines jeden in dieses Ganze (...) eingeschlossenen Individuums ist die entscheidende Basis (...) für die volle Entwicklung der Identität des Einzelnen: nur insoweit er die Haltungen der organisierten gesellschaftlichen Gruppe, zu der er gehört, (...) annimmt, kann er eine vollständige Identität entwickeln und (...) besitzen.“166 Zusammenfassend lässt sich Meads Konzept der Identitätsentwicklung folgendermaßen umschreiben: Identitätsgenese ist wesentlich Ergebnis sprachlich vermittelter Interaktionsbeziehungen, deren Funktion in der wechselseitigen Reaktion aufeinander, der wechselseitigen Konfrontation mit Verhaltenserwartungen und in der Folge der Internalisierung gesellschaftlich vorgegebener Werte und Normen liegt. Die Individuen reagieren auf Ereignisse im Lebensprozess nach der Maßgabe der in ihrem gesamten sozialen Erfahrungsbereich erworbenen generalisierten Bedeutungszuschreibungen. Dabei vollziehen sich diese Interaktionsbeziehungen zunächst im sozialen Nahbereich der primären Sozialisation, in der aktiv165 166 Abels 1997b, S. 31 Mead 1934, S. 197 95 kommunikativen Auseinandersetzung mit den signifikanten Anderen und erweitern sich im Rahmen der sekundären Sozialisation im Sinne der Hereinnahme des Standpunktes der Gesellschaft in das Denken des Individuums in der Gestalt des generalisierten Anderen, der als „Instanz der sozialen Erfahrung“167 die Identität beeinflusst. Wenzel führt weiter aus: „Mead fasst die Bildung der Identität als einen Prozess sozialer Erfahrung, in dem das Individuum schließlich die Perspektiven einer universalen und abstrakten Kommunikationsgemeinschaft zu übernehmen lernt. Struktur und emergente Einheit der Identität des Selbst bedeuten nichts anderes als die Internalisierung des Prozesses sozialer Erfahrung.“168 Habermas orientiert sich an den Aussagen Meads, indem er den Sozialisationsprozess als Rollenübernahme und Identitätsgenese deutet. Dafür steht folgendes Zitat: „Mead erklärt hauptsächlich die Struktur des Rollenhandelns, indem er zeigt, wie sich das Kind die soziale Welt, in die es hineingeboren wird und in der es aufwächst, nachkonstruierend aneignet. Komplementär zum Aufbau der sozialen Welt vollzieht sich die Abgrenzung einer subjektiven Welt; das Kind bildet seine Identität aus, indem es die Qualifikation erwirkt, an normengeleiteten Interaktionen teilzunehmen. Im Mittelpunkt der Analyse stehen also die Begriffe der sozialen Rolle und der Identität.“169 3.4. Innen- und Außenperspektive sowie theoretische Einwände Symbolische Interaktion ist ein prinzipiell offener Prozess. Bewertungen, die in den Kommunikationsprozess Eingang gefunden haben und bestimmte intersubjektiv geteilte Haltungen und Erwartungen scheinbar festschreiben, unterliegen einer fortwährenden Dynamik. So ist auch die soziale, intersubjektive Konstruktion der Identität nichts, das unveränderbar im Leben des Menschen existiert. Die gesellschaftliche Prägung bewirkt zwar, dass jede Identität einer sozialen Determination folgt, aber Menschen sind nicht 167 vgl. Wenzel 1985, S. 33 ebd. 169 Habermas 1981, S. 47 168 96 einfach nur darauf zu reduzieren, dass sie ausschließlich sozial determiniert seien. Mead hat diesem Umstand mit seiner Differenzierung der zwei Identitätsinstanzen „I“ und „me“ Rechnung getragen. Während die „me-Instanz“ das gesellschaftlich geprägte Ich repräsentiert, das sich in die sozialen Funktionszusammenhänge einpasst und der Vielfalt von Rollenerwartungen entspricht, bildet das „I“ eine Instanz, die dem Ich dazu dient, nicht restlos an gesellschaftliche Strukturen assimiliert zu werden. Die „me's“ repräsentieren die internalisierten Haltungen anderer, die in ihrer Gesamtheit den generalisierten Anderen bilden. Mead definiert das „I“ als eine „Phase der Identität“170. Insofern ist es ein Teil der Persönlichkeit mit einer ganz bestimmten Funktion: „Das ‚I‘ ist die Reaktion des Organismus auf die Haltungen anderer.“171 Das „I“ ist „vorsozial“, gleichsam „ein Erdenrest“, der nicht vollständig sozialisierbar und dem Freudschen „Es“ nicht unähnlich ist. Es bildet in diesem ganzen System so etwas wie eine organische Residualkategorie. Es ist stets unberechenbar und für die Wandlungen der Identität zuständig: „Neue Entwicklungen finden in den Aktionen des ‚I‘ statt.“172 In diesem Sinne sind Interaktionssituationen prinzipiell stets „offen“, und hierin liegt auch der tiefere theoretische Grund, weshalb in einigen Fällen eine einvernehmliche Identitätszuweisung misslingen kann. Abels schreibt hierzu Folgendes: „Mead hat einen prozessualen Ansatz zur Erklärung des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft verfolgt, der die Bedeutung des Individuums als Gestalter seiner Welt herausstellt. Ein entscheidender Unterschied (zu der strukturfunktionalistischen Theorie von T. Parsons, soweit sich diese mit Sozialisationsprozessen befasst (Anmerkung des Verfassers)) liegt aber in der sozialpsychologischen Perspektive auf das widerständige impulsive Ich. Während Parsons eine solche Differenz zwischen Individuum und gesellschaftlichen Erwartungen als Defizit interpretiert, ist es für Mead geradezu Voraussetzung für die Veränderung von Gesellschaft. Ganz nebenbei ist es auch Voraussetzung für Identität. Mead hat dem 170 vgl. Mead 1934, S. 221 Mead 1934, S. 218 172 Mead 1934, S. 253 171 97 Individuum in der Soziologie ein Stück Freiheit zurückgegeben und gleichzeitig gezeigt, dass gesellschaftliche Ordnung dadurch nicht gefährdet, sondern letztlich sogar gestärkt wird – allerdings als Ordnung im Wandel.“173 Das leibgebundene „I“, der körperliche Rest im Wesen des Menschen als Motor für Freiheit? Man kann das auch anders sehen, wie z.B. Tenbruck, der dem Menschen nach der Meadschen Logik jegliche Möglichkeit der Selbstbestimmung abspricht und ihn „hineingestellt zwischen die soziale Fixiertheit seines ‚me‘ und die uneinholbare Erratik seines Organismus“ sieht.174 Schließlich möchte ich noch auf folgenden theoretischen Einwand von Joas eingehen. Joas stellt zunächst fest, dass sich nach Meads Theorie die Identitätsgenese in Interaktionsprozessen vollzieht. Der Anteil des Individuums am Aufbau und der Ausbildung der Identität ist zwar nicht bestimmbar, es kann jedoch vermutet werden, dass er im Laufe zunehmender Reife und Souveränität im Umgang mit den Rollenstrukturen der Gesellschaft immer größer, wenn nicht sogar bestimmend wird. Joas stellt jedoch fest, „dass Mead (...) nur die dialogischdiskursiven Strukturen der Identitätsbildung (kannte) und nicht die identitätsstabilisierenden Wirkungen von Ausschluss und Ausgrenzung. (...) Meads explizite Theorie kennt nur die Identitätsbildung über Interaktion und Rollenübernahme.“175 Dabei gibt es in Meads Werk auch Ansätze für eine Konzeption von Identität, die nicht nach einem dialogischen Muster konstruiert ist. Joas weist darauf hin, dass gelingende Identitätsbildung unter dialogischen Bedingungen im Vordergrund der Meadschen Theorie thematisiert wird. In diesem Zusammenhang sind Mead und beispielsweise Erikson in ihrer theoretischen Ausrichtung analog: Identitätsbildung vollzieht sich in Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Strukturen, sie ist gesellschaftlich erwünscht und Voraussetzung für ein erfülltes Leben. So schreibt Joas: „Die Leistungen der Synthese zu einer konsistenten und kontinuierlichen Identität wurden nicht einfach nur beschrieben, 173 Abels 1997b, S. 37 Tenbruck 1985, S. 222 175 Joas 1997, S. 244f. 174 98 sondern es gab bei Mead und Erikson, wie bei allen Anhängern und Fortsetzern die stillschweigende Hintergrundannahme, dass es auch gut sei, eine Identität zu bilden – gut zumindest in dem auch empirisch bestätigbaren Sinn, dass das Maß seelischer und körperlicher Gesundheit und subjektiven Glücksempfindens bei gelingender Identitätsbildung höher sei.“176 Aufgrund der in der Postmoderne aufgekommenen Infragestellung der „normativen Hintergrundannahmen der sozialwissenschaftlichen Identitätskonzeption“177 diskutiert Joas den Einfluss von Macht- bzw. Ohnmachtverhältnissen bei der Bildung von Identität und weist darauf hin, dass es gerade auch in Meads Werk Ausführungen dazu gibt, dass Identität nicht immer unter den Bedingungen gegenseitiger und übereinstimmender Verständigung entsteht und dies auch nicht immer unter den Voraussetzungen eines konstruktiven und generativen gesellschaftlichen Prozesses erfolgt. Joas behauptet, dass aus Meads Arbeiten auch Hinweise für eine identitätsstabilisierende Wirkung von Ausschluss und Ausgrenzung ableitbar seien und empfiehlt insofern eine „dekonstruktive Lektüre Meads“.178 Joas fragt sich, wie die „offizielle Theorie“ mit den Phänomenen Gewalt- und Ausgrenzung als Identitätsfaktoren zurechtkommt. Joas führt hierzu Folgendes aus: „Identitätsbildung könne nur unter dialogischen Bedingungen gelingen; Gewalt und Ausgrenzung dienten zwar zur Stabilisierung von Identitäten und seien insofern dialogischer Stabilisierung funktional äquivalent, sie seien selbst aber nicht zur Bildung von Identität imstande.“179 Unter Hinweis auf die Verhältnisse in den Familien, die auch von Gewalt und Ausgrenzung geprägt sein können, verweist Joas auf eine theoretische Unzulänglichkeit in Meads Theoriegebäude, da die Ausschließlichkeit der dialogischen, systemkonformen Identitätsbildung empirisch nicht gesichert ist. Vielmehr sieht Joas eine Verschränkung zweier Formen von Identitätsbildung, die in gleicher Weise ihren Anteil an der Persönlichkeit des Individuums haben können: „Das idyllische Bild einer 176 Joas 1997, S. 237 vgl. Joas 1997, 241 178 Joas 1997, S. 244f. 179 Joas 1997, S. 246 177 99 dialogischen Identitätsbildung in der Familie wird zwar noch nicht durch den Hinweis widerlegt, dass solche Familien nicht die Regel und dass Gewalttaten in der Familie häufig seien; schwieriger wird die Lage aber durch die Einsicht, dass die Familie selbst Resultat einer Grenzziehung ist. Das Maß an Einfühlung, das zwischen den Familienmitgliedern erreicht werden mag, gilt nicht unspezifisch; schon Stief- und Pflegekinder sind von ihr oft ausgeschlossen. (...) Die sozialwissenschaftliche Identitätskonzeption in ihrer klassischen Form hat diese Verschränkung von Dialog und Ausgrenzung nicht angemessen begriffen.“180 Mir scheint dieser Einwand sehr gewichtig und Joas Vorschlag, nämlich die Schaffung eines sozialwissenschaftlichen Konzeptes, das eine Verschränkung von Dialog und Ausgrenzung thematisiert, eine angemessene Lösung zu sein. Es war ja gerade eine Kritik der normativen Theoretiker an der Theorie Meads, dass die nur dialogische Identitätsgenese ein artifizielles Konstrukt einer Mittelschicht-Soziologie mit sozial gepflegten und kultivierten Interaktionsstrukturen sei, die in der empirischen Realität einer Welt, die nicht frei von Ausgrenzung und Unterdrückung ist, keine Entsprechung findet. Meines Erachtens könnte sich der interaktionistische Ansatz da bewähren, wo die Realität einer Verschränkung der Perspektiven von Dialog und Zwang bei der theoretischen Explikation von Identitätsbildungsprozessen berücksichtigt wird. 3.5. Identitätsprobleme Identität ist das Ergebnis von Kommunikationsprozessen und damit letztlich nichts anderes als das Resultat interaktiver Handlungsprozesse. Diese basieren auf der Verständigung der Interaktionspartner untereinander. Bei Mead heißt es: „Wenn wir eine Identität erlangen, erlangen wir auch ein bestimmtes Verhalten, einen bestimmten gesellschaftlichen Prozess, der die wechselseitige Beeinflussung verschiedener Individuen voraussetzt und gleichzeitig impliziert, dass die einzelnen Individuen irgendeiner kooperativen Tätigkeit nachgehen.“181 Joas hat dafür die Formel „praktische Intersubjektivität“ geprägt. 180 181 Joas 1997, S. 246 Mead 1934, S. 208 100 Jegliches Handeln kann jedoch zum Problem werden. Für Mead ist das insbesondere dann der Fall, wenn die gleichsam habitualisierten Handlungsverläufe – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr funktionieren, wenn sich bisher unproblematische und unhinterfragte Handlungen in den Fokus des Bewusstseins drängen, weil sie, wie Mead es formuliert, ihrer „Objektivität beraubt“ sind.182 Dieser Verlust an Objektivität tritt da auf, wo das Handeln an Problemen zu scheitern droht. Dieser Zustand ist von einer allgemeinen Desorganisation begleitet, und „unsere Anstrengung richtet sich auf die Rekonstruktion dieser Objektivität, die aber nur durch eine kreative Eigenleistung zu erreichen ist.“183 Auf die Frage, wie Identität unter diesem Handlungsaspekt zum Problem werden kann, finde ich bei Joas folgenden Hinweis: „(Mead) fasst das ‚me‘, welches sich jeweils als von mir wahrgenommenes Bild meiner Person beim Interaktionspartner einstellt, in seiner Abhängigkeit von der Vielfalt der Interaktionssituationen. Aufgabe der Identität ist es dann, die zahlreichen, immer neuen ‚me‘s aktiv zu synthetisieren zu einem einheitlichen Selbstbild.“184 Diese Aussage ist nach meinem Erachten wesentlich für einen Erklärungsansatz der Gefährdung von Identität aufgrund divergierender sozialer Erwartungen in den vielfältigen Handlungs- und Kommunikationssituationen des Lebens. Bekanntlich sind die „me’s“ die Repräsentationen der sozialen Umwelt in der Identität des Einzelnen. Sie bedeuten somit die Hereinnahme der Erwartungen der Interaktionspartner in das Bewusstsein des Individuums. Der generalisierte Andere ist die universalistische Entsprechung dieser Erwartungen. Dieses Konzept repräsentiert die Wert- und Normorientierung der Gesellschaft, der das Individuum zugehörig ist. Dies bedeutet, dass ein Individuum, wenn es seine Bedürfnisse realisieren will, sich mit den vorwaltenden Wertmustern der Gruppe oder Gesellschaft, zu der es gehört, aktiv auseinandersetzen muss, sie nach Möglichkeit in seinem eigenen Verhalten reflektieren muss. Dies geht nur im Rahmen einer 182 vgl. Joas 1980, S. 84 ebd. 184 Joas 1980, S. 107 183 101 erfolgreichen Teilnahme an Interaktionen, in denen das Individuum auf der Grundlage einer einheitlichen, konsistenten Identität handelt, in der die verschiedenen Erwartungen der sozialen Umwelt kompatibel gemacht werden können, in der die verschiedenen und unterschiedlichen „me’s“ in ein möglichst homogenes Identitätskonzept integriert sind. Nur unter dieser Bedingung erscheint es Mead möglich, dass Interaktionen unproblematisch verlaufen, nur unter der Bedingung, dass die beteiligten Individuen eine konsistente Haltung für ihre Handlungsorientierung im Rahmen der Interaktion realisieren können. Denn Mead geht in seinen theoretischen Annahmen von der grundsätzlichen Einheit der Identität aus: „Die Einheit und Struktur der kompletten Identität spiegelt die Einheit und Struktur des gesellschaftlichen Prozesses als Ganzem. Jede der elementaren Identitäten, aus denen er gebildet wird, spiegelt die Einheit und Struktur eines der verschiedenen Aspekte dieses Prozesses, in den der Einzelne eingeschaltet ist. Mit anderen Worten: die verschiedenen elementaren Identitäten, die eine vollständige Identität konstituieren oder zu ihr organisiert werden, sind die verschiedenen Aspekte der Struktur dieser vollständigen Identität, die den verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Prozesses als Ganzem entsprechen. Die Struktur der vollständigen Identität ist somit eine Spiegelung des vollständigen gesellschaftlichen Prozesses.“185 Wenn es dem Individuum nicht gelingt, eine einheitliche Identität zu entwickeln, das heißt die verschiedenen „me’s“ als Komponenten seiner Identität zu integrieren, wird es ihm unmöglich sein, einheitliche und rollenübergreifende Handlungskonzepte zu entwickeln. Joas merkt hierzu an: „Trete ich mehreren für mich bedeutsamen Bezugspersonen gegenüber, so gewinne ich mehrere unterschiedliche ‚me’s‘. Diese müssen, wenn konsistentes Verhalten überhaupt möglich sein soll, zu einem einheitlichen Selbstbild synthetisiert werden. Gelingt diese Synthetisierung, dann entsteht das ‚self‘, Ich-Identität als einheitliche und doch auf die Verständigung mit stufenweise immer mehr Partnern hin offene und flexible Selbstbewertung 185 Mead 1934, S. 186 102 und Handlungsorientierung; zugleich entwickelt sich eine stabile, ihrer Bedürfnisse sichere Persönlichkeitsstruktur.“186 Im negativen Fall des Misslingens der Syntheseleistung ist die Person gezwungen, mit Widersprüchen in ihrem Verhalten zu leben. Diese treten in Interaktionssituationen auf, in denen divergierende Verhaltenserwartungen zu Tage treten. Die aktive und erfolgreiche Teilhabe und Teilnahme des Individuums an gesellschaftlichen Prozessen kann sich nach der Theorie nur auf der Grundlage einer einheitlichen Identität ergeben. Dies ist die Voraussetzung, die das Individuum in den gesellschaftlichen Prozess einzubringen hat. Seitens der Gesellschaft erfolgt eine Steuerung dieser Wechselwirkungen nach der Maßgabe gesellschaftlicher Werte und Normen, denn der Aufbau der Identität gelingt - wiederum nach der Theorie - nur in der Übernahme der Rolle des anderen, das heißt in der Antizipation der mit dieser Rolle verknüpften sozial erfahrenen und symbolisch sedimentierten Wert- und Handlungsmuster. Bei Joas heißt es daher: „Die Identität des Handelnden entwickelt sich durch die Berücksichtigung der Werte und Interessen Anderer und nur dadurch. Um seine Identität zu realisieren, ist damit die Teilhabe an den zentralen gesellschaftlichen Wert-Auseinandersetzungen nötig. Mead stellt damit Identitätsbildung hinein in die gesellschaftliche und politische Praxis.“187 Mead deutet den Wertbegriff handlungstheoretisch. Werte wirken über den generalisierten Anderen, konkreter: über Rollenerwartungen auf die Menschen ein. Dabei wendet er sich gegen einen objektivistischen Wertbegriff. Demnach sind Werte nicht einfach nur objektive Gegebenheiten, also „Tatsachen“ im Sinne Durkheims. Denn aus der handlungstheoretischen Perspektive kann es keine Wertkonzeption geben, die gleichsam religiös, die Lebenswelt der Menschen transzendierend, Gewissheiten sui generis impliziert. Auch ist Objektivität nicht dahingehend zu verstehen, dass menschliches Verhalten, das moralisch hoch bewertet wird, als Derivat biologischer Impulse anzusehen ist. Dies wird z.B. gerne im Falle mütterlichen Fürsorgeverhaltens unterstellt. 186 187 Joas 1980, S. 117 Joas 1980, S. 133 103 Andererseits sind Werte aber auch nicht nur subjektiv konstituiert. Das Individuum wird immer in seiner Umwelt erfahrbare Wertstrukturen vorfinden, mit denen es sich auseinandersetzen muss. Es kann sie respektieren oder ablehnen – immer jedoch besitzen sie für das Individuum eine unbezweifelbare Faktizität, weil z.B. Institutionen der menschlichen Gesellschaft durch sie geprägt sind. Daraus resultiert wiederum ihre Objektivität. Berger und Luckmann führen hierzu Folgendes aus: „Eine institutionelle Welt wird als objektive Wirklichkeit erlebt. Sie hat eine Geschichte vor der Geburt des Individuums, die sich persönlich-biographischer Erinnerung entzieht. Sie war da, bevor der Mensch geboren wurde, und sie wird weiter nach seinem Tode da sein. (...) Die Institutionen stehen dem Individuum als objektive Faktizitäten unabweisbar gegenüber. Sie sind da, außerhalb der Person und beharren in ihrer Wirklichkeit, ob wir sie leiden mögen oder nicht. Der Einzelne kann sie nicht wegwünschen. Sie widersetzen sich seinen Versuchen, sie zu verändern oder ihnen zu entschlüpfen. Sie haben durch ihre bloße Faktizität zwingende Macht über ihn.“188 Die Dialektik besteht darin, dass das Individuum bei seiner Erfahrung von Wirklichkeit, hier also einer „Wertewirklichkeit“, sich auf eine, subjektiv so empfundene, vorgegebene stabile und objektive Ordnung beruft; aber diese Ordnung ist Ergebnis der sozialen Konstruktion der Welt. Auf der anderen Seite greift das Individuum in diese vorab gegebene Wirklichkeit mit eigenen Strukturierungsleistungen ein. Letzterer Gedanke ist maßgeblich für das interpretative Paradigma. Das handelnde Individuum übernimmt nicht einfach einen bestimmten Status mit festen Werten und Rollen. Der Sinn und die Bedeutung der Rolle und Interaktionssituation wird jeweils neu generiert, in Abhängigkeit der intersubjektiven Definition des Geschehens.189 Dabei ist die Sinn- und Bedeutungssuche, die auch den gleichsam hermeneutischen Prozess der Identitätsgenese umfasst, von einem Bemühen um Handlungsoptimierung geprägt und von Zweifeln und Fehlern bedroht. Und auch wertebezogenes, moralisches Verhalten vollzieht sich vor dem Hintergrund des Optimierungserfor188 189 Berger und Luckmann 1966, S. 64 vgl. Abels 1997b, S. 39f. 104 dernisses. Mead schreibt dazu: „Die einzige Regel, die uns eine Moral zu bieten vermag, besagt, dass sich ein Individuum mit allen bei einem spezifischen Problem auftretenden Werten rational auseinandersetzen sollte. Das heißt nun nicht, dass man alle gesellschaftlichen Werte vor sich ausbreiten müsste, wenn man sich einem Problem nähert. Das Problem definiert die Werte. Es ist ein spezifisches Problem, und es gibt bestimmte Interessen, die ganz eindeutig betroffen sind. Der Einzelne sollte alle diese Interessen beachten und dann einen Handlungsplan aufstellen, der sich mit diesen Interessen rational befasst. Das ist die Methode, die die Ethik dem Einzelnen anbieten kann.“190 Moralisches Handeln ist also abhängig von gesellschaftlich definierten Maßstäben und aus gesellschaftlichen Werten konstituiert. Moralische Situationen, wie Mead den Sachverhalt nennt, entstehen dann, wenn sozial konstruierte Werte im sozialen Handeln kollidieren. So schreibt Mead: „Ethische Ideen entwickeln sich innerhalb der jeweiligen menschlichen Gesellschaft im Bewusstsein der einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft aus dem Umstand der gemeinsamen gesellschaftlichen Abhängigkeit aller dieser Mitglieder untereinander (...) und aus ihrem Bewusstsein von dieser Tatsache. Ethische Probleme treten aber für die einzelnen Mitglieder jeder menschlichen Gesellschaft immer dann auf, wenn sie einzeln mit einer gesellschaftlichen Situation konfrontiert werden, auf die sie sich nicht sofort einstellen können, in der sie sich nicht sogleich verwirklichen oder in die sie ihr eigenes Verhalten nicht unmittelbar integrieren können.“191 Der vorgenannte allgemeine Aspekt der „problematischen Identität“ als Folge eines Handlungsproblems lässt sich noch erweitern, und zwar auf der Grundlage von Meads Arbeiten über die Ethik bzw. über „moralische Probleme“: sie konstituieren die Identitätsprobleme par excellence. So schreibt Cook: „In Meads Sicht ähneln solche moralischen Probleme anderen Problemen, die im menschlichen Handeln auftauchen, insofern sie die Hemmung habitueller Reaktionen auf bestimmte Arten von Umweltreizen einschließen. Sie unterscheiden sich jedoch von 190 191 Mead 1934, S. 439 Mead 1934, S. 368f. 105 diesen anderen Problemen durch das besondere Ausmaß, in dem sie mit den sozialen Interessen und der sozialen Struktur der menschlichen Identität verknüpft sind. (...) Mead behauptet, dass sich moralische Probleme von Problemen (der allgemeinen Art, Anmerkung des Verfassers) primär deshalb unterscheiden, weil die Hemmungen, die zu ihnen führen, mit konkreten persönlichen Interessen zu tun haben, in die die ganze IchIdentität einbezogen ist.“192 Dies deute ich als ein Defizit der Integration der verschiedenen „me’s“ in der Identität des Individuums. Dieser Mangel kann durch die Widersprüche der Rollenanforderungen entstehen, mit denen das Individuum konfrontiert ist. Mead sieht in einem solchen Integrationsdefizit eine „moralische Situation“ im Sinne einer Divergenz der Wertorientierungen, die für das Individuum gelten, im Verhältnis zu denen seiner sozialen Umwelt. Aus einer solchen Diskrepanz resultiert eine Gefährdung der Identität des Individuums: „in der moralischen Situation erfährt der Einzelne einen Konflikt zwischen bestimmten eigenen Werten und anderen eigenen Werten, den Werten von Partnern oder den im ‚generalisierten Anderen‘ verkörperten Werten.“193 Dies ist der Fall, wenn das Individuum zwischen entgegengesetzten Wertungen oder moralischen Interpretationen einer gegebenen Situation hin- und hergerissen ist. Eine solche Situation ist denkbar, wenn die gesellschaftlichen Wertsetzungen nicht eindeutig oder sogar widersprüchlich sind, ein Zustand der Anomie, wie er in der fortgeschrittenen Moderne geradezu zwangsläufig ist. In dieser moralischen Situation vermögen die Betroffenen in der Regel zeitweise mit dem Konflikt antagonistischer Werte umzugehen. Aber das Individuum ist in dieser Situation gesellschaftlicher Anomie den nachteiligen Folgen wertbezogener gesellschaftlicher Widersprüche in der Regel ausgeliefert und wird irgendwann unter den Konflikten zu leiden haben. Joas schreibt dazu Folgendes: „Mead weiß natürlich, dass die alte Identität durch Abwehr- und Ausweichstrategien das Problem zu umgehen versuchen kann (gemeint ist das Problem der Desintegration der Identität aufgrund des Werteantagonismus, 192 193 Cook 1985, S. 132f. Joas 1980, S. 132 106 Anmerkung des Verfassers). Sie wird aber immer wieder auf dieses Problem zurückgeworfen. Das Beharren bei der alten Identität, ohne dies zumindest durch argumentative Auseinandersetzung mit den neuen Zumutungen zu erweitern, bringt das Individuum gerade um seine eigenen Entwicklungschancen.“194 Die Konflikte zwischen verschiedenen Ansprüchen und Werten lähmen das Handeln und führen zu einer Desintegration der Identität: „Die moralische Situation ist nach Mead eine Krise der ganzen Persönlichkeit.“195 Für Mead haben moralische Werte funktionale und korrigierbare Bedeutungen im Hinblick auf bestimmte soziale Interessen und Verhaltensmuster. Ein moralisches Bewusstsein entsteht dann, wenn konfligierende Wertorientierungen gewohnheitsmäßiges Verhalten hemmen und eine reflexive Bestandsaufnahme der antagonistischen Werte notwendig machen. Die Reflexivität hat die Funktion, die Auflösung der Wertkonflikte zu erreichen und die Reintegration der Identität zu bewirken sowie eine Strategie zur Konstitution einer neuen Identität zu entwickeln. Das Ergebnis dieses Reflexionsprozesses ist eine Bestätigung oder eine Neudeutung der Universalien, das heißt der generalisierten Bedeutungen, die für alle an der Handlung Beteiligten maßgeblich sind. Es kann aber auch mithilfe dieses Reflexionsprozesses nach neuen Unversalien gesucht werden, mit denen die ganze Situation neu gedeutet werden kann. Im ersten Fall kann eine Bestätigung der konventionellen Werte erfolgen, und das Individuum muss in der Folge versuchen, mit den Widersprüchen, die sich aus dem Antagonismus der konventionellen Werte und seiner eigenen Wert-Orientierung ergeben, zu leben. Die Inkonsistenz seiner Identität oder auch die Inkompatibilität der verschiedenen „me’s“ seiner sozialen Identität muss es ignorieren, und mit einer (partiellen) Desintegration seiner Identität umgehen: „Einerseits kann die Reflexion (der moralischen Situation, Anmerkung des Verfassers) einfach auf eine Situationsdeutung zurückgehen, die mit Universalien arbeitet, welche in der Vergangenheit deutliche moralische Bekräftigung erhalten haben. Die Reflexion kann 194 195 Joas 1980, S. 132 ebd. 107 zum Beispiel mit der Situation so umgehen, dass sie die gewohnheitsmäßigen Bedeutungen und Werte bestätigt, welche seit langem in einem abstrakt formulierten Moralkodex aufbewahrt werden. Insoweit die Identität einigermaßen konsistent gemäß eines solchen Kodex leben kann, kann sie die verbleibenden Widersprüche vielleicht ignorieren. Und wo diese nicht ignoriert werden können, besteht das übliche Verfahren darin, ihnen durch eine metaphysische Beschreibung der Situation die Wirklichkeit abzusprechen.“196 Diese „metaphysische Moral“ bedeutet gleichsam eine kognitive Selbstvergewaltigung. Bestimmte Arten von Handlungen werden als „falsch“ oder „richtig“ angesehen, und zwar auf der Grundlage von die aktuelle Situation transzendierenden Bewertungsstandards.197 Im zweiten Fall, der Suche nach neuen, anderen Universalien, kann das Individuum einen Handlungsplan entwerfen, der es ihm erlaubt, alle maßgeblichen Werte, soweit wie möglich, in seiner Reflexion zu berücksichtigen und je nach seiner Bedürfnislage, in Abwägung des Möglichen, eine veränderte Identität zu konstruieren: „Der andere Weg, den die moralische Reflexion einschlagen kann, ist von weniger konservativer Art. Anstatt zu versuchen, die moralische Problemsituation mit Hilfe alter Universalien oder Bedeutungen wieder zusammenzufügen, führt dieser Weg zur Suche nach neuen Universalien, mit denen die Situation gedeutet werden kann.“198 Man könnte dies auch im Sinne der Meadschen Theorie so deuten, dass das Individuum dazu übergeht, sich an einem anderen „generalisierten Anderen“ zu orientieren. Dies kann dazu führen, dass sich das Individuum eine andere (soziale) Identität „zulegt“. Mead favorisiert den zweiten Weg: Er argumentiert, dass jeder Appell an eine moralische Ordnung, welche „die konkrete moralische Situation transzendiert, für das moralische Leben schädlich ist (...), weil es an sich eine armselige Methode zur Lösung einer moralischen Auseinandersetzung ist.“199 Die zweite von Mead benannte Methode ist diejenige, bei der die soziale 196 Cook 1985, S. 138 ebd. 198 ebd. 199 Cook 1985, S. 140 197 108 Situation des Individuums verändert werden soll. Dies berührt die bestehende Identität im Kern und hinterfragt die soziale und gesellschaftliche Situation, in der sich das Individuum befindet. Damit sind auch Fragen nach der Zulässigkeit und Angemessenheit bestehender Ordnungsverhältnisse impliziert, die jedoch von Mead nicht weiterverfolgt wurden. 3.6. Weiterentwicklung des Identitätskonzeptes im Rahmen des interpretativen Paradigmas Nach Meads Theorie entwickelt sich Identität vor dem Hintergrund eines interaktiven und kommunikativen Prozesses. Durch mangelnde Integration gesellschaftlicher Werte und Normen im Persönlichkeitskonzept des Individuums kann es zu Problemen mit der Identität kommen. Dieser Zustand umfasst eine defiziente Integration der verschiedenen „me’s“. Bei Mead erscheint diese Thematik nur ganz am Rande. Erving Goffman indes hat die Identitätsdiskrepanz zu einem zentralen Thema seines wissenschaftlichen Werkes gemacht. Gesellschaftliche Werte können von Individuen verletzt werden, wenn es diesen nicht gelingt, bestimmte Erwartungen der Gesellschaft in der sozial erfahrbaren Manifestation ihrer Persönlichkeit (Goffman spricht in diesem Zusammenhang von der „Fassade“) zu reproduzieren. Auch darin liegt eine defiziente Integration der „me´s“. Auch dann ist Identität problematisch. Auf diese Weise entwickelt sich ein bestimmter Typus des gesellschaftlichen Außenseiters, nämlich jener, der in einem oder mehreren identitätsdefinierenden Interaktionszusammenhängen, die seine Zugehörigkeit zum sozialen System prägen, vorwaltende (Wert)Erwartungen der anderen verfehlt. Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der interpretativen Soziologie erwähnt werden muss, ist die Erkenntnis, dass individuelle Identität und das Problem der interpretativen Teilhabe an der Wirklichkeit nicht eine Funktion einer biologisch begründeten Instanz ist, die prinzipiell unberechenbar bleibt. 109 Vielmehr gibt es eine Instanz in der Persönlichkeit, die sich von den Reifikationen ihrer Rollenbezüge abhebt. Goffman hat den Begriff persönliche Identität200 geprägt Die persönliche Identität umfasst die Dimension lebensgeschichtlich je einmaliger Erfahrungen des Menschen und somit seine höchst einzigartigen Synthesen von „me’s“ über die Zeitläufte hinweg. Diese Identitätsformation ist, so wie die soziale Komponente der Identität (die Gesamtheit der „me’s“), eine soziale Konstruktion, in der aber auch individuelle Erfahrungen, Gefühle und Bewertungen mit eingehen. Der theoretische Vorteil gegenüber der interaktionistischen Perspektive Meads liegt in der Emanzipation des Individuums von der zwangvollen Erratik des „I“. Identität entsteht damit auf der Grundlage einer individuellen Biographie im Sinne einer Integration schon bestehender und neu erworbener Bedeutungen, Rollen, Werte und Selbstbilder. Schließlich ist aus einer kritischen Perspektive zur Theorie Meads anzumerken, dass das Konzept der Überwindung einer moralischen Krise, das ich in diesem Zusammenhang als Überwindung einer Identitätskrise deute, inhaltlich zu begrenzt und zu einfach gefasst ist: entweder passt sich das Individuum den Wertmaßstäben seiner sozialen Umwelt an, oder es passt sich anderen Wertmaßstäben, anderen Universalien oder einem anderen „generalisierten Anderen“ an. Dass diese Anpassungsleistungen oft nicht so unproblematisch durchgeführt werden können, lehrt die Lebenserfahrung. Insbesondere da, wo sich der Gestaltungsspielraum der Individuen auf Null reduziert, wo sich das Individuum weder wertgemäß anpassen, noch in eine andere Wertstruktur flüchten kann, nimmt seine Identität notorisch Schaden. Zu solchen Problemen konnte bei der Rezeption der Meadschen Theorie nichts gefunden werden. Die Anpassungsversuche des Individuums an die Wertstrukturen seiner Gesellschaft und die damit einhergehenden Schwierigkeiten werden jedoch von Goffman thematisiert: die Aufrechterhaltung einer sozialen Identität im Sinne einer bestimmten Fassade, die Präsentation des Selbst in dem engen Bereich der gesellschaftlich lizenzierten Bahnen ist bisweilen 200 vgl. Goffman 1963, S. 74f. 110 hart erkämpft und oft nur für einen hohen psychologischen Preis zu haben. So sind Goffmans Arbeiten stets „vom Wissen um die Gefährdung des Individuums geprägt.“201 Gerade deshalb sind sie für die Thematik dieser Arbeit von großer Bedeutung. 201 Abels 1997b, S. 159 111 4. Identität und ihre Präsentation in der Soziologie Goffmans Über Goffman als soziologischen Theoretiker wurde schon viel geschrieben. Zu den wesentlichen biografischen Fakten gehört, dass er 1922 in Kanada als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde. Er studierte in Toronto und Chicago. Nach seinem Studium führte er auf den Shetland-Inseln eine Feldstudie durch. Im Jahre 1953 promovierte Goffman in Chicago und wechselt im Jahre 1958 nach Berkeley an die Universität von Kalifornien. Hier avancierte er zum Lehrstuhlinhaber, und hier wurde auch der „Mythos Goffman“202 geboren. Dieser bestand darin, dass Goffman jenen Nonkonformismus verkörperte, der zu jener Zeit den studentischen Aufbruchswillen beflügelte. Im Jahre 1969 wechselte Goffman an die Universität von Philadelphia. Im Jahre 1981 wurde Goffman zum Präsidenten der American Sociological Association gewählt, eine bemerkenswerte Tatsache, wenn man bedenkt, wie einflussreich die „harte Soziologie“ war, die z.B. in Harvard unter dem Einfluss von Talcott Parsons betrieben wurde, und wie sehr sich Goffman mit seinem Erkenntnisinteresse und seiner Methode von dieser Schule unterschied. Goffman starb am 19. November 1982. Goffman beschreibt nicht die Entstehung des Selbst in einem evolutionären Sinne. Die Handelnden bei Goffman sind alle schon erwachsen, zumindest kann man unterstellen, dass sie die Einflüsse der Erziehung in ihrem Selbst integriert haben. Identität wird bei Goffman im Prozess der Interaktion stets neu konstruiert. Für Goffman besteht das Selbst aus verschiedenen Komponenten, deren Bezeichnungen, wie die Terminologie des Selbstkonzeptes selbst, in seinem Werk variieren. Für diese Arbeit erscheinen vier aus dem Werk Goffmans abzuleitende Aspekte wichtig: 1. Identität ist sozial konstruiert und Ergebnis von Interaktionsprozessen. 2. Die Identitätskonzepte, die die soziale Umwelt dem Individuum zuschreibt, gehen in dessen Selbstkonzept ein und prägen dieses entscheidend mit. 202 Hettlage und Lenz 1991, S. 12 112 3. Die Identitätskonzepte manifestieren sich im Rahmen sozialer Interaktionsprozesse. Über diese Prozesse erfolgt eine Zuteilung von Positionen in der gesellschaftlichen Rollenstruktur. 4. Die im Interaktionsprozess entwickelte Identität unterliegt einer ständigen Dynamik. Um sie muss stets von neuem gerungen werden. Goffman unterscheidet zwischen „sozialer Identität“ und „persönlicher Identität“. In dieser Dichotomie findet die bereits oben angedeutete Abkehr von der organischen Beeinflussung der Identität im Sinne von Meads „I“ ihren Niederschlag. Beide Identitätskonzepte stehen für eine ausschließlich soziale Beeinflussung der Persönlichkeit. Zu dem Konzept der „sozialen Identität“ merkt Goffman an: „Die Gesellschaft schafft die Mittel zur Kategorisierung von Personen und den kompletten Satz von Attributen, die man für die Mitglieder jeder dieser Kategorien als gewöhnlich und natürlich empfindet. Die sozialen Einrichtungen etablieren die Personenkategorien, die man dort vermutlich antreffen wird. (...) Wenn ein Fremder uns vor Augen tritt, dürfte uns der erste Anblick befähigen, seine Kategorie und seine Eigenschaften, seine ‚soziale Identität‘ zu antizipieren (...) Wir stützen uns auf diese Antizipation, die wir haben, indem wir sie in normative Erwartungen umwandeln, in rechtmäßig gestellte Anforderungen.“203 Goffman versteht darunter das Konzept von Identität, welches man typischerweise von einem Individuum erwartet, das bestimmte Rollenattribute aufweist, die für seine soziale Umwelt zunächst erfahrbar sind (virtuale soziale Identität). Hiervon unterscheidet er nochmals „Kategorie und die Attribute, deren Besitz dem Individuum tatsächlich bewiesen werden konnte.“204 Goffman bezeichnet dieses Konzept als „aktuale soziale Identität“. Damit sind die tatsächlichen Eigenschaften und Bedingungen der sozialen Existenz gemeint, die oft erst bei näherer Betrachtung zum Vorschein kommen und oft auch nicht in Übereinstimmung mit der virtualen sozialen Identität stehen. 203 204 Goffman 1963, S. 10 ebd. 113 Die soziale Identität impliziert die Zugehörigkeit des Individuums zu seinen Bezugsgruppen. Soziale Identität ist daher in diesem Sinne querschnittlich zu begreifen („synchronische Dimension“). Sie „wahrt die Einheit in der Mannigfaltigkeit verschiedener Rollensysteme.“205 Von dem Konzept sozialer Identität unterscheidet Goffman eine persönlich geprägte Identität: „Mit persönlicher Identität meine ich positive Kennzeichen oder Identitätsaufhänger und die einzigartige Kombination von Daten der Lebensgeschichte, die an dem Individuum festgemacht wird.“206 In der persönlichen Identität kommt die unverwechselbare Biographie des Individuums zum Ausdruck. Das Konzept der persönlichen Identität erlaubt daher eine längsschnittliche Erfassung der Identität eines Menschen, es repräsentiert eine „diachronische Dimension“ im Sinne von Kontinuität der Lebensgeschichte. 4.1. Identität und Fassade Für Goffman ist der Aspekt intersubjektiver Konstruktion von Identität maßgeblich. Dabei mag ein eigener Identitätsentwurf der Person zunächst vorhanden sein, der von der sozialen Umwelt aufgenommen wird: „Die Gesellschaft hat sich so etabliert, dass jeder mit Recht erwarten darf, von den anderen nach seinen sozialen Eigenschaften eingeschätzt und behandelt zu werden. Mit diesem Prinzip ist ein zweites verknüpft: dass nämlich jemand, der ausdrücklich oder stillschweigend zu verstehen gibt, er habe diese oder jene sozialen Eigenschaften, auch wirklich das sein soll, was er zu sein behauptet. Wenn daher jemand eine Bestimmung seiner Situation entwirft, indem er sich als eine Person einer bestimmten Art vorstellt, erhebt er damit automatisch die moralische Forderung, wonach die anderen ihn so einzuschätzen und zu behandeln hätten, wie es Personen seiner Art erwarten dürften.“207 205 ebd. Goffman 1963, S. 74 (Anmerkung: Es geht ihm hier um die Einzigartigkeit der Person, die es zulässt, sie stets als die „selbst-gleiche“ wiederzuerkennen. Dazu zählen äußerliche Kennzeichen, die eine Verwechslung mit einer anderen Person unmöglich machen, sowie „der ganze Satz von Fakten, (der) als Kombination für keine andere Person in der Welt als gültig befunden (wird), wodurch ein zusätzliches Mittel vorhanden ist, durch das er positiv von jedermann sonst unterschieden werden kann.“ (Goffman 1963, S. 74)) 207 Goffman 1959, S. 16 206 114 Die Reaktionen der sozialen Umwelt auf das dargestellte Identitätskonzept wirken als sozialer Einfluss auf die Identität. Somit ist Identität eine intersubjektive soziale Konstruktion. Goffman veranschaulicht diese Intersubjektivität mit Hilfe der Theatermetaphorik, wonach das Individuum seine Identität letztlich aus seiner Mitgliedschaft in einem Ensemble, das einem Publikum gegenübersteht, gewinnt. Ein Ensemble ist „eine Gruppe von Individuen, die eng zusammenarbeiten muss, wenn eine gegebene Situationsbestimmung aufrechterhalten werden soll. Ein Ensemble ist zwar eine Gruppe, aber nicht in Bezug auf eine soziale Struktur oder eine soziale Organisation, sondern eher in Bezug auf eine Interaktion oder eine Reihe von Interaktionen, in denen es um die relevante Definition geht.“208 In dieser ausschließlich soziologischen Sicht der Entstehung von Identität gibt es keinen Raum für eine leibgebundene Kausalität: „Insofern man dieses Bild von dem Einzelnen gemacht und ihm somit ein Selbst zugeschrieben hat, entspringt dieses Selbst nicht seinem Besitzer, sondern der Gesamtszene seiner Handlungen und wird von den Merkmalen lokaler Ereignisse erzeugt, die sie für Beobachter interpretierbar machen. Eine richtig inszenierte und gespielte Szene veranlasst das Publikum, der dargestellten Rolle ein Selbst zuzuschreiben, aber dieses zugeschriebene Selbst ist ein Produkt einer erfolgreichen Szene und nicht ihre Ursache. Das Selbst als dargestellte Rolle ist also kein organisches Ding, das einen spezifischen Ort hat und dessen Schicksal es ist, geboren zu werden, zu reifen und zu sterben; es ist eine dramatische Wirkung, die sich aus einer dargestellten Szene entfaltet, und der springende Punkt, die entscheidende Frage, ist, ob es glaubwürdig oder unglaubwürdig ist.“209 Die „Mittel zur Produktion des Selbst“210 sind in den sozialen Institutionen verankert, denen die Individuen zugehörig sind. Die Vorstellung, die das Individuum gegenüber dem Publikum gibt, nennt Goffman „Fassade“.211 Das Konzept der Fassade korrespondiert zum Teil mit dem Konzept der persönlichen Iden- 208 Goffman 1959, S. 96 Goffman 1959, S. 231 210 ebd. 211 vgl. Goffman 1959, S. 23 209 115 tität im Sinne positiver und unverwechselbarer Kennzeichen.212 Dazu zählen für Goffman Kleidung, Geschlecht, Alter, Größe, physische Erscheinung (persönliche Fassade). Das Konzept ist jedoch verwoben mit Elementen der sozialen Identität, denn Goffman zählt dazu auch Amtsbezeichnungen und Rangmerkmale, soweit damit konkrete Rollenerwartungen verbunden sind (soziale Fassade). Welche Fassade das Individuum im Rahmen seiner Präsentation realisiert, hängt von den Erwartungen der Gesellschaft ab. Insofern korreliert das Konzept der sozialen Identität mit dem der sozialen Fassade. Mit „Erscheinung“ bezeichnet Goffman auch die soziale (erfahrbare) Identität des Individuums: „Der Begriff ‚Erscheinung‘ bezieht sich dabei auf die Teile der persönlichen Fassade, die uns über den sozialen Status des Darstellers informieren.“213 Der Begriff der „Erscheinung“ scheint völlig kongruent mit dem Konzept der sozialen Identität zu sein. Schließlich gehört zu diesem Konzept eine „szenische Komponente“ im Sinne des Bühnenbildes, das heißt der „gestaltete Raum, in dem wir auftreten.“214 All das zusammen genommen macht die soziale Identität des Individuums im Zusammenhang mit seiner szenischen Präsentation aus. Zur eigentlichen Identität, die mehr ist als eine nur mehr oder weniger geglückte Darstellung, wird es erst, wenn das Individuum das, was das Publikum von ihm hält, auch in sein eigenes Selbstkonzept implementiert. Menschen versuchen in Interaktionen mit ihren Handlungen die Deutung der jeweiligen Situation durch ihre soziale Umwelt in ihrem Sinne zu beeinflussen. Gleichzeitig verfügen die anderen, die Goffman im Rahmen der Theatermetaphorik „Publikum“ nennt, ebenfalls über eine Definitionsmacht im Hinblick auf das Interaktionsgeschehen: „Nehmen wir an, der Einzelne projiziere seine Situation vor anderen, so ist gleichzeitig festzustellen, dass die anderen, wie passiv ihre Rolle auch erscheinen mag, durch ihre Reaktion auf den Einzelnen und die Art des Verhaltens, die sie ihm ermöglichen, ebenfalls wirkungsvoll die Situation 212 vgl. Goffman 1963, S. 74 Goffman 1959, S. 25 214 Abels 1997b, S. 178 213 116 bestimmen.“215 Jedes Ensemblemitglied fühlt sich mehr oder weniger verpflichtet, den richtigen Eindruck zu liefern. Ein Ausscheren aus der Ensembledisziplin ist gleichbedeutend mit einem Verlust an Anerkennung und Integration. Aber es sind nicht nur Integrations- und Zugehörigkeitsmotive, die die Menschen in ihrem Verhalten leiten: „Abgesehen von dem unmittelbaren Ziel, das der einzelne sich gesetzt hat, und von den Motiven dieser Zielsetzung, liegt es in seinem Interesse, das Verhalten der anderen, insbesondere ihr Verhalten ihm gegenüber zu kontrollieren.“216 Wer zusammen mit anderen handelt, hat auch den – vielleicht unbewussten – Wunsch, die Reaktionen der anderen Anwesenden zu leiten und zu kontrollieren: „Diese Kontrolle wird weitgehend dadurch bewirkt, dass er die Deutung der Situation beeinflusst, und zwar kann er das dadurch, dass er sich in einer Art und Weise ausdrückt, die bei den anderen einen Eindruck hervorruft, der sie veranlasst, freiwillig mit seinen Plänen übereinzustimmen. So hat der einzelne im allgemeinen allen Grund, sich anderen gegenüber so zu verhalten, dass er bei ihnen den Eindruck hervorruft, den er hervorrufen will.“217 Ein anderer Grund, weshalb ein Individuum eine bestimmte Präsentation seiner Person vornimmt und damit für eine bestimmte Ausprägung seiner Identität sorgt, wird von Goffman so erläutert: „Es kann sich auch absichtlich und bewusst in bestimmter Weise darstellen, weil die Traditionen seiner Gruppe oder seines sozialen Ranges diese Art der Selbstdarstellung vorschreiben; also nicht um irgendeiner bestimmten Reaktion willen, die dadurch bei den anderen hervorgerufen werden könnte. Gelegentlich veranlassen die Rollentraditionen, denen der Einzelne unterworfen ist, ihn dazu, einen komplexen Eindruck bestimmter Art hervorzurufen, obgleich er das weder bewusst noch unbewusst wollte.“218 Die richtige dramaturgische Wirkung ist nicht nur für das einzelne Ensemblemitglied wichtig, sondern auch für das ganze Ensemble, denn auch dieses steht unter Erfolgsdruck. Goffman 215 Goffman 1959, S. 12 Goffman 1959, S. 7 217 ebd. 218 Goffman 1959, S. 10 216 117 hat für diese Handlungstendenz die Begriffe „dramaturgische Loyalität“, „dramaturgische Disziplin“ und „dramaturgische Sorgfalt“ geprägt. Man muss dabei immer bedenken, dass ein Ensemble durchaus aus sehr heterogenen Mitgliedern bestehen kann, die sich in vielfältiger Hinsicht, insbesondere in Bezug auf den sozialen Status unterscheiden können. Gleichwohl sind die Ensemblemitglieder dazu gezwungen, an dem Gelingen ihrer Vorstellung mitzuwirken. Dieser Zwang kann als bestimmte Rollenerwartungen gedeutet werden, die sich an den Zielen des Ensembles oder, allgemeiner gesprochen, an den Werten der Gruppe oder der gesamten Gesellschaft orientieren. Hinter dieser Pflicht zur Disziplin und Loyalität, der alle Ensemblemitglieder unterliegen, steht der Zwang zu wertkonformem und rollengerechtem Verhalten. Dieser Zwang ergibt sich nach Goffman aus dem Willen und der Verpflichtung zur Einheitlichkeit der Dramaturgie in der Gruppe. Aus der Sicht des Individuums ist der Wunsch maßgeblich, seiner Rolle gerecht zu werden, sie am Ende nicht gar zu verlieren und damit zum Außenseiter zu werden. Der innere Konflikt des Agierenden liegt dann darin, dass er zwar etwas Besonderes sein möchte, in dem Sinne, dass er mit seiner Rolle, so klein sie auch sein mag, auffällt, nicht jedoch um den Preis der Verletzung der Ensembledisziplin. Auf diese Dialektik wird später im Rahmen der Erörterungen zur „balancierenden Identität“ eingegangen. Das Ensemble besitzt, wie bereits ausgeführt, ein Interesse an einer Einheitlichkeit der Darstellung. Neben dem Erfolgsinteresse gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund, weshalb ein Ensemble grundsätzlich keine Abweichung einzelner Gruppenmitglieder akzeptieren kann. Dabei geht es um die Gefahr einer „sozialen Ansteckung“ mit einem Stigma, dessen Implikationen stets auf die Mitglieder einer Gruppe übertragen werden, zu der ein Individuum mit einem Stigma gehört. Ein solcher Sachverhalt ergibt sich typischerweise bei Familien, in denen einzelne Familienmitglieder eine „Schande“ über den Rest der Familie bringen, z.B. der Alkoholiker-Vater oder die drogenabhängige Tochter. 118 So gibt es immer eine Tendenz des Ensembles, die Darsteller auf eine „magere Parteilinie“219 zurückzuführen, auch wenn deren Wirklichkeitsdefinition anders ist. Und „öffentlicher Streit zwischen Ensemblemitgliedern (hindert) diese nicht nur an gemeinsamem Handeln, sondern beeinträchtigt auch die vom Ensemble dargestellte Realität. Um jenen Realitätseindruck zu schützen, kann von den Ensemblemitgliedern verlangt werden, dass sie keine öffentlichen Meinungsäußerungen abgeben; bevor die offizielle Stellung des Ensembles einmal festgelegt ist, können alle Mitglieder verpflichtet werden, sich nach ihm zu richten.“220 So werden mögliche Abweichler – mit Macht – auf die Parteilinie zurückgeführt. Eine überzeugende Situationsbzw. Realitätsdefinition durch ein Ensemble kann nur auf der Basis einer Einmütigkeit erfolgen, und das ist der Grund für die Ausgrenzung von Abweichlern: ihre Existenz gefährdet die einheitliche Situationsdefinition des Ensembles und damit auch dessen Definitionsmacht. 4.2. Gefährdete Darstellung und Identität Die Möglichkeit, der Gefährdung der Interaktionssituation, weil die gegenseitigen Situationsinterpretationen verfehlt werden, ist stets latent gegeben. Goffman befasst sich daher mit der Frage, wie die an der Interaktion beteiligten Personen umfangreiche Maßnahmen ergreifen, um einen Zustand situativer Anomie zu vermeiden: „Tatsächlich kann man feststellen, dass immerzu Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, um peinliche Situationen zu vermeiden, und dass ständig Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um diskreditierende Vorfälle auszugleichen, die nicht zu vermeiden waren.“221 Solche Maßnahmen sind Techniken, „die zur Sicherung des Eindruckes angewendet werden, den ein Einzelner in Gegenwart anderer aufgebaut hat.“222 Um die Beständigkeit einer erwünschten sozialen Identität, die auf den interaktiven Prozess gemeinsam getragener Situationsdeutung zurückgeht, muss also stets gerungen werden: „Normalerweise sind Situationsbestimmungen der einzelnen 219 Goffman 1959, S. 80 Goffman 1959, S. 80 221 Goffman 1959, S. 16 222 ebd. 220 119 Mitglieder einer Gruppe so weitgehend aufeinander abgestimmt, dass keine offensichtlichen Widersprüche auftreten. (...) Man erwartet von jedem Teilnehmer, dass er seine unmittelbaren tieferen Gefühle unterdrückt und einen Aspekt der Situation ausdrückt, den seiner Ansicht nach die anderen wenigstens vorübergehend akzeptieren können. Diese oberflächliche Übereinstimmung, die den Anstrich von Einigkeit hat, wird ohne Schwierigkeiten aufrechterhalten, wenn jeder seine eigenen Bedürfnisse hinter der Verteidigung von Werten verbirgt, denen sich alle Anwesenden verpflichtet fühlen.“223 Und weiter: „Alle Gruppenmitglieder tragen gemeinsam zu einer umfassenden Bestimmung der Situation bei, die weniger auf echter Übereinstimung über die Realität beruht, als auf echter Übereinstimmung darüber, wessen Ansprüche in welchen Fragen vorläufig anerkannt werden sollen.“224 Die Einigkeit des Ensembles wird in der Regel mit Machtmitteln und mit Bezugnahme auf die die Aktionen des Ensembles strukturierenden Werte durchgesetzt. Goffman erkennt jedoch zutreffend, dass diese Einigkeit aufgrund der Ausprägungen der persönlichen Identität stets gefährdet ist. Die Darstellung, die entscheidend dafür sein kann, ob ein Individuum „dazugehört“ oder nicht, ob die soziale Umwelt dazu bereit ist, die Definitions- und Kommunikationsmacht des Individuums anzuerkennen oder nicht, ist labil. Innerhalb der Darstellung können sich Abweichungen entwickeln: „Manchmal treten Störungen durch ungewollte Gesten, Fauxpas und Szenen auf, widersprechen der dargestellten Situation oder diskreditieren sie (...) Wir beobachten, dass sowohl die Darsteller als auch Publikum und Außenseiter bestimmte Techniken anwenden, um das Schauspiel zu retten. Um eine Gewähr dafür zu haben, dass solche Techniken zum Einsatz kommen, wird das Ensemble möglichst Mitglieder wählen, die loyal, diszipliniert und sorgfältig sind, und sich taktvolle Zuschauer suchen.“225 223 Goffman 1959, S. 12f. Goffman 1959, S. 13 225 Goffman 1959, S. 218 224 120 Daher gilt, „dass der Eindruck von Realität, den eine Darstellung erweckt, ein zartes, zerbrechliches Ding ist, das durch das kleinste Missgeschick zerstört werden kann.“226 Und dies geschieht auch oft genug. Goffman gibt gegen Ende seines Buches „Wir alle spielen Theater“ eine Zusammenfassung der Störpotentiale in den Fällen misslungener Dramaturgie: „Wenn ein Einzelner vor anderen erscheint, stellt er bewusst oder unbewusst eine Situation dar, und eine Konzeption seiner selbst ist wichtiger Bestandteil dieser Darstellung. Wenn ein Ereignis eintritt, das mit dem hervorgerufenen Eindruck unvereinbar ist, machen sich gleichzeitig auf drei verschiedenen Ebenen der sozialen Realität Folgen bemerkbar, von denen jede von einem anderen Bezugspunkt und einer anderen Tatsachenebene ausgeht.“227 1. Im Hinblick auf die individuelle Persönlichkeit heißt das: der Einzelne bezieht sich selbst stark in seiner Identifikation mit einer bestimmten Rolle, Institution oder Gruppe in sein Selbstbild als jemand ein, der keine sozialen Interaktionen stört und die Sozialeinheiten nicht im Stich lässt, die von der Interaktion abhängig sind. Wenn eine Störung eintritt, wird die Selbstdarstellung, auf die eine Persönlichkeit aufgebaut wurde, diskreditiert. Goffman bezeichnet dies als Störung unter dem Gesichtspunkt der Einzelpersönlichkeit. 2. Im Hinblick auf die soziale Interaktion wird festgestellt, dass der Dialog in einen peinlichen und verworrenen Stillstand geraten kann. Das soziale System der Interaktion ist desorganisiert, und ursprünglich ins Auge gefasste Handlungspläne und Motive werden hinfällig. Goffman bezeichnet diesen Umstand an anderer Stelle als „Pathologie der Interaktion“228 und meint damit die Folgen der Störung unter dem Gesichtspunkt der sozialen Interaktion. 3. Das Publikum neigt dazu, das Selbst, das der Darsteller während seiner Vorstellung von sich entwirft, als stellvertretend für das Ensemble, z.B. die Kollegengruppe, aber auch die Familie, zu der jener gehört, anzusehen. Weiters wird die einzelne Darstellung, die das Individuum liefert, als 226 Goffman 1959, S. 52 Goffman 1959, S. 221 228 vgl. Goffman 1963, S. 22f. 227 121 Beweis dafür angesehen, ob es seine Rolle beherrscht oder nicht, ob es überhaupt dazu in der Lage ist, irgendeine Rolle zu spielen. Im Sinne einer „sozialen Ansteckung“ werden die größeren Sozialeinheiten (z.B. die Arbeitsgruppen, die Vereine, die Ämter, die Familien usw.) immer mit hineingezogen in die zunächst individuenbezogene Bewertung. Mit jeder Darstellung wird die Legitimität der Ensembles aufs Neue in Frage gestellt und ihr bleibender Ruf aufs Spiel gesetzt. Das sind die Folgen der Störung vom Standpunkt der Sozialstruktur. Interaktionen sind demnach eine heikle Angelegenheit, weil ihr Gelingen durchaus nicht garantiert ist: „Obgleich die Wahrscheinlichkeit der Störung von einer Interaktion zur anderen sehr verschiedenartig ist und auch die Bedeutung möglicher Störungen stark variiert, so scheint es doch, als gebe es keine Interaktion, in der die Teilnehmer nicht ein merkliches Risiko eingehen, geringfügigen Peinlichkeiten ausgesetzt zu sein, oder ein leichtes Risiko eingehen, tief gedemütigt zu werden. Vielleicht ist das Leben kein Glücksspiel, aber die Interaktion ist es.“229 Nicht wenige Soziologen, die sich mit Goffman befasst haben, rezipieren im Wesentlichen den Aspekt seines Werkes, wonach die Menschen offenbar in berechnender Art und Weise stets danach trachteten, im Rahmen des tagtäglichen Schauspieles eine möglichst optimale Präsentation ihrer selbst zu bieten, stets auf ihren eigenen Nutzen bedacht, täuschend und überaus opportunistisch sich durch das Leben mogelnd, eine Identität konstruierend, die ihr eigentliches und wahres Selbst verleugnet. Es scheint so, als hätten für Goffman die Aussagen der klassischen Theorien, wonach die Menschen in die Gesellschaft mit ihren Wertstrukturen sozialisiert werden, die sie dann auch als verbindlich anerkennen und deswegen gerade nicht täuschen, von geringer Bedeutung. Man könnte indes eher vermuten, dass Goffman mit seinen Arbeiten einen systemaffirmativen Ansatz der Klassiker relativieren wollte. In der Tat hat sich in den Sozialwissenschaften die Erkenntnis durchgesetzt, dass moralische Werte in ihrer sozialisationsdeterminierenden Wirkung offenbar doch nicht so handlungsprägend 229 Goffman 1959, S. 222 122 sind, wie von den Klassikern Durkheim, Mead, Erikson und Parsons vermutet. An dieser Stelle muss man ausdrücklich die Position Max Webers erwähnen, der die Existenz eines zweckrationalen Handelns neben wertrationalem Handeln postuliert hat und damit erklären kann, dass Menschen zwar analog gesellschaftlicher Werte handeln können, dass sie sich aber, da wo es für sie günstig ist, auch an anderen als moralisch bewerteten Kriterien orientieren können, ohne zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden.230 Dazu gehört z.B. der Vermieter, der in legitimer Weise die überschuldete Familie mit Mietrückständen aus der Mietwohnung klagt, oder um ein drastisches Beispiel zu bemühen, der Wachmann, der im texanischen Gefängnis von Huntsville, den zum Tode verurteilten Häftlingen die Giftspritze setzt (und dabei auch nur „seinen Job macht“). Jedenfalls kann man Goffmans Sicht so deuten, dass Menschen nicht aus purer Lust außerhalb gesellschaftlicher Wertstrukturen handeln. Sie handeln so, weil es ihnen hilft, ihr Dasein zu bewältigen. Diese Hilfe kann sogar überlebenswichtig sein. Insofern ist die Charakterisierung der Menschen als opportunistisch oder berechnend unpassend. Die Gründe für eine solche Rezeption liegen wohl darin, dass manche Autoren die Theatermetaphorik „zu ernst“ nehmen und verkennen, dass Goffman die Menschen nicht wirklich als Schauspieler ansieht: er benutzt lediglich methodisch dieses Konzept. Lenz schreibt daher: „Goffman wird gänzlich missverstanden, wenn das Bild entworfen wird, als wären die Akteure bei ihm amoralische Wesen, die dauerhaft damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu betrügen. Im Gegenteil, er zeigt gerade, dass die Kooperation der Akteure ein strukturelles Erfordernis für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der interaction order ist.“231 Dieser unablässige Prozess, der die gegenseitige Verständigung über die Positionen der handelnden Individuen beinhaltet, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf deren Identitäten. Goffman ist „der Soziologe, der von der Gefährdung des Individuums wusste und deshalb immer aufs Neue beschrieb, wie Menschen sich in ihrem Alltag zu schützen versuchen – vor der Gesellschaft und vor den 230 231 vgl. Weber 1922, S. 12 Lenz 1991, S. 46 123 vielen anderen. Dass er dabei auch beschreiben musste, wie die Gesellschaft und ihre Institutionen versuchen, Identität auf eine bestimmte Funktionalität ‚hinzubiegen‘, liegt auf der Hand.“232 4.3. Die Theorie des Abweichens Die klassischen Theorien der Identitätsgenese sind von dem Regelfall einer Ontogenese im Rahmen gesellschaftlicher Strukturen ausgegangen. Abweichung wurde nicht systematisch erforscht, sondern nur als theoretischer Teilaspekt unter der Perspektive des „Misslingens“ erwähnt. Zum Beispiel befasst sich Erikson ausführlich mit der „gesunden“ Entwicklung der menschlichen Identität und erwähnt nur als deren Derivat die Perspektive der Abweichung. Parsons behandelt Abweichung als ein Phänomen einer pathologischen Entwicklung. Dieses wird in seiner Theorie deutlich von dem von ihm so empfundenen „Normalfall“ einer konformen Persönlichkeitsentwicklung abgegrenzt. Für Erikson und Parsons bedeutet Abweichung ein Verhalten, das mit gesellschaftlichen Werten unvereinbar ist und eine Ausnahme sozialisatorischer Entwicklung darstellt. Mead deutete an, dass im Falle von Abweichung die Identität des Menschen von Desintegration bedroht ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es dem Individuum nicht gelingt, unterschiedliche Wertorientierungen in sein Selbst, in den Apparat seiner verschiedenen „me’s“ bruchlos einzubauen. Die vermuteten Folgen wurden weiter oben beschrieben. Allerdings ist auch Mead nicht weiter in diese Thematik eingedrungen. Mead hat im Gegensatz zu Goffman, bei der theoretischen Konzeption der Bedingungen für die Entstehung von Identität fast ausschließlich auf Interaktion und Rollenübernahme in einvernehmlichem Sinne reflektiert. Es wird ihm daher von seinen Kritikern vorgeworfen, zu wenig Bezug auf die Frage, inwieweit bestimmte Formen der Bildung von Identität andere als solche der Harmonie und des Interessenausgleiches sind, genommen zu haben. Diese wertkonforme und integrationsorientierte Sicht steht im Einklang mit den anderen klassischen Theorien der Identitätsgenese. Diese Theoretiker interessierten sich offenbar nicht für die Erforschung von Abweichung von gesell232 Abels 1997b, S. 167f. 124 schaftlichen Normen im Sinne empirisch erfahrbarer und theoretisch systematisierbarer Konzepte. Vielmehr betrachteten sie Abweichung als Sachverhalt, von dem immer Einzelne, nämlich Außenseiter, betroffen waren. Diese Haltung ist naheliegend, wenn man wie Erikson und Parsons gesellschaftliche Normen und Konformität mit diesen in besonderer Weise hochhält. Von Konflikten mit gesellschaftlichen Normen und der gesamten gesellschaftlichen Moral haben zwar alle Theoretiker geschrieben, und die Desintegration der Identität des Individuums aufgrund moralischer Konflikte und damit eine bestimmte Form der Gefährdung des Individuums, zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden, wurde auch von Mead thematisiert. Es war jedoch Goffman, der sich systematisch mit gesellschaftlichem Außenseitertum auf der Grundlage beschädigter Identität befasst hat. 4.4. Identität und „Stigma“ Dem Untertitel zu Goffmans Buch „Stigma“ ist zu entnehmen, dass sich der Autor damit befasst, wie Menschen, die aufgrund der Tatsache, dass sie stigmatisiert werden, in ihrer Identität „beschädigt“ werden, und wie sie gezwungen sind, sich Techniken anzueignen, um das Leben mit diesem Zustand zu bewältigen. Für das Individuum, das einen Makel oder ein Stigma besitzt, ist die Darbietung mit der Zielsetzung, den Darstellungsrahmen nicht zu beschädigen, sehr schwierig. Goffman nennt die Lebenserfahrung, ein Stigma zu besitzen, einen „moralischen Werdegang.“233 Sozialisationserfahrungen vor dem Hintergrund eines Stigmas bedeuten einen Lernprozess, bei dem der Ablauf des sozialen Zusammenlebens mit den Augen der „Normalen“ gedeutet wird und das ständige Bemühen besteht, trotz der Andersartigkeit in der Welt der „Normalen“ nicht negativ aufzufallen. Allerdings bleibt stets im Bewusstsein des Individuums, dass man doch irgendwie anders, mehr oder weniger nicht zugehörig und vor allem: mehr oder weniger gefährdet ist, Demütigungen ertragen zu müssen. Zunächst beschreibt Goffman den Regelfall des Umgangs von Menschen, die „normal“ sind. In dieser alltäglichen Situation 233 Goffman 1963, S. 45ff. 125 erzeugt der Anblick alters bei ego Erwartungen in dem Sinne, dass ego alters soziale Identität antizipiert. Diese Erwartungen fließen in die von Goffman so bezeichnete „virtuale soziale Identität“ ein. Diese hebt sich jedoch von dem ab, was das Individuum an „aktualer sozialer Identität“ besitzt. In dieser Unterschiedlichkeit manifestiert sich der Umstand, dass von einem Individuum oft mehr und anderes erwartet wird, als es de facto ist. Wenn also alter ein Fremder ist und ich mir einer Tatsache bezüglich alters inne werde, die eine diskrepante Kognition zu meiner Erwartung darstellt, drückt sich das als Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität alters aus. Soweit es sich dabei um eine ungünstige Eigenschaft handelt, mutiert in meiner Vorstellung alter zu einem Menschen, der eine Schandsignatur besitzt, ein Stigma. Der Stigmabegriff ist relativ: „Ein und dieselbe Eigenschaft vermag den einen Typus zu stigmatisieren, während sie die Normalität eines anderen bestätigt, und ist daher als ein Ding an sich weder kreditierend noch diskreditierend.“234 Als Beispiele mögen rote Haare oder uneheliche Kinder dienen. Was in dem einen sozialen Milieu peinlich und schändlich ist, kann in dem anderen völlig unproblematisch sein. Es gibt aber gewisse Sachverhalte, wie z.B. Geisteskrankheit oder Inzest, die in fast allen Gesellschaften diskreditierend sind. Goffman unterscheidet zwischen zwei Gruppen von Menschen, die mit Stigmata zu tun haben: Diskreditierbare und diskreditierte Menschen. 4.5. Diskreditierbare Menschen Zu den diskreditierbaren Menschen gehören jene, die eine Eigenschaft besitzen, die, wenn sie erkannt wird, zum Stigma werden kann. Hier kommt es wesentlich auf den Grad der Visibilität der maßgeblichen Eigenschaft an: ein Mensch wird solange nicht als abweichend etikettiert, solange seine Abweichung nicht bekannt und als solche nicht benannt ist. Daher ist das diskreditierbare Individuum gezwungen, gegenüber seiner sozialen Umwelt sein Stigma zu verheimlichen. Damit muss es einen Teil seiner Lebensvollzüge um die gesellschaftlichen Konsequenzen der Stigmaeigenschaft organisieren. Die Person 234 Goffman 1963, S. 11 126 muss lernen, den Umgang mit der Information über ihren Fehler sorgsam zu steuern. Sie muss genau bedenken, ob und wem sie ihren Makel gesteht. Indem der Stigmaträger sein wahres „Sosein“ verbirgt, „erhält und akzeptiert er eine Behandlung, die auf falschen Voraussetzungen hinsichtlich seiner beruht.“235 Goffman stellt fest, dass diskreditierbare Menschen dazu gezwungen sind, bezüglich ihrer Stigma-Eigenschaft zu täuschen. Dies stellt die wichtigste Maßnahme des Informationsmanagements dar.236 Goffman hat den „Techniken der Informationskontrolle“237 ein ganzes Kapitel gewidmet. Dabei geht es immer darum, die persönlichen Eigenschaften, die ein Stigma darstellen können, zu verbergen. So kann die Person, die eine Gesichtsdeformation hat, versuchen, dieselbe mit bestimmten Kleidungsstücken zu verbergen. Neuerdings werden Schönheitsoperationen immer beliebter. Die räumliche Welt des Individuums, das etwas zu verbergen hat, kann aufgeteilt sein. Bestimmte Bereiche sind gefährlich für die Aufrechterhaltung der Kontrolle über das Stigma. Zum einen kann es sein, dass das Individuum an einem Ort nicht gesehen werden möchte, an dem ansonsten andere Menschen mit dem spezifischen Stigma anzutreffen sind und die Anwesenheit für Unbeteiligte die Vermutung nahe legt, dass der dort vorgefundene Mensch ebenfalls ein Stigmaträger ist. Dies betrifft z.B. den bürgerlich lebenden Ehemann, der keinesfalls als potentieller Freier auf einem Straßenstrich erkannt sein möchte. Zum anderen kann es Bereiche geben, zu denen das Individuum legitimerweise keinen Zugang hat. Und wenn es sich doch Zugang verschaffen sollte, kann die Enthüllung als eine Person, die dort nicht „hingehört“, Ausstoßung bedeuten oder, aufgrund der Unerfreulichkeit und Peinlichkeit, eine stillschweigende Kooperation der Beteiligten verursachen, so dass ein Eklat zumindest vorerst vermieden werden kann. Eine weitere Teilung der räumlichen Welt erfolgt im Hinblick auf die persönliche Identität. Es ist für ein Individuum, das gezwungen ist, die Umwelt über sein Stigma zu täuschen, wichtig, 235 Goffman 1963, S. 57 vgl. ebd. 237 Goffman 1963, S. 116ff. 236 127 sich hauptsächlich an Orten zu befinden, wo es anonym ist. Typischerweise leben viele homosexuelle Männer hauptsächlich in urbanen Ballungsräumen, um sich der Kontrolle durch Verwandte und Kollegen entziehen zu können. Diskreditierbare Menschen müssen auch in strategischer Weise lernen, Distanz zu anderen zu wahren, bewusst den Umgang mit Menschen zu meiden, der dazu führen könnte, dass eine Diskreditierung stattfindet. Sie beenden daher soziale Beziehungen zu „Prästigma“-Freunden, Verwandten und Kollegen, nur um zu verhindern, dass es zu der Entlarvung kommt. Und sie verschließen sich neuen Beziehungen, soweit es zu vermuten steht, dass ein „Gefahrenpotential“ existieren könnte. Hieraus resultiert auch eine systematisch betriebene Entwicklung, deren Resultat die Einsamkeit und soziale Isolation des Individuums sein kann: „Durch die Aufrechterhaltung physischer Distanz kann das Individuum auch die Tendenz anderer einschränken, eine persönliche Identifizierung von ihm anzusammeln.“238 Dazu gehört der Wechsel des Wohnortes, um eine räumliche Distanz zu den sonstigen Orten der allgemeinen und gegebenenfalls obskuren Lebensvollzüge zu erreichen. Damit wird eine biographische Zusammenhangslosigkeit239 erreicht. Goffman bezeichnet die Technik des Nichtoffenbarens diskreditierender Informationen als „Täuschen“. Damit ist ein Verhalten gemeint, das von Menschen praktiziert wird, die es vorziehen, als „Normale“ angesehen zu werden. Täuschen kann in der Interaktion als dramaturgisches Mittel eingesetzt werden, um eine bestimmte Wirklichkeitsdefinition zu erhalten. Unter der Formel „Darstellung auf der Vorderbühne“ beschreibt Goffman die vielfältigen Methoden, wie Ensembles und ihre Mitglieder mit dem Ziel, eine bestimmte Situationsdefinition aufrechtzuerhalten, eine Vorstellung geben, die sich von der Lebensrealität auf der Hinterbühne unterscheidet. Die Täuschung besteht z.B. darin, „Personen aus dem Publikum auszuschließen, die den Darsteller vor längerer Zeit in einer anderen und der jetzigen, widersprechenden Rolle gesehen haben.“240 238 Goffman 1963, S. 125 vgl. Goffman 1963, S. 126 240 Goffman 1959, S. 126 239 128 Personen, die täuschen, führen ein Doppelleben, das sie potentiell erpressbar macht. Täuschen bezieht sich auf etwas Diskreditierendes aus der Vergangenheit oder der Gegenwart des Individuums. Die Unsicherheit des diskreditierbaren Individuums steigt an, „je mehr andere über die dunkle Seite Bescheid wissen.“241 Es handelt sich dabei um die Bedrohung einer gegenwärtigen sozialen Identität, die dadurch entsteht, dass einige Menschen über die Vergangenheit des Individuums oder über die dunkle Seite seiner Gegenwart informiert sind. Die umgekehrte Variante ist jedoch auch möglich: ein Stigma, das ein Individuum in der Gegenwart besitzt, kann eine von Diskreditierung bisher verschonte Vergangenheit gefährden. Auch hier kann es für das Individuum wichtig sein, zu täuschen. So geht es z.B. der Prostituierten, die unter allen Umständen vermeiden möchte, mit Männern aus ihrem Heimatort zusammenzutreffen, die dort ihrem guten Ruf ein jähes Ende bereiten könnten. Goffman nennt verschiedene Ausprägungen des Täuschens.242 Die folgende Auflistung soll als eine Darstellung von Täuschungshandlungen mit zunehmender Intensität und Schwere verstanden werden: - unwissentliches Täuschen - unbeabsichtigtes Täuschen - Täuschen aus Spaß - Täuschen während nicht-routinemäßiger Teile des sozialen Ablaufes - Täuschen während täglicher Routineangelegenheiten - „Untertauchen“, das heißt vollständiges Hinwegtäuschen in allen Lebensbereichen. Das Individuum täuscht nach Goffmans Meinung unwissentlich und unbeabsichtigt, wenn es selbst nicht weiß, dass es gerade täuscht oder sich sozusagen beim Täuschen selbst ertappt. Fälle unwissentlichen Täuschens sind nach Ansicht des Verfassers dieser Arbeit schwer zu rekonstruieren. Denkbar wären z.B. Menschen, die permanent als gut gelaunt auftreten. Für den Fall, dass eine Personen wirklich permanent gut gelaunt ist, ist nach meiner Meinung davon auszugehen, dass sich diese Person 241 242 Goffman 1963, S. 99 vgl. Goffman 1963, S. 102 129 in einem Grenzbereich seelischer Gesundheit befindet. Dies zumal, wenn diese Person - ohne sich dessen inne zu sein - ihre soziale Umwelt und sich selbst mit ihrem Verhalten täuscht. Maßgeblich für die Täuschung ist, dass mit Absicht etwas Unwahres dokumentiert wird, wenn es gleichzeitig möglich gewesen wäre, bei der Wahrheit zu bleiben.243 Wo die Absicht fehlt, kann es sich nur um Irrtum oder seelische oder geistige Unzulänglichkeit handeln. Goffman macht zu diesen Grenzfällen leider keine weiterführenden Aussagen. Es liegt auf der Hand, dass viele Täuschungshandlungen aus Spaß geschehen. Allerdings ist einem diskreditierbaren Individuum sicher nicht nach Spaß zumute. Insofern ist auch diese Kategorie nicht wesentlich für diese Arbeit. Das nicht routinemäßige Täuschen kommt für das diskreditierbare Individuum in Frage, wenn es sich außerhalb seiner normalen Alltagsbezüge bewegt. Eine schwerhörige Ehefrau und Mutter hat es nicht nötig, im Bereich ihrer Familie ihre Behinderung zu verheimlichen. Dies kann aber der Fall sein, wenn sie zusammen mit ihrem Mann zu einem Ball eingeladen ist. Plötzlich wird das Täuschen wichtig, und der Mann hat in diesem Zusammenhang auch noch eine besondere Funktion als Mit-Täuscher. Das routinemäßige Täuschen im Alltag findet in der Mehrzahl der Fälle zur Abwehr von Diskreditierungen statt. Nach Goffmans Erkenntnis wird dies von allen Menschen angewendet, die bestimmten kulturell vermittelten Idealen nicht entsprechen. Vor allem im Berufsleben ist das Täuschen erforderlich, je härter und unbarmherziger der Konkurrenzkampf wird. Dabei geht es um das Täuschen über Unzulänglichkeiten und Fehler, die einen unter Umständen den Job kosten können. Schließlich ist das „Untertauchen“ die Variante des Täuschens, die die gesamte soziale und personale Identität des Individuums umfasst und dann zum Tragen kommt, wenn ein Weiterleben in den bisherigen Bahnen überhaupt nicht mehr möglich erscheint. Dies ist typisch für Kriminelle und Prostituierte. 243 vgl. Schmid 2003, S. 52f. 130 Goffman spricht von einer „Täuschungseskalation“, in die man als Diskreditierbarer geraten kann. Dies bezeichnet eine besondere Dynamik des Täuschens, die darin besteht, dass man sich unversehens in Entwicklungen „hineintäuschen“ kann, aus deren Verstrickungen sich zu lösen schwer sein kann: „Wer täuscht, leidet auch unter ‚Sichhineinreiten‘, das heißt unter dem Druck, eine Lüge nach der anderen auszuarbeiten, um eine bestimmte Enthüllung zu verhindern.“244 Thiersch schreibt: „in Täuschungen sich zu bewegen, ist gefährlich. Man hat das Täuschen nicht in der Hand, die erste falsche Auskunft bedingt, um glaubwürdig zu bleiben, die zweite, die wieder die dritte, und so verfängt sich, wer sich auf Täuschen einlässt, leicht im Netz seiner eigenen Lügen. Täuschungen durchzuhalten, verlangt gespannte Aufmerksamkeit. Der Diskreditierbare lebt wie auf Lauer. Verraten vielleicht Anspielungen, dass der andere schon weiß, was er nicht wissen sollte? In Täuschungen zu leben, bedeutet, ein Doppelleben führen und deshalb Angst.“245 Täuschen ist der Versuch des Individuums, der sozialen Umwelt die Möglichkeit zu nehmen, Stigmatisierungen auszuüben. Damit steht dahinter auch das peinliche Bemühen, nicht zum Außenseiter gemacht zu werden. Es kann auch das Bemühen dahinter stehen, seine Identität in ihren für die soziale Umwelt erfahrbaren Zügen, „aufwerten“ zu wollen, indem Eigenschaften geltend gemacht werden, die vermeintlich Distinktionsgewinne erzeugen. Fatalerweise kann man genau dann zum Außenseiter werden, wenn man sich auf solche Strategien einlässt. Wer meint, eine diskreditierende Eigenschaft verbergen zu müssen oder eine Eigenschaft vortäuschen zu sollen, die ungerechtfertigte Distinktionsgewinne vermittelt, macht seiner sozialen Umwelt etwas vor und wird dadurch unauthentisch, unglaubhaft und schließlich zunehmend einsam. In diesem Zusammenhang ist ein Verweis auf die psychischen und sozialen Kosten dieses Verhaltens angebracht. Dafür steht das folgende Zitat von Goffman: „Ebenso kann der Einzelne, wenn er auch nur einen Punkt zu verbergen hat, und selbst wenn die Gefahr der 244 245 Goffman 1963, S. 107 Thiersch 1969, S. 376f. 131 Entdeckung höchst unwahrscheinlich ist, während seiner ganzen Darstellung von Angst verfolgt sein.“246 4.5.1. Etikettierung Goffman hat als Schwelle zwischen dem Zustand der Diskreditierbarkeit und des Diskreditiertseins die Visibilität des Stigmas benannt, das heißt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt oder Zustand das Stigma nicht mehr verleugnet werden kann. Von nun an ist eine von dem Stigma unbeeinträchtigte Interaktion des Stigmaträgers mit den „Normalen“ nicht mehr möglich. Im Falle körperlicher Stigmata ist dies evident. Eine Interaktion eines sehenden mit einem blinden Menschen wird irgendwann auf die Behinderung Bezug nehmen müssen, spätestens dann, wenn man sich über visuell geprägte Themen unterhalten will. Völlig anders ist es jedoch mit solchen Stigmata, die zunächst nicht erkennbar sind, wie in den Fällen der von Goffman so genannten „Charakterfehler“ und den „phylogenetischen Stigmata“. Bestimmte Stigmata bedürfen zu ihrem Wirksamwerden einer Hervorhebung, einer Kennzeichnung, einer symbolischen Aufladung. Howard Becker hat den Sachverhalt, dass soziale Zuschreibungen zu einer bestimmten, von der Umwelt perzipierten Eigenschaft führen können, als „labeling“ bezeichnet. Die aus dieser Beobachtung abgeleitete wissenschaftliche Theorie, der labeling approach bzw. die Etikettierungstheorie soll nun erklärt werden. In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstand im theoretischen Kontext des symbolischen Interaktionismus die Etikettierungstheorie. Ihr Anliegen war eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit abweichendem Verhalten als gesellschaftlichem Phänomen. Aus den drei Prämissen des symbolischen Interaktionismus, dass nämlich - Menschen auf der Grundlage der Bedeutungen, die die Dinge für sie haben, handeln, 246 ebd. 132 - diese Bedeutungen aus der Interaktion mit Anderen, insbesondere mit vertrauten Anderen erwachsen und - die Bedeutungen kontinuierlich durch Interpretationsprozesse modifiziert werden, lässt sich eine theoretische Fragestellung zu gesellschaftlicher Abweichung ableiten, die neben den in der Person liegenden Faktoren zu klären versucht, „inwieweit (...) die Verhaltensweisen der Normalen an der Ausbildung sozial auffälligen Verhaltens (...) mitbeteiligt sind.“247 Die Etikettierungstheorie ist die Anwendung interaktionistischer Perspektiven auf das gesellschaftliche Phänomen der Devianz. Im Unterschied zu den funktionalistischen Ansätzen in der Soziologie (z.B. der strukturfunktionalistischen Theorie von Parsons oder der Anomietheorie Mertons), die abweichendes Verhalten in erster Linie als ein Resultat spezifischer Ausrichtungen der handelnden Person oder der Situation ansehen, richtet die Etikettierungstheorie ihr Augenmerk auf die Vorgänge, die die Zuweisung einer Person bzw. ihres Verhaltens in die Kategorie „abweichend“ bzw. „nicht-abweichend“, als Ergebnis eines komplizierten Interaktions- und Interpretationsprozesses, bewirken. Frey sieht dafür drei Faktoren als maßgeblich an: 1. Etikettierungen treffen bevorzugt Personen mit geringem sozialen Status, 2. Etikettierungen führen zu Veränderungen des Selbstbildes, 3. Etikettierungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit fortgesetzten kriminellen Verhaltens.248 Als theoretische Vorläufer gelten die Arbeiten von Tannenbaum (Crime and Community, 1938) und Lemert (Social Pathology, 1951). Lemert unterscheidet im Rahmen seiner Analyse zwischen primärer und sekundärer Deviation. Primäre Deviation ist nach Lemert einfach nur die aktuelle Verwirklichung abweichenden Verhaltens jeglicher Art. Dieses Verhalten kann vielfältige Gründe und Ursachen haben, die entweder in der Person des Abweichenden zu finden sind oder in der konkreten Situation. Dieser Ansatz wird als „ätiologisch“ bezeichnet und 247 248 Thiersch 1969, S. 373 vgl. Frey 1983, S. 11f. 133 kümmert sich nicht um die gesellschaftlichen Randbedingungen der Abweichung. Sekundäre Deviation hingegen ist die Folge aus den Problemen, die dem Individuum aus den sozialen Reaktionen auf das abweichende Verhalten entstehen. Sie ist das Produkt einer von der Umwelt vorgenommenen Rollenzuschreibung als Normverletzer. Nicht jede primäre Abweichung wird bestraft. Bei dem primär devianten Individuum sind die Übertritte zunächst unbekannt und von seiner sozialen Identität als regelkonformem Individuum überlagert. In bestimmten Fällen herrscht außerdem ein höheres Maß an Toleranz in Hinblick auf die Übertritte. Auf diese These werde ich weiter unten zurückkommen. Die sekundäre Devianz hängt von der Reaktion der sozialen Umwelt auf die primäre Abweichung ab. Diese besteht in der negativen Sanktionierung der Abweichung und der Stigmatisierung des Individuums. Die Tatsache, dass die Übertritte des Individuums bekannt geworden sind, beeinflusst seine soziale Identität. Eine Folge daraus kann vor allem bei Jugendlichen eine weitergehende Bindung an Gruppen sein, die systematisch abweichendes Verhalten praktizieren, was z.B. eine zunehmende Verstrickung in deviante, subkulturelle Milieus nach sich zieht. Das Tragische an diesem Prozess ist, dass das Individuum, das für seine Abweichung bestraft werden soll, nun erst recht abweichend wird. Die von der Gesellschaft als deviant erkannte Person passt ihr Verhalten ihrem Status an. Das Modell beinhaltet eine Dynamik, gleichsam eine Eskalation, wobei die soziale Kontrolle und die gesellschaftliche Reaktion eher die Ursache als die Folge des abweichenden Verhaltens darstellt. Die Arbeit Lemerts gilt als eine frühe Version der Etikettierungstheorie. Wesentlich häufiger wird jedoch auf die Arbeit Howard Beckers Bezug genommen, die erstmals 1963 unter dem Titel „Outsiders“ veröffentlicht wurde.249 249 Becker hat die Bezeichnung „labeling-theory“ abgelehnt. Stattdessen hat er sein theoretisches Konzept als „Interaktionstheorie abweichenden Verhaltens“ bezeichnet, vgl. Becker 1963, S. 163 134 4.5.2. Abweichung als Folge gesellschaftlicher Normsetzung Menschliche Gesellschaften entwickeln aus ihren Werten bestimmte Normen und Verhaltenserwartungen, die das Zusammenleben ihrer Mitglieder steuern und regulieren. Die Valenz dieser Normen hängt davon ab, dass – soweit notwendig – ihre Durchsetzung mit dem Ziel erfolgt, die soziale Ordnung zu schützen. Normen definieren, welche Verhaltensweisen in positiver oder negativer Weise sanktioniert werden. So schreibt Thiersch: „Abweichendes Verhalten kann nur von den Regeln und Normen aus bestimmt werden, die in der Gesellschaft gelten.“250 Und so ist die Beachtung und Befolgung gesellschaftlicher Normen und Regeln das maßgebliche Kriterium dafür, ob ein Mensch als Gesellschaftsmitglied in positiver Weise anerkannt oder ausgeschlossen wird: „Wenn eine Regel durchgesetzt ist, kann ein Mensch, der in dem Verdacht steht, sie verletzt zu haben, als besondere Art Mensch angesehen werden, als eine Person, die keine Gewähr dafür bietet, dass sie nach den Regeln lebt, auf die sich die Gruppe geeinigt hat. Sie wird als Außenseiter angesehen.“251 Der Außenseiter ist jemand, der von den Gruppenregeln abweicht. Weiter schreibt Becker, dass im Gegensatz zu den Aussagen ätiologischer oder funktionalistischer Erklärungsversuche, die die Gründe für die Devianz in der Person des Regelverletzers suchen, nach seiner Überzeugung das abweichende Verhalten von der Gesellschaft geschaffen wird, bzw. „dass gesellschaftliche Gruppen abweichendes Verhalten dadurch schaffen, dass sie Regeln aufstellen, deren Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert, und dass sie diese Regeln auf bestimmte Menschen anwenden, die sie zu Außenseitern abstempeln.“252 Zu diesem Zwecke bildet die Gesellschaft bestimmte Institutionen um Abweichung im Verhältnis zu gesellschaftlichen Regeln zu erkennen und ermächtigt sie zur Durchführung von Sanktionsmaßnahmen: „Die Art von Institutionen, die gesellschaftlich zur Verfügung stehen, und die Art ihrer Ausdifferenzierung bestimmen dann, wie das herangetragene Problem auch inhaltlich definiert wird. ‚Kriminalität’ etwa ist dann dadurch 250 Thiersch 1969, S. 374 Becker 1963, S. 1 252 Becker 1963, S. 8 251 135 bestimmt, dass es das Strafrecht und die Polizei gibt, die für bestimmte ‚Dienste’ in Anspruch genommen werden können, und davon, dass für die Bewältigung bestimmter Problemlagen diese Dienste als brauchbar erscheinen und daher in Anspruch genommen werden.“253 Die Etikettierungstheorie relativiert die strukturfunktionalistische Position, wonach es so etwas wie eine objektive Wahrheit und Wirklichkeitsdeutung gibt. Im Gegenteil: die oben erwähnten Institutionen, die z.B. mit der Strafrechtspflege betraut sind, konstruieren gesellschaftliche Wirklichkeit: „Man kann Normen des formellen Strafrechts als für die Organe der Strafrechtspflege verbindliche Regeln der Wirklichkeitskonstruktion ansehen.“254 In Deutschland wurde die Etikettierungstheorie hauptsächlich im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen in Bezug auf kriminelles Verhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen diskutiert. Feest und Blankenburg beschreiben in ihrer Arbeit eine situative Definitionsmacht der Polizei, die dem Schutzinteresse des beobachteten Individuums entgegensteht. Unter Definitionsmacht verstehen Feest und Blankenburg „die sozial vorstrukturierte Chance, eine Situation für andere verbindlich zu definieren. Diese Macht kann auf ausdrücklicher gesetzlicher Delegation beruhen, sie kann jedoch auch völlig außergesetzlich vorhanden sein.“255 Diese Macht beinhaltet nach der Überzeugung Feests und Blankenburgs die Möglichkeit, eine eigene, von rationalen Kriterien losgelöste Wirklichkeit zu definieren. So beschreiben die Autoren, wie die Polizisten einen bestimmten Menschentypus bewusst in einen Kriminalitätszusammenhang bringen, unabhängig davon, ob sich die konkrete Person abweichend verhalten hat oder nicht. Feest und Blankenburg nennen dies „verdachtsgeleitete Wirklichkeitskonstruktion.“256 Was sie darunter verstehen, ergibt sich aus folgendem Zitat: „Unter den geschilderten Bedingungen erlaubt die polizeiliche Definitionsmacht es nicht nur, formale Regeln juristischer Tatsachenfeststellung zu verletzen, (...) sondern auch durch selektive 253 Steinert 1984, S. 30 Feest u. Blankenburg 1972, S. 50 255 Feest u. Blankenburg 1972, S. 19 256 Feest u. Blankenburg 1972, S. 51 254 136 Perzeption und Wiedergabe von Fakten, die ‚Wirklichkeit’ dem Verdacht anzupassen.“257 Bei ihrer Arbeit verhält sich die Polizei nach Feests und Blankenburgs Feststellung höchst unterschiedlich, je nachdem welcher sozialen Schicht die Person angehörte, die in das Visier polizeilicher Ermittlungen geraten ist. Ein wichtiger Aspekt bildet dabei die Tatsache, dass die Polizei von vornherein ihre Beobachtungen im Bereich bestimmter Milieus konzentriert, so dass dort eventuell vorkommendes kriminelles Verhalten nicht entgehen kann: „Die Chancen eines Angehörigen einer sozial unterprivilegierten Schicht, in Verdacht zu geraten und überprüft zu werden, sind erheblich größer als die einer Person von höherem sozialem Status.“258 In den bürgerlichen Milieus ist die Wachsamkeit der Polizei erheblich reduziert, so dass hier eine viel höhere Chance besteht, unerkannt zu bleiben und nicht in ein System von Etikettierung und Kriminalisierung hineingezogen zu werden. So beobachten Feest und Blankenburg, dass einem Angehörigen der sozialen Unterschicht eine polizeiliche Behandlung zuteil wurde, die ihm keine Chance auf Rehabilitation ließ: „Zweifellos wären sie gegenüber jemandem, der sich als Geschäftsmann oder Akademiker ausgewiesen hätte, beträchtlich vorsichtiger gewesen.“259 Die Qualifizierung eines Verhaltens im Sinne von Abweichung ist nach der Etikettierungstheorie letztlich eine gesellschaftliche Setzung. Bestimmte Gruppen können, vermöge ihrer gesellschaftlichen Macht, anderen Gruppen bestimmte Regeln aufzwingen. Jede neue Regel schafft einen neuen Typus von Außenseiter. Becker merkt hierzu an: „Regeln sind Produkte einer Initiative, die jemand ergreift, und wir können uns Menschen, die eine solche Initiative entfalten, als moralische Unternehmer vorstellen.“260 Die Regelsetzer vergleicht Becker mit „Kreuzfahrern in moralischen Dingen“, die einen für sie wichtigen Aspekt ihrer Lebenswelt für „nicht in Ordnung“ erachten. Sie versuchen anderen Menschen ihre Sicht der Dinge 257 Feest u. Blankenburg 1972, S. 53 Feest u. Blankenburg 1972, S. 57 259 Feest u. Blankenburg 1972, S. 47 260 Becker 1963, S. 133 258 137 aufzudrängen. Dabei ist es typisch, „dass moralische Kreuzzüge von den oberen Rängen der Sozialstruktur beherrscht werden, das bedeutet, dass sie die Macht, die sie aus der Legitimität ihrer moralischen Position ableiten, noch um jene Macht verstärken, die sie aus ihrer höheren Position in der Gesellschaft ableiten.“261 Eine wichtige Konsequenz aus dem moralischen Kreuzzug ist die Aufstellung einer neuen Regel, gewöhnlich verbunden mit der Bereitstellung einer Durchsetzungsmaschinerie. Becker beschreibt diesen Zusammenhang anhand einer Gesetzesinitiative der „moral majority“ gegen eine unauffällige Gruppe von Menschen, die Marihuana konsumiert. Der Konsum von Marihuana bewirkt Rauschzustände, die nach der amerikanischen Moral unerlaubt sind. So schreibt Becker Folgendes: „Marihuana-Raucher, machtlos, unorganisiert und ohne öffentlich legitimierten Grund zum Gegenangriff, sandten keinen Vertreter zu den Anhörungen, und ihr Standpunkt fand in den Akten keinen Platz. Ohne Gegenstimme passierte das Gesetz (...) sowohl das Abgeordnetenhaus wie den Senat. Die Initiative (der moralischen Unternehmer, Anmerkung des Verfassers) hatte eine Regel geschaffen, deren anschließende Durchsetzung dazu beitrug, eine neue Klasse von Außenseitern ins Leben zu rufen – Marihuana-Raucher.“262 Die Kritik an den moralischen Unternehmern und ihren Institutionen liegt auf der Hand, und nach Beckers Meinung gibt es Wege, ihre Kreuzzüge zu beenden, „indem man ihnen nachweist, dass sie ihren selbstgesteckten Zielen nicht gerecht werden, (dass das Strafrecht keine präventiven Effekte hat, dass die Psychiatrie nicht heilt, dass die Schule Benachteiligungen nicht kompensiert) (...), denn das mit dem Etikett verbundene Stigma kann dadurch verstärkt werden: Ehemalige Insassen von Gefängnissen und Psychiatrie sind nicht rehabilitiert, schlechte Schüler bleiben ungebildet, Langzeit-Arbeitslose sind zerrüttete Persönlichkeiten.“263 261 Becker 1963, S. 135 Becker 1963, S. 131 263 Steinert 1984, S. 31f. 262 138 Gesellschaftliche Regeln definieren Situationen und die diesen angemessenen Verhaltensweisen. Bei der Konstituierung von Regeln werden gesellschaftliche Werte umgesetzt. Regeln gibt es nicht nur im großen gesellschaftlichen Kontext sondern auch in Gruppen. Die Etikettierungstheorie zeigt auf, dass die Anwendung von Regeln nicht einheitlich ist, und dass verschiedene Gruppen unterschiedliche Positionen bezüglich gesellschaftlicher Regeln haben können. So ist auch die Bewertung einer Handlung als deviant oder konform nicht eindeutig. Wie bereits erwähnt kann diese Ambivalenz sogar innerhalb einer Gruppe in Bezug auf verschiedene Menschen unterschiedlich erfolgen. Wie Feest und Blankenburg festgestellt haben, gibt es z.B. ein diskriminierendes Sanktionsverhalten der Polizei, bei dem Angehörige der sozialen Unterschicht für bestimmte Handlungen negativ sanktioniert werden, wohingegen Mittelschichtangehörige keine Sanktionen erleiden. Die Bewertung von Devianz ist kein objektiver Vorgang. Becker hat daher allen Versuchen, eine Taxonomie devianten Verhaltens aufzustellen, eine Absage erteilt. Solche Versuche sind nach Beckers Ansicht allein schon deswegen verfehlt, weil es eine Fülle von Beispielen für ungleiche Reaktionen auf menschliches Verhalten gibt. Letztlich kann eine Handlung nur dann als abweichend angesehen werden, wenn Menschen sie als abweichend definieren. In diesem Zusammenhang schreibt Steinert: „Merkmale und Eigenschaften, die an Menschen und ihren Handlungen ‚festgestellt’ werden, sind tatsächlich Abstraktionen zu einem bestimmten Zweck und daher auch Zuschreibungen. Das gilt in einem doppelten Sinn: es wird gesellschaftlich ein bestimmtes Vokabular zur Kategorisierung von Menschen und Handlungen produziert, das sich mit der Sozialstruktur und daher historisch ändert, und die Anwendbarkeit und faktische Anwendung bestimmter dieser Kategorien auf konkrete Menschen und Handlungen variiert mit der Position in der Sozialstruktur.“264 Mit diesem Zitat ist die scheinbare Kontingenz bestimmter Zuschreibungen belegt. Es ist aber nochmals eine Bekräftigung der zuvor schon erwähnten These, wonach bestimmte Gruppen, 264 Steinert 1984, S. 29 139 wie z.B. die Polizei, eine Definitionsmacht besitzen, die es ihnen ermöglicht, in gesellschaftlichem Auftrag das Verhalten von Menschen als abweichend zu bewerten und entsprechende Etikette zu verteilen, die Menschen zu gesellschaftlichen Außenseitern machen können. Nicht jedes Verhalten, das als abweichend erkannt wird, löst automatisch negative Reaktionen aus. Die Arten gesellschaftlicher Sanktionen sind nicht immer gleichsinnig. So wie die Beurteilung von Verhalten als deviant oder konform nicht eindeutig erfolgt, muss auch nicht jedes Verhalten, auch wenn es erkennbar bestehenden Regeln zuwiderläuft, negative Sanktionen nach sich ziehen. In allen Rechtsordnungen gibt es Regeln, die aufgrund des gesellschaftlichen Wandels sozialer Werte ihre Relevanz für das Leben der Menschen verloren haben. Sie fristen, soweit sie zu kodifiziertem Recht geronnen sind, das Schattendasein von Kuriositäten in den Gesetzesfolianten. Als Beispiel können die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über das Verlöbnis gemäß §§ 1297 ff. BGB angesehen werden, die bis vor kurzem noch einen „Kranzgeldanspruch“ vorsahen, der einer „unbescholtenen Verlobten“ zustand, deren Bräutigam nach gestatteter „Beiwohnung“ das Verlöbnis beendete (§ 1300 Abs. 1 BGB). Becker definiert abweichendes Verhalten als „Produkt einer Transaktion, die zwischen einer gesellschaftlichen Gruppe und einer von dieser Gruppe als Regelverletzer angesehenen Person stattfindet.“265 Aber: „Menschen reagieren auf eine von ihnen als abweichend angesehene Handlung graduell sehr unterschiedlich.“266 So kann eine Person zu dem Zeitpunkt t1 nachsichtiger für eine abweichende Handlung beurteilt werden als zum Zeitpunkt t2. Becker spricht auch in diesem Zusammenhang von „Feldzügen“, die eine bestimmte Form der Abweichung in den Fokus des öffentlichen Interesses zerren, was die fragliche Verhaltensform zu diesem Zeitpunkt gefährlicher macht als zu einem anderen Zeitpunkt. Zum Beispiel ist in den USA eine groß angelegte Kampagne gegen das Rauchen entstanden, die das, was früher selbstverständlich war (z.B. Rauchen in öffentlichen 265 266 Becker 1963, S. 8 Becker 1963, S. 10f. 140 Gebäuden), zu einer riskanten Angelegenheit für die soziale Integrität des Rauchers macht. Weiterhin gibt es nach dem Motto „duo cum faciunt idem, non est idem“ erhebliche Unterschiede der gesellschaftlichen Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten unterschiedlicher Personen oder Personenkreise. Becker weist darauf hin, dass delinquente Jugendliche aus der Mittelschicht in geringerem Maße in strafrechtliche Vorgänge verwickelt werden, als Jugendliche aus der Unterschicht. Dieser These sind auch Feest und Blankenburg nachgegangen. Sie haben festgestellt, dass Angehörige der Unterschicht nicht nur häufiger unter Beobachtung standen, sondern auch strafrechtlich anders behandelt wurden. So wurde im Fall delinquenter Mittelschichtangehöriger eher das Verfahren eingestellt, weil unter Umständen damit zu rechnen war, dass die Personen sich gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr setzen würden. Im komplementären Fall, der wehrlosen Unterschichtangehörigen, haben Feest und Blankenburg folgenden Zusammenhang formuliert: „Die Instanzen der Kriminalitätskontrolle schaffen ungleiche soziale Chancen, ‚kriminell’ zu werden. In dieser Hinsicht ähneln sie denjenigen sozialen Instanzen, welche positive soziale Güter (z.B. Bildung) zu verteilen haben. Hier wie dort wirken die Kräfte und Mechanismen, die generell dafür verantwortlich zu machen sind, dass die positiven wie die negativen Güter in der Gesellschaft ungleich und nach Kriterien verteilt sind, die ihr das Etikett der Klassengesellschaft eintragen.“267 Jugendliche aus der Unterschicht werden regelrecht irgendwelche Vergehen „in die Schuhe geschoben“, die sie möglicherweise gar nicht oder nicht in dem Ausmaß begangen haben: „aber es ist natürlich mehr als unwahrscheinlich, dass mittellose Jugendliche ohne rechte Ausbildung sich einen Anwalt nehmen, insbesondere, nachdem sie bereits ein Geständnis abgelegt haben.“268 Ein weiteres Beispiel ist die unterschiedliche Ahndung von Frauen und Männern, z.B. in Bezug auf „unerlaubte“ sexuelle Beziehungen, wie auch die unterschiedliche Reaktion auf sexuelle Partnerschaften mit großen Altersunterschieden. Jeweils wird die Rolle der Frauen strenger beurteilt. Frauen müssen mit 267 268 Feest u. Blankenburg 1972, S. 117 Feest u. Blankenburg 1972, S. 50 141 dem Verlust ihrer Ehre rechnen. Dagegen genießen Männer oft das Privileg, sogenannte Kavaliersdelikte begehen zu dürfen. Aus all dem zieht Becker folgende Schlüsse: „abweichendes Verhalten (ist) nicht einfach eine Qualität, die bei einigen Verhaltensweisen vorkommt, bei anderen nicht. Es ist vielmehr das Produkt eines Prozesses, der die Reaktionen anderer Menschen auf das Verhalten mit einschließt. Das gleiche Verhalten kann zu diesem Zeitpunkt ein Verstoß gegen Regeln sein, zu einem anderen nicht; kann ein Verstoß sein, wenn eine bestimmte Person dieses Verhalten zeigt, und kein Verstoß, wenn eine andere es zeigt; einige Regeln werden straflos verletzt, andere nicht. Kurz, ob eine gegebene Handlung abweichend ist oder nicht, hängt zum Teil von der Natur der Handlung ab (...) zum Teil, was andere Menschen daraus machen. (...) Wir können erst dann wissen, ob eine gegebene Handlung als abweichend einzuordnen ist, wenn die Reaktion anderer erfolgt ist. Abweichendes Verhalt ist keine Qualität, die im Verhalten selbst liegt, sondern in der Interaktion zwischen einem Menschen, der eine Handlung begeht, und Menschen, die darauf reagieren.“269 Im Zusammenhang mit der Strafjustiz schreiben Feest und Blankenburg entsprechend: „dass es sich bei der Identifikation eines Straftäters um einen Definitionsprozess handelt und dass das Resultat dieses Prozesses ein Ausdruck der relativen sozialen Macht der Beteiligten ist.“270 Von daher lässt sich feststellen, dass die entsprechenden Zuschreibungen nicht kontingent sind. Zuschreibungen erfolgen aufgrund vorgefasster subjektiver Theorien zu der Person oder der Personengruppe, die sich im Focus der Zuschreibenden befindet, und sie sind in der Regel interessengeleitet. 4.6. Diskreditierte Menschen Menschen sind diskreditiert, soweit ihr Stigma bekannt oder evident ist. In der Logik der Etikettierungstheorie ist dieser Punkt erreicht, wenn die potentiell stigmatisierende Verhaltensabweichung offiziell bekannt wird und die gesellschaftlichen Sanktionen beginnen. Bei einer stigmatisierten Person, deren Stigma evident ist, ist der sozialen Umwelt ohne weiteres klar, 269 270 Becker 1963, S. 12f. Feest u. Blankenburg 1972, S. 19 142 dass es eine Diskrepanz zwischen aktualer und virtualer Identität gibt. In der sozialen Interaktion mit „den Normalen“ werden diese es möglicherweise vorziehen, nicht auf das Stigma einzugehen. In solchen Fällen kann es dazu kommen, dass die Situation insgesamt als gespannt und unangenehm empfunden wird. Goffman bezeichnet ein solches Interaktionsgeschehen als „pathologisch“.271 Dabei besteht im Umgang mit anderen Menschen eine Reserviertheit, die Goffman folgendermaßen beschreibt: „Die bloße Antizipation solcher Kontakte kann Normale und Stigmatisierte dazu bringen, das Leben auf ihre Vermeidung hin auszurichten. (...) Das stigmatisierte Individuum dürfte spüren, dass es sich unsicher fühlt, wie wir Normalen es identifizieren und aufnehmen werden. Diese Unsicherheit entsteht nicht nur dadurch, dass das stigmatisierte Individuum nicht weiß, in welche von verschiedenen Kategorien es plaziert wird, sondern auch dadurch, dass es genau weiß, dass die anderen es innerlich nach seinem Stigma definieren.“272 Die Unsicherheit, nicht zu wissen, was wirklich über einen gedacht wird, bedeutet eine unaufhörliche psychische Belastung. Es gibt demnach keine verlässliche Routine der alltäglichen Interaktion, was dazu führt, dass das stigmatisierte Individuum sich zurückziehen wird und nur mit einer defensiven Attitüde an weiteren Interaktionen teilnimmt. Menschen, bei denen über die Existenz eines Stigmas nicht hinweggetäuscht werden kann, können versuchen, ihrem Stigma seine Aufdringlichkeit zu nehmen, indem sie, wie Goffman es nennt, ihr Stigma „kuvrieren“, wie z.B. Blinde, die ihre Augen mit einer dunklen Brille verbergen. Sie können ihr Stigma aber auch so herausstellen, dass ihre Behinderung wie eine normale Bedingung für ein normales Leben erscheint. Es ist auch denkbar, dass das stigmatisierte Individuum derart exponiert ist, dass die Mühe des Täuschens nicht mehr verlohnt. Dies kann in der Gesellschaft mit gleichartigen Menschen der Fall sein, was eine freiwillige oder unfreiwillige Angelegenheit sein kann (z.B. in absoluten Institutionen wie Gefängnissen). Ein denkbares Szenario ist es dann, in der sozialen Interaktion in offensiver Weise der Umwelt ein glaubhaftes Zeugnis der Stigmaeigen271 272 vgl. Goffman 1963, S. 29 Goffman 1963, S. 22f. 143 schaft zu liefern, die Umwelt zu schockieren. Nach Goffmans Ansicht provozieren die gesellschaftlichen Außenseiter, die als gesellschaftliche Minderheit auf sich aufmerksam machen, jedoch möglicherweise feindselige Reaktionen und verfestigen Vorurteile der anderen. Damit offenbart sich eine weitere Dimension des Stigmaproblems: Entweder ist das stigmatisierte Individuum zu schüchtern oder zu aggressiv, und der Interaktionspartner hat die jeweils ihm eigenen Probleme des Umgangs mit diesen Extremhaltungen. Die Interaktion wird daher entweder verkrampft oder feindselig. Jedenfalls kann das eigentliche Ziel der Interaktion nicht erreicht werden. Goffman spricht in diesem Zusammenhang von „Ich-Bewusstheit“ und „Fremdbewusstheit“ egos und alters.273 Damit meint er, dass bei der Interaktion mehr zum Tragen kommt als deren reiner Selbstzweck. Vielmehr fühlen sich ego und alter dazu verleitet, eine höchst kontrollierte und künstliche Interaktionssituation zu gestalten, die von Peinlichkeitsgefühlen und der Angst vor Fehlern geprägt ist. Schließlich ist noch auf ein drittes Szenario zu verweisen, den Umgang mit den „sympathisierenden Anderen“. Abgesehen von denen, die das Schicksal der maßgeblichen Stigmaeigenschaft teilen, gibt es noch Menschen, die mehr oder weniger indirekt mit den Folgen der Stigmata anderer umzugehen haben. Gerade die Menschen, die mit dem stigmatisierten Individuum zusammenleben (die Ehefrau des Alkoholikers, die Kinder des Kriminellen usw.) sind zum Teil maßgeblich an dem Stigmamanagement beteiligt. Sie bezahlen Schulden, liefern Entschuldigungen und Alibis, sie beteiligen sich daran, das Stigma zu kuvrieren, das heißt seine Aufdringlichkeit zu mildern, das Unerhörte an seiner Existenz zu relativieren. Dabei fällt immer auch ein Teil der Schande auf sie selbst zurück, weshalb man meines Erachtens von einer sozialen Ansteckung mit einem Stigma sprechen kann. Vor diesem Hintergrund wird es auch verständlich, wie Menschen, die sich im Grunde nahe sind, in die Lage kommen können, die Ihren zu verleugnen, sie zu verlassen. Auch unter diesem Aspekt kann ein Stigma Menschen einsam und zu Außenseitern machen. 273 vgl. Goffman 1963, S. 29 144 Aus all dem wird deutlich, dass der Besitz einer Stigmaeigenschaft das Alltagsleben erheblich verkomplizieren kann. Neben der Vermeidung „gefährlicher“ Orte und Gesprächsthemen muss die Person auch darauf achten, sich nicht in der Öffentlichkeit mit Menschen oder Symbolen zu zeigen, die eine Entlarvung zur Folge haben könnten. Goffman schreibt weiter: „Das Problem des Täuschens hat immer Fragen über den psychischen Zustand des Täuschers aufgeworfen. Erstens wird angenommen, dass er notwendig einen sehr großen psychologischen Preis zahlen, einen sehr hohen Grad von Angst ertragen muss, weil er ein Leben lebt, das in jedem Augenblick zu Fall gebracht werden kann. (...) Zweitens wird oft und mit Evidenz angenommen, dass der Täuscher sich zwischen zwei Bindungen zerrissen fühlt. (...) Vermutlich wird er auch unter Gefühlen von Illoyalität und Selbstverachtung leiden, wenn er nicht gegen ‚offensive‘ Bemerkungen einschreiten kann, die von Mitgliedern der Kategorie, in die er sich hineintäuscht, gemacht werden gegen die Kategorie, aus der er sich heraustäuscht. (...) Drittens scheint angenommen zu werden und dies offensichtlich zu Recht, dass der Täuscher sich solcher Aspekte der sozialen Situation bewusst sein muss, mit denen andere nicht kalkulieren und nachlässig umgehen.“274 Das täuschende Individuum kann nicht auf der sicheren Grundlage routinehafter Alltagserfahrung immer neue Zufallsmomente bewältigen, da frühere Verheimlichungsvorkehrungen inadäquat werden können. Wie vorher bereits referiert, geht die Unkompliziertheit der sozialen Interaktion verloren und weicht einer verkrampften Attitüde, die darauf gerichtet ist, peinliche Situationen zu vermeiden. Dies ist eine Haltung, die dazu führen kann, dass man sich schnell im sozialen Interaktionsrahmen isoliert und zum Außenseiter wird. Goffman weist darauf hin, dass das Täuschen zu erlernen eine Phase in der Sozialisation des Individuums sein kann, an deren Ende sich ein Wendepunkt des moralischen Werdegangs des Individuums abzeichnet. Wenn es einen anderen Bezug zu sich selbst gefunden hat und sich als reifer empfindet, kann es die Einstellung entwickeln, dass es 274 Goffman 1963, S. 111f. 145 seiner Würde geschuldet ist, die freiwillige Enthüllung seines Stigmas zuzulassen und aufrichtiger mit sich selbst und seiner sozialen Umwelt umzugehen. Damit ist eine Haltung beschrieben, die an mehreren Stellen dieser Arbeit ist schon benannt wurde. Die Behauptung einer Identität, selbst wenn sie von generellen gesellschaftlichen Bewertungen abweicht, kann ein für das Individuum ausgesprochen konstruktiver Sachverhalt sein. Identitätsbehauptung wird daher auch als theoretisches Handlungsmodell beschrieben. Als Akteurmodell des normativen Paradigmas wurde der Homo sociologicus weiter oben bereits vorgestellt. Die Beantwortung der Frage, warum ein Mensch rollenkonform handelt, ist scheinbar einfach: weil er sozial integriert sein möchte. Die Schwierigkeiten des Homo sociologicus sind aber leicht aufgezeigt. Sie werden aus dem Gesichtspunkt der interpretativen Soziologie formuliert. Es sind im Wesentlichen Rollenkonflikte, die dieses Akteurmodell vor dem Hintergrund einer immer komplexer werdenden Gesellschaft fragwürdig erscheinen lassen. In immer geringerem Maße erschöpfen sich die Anforderungen, die das Leben an die Individuen richtet, im reinen Befolgen gesellschaftlicher Erwartungen. Wer jedoch Rollenerwartungen zuwiderhandelt, ist in der Gefahr, zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden. Dies betrifft selbstverständlich auch das Bewusstsein, das die betreffende Person von sich selbst hat. Daher sind Rollenkonflikte auch Identitätskonflikte. Sie zwingen die Menschen, auf ihre Rollen einzuwirken, sie nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen zu gestalten. Und da, wo ihnen dies gelingt, ist die Gefahr, zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden, gemindert. Wenn Menschen jedoch in die Situation geraten, sich gegen gesellschaftliche Anforderungen zur Wehr setzen zu müssen, nehmen sie eine Haltung ein, bei der sie Identität besitzen und sich auch für diese einsetzen müssen. Identitätsbehauptung trotz gegebenenfalls entgegenstehender externer Rollenzuschreibungen kann daher ein machtvoller Antrieb der Person sein und ist somit neben dem Modell des Homo sociologicus ein wesentliches Akteurmodell. Schimank weist darauf hin, dass die Identität des Menschen von dem Bild 146 bestimmt ist, das dieser von sich selbst entwirft. Dabei kommen evaluative und normative Selbstansprüche sowie kognitive Selbsteinschätzungen zum Tragen. Evaluative Selbsteinschätzungen sind die Vorstellungen, die die Person davon hat, „wer sie sein und wie sie leben möchte.“275 Diese Vorstellung beinhaltet zunächst eine Motivation, die Umstände des eigenen Lebens zu beeinflussen, z.B. Sport zu treiben, weil man schlank sein möchte. Es beinhaltet aber auch den Anspruch an die soziale Umwelt, die Möglichkeiten dieser Anspruchshaltung einzuräumen. Da wo dies verweigert wird, ist die Identität des Menschen bedroht. Evaluative Selbstansprüche umfassen also das „Sein-Wollen“ der Person. Die zweite Komponente sind die normativen Selbstansprüche der Person. Es sind „solche Sollensvorgaben für das eigene Handeln, deren Nichteinhaltung die betreffende Person als Scheitern des eigenen Lebens begreifen würde. Diese Selbstansprüche können auf internalisierte soziale Normen zurückgehen.“276 Diese Komponente umfasst also ein subjektiv geprägtes Konzept des „Sein-Sollens“. Kognitive Selbsteinschätzungen betreffen „die Fähigkeiten und Möglichkeiten einer Person, ihren evaluativen und normativen Selbstansprüchen gerecht zu werden, sowie ihr faktisches SoSein im Vergleich zum Sein-Wollen und Sein-Sollen.“277 Es ist also die Realitätsdimension, an der sich die Ansprüche der Person brechen. Sie führt dazu, dass die Person zum Erreichen eines seelischen Gleichgewichtes immer dazu gezwungen ist, ihre evaluativen und normativen Ansprüche zu relativieren und unter Umständen Kompromisse einzugehen. Schimank stellt fest, dass die Person zur Beschreibung ihrer Identität nicht an einem Ist-Zustand festhält, wie er für die Person momentan erfahrbar ist. Vielmehr gehen Erfahrungen der Vergangenheit und Projektionen in der Zukunft damit einher. Aber selbst dieser weite Bereich der Identitätskomponenten ist nur ein selektiv komponiertes Bild: Menschen benutzen für ihr Identitätskonzept eine Selbstsimplifikation. Nur auf diese Weise, 275 Schimank 2000, S. 123 Schimank 2000, S. 124 277 Schimank 2000, S. 125 276 147 den gesamten Umfang ihrer Persönlichkeit vernachlässigend, schaffen sie es, an einem Identitätsentwurf festhalten zu können. Dieser Identitätsentwurf bedarf der Bestätigung durch die soziale Umwelt. Es handelt sich dabei um ein Erfordernis, um das der Mensch immer wieder aufs Neue kämpfen muss: „Identitätsbehauptung ist eine Daueraufgabe des Akteurs, ein Prozess selbst dann, wenn die Identität über längere Zeit identisch reproduziert wird.“278 Wenn die soziale Umwelt das Identitätskonzept des Individuums auf Dauer nicht bestätigt, liegt eine Identitätsbedrohung vor. Schimank nennt folgende Formen der Identitätsbedrohung:279 - Spezifische substantielle Identitätsbedrohung: Diese Form der Identitätsbedrohung liegt vor, wenn einzelne Bestandteile des Selbstbildes von der sozialen Umwelt nachhaltig nicht bestätigt werden. Es handelt sich also um Teilaspekte des Identitätskonzeptes eines Menschen, die jeweils keine Bestätigung finden, andere Aspekte können hiervon gänzlich unberührt bleiben. Somit ist die Identitätsbehauptung ebenfalls nur in Teilen erforderlich. Einer umfassenden Strategie bedarf es also nicht. Diese Form der Identitätsbedrohung wurde von Goffman in „Stigma“ beschrieben. Dabei geht es immer um den Aspekt einer Andersartigkeit, die nach dem Urteil der sozialen Umwelt eine Identitätsbedrohung darstellt, die scheinbar die gesamte Persönlichkeit umfasst. Je nachdem, ob man sich dem identitätsbedrohenden Urteil der sozialen Umwelt ausliefert und versucht, eine möglichst unauffällige Pseudo-Normalität zu leben, oder ob man dazu übergeht, in offensiver Weise mit seinem Stigma zu leben, bleibt dennoch die Chance, mithilfe von StigmaManagement, die Identität im Wesentlich zu behaupten. - Indirekte Identitätsbedrohungen durch Existenzgefährdungen: Diese Erfahrung machen Menschen im Zusammenhang mit der körperlichen Hinfälligkeit von Angehörigen und Bekannten, schließlich jedoch auch im Zusammenhang mit dem eigenen körperlichen Verfall und dem Bewusstsein einer permanenten Bedrohung durch Krankheit und Tod. Krankheit, Behinderung und Tod sind Bewusstseinskategorien, die 278 279 Schimank 2000, S. 129 vgl. Schimank 2000, S. 133ff. 148 im Leben eines leistungsorientierten Gesellschaftsmitgliedes möglichst verdrängt werden. Auch in diesem Bereich gibt es ein umfassendes Stigmamanagement um die identitätsgefährdende Wirkung von Krankheit und Tod im Bewusstsein des Menschen in den Hintergrund zu drängen. So wird beispielsweise viel Zeit, Mühe und Geld darauf verwendet, Anzeichen des Alterns zu kaschieren. - Entindividualisierungserfahrungen: Diese Erfahrungen entstehen in Situationen, in denen Menschen aufgrund äußerer sozialer Umstände keine Möglichkeit haben, nach Maßgabe des eigenen Willens und der eigenen Vorstellungen zu handeln. Der Mensch erlebt die Bedrohung seiner Identität, wenn er z.B. im Gefängnis oder im Altenheim in ein System gezwungen wird, das nach externen Kriterien abläuft und keine Freiräume bietet, in denen der Mensch mit seinen spezifischen Eigenheiten und seinen spezifischen Bedürfnissen handeln und leben kann. Diese Erfahrung kann auch in engen sozialen Beziehungen wie Ehen und Familienverbänden aufkommen. Menschen, die auf diesem Wege ihrer Individualität beraubt werden, verlieren eine wesentliche Grundlage für ihre Identität, nämlich die Möglichkeit, ihr eigenes Lebenskonzept auf der Grundlage vergangener Erfahrungen und der daran gebundenen Erwartungen und Projektionen in der Zukunft zu verwirklichen. Stigmamanagement ist eine Möglichkeit, wie die Identitätsbedrohung abgewehrt, die Identitätsbehauptung gewährleistet werden kann. Schimank benennt aus diesem Bereich als relevante Praktiken die Umdefinition sozialer Nichtbestätigung der Identität sowie Wechsel und Pluralisierung der sozialen Umgebung.280 Entsprechende Verhaltensweisen zielen darauf, das diskriminierende soziale Umfeld zu meiden, in der Hoffnung, an anderer Stelle Anerkennung und Akzeptanz zu finden. Sie können auch dazu dienen, die Kognitionen, die eine Identitätsbedrohung mit sich bringen, zu meiden. In den Fällen, in denen die Existenz gefährdet ist und daraus resultierend auch die Identität, kann eine massive Verhaltens280 vgl. Schimank 2000, S. 139 149 änderung angezeigt sein. So kann es sein, dass sich todkranke Menschen plötzlich gesundheitsbewusst verhalten. In den Fällen, in denen spezifische substantielle Identitätsbedrohungen oder Entindividualisierungserfahrungen bestehen, weil das Individuum sich in bestimmten Rollenstrukturen wiederfindet, die sein subjektives Identitätskonzept untergraben, kann das Individuum versuchen, mit Rolleninszenierung, Rollendistanz und Rollendevianz seine Identität zu retten. Bei der Rolleninszenierung nutzt das Individuum bestimmte Freiräume seiner Rolle, die streng genommen nicht zu der Rolle gehören, aber auch nicht ausdrücklich untersagt sind. Dazu kann der Betriebsmitarbeiter gezählt werden, der sich im Betriebsrat engagiert und so seiner relativ begrenzten Berufsrolle ein hohes Maß an Autonomie in der Nebenrolle als Betriebsratsmitglied abtrotzt. Rollendistanz bezeichnet Schimank als „Selbstdarstellung neben der Rolle“281 Dazu zählt z.B. der Musiklehrer, der nebenberuflich als Organist wirkt und seine Berufsrolle eigentlich nur noch „nebenher“ wahrnimmt und all seine Kreativität und Leistungskraft in sein sonntägliches Organistenamt einbringt. Schließlich kann es der Identität dienen, wenn das Individuum sich gänzlich deviant in seiner Rolle verhält. Wenn die Rollenstruktur dem Individuum keine Möglichkeit lässt, mit seinen persönlichen Zügen zu leben, ohne sich permanent selbst zu verleugnen, und wenn andere Abwehrmechanismen der Identitätsbehauptung nicht mehr funktionieren, dann kann nur noch die Flucht aus der Rollenstruktur helfen. In diesem Sinne werden Menschen zu gesellschaftlichen Außenseitern, weil sie ihre Identität schützen möchten. Und dennoch: das Leben des stigmatisierten Individuums ist potentiell von tagtäglichen Diskriminierungen und Erniedrigungen geprägt. Die Bewältigung beschädigter Identität ist besonders schwierig, da „ein falscher Eindruck, den ein Einzelner in irgendeiner seiner Rollen erweckt, seinen gesamten Status, dessen Teil die Rolle ist, bedrohen kann, denn eine diskreditierende Entdeckung in einem Handlungsbereich lässt 281 Schimank 2000, S. 142 150 die zahlreichen anderen, in denen er womöglich nichts zu verbergen hat, zweifelhaft erscheinen.“282 Dieser Gedanke hat auch seinen Niederschlag in der Etikettierungstheorie gefunden: der Status, den ein Individuum aufgrund seiner öffentlichen Devianz erwirbt, überschattet alle anderen, möglicherweise gegenläufigen Charakteristika, denn man wird zuvörderst als abweichend angesehen, bevor andere Identifikationen gemacht werden. In diesem Sinne knüpfen sich an den Hauptstatus (master-status) immer irgendwelche Erwartungen, die dann handlungsleitend sind. Von einem Drogenabhängigen (Hauptstatus) wird erwartet, dass er männlich und (in den USA) schwarz, arm und ungebildet ist. Der master-status besitzt einen Haloeffekt, der alle anderen Aspekte des Individuums überstrahlt. Es gereicht dann zu einiger Irritation, wenn sich herausstellt, dass ein weißer, gebildeter, verheirateter Mittelschichtangehöriger süchtig ist. In der Folge, wenn seine Abweichung öffentlich bekannt gemacht wurde, wird er es aber schwer haben, den bisherigen privilegierten Status aufrecht zu erhalten. Jetzt ist er zum Drogenabhängigen geworden: seine bisherige bürgerliche Fassade ist unglaubwürdig geworden, seine Frau lässt sich wahrscheinlich von ihm scheiden, seine Freunde wenden sich wahrscheinlich von ihm ab, er verliert seinen Job und seine Kreditkarte usw. Als abweichend etikettiert zu sein, ist wie mit einem Mantel bedeckt zu sein, der den Hauptstatus zeigt, aber die anderen, moralisch akzeptablen Züge des Individuums bedeckt hält. So vermindert der von der sozialen Umwelt perzipierte Hauptstatus die Neigung, dem als deviant angesehenen Individuum auch abzunehmen, dass es sich im Übrigen regelkonform verhalten kann. Von Regelverletzern wird ausschließlich erwartet, dass sie Regeln verletzen. Die Tatsache, dass der Hauptstatus oft nicht mit dem Nebenstatus übereinstimmt, trägt dazu bei, dass viele Menschen ihre Devianz geheim halten können. Auf diese Weise können sie die soziale Umwelt über ihr Stigma täuschen, oder, um wieder die Theatermetaphorik zu benutzen, eine Darstellung liefern, die den eigentlichen Gegebenheiten nicht voll entspricht. Sie können auf 282 Goffman 1959, S. 60 151 diese Weise ihre soziale Identität aufpolieren und eine ScheinNormalität konstruieren, die sie vor Etikettierung und Stigmatisierung schützt. Aber da, wo der abweichende Zug der individuellen Persönlichkeit in das öffentliche Bewusstsein dringt, kann er zu dem für die Beurteilung der Person durch ihre soziale Umwelt maßgebliche Maßstab werden, mit der Folge, dass die Person generell als abweichend angesehen wird, dass die Stigmaeigenschaft als wesentliches Element ihrer Persönlichkeit anzusehen ist: „Der Besitz eines abweichenden Merkmals kann von allgemeinem symbolischen Wert sein, so dass die Leute automatisch annehmen, dass sein Träger andere unerwünschte, angeblich mit diesem Merkmal verbundene Merkmale besitzt.“283 Und wenn die als deviant bekannten Individuen der Erwartung nachkommen, wonach sie vermeintlich nur abweichendes Verhalten praktizieren können, entsteht eine „Sich-selbst-erfüllende-Prophezeiung“.284 Dadurch werden viele Menschen, die in einem bestimmten Bereich ihrer Existenz ein abweichendes Element haben, automatisch aus dem Bereich der Normalität gedrängt, so dass nur noch illegitime Gewohnheitshandlungen möglich sind. Oft sind es Stereotypisierungen und soziale Vorurteile, die das Verhalten der „normalen“ Menschen im Verhältnis zu Außenseitern prägen. Pfuhl et al. weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Stereotype zu einem „Vorurteilswissen“ werden. Dadurch, dass „normale“ Menschen in der Regel wenig Kontakt zu Drogenabhängigen, Alkoholikern, Homosexuellen, Prostituierten usw. haben, ist ihr Bild von diesen Personen im Sinne ihrer Stereotypen und Vorurteile eindimensional: „However the ‘price’ of such comfort may well be not only the brutalization/ dehumanization of the stereotyped persons, but also the creation of unnecessary fear and an ultimate limit on their own freedom.“285 Hinzu kommt, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche oft genug eng miteinander verflochten sind und die Abweichung in dem einen Bereich auf benachbarte Bereiche ausstrahlt. 283 Becker 1963, S. 29 vgl. Becker 1963, S. 30 285 Pfuhl und Henry 1993, S. 131 284 152 An dieser Stelle soll nochmals die übergeordnete Perspektive in das Blickfeld gebracht werden. Mead begründete das Problem desintegrierter Identität mit der fehlenden Integration gesellschaftlicher Erwartungen und Werte in den Strukturen der Persönlichkeit. Die Einheitlichkeit der den generalisierten Anderen repräsentierenden „me’s“ liegt nach dieser Konzeption nicht vor. Daher wird Handeln problematisch und eine einvernehmliche Verständigung über die zu spielenden Rollen unmöglich. Ich leite aus diesem Zustand desintegrierter Identität einen Ansatz für gesellschaftliches Außenseitertum in der Theorie Meads ab. Goffman beschreibt die Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität. Auch hier ist von einem Zustand der Desintegration auszugehen. Dabei sind gesellschaftliche Werte, die in der sozialen Identität repräsentiert sind, mit den tatsächlichen Zügen des Individuums nicht kompatibel. Diese Diskrepanz bewirkt die beschriebene Diskreditierbarkeit des Individuums. Gesellschaftliches Außenseitertum wird sowohl von Mead als auch von Goffman dahingehend gedeutet, dass die betroffenen Individuen nicht dazu in der Lage sind, in ihrem eigenen Selbst gesellschaftliche Werte zu integrieren und in der Folge zu reproduzieren. Dass dies aber nach Goffmans Auffassung das Ziel einer individuellen Präsentation ist, geht meines Erachtens aus folgendem Zitat hervor: „Der Einzelne wird sich also bei seiner Selbstdarstellung vor anderen darum bemühen, die offiziell anerkannten Werte der Gesellschaft zu verkörpern und zu belegen, und zwar in stärkerem Maße als in seinem sonstigen Verhalten. Insofern eine Darstellung die gemeinsamen offiziell anerkannten Werte der Gesellschaft, vor der sie dargeboten wird, betont, können wir sie (...) als eine ausdrückliche Erneuerung und Bestätigung der Werte der Gemeinschaft (betrachten).“286 Daraus leitet sich für das Individuum die Notwendigkeit ab, sich so zu verhalten, wie das Ensemble und das Publikum oder ganz allgemein: die Gesellschaft es von ihm fordern. Dazu zählen die spezifischen Erwartungen in einer Berufsrolle. Wer hier versagt, wird seine Ensemblemitgliedschaft früher oder später verlieren. 286 Goffman 1959, S. 35f. 153 Auch zählt dazu die Mitgliedschaft in einer Familie – das „schwarze Schaf“ ist der Inbegriff des Außenseiters, der den Ansprüchen und Erwartungen der Familie nicht nachkommt. Noch deutlicher wird Goffman, wenn er beschreibend eingrenzt, unter welchen ausschließlichen Bedingungen Menschen der Zuweisung einer Außenseiteridentität scheinbar entgehen können: es gibt „in einem gewichtigen Sinn nur ein vollständig ungeniertes und akzeptables männliches Wesen in Amerika: ein junger, verheirateter, weißer, städtischer, nordstaatlicher, heterosexueller, protestantischer Vater mit Collegebildung, voll beschäftigt, von gutem Aussehen, normal in Gewicht und Größe und mit Erfolgen im Sport. Jeder amerikanische Mann tendiert dahin, aus dieser Perspektive auf die Welt zu sehen.“287 In Wahrheit, so ist aus dem Resümee Goffmans abzuleiten, ist das Versagen in Bezug auf bestimmte gesellschaftliche Normen und Werte das eigentlich Normale und eines jeden „ScheinNormalität“, und damit eines jeden Identität, potentiell gefährdet. Abels weist in diesem Zusammenhang auf die doppelte Funktion der Techniken zur Bewältigung einer beschädigten Identität hin: „sie dienen der Sicherung oder Wiederherstellung der eigenen Identität, und sie schaffen für die anderen die Voraussetzungen, dass sie sich ganz normal verhalten können.“288 Diese Konzeption von Normalität ist sehr dialektisch. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Stigmaträger sich so verhalten müssen, „als ob sie eigentlich ganz normal sind, damit diejenigen, die nicht recht wissen, wie sie mit den Behinderten umgehen sollen, so tun können, als ob sie sie wie normale Menschen behandeln.“289 In der Logik der Theatermetaphorik wurde diese Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Eindruckes bereits beschrieben. Goffman sprach davon, dass es für das Individuum und das Ensemble, dem es zugehört, notwendig ist, mit Hilfe verschiedener Verteidigungsund Schutzmechanismen Störungen der Vorstellung zu vermeiden. Auch müssen allenthalben Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um diskreditierende Vorfälle auszugleichen. In 287 Goffman 1963, S. 158 Abels 1997b, S. 171 289 ebd. 288 154 diese Vollzüge ist immer auch das Publikum mit eingebunden. Es beteiligt sich in seinem eigenen Interesse an dem Stigmamanagement, da es auch teilhat an der „als-ob“-Wirklichkeit: „Es bedeutet, dass die Unfairness und die Pein, ein Stigma tragen zu müssen, ihnen (den Normalen, Anmerkung des Verfassers) niemals vorgehalten werden wird, es bedeutet, dass Normale sich nicht werden eingestehen müssen, wie begrenzt ihr Takt und ihre Toleranz sind; und es bedeutet, dass Normale relativ unberührt bleiben können von intimem Kontakt mit den Stigmatisierten, relativ unbedroht in ihrem Identitätsglauben.“290 Im Gegenzug gewähren die Normalen für die „gute Anpassung“, wie Goffman es nennt, eine Schein-Akzeptierung, deren Grenzen nur sie definieren. Sie ermöglicht es dem Individuum als Außenseiter jene ambivalente Schein-Normalität zu leben, die die Grundlage seiner problematischen Identität bildet. 290 Goffman 1963, S. 151 155 5. Identität und das Problem des „doppelten als-ob“ Meads Überzeugung war es, dass mit Hilfe symbolischer Interaktionen die für den Menschen wesentlichen Sachverhalte seiner (sozialen) Umwelt begreifbar werden. Bezogen auf die Identität des Menschen wurde festgestellt, dass sie sich als Ergebnis „praktischer Intersubjektivität“ letztlich aus Interaktions- bzw. Kommunikationsprozessen ableitet. Krappmann thematisiert die umgekehrte Perspektive und kommt zu dem Schluss, dass Kommunikation davon abhängt, dass von dem an ihr beteiligten Individuum eine Identität in den Kommunikationsprozess „eingebracht“ werden muss, das heißt, dass das interagierende und kommunizierende Individuum auf der Grundlage seiner Identität handelt: „Die vom Individuum für die Beteiligung an Kommunikation und gemeinsamem Handeln zu erbringende Leistung soll hier mit der Kategorie der Identität bezeichnet werden. Damit das Individuum mit anderen in Beziehung treten kann, muss es sich in seiner Identität präsentieren; durch sie zeigt es, wer es ist.“291 Denn die Interaktionsteilnehmer sind auf ein gewisses Maß an Widerspruchsfreiheit und Beständigkeit im Verhältnis zueinander angewiesen, und das obwohl Identität auch für Krappmann nichts Starres und Unveränderliches ist: „Identität ist nicht mit einem starren Selbstbild, das das Individuum für sich entworfen hat, zu verwechseln; vielmehr stellt sie eine immer wieder neue Verknüpfung früherer und anderer Interaktionsbeteiligungen des Individuums mit den Erwartungen und Bedürfnissen, die in der aktuellen Situation auftreten, dar.“292 Man kann also im Sinne Krappmanns sagen, dass Identität eine strukturelle Bedingung für die Teilnahme des Individuums an stets wechselnden Interaktionsprozessen ist. Identität zu besitzen und in Interaktionen zu manifestieren, kommt jedoch aufgrund der erwähnten Dynamik einem Dilemma gleich: „Wie soll sich (das Individuum, Anmerkung des Verfassers) den anderen präsentieren, wenn es einerseits auf seine verschiedenartigen Partner eingehen muss, um mit ihnen kommunizieren und handeln zu können, andererseits sich in seiner Besonderheit darzustellen hat, um als derselbe auch in verschiedenen Situationen erkennbar zu 291 292 Krappmann 1969, S. 8f. Krappmann 1969, S. 9 156 sein?“293 Krappmann bedient sich zur Veranschaulichung dieses Dilemmas der von Goffman vorgeschlagenen Konzepte der personalen und der sozialen Identität. 5.1. Die horizontale Perspektive der sozialen Identität Das Konzept der sozialen Identität im Sinne Goffmans umfasst die Erwartungen der sozialen Umwelt an das Individuum im Rahmen des Interaktionsprozesses. Diese Erwartungen orientieren sich an den Rollen, die das Individuum für seine Interaktionspartner wahrnehmbar besitzt. Die Perspektive dieses Konzeptes ist nach Krappmanns Auffassung eine „horizontale“, das heißt, dass es um die Identität des Individuums im Verhältnis zu zeitgleichen, gegenwärtigen Interaktionszusammenhängen geht. Aus dieser Perspektive steht das Individuum vor der Schwierigkeit, „eine Identität aufzubauen, die scheinbar den sozialen Erwartungen voll entspricht, aber in dem Bewusstsein, in Wahrheit die Erwartungen doch nicht erfüllen zu können.“294 Und die vordergründige Lösung dieses Problems, die trotz divergierender Erwartungen die Interaktionsbeteiligung ermöglicht, besteht sowohl für Außenseiter als auch für „Normale“ in der Annahme einer Scheinnormalität. Goffman hat davon gesprochen, dass die Annahme der Schein-Normalität ein Charakteristikum der problematischen Interaktionsstrukturen des stigmatisierten Individuums mit der sozialen Umwelt sei.295 Goffman gelangt zu der Erkenntnis, dass eigentlich jedes Gesellschaftsmitglied in bestimmter Weise gesellschaftliche Erwartungen verfehlt, dass demnach eigentlich jedes Gesellschaftsmitglied zumindest in bestimmten Bereichen seiner sozialen Identität sein Handeln unter den Bedingungen einer Schein-Normalität einrichten muss. Dies ist Krappmanns Ansatz für die Beschreibung der Problematik der sozialen Identität. Krappmann geht davon aus, dass jede Identität im Hinblick auf die Erfüllung sozialer Erwartungen überfordert ist, „weil diese prinzipiell unerfüllbar sind“. Die Gründe dafür liegen „sowohl in den bestehenden Mehrdeutigkeiten und Widersprüchlichkeiten der gerade ablaufenden Interaktion als auch in der Tatsache, dass 293 Krappmann 1969, S. 7 Krappmann 1969, S. 72 295 vgl. Goffman 1963, S. 151f. 294 157 jeder an mehreren Interaktionssystemen – gleichzusetzen mit: Rollensystemen – beteiligt ist, die ihn auf Bezugsgruppen mit zum Teil recht verschiedenen oder einander sogar ausschließenden Erwartungen verweisen.“296 „Die „phantom normalcy“297 ist also sowohl die „Lösung“ des Identitätsproblems im Hinblick auf den Besitz eines Stigmas als auch im Hinblick auf die gleichzeitig relevanten Erwartungen aus sämtlichen Interaktionssystemen, an denen ein Individuum zur Zeit beteiligt ist und die mehr verlangen, als erfüllbar ist. Krappmann begründet dies so: „Da ‚phantom normalcy‘ darin besteht, dass das Individuum durch seine ‚als-ob‘-Übernahme angesonnener Erwartungen mehr von sich ausdrückt, als die gerade aktuelle Interaktionssituation verlangt, eröffnet sie dem Individuum die Chance, in den nebeneinander stehenden Interaktionsprozessen als dasselbe aufzutreten beziehungsweise wieder erkennbar zu sein. Es stellt nämlich durch die ‚als-ob‘-Übernahme der Normen in jeder Interaktionssituation auch einen Bezug zu seinen anderen Rollen her, um auf diese Weise zu erkennen zu geben, dass es den Anforderungen dieser Situation nicht voll entsprechen kann und darf.“298 Denn eine komplette Übernahme der angesonnenen Erwartungen käme einer „Verdinglichung“ des Individuums gleich, einem Verlust seiner Individualität. Ein Individuum, das nichts anderes als eine Reifikation seiner jeweils maßgeblichen Rollenbezüge ist, ist jedoch nach Krappmanns Überzeugung für sinnvolle Interaktionen disqualifiziert, da es „seine eigene Perspektive nicht in Interaktionen einbringen kann und sich nur an den Erwartungen der anderen orientiert, fällt (es) als Partner für seine Gegenüber aus, weil es ihnen keinen neuen Blick auf ein Problem, keine Lösung für einen Konflikt, keine Bestätigung ihrer eigenen Identität, auf die sie angewiesen sind, zu bieten hat.“299 296 Krappmann 1969, S. 74 Anmerkung: Krappmann verwendet den englischen Originalbegriff für das ScheinNormalitäts-Konzept 298 Krappmann 1969, S. 74f. 299 Krappmann 1969, S. 57 (Man könnte der Ansicht sein, dass nicht unbedingt jede Interaktion eines „neuen Blickes“ bedarf. Dies trifft für Routineinteraktionen zu. Allerdings erfordert die Dynamik der gesellschaftlichen Wirklichkeit, dass sich die Interaktionspartner an wechselnde Bedingungen anpassen können und insofern schon jeweils neue, aktualisierte Gesichtspunkte in der Interaktion zum Tragen kommen.) 297 158 Somit wären auch „normale“ Menschen, jene, die den Rollenerwartungen entsprechen, in Interaktionen disqualifiziert, denn eine „wirkliche“ Normalität ist gar nicht möglich, da sich in ihr das Individuum alle Identitätsnormen voll zu eigen machen müsste – dies scheitert allein an dem Umstand, dass man niemals mit seiner Persönlichkeit vollkommen in einer Rolle aufgehen kann. Ein Individuum, das trotzdem mit all seinen großen und kleinen Abweichungen im Interaktionsgeschehen verbleibt und sich aus diesem Grunde allen möglichen gesellschaftlichen Normalitätskonzepten scheinbar angleicht, hat jedoch die Chance, im Interaktionsgeschehen als ein Mensch wahrgenommen zu werden, der auf der Grundlage seiner Identität den sozialen Prozess (mit)gestaltet. Krappmann schreibt daher über das unter der Bedingung der Schein-Normalität interagierende Individuum: „Es bewahrt eine individuelle Identität, weil es die sozialen Identitätsnormen nicht voll übernimmt, sondern nur respektiert, und zwar indem es trotz Benutzung dieser Normen, ohne die es sich als Interaktionspartner nicht etablieren kann, zu erkennen gibt, dass es doch unter sie nicht gänzlich zu subsumieren ist.“300 5.2. Die vertikale Perspektive der personalen Identität Das zweite Identitätskonzept Goffmans, die personale Identität, befasst sich mit der „vertikalen“ Dimension von Identität, das heißt Identitätsgewinnung und -erhaltung im Zeitablauf. Krappmann schreibt dazu: „Während der einzelne im Hinblick auf die verschiedenen gleichzeitigen Interaktionssysteme das Problem zu lösen hat, wie er als ein und derselbe auftreten kann, obwohl er sich in jeder Interaktion im Horizont verschiedener Erwartungen artikulieren muss, steht er im Hinblick auf die Zeitdimension vor der Frage, wie er seinen Lebenslauf als kontinuierlich zu interpretieren und darzustellen vermag, obwohl er in verschiedenen Lebensphasen auf sehr unterschiedliche Art versucht hat, die Balance einer Ich-Identität aufrechtzuerhalten. (...) ‚Personal identity‘ im Sinne Goffmans ist nicht eine freie Leistung des Individuums, sondern der Begriff bezieht sich auf eine dem Individuum zugeschriebene Biographie.“301 300 301 Krappmann 1969, S. 75 Krappmann 1969, S. 75f. 159 Die zu erbringende Leistung, das Aushalten einer Identität über die Zeitläufte hinweg, ist nach Krappmanns Ansicht nur mit Hilfe der „phantom-uniqueness“ möglich. Dieses Konzept wurde ursprünglich von Habermas vorgeschlagen: „(Wir) halten eine persönliche Identität aufrecht, indem wir gegenüber allen relevanten Bezugsgruppenmitgliedern den sozialen Abstand einer ausdrücklichen Nicht-Identität wahren und gleichwohl Anstrengungen unternehmen, diese Nicht-Identität als eine fiktive Einzigartigkeit (phantom-uniqueness) sichtbar zu machen.“302 An anderer Stelle schreibt Habermas Folgendes: „die vergesellschafteten Subjekte widersetzen sich im Maße ihrer Individuierung einem Aufgehen in Gesellschaft. Sozialisation, die Vergesellschaftung der inneren Natur, lässt sich (...) zureichend als eine Reduktion von Umweltkomplexität begreifen. (...) Mit wachsender Individuierung scheinen sich die Immunisierungen der vergesellschafteten Individuen gegen Entscheidungen des ausdifferenzierten Steuerungszentrums zu verstärken.“303 In dem Maß, in dem die vertikale Perspektive der Identität zum Tragen kommt, wird das Bedürfnis nach Distanz gegenüber den vielfältigen Rollenzumutungen stärker und damit auch die Fähigkeit zur Individualität. Für die Interaktionsfähigkeit des Individuums ist nach Krappmann die „phantom-uniqueness“ genauso notwendig wie die „phantom-normalcy“: „Wie die ‚phantom-normalcy‘ das Individuum in die Lage versetzt, in den verschiedenartigen Interaktionssystemen jeweils als ein und dasselbe aufzutreten und doch auf verschiedene Erwartungen einzugehen, so ermöglicht die ‚phantom-uniqueness‘ Einzigartigkeit und Kontinuität zu wahren und doch wandlungsfähig zu bleiben. ‚Phantomuniqueness‘ bewegt sich wie ‚phantom-normalcy‘“ auf einer ‚als-ob‘-Basis, denn das Individuum agiert, als ob es einzigartig wäre und hält doch die Gemeinsamkeit mit den Interaktionspartnern fest.“304 Die Einzigartigkeit darf jedoch nicht so weit gehen, dass sich das Individuum vollständig isoliert, denn dann wäre seine Teilhabe 302 Habermas 1973b, S. 132 Habermas 1973a, S. 26 304 Krappmann 1969, S. 77f. 303 160 an Interaktionszusammenhängen ebenfalls ausgeschlossen. Die einzige Möglichkeit, eine interaktionsfähige Identität zu erlangen, besteht in dem Aushalten der Ambivalenz von Anpassung und Absonderung. Mit Blick auf eine solche interaktionsfähige Identität und deren Präsentation schreibt Abels: „Die Strategie, eine solche Spannung zwischen Normalität und Einzigartigkeit aufrechtzuerhalten, nenne ich die doppelte Strategie des als-ob und behaupte, dass ohne sie Leben in der Gesellschaft nicht möglich ist. Tatsache ist, dass nur mit diesem doppelten als-ob soziale Sicherheit (in der Erwartung des Handelns aller anderen) und individuelle Freiheit (als Annahme, relevant zu sein und Spuren zu hinterlassen) gegeben sind. Dass mit dieser Strategie ein soziales Risiko und eine individuelle Täuschung zugleich gegeben sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Spannung zwischen Normalität und Einzigartigkeit ist nämlich eine Spannung zwischen zwei Täuschungen, die einmal die anderen und zum zweiten das Individuum selbst betreffen. Deshalb wird auch in der kritischen Interaktionstheorie von einer Balance zwischen phantom normalcy und phantom uniqueness gesprochen.“305 Für Krappmann ist das Aushalten des „doppelten als-ob“ eine „strukturelle Notwendigkeit“ des Interaktionsprozesses. Aber: „Auf beiden Dimensionen muss das Individuum balancieren, weil es, um Interaktion nicht zu gefährden, weder der einen noch der anderen Forderung, noch beiden voll nachgeben, noch sie gänzlich verweigern kann. (...) Der vom Individuum verlangte Balanceakt ist also eine Leistung, die zwei Dimensionen der Handlungsorientierung zu berücksichtigen hat: ein Ausgleich zwischen den divergierenden Erwartungen der Beteiligten muss sowohl in der gleichsam horizontalen Dimension der ‚social identity‘ und ‚phantom normalcy‘ als auch in der vertikalen Zeitdimension von ‚personal identity‘ und ‚phantom uniqueness‘ gerecht werden, wobei die Balance in jeder der Dimensionen durch die, die in der anderen eingenommen werden muss, mitbestimmt wird. Diese Balance aufrechtzuerhalten ist die Bedingung für Ich-Identität. Ich-Identität wird dem Individuum zuerkannt, das gerade unter Ausnutzung der Identitätsnormen 305 Abels 1997a, S. 13f. 161 der anderen und im Medium gemeinsamer Symbolsysteme seine besondere Individualität festhalten kann.“306 Nach Krappmanns Überzeugung ist Besitz der Ich-Identität, die zu der Balance auf der vertikalen und horizontalen Ebene befähigt, eine Voraussetzung für die Teilnahme an Interaktionen. Und wie auch bereits gezeigt wurde, birgt ein Unvermögen des Individuums, an den Interaktionen unter den Bedingungen einer balancierenden Identität teilzunehmen, die Gefahr, zum Außenseiter zu werden. Die Gründe für ein solches Unvermögen könnten darin liegen, dass das Individuum im Besitz eines Stigmas ist, das die Aufrechterhaltung der Schein-Normalität erschwert. An dieser Stelle komme ich auf die bereits in dem Abschnitt zur Sozialisationstheorie Meads angesprochenen Zusammenhänge zurück: grundlegend für alles Gesellschaftliche ist die Interaktion. Über Kommunikation, wesentlich im Medium der Sprache, werden gesellschaftliche Werte vermittelt, die durch die Hereinnahme des Standpunktes der Gesellschaft in Form des generalisierten Anderen einen wesentlichen Teil der Ich-Identität ausmachen. Der Zusammenhang zwischen Symbolen und gesellschaftlichen Erwartungen wird dann in Bezug auf die Situation gesellschaftlicher Außenseiter deutlich, denen vermutlich der Anschluss an eine bestimmte Symbolität verweigert wird (oder der sie sich nicht anschließen können). Dies könnte der Fall sein, wenn die Synthese der balancierenden Identität misslingt. Wie bereits ausgeführt, geht Krappmann davon aus, dass Ich-Identität nur dann vorliegt, wenn die beiden „als-ob“-Komponenten der Normalität respektive Einzigartigkeit ausbalanciert sind. Bezogen auf die „phantom-normalcy“ ist nochmals festzustellen, dass ein Außenseiter, will er sich an Interaktionen, so wie alle anderen, beteiligen, sich eine solche Schein-Normalität zueignen muss. Wenn ihm das misslingt, wird sich sein Außenseiterstatus festsetzen, ohne dass er eine Chance hätte, daran etwas zu ändern. Im Hinblick auf die „phantom-uniqueness“ bin ich der Meinung, dass Goffman bei der Deskription von Menschen mit beschädigter Identität auf dieses Konzept ohne Not verzichten konnte, 306 Krappmann 1969, S. 78f. 162 da sich die Menschen, die von einem Stigma betroffen sind und darunter leiden, wahrscheinlich unter allen Umständen so „normal“ wie möglich präsentieren und auf jegliche Außergewöhnlichkeit gerne verzichten. Denn die Anders- bzw. Einzigartigkeit des sozialen Außenseiters bedarf nicht mehr eines „alsob“-Faktors: sie ist ganz real! Der Interaktionsprozess kann unter der Stigma-Bedingung nur dann gelingen, wenn die wirkliche Andersartigkeit mit Hilfe der Schein-Normalität kompensiert wird. Aber kann es dann für soziale Außenseiter überhaupt eine Möglichkeit zur Ich-Identität geben, wenn diese doch nur auf der integrierenden Grundlage des „doppelten als ob“ existiert? Abels weist auf die Gefährdung der Identität hin, die darauf angewiesen ist, unter Anwendung von Scheinkonstruktionen die soziale Integration des Individuums zu gewährleisten: „Phantom normalcy und phantom uniqueness sind ein strategisches Kalkül, hinter dem aber die Gefährdung von sozialer Identität aufscheint. Und es ist nicht nur der soziale Außenseiter, der es anwenden muss, sondern dieses Kalkül wird auch von denjenigen in ihr Handeln einbezogen, die sich mitten im Zentrum der Gesellschaft wähnen. Die Balance von Nicht-Wirklichem zeigt, dass Identität zum Krisenbegriff in der Moderne geworden ist.“307 Von diesem Kalkül hat auch der französische Soziologe Bourdieu geschrieben, der den Einfluss eines sozialisatorisch erworbenen Habitus auf die Persönlichkeit des Individuums beschreibt. Dabei interpretiere ich die Schriften Bourdieus auch dahingehend, dass eine klassenspezifische Prägung ein Individuum zum Außenseiter machen kann, wenn es seine, von seiner Herkunft determinierte Klassenzugehörigkeit hinter sich lassen möchte. Obwohl Bourdieu sich nicht auf Goffman bezieht, erkenne ich in den Identitätskonflikten des Kleinbürgers jene Desintegration der Identitätskomponenten, die ich als konstitutiv für eine bestimmte Form gesellschaftlichen Außenseitertums ansehe. Es handelt sich dabei nicht um die Stigmaproblematik, sondern um das Problem, mit dem ein Individuum umzugehen hat, das eine bestimmte (privilegiertere) Gruppenzugehörigkeit 307 Abels 1997a, S. 14f. 163 anstrebt, dem es jedoch des Besitzes eines dafür erforderlichen sozialen Merkmales gebricht, oder in der Logik des oben erwähnten Kalküls gefasst: das Identitätsproblem eines Individuums, das nach symbolischer Manifestation seiner Besonderheit (Distinktion) und damit nach phantom-uniqueness strebt, dem jedoch die sozialen und materiellen Bedingungen seines Lebens solche Distinktionsgewinne verwehren. 164 6. Die Antinomie der Paradigmen Die bisherigen Ausführungen reflektieren eine theoretische Antinomie, die sich auf zwei unterschiedliche soziologische Erklärungsparadigmen bezieht, dem normativem Paradigma, das im Wesentlichen eine Determination der Identität postuliert, und dem interpretativen Paradigma, demzufolge Identität sozial konstruiert ist. Diesen Gegensatz findet man auch in den französischen Sozialwissenschaften. Die dort entstandene intellektuelle Strömung des Strukturalismus leitet sich letztlich aus dem Werk Durkheims ab, der von „Sozialen Tatsachen“ im Sinne sozialer Regelmäßigkeiten sprach, die derart einen Objektivitätscharakter annehmen, als seien sie vergleichbar mit anderen objektiv erfahrbaren Gegenständen und Sachverhalten, die die Lebenswelt des Menschen prägen, aber nicht in dem Sinne, dass sie von ontologisch gleicher Natur wie physikalische Objekte seien; das Soziale ist für Durkheim eine eigene Realität, die jedoch eine systematische Beobachtung ihrer Seinsweise außerhalb der Individuen ermöglicht. Darauf aufbauend hat der Strukturalismus die methodische Erfassung und Analyse jener Strukturzusammenhänge, „die, ohne dass es den Subjekten bewusst wäre, den verschiedenen gesellschaftlichen (und psychischen) Phänomenbereichen wie Sprache, Verwandtschaftsbeziehungen, Ökonomie, Mythen, Kunst, psychischen Kognitionen unter anderem konstitutiv zugrunde liegen“308 zum Gegenstand. Der französische Strukturalismus kann so unter die objektivistische Erkenntnisweise subsumiert werden, da er die Prävalenz sozialer Tatsachen, ihren Zwangscharakter im Verhältnis zu den Handlungsorientierungen und ihre Unabhängigkeit vom Willen der Individuen thematisiert. Auf der anderen Seite steht vor allem die Existenzphilosophie, deren einflussreichster Vertreter Jean-Paul Sartre war, die die Fähigkeit des Menschen hervorhebt, sich selbst „zu machen“, und somit die absolute Emanzipation des Menschen von allen möglichen Einflüssen behauptet. Bourdieus Ansatz ist die Kritik beider Extrempositionen. Seine theoretische Arbeit findet ihren Standort zwischen dem wissenschaftlichen Objektivismus und 308 Schwingel 1995, S. 29 165 der intellektuellen Strömung, die den Menschen als Subjekt in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt. Bourdieu fasst diese intellektuelle Problemlage folgendermaßen zusammen: „Es ist nicht leicht, sich die Wirkungen des Werks von Claude Lévi-Strauss (als Vertreter des Strukturalismus, Anmerkung des Verfassers) auf das intellektuelle Feld Frankreichs (...) zu vergegenwärtigen, durch die einer ganzen Generation eine neue Auffassung der Geistestätigkeit aufgedrängt wurde, die in durchaus dialektischem Gegensatz zur Gestalt des ‚totalen‘ (...) Intellektuellen trat, wie sie Jean-Paul Sartre verkörperte.“309 Bourdieu kommt zu folgendem Schluss: „Von allen Gegensätzen, die die Sozialwissenschaften künstlich spalten, ist der grundlegendste und verderblichste der zwischen Subjektivismus und Objektivismus.“310 Denn beide Positionen erscheinen ihm für eine „Wissenschaft der Sozialwelt gleichermaßen unentbehrlich.“311 Eine Privilegierung dieser Position zu Lasten jener bringt stets einen Verlust an Erkenntnis mit sich. Die ausschließlich subjektivistisch-interaktionistische Sicht und Methode birgt das Risiko, dass gewisse, durchaus handlungsleitende Hintergründe der Interaktion in ihrer Bedeutung verkannt werden, nämlich dann, wenn das, was die Individuen tun, einen (zusätzlichen) Sinn hat, der sich ihrer kognitiven Erkenntnisfähigkeit vorderhand entzieht. Auf diese Weise „ragen die gesellschaftlichen Beziehungen über die physischen Personen als deren ‚Träger‘ in die Interaktion hinein und prägen sie nachhaltig. Wechselseitige Anpassungen erfolgen dabei nicht (allein) über bewusstes Hineinversetzen in den anderen, sondern vollziehen sich zu einem erheblichen Teil präreflexiv ohne ausdrückliche Abstimmung.“312 Außerdem bewirkt eine allzu unkritische Reproduktion subjektiver Primärerfahrungen, wie sie dem soziologischen Subjektivismus unterstellt wird, dass sich die solcherart gewonnen Aussagen auf vorwissenschaftliche Erkenntnisse und Sachverhalte stützen. 309 Bourdieu 1980, S. 8 vgl. Bourdieu 1980, S. 49 311 ebd. 312 Wittpoth 1994, S. 86 310 166 Umgekehrt gibt es auch subjektivistische Einsichten, die bei allem Ringen um objektivierbare Qualität der Aussagen dennoch ihre Berechtigung haben, nämlich die Erkenntnis des Subjektivismus, wonach die Primärerfahrungen sozialer Akteure konstitutiver Bestandteil der sozialen Welt sind. Indem objektivistische Wissenschaft Primärerfahrungen der Subjekte in ihrer Bedeutung verkennt, sie als redundant abtut und es unterlässt, sie methodisch zu erfassen, unterstellt sie einen Primat ausschließlich wissenschaftlich erfassbarer objektiver Sachverhalte und droht so eine unüberwindliche Barriere zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und so genannter Alltagserkenntnis aufzubauen: „Bourdieus Auffassung zufolge sind nun die vom Objektivismus tendenziell ignorierten sozialen Akteure mit ihren praktischen Erfahrungen und Alltagserkenntnissen konstitutiver Bestandteil der sozialen Welt und müssen in dieser Eigenschaft von der soziologischen Analyse, neben den objektiven Strukturfaktoren, berücksichtigt werden.“313 In Ergänzung dieser Gedanken liest man bei Wittpoth Folgendes: „Bourdieu will diesen ‚naiven Subjektivismus‘ überwinden, ohne einem ‚mechanistischen Objektivismus‘ zu verfallen.“314 Das Vorgehen besteht in dem Bruch mit dem reinen und keuschen Objektivismus durch die Integration subjektiver Erkenntnisleistungen in das Forschungskonzept. Dies geschieht methodisch durch eine besondere Bezugnahme auf die Handlungspraxis der Individuen: „Die Theorie der Praxis als Praxis erinnert gegen den positivistischen Materialismus daran, dass Objekte der Erkenntnis konstruiert und nicht passiv registriert werden, und gegen den intellektualistischen Idealismus, dass diese Konstruktion auf dem System von strukturierten und strukturierenden Dispositionen beruht, das in der Praxis gebildet wird und stets auf praktische Funktionen ausgerichtet ist. (...) Dazu braucht man sich nur in die ‚wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche‘, also in das praktische Verhältnis zu Welt hineinzuversetzen, in jene beschäftigte und geschäftige Gegenwärtigkeit auf der Welt, durch welche die Welt ihre Gegenwärtigkeit mit ihren Dringlichkeiten aufzwingt, mit den Dingen, die gesagt oder getan werden müssen, die dazu da sind, 313 314 Schwingel 1995, S. 43 Wittpoth 1994, S. 87 167 gesagt oder getan zu werden, und die die Worte und Gebärden unmittelbar beherrschen, ohne sich jemals wie ein Schauspiel zu entfalten.“315 Von zentraler Bedeutung im Werk Bourdieus ist das Habituskonzept. Der Habitus ist ein „Dispositionssystem sozialer Akteure“316 und insofern eine strukturelle Vorgabe, die gleichsam objektiv und unabdingbar die Lebenswelt der Individuen beeinflusst. Da dieses theoretische Konzept auf die alltägliche Praxis der Individuen Bezug nimmt, handelt es sich auch um eine subjektorientierte Methode. Somit ist das Habituskonzept ein Beispiel dafür, wie sich Bourdieus Werk der Antinomie der subjektivistischen gegen die objektivistische Position enthebt. 6.1. Der Habitus als Identitätskonzept Bourdieu hat sich nicht mit der Ontogenese des Individuums beschäftigt. Es findet sich in seinen Arbeiten kein evolutionäres Entwicklungsmodell wie bei Erikson oder Mead. Gleichwohl nimmt er Bezug auf jene sozialisationstheoretischen Erkenntnisse, die in den Sozialwissenschaften etabliert sind, und integriert sie in sein „praxistheoretisches“ Sozialisationsmodell: „Familie und Schule fungieren als Orte, an denen sich durch die bloße Verwendung die für einen bestimmten Zeitpunkt als nötig erachteten Kompetenzen herausbilden; zugleich und untrennbar damit verbunden als Orte, an denen sich der Preis dieser Kompetenzen ausbildet. Das heißt, sie fungieren als Märkte, die kraft positiver wie negativer Sanktionen die Leistung kontrollieren - die verstärken, was ‚annehmbar‘ ist, entmutigen, was dem widerspricht, die entwertete Fähigkeiten zum Verschwinden zwingen.“317 Über die Sozialisation in der Familie und der Schule, vor dem Hintergrund bestimmter sozialer und materieller Bedingungen, erfolgt die Internalisierung der Dispositionen, die die sozial erfahrbare Identität des Menschen, seinen Habitus ausmachen: „Die Konditionierungen, die mit einer bestimmten Klasse von Existenzbedingungen verknüpft sind, erzeugen die Habitusformen als Systeme dauerhafter und übertragbarer Disposi315 Bourdieu 1980, S. 97 vgl. Schwingel 1995, S. 53 317 Bourdieu 1979, S. 150f. 316 168 tionen, als strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren.“318 Nach der Habitustheorie werden also die für einen Habitus maßgeblichen Dispositionen erworben, indem im Rahmen der primären Sozialisation eine Internalisierung der objektiv vorhandenen Strukturbedingungen der Lebenswelt des Individuums einsetzt. So erfolgt über den Sozialisationsprozess die Rückwirkung äußerer Lebensbedingungen auf den Habitus: es werden Lebensinhalte verwirklicht, die die soziale Existenz des Menschen bilden. Diese Lebensinhalte beziehen sich auf das, was in der maßgeblichen Lebenslage und sozialen Stellung nahe liegt und sinnvollerweise praktiziert wird. Die sozialen Praktiken, die den Habitus des Individuums prägen, sind vorgegeben und erscheinen obligatorisch. Dies gilt umso mehr, als bestimmte Praktiken über den Sozialisationsprozess verinnerlicht werden. Dabei geraten zumeist Verhaltensalternativen zu den verinnerlichten Praxisformen aus dem Blickfeld. Um diesen Sachverhalt eingehender zu explizieren, verweise ich auf die Ausführungen von Berger und Luckmann, die sich mit der Genese gesellschaftlicher Institutionen befassen. Die Bildung von Institutionen kann demnach als gesellschaftliche Determination der von den Gesellschaftsmitgliedern anzuwendenen Praktiken verstanden werden. Am Anfang steht bei Berger und Luckmann (in einer hypothetischen Konstruktion, in der zwei Individuen von Grund auf ein Zusammenleben in einer ansonsten kulturell völlig unbeeinflussten Umwelt bewerkstelligen müssen) die Entdeckung, dass bestimmte Handlungsvollzüge, wenn sie einem wiederkehrenden Modus folgen, zu einer Entlastung aufgrund von Gewohnheit und Übung führen können. Berger und Luckmann sehen darin Habitualisierungen: „Wenn habitualisierte Handlungen Institutionen begründen, so sind die entsprechenden Typisierungen Allgemeingut. Sie sind für alle Mitglieder der jeweiligen Gruppe erreichbar. Die Institution ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und individuellen Akten Typen.“319 Auf der Ebene einer basalen soziologischen Analyse beschreiben Berger und Luckmann den Prozess der Entstehung von Institutionen in der 318 319 Bourdieu 1980, S. 98 Berger und Luckmann 1966, S. 58 169 Folge von bereits gefestigten habituell generierten Handlungsfolgen, die sozusagen in zweiter Generation praktiziert werden: „Die gemeinsamen Habitualisierungen und Typisierungen von A und B, die bislang (in der ersten Generation, Anmerkung des Verfassers) noch den Charakter von ad-hoc-Konzeptionen zweier Individuen hatten, sind von nun an historische Institutionen. Durch die erreichte Historizität ergibt sich - oder genauer gesagt: vollendet sich - noch eine andere entscheidende Qualität, welche von Anfang an da war, seit A und B mit der reziproken Typisierung ihres Verhaltens begonnen hatten: Objektivität. Die Institutionen nämlich, welche sich nun herauskristallisiert haben, die die ersten Kinder bereits vorfinden, werden als über und jenseits der Personen, welche sie ‚zufällig‘ im Augenblick verkörpern, daseiend erlebt. Mit anderen Worten: Institutionen sind nun etwas, das seine eigene Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres Faktum gegenübersteht.“320 Die Bedeutung und Wirkung der so generierten Institutionen ergibt sich aus ihrer scheinbaren Objektivität, die nur deshalb von den Gesellschaftsmitgliedern so empfunden und grundsätzlich unhinterfragt hingenommen und in der Handlungsplanung implementiert wird, weil bestimmte habitualisierte Verhaltensweisen eine Tradition gewonnen haben und die adhoc-Zielsetzung ihrer Entstehungsweise nicht unmittelbar aus dem aktuellen Handlungskontext zu erschließen ist. Im Gegenteil: die Kausalitäten der alltäglichen Handlungsfolgen sind zumeist unbewusst. So wird dies auch von Bourdieu gesehen: Die Objektivität der Erzeugungsprinzipien der gesellschaftlichen Praxis wird von ihm unter Rückgriff auf „das Unbewusste“ im menschlichen Verhalten erklärt. Es bedeutet die Verinnerlichung der Standpunkte der vom Individuum vorgefundenen, selbstverständlich vorgegebenen, „natürlichen“, sozialen Welt dergestalt, dass der daraus resultierende Habitus „die Übereinstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen (gewährleistet).“321 320 321 Berger und Luckmann 1966, S. 62 Bourdieu 1980, S. 101 170 Denn: „Das ‚Unbewusste‘ ist in Wirklichkeit nämlich immer nur das Vergessen der Geschichte, von der Geschichte selber erzeugt, indem sie die objektiven Strukturen realisiert, die sie in den Habitusformen herausbildet, diesen Scheinformen der Selbstverständlichkeit. Als einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche vergessene Geschichte ist der Habitus wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die ihn erzeugt hat.“322 Das Bourdieusche Habituskonzept beinhaltet daher das Konzept der personalen Identität, insoweit der Habitus im Hinblick auf seine Dispositionen ausdrücklich Bezug auf den Einfluss von Biographie und Lebensgeschichte des Individuums nimmt. Dabei geht es um die Anteile der Identität des Individuums, die aus der Vergangenheit wirkend das Handeln sowohl in unbewusster als auch dem Bewusstsein zugänglicher Weise determinieren. Die sehr individuellen Erfahrungen eines Individuums werden von Bourdieu als maßgeblich angesehen in Bezug auf all das, was das Individuum, abgesehen von seinen sozialen Rollenbezügen, prägt und beeinflusst, denn der Habitus garantiert „die aktive Präsenz früherer Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata niederschlagen.“323 Die „personale Identität“ geht daher als biographische Dimension in den Habitus ein, als ein Element dessen, was aktuell in einer vis-à-vis-Situation den Interaktionsprozess beeinflusst, ein Konstrukt von Erfahrungen, sozialen Kategorisierungen und sozialisatorischen Effekten, die seit der frühesten Kindheit die Existenzbedingungen des Individuums prägen und beeinflussen, das heißt die Grenzen seines Handelns, Denkens und Wahrnehmens definieren. Die dahinter stehenden ökonomischen und kulturellen Ressourcen sind maßgeblich für diese Grenzziehungen, auch insoweit, als unter ihrem Vorbehalt alle weiteren Erfahrungen und Einflüsse stehen. Mit Blick auf die soziale Identität ist festzustellen, dass der Habitus alle äußeren intelligiblen Eigenschaften und Verhältnisse des Individuums – bis hin zu seiner leibgebundenen Erscheinung – erfasst. Bourdieu operationalisiert die soziale 322 323 Bourdieu 1980, S. 105 Bourdieu 1980, S. 101 171 Identität inhaltlich und methodisch auf der Grundlage des praktizierten Lebensstils. Denn der Habitus ist strukturierende Struktur, die entsteht, 1. indem die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse (und damit der Einfluss der je spezifischen Rollenbezüge) den Lebensstil in seiner Ausgestaltung determiniert und 2. indem ein Lebensstil wiederum die Klassenzugehörigkeit beeinflussen kann. ad 1. Die spezifische Art der Sozialisiertheit des Menschen in Abhängigkeit zu seiner Positionierung im, von Bourdieu so genannten, sozialen Feld drückt sich in seinem Habitus aus. Bei Bourdieu heißt es dazu: „Zu einer intelligiblen wird die Beziehung zwischen den relevanten Merkmalen der sozioökonomischen Lage (Umfang und Struktur des Kapitals jeweils in synchronischer wie diachronischer Dimension) und den mit der entsprechenden Position im Raum der Lebensstile verbundenen Unterscheidungsmerkmalen allein durch die Konstruktion des Habitus im Sinne einer Erzeugungsformel, mit der sich zugleich die klassifizierbaren Formen der Praxis und Produkte wie die diese Formen und Produkte zu einem System distinktiver Zeichen konstituierenden Urteile und Bewertungen erklären lassen.“324 Und weiter: „In den Dispositionen des Habitus ist somit die gesamte Struktur des Systems der Existenzbedingungen angelegt, so wie diese sich in der Erfahrung einer besonderen sozialen Lage mit einer bestimmten Position innerhalb dieser Struktur niederschlägt. Die fundamentalen Gegensatzpaare der Struktur der Existenzbedingungen (oben / unten, reich / arm, etc.) setzen sich tendenziell als grundlegende Strukturierungsprinzipien der Praxisformen wie deren Wahrnehmung durch.“325 Die Zuweisung einer sozialen Identität erfolgt auf der Grundlage des Lebensstils, d. h. die soziale Identität eines Menschen reflektiert nicht zuletzt seine Position im hierarchisch strukturierten System der Klassengesellschaft. Soziale Identität steht daher für 324 325 Bourdieu 1979, S. 278 Bourdieu 1979, S. 279 172 Bourdieu immer in Konvergenz zu den äußeren Lebensbedingungen: „Die Lebensstile bilden also systematische Produkte des Habitus, die in ihren Wechselbeziehungen entsprechend den Schemata des Habitus wahrgenommen, Systeme gesellschaftlich qualifizierter Merkmale konstituieren. Grundlage jenes alchemistischen Prozesses, worin die Verteilungsstruktur des Kapitals, Bilanz eines Kräfteverhältnisses, in ein System wahrgenommener Differenzen, distinktiver Eigenschaften, anders gesagt, in die Verteilungsstruktur des in seiner objektiven Wahrheit verkannten symbolischen und legitimen Kapitals verwandelt wird, ist die Dialektik von sozialer Lage und Habitus.“326 Und präzisierend: „Eine jede soziale Lage ist mithin bestimmt durch die Gesamtheit dessen, was sie nicht ist, insbesondere jedoch durch das ihr Gegensätzliche: soziale Identität gewinnt Kontur und bestätigt sich in der Differenz. In den Dispositionen des Habitus ist somit die gesamte Struktur des Systems der Existenzbedingungen angelegt, so wie diese sich in der Erfahrung einer besonderen sozialen Lage mit einer bestimmten Position innerhalb dieser Struktur niederschlägt.“327 Diese durch die Lebensstile verursachten und beobachtbaren Differentiale werden von Bourdieu methodisch erfasst und thematisiert. Bourdieu behauptet, dass die Klassenzugehörigkeit über den Habitus derart auf die Identität des Individuums einwirkt, dass man grundsätzlich einem Menschen seine soziale Position aufgrund seiner körperlichen Erscheinung ansieht: „Die gesellschaftliche Vorstellung des eigenen Körpers, die bei jedem Individuum von Anbeginn in dessen sich entwickelndes subjektives Bild vom je eigenen Körper und der je eigenen körperlichen Hexis konstitutiv eingeht, wird demzufolge durch die Anwendung eines sozialen Klassifikationssystems erreicht, dessen Prinzip sich in nichts von dem der gesellschaftlichen Produkte unterscheidet, auf die es angewendet wird. So wären Wert und Geltung eines Körpers zweifellos jeweilig genau proportional zur Stellung seines Besitzers innerhalb der Verteilungsstruktur der übrigen Grundeigenschaften, würde die gegenüber der Logik sozialer Vererbung autonome Logik der biologischen Vererbung nicht dann und wann einigen der 326 327 Bourdieu 1979, S. 281 Bourdieu 1979, S. 279 173 hinsichtlich aller anderen Aspekte Mittellosen mit den selteneren körperlichen Eigenschaften wie etwa Schönheit ausstatten (die in derartigen Fällen dann häufig auch – weil hierarchiebedrohend – als ‚fatal‘ apostrophiert wird), und wären umgekehrt den ‚Großen‘ durch biologische ‚Unfälle‘ nicht manchmal die körperlichen Attribute ihrer Stellung wie Hochwüchsigkeit und Schönheit versagt.“328 ad 2. Diesbezüglich findet sich im Werk Bourdieus eine völlige Analogie zu dem Konzept der „Fassade“ und deren Funktion, wie es bereits im Zusammenhang mit den Erörterungen zu Goffman diskutiert wurde. Eine bedeutsame Fundstelle erlaube ich mir ungekürzt wiederzugeben: „Die gesellschaftlichen Bestimmungen sind Legion, mit denen die Beziehungen zwischen Sein und Schein geregelt werden sollen - angefangen mit den einschlägigen Vorschriften über das legale Tragen von Uniformen und Auszeichnungen, das widerrechtliche Führen von Titeln bis hin zu den milderen Formen von Sanktionierung, deren Ziel es ist, jene an die Realität und damit an Grenzen zu erinnern, die damit, dass sie sich mit äußeren, in mehr oder minder krassem Missverhältnis zu ihren eigenen sozialen und materiellen Verhältnissen stehenden Insignien des Reichtums behängen, demonstrieren, dass sie sich als ‚etwas anderes‘ dünken, als sie in Wirklichkeit sind - nämlich ehrgeizige Prätendenten, die durch ihr Gehabe, ihre Mimik, ihre generelle ‚Selbstdarstellung‘ verraten, dass ihr Selbstbild, das sie auch den anderen vermitteln möchten, erheblich abweicht vom Bild der anderen von ihnen und sie denn auch, wollten sie sich an ihm orientieren, unweigerlich ‚zurückstecken‘ müssten. Damit ist keineswegs gesagt, dass derartige Strategien der Anmaßung vorab zum Scheitern verurteilt wären. Da der zuverlässigste Beweis von Legitimität im sicheren Auftreten liegt, das, wie es so schön heißt, ‚Eindruck schindet‘, bildet der (...) gelungene Bluff eines der wenigen Mittel, den Zwängen einer bestimmten sozialen Lage im Spiel mit der relativen Autonomie des Symbolischen zu entkommen, um derart eine normalerweise mit 328 Bourdieu 1979, S. 311 174 einer höheren sozialen Lage assoziierte Selbst-Darstellung den anderen nicht nur aufzudrängen, sondern ihr auch deren Zustimmung und Anerkennung zu sichern, welche sie allererst zu einer objektiven und legitimen machen. Zwar sollte man sich hüten, sich blind dem – typisch kleinbürgerlichen – idealistischen Interaktionismus zu verschreiben, der die (soziale) Welt als Wille und Vorstellung begreift, doch wäre es absurd, wollte man aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit die Vorstellung eskamotieren, die sich die Akteure von ihr machen: In der Tat ist in den Kämpfen, die die Akteure untereinander um die Repräsentation ihrer sozialen Position innerhalb der Sozialwelt und damit um diese Welt austragen, immer auch partiell die Wirklichkeit der Sozialwelt mit im Spiel.“329 An dieser Stelle durchbricht Bourdieu also den Determinismus, der seine bisherigen theoretischen Ansichten geprägt hat, und benutzt zur Ergänzung seiner Theorie eine interaktionistische Sicht, wie sie in dem Werk Goffmans formuliert ist. Diese bezeichnet er als „Berkeleysches Weltbild“330; auf die Implikationen seiner diesbezüglichen Ausführungen werde ich weiter unten eingehen. Trotz dieses Zugeständnisses an die Soziologie Goffmans bleibt festzustellen, dass Bourdieu den von ihm so bezeichneten „idealistischen Interaktionismus“ kritisch sieht. Entsprechend geht das Habituskonzept grundsätzlich nicht von Individuen aus, die, subjekttheoretisch, nach der Maßgabe selbst gewählter Handlungsentwürfe ihr Leben gestalten; es steht vielmehr das gesellschaftlich präformierte Individuum im Vordergrund dieses Konzeptes: „Damit steht die Habitustheorie in Opposition zu voluntaristischen Handlungstheorien, die das Prinzip des Handelns in den ‚freien‘ Entscheidungen der Akteure suchen; sie stellt statt dessen den Sachverhalt ins Zentrum, dass jeder Akteur gesellschaftlich prädeterminiert ist, und zwar dergestalt, dass diese Prädetermination als bestimmender Faktor in seine gegenwärtigen und zukünftigen Handlungen einfließt.“331 Allerdings gesteht Bourdieu den handelnden Subjekten zu, dass sie hier und da die Determination umgehen können. So kann es ihnen gelingen, eine Fassade aufzubauen 329 Bourdieu 1979, S. 392ff. Bourdieu 1979, S. 395 331 Schwingel 1995, S. 55 330 175 und aufrecht zu erhalten, die nicht mit den objektiv vorhandenen Strukturvorgaben der sozialen Umwelt im Einklang steht, die aber aufgrund der erfolgreichen Darbietung geglaubt wird. Das System dauerhafter Dispositionen ist das Ergebnis der Sozialisation und entsteht, indem die als objektiv empfundenen Strukturen der Lebenswelt von den Individuen internalisiert werden. Die Internalisierung der Dispositionen des Habitus hat für die handelnden Individuen den Vorteil, dass die Mehrzahl ihrer Handlungen gleichsam automatisch verlaufen können, was aus dem Gesichtspunkt der Handlungsökonomie von Vorteil sein kann. Dadurch werden im alltagspraktischen Handeln Reflexionen über Sinn oder Unsinn einer bestimmten Praxis des Handelns gar nicht erst erforderlich, „da der Habitus als handlungsgenerierende Instanz gewöhnlich all das hinreichend leistet, was für die Praxis notwendig ist.“332 Vogt hat ebenfalls eine Beziehung zwischen Identität und Kapital erkannt.333 Nach Vogts Auffassung ist der Besitz oder Nicht-Besitz von Kapital eine „strukturelle Rahmenbedingung von Identitätsbildungsprozessen“.334 Die Autorin beschreibt jedoch nur die Art und Weise, wie der Besitz oder Nicht-Besitz von Kapital Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten in strukturierender Weise beeinflusst. Auf die Bedeutung des Habitus, mithin des biographischen Hintergrundes der Person, der in aktuellen Interaktions- und Kommunikationssituationen durchaus eine Bedeutung haben kann, geht die Autorin nicht ein. Insofern ist die eigentliche identitätstheoretische Dimension der Theorien Bourdieus von der Autorin nicht gesehen worden. Die Unbewusstheit des Verhaltens ergibt sich, wenn Handlungsabläufe derart automatisiert sind, dass ihre eigentlichen Inhalte eine bestimmte Bewusstseinsschwelle nicht mehr transzendieren. Denn wir Menschen sind „in Dreiviertel unserer Handlungen Automaten.“335 Es handelt sich um emergente 332 Schwingel 1993, S. 46 vgl: Vogt 2000, S. 77 ff. 334 Vogt 2000, S. 77 335 Bourdieu 1979, S. 740 333 176 Sinnhorizonte, die übersehen werden, wenn man z.B. in einer glücklichen Partnerwahl die Elemente eines unbewussten Meidungsverhaltens übersieht, das bei der Partnersuche dem Habitus Fremdes und Unbekanntes ausschließt. In diesem Zusammenhang schreibt Bourdieu Folgendes: „als Erzeugnis einer bestimmten Klasse objektiver Regelmäßigkeiten sucht der Habitus die ‚vernünftigen‘ Verhaltensweisen des ‚Alltagsverstands‘ zu erzeugen, und nur diese, die in den Grenzen dieser Regelmäßigkeiten möglich sind und alle Aussicht auf Belohnung haben, weil sie objektiv der Logik angepasst sind, die für ein bestimmtes Feld typisch ist, dessen objektive Zukunft sie vorwegnehmen.“336 Und an anderer Stelle schreibt er: „Der Habitus, der mit den Strukturen aus früheren Erfahrungen jederzeit neue Erfahrungen strukturieren kann, die diese alten Strukturen in den Grenzen ihres Selektionsvermögens beeinflussen, sorgt für eine einheitliche, von den Ersterfahrungen dominierte Aufnahme von Erfahrungen, die Miglieder derselben Klasse statistisch miteinander gemein haben. Das besondere Gewicht der ursprünglichen Erfahrungen ergibt sich nämlich im Wesentlichen daraus, dass der Habitus seine eigene Konstantheit und seine eigene Abwehr von Veränderungen über die Auswahl zu gewährleisten sucht, die er unter neuen Informationen trifft, indem er z.B. Informationen, die die akkumulierte Information in Frage stellen können, verwirft, wenn er zufällig auf sie stößt oder ihnen nicht ausweichen kann, und vor allem jedes Konfrontiertwerden mit derlei Informationen hintertreibt.“337 Es erfolgt dabei automatisch eine „Sofortunterwerfung unter die Ordnung, die aus der Not gern eine Tugend macht“ und diese Haltungen beruhen auf „Vorwegnahmen des Habitus als eine Art praktischer Hypothesen, die auf früherer Erfahrung fußen.“ Dadurch gewährleistet der Habitus „die aktive Präsenz früherer Erfahrungen. Das System der Dispositionen als Vergangenheit, die im Gegenwärtigen überdauert und sich in die Zukunft fortzupflanzen trachtet, indem sie sich in den nach ihren eigenen Prinzipien strukturierten Praktiken aktualisiert, als inneres Gesetz.“338 336 Bourdieu 1980, S. 104 Bourdieu 1980, S. 113f. 338 Bourdieu 1980, S. 100ff. 337 177 Ohne auf das Konzept der personalen Identität einzugehen, verweist Bourdieu bei seinen Annahmen auf den Einfluss der Lebensgeschichte auf die Identität des Individuums. Die personale Identität ist von dem Bewusstsein unzugänglichen Motivationen, die aus der Vergangenheit heraus Einfluss auf die Persönlichkeit des Menschen und seine Identität nehmen können, geprägt. Wenn diese Impulse im Widerspruch zu den gegenwärtigen Konzepten der sozialen Identität stehen, wenn die Identität des Menschen desintegriert ist, ist eine subjektive Situation gegeben, die den Menschen zum Außenseiter machen kann. Ganz in diesem Sinne beschreibt Bourdieu die Nachwirkung einer inneren Verhaltensdisposition, die eigentlich in aktuellen Handlungskontexten an praxisrelevanter Wirkung verloren hat. Er bezeichnet diese Desintegration als „Hysteresis-Effekt“: „Die vom Habitus in dieser Art umgekehrter Vorwegnahme der Zukunft bewirkte Gegenwart der Vergangenheit ist nie besser erkennbar, als wenn der Sinn der wahrscheinlichen Zukunft plötzlich Lügen gestraft wird und Dispositionen, die infolge eines Effektes der Hysteresis (...) schlecht an die objektiven Möglichkeiten angepasst sind, bestraft werden, weil das Milieu, auf das sie real treffen, zu weit von dem entfernt ist, zu dem sie objektiv passen.“339 Soziale Laufbahnen, in denen sich der Habitus niederschlägt, können aufgrund der Hysteresis der vom Habitus beeinflussten Einstellungen und Praxisformen eine krisenhafte Entwicklung annehmen, wenn das unmittelbare Angepasstsein der subjektiven an die objektiven Strukturen aufbricht, praktisch die Evidenzen zerstört und darin einen Teil dessen in Frage stellt, was ungeprüft hingenommen worden war. Hier ist die Desintegration der bestehenden Identität des Individuums erkennbar: die krisenhafte Entwicklung setzt dann ein, das Individuum wird potentiell zum Außenseiter, wenn die internalisierten Elemente seines Habitus nicht mehr mit den äußeren Bedingungen seiner Existenz im sozialen Feld in Übereinstimmung gebracht werden können. Dies geschieht zuvörderst dann, wenn konkurrierende Lebensentwürfe einen Bruch mit bisherigen Konzeptionen 339 Bourdieu 1980, S. 116 178 erzwingen, insbesondere mit der bisher maßgeblichen Wertorientierung. Durchaus im Einklang mit meiner bisherigen Argumentation behaupte ich daher, dass im Hinblick auf das Außenseiterkonzept in der Logik der Habitustheorie festgestellt werden kann, dass, vergleichbar mit der Desintegration des Selbst, Menschen zu Außenseitern werden können, wenn die Konsistenz der Dispositionen, und zwar im Hinblick auf die biographisch-lebenshistorisch geprägten Identitätsanteile und der (aktuellen) sozialen Identität, die den Habitus einer Personen definieren, aufgehoben ist. In einem theoretischen Idealzustand besteht eine homogene Beziehung zwischen den objektiven und realisierbaren Perspektiven des Individuums und den internalisierten Dispositionen seines Habitus, so dass keine Brüche oder Widersprüche zwischen „Sein“ und „Sollen“ oder zwischen „aktualer sozialer Identität“ und „virtualer sozialer Identität“340 vorliegen. Wie in den interaktionistischen Ansätzen ist auch in der Habitustheorie die Preisgabe der Ausgewogenheit dieser Identitätsaspekte (Krappmann definiert dies als den Verlust der Balance) Ausdruck einer persönlichen Krise, die ein Individuum in seinem sozialen Milieu zum Außenseiter machen kann. Die dahinter stehende soziale Dynamik wird von Bourdieu mit Veränderungen der ökonomischen und sozialen Grundlagen erklärt, die das Leben des Individuums prägen und an deren Dynamik sich die auf internalisierten Strukturen aufbauende Identität nicht anpassen kann. 341 6.2. Der „Kleinbürger“ – Außenseiter und dennoch Mehrheitsmitglied? Die Inkonsistenz der Dispositionen wird von Bourdieu in seinem Werk „Die feinen Unterschiede“ anhand der sozialen Lage und der psychosozialen Situation des Kleinbürgertums beschrieben. Demnach ist das Kleinbürgertum stets geleitet von dem Bemühen, seine Stellung im sozialen Feld zu verbessern und, über die Ansammlung symbolischen Kapitals, das heißt über den Nachweis ökonomischen Wohlstands oder Bildung, eine Unter340 341 vgl. Goffman 1963, S. 10 vgl. Bourdieu 1980, S. 117 179 scheidung von den niederen Schichten der Gesellschaft zu erreichen. Damit einhergehend ist das Bewusstsein, dass der Besitz „wahrer Distinktion“ gleichbedeutend ist mit dem Besitz der „Macht, der Not und dem Zwang des Ökonomischen gegenüber Distanz zu schaffen“342, was gleichbedeutend ist mit einer „bürgerlichen“, von „Dringlichkeiten befreiten Welterfahrung“343, die sich nach Bourdieu im Lebensstil der Etablierten manifestiert, der von Ungezwungenheit geprägt ist und von der Fähigkeit zur Distinktion. Einen solchen Lebensstil zu verwirklichen, ist das Streben des Kleinbürgers, was sich jedoch aufgrund der internalisierten Dispositionen des Habitus als schwierig erweist: „Als Bekräftigung der Macht über den domestizierten Zwang beinhaltet der (bürgerliche, Anmerkung des Verfassers) Lebensstil stets den Anspruch auf legitime Überlegenheit denen gegenüber, die – da unfähig, in zweckfreiem Luxus und zur Schau gestellter Verschwendung ihre Verachtung der Kontingenzen geltend zu machen – von den Interessen und Nöten des Alltags beherrscht bleiben.“344 Die Versuche der Kleinbürger, sich eine entsprechende Fassade anzueignen, sind deswegen zum Scheitern verurteilt, da sie durch eine „grundsätzliche Überkorrektheit der prätentiösen Prätendenten“ gekennzeichnet sind, die „dazu verurteilt, stets zu viel oder zu wenig zu tun - sich auf ängstliche Rückfragen nach der Regel und danach, wie ihr auf legitime Weise Folge zu leisten sei, verwiesen finden und, gelähmt durch diese Rückversicherung - das glatte Gegenteil von Ungezwungenheit -, erst recht nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht“345 Der ungezwungene Lebensstil ist dort opportun, wo die Lebensführung der Menschen nicht durch die unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten des Alltages beeinflusst ist, dort wo genügend Mittel vorhanden sind, um das zu tun und zu lassen, was einem selbst angemessen erscheint: „Ungezwungenem Verhalten gilt deshalb so allgemeine Anerkennung, weil es die sichtbarste Bestätigung der Ungebunden342 Bourdieu 1979, S. 102 Bourdieu 1979 S. 101. 344 Bourdieu 1979, S. 104f. 345 Bourdieu 1979, S. 397f. 343 180 heit gegenüber sozialen Zwängen ist, denen die ‚einfachen Leute‘ stets noch unterworfen sind, und das unbezweifelbarste Zeugnis für den Besitz von Kapital, und damit sowohl der Befähigung, den Anforderungen der biologischen und gesellschaftlichen Natur nachzukommen, als auch der Autorität, diese zu ignorieren.“346 Für die Etablierten entlarven sich die Emporkömmlinge zumeist aufgrund des „proletarischen Lebensstils, durch den sich die Mittellosen noch im Gebrauch ihrer freien Zeit bloßstellen, (er) ist eine Art Negativfolie für jedweden Versuch distinktiver Absetzung und Abhebung. (...) Nicht genug damit, dass sie nahezu keine Kenntnisse und kein Betragen ihr Eigen nennen können, die auf dem Markt der schulischen Examina oder der Salongespräche Geltung besitzen, vielmehr nur über dort wertlose Fertigkeiten verfügen, sind sie zudem noch abgestempelt als jene, die ‚nicht zu leben verstehen‘, die das Meiste für ihr leibliches Wohl hergeben, (...) als jene, die das Wenigste für Kleidung und Körperpflege ausgeben, (...) die ‚sich nicht entspannen können‘, ‚die immer etwas zu tun finden‘, (...) die sich vorgestanzten Freizeitvergnügungen hingeben, für ihren Bedarf entwickelt von Ingenieuren der seriellen und kulturellen Massenproduktion, jene, die den Klassenrassismus in seiner Überzeugung bestätigen, dass sie lediglich haben, was sie verdienen.“347 So können die Etablierten sich, aufgrund ihres verfeinerten Sinns für Distinktion und den damit verbundenen Emblemen ihrer Gleichartigkeit, die nur sie kennen, von jenen absetzen, die zwar zu ihnen gehören wollen, aber nach dem Willen der Etablierten nicht sollen, sie können, bezogen auf ihre Lebenswelt, die allzu bemühten Prätendenten zu Außenseitern machen. Und so ragt die Hysteresis des unterprivilegierten Lebensstiles in die gegenwärtigen Handlungskonzepte der Emporkömmlinge hinein und stört die Fassade, die sie aufzubauen trachten. Das Streben der Kleinbürger nach Distinktion wird von Bourdieu als „fast peinlich-methodisches Sich-Abgrenzen von Geschmack und Eigenschaften, die am klarsten mit den unteren 346 347 Bourdieu 1979, S. 397 Bourdieu 1979, S. 292 181 Klassen assoziiert werden“348 beschrieben. Dabei leben die Kleinbürger „in latenter Angst, etwas falsch zu machen und einen Status, den sie sich vormachen, zu verlieren.“349 Auch unter diesem Aspekt stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Identität jener Menschen. In der Verleugnung der eigenen personalen Identität, in dem Willen zur Abkehr von dem Habitus, den man aufgrund seines Herkommens erworben hat, ist auch der Verlust eines tragfähigen Identitätskonzeptes angelegt, da sich der Kleinbürger „in einer Mischung aus Neid und Bewunderung nach oben andient und nach unten abgrenzt. Er hat einen Status inne, der nicht wirklich Identität garantiert.“350 Das Negieren des eigenen lebensbiographischen Hintergrundes geht einher mit dem Aufbau einer Fassade, die den Aufstieg in die Welt der Etablierten erfordert. So muss der Kleinbürger zum einen mit seiner bisher maßgeblichen Identität brechen und zum anderen eine Scheinidentität annehmen, die jederzeit zerstört werden kann. Bourdieu schreibt, dass „wer ‚hochkommen‘ will, seinen Zutritt zur Sphäre alles dessen, was den ‚Menschen als wahren Menschen’ auszeichnet, mit einem wahrhaften Wandel seiner Natur bezahlen (...) und seinen gesellschaftlichen Aufstieg wie eine ontologische Erhöhung empfinden (muss) (...) - doch jetzt, da er sich selbst zum Schauplatz des aller Kultur immanenten Klassenkampfes gemacht hat, wird er von Schmach, Entsetzen, ja Hass gegenüber dem ‚alten Adam‘ heimgesucht (...), gegenüber allem, dem er einst solidarisch war, (...) gegenüber Seinesgleichen und manchmal sogar gegenüber seiner eigenen Muttersprache - von alledem ist er nun durch eine Grenzlinie geschieden, die totaler ist als alle Verbote.“351 Was ihm bei diesem Identitätswandel zugemutet wird, bzw. was das Individuum sich selbst zumutet, ist nicht weniger als die Konstruktion einer sozialen Identität, die sich von der bisherigen sozialen Identität fundamental unterscheidet, und ein Leugnen lebensbiographisch fundierter Bezüge. Dem Betroffenen bleibt nur, eine Scheinidentität anzunehmen. Bourdieu schreibt dazu: 348 Bourdieu 1979, S. 568 Abels 2001, Bd. 2, S. 257 350 ebd. 351 Bourdieu 1979, S. 391 349 182 „Der Kleinbürger, ausgesetzt den Widersprüchen zwischen objektiv dominierter Soziallage und der Aspiration auf Teilnahme und Teilhabe an den dominanten Werten, ist besessen vom Gedanken daran, welches Bild wohl die Anderen von ihm haben mögen und wie sie es beurteilen. (...) um seine Rolle spielen zu können, (...) tendiert er zu einem Berkeleyschen Weltbild, worin Gesellschaft bloßes Theater, Sein immer nur wahrgenommenes Sein, oder besser, (geistige) Vergegenwärtigung einer (Theater)-Vorstellung ist.“352 Der Kreis schließt sich eingedenk der Tatsache, dass es wiederum an den Etablierten liegt, die Scheinidentität zu akzeptieren, und sie die Macht besitzen, diese Scheinidentität jederzeit zu zerstören. Dies hat Goffman mit dem Konzept der „phantomnormalcy“ beschrieben, wobei der Verlust der auf einer scheinbaren Normalität gründenden Identität gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet. Insoweit der Kleinbürger als Beispiel für einen neuzeitlichen Typus des gesellschaftlichen Außenseiters als Preis für den Aufbau einer Scheinidentität die Bezüge zu seiner Vergangenheit, seiner Herkunft, kurz: zu seiner personalen Identität opfert, droht er von seinen angenommen Rollen im Sinne der Zwänge und Nötigungen des Alltages erdrückt zu werden, sich restlos in diesen instrumentellen Identitätskonzepten zu verlieren. Die Sehnsucht, diesen Zwängen zu entgehen und ein Leben wie die Etablierten zu führen, lässt die Bereitschaft zu wirtschaftlichen und sozialen Opfern wachsen. So weist Bourdieu darauf hin, dass der etablierte Lebensstil für den Kleinbürger meist nur auf Kreditbasis gelebt werden kann, wofür unter Umständen ein ganzes Leben lang gearbeitet werden muss. Nach meinem Erachten ist die Sehnsucht des Kleinbürgers daher nichts anderes als die Sehnsucht nach jener Einzigartigkeit und Rollendistanz, von der im Rahmen der Erörterungen zum Interaktionismus die Rede war. Bourdieu spricht von „Distinktion“, wenn er von den Vorzügen des bürgerlichen Lebensstils schreibt. Und gewisse Symbole der bürgerlichen Konsumkultur, für die der Kleinbürger bereit ist, sich hoch zu verschulden, verleihen ihm in der Folge Distinktionsgewinne.353 Diese 352 353 Bourdieu 1979, S. 394f. vgl. Bourdieu 1979, S. 360 183 Sehnsucht nach Unterscheidung, nach Einzigartigkeit bei gleichzeitiger Rollen-Anpassung, entspricht dem Konzept der „phantom-uniqueness“. Diese war für Krappmann eine Seite der Ich-Identität, deren Fehlen zu einem Verlust an Balance der Identität führte. Bezogen auf die Außenseiterthematik war es meines Erachtens typisch, dass jene gesellschaftlichen Außenseiter, die von einem Stigma betroffen sind, so wenig wie möglich Rollendistanz im Sinne von ‚phantom-uniqueness‘ suchten, um so „normal“ wie möglich leben zu können. Der Außenseitertypus des Kleinbürgers, der insofern Außenseiter ist, weil ihm eine Zugehörigkeit zu jenen Gruppen und Schichten, deren Lebensstil er gerne adaptieren möchte, verweigert wird, ist jedoch meines Erachtens bei aller Rollenkonformität, die er aufbringen muss, um die Fassade, die er sich aufgebaut hat, beibehalten zu können, in Wahrheit auf der Suche nach einem höheren Maß an Rollendistanz, so wie sie von jenen gelebt wird, denen er gleich sein möchte. Dies zu erreichen, ist jedoch nicht zuletzt davon abhängig, dass er sich diese Rollendistanz auch leisten kann. Aufgrund der begrenzten ökonomischen Verhältnisse ist dies jedoch sehr fraglich, so dass das ganze Identitätskonstrukt sehr fragil ist und fortwährend davon bedroht, dass aus dem scheinbar etablierten Mitglied der etablierten Gruppe ein Verlierer wird, der als gesellschaftlicher Außenseiter aus allen seinen sozialen Bezügen herausfällt. Im Rahmen der normativen Erklärungsansätze ist Identität eine Errungenschaft des Individuums, das in der Auseinandersetzung mit inneren oder äußeren Verhaltensanleitungen, die als internalisierte Wert- und Normdispositionen der Gesellschaft anzusehen sind, seine spezifische Stellung in der Gesellschaft erwirbt und behauptet. An diesen Anforderungen zu scheitern, bedeutet ein gesellschaftlicher Außenseiter zu werden. Die theoretischen Ansätze, die dem interpretativen Paradigma zuzurechnen sind, haben das Ich in unauflösbarer Abhängigkeit von den Anderen gesehen. Die Konsistenz und das Überdauernde der Identität ist in der Theorie Meads mit der Übernahme der Haltungen des „generalisierten Anderen“, der den Standpunkt der Gesellschaft und damit deren Wert- und Normorientierungen repräsentiert, verknüpft, was jedoch eine 184 beständige Anpassungsleistung erfordert, denn gesellschaftliche Erwartungen unterliegen einer permanenten Dynamik. Identität zu behaupten wird in den neueren Ansätzen (Goffman und Krappmann) als das Vermögen zur Integration der Ansprüche der Gesellschaft mit persönlichen biographischen Zügen des Individuums gedeutet. Goffman sieht die Inkonsistenz der Ansprüche in der „schmachvollen Kluft zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität“354 als Anlass für die Gefährdung von Identität. Krappmann behauptet, dass ein Mangel an Balance zwischen den Forderungen einer personalen Identität und jenen der sozialen Identität die Konsistenz des Selbst untergräbt. Hier bedeutet die Desintegration der divergierenden Ansprüche des Individuums an sich selbst, im Verhältnis zu den Ansprüchen, die die Gesellschaft an das Individuum richtet, den Verlust an Balance, die erforderlich ist, um mit den widersprüchlichen Anforderungen der Gesellschaft zurechtkommen zu können. Ich sehe darin einen Verlust der Konsistenz des Selbst mit der Folge einer gefährdeten Identität, was immer auch als Behinderung in den regulären Bezügen des Individuums zu seiner sozialen Umwelt gedeutet werden kann. Schließlich beinhaltet die Habitustheorie den Gedanken, dass desintegrierte Identität dann vorliegt, wenn das, was in Form eines verinnerlichten Leitmotivs, was allerdings ausschließlich gesellschaftlichen Ursprungs ist, nämlich der Habitus, der dem Individuum Verhaltensorientierung vermittelt, aber auch Grenzen seines Verhaltens zumutet, in der Folge persönlicher biographischer Implikationen, unpassend wird und eine Veränderung, vor allem im Sinne einer Mobilität durch den sozialen Raum, mit welchen Schwierigkeiten auch immer, notwendig wird. Im Weiteren sind die Zusammenhänge zu analysieren, wie aufgrund gesellschaftlicher Werte bzw. Normen bestimmte gesellschaftliche Individuen oder Gruppen eine Identitätszuweisung erlangen, die sie zu gesellschaftlichen Außenseitern werden lässt. Dabei korrespondiert der Grad der Integration der Identität, der einem Individuum eignet, mit dem Grad seiner eigenen gesellschaftlichen Integration. Hierbei geht es um die 354 Goffman 1963, S. 157 185 Frage, welche gesellschaftliche Definitionsmacht dafür maßgeblich ist, dass einem Individuum oder einer Gruppe ein Integrationsprozess im Hinblick auf die eigene Identität und damit auch auf die gesellschaftliche Integration verwehrt werden kann. 186 7. Identitätsentwicklung im Einklang mit der sozialen Umwelt – die dogmatischen Positionen der klassischen Theorielinien Alle theoretischen Ansätze, die Identitätsgenese erklären, thematisieren auch die Bedeutung der sozialisatorischen Wechselwirkung von Individuum und Umwelt. Dies gilt insbesondere für die interaktionistischen und subjekttheoretischen Identitätskonzepte, wobei hier die Beteiligung des Individuums an der Entstehung seiner eigenen Identität besonders hervorgehoben wird. Der Anteil der Gesellschaft am Zustandekommen von Identität kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Selbst in der höchst individualisierten Interaktion zwischen dem signifikanten Anderen und dem Individuum manifestiert sich ihr Einfluss, nämlich in den Erfahrungen mit der Gesellschaft als gleichsam objektivem Sachverhalt, die das Individuum und der Andere in ihren Interaktionsanteilen einbringt. Dieser Aspekt wird von Berger und Luckmann, ebenfalls unter Rückgriff auf Elemente der Identitätstheorie von Mead, erwähnt: „Der Vorgang der Menschwerdung findet in Wechselwirkung mit einer Umwelt statt. Die Feststellung gewinnt besondere Bedeutung, bedenkt man, dass diese Umwelt sowohl eine natürliche als auch eine menschliche ist. Das heißt, der sich entwickelnde Mensch steht in Verbindung nicht nur mit einer besonderen natürlichen Umwelt, sondern auch mit einer besonderen kulturellen und gesellschaftlichen Ordnung, welche ihm durch ‚signifikante Andere‘ vermittelt wird, die für ihn verantwortlich sind.“355 Über die Sozialisation erwirbt das Individuum Wissen um die Sachverhalte gesellschaftlicher Ordnung. Die elementarste Orientierung über das, was als Verhalten gewünscht bzw. unerwünscht ist, kann jetzt entstehen. Sie manifestiert sich in dem kindlichen Rollenspiel, das die Welt der Erwachsenen und deren Ordnung antizipiert und eine Konstruktion der Persönlichkeit einleitet. Die Sozialisation vollendet sich mit der Entwicklung einer einheitlichen Identität, die nach Meads Theorie dadurch gekennzeichnet ist, dass das Individuum den Standpunkt des „allgemeinen“ oder „generalisierten“ Anderen in seinen 355 Berger und Luckmann 1966, S. 51 187 Handlungen verwirklicht, und dies ist der Fall, wenn ganz konkrete Erwartungen an das Verhalten, wie sie sich in sozialen Rollen manifestieren, in internalisierter Weise die Persönlichkeit des Individuums prägen. Die Integration des Individuums in die Gesellschaft im Sinne der Ausbildung einer gesellschaftlich (mit)konstruierten Identität ist eine wesentliche Erkenntnis der Theorielinien, die Identität thematisieren. So betont auch Joas den gesellschaftlichen Rahmen der Ich-Synthese: „Die Leistungen der Synthese zu einer konsistenten und kontinuierlichen Identität wurden nicht einfach nur beschrieben, sondern es gab bei Mead und Erikson wie bei allen Anhängern und Fortsetzern die stillschweigende Hintergrundannahme, dass es auch gut sei, eine Identität zu bilden – gut zumindest in dem auch empirisch bestätigbaren Sinn, dass das Maß seelischer und körperlicher Gesundheit und subjektiven Glücksempfindens bei gelingender Identitätsbildung höher sei. Gut aber sei Identitätsbildung auch noch in einem tieferen und eindeutiger normativen Sinn, nämlich dem, dass Identitätsbildung Autonomiegewinn darstelle und damit ein Misslingen der Identitätsbildungsversuche einem Verharren in Unmündigkeit gleichzusetzen sei. Die Vorstellung, im Verlust der Ich-Identität oder im Scheitern von Identitätsbildungsprozessen etwas anderes zu sehen als Unglück für die Betroffenen, war in dieser Tradition ganz abwegig.“356 Diese Identitätsbildungsprozesse erfolgen aber immer nur im Rahmen einer gesellschaftlichen Ordnung, die die Sozialisationserfolge festlegt und definiert, dazu gehört die Einpassung des Individuums in die gesellschaftliche Rollenstruktur. 7.1. Ethik und Gesellschaft In den bisherigen Erörterungen war eine Grundannahme der klassischen Identitätstheorien, dass die Konstitution und Entwicklung der Identität in einem engen Zusammenhang mit den Werten, die in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe maßgeblich sind, steht. So schreibt Habermas, dass „Gesellschaft stets als eine moralische Realität (zu begreifen ist, Anmerkung des Verfassers). Die klassische Soziologie hat nie in 356 Joas 1997, S. 237f. 188 Zweifel gezogen, dass sprach- und handlungsfähige Subjekte die Einheit ihrer Person nur im Zusammenhang mit identitätsverbürgenden Weltbildern und Moralsystemen ausbilden können.“357 So wie die Identität der Angehörigen der Gesellschaft sind auch deren Wertstrukturen gesellschaftlich konstruiert. Mead schreibt über diesen Zusammenhang: „Im Rahmen unserer gesellschaftlichen Theorie über Ursprung, Entwicklung, Wesen und Struktur der Identität lässt sich eine ethische Theorie auf gesellschaftlicher Grundlage erstellen.“358 Aus dieser Perspektive sind Wertorientierungen immer gesellschaftlich abgeleitet; eine transzendente Epistemologie der Werteentstehung, wie sie z.B. von religiösen Systemen geliefert wird, ist ausgeschlossen. Der Ursprung gesellschaftlicher Werte ist nach Meads Ansicht das Desiderat einer für alle Gesellschaftsmitglieder möglichst umfassenden Handlungsanleitung, die weitgehend von ihnen akzeptiert und implementiert werden kann. Joas beschreibt dies als „Einordnung des individuellen Handelns in die ‚Universalisierung‘ gesellschaftlicher Strukturen“359 und meint damit, dass individuelle Handlungsziele im Falle einer Orientierung an allgemeinen gesellschaftlichen Zielen an sich wertvoll sind. Dies behauptet er gegen die Moralphilosophie Kants, die als reine Gesinnungsethik individuelle Bedürfnisse, welche ihrerseits weder rational geleitet noch einer allgemeinen Ethik verpflichtet sind, als Antrieb menschlichen Handelns verbietet. Diesen „bedürfnisrepressiven Charakter“360 der Ethik Kants lehnt Mead ab und behauptet, dass auch Handlungen, die von menschlichen Bedürfnissen geleitet oder induziert sind, endlich moralischen Charakter haben können. So ist auch eine moralische Ordnung von Menschen gemacht, deren Bedürfnisse darin zum Ausdruck kommen. Damit gilt sie als eine soziale Konstruktion, und das menschliche Wertesystem ist ein Ergebnis menschlicher Praxis: „Die Ordnung des Universums, in dem wir leben, ist die moralische Ordnung. Sie ist zur moralischen Ordnung geworden, weil sie die ihnen selbst bewusste Methode von Mitgliedern 357 Habermas 1973a, S. 162 Mead 1934, S. 429 359 Joas 1980, S. 124 360 Joas 1980, S. 122 358 189 einer menschlichen Gesellschaft geworden ist. Wir sind keine Pilger und Fremdlinge. Wir sind in unserer eigenen Welt zu Hause, aber diese Welt ist nicht die unsere, weil wir sie geerbt, sondern weil wir sie erobert haben. Die Welt, die aus der Vergangenheit auf uns kommt, beherrscht und kontrolliert uns. Wir beherrschen und kontrollieren die Welt, die wir entdecken und erfinden. Und dies ist die Welt der moralischen Ordnung.“361 Eine Welt, in der eine von Menschen konstruierte moralische Ordnung herrscht, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, bietet wahrscheinlich ihren Gesellschaftsmitgliedern deren Interessen dienliche Handlungsanleitungen. Entsprechend wird sich eine Gesellschaft, in der ausschließlich Individuen leben, die sich in ihrem Handeln nach allgemeinen Regeln richten, bzw. nach dem Kantschen kategorischen Imperativ362 handeln, harmonisch sein, „so dass eine Gesellschaft, die aus solchen, das moralische Gesetz anerkennenden Menschen besteht, eine moralische Gesellschaft wäre.“363 Mead stellt mit Bezug auf das Individuum klar: „nur insoweit man das eigene Motiv und das tatsächlich verfolgte Ziel mit dem Gemeinwohl identifizieren kann, erreicht man ein moralisches Ziel und moralisches Glück. Da die menschliche Natur entscheidend gesellschaftlich geprägt ist, müssen moralische Ziele ihrem Wesen nach ebenfalls gesellschaftlich sein. (...) Als gesellschaftliche Wesen sind wir moralische Wesen. Auf der einen Seite steht die Gesellschaft, die die Identität ermöglicht, auf der anderen die Identität, die eine hochorganisierte Gesellschaft ermöglicht. Die beiden entsprechen einander im moralischen Verhalten.“364 Mit dieser Aussage macht Mead deutlich, dass seiner Ansicht nach gesellschaftliche Werte das Fundament der Identitätsentwicklung sind und dass die Gesellschaft wiederum darauf angewiesen ist, dass in ihr Individuen auf der Grundlage moralischer Werte handeln. 361 Joas 1980, S. 126f. „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ (Kant: Kritik der reinen Vernunft, Königsberg 1781) 363 Mead 1934, S. 433 364 Mead 1934, S. 436 362 190 7.2. Die ethische Konstruktion der Identität (G.H. Mead) Einem ontogenetischen Prinzip folgend ist die Festigung der Identität im Zusammenhang mit der zunehmenden Verallgemeinerung gesellschaftlicher Erwartungen zu sehen. Es erfolgt eine Abstraktion von der konkreten Person des „signifikanten Anderen“ zu der des „verallgemeinerten Anderen“ und auch vom konkreten, externen Verhaltensimperativ hin zu einer verinnerlichten Form der Verhaltensdisposition bezüglich gesellschaftlicher Sollgeltungen. Habermas bemerkt dazu: „Diese imperativische Autorität (im Sinne der äußeren Sanktionsmacht der sozialen Gruppe, der das Individuum angehört, Anmerkung des Verfassers) wird erst durch Verinnerlichung in eine normative Autorität umgewandelt. Erst damit entsteht die Instanz des ‚verallgemeinerten Anderen‘, die die Sollgeltung von Normen begründet.“365 Anders ausgedrückt: Die konkreten Verhaltenserwartungen, die von signifikanten Anderen an das Individuum herangetragen werden, werden von allgemeinen Verhaltensdispositionen, die als Verhaltensimperative der Gesellschaft in der Persönlichkeit des Individuums verinnerlicht sind, abgelöst. Habermas hat diesen Gedanken in seiner Kommunikationstheorie aufgenommen und dabei unter anderem folgende Feststellung getroffen: „Dem Moment des Allgemeinen im ‚verallgemeinerten Anderen‘ haftet noch die faktische Macht eines verallgemeinerten Imperativs an; denn der Begriff bildet sich auf dem Wege der Verinnerlichung der sanktionierten Macht einer konkreten Gruppe. Allein, in demselben Moment des Allgemeinen ist auch schon der auf Einsicht angelegte Anspruch enthalten, dass einer Norm Geltung nur insoweit zukommt, wie sie im Hinblick auf eine jeweils regelungsbedürftige Materie die Interessen aller Betroffenen berücksichtigt und den Willen, den alle im jeweils eigenen Interesse gemeinsam bilden könnten, als Willen des ‚verallgemeinerten Anderen‘ verkörpert.“366 Der „verallgemeinerte Andere“ ist somit die in der Persönlichkeit des Individuums verdichtete Ausprägung gesellschaftlicher Sollgeltungen, die sich jedoch wiederum aus den Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaftsmitglieder ableiten. Er repräsentiert allgemeine Prinzipien 365 366 Habermas 1981, S. 63 Habermas 1981, S. 64 191 des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und hinter diesen Prinzipien des Allgemeinen, die gesellschaftlich konstruiert sind, steht nach Meads Ansicht das Prinzip der Vernunft. So schreibt Mead: „Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, weil er ein gesellschaftliches Wesen ist. Die Allgemeinheit unserer Urteile (...) leitet sich aus der Tatsache ab, dass wir die Haltung der ganzen Gemeinschaft, die Haltung aller vernunftbegabten Wesen einnehmen.“367 Aus dieser Sicht erscheint Moral gleichbedeutend mit Allgemeinheit, im Sinne einer allgemeinverbindlichen Gültigkeit von Werten, deren Genese mit „vernunftgeleiteten“ Motiven erklärt werden kann und deren Manifestation sich in den Handlungsorientierungen der Gesellschaftsmitglieder reflektiert. Dies ist die Gewähr dafür, dass Gesellschaften mit ihren komplexen sozialen Systematiken entstehen und bestehen können, und nur unter diesen Bedingungen „kann sich aus solchen gesellschaftlichen, allgemeinen Zielen eine Gesellschaftsordnung entwickeln.“368 Der gesellschaftliche Aspekt der Sozialisationstheorie beinhaltet, dass Gesellschaften optimal integriert sind, wenn die sie konstituierenden Individuen aufgrund der Internalisierung der gesellschaftlichen Wertstrukturen „optimal“, das heißt den Erfordernissen des gesellschaftlichen Prozesses gemäß, agieren, eine Handlungsorientierung, die nach Meads Logik als „vernünftig“ zu bezeichnen wäre. Bezogen auf das Handeln des Individuums umschreibt Mead diesen Zusammenhang so: „Nur ein vernunftbegabtes Wesen kann seine Handlung und die Maxime seiner Handlung (...) verallgemeinern, und der Mensch verfügt über diese Rationalität. Wenn er auf eine bestimmte Weise handelt, wünscht er, dass unter den gleichen Voraussetzungen jedermann ebenso handeln sollte.“369 Diese Erwartung kann nur entstehen, wenn soziale Prozesse die Existenz von Normen bewirken, die von allen Gesellschaftsmitgliedern anerkannt werden und eine Handlungsorientierung bei den Gesellschaftsmitgliedern herbeiführen, auf deren Grundlage eine gesellschaftliche Ordnung etabliert ist. In Habermas’ Worten: „Erst die kommunikative Ethik sichert die Allgemeinheit der 367 Mead 1934, S. 429f. ebd. 369 ebd. 368 192 zulässigen Normen und die Autonomie der handelnden Subjekte allein durch die diskursive Einlösbarkeit der Geltungsansprüche, mit denen Normen auftreten, das heißt dadurch, dass nur die Normen Geltung beanspruchen dürfen, auf die sich alle Betroffenen als Teilnehmer eines Diskurses (zwanglos) einigen (oder einigen würden).“370 Die Gruppe, der das Individuum angehört, besitzt eine Sanktionsmacht, die im Falle des wohl sozialisierten Gesellschaftsmitgliedes keiner permanenten Aktualisierung bedarf. Je besser eine Gesellschaft integriert ist, je funktionaler die Sozialisationsergebnisse ihrer Mitglieder im Hinblick auf gesellschaftliche Erwartungen ausfallen, desto weniger muss sich gesellschaftliche Macht manifestieren und desto ökonomischer ist die Realisierung gesellschaftlicher Ordnung. Auf diese Weise erklärt sich die Parallelität von ontogenetischer und gesellschaftlicher Entwicklung. Zu Recht schreibt daher Habermas: „Die identitätssichernden und sozialintegrativ wirksamen Bestandteile der Weltbilder, also die Moralsysteme und die zugehörigen Interpretationen, folgen mit zunehmender Komplexität einem Muster, das auf ontogenetischer Ebene in der Logik der Entwicklung des moralischen Bewusstseins eine Parallele hat.“371 In dem Maße nämlich, in dem das Individuum den sozial verallgemeinerten Imperativ in Form des generalisierten Anderen internalisiert, nähert es sich einem optimalen Sozialisationsziel an. Habermas spricht daher von dem „sozialisierten Erwachsenen, der schon weiß, was es heißt, dass eine Norm gilt.“ 372 Die Gültigkeit dieser Norm besteht auch für die Anderen. Diese stehen auch unter dem Einfluss des generalisierten Anderen bzw. des für ihren Interaktionsanteil maßgeblichen Teilaspekt des generalisierten Anderen. Dieser bezieht seine Allgemeinverbindlichkeit und Autorität aus dem „allgemeinen Gruppenwillen“. So lässt sich der für diese Arbeit wesentliche Zusammenhang der Meadschen Ethik folgendermaßen zusammenfassen: das, was eine allgemeine Gültigkeit besitzt und dessen Implementierung in den alltäglichen Handlungsvollzügen „vernünftig“ 370 Habermas 1973a, S. 125 Habermas 1973a, S. 24 372 Habermas 1981, S. 62 371 193 erscheint und sich daher für eine gesellschaftliche Mehrheit bewährt, weil es deren Neigungen und Interessen dient, erlangt eine hohe moralische Bewertung. Daran orientieren sich Sozialisationsprozesse, die ihren Abschluss darin finden, dass gesellschaftliche Wertpositionen verinnerlicht werden, die das Handeln der Individuen in einer für die Gesellschaft funktionalen Weise beeinflussen sollen. Dies vollzieht sich auf der Grundlage gesellschaftlich normierter Identitäten. 7.3. Die soziale Konstruktion der Ethik (E. Durkheim) Die handlungsdeterminierende Funktion gesellschaftlicher Werte wurde von Mead ansatzweise erklärt: er beschreibt im Wesentlichen Internalisierungsmechanismen als maßgebliche Faktoren. Auf der Grundlage dieser internalisierten Dispositionen zu moralischem Handeln ist nach Meads Auffassung Gesellschaft erst möglich. Auf diesen theoretischen Überlegungen aufbauend schreibt Habermas: „Die Teilnehmer an symbolisch vermittelten Interaktionen können sich (...) erst in dem Maße in Angehörige eines Kollektivs mit Lebenswelt verwandeln, wie sich die Instanz eines verallgemeinerten Anderen, wir können auch sagen: ein Kollektivbewusstsein oder eine Gruppenidentität herausbildet.“373 Der Begriff des „Kollektivbewusstseins“ gehört zum theoretischen Vokabular Durkheims, der ebenfalls die Entstehung von Werten im Kontext gesellschaftlicher Evolution verortet hat. Nach Durkheims Auffassung vermehren sich mit steigender physischer Dichte einer Gesellschaft auch die Interaktionen der Gesellschaftsmitglieder. Durkheim unterscheidet zwischen segmentären, das heißt primitiven Gesellschaften und höher entwickelten Gesellschaften, die er auch arbeitsteilig nennt. Die Unterscheidung bezieht sich auf verschiedene Modi des Zusammenlebens in der jeweiligen Gesellschaft. Die nicht-arbeitsteiligen, segmentären Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen weitgehend ähneln. Es können nach Durkheims Auffassung Menschen, die sich ähnlich sind, „nicht zusammen373 Habermas 1981, S. 73 194 leben, ohne dass sich zwischen ihnen Gefühle der Sympathie und der Liebe einstellen.“374 Durkheim bezeichnet daher die in diesen Gesellschaften praktizierte Solidarität, d.h. das Verbundensein der Menschen in dieser Gesellschaft, als mechanisch. Und Abels schreibt dazu: „In einer segmentären Gesellschaft leben die Menschen in abgegrenzten Gruppen oder Clans, die nach außen, zu anderen Gruppen, relativ wenige Beziehungen pflegen. (…) In diesen einfachen Gesellschaften (sociétés primitives) ist die Arbeit kaum geteilt. Im Prinzip sorgt jeder für seinen gesamten Lebensunterhalt selbst. Die Mitglieder sind sich im großen Ganzen ähnlich; sie stimmen in ihren Anschauungen und religiösen Überzeugungen, die seit je zu existieren scheinen, überein und folgen ihnen wie mechanisch.“375 In den höher entwickelten Gesellschaften ändern sich die Beziehungen der Menschen, wofür zwei Bedingungen verantwortlich sind: Bevölkerungszunahme und soziale Verdichtung. Die Menschen sind sich, trotz der Tatsache, dass sie räumlich enger zusammenrücken, in sozialer Hinsicht ferner. Die relative soziale Ferne der Individuen der höher entwickelten Gesellschaften bedingt jedoch einen anderen Solidaritätsmodus, denn „Ähnlichkeit steht (...) in arbeitsteiligen Gesellschaften als Ressource der Moral immer weniger zur Verfügung.“376 Diesen Sachverhalt zusammenfassend schreibt Luhmann: „Daraufhin lässt sich dann formulieren, dass zunehmende Arbeitsteilung mit zunehmender Solidarität korreliert, wobei die Form der Solidarität von Gleichheit auf Ungleichheit umgestellt werden muss.“377 Unterstützt durch zunehmende Kommunikationsdichte und verbesserte Kommunikationsformen nimmt die soziale Differenzierung zu und deshalb auch die Arbeitsteilung. So schreibt Durkheim: „Mit der Bestimmung der Hauptursache der Fortschritte der Arbeitsteilung haben wir zugleich den Hauptfaktor dessen bestimmt, was man Zivilisation nennt. Die Zivilisation ist selber eine notwendige Folge der Veränderungen, die im Volumen und in der Dichte der Gesellschaft entstehen. Wenn die 374 Baurmann 1999, S. 89 Abels 2001 Bd. 1, S. 112f. 376 ebd. 377 Luhmann 1977, S. 25 375 195 Wissenschaft, die Kunst und die Wirtschaftstätigkeit sich entwickeln, so aufgrund einer den Menschen auferlegten Notwendigkeit; weil es für sie keine andere Möglichkeit gibt, unter den neuen Bedingungen zu leben, denen sie ausgeliefert sind. Von dem Augenblick an, da die Zahl der Individuen, zwischen denen sich soziale Beziehungen ausgebildet haben, bedeutender ist, können sie sich nur erhalten, wenn sie sich weiter spezialisieren, mehr arbeiten und ihre Fähigkeiten intensivieren. Aus dieser allgemeinen Anregung geht unweigerlich ein höherer Grad der Kultur hervor.“378 Spezialisierung ist ein grundlegendes Phänomen gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Spezialisierung führt dazu, dass Gesellschaftsmitglieder in ihren Arbeitsprozessen zunehmend aufeinander angewiesen sind. Soweit aus diesen Interdependenzen ökonomische Optimierung der Arbeitsergebnisse resultiert, werden diese sozialen Strukturen als wertvoll und erhaltenswert erlebt. Folglich ist „es (...) eine sehr legitime Annahme, dass (...) (sich die Gesellschaften, Anmerkung des Verfassers) nur dank der Spezialisierung der Aufgaben im Gleichgewicht halten können, dass die Arbeitsteilung die, wenn nicht einzige, so doch hauptsächlichste Quelle der sozialen Solidarität ist.“379 Die aus der Arbeitsteilung erwachsende Solidarität wird von Durkheim als organisch bezeichnet. Für diese Form der Solidarität ist charakteristisch, dass in ihr nicht ähnliche und im Prinzip austauschbare Menschen agieren, sondern Individuen, die mit ihren spezifischen Fähigkeiten und Möglichkeiten dem gesellschaftlichen Ziel dienen. So bezeichnet Abels diese Form der Solidarität auch als „Solidarität der Individualität“.380 Und weiter: „Organische Solidarität ist eine funktionale Solidarität. Diese neue Form der Solidarität beinhaltet die Verpflichtung, zur Förderung des Ganzen beizutragen.“381 Durkheims theoretische Konzeption der Arbeitsteilung liefert somit eine Erklärung für das Entstehen gesellschaftlicher Werte. Diese sind demnach ein Derivat der Arbeitsteilung. Die Individuen sind durch Arbeitsteilung verbunden, indem sie sich in 378 Durkheim 1893, S. 401f. Durkheim 1893, S. 109 380 Abels 2001 Bd. 1, S. 114 381 ebd. 379 196 ihren Lebensvollzügen ergänzen, ein Umstand, der es begründet, dass sie gegenseitig aufeinander angewiesen sind. Aus dem Bedürfnis nach Ordnung und Harmonie und sozialer Solidarität ergibt sich der moralische Charakter der Arbeitsteilung. So schreibt Durkheim, dass die Arbeitsteilung „eine viel bedeutendere Rolle (spielt), als man ihr gewöhnlich zugesteht. Sie würde nicht nur dazu dienen, unseren Gesellschaften einen vielleicht beneidenswerten, aber überflüssigen Luxus zu verschaffen; sie wäre vielmehr eine Bedingung ihrer Existenz. Denn durch sie (...) würde deren Zusammenhalt gesichert; (...) (Man kann) feststellen, dass die Arbeitsteilung (...) einen moralischen Charakter haben muss, denn die Bedürfnisse nach Ordnung, Harmonie und sozialer Solidarität gelten gemeinhin als moralische.“382 Eine Komponente dieses theoretischen Ansatzes ist das Konzept des „Kollektivbewusstseins“383, von dem eingangs die Rede war. Abels schreibt, dass das funktionale Handeln der Individuen in der Gesellschaft und ihren Institutionen auf der Grundlage des kollektiv geteilten Bewusstseins, von dem, was geboten und was verboten ist, beruht. Dieses Kollektivbewusstsein „bildet gewissermaßen die Klammer, durch die die Individuen zusammen gehalten werden. Das Kollektivbewusstsein als das mehr oder weniger bewusste Einverständnis über zentrale Werte und Normen regelt das Handeln der Menschen untereinander, ohne dass es in jeder Situation einer expliziten Abstimmung der Gründe und Ziele des Handelns bedürfte.“384 Es gründet auf der Kooperation der Individuen und deren gegenseitiger Abhängigkeit. Denn, so schreibt Durkheim, „es ist unmöglich, dass Menschen zusammenleben und regelmäßig miteinander verkehren, ohne schließlich ein Gefühl für das Ganze zu entwickeln, das sie mit ihrer Vereinigung bilden, ohne sich an dieses Ganze zu binden, sich um dessen Interessen zu sorgen und es in ihr Verhalten einzubeziehen. Nun ist aber diese Bindung an etwas, was das Individuum überschreitet, diese Unterordnung der Einzel- 382 Durkheim 1893, S. 110 vgl. Durkheim 1893, S. 466 384 Abels 2001, S. 130 (Bd.1) 383 197 interessen unter ein Gesamtinteresse, die eigentliche Quelle jeder moralischen Tätigkeit.“385 Durkheim ist der Auffassung, dass das Kollektivbewusstsein nur zum Schaden der Gesellschaft geschwächt wird, denn die Verletzung der Kollektivgefühle hat die Desintegration der Gesellschaft zur Folge: „Es ist unmöglich, dass die Verletzung der grundlegendsten Kollektivgefühle geduldet würde, ohne dass die Gesellschaft desintegrierte. Vielmehr muss sie mit Hilfe jener besonders energischen Reaktion bekämpft werden, die den moralischen Regeln eigen ist.“386 Es lässt sich daher meines Erachtens feststellen, dass das Kollektivbewusstsein im Sinne Durkheims aus der Solidarität entsteht, die wiederum eine soziale Folge funktionierender arbeitsteiliger Prozesse ist. Und in diesem Sinne ist das Kollektivbewusstsein die Basis, auf der kollektive gesellschaftliche Werte gründen. Man könnte auch sagen, dass Werte stets vor dem Hintergrund einer bestimmten Kollektivität entstehen, und die Zugehörigkeit zu Kollektiven beinhaltet die Reproduktion ihrer Werte. Das Kollektivbewusstsein ist ein Bewusstsein gemeinsamer Werte und zumeist ein Erbe der vorherigen Generation. So schreibt Abels: „Das Kollektivbewusstsein ist ein Bewusstsein von etwas, das unabhängig vom Willen oder der Sympathie eines einzelnen Individuums existiert. Dieses ‚Etwas‘ ist real schon vorhanden, bevor das Subjekt die Bühne des Lebens betritt, und es bestimmt das Denken und Handeln des Individuums.“387 Die moralische Implikation gesellschaftlicher Arbeitsteilung ergibt sich aus der Pflicht zu gesellschaftlicher Integration, sich in den gesellschaftlichen Prozess ein- und den gesellschaftlichen Imperativen unterzuordnen. Denn wer diesen Imperativen nicht folgt, partizipert nicht an den durch das Kollektivbewusstsein gesetzten Handlungsoptionen, gefährdet das Kollektiv, trägt zur gesellschaftlichen Desintegration bei. Durkheim schreibt, dass die Gesellschaft solchem Ausscheren begegnet und entsprechend einen „heilsamen Druck“388 zu gelebter Konformität ausübt. Diese Hervorhebung der 385 Durkheim 1893, S. 56 Durkheim 1893, S. 467 387 Abels 2001, Bd1, S. 130f. 388 vgl. Durkheim 1893, S. 471 386 198 Kollektivität lässt in der Theorie wenig Platz für Menschen mit ihren individuellen Regungen. Abels schreibt daher, dass Durkheims Konzept „am Vorrang der Gesellschaft gegenüber dem Individuum keinen Zweifel lässt.“389 Über diese „französische“ Sicht der Stellung des Individuums in der Gesellschaft, mit den angeblichen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der strukturellen Grenzziehungen, habe ich schon geschrieben. Über den Strukturalismus hat diese Sicht die Habitustheorie Bourdieus beeinflusst und steht im Widerspruch zu interpretativen Subjekttheorien. In diesem Abschnitt habe ich darzustellen versucht, wie die in der Soziologie bisher maßgeblichen Konzepte Identitätsbildung in einen ausschließlichen gesellschaftlichen Kontext stellen und das Vorhandensein von Internalisierungsmechanismen unterstellen. Ich habe diesen Ansatz eingangs als „dogmatisch“ bezeichnet, weil er in seiner Konsequenz eine „gelungene“ Identitätsbildung fordert, die nur dann vorliegt, wenn der Standpunkt der Gesellschaft gewahrt bleibt. Die verschiedenen Theoretiker haben diese Forderung mit den Variablen „Vernunft“ und „Moral“ und „Natur“ (über psychoanalytische Konstruktionen) abgesichert. Wie sich zeigt, ist in der jüngeren Vergangenheit die theoretische Diskussion darauf gerichtet, das Individuum auch im Hinblick auf die Bildung seiner Identität als bewusst handelnd und gestaltend in den Vordergrund zu stellen. Dabei treten gegensätzliche Interessen zu Tage, die der dogmatischen Position der Vergangenheit bisher verborgen geblieben ist. Den oben angebenen Variablen ist nämlich eine weitere hinzuzufügen: Macht. Zuvor möchte ich jedoch analysieren, auf welche Weise Werte den sozialen Konstitutionsprozess von Identität beeinflussen. Dies geschieht nämlich nicht sui generis, sondern aufgrund ihrer Nutzung im gesellschaftlichen, das heißt institutionellen Rahmen. 389 Abels 2001, Bd.2, S. 52 199 7.4. Institutionen Die soziale Ontogenese bzw. Sozialisation des Menschen ist soziologisch betrachtet ein Abstraktionsprozess, der ein partikulares Verständnis menschlicher Interaktion mit einzelnen Individuen (signifikanten Anderen) überwindet und in formalisierte Interaktionszusammenhänge mit vielen, auch unbekannten Menschen übergeht, deren Ausprägung jedoch aufgrund gemeinsam getragener Wertstrukturen weitgehend festgelegt ist und daher bestimmte Erwartungshorizonte der sozialisierten Gesellschaftsmitglieder bewirkt. Diese Erwartungszusammenhänge bilden das Rückgrat sozial regulierter menschlicher Interaktionen, die als gefestigte Interaktionsstrukturen, als Institutionen, bezeichnet werden. Mead erklärt sie folgendermaßen: „Bestehen wir auf unseren Rechten, so rufen wir bestimmte Reaktionen hervor – eine Reaktion, die bei jedermann ausgelöst werden sollte und vielleicht auch bei jedermann auftritt. Nun ist diese Reaktion in unserem eigenen Wesen gegeben; bis zu einem gewissen Grad sind wir dazu bereit, diese gleiche Haltung gegenüber einem anderen einzunehmen, wenn er an uns appelliert. Lösen wir diese Reaktion bei anderen aus, so können wir die Haltung der anderen übernehmen und dann unser eigenes Verhalten darauf abstimmen. Es gibt also solche gemeinsame Reaktionen in der uns umgebenden Gemeinschaft, wir bezeichnen sie als ‚Institutionen‘. Die Institution ist eine gemeinsame Reaktion seitens aller Mitglieder der Gemeinschaft auf eine bestimmte Situation...“390 Soziologisch betrachtet sind Institutionen soziale Konstruktionen im Sinne von Kooperationsmustern, die in ihren Verfahrensabläufen bestimmten sozial konstituierten Regeln folgen. Diese allgemeine Definition ist auf systematisierte und formalisierte soziale Interaktionszusammenhänge gerichtet. In der praktischen Alltagserfahrung erscheinen Institutionen als soziale Organisationen, die das soziale Leben der Menschen nachhaltig beeinflussen. So zählt der Anthropologe Arnold Gehlen zu den Institutionen exemplarisch „den Staat, die Familie, die wirtschaftlichen, rechtlichen Gewalten.“391 390 391 Mead 1934, S. 308 Gehlen 1956, S. 9 200 Berger und Luckmann haben ein wesentlich allgemeineres Verständnis des Institutionenbegriffs. Sie erklären die Entstehung von Institutionen auf der Grundlage von Gewohnheiten: „Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine Institution. (...) Wenn habitualisierte Handlungen Institutionen begründen, so sind die entsprechenden Typisierungen Allgemeingut. Sie sind für alle Mitglieder der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe erreichbar. Die Institution ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und individuellen Akten Typen.“392 Es sind zwei Perspektiven in diesem Zitat hervorzuheben: neben dem Prozess der Bildung von Institutionen im Sinne einer gesellschaftlichen Evolution vollzieht sich ein identitätsbildender Typisierungsprozess auf der Ebene des Individuums. Erstere ist eine anthropologische Perspektive, die zweite Perspektive knüpft an die Identitätsthematik an. Und wie so oft sind die Zusammenhänge nur in ihrer Reziprozität zu verstehen, denn während sich gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer Einflussmacht auf die Persönlichkeit des Individuums weitgehend in institutionalisiertem Rahmen manifestiert, sind es wiederum Individuen mit ihren ganz eigentümlichen, von Institutionen geprägten Identitäten, die gesellschaftliche Institutionen konstituieren. Ad 1: Aus der anthropologischen Perspektive ist die Bildung von Institutionen sowohl Folge als auch Bedingung der Evolution der Menschheit. Gehlen geht daher davon aus, dass der Mensch zur Sicherung seiner Überlebensfähigkeit darauf angewiesen ist, seine Umwelt mit Hilfe der von ihm geschaffenen Institutionen derart zu ordnen, dass er seine physiologischen Unzulänglichkeiten kompensiert. Die Institutionen „haben angesichts der unwahrscheinlichen Plastizität, Formbarkeit und Versehrbarkeit eines Wesens, das jeder Impuls außerhalb der Bindungen sehr leicht deformiert, eine geradezu fundamentale Bedeutung. Alle Stabilität bis in das Herz der Antriebe hinein, jede Dauer und Kontinuität des Höheren im Menschen hängt zuletzt von ihnen ab.“393 Gehlens theoretischer Ansatz liefert eine Erklärung für 392 393 Berger und Luckmann 1966, S. 58 Gehlen 1956, S. 8 201 die Notwendigkeit kognitiver Evolution: die physiologische Unangepasstheit an Umweltbedingungen. Aus der grundlegenden Aussage vom „Mängelwesen“ des Menschen, das heißt seiner Unangepasstheit und Unspezialisiertheit, kurz seiner physiologischen Unzulänglichkeit im Hinblick auf die Anforderungen der natürlichen Umwelt, leitet Gehlen die Notwendigkeit ab, eine künstliche Umwelt zu schaffen. Zu diesen Unzulänglichkeiten des Menschen gehört auch das weitgehende Fehlen verhaltensleitender Instinkte. Berger und Luckmann weisen darauf hin, dass beim Menschen anstatt eines instinktorientierten Verhaltens ein gewohnheitsfolgendes Handeln einsetzt, das prinzipiell eine ähnliche Funktion hat: „Alles menschliche Tun ist dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen. Jede Handlung, die man häufig wiederholt, verfestigt sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von Kraft reproduziert werden kann und dabei vom Handelnden als Modell aufgefasst wird. Habitualisierung in diesem Sinne bedeutet, dass die betreffende Handlung auch in Zukunft ebenso und mit eben der Einsparung von Kraft ausgeführt werden kann.“394 Das gewohnheitsmäßige Handeln „befreit den Einzelnen von der ‚Bürde der Entscheidung‘ und sorgt für psychologische Entlastung, deren anthropologische Voraussetzung der ungerichtete Instinktapparat des Menschen ist. Habitualisierung sorgt für eben die Richtung und Spezialisierung des Handelns, die der biologischen Ausstattung des Menschen fehlt, und baut auf diese Weise Spannungen ab, welche von gerichteten Trieben kommen.“395 Institutionen bringen eine Bedürfnisentlastung mit sich, da sie mit Hilfe des gesellschaftlichen Mechanismus der Arbeitsteilung und der damit verbundenen Spezialisierung im Bereich der gesellschaftlichen Arbeit zu einer permanenten Befriedigung der Bedürfnislage beitragen können. Durch die „stationäre Erfüllung der Primärbedürfnisse und die so eintretende Affektentlastung und Trivialisierung derselben, wenn sie ohne eigenes Handlungsrisiko der Erfüllung sicher sein können“396, gewinnen die Menschen Handlungsfreiheit und Sicherheit. Dieser Zustand 394 Berger und Luckmann 1966, S. 56 Berger und Luckmann 1966, S. 57 396 ebd. 395 202 begründet nach Gehlens Ansicht den kulturellen Fortschritt, denn die Freisetzung von Handlungsenergie, die Entlastung von der tagtäglichen Mühsal der Nahrungssuche, schafft Freiräume für die Kultivierung neuer Bedürfnisse: „Daher auch der erstaunliche Aufschwung der Kultur, sobald Pflanzenbau und Tierzucht den Menschen von der Nahrungssuche freisetzten, und zwar in doppelter Richtung: zur Intensivierung der inneren Mannigfaltigkeit der nunmehr sich spezialisierenden Arbeit und zur Entwicklung neuer Bedürfnisse nach Dauerabsättigung der primären.“397 Gehlen argumentiert, dass die Arbeitsteilung in der Folge der gesellschaftlichen Prozesse, die zur Konstituierung von Institution beitragen, die Basis für eine kulturelle Fortentwicklung ist. Diese Prozesse sind ökonomisch motiviert. Dieser Gedanke reflektiert dieselbe Parallelität von ontogenetischer und gesellschaftlicher Entwicklung, wie sie von Mead diskutiert wurde. Mead hat jedoch einen Schwerpunkt auf die kognitive Evolution des Menschen gesetzt, ohne die Voraussetzungen dieser Entwicklung weiter zu diskutieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Entwicklung menschlicher Gesellschaften ist von verschiedenen Autoren mit jeweils unterschiedlichem Vokabular angesprochen worden. Luhmann spricht z.B. von der „Reduktion der Varietät des Verhaltens“398, die Institutionen bewirken. Abels spricht von der „Produktion gesellschaftlicher Ordnung“399 im Zusammenhang mit Institutionalisierungsprozessen. Habermas schließlich sieht die Funktion von Institutionen in der Konstituierung „weltstabilisierender Deutungssysteme“, deren Grundfunktion darin bestehe, „Chaos zu vermeiden, das heißt Kontingenzen (zu) überwinden.“400 Institutionen gewinnen also eine besondere Bedeutung, indem sie eine Stabilisierung der Formationen menschlicher Sozialität bewirken. Ad 2: Die Beeinflussung der Menschen in Institutionen entsteht dadurch, dass Institutionen Verhaltensregularien vorgeben. Habermas hat sie als „Imperative“ bezeichnet, und das Hinein397 Gehlen 1956, S. 38 vgl. Luhmann 1975, S. 31 399 vgl. Abels 1997b, S. 91 400 vgl. Habermas 1973a, S. 163 398 203 wachsen in gesellschaftliche Institutionen ist das Erkennen und Verinnerlichen dieser Verhaltensregularien. Interessanterweise greift Gehlen bei der Thematisierung dieser Zusammenhänge auch auf die Konzepte Meads zurück: „Das ganze Gruppenspiel (game) ist ein System aufeinander bezogener, an einer bestimmten Aufgabe orientierter Handlungen, wobei jede derselben sich auf die vorweggenommenen Antworten definierter Anderer schon einstellt. Dieses geordnete System möglicher Reaktionen von Partnern und Gegnern wird in Form der ‚Spielregeln‘ abgehoben. Sie sind es, die das Netz von Möglichkeiten des Verhaltens organisieren, und innerhalb dieses Netzes wird die freie Ausnützung der Zufälle erst reizvoll.“401 Wie bereits dargestellt, dient die Situation des game der Vorwegnahme der institutionellen Rollenzusammenhänge des Erwachsenenlebens. Bereits in dieser Konstellation des Systems aufeinander bezogener Handlungserwartungen im kindlichen Gruppenspiel sind die Charakteristiken von Institutionen zu erkennen. Es ist hier besonders typisch, dass das Gruppenspiel eigene Regeln entwickelt, denn: „Jedes Spiel geht um eine Sache, die allerdings innerhalb aller anderen Zusammenhänge gleichgültig wäre. Dieser Sachverhalt ist zu realisieren, und jedes Verhalten, das nicht im Hinblick auf ihn zweckmäßig ist, wird verworfen. Andererseits darf der Sachverhalt nicht mit allen Mitteln erreicht werden, sondern nur innerhalb gegenseitig festgelegter Verhaltensformen. Die Sollgeltung der Regeln bezieht ihre Kraft aus beiden Quellen: von der Sache her, und von der Rücksicht auf die Mitwirkung und Gegenwirkung der Anderen. Insofern ist das Spiel ein Kleinmodell institutionalisierter gesellschaftlicher Kooperation zu Zwecken überhaupt, nur dass sich Affekte und Fähigkeiten ausleben können, die beim ‚Ernst der Arbeit‘ unter Hemmung gesetzt sind.“402 Gehlen weist also daraufhin, dass es geradezu typisch für eine Institution ist, dass Regeln aufgestellt werden und das Gesollte definiert wird. Dies gilt auch dann, wenn die Institution so temporär wie ein Gruppenspiel ist. Ihre Existenz basiert auf diesen Sollgeltungen und diese manifestieren sich letztlich in konkreten Verhaltenserwartungen mit der negativ definierten Möglichkeit 401 402 Gehlen 1956, S. 42 ebd. 204 zur Abweichung. Nur im Rahmen der Institution ist es möglich (wenn überhaupt), leiblich definierte Verhaltensdispositionen, institutionell gefiltert, in legitimes Handeln zu transformieren. Gehlen nähert sich dem Problem der Internalisierung aus seiner anthropologischen Sicht mit dem Hinweis, dass alle Sozialformen auf sekundäre Weise „den primär versagten Automatismus des Verhaltens gestatten“403, denn: „Alles gesellschaftliche Handeln wird nur durch Institutionen hindurch effektiv, auf Dauer gestellt, normierbar, quasi-automatisch und voraussehbar.“404 Und nur in diesem Rahmen darf das Individuum seine Bedürfnisse verwirklichen. Die psychologische Entlastung, von der Gehlen spricht, von der auch Berger und Luckmann als „Einsparung von Kraft“ bei der Reproduktion menschlichen Modellhandelns sprechen, hat jedoch ihren Preis, denn alle Mitglieder der Institution haben sich nach den allgemeinen Verhaltensanforderungen der Institution zu richten, von ihnen wird ein individueller Beitrag erwartet, dessen Eigenart arbeitsteilig determiniert ist. 7.5. Institutionen und Unterdrückung Bergers und Luckmanns Erklärung für das Entstehen von Institutionen auf der Grundlage gesellschaftlicher Arbeitsteilung beinhaltet die elementare Orientierung an den Handlungsperspektiven der Individuen und verortet die Entstehung und Existenz gesellschaftlicher Institutionen im Handlungskontext der Menschen im Sinne eines menschlichen Produktes, das auch ständigen Modifikationen unterliegt. Wie bereits erwähnt, beziehen sich Berger und Luckmann aus heuristischen Gründen auf die elementarste Form menschlicher Gesellschaftlichkeit, die Situation, dass zwei menschliche Individuen von Grund auf ein Zusammenleben organisieren müssen, und zwar in einer kulturell völlig unbeeinflussten Umgebung. Berger und Luckmann gehen davon aus, dass bereits in dieser elementaren Situation das Konzept der Arbeitsteilung wirkt, das heißt, dass die Individuen, je nach ihrem Vermögen, je nach ihrer Position in der Dyade in unterschiedlicher Weise zu der Entwicklung ihres Zusammenlebens beitragen. So haben es auch Robinson und Freitag getan. 403 404 Gehlen 1956, S. 47 Gehlen 1956, S. 48 205 Berger und Luckmann beschreiben, wie aus einer anfänglich, nur als Übereinkommen zweier Personen entstandene Verfahrensweise, die sich im alltäglichen Geschehen bewährt hat, eine Gewohnheit wird. Diese wird dann zur Institution, wenn sie, unabhängig von ihren Schöpfern, die aus dieser gewohnheitsmäßigen Handlung noch einen unmittelbaren Nutzen ziehen konnten, auch für andere Individuen, etwa ihre Kinder und Enkel, handlungsleitend wird. Da der unmittelbare Zweck einer institutionellen Regelung für die nachfolgenden Generationen nicht erkennbar ist, die institutionelle Regelung gegebenenfalls sogar für das einzelne Individuum nachteilig ist, nämlich da, wo sie ein Verbot beinhaltet oder eine Privilegierung einer anderen Gruppe, der das Individuum nicht angehört, bedürfen die Institutionen einer zusätzlichen Legitimierung und auch eines Sanktionsapparates zur Gewährleistung ihrer Durchsetzung. So schreiben Berger und Luckmann: „Auch die Entwicklung besonderer Kontrollmechanismen wird nötig, wenn Institutionen Geschichtlichkeit und Gegenständlichkeit gewonnen haben. Sobald sie nämlich dadurch Wirklichkeit geworden sind, entsteht auch schon die Möglichkeit der Abweichung von den institutionell ‚programmierten‘ Handlungsabläufen, die sich von der konkreten Relevanz ihres Ursprungs abgelöst haben. Um das einfacher zu sagen: man weicht eher von Programmen ab, die einem andere aufgestellt haben, als von solchen, an deren Aufstellung man selbst beteiligt war. Mit der neuen Generation erhebt sich das Problem ihrer Willfährigkeit, und ihre Einfügung in die soziale Ordnung macht Sanktionen notwendig. Die Institutionen stellen dem Individuum gegenüber den Anspruch auf Autorität und müssen ihn stellen, ungeachtet des subjektiv gemeinten Sinnes, den der Einzelne mit einer Situation verbindet.“405 Der Zweck, den eine Institution verfolgt, ist oft den ursprünglichen und leiblich definierten Impulsen des Individuums entgegengerichtet. Oft kann es auch sein, dass institutionelle Regelungen als ungerecht oder diskriminierend empfunden werden, was typisch für die Außenseiterthematik dieser Arbeit erscheint. Denn was sich ursprünglich, im Rahmen des direkten Praxisbezuges bewährte, da wo Gewohn405 Berger und Luckmann 1966, S. 66f. 206 heiten zur Vereinfachung des Alltags beitrugen, verselbständigt sich und gewinnt eine Rechtfertigung aus sich heraus. Dann generieren Institutionen aufgrund ihrer Eigengesetzlichkeit jeweils eigene „Sollgeltungen“ des Handelns ihrer Mitglieder. Gehlen schreibt, dass „je ganz konkrete Einstellungen, Gesinnungen, Handlungsarten und Sachbereiche (...) jeweils von innen und außen her als verpflichtend erlebt (werden), und dies ist eine Funktion der Institutionen selbst.“406 Nicht immer folgen diese Verpflichtungen einer rational nachvollziehbaren Begründung, bzw. dienen einer Optimierung des institutionellen Prozesses im Interesse der Menschen, die den Institutionen verbunden sind. Hier wird die zwiespältige Bedeutung des Institutionenprozesses deutlich, denn einerseits ist ihre gesellschaftliche Funktion hervorzuheben: Institutionen induzieren aufgrund ihrer allgemeinen Entlastungsfunktion den gesellschaftlichen Fortschritt. Sie entlasten die Gesellschaftsmitglieder aufgrund arbeitsteiliger Handlungsstrukturen von basalen Handlungserfordernissen. Andererseits verlangen sie von den ihnen unterstehenden Mitgliedern eine Disziplin, eine Bereitschaft des sich Unterordnens und Anpassens an die aus dem Zweck der Institutionen ableitbaren Sollgeltungen und nicht nur diesen allein. Auf diese Art entwickeln sie eine machtvolle Bedeutung für den gesamten gesellschaftlichen Prozess und auch einen gewaltigen Einfluss auf das Denken und Handeln der in ihnen agierenden Mitglieder. Die Zielsetzung, die die Institution leitet und zu konkreten Handlungserwartungen gerinnt, tritt dem Individuum in ihrer objektiven Faktizität gegenüber, und das Individuum kommt nur in den Genuss der Vorzüge der Institution, wenn es sich ihren Regeln unterordnet. In manchen Fällen haben Institutionen jedoch die Funktion, die ihnen untergeordneten Menschen zu unterdrücken und zu demütigen. 406 Gehlen 1956, S. 41 207 7.6. Institutionen und Identität Einerseits bewirkt der gesellschaftliche Fortschritt die allmähliche Ausdifferenzierung der sozialen Positionen, und die auf diese Art arbeitsteilig organisierten Gesellschaften konstituieren klar definierte Interaktionszusammenhänge, die sich aufgrund von Gewohnheit und ökonomischer Bewährung festigen. Andererseits werden die Mitglieder der Gesellschaft in diesen Institutionen sozialisiert und zwar auf der Grundlage der institutionell vorgegebenen Interaktionsstrukturen. Diese erscheinen objektiv und unantastbar und erzeugen, da sie allgemeinverbindlich sind, ein Kollektivbewusstsein, dessen Wahrung und Reproduktion durch das Individuum moralisch hoch bewertet ist. Göhler schreibt daher: „Soziale Institutionen sind relativ auf Dauer gestellte, durch Internalisierung verfestigte Verhaltensmuster und Sinngebilde mit regulierender und orientierender Funktion.“ Das Kennzeichnende an Institutionen ist „ihre Stabilität und, daraus folgend, ihre stabilisierende Wirkung.“ Diese entfalten sie, „weil sie dem menschlichen Zusammenleben über die Situationsbedingtheit hinaus eine Form geben, die die Handlungen der anderen bis zu einem gewissen Grade erwartbar und in den Gemeinsamkeiten erkennbar macht.“407 Sozialisationsprozesse induzieren die Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte, was wiederum, so lehren es alle Identitätstheorien, zu einer festen Handlungsorientierung führt. So möchte ich diesen Abschnitt zunächst abschließen mit einem neuerlichen Zitat Göhlers, welches als eine Zusammenfassung meiner bisherigen Überlegungen aufgefasst werden kann: „Die Bürger finden ihre gemeinsame Identität in einem jeweils situativ aktualisierten geistigen Zusammenhang, der ebenso wohl rational wie emotional und affektiv bestimmt ist. Das ist das ‚Werterlebnis‘, welches erst die geistigen Zusammenhänge herstellt, aus denen soziale Gemeinschaften bestehen; dieses Werterlebnis bewirkt politische Integration und konstituiert somit erst eine politische Einheit. In den politischen Institutionen ist es, soweit überhaupt möglich, auf Dauer gestellt.“408 Menschen, die Institutionen angehören, markieren ihre Zugehörigkeit aufgrund der Reproduktion der die Institution 407 408 Göhler 1997 S. 15 Göhler 1997, S. 35 208 tragenden Wertstrukturen. In dem Ausmaß ihrer Autonomie drückt sich auch ihr Verhältnis zur Macht aus: die über ökonomisches und kulturelles Kapital Verfügenden, die Herrschenden, haben sogar die Macht, identitätsprägende Wertsetzungen für andere vorzunehmen. Dies geschieht am anschaulichsten in politischen Institutionen. 209 8. Macht Hinsichtlich des von Durkheim geprägten Begriffes des Kollektivbewusstseins schreibt Abels, dass es sich dabei um „festliegendes ‚Wissen‘ über gesellschaftliche Erscheinungen und Beziehungen zwischen Individuen in einer konkreten Gesellschaft“ handelt.“409 Dieses Bewusstsein als Folge von Prozessen der Verinnerlichung gesellschaftlicher Sollgeltungen produziert letztlich einen Zustand gesellschaftlicher Ordnung. Das Kollektivbewusstsein (oder auch der „generalisierte Andere“ nach der Theorie Meads) ist als Resultat gesellschaftlicher Sozialisationsprozesse sowohl ontogenetisch als auch phylogenetisch bedeutsam: es beinhaltet die aktive Reproduktion und Bejahung gesellschaftlicher Sollgeltungen. Es ist, ich wiederhole es an dieser Stelle, für die Entstehung moralischer Strukturen verantwortlich. Diese wiederum sind Grundlage und Folge für Institutionalisierungen, wenn sie nicht selbst Institutionen sind. So schreibt Gehlen: „Diese je ganz konkreten Einstellungen, Gesinnungen, Handlungsarten und Sachbereiche werden jeweils von innen und außen her als verpflichtend erlebt, und dies ist eine Funktion der Institutionen selbst.“410 Sie determinieren die Handlungsorientierungen der Gesellschaftsmitglieder, da die Möglichkeit sozialer Sanktionen in ihrem Kontext steht. Und selbst wenn diese Sanktionen nicht in manifester äußerer Form zum Tragen kommen, bewirkt die Internalisierung gesellschaftlicher Sollgeltungen als Folge der Sozialisation, dass Institutionen ihren sozialen Einfluss behalten, selbst wenn dies keine äußere Sanktionsmacht permanent gewährleistet. Damit einhergehend zeigt sich eine Festigung sowohl der Gesamtgesellschaft als auch der individuellen Persönlichkeit. Berger und Luckmann sind auf diesen theoretischen Zusammenhang der Bedeutung von Institutionen eingegangen: „Durch die bloße Tatsache ihres Vorhandenseins halten Institutionen menschliches Verhalten unter Kontrolle. Sie stellen Verhaltensmuster auf, welche es in eine Richtung lenken, ohne ‚Rücksicht‘ auf die Richtungen, die theoretisch möglich wären. Dieser Kontrollcharakter ist der Institutionalisierung als solcher eigen. 409 410 Abels 1997b, S. 86 Gehlen 1956, S. 41 210 Er hat Priorität vor und ist unabhängig von irgendwelchen Zwangsmaßnahmen, die eigens zur Stütze einer Institution eingesetzt werden oder worden sind. (...) Die primäre soziale Kontrolle ergibt sich (...) durch die Existenz von Institutionen überhaupt. Wenn ein Bereich menschlicher Tätigkeit institutionalisiert ist, so bedeutet das eo ipso, dass er unter sozialer Kontrolle steht. Zusätzliche Kontrollmaßnahmen sind nur erforderlich, sofern die Institutionalisierungsvorgänge selbst zum eigenen Erfolg nicht ganz ausreichen.“411 Die Kontrolle der Gesellschaftsmitglieder aufgrund von Institutionen, die als von außen induzierte Reduktion individueller Handlungsoptionen der Individuen erscheint, die jedoch auch bei den sozialisierten Individuen als internalisierte Identitätskomponente das Handeln des Individuums beeinflusst, dient der Verwirklichung gesellschaftlicher Werte. Habermas hat diesen Gedanken, in Rezeption der Meadschen Sozialisationstheorie aufgegriffen und dabei folgendes angemerkt: „Die Autorität des ‚verallgemeinerten Anderen‘ unterscheidet sich von einer allein auf die Verfügung über Sanktionsmittel gestützten Autorität dadurch, dass sie auf Zustimmung beruht. Sobald A die Gruppensanktionen als seine eigenen von ihm selbst gegen sich gerichteten Sanktionen betrachtet, muss er seine Zustimmung zu der Norm, deren Verletzung er auf diese Weise ahndet, voraussetzen. Anders als sozial verallgemeinerte Imperative besitzen Institutionen eine Geltung, die auf die intersubjektive Anerkennung, auf die Zustimmung der Betroffenen zurückgeht.“412 Da die äußere Kontrolle, die die Institutionen ihren Mitgliedern „antun“, zumeist von jenen als beeinträchtigend, unwillkommen empfunden wird, bedarf sie zu ihrer Implementierung entweder der Bereitschaft der Gesellschaftsmitglieder, ihre Existenz zu akzeptieren, oder besonderer Machtmittel. Die Institutionen, die dies in besonderer Weise leisten, sind politische Institutionen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Macht im Verhältnis zu den Adressaten ihres Funktionszusammenhanges ausüben. Macht bedeutet „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durch411 412 Berger und Luckmann 1966, S. 58f. Habermas 1981, S. 63 211 zusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“413 Macht kann zwischen Individuen und Gruppen auftreten. In den Fällen, in denen Macht institutionalisiert ist, wandelt sie sich zu Herrschaft. Der Herrschaftsbegriff wird von Weber auch definiert, und zwar als die „Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.“414 Die Ausübung von Macht im Rahmen bestimmter Herrschaftsverhältnisse gründet auf den Werten und Normen, die die Herrschenden mit den Beherrschten gemeinsam haben, da sie letztlich an das Vorhandensein gesellschaftlicher Strukturen geknüpft ist. Somit kann die Ausübung von Macht im Rahmen bestimmter Herrschaftsverhältnisse von den Beherrschten als legitim angesehen werden. Berthold formuliert daher folgenden Zusammenhang: „Aus Webers Definition ergibt sich, dass Herrschaft eine gegenseitige Willensbeziehung ist, die das Befehlenwollen des Herrn ebenso einschließt wie das Gehorchenwollen der Beherrschten. Herrschaft kann mit anderen Worten auch als eine Machtchance definiert werden, die durch ein relativ hohes Maß an Erwartungssicherheit in Bezug auf den Gehorsam eines angebbaren Kreises von Personen spezifiziert ist.“415 Ich möchte anfügen, dass das Maß des Gehorchenwollens der Beherrschten in einem Verhältnis der Konvergenz zu dem Maß des Legitimitätserlebens der Beherrschten steht. Herrschaft, die auf Legitimität gründet, kann weitgehend darauf verzichten, zum Zwecke ihrer Absicherung Gewaltmittel zu benutzen. Es ist gerade ein wesentlicher Zug institutionalisierter Herrschaftsverhältnisse, dass sie in der Regel auf den Einsatz von Machtmitteln verzichten können, da ihr Machtanspruch aufgrund der Sozialisationswirkungen auf die Gesellschaftsmitglieder a priori unangefochten erscheint. Wenn keine allzu krassen Ungerechtigkeiten existieren, und wenn die Gesellschaftsmitglieder keine materielle Not erleben, sind die Machtstrukturen relativ gut abgesichert. Die Erfahrung der Legitimität wird insbesondere gestützt, wenn die Herrschaft durch eine Rationalität des Verhältnisses von Herrschenden zu Beherrschten gekennzeichnet ist und damit eine Berechenbarkeit der Interaktions413 Weber 1922, S. 28f. ebd. 415 Berthold 1997, S. 350f. 414 212 zusammenhänge, etwa wie in einem Rechtsstaat, begründet oder, wie Luhmann sagt, eine Reduktion der Kontingenzen der gesellschaftlichen Verhältnisse zeitigt. Dies gilt selbst dann, wenn die als legitim erlebten Herrschaftszusammenhänge aus den Gesichtspunkten einer „objektiven Moral“ (wenn es sie dann wirklich gäbe) als angreifbar erscheinen. Webers Machttheorie steht in einem scheinbaren Gegensatz zur Machttheorie von Hannah Arendt. Macht ist für Arendt die „menschliche Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammen zu schließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln.“416 Im Gegensatz zu dem Weberschen Ansatz, der ein individuelles, „transitives“417 Machtverständnis impliziert, begreift Arendt Macht als eine soziale Konstruktion, als etwas, „das sich immer nur im Besitz der Gruppe befindet“418 und aus diesem Umstand letztlich seine Legitimität bezieht. Da dieses Machtkonzept selbstbezüglich ist, das heißt davon ausgeht, dass die Herrschenden gleichzeitig die Beherrschten sind und einzeln agierende Machthaber von der Gruppe lediglich ermächtigt wurden, wird von der politischen Soziologie als „intransitiv“ bezeichnet. Diese Machtkonzept konvergiert mit dem Konzept legitimer Herrschaft im Sinne Webers. In beider Gegensatz steht die Willkür und Gewalt im Rahmen von Herrschaftsverhältnissen, die von ihren Objekten als illegitim erlebt werden. Illegitime Herrschaft ist somit prekär, weil es dem Herrschenden an Autorität mangelt. In diesem Fall kann die Chance zur Gehorsamsbereitschaft auf Gewalt beruhen. Den Gewaltbegriff benutzt auch Hannah Arendt, um das Gegenteil von legitimer Herrschaft und Macht zu explizieren. Ihre Differenzierung lautet wie folgt: „Politisch gesprochen genügt es nicht zu sagen, dass Macht und Gewalt nicht dasselbe sind. Macht und Gewalt sind Gegensätze: wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt tritt auf den Plan, wo Macht in Gefahr ist; überlässt man sie den ihr 416 Arendt 1970, S. 45 hierbei beziehe ich mich auf die Ausführungen von Speth und Buchstein in Göhler 1997: „Transitiv ist eine Machtbeziehung dann, wenn bei ihr zwischen einem Akteur und einem Adressaten unterschieden werden kann, also wenn es ein feststellbares Subjekt gibt, das Macht auf einen anderen Akteur als Objekt ausübt.“ (S. 225 a.a.O) 418 Berthold 1997, S. 351 417 213 innewohnenden Gesetzen, so ist das Endziel, ihr Ziel und Ende, das Verschwinden von Macht.“419 Mit Webers Terminologie lässt sich dieser Zusammenhang mit dem Schwinden von Legitimität und Autorität und dem zunehmenden Einsatz von Gewaltmitteln zur Herbeiführung des „Gehorchenwollens“ durch die Beherrschten erklären. Die soziologische Konzeption legitimer Herrschaft à la Weber und die Machtkonzeption à la Arendt bedeutet keinesfalls die Unmöglichkeit der Ausgrenzung von Individuen, also das gesellschaftliche Außenseitertum. Im Unterschied zu illegitimen Herrschaftsformen (Macht, die nicht auf Autorität beruht (Weber)) und Gewalt (Arendt) kann es auch unter der Bedingung von Herrschaft (Weber) und Macht (Arendt) Ausgrenzung und Stigmatisierung geben. So schreibt Berthold: „Macht kann durchaus auch Gewalt hervorbringen und sich ihrer bedienen. Die Gewalt wird dann aber von einer Autorität ausgeübt, hinter der die Bürger stehen.“420 Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang nur, wie Machtverhältnisse ihre Zustimmung sichern können, obwohl sie unter Umständen zu Diskriminierung und (subjektiv empfundenen) Unrecht führen kann. 8.1. Die Macht der Symbole (P. Bourdieu) Bourdieu hat in seinem Werk die Frage nach der Legitimität gesellschaftlicher Macht gestellt. Dem gesellschaftlichen Phänomen der Macht hat er sich in analytischer Weise genähert und sie zunächst mit seiner Unterscheidung der gesellschaftlich relevanten Kapitalien (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) genauer beschrieben. Diese Kapitalformen sind gleichsam das Substrat, aus dem Macht entstehen kann. Ihnen gemeinsam ist jedoch, dass sie, um wirksam zu werden, in symbolisches Kapital transformiert werden müssen. Erst in der Form des symbolischen Kapitals können die anderen drei Kapitalarten von der sozialen Umwelt wahrgenommen werden. Dazu zählen beispielsweise im Fall des ökonomischen Kapitals bestimmte Insignien eines privilegierten Lebensstils, im Fall des kulturellen Kapitals der Nachweis von Bildungspatenten, im Fall 419 420 Arendt 1970, S. 57 Berthold 1997, S. 352 214 des sozialen Kapitals der Nachweis des Besitzes wertvoller sozialer Beziehungen und Mitgliedschaften. Schwingel hebt daher hervor, dass legitime gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung ein symbolisches Kapital darstellt. Nebenbei lässt sich daraus ableiten, dass der Besitz symbolischen Kapitals eine Teilhabe an gesellschaftlichen Wertsystemen voraussetzt; und gesellschaftliche Außenseiter, die gegen bestimmte Wertdispositionen verstoßen, sind genau diejenigen, die in der Tendenz über geringes symbolisches Kapital verfügen. Die Konstitutionsbedingungen symbolischen Kapitals sind nicht im Zusammenhang mit der Knappheitsbedingung zu sehen, die für andere Kapitalsorten maßgeblich ist: „Vielmehr gehorcht das symbolische Kapital einer Logik der Hervorhebung und Anerkennung.“421 Bourdieus Theorie ist eine Theorie der sozialen Kämpfe, und wenn die Kämpfe um ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital stets mit der Zielsetzung geführt werden, den Besitz an der jeweils erwünschten Kapitalsorte zu vermehren, geht es bei den Kämpfen im Zusammenhang mit dem Besitz symbolischen Kapitals darum, „wer die Benennungsmacht innehat und damit eine neue Weltsicht schaffen kann, denn diese Perspektivsetzung bestimmt zugleich den Boden der Auseinandersetzung, auf dem konkurrierende Sinnstiftungen operieren müssen. Das strategische Handeln der sozialen Gruppe vollzieht sich um hierarchische Positionen im Sozialsystem, um Anerkennung und um gesellschaftliche Ehre.“422 Um eine bestimmte dominierende Sinngebung durchsetzen zu können, bedarf es des Besitzes einer oder mehrerer gesellschaftlich relevanter Kapitalien, die sich jedoch nur dann zu einem herrschaftbegründenden gesellschaftlichen Faktor wandeln können, wenn sie Anerkennung finden. So schreibt Speth: „Das symbolische Kapital ist ökonomisches oder kulturelles Kapital, sobald es ‚anerkannt‘ und ‚erkannt‘ ist. (...) Dieses erworbene und anerkannte Kapital kann sich als Macht realisieren, wenn es Konstitutionsakte vollzieht.“423 Diese symbolischen Konstitutionsakte resultieren aus den Prozessen der Bewertung bestimmter Eigenschaften von Gruppen oder 421 Schwingel 1995, S. 88 Speth 1997, S. 336 423 Speth 1997, S. 340 422 215 Individuen, die darauf gerichtet sind, deren Kapitalbesitz so zu transformieren, dass die Durchsetzung oder Wahrung der Interessen in der Folge gesellschaftlicher Legitimationsprozesse gewährleistet ist. Diese Erkenntnis liegt der Marxschen Revolutionsidee zugrunde, wonach die Nicht-Besitzenden, das Proletariat, die Macht nicht gewinnen, solange „sich das Proletariat seiner Lage nicht bewusst wird, (denn solange, Anmerkung des Verfassers) ist es nur eine ‚Klasse an sich‘. Es wird sich der Tatsache nicht inne, dass das Prinzip der ungleichen Verfügung über die Produktionsmittel nicht nur Besitzer und Nichtbesitzer gegenüberstellt, sondern dass es Interessen gegenüberstellt, die in scharfem Gegensatz zueinander stehen. Erst wenn es sich der damit gegebenen Verelendung und Unterdrückung bewusst wird und sich solidarisiert, wird es zur ‚Klasse für sich‘, erhebt sich und stürzt in einem revolutionären Klassenkampf die Verhältnisse um.“424 Um diese Überlegungen zu ergänzen, ist noch anzumerken, dass das Proletariat, als Prototyp der Beherrschten, potentieller Besitzer ökonomischen Kapitals ist; seine maßgebliche und im Wirtschaftsprozess unverzichtbare Ressource ist seine Arbeitskraft425. Dieses ökonomische Kapital an sich ist jedoch bei der Durchsetzung spezifischer Interessen vergleichsweise wirkungslos, wenn es nicht auf einer anderen Ebene, einer symbolischen, seine Repräsentation findet. Schwingel schreibt daher: „Die – sozialstrukturell bedingten – Schwierigkeiten, mit denen die beherrschten Gruppen und Klassen konfrontiert sind in ihrem Versuch, sich selbst öffentlich bemerkbar zu machen, der normativen Kraft des Faktischen entgegenzutreten426 und den Zirkel der (symbolischen) Reproduktion zu durchbrechen, sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass ihnen hierzu nicht nur die materiellen, sondern ebenso die symbolisch-kulturellen Mittel fehlen. Dies hat zur Folge, dass die dominierten Klassen, um einen politisch effektiven Kampf führen zu können, auf Verbündete angewiesen sind, die ihnen die notwendigen (symbolischen) Mittel zur Durchsetzung einer Weltsicht (und 424 Abels 2001, Band 1, S. 271 im Rahmen der Globalisierung ist der Wert der Arbeitskraft jedoch gesunken. 426 hier ist wohl gemeint, dass die Beherrschten in ihrer aktuellen Situation sich (noch) nach den normativen Vorgaben der Herrschenden richten müssen. 425 216 also zur Artikulation bisher unausgesprochener Interessen) zur Verfügung stellen, die sich von der eingelebten, die symbolischen (und folglich materiellen) Verhältnisse stabilisierenden Sicht grundlegend unterscheidet.“427 In der Theorie Bourdieus sind diese Verbündeten die Intellektuellen, die als Inhaber kulturellen Kapitals zwar auch zu den Herrschenden gehören, aber innerhalb dieser Gruppe als „beherrschte Herrschende“ wiederum ein Interesse an der Überwindung bestehender Herrschaftsverhältnisse haben können. Potentiell vorhandene Machtstrukturen erhalten mit Hilfe symbolischen Kapitals die Möglichkeit, sich zu entfalten, und den Glanz der Legitimität. So schreibt Schwingel in Rezeption der Theorie Bourdieus: „Die symbolische Macht zeitigt (...) einen Legitimierungs- und Verklärungseffekt, der (...) faktische Privilegien garantiert. (...) Die Eigenwirkung von symbolischer Macht besteht also, allgemein gesprochen, darin, dass sie einer beliebigen (ökonomischen, kulturellen oder sonstigen) objektiven Macht eine spezifische (...) Anerkennung verschafft, indem sie die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse mittels symbolischer Transfigurationsstrategien zu ‚natürlichen‘ Verhältnissen verklärt und sie so in ihrer Kontingenz, soll heißen: Willkür, unkenntlich macht.“428 Und weiter: „Symbolische Macht (...) verschleiert die gesellschaftliche Bedingtheit (der symbolischen Verhältnisse, Anmerkung des Verfassers) und macht dadurch (besonders, wenn auch nicht ausschließlich: die Beherrschten) vergessen, dass die betreffende Ordnung veränderbar ist.“429 Hier erkenne ich eine theoretische Schwäche des Arendtschen Machtkonzeptes: die Zustimmung der Machtobjekte allein kann Machtausübung meines Erachtens nicht generell legitimieren bzw. amnestieren. Unrecht, also „Gewalt“ im Sinne Arendts, kann auch dann vorliegen, wenn die Machtobjekte nicht die geringste Bereitschaft aufweisen, die Machtverhältnisse zu verändern, wenn sie also durchaus mit vorwaltenden Wertdispositionen der Gesellschaft, in der sie leben, einverstanden sind. Die legitimierende Kraft des Symbolischen ist eine erstaunliche Ordnungsqualität menschlicher Gesellschaft. Sie wirkt sich 427 Schwingel 1993, S. 157 Schwingel 1993, S. 105 429 Schwingel 1993, S. 106 428 217 selbst dann aus, wenn (legitime) Machtzustände bzw. Herrschaftsverhältnisse dazu führen, dass einzelne Individuen bzw. Gruppen unter den jeweiligen Ordnungsverhältnissen zu leiden haben, ja sogar bereitwillig und klaglos leiden, weil sie den maßgeblichen Herrschafts- bzw. Machtverhältnissen ein Gehorchenwollen und Einverständnis entgegenbringen, das ihre Lage letztlich untermauert. 8.2. Die symbolisch erzeugte Legitimität von Ausgrenzung Im Folgenden nehme ich Bezug auf eine Studie von Elias und Scotson, die die Beobachtungen und die daraus resultierenden Schlüsse über das Zusammenleben in einer kleinen englischen Gemeinde referiert, deren Besonderheit es war, dass sie aus zwei Teilen bestand. Der eine, ältere Teil der Gemeinde („Dorf“), war historisch gewachsen und mit einer homogenen Bevölkerungsstruktur, deren Angehörige seit mehreren Generationen in Folge in diesem Ort lebten, ausgestattet. Sie besaßen die sozialen Schlüsselpositionen in der Kommunalpolitik, im kirchlichen Leben, im kulturellen und Vereinsleben. Der andere Teil des Ortes („Siedlung“) entstand in der Zeit nach dem Krieg. Aufgrund der Ansiedlung neuer Fabriken sind viele Menschen aus größeren Städten hierher gezogen. Diese Gruppe war sehr heterogen und hatte nach Elias’ und Scotsons Beobachtung keinerlei Teilhabe an den sozialen und kulturellen Aktivitäten in dem Ort. Elias und Scotson konnten bei ihren Untersuchungen feststellen, dass die Gruppe der etablierten Dorfbewohner die Reihe gegen die Zugewanderten schlossen und deren Mitglieder als Menschen geringeren Wertes stigmatisierten. Elias und Scotson führen aus, dass privilegierte Gruppen, die mehr Macht als andere Gruppen besitzen, eine besondere Einstellung zu sich selbst entwickeln, derzufolge sie glauben, gegenüber der unterlegenen Gruppe in besonderer Weise ausgezeichnet zu sein, ein „Charisma“ zu besitzen. Und „in all diesen Fällen können die Machtstärkeren die Machtschwächeren selbst immer wieder zu der Überzeugung bringen, dass ihnen die Begnadung fehle, dass sie schimpfliche, minderwertige Menschen seien.“430 430 Elias u. Scotson 1965, S. 8 218 Elias und Scotson beziehen sich auf Freuds psychoanalytische Theorie, um das Phänomen des Gruppencharisma zu erklären. In Abwandlung der sozialisationstheoretischen Aussagen Freuds, die sich auf die Konstituierung der seelischen Instanzen „Ich“, „Überich“ und ,,Ich-Ideal“ beziehen, postulieren Elias und Scotson ein „Wir-Bild“ und ein „Wir-Ideal“ als Teil des Selbstbildes.431 Kollektive Phantasien können das Selbstbild des Menschen entscheidend prägen. Elias und Scotson verweisen in diesem Zusammenhang auf die Einstellung der Angehörigen ehemals ,,großer Nationen“, die noch einen Teil ihres Selbstwertgefühls aus der Nostalgie an die früheren Zustände ihrer Gesellschaft beziehen. Im Ergebnis folgt daraus die Gleichsetzung von Zugehörigkeit zu einer Nation oder einem Volk mit einem höheren menschlichen Wert. Die Sozialstruktur des Ortes Winston Parva ist von einer zunächst unbegreiflichen Tatsache geprägt: obwohl sich die Bewohner der beiden Hälften der Ortschaft eigentlich überhaupt nicht voneinander in besonderer Weise unterschieden, waren sie dennoch Privilegierte und Außenseiter. So gab es keine Unterschiede der Rasse oder Hautfarbe. Auch unterschieden sich die Menschen nicht nach Maßgabe ihrer ethnischen Zugehörigkeit und Nationalität. Sie unterschieden sich auch nicht nach Maßgabe sozialer Parameter, wie z.B. Beruf, Einkommen, Bildung und Wohnverhältnisse. Im Grunde waren sie alle kleine Leute, die ihr Einkommen mit gewerblicher Arbeit in der ortsansässigen Industrie erzielten. Elias und Scotson stellen daher fest: ,,Als einziger Unterschied blieb, dass die Bewohner des einen Bezirks Alteingesessene waren, die seit zwei oder drei Generationen in der Nachbarschaft lebten, und die des anderen waren Neuankömmlinge.“432 Nach Elias’ und Scotsons Deutung dieser Verhältnisse beruhen Machtdifferentiale allein auf dem unterschiedlichen Organisationsgrad der Gruppen. Die ältere Gruppe hatte ein höheres Kohäsionspotential, das es ihr ermöglichte, die Angehörigen der jüngeren Gruppe von bestimmten zentralen Positionen fern zu halten. Elias und Scotson weisen darauf hin, dass wesentlich für Stigmatisierungsprozesse, die Gruppen einander antun, nicht die Persönlichkeitsstruktur 431 432 vgl. Elias u. Scotson 1965, S. 43f. Elias u. Scotson 1965, S. 10 219 einzelner Individuen ist; maßgeblich ist vielmehr die „Figuration“ der betroffenen Gruppen und die diesem Verhältnis inhärente asymmetrische Machtbalance. Diese ist der entscheidende Faktor, der einer Etabliertengruppe die effektive Stigmatisierung einer Außenseitergruppe ermöglicht. So schreiben Elias und Scotson: ,,Ungehemmte Verachtung, einseitige Brandmarkung von Außenseitern ohne Chance einer Gegenwehr, wie sie etwa für das Verhältnis der höheren Kasten in Indien zu den ,Unberührbaren’ oder für das weißer Amerikaner zu afrikanischen Sklaven und deren Abkömmlingen charakteristisch war, verweist auf ein sehr stabiles Machtgefälle.“433 Das Verhältnis der Etabliertengruppen zu den Außenseitergruppen kann unterschiedlich gestaltet sein. Außenseiter, die für die Etablierten gänzlich ohne Funktion sind, werden vollkommen verdrängt. Wenn jedoch die Außenseitergruppe eine eigenständige Bedeutung für die Etablierten hat, zum Beispiel als ökonomisch ausnutzbares Potential, kann es zu einer Verminderung des Machtgefälles kommen: ,,Je kleiner die Machtdifferentiale werden, desto deutlicher treten andere nichtökonomische Aspekte der Spannungen und Konflikte ans Licht.“434 Dann werden andere Bedürfnisse als die nach Sicherung des Überlebens prävalent - Bedürfnisse nach Emanzipation und Steigerung des Selbstwertgefühles. Dann kann es passieren, dass die ehemals unterlegene Gruppe den „Spieß wendet“ und Gegenstigmatisierungen betreibt. Nach Elias’ und Scotsons Beobachtung vermieden die Angehörigen der alten Familien, wo sie nur konnten, den Kontakt zu den Zuwanderern. Für die Autoren kennzeichnet sich ein solches Verhalten als universale Regelmäßigkeit in Etablierten-Außenseiter-Beziehungen: „die etablierte Gruppe schrieb ihren Mitgliedern überlegene menschliche Eigenschaften zu und schloss alle Mitglieder der anderen Gruppe vom außerberuflichen Verkehr mit ihren eigenen Kreisen aus.“435 Die Autoren weisen darauf hin, dass die Etabliertengruppe dazu neigte, der Außenseitergruppe insgesamt die „schlechten“ Eigen433 Elias u. Scotson 1965, S. 14 Elias u. Scotson 1965, S. 29 435 Elias u. Scotson 1965, S. 9 434 220 schaften der „schlechtesten“ ihrer Teilgruppe zuzuschreiben, um sich selbst nur die besten Eigenschaften der eigenen Elitegruppe anzumaßen. Elias und Scotson nennen dies eine ,,pars-pro-totoVerzerrung“, die stets gute Gründe dafür liefert, die eigene Gruppe als „gut“ anzusehen und die andere als „schlecht“. Derartiges Denken und Handeln wird in der Sozialpsychologie als „Ethnozentrismus“436 bezeichnet. Dabei kommen kaum rationale Motive zum Tragen, um die vermeintliche Überlegenheit der einen und die Unterlegenheit der anderen Gruppe zu begründen. So irrational wie der Akt der Abwertung selbst ist auch die Art, wie im Verhalten der Menschen die Ausgrenzung betrieben wird: „Oft klingen in den bloßen Namen für Gruppen, die sich in einer Außenseiterposition befinden, Untertöne der Minderwertigkeit und Schande mit.“437 So wird die symbolische Dimension der Namensgebung zum Repressionsinstrument der überlegenen Gruppe. In dieser Situation kann die negative Bewertung in das Selbstbild der schwächeren Gruppe eingehen, insbesondere dann, wenn die Wirklichkeit scheinbar dem Vorurteil folgt. Zum Beispiel werden von machtüberlegenen Gruppen die machtschwächeren Gruppen oft als „unrein“ oder „unsauber“ angesehen, was angesichts schlechterer Lebensverhältnisse durchaus als empirisch nachvollziehbarer Sachverhalt bestätigt werden kann. Ähnliches kann man über Bildung und Ausbildung sagen: da, wo Diskriminierung dafür sorgt, dass geringere ökonomische Kapazitäten vorhanden sind, kann auch weniger hochwertige (Aus)bildung gewährleistet werden. Insofern lässt sich feststellen, dass die Angehörigen von Außenseitergruppen weniger Zugang zu adäquater Ausbildung finden, entsprechend geringer qualifiziert sind und sich damit ihr gesellschaftliches Defizit verfestigt, und zwar nicht nur in Bezug auf äußere Parameter wie Einkommen und Sozialprestige, sondern auch in Bezug auf das eigene Selbstbild. Auf der anderen Seite wirkt sich das Gruppencharisma für die Mitglieder der Etabliertengruppe als ein Bündel von Verhaltenserwartungen aus, und der Preis für die Teilhabe an der 436 Zu diesem theoretischen Konzept werden weiter unten eingehendere Erläuterungen folgen. 437 Elias u. Scotson 1965, S. 19 221 „Begnadung“ bedeutet Konformität. Dies ist auch das Exklusivitätskriterium im Sinne Bourdieus. Die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Herrschenden ist gleichfalls symbolisch dokumentiert, und für die Betroffenen gibt es gleichsam eine Verpflichtung, die Charakteristiken des Lebensstils in ihrem Denken und Handeln zu reproduzieren. Wenn ihnen dies gelingt, werden sie als Mitglieder der Etabliertengruppe Akzeptanz finden, was wiederum die Chance beinhaltet, vorhandene Kapitalien zu vermehren und symbolisch zu verwerten. Der Kontakt zu den Außenseitern ist jedoch im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Etabliertengruppe „tödlich“. Elias und Scotson sprachen von „Ansteckung“, wenn ein Mitglied der Etabliertengruppe ein solches Tabu brach. Dann musste dieses Individuum mit der schlimmsten Konsequenz, dem „Schimpfklatsch“ und damit der sozialen Isolation rechnen. Wenn weiter oben versucht wurde, die Dimension des Symbolischen als das Faktum darzustellen, das letztlich gesellschaftliche Macht entstehen lässt, indem es die Kapitalformen hervorhebt, so lässt sich auch in der Studie von Elias und Scotson diese Besonderheit ausmachen. In der dort beschriebenen Situation beruht das Machtdifferential auf der Tatsache, dass soziales Kapital, nämlich die festen und tradierten sozialen Interaktionsstrukturen der Bewohner des „Dorfes“, das sich als höheres Maß an Gruppenkohäsion manifestiert, zu einer symbolischen Macht wandelt, die darin besteht, Exklusivität zu erzeugen. Die anderen Kapitalformen spielen, wie bereits erwähnt, in diesem Setting erstaunlicher Weise keine Rolle. Ein Mechanismus der Exklusivität war die Kontrolle über die Zuweisung von Wohnraum, die eigentlich durch eine öffentliche Wohnbauorganisation erfolgte. Es wurde jedoch seitens der Bewohner des alten Teils des Dorfes dafür Sorge getragen, dass sich in ihrem Teil grundsätzlich keine Fremden ansiedeln konnten. Dies konnte dadurch geschehen, dass die alten Familien darauf achteten, dass im Falle einer frei werdenden Wohnung, etwa wenn die Bewohner gestorben waren, dem Verwalter der Gesellschaft nur Interessierte aus den eigenen Reihen zur Weitervermietung empfohlen wurden. Im Untersuchungszeitraum (1950er Jahre) bot die ortsansässige Industrie 222 noch genügend Beschäftigungsmöglichkeiten, so dass kein Anlass für eine Mobilität der Menschen bestand. Daraus folgt, dass die junge Generation am Ort verbleiben konnte, möglichst im Umfeld der Elterngeneration. So blieb die demographische Struktur des alten Ortsteils über die Jahre hinweg homogen, wohingegen der junge Ortsteil (unter anderem aus Gründen der fehlenden Integration) immer wieder einer Veränderungsdynamik unterlag. Aus ihrer Homogenität heraus kultivierten die Bewohner des alten Ortsteiles eine gemeinsame Lebensweise, einen Habitus, der das Selbstbild und Fremdbild prägte und dazu geeignet war, Mitglieder der Eigengruppe von der Fremdgruppe zu unterscheiden. Bezüglich dieser Beobachtung der Autoren ist meines Erachtens darauf hinzuweisen, dass solche Faktoren symbolischer Macht keinesfalls als stabil und unabänderlich anzusehen sind. Es hätte nur eines Abweichens von der bisherigen Vergabepraxis bedurft, wenn die Wohnbaugesellschaft ihre neuen Mieter aufgrund anderer Kriterien (z.B. ökonomischen Kapitals ?) auswählte. In diesem Fall wäre die Homogenität, das heißt, das soziale Kapital der Dorfbewohner schnell verloren gewesen. Leider haben Elias und Scotson solche Beobachtungen nicht dokumentiert. Unzweifelhaft im Stil der Etikettierungstheorie nehmen Elias und Scotson Bezug auf das abweichende Verhalten der Jugendlichen im „schlechten“ Ortsteil. So verhielt sich die Jugend aus dem schlechten Teil des Ortes auffällig, aufsässig, aggressiv und asozial. Sie rebellierten, um sich zu rächen: „Das Bewusstsein, dass sie die Menschen, von denen sie zurückgewiesen und verfemt wurden, durch ein lärmendes, destruktives und beleidigendes Auftreten ärgern konnten, wirkte als ein zusätzlicher, vielleicht als der hauptsächliche Ansporn, sich ‚schlecht zu benehmen‘.“438 Sie störten bei sozialen Zusammenkünften, die z.B. von der Kirchengemeinde und den Vereinen für die Jugend des gesamten Dorfes eingerichtet wurden. Sie vollbrachten genau die Dinge, die ihnen vorgeworfen wurden, um es denen heimzuzahlen, die sie ihnen vorwarfen. Ihre Aggressionen richteten sich hauptsächlich gegen die Jugendlichen des „besseren“ Ortsteiles, jene, die konform waren und die 438 Elias u. Scotson 1965, S. 24 223 Vorbehalte und Vorurteile gegen die Siedlungsbewohner, die sie von ihren Eltern erlernt hatten, übernommen haben. Nach der Beobachtung der Autoren waren diese in ihrer Herablassung gegenüber den Jugendlichen der Siedlung sogar noch härter und grausamer als die Alten. Dies wird in der Studie damit erklärt, dass das schlechte Beispiel der Siedlungsjugend die Abwehr der jungen Dörfler gegen deren eigene Triebe bedrohte. Der Preis der Konformität in der Etabliertengruppe, also der Preis des „Etabliertenhabitus“, war für die jungen Leute aus dem Dorf hoch. Natürlich hätten auch sie Anlass zur Rebellion gehabt (das Leben in diesem Dorf wird auch für die Jugend der Etabliertengruppe nicht allzu befriedigend gewesen sein), was ihnen jedoch ihre Zugehörigkeit zu der Etabliertengruppe verbat. Es versteht sich von selbst, dass die örtlich ansässigen Agenturen gesellschaftlicher Ordnung und damit sozialer Ungleichheit, das heißt die so genannten „Vertreter des Gesetzes“, den Jugendlichen aus der Siedlung einen wesentlichen Teil ihrer Aufmerksamkeit widmeten. Dieser Umstand zeitigte auch entsprechende Folgen: Es waren hauptsächlich Jugendliche aus der Siedlung, die von der Polizei aufgegriffen und in juristische Verfahren verwickelt wurden, und zwar nicht nur, weil sie möglicherweise mehr angestellt hätten, sondern auch, weil die Siedlungsjugendlichen der Polizei aufgrund ihrer erhöhten Aufmerksamkeit einfach mehr auffielen.439 Wenn man die Situation der Außenseitergruppe in der „TäterOpfer-Semantik“ liest, kommt man zu dem Ergebnis, dass eine Gruppe, die in überlegener Weise über ein bestimmtes Kapital verfügt, welches sich durch symbolische Transformation in gesellschaftliche Macht wandelt, eine unterlegene Gruppe dominiert und ihr ihren Willen aufzwingt. Dies kann sogar als legitim angesehen werden, weil Macht im Sinne Arendts und Herrschaft im Sinne Webers nicht ausschließen, dass es Definitionen gesellschaftlicher Wirklichkeit gibt, die von Minderheiten geteilt werden, die sich mit ihren Interessen letztlich nicht durchsetzen können. Ein weiterer Faktor, der das Verhältnis von überlegener zu unterlegener Gruppe kennzeichnet, liegt darin 439 vgl. Elias u. Scotson 1965, S. 214f. 224 begründet, dass sich bestimmte Kapitalien im Sinne Bourdieus nicht in gesellschaftliche Macht umwandeln können, weil ihnen die dahingehende symbolische Transformation nicht gelingt, dass es also gesellschaftliche Gruppen gibt, die unterlegen, ausgegrenzt und diskriminiert sind, obwohl sie potentiell dazu in der Lage wären, ihre Situation zu verbessern. Hier sei nur an die „Klasse an sich“ im Sinne von Marx erinnert. Die Bewohner der „Siedlung“ von Winston Parva sind ebenfalls eine Klasse an sich, deren Etablierung misslingt, weil sie keine symbolischen Möglichkeiten besitzen, das ihnen eigene Kapital wirksam für sich einzusetzen. In diesem Sinne verstehe ich auch die Bedeutung des Symbolischen in Bourdieus Gesellschaftstheorie: die symbolische Macht ist als derjenige Faktor hervorgehoben, der im Sinne sozialer Konstruktion die maßgeblichen Zuweisungen im System gesellschaftlicher Ungleichheit gewährleistet. So schreibt Göhler: „Es sind die Symbole, und zwar die Herrschenden, welche die gesellschaftlichen Unterschiede, das Oben und Unten bestimmen und sichtbar machen. Insofern geht von ihnen transitive Macht aus, und sie sind das Ergebnis von Kämpfen um ihre Durchsetzung in der Gesellschaft. Einmal herrschend geben sie allerdings eine legitime, von allen geteilte Weltsicht, die den Wahrnehmungsraum der einzelnen Klassen gemeinsam strukturiert. Insofern handelt es sich wiederum um intransitive Macht, und bei Bourdieu ist nun das Ergebnis von symbolischen Kämpfen, was Hannah Arendt als intransitive Macht normativ voraussetzt.“440 Dies bedeutet, dass Machtverhältnisse (selbst dann, wenn sie zur Ausgrenzung Unterlegener führen) grundsätzlich legitimierbar sind, wenn sie symbolisch legitimierbar sind. Seine Entsprechung findet dieser Prozess in der Identität des Individuums bzw. der Gruppe. Wie schon im Zusammhang mit Goffmans Stigmaansatz dargestellt wurde, ist das aus interaktiven Prozessen hervorgegangene Identitätskonzept ein Resultat akzeptierter Identitätszumutungen auf der Seite des Individuums. Willems schreibt zur Identität im Sinne Goffmans daher: „Soziale und persönliche Identität sind ‚zuallererst Teil der Interessen und Definitionen anderer Personen hinsichtlich 440 Göhler 1997, S. 42f. 225 des Individuums‘, das sich auf die objektiven Identitätsschemata und Identifizierungen seiner Umwelten einzustellen hat und das, indem es vor diesem Hintergrund Informationen über sich handhabt, seine persönliche Identität mitformiert.“441 Goffman spricht auch von „gefälliger Anpassung“442, die die Stigmatisierten betreiben. Diese Anpassung erfolgt in der Erwartung, dass die soziale Umwelt ein erfahrbares Stigma „hinnimmt“, und zwar auf der Grundlage gemeinsam geteilter Werthorizonte, die sowohl für das stigmatisierte Individuum (resp. die stigmatisierte Gruppe) als auch für die stigmatisierende Umwelt gelten. Die von Goffman eingehend beschrieben Strategien des „Kuvrierens“ zielen auf nichts anderes als auf Akzeptanz der Ausgrenzung durch die Ausgegrenzten. So wird: „Ich-Identität hauptsächlich als Frage des Erlebens und Verabeitens der Abweichung von Identitätsnormen verstanden.“443 Denn Identität wird zur Balanceleistung, wenn es darum geht, Abweichung, die bei der eigenen Person als solche von dem Individuum erkannt ist, im gesellschaftlichen Prozess auszuhalten. Und nach Goffmans Überzeugung ist im Grunde jedes menschliche Individuum irgendwann im Laufe seines Lebens zu einer solchen Balance gezwungen: „Da jeder gegenüber dem hohen Ideal des erfolgreichen, gut aussehenden, gebildeten, sportlichen, normalgewichtigen und normal verheirateten Bürgers in irgendeinem Punkt versagt, unvollkommen und inferior ist, ist jede Alltagsbegegnung von Konformität und Abweichung überschattet.“444 Die Folge davon ist das „Drama normal-abweichend“ bzw. das ewige „Stigmamanagement“, das das Leben der Außenseiter in unsäglichem Maße verkompliziert und Lebenschancen vernichtet. Aber warum ist das so? Die Antwort kann nur darin liegen, dass die Ich-Identität als das „subjektive Empfinden seiner eigenen Situation und seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, das ein Individuum allmählich als ein Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt“445, darauf hinwirkt, dass die 441 Willems 1997, S. 156 Goffman 1963, S. 31 443 Willems 1997, S. 177f. 444 Hettlage 1991, S. 116 445 Goffman 1963, S. 132 442 226 Fremdattribuierungen, die das Individuum (be)treffen und die auch eine Legitimation aufgrund symbolischer Absicherung bestehender Macht- und Ungleichheitsverhältnisse erfahren, in Eigenattribuierungen seiner selbst übergeführt werden und auf diese Weise eine von der sozialen Umwelt perzipierte Abweichung im Selbstkonzept des sozialisierten Individuums seinen Niederschlag findet und übernommen wird. Im gewissen Sinne sagt das Habituskonzept Bourdieus nichts anderes aus: „Der Habitus ist sozialstrukturell bedingt, das heißt durch die spezifische Stellung, die ein Akteur (...) innerhalb der Struktur gesellschaftlicher Relationen innehat; er formt sich im Zuge der Verinnerlichung der äußeren gesellschaftlichen (materiellen und kulturellen) Bedingungen des Daseins. Diese Bedingungen sind, zumindest in modernen, differenzierten Gesellschaften ungleich (...) verteilt. Von der frühesten Kindheit an, vermittelt über die sozialisatorische Praxis, bestimmen die objektiv vorgegebenen materiellen und kulturellen Existenzbedingungen eines Akteurs, mithin die Lebensbedingungen (...) die Grenzen seines Handelns, Wahrnehmens und Denkens. (...) Obgleich sozial und historisch entstanden, werden die im Habitus inkorporierten Strukturen zur ‚zweiten Natur‘ des Menschen. Dadurch manifestiert sich im Habitus (...) die Liebe zum Schicksal, welche, da sie die gesellschaftliche Not(wendigkeit) zur Tugend macht, die Anerkennung der herrschenden Ordnung zum Ausdruck bringt.“446 Willems spricht in diesem Zusammenhang von einer Selbstzwangapparatur, „die wegen ihrer (zweiten) ‚Natürlichkeit‘ normalerweise der Selbstaufmerksamkeit entgeht und als Ich-Identitätsmoment empfunden wird.“ 447 Willems führt weiter aus, dass das Individuum, das sich bei seinen Handlungen an sozialen Werten orientiert und dementsprechend sich nicht selbstentfremdet fühlt, wenn sein Habitus dabei zum Tragen kommt. Davon sind die Individuen „um mit Bourdieu zu sprechen, eher besessen, als dass sie sie besitzen.“448 Der Selbstzwang wirkt sich demnach so aus, dass das Individuum „zu ‚seinem eigenen Gefängniswärter (wird); dies ist ein fundamentaler Zwang, auch wenn jeder Mensch seine Zelle 446 Schwingel 1995, S. 60ff. Willems 1997, S. 207f. 448 Willems 1997 a.a.O. 447 227 gerne mag.‘ (Goffman 1971, 15).“449 Der letzte Halbsatz verweist darauf, dass das Individuum solche Identitätszumutungen nicht nur erleidet, sondern sogar in die Situation geraten kann, gesellschaftliche Stratifikationsverhältnisse, die zu seinem Nachteil ausfallen, zu schätzen, sein Schicksal sogar zu lieben, wie Bourdieu geschrieben hat. Mit der Frage der Übernahme negativer Selbstkonzepte hat sich auch der Sozialpsychologe Tajfel befasst. Dabei geht es um die Übernahme negativer Identitäten durch Außenseiter. In seiner Arbeit „Gruppenkonflikt und Vorurteil“ erörtert er das Verhältnis von Majoritäten zu Minoritäten, deren Angehörige zumeist einen Außenseiterstatus zugewiesen erhalten: ,,Personen, die Mitglieder (...) von Minoritäten sind (...), haben ein schwieriges psychologisches Problem gemeinsam, das man ganz allgemein als Konflikt zwischen zufriedenstellender Selbstverwirklichung und den Restriktionen, die dieser durch die Mitgliedschaft in einer Minoritätsgruppe auferlegt werden, beschreiben kann.“450 Aus dem Vergleich mit anderen Gruppen (z.B. der Majorität, den Nicht-Behinderten usw.) kann als ein bedeutender Aspekt des Selbstbildes einer Person das Gefühl des Abgesondertseins und des Minderwertigseins erwachsen: „solange die Mitgliedschaft in einer Minorität durch allgemeinen Konsens als Abweichung von einer (...) Norm innerhalb der Majorität definiert ist, werden die Selbstbildnis- und Selbstachtungsprobleme von Minoritätsmitgliedern akuten Charakter haben“451 Tajfel führt in diesem Zusammenhang das Phänomen des „Ethnozentrismus“ an, womit die Überhöhung des Wertes der Eigengruppe und die Geringschätzung anderer gemeint ist. Deren Eigenheiten werden mit Verachtung bedacht. Diese Haltung wurde von mir bereits in der Arbeit von Elias und Scotson erwähnt. Etwas Besonderes stellt jedoch die Einstellung der Mitglieder von Minderheitsgruppen zu sich selbst dar. Tajfel zitiert in diesem Zusammenhang den schwarzen Psychologen Clark, der das Phänomen der Internalisierung abwertender Majoritätsurteile 449 Willems 1997 a.a.O. Tajfel 1982, S. 159 451 Tajfel 1982, S. 159f. 450 228 durch Minderheiten folgendermaßen beschreibt: „Menschen, die gezwungen sind, unter Ghetto-Bedingungen zu leben, und denen ihre alltäglichen Erfahrungen die Überzeugung geben, dass sie fast nirgendwo in der Gesellschaft respektiert werden und dass ihnen die normale Würde und Höflichkeit verweigert wird, die man anderen bereitwillig zugesteht, werden zwangsläufig an ihrem eigenen Wert zu zweifeln beginnen. Da jeder Mensch aus seinen kumulierten Erfahrungen mit anderen die Hinweise darauf ableitet, wie er sich selbst sehen und bewerten soll, werden Kinder, die durchgängig abgelehnt werden, verständlicherweise anfangen, sich selbst zu fragen, und daran zu zweifeln, ob sie selbst ihre Familien und ihre Gruppe tatsächlich nicht mehr Respekt von der Gesellschaft verdienen, als sie erhalten. Diese Zweifel werden zum Ausgangspunkt eines verderblichen Selbst- und Gruppenhasses, des komplexen und schwächenden Vorurteils des Schwarzen gegenüber sich selbst. Die Schwarzen glauben inzwischen an ihre eigene Minderwertigkeit.“452 Der Prozess der Herabsetzung des Selbst bzw. der Eigengruppe beginnt in der frühen Kindheit. Empirische Untersuchungen Clarks mit schwarzen Kindern (1947) zeigten, dass diese einen Spielkameraden, der Angehöriger der weißen Rasse war, gegenüber einem Angehörigen der gleichen Rasse bevorzugten. Dieser empirische Beweis der Bevorzugung der Fremdgruppe wurde erbracht, indem Kindern Puppen vorgelegt wurden, mit denen sie im Rahmen der Untersuchung spielen sollten. Diese Puppen repräsentierten in ihrer äußeren Gestaltung die verschiedenen menschlichen Rassen. Die Variation der angedeuteten Hautfarbe als unabhängige Variable sollte Aufschluss darüber geben, ob mit einem Kind der eigenen Hautfarbe lieber oder weniger gern gespielt wird. Tajfel zieht folgenden Schluss: „in diesen Untersuchungen (geben) Minoritätsmitglieder Urteile über ihre eigene Gruppe in einem Kontext (ab), in dem sie sich direkt und explizit mit der Majorität vergleichen müssen. Wie wir gesehen haben, liegen überzeugende Beweise dafür vor, dass unter solchen Bedingungen ein negatives Selbstbild internalisiert wird.“453 452 453 Clark 1965, zit. n. Tajfel 1982, S. 161 Tajfel 1982, S. 164 229 8.3. Negatives symbolisches Kapital Wenn ein Individuum aufgrund der fehlenden Konvergenz mit gesellschaftlichen Wertdispositionen zum Außenseiter wird, vollzieht sich gleichsam ein analoger Prozess der symbolischen Manifestation der Machtverhältnisse, wie er weiter oben, allerdings im positiven Sinne, beschrieben wurde: in diesem Zusammenhang manifestiert sich Kapitalarmut im Sinne von Ohnmacht, und es bedarf negativen symbolischen Kapitals, um die Armut an den anderen Kapitalien manifest werden zu lassen. Um dies zu verdeutlichen beziehe ich mich nochmals auf Goffman, der allerdings keine Kapitaltheorie im Sinn hatte. Goffman sprach von moralischer Karriere 454, die darauf gerichtet ist, eine bestimmte Ausprägung der Persönlichkeit des Individuums als abweichend zu definieren und symbolisch abzuwerten und dem Individuum in der Folge sämtliche Möglichkeiten als selbstbestimmtes Subjekt zu nehmen. Man könnte auch sagen, dass dem Individuum die Verfügungsmöglichkeit über seine übrigen Kapitalien genommen werden. Dies geschieht im Rahmen legitimer Machtausübung, die sich darin manifestiert, dass sie von Institutionen ausgeht. Gemäß der Etikettierungstheorie entsteht abweichendes Verhalten aus gesellschaftlichen Zuschreibungsprozessen. Becker sprach von einer „Laufbahn“, an deren Ende sich das Individuum in einem Zustand manifester Devianz wiederfindet und die deviante Identität zu seiner eigenen wird. Auch Goffman bedient sich des Laufbahnkonzeptes und begründet dies folgendermaßen: „Der Begriff der Karriere erlaubt uns, (...) zwischen dem persönlichen und dem öffentlichen Bereich, zwischen dem Ich und der für dieses relevanten Gesellschaft hin und her zu bewegen, ohne dass wir allzu sehr auf Angaben darüber angewiesen sind, wie der betreffende Einzelne sich in seiner eigenen Vorstellung sieht.“455 Um an die Terminologie Meads nochmals anzuknüpfen, könnte man sagen, dass Goffmans Konzeption von Karriere eine Darstellung der Entwicklung des „Mich“ unter den besonderen Bedingungen der Stigmasituation beinhaltet. Dabei legt er seinen Schwerpunkt auf den „moralischen Aspekt“ der Karriere. Damit meint Goffman 454 455 Goffman 1961, S. 127 Goffman 1961, S. 127 230 den „regulären Ablauf der Veränderungen, die die Karriere im Selbst des Menschen und im metaphorischen Bezugsrahmen, mit dem er sich und andere beurteilt zur Folge hat.“456 Goffman hat sich bei der Beschreibung dieses Prozesses insbesondere auf die Situation in psychiatrischen Krankenhäusern bezogen. Goffman stellt bei seiner Untersuchung fest, dass geradezu beängstigende Veränderungen mit der Identität des Individuums geschehen, wenn es in die Prozessstrukturen einer, wie er es nennt, „totalen“ Institution gerät: „Die Personen, die als psychiatrische Patienten in eine Klinik kommen, unterscheiden sich beträchtlich voneinander hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der Krankheit, die der Psychiater bei ihnen feststellt, sowie hinsichtlich der Attribute, mit denen der Laie sie belegt. Aber einmal auf dem Weg durch die Instanzen der Klinikpsychiatrie, sind sie im Wesentlichen mit ähnlichen Gegebenheiten konfrontiert und reagieren im Wesentlichen ähnlich darauf. (...) Es muss (...) der Macht gesellschaftlicher Kräfte zugeschrieben werden, wenn der uniforme Status des Geisteskranken einer ganzen Personengruppe nicht nur ein gemeinsames Schicksal und mithin schließlich einen gemeinsamen Charakter zuweist, sondern jener soziale Umformungsprozess auch auf die vielleicht krasseste Vielfalt von Charakteren angewendet werden kann.“457 Goffman beschreibt mit diesen Worten den von mir weiter oben diskutierten Zusammenhang: aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Bewertungen, die in Zuschreibungsprozesse einfließen, können Menschen in formal legitimen Prozeduren zu gesellschaftlichen Außenseitern gemacht werden. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Goffmans Beobachtungen etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden sind und es zu diesem Zeitpunkt zum Teil völlig andere Wertstrukturen gegeben hat, die eine legitime Ausgrenzung zuließen, wird klar, wie willkürlich und kontingent moralische Urteile sein können, auf deren Grundlage menschlichen Schicksalen eine Richtung gegeben wird. Das GoffmanZitat gibt seine theoretische Nähe zur Etikettierungstheorie wieder, wonach sich die Gesellschaft mit der Hilfe ihrer totalen Institutionen ihre Außenseiter schafft. 456 457 Goffman 1961, S. 127 Goffman 1961, S. 128f. 231 8.4. Die vorklinische Phase Im Vorfeld muss der Mensch jedoch bereits einen Teil der Karriere durchlaufen haben, die Goffman als „vorklinische Phase“ bezeichnet. In einigen Fällen beginnt diese Phase damit, dass das Individuum selbst bereits in Sorge ist, ein bestimmtes stigmarelevantes Symptom zu besitzen, das nach außen nicht mehr verborgen werden kann. Es erfolgt dann eine „desintegrierende Neubewertung“ 458 seiner selbst, die begleitet ist von dem „Versuch, vor anderen das zu verbergen, was er für die neuen, fundamentalen Tatsachen über seine eigene Person hält, und herauszufinden, ob auch andere diese bereits entdeckt haben.“459 Diese Phase endet damit, dass das Individuum – meistens unfreiwillig – in die Anstalt gelangt. Goffman bezeichnet die damit entstandene neue Phase der moralischen Karriere als „klinisch“. Die Gründe für den Statuswechsel des Individuums sind vielfältig. Oft ist familiärer Druck oder Überredung maßgeblich. Es kann ebenso eine Initiative der Agenten, die sich der Wahrung von Sicherheit und Ordnung verpflichtet haben (z.B. Polizei), der Anlass sein. Nach Goffman ist eine Einweisung oft die Folge von „Karriere-Zufällen“. Es gibt viele vergleichbare Übertretungen, die jedoch andere, möglicherweise mildere Konsequenzen nach sich ziehen können. Auch im Rahmen der Etikettierungstheorie wurde dieses Phänomen angesprochen. Bei solchen persönlichen Entwicklungen spielen auch sozioökonomische Faktoren, das heißt die persönlichen Verfügungsmöglichkeiten der Betroffenen über ökonomisches, kulturelles und auch soziales Kapital, eine Rolle. In dem für die Betroffenen günstigen Fall trifft auf die gesellschaftliche Macht, die eine moralische Karriere im Sinne Goffmans betreiben kann, eine persönliche Gegenmacht, die bis hin zur Immunität gegen soziale Sanktionen des Individuums führen kann. Wem diese Möglichkeiten aber verwehrt sind, kann der Verlust gesellschaftlicher Zugehörigkeit drohen: „Die Karriere des vorklinischen Patienten kann als ein Modell des Ausschlusses aufgefasst werden; anfangs hat er Beziehungen und Rechte, und schließlich, zu Beginn seines Klinikaufenthaltes, verfügt er kaum noch 458 459 Goffman 1961, S. 131 ebd. 232 über das eine oder das andere. Die moralischen Aspekte dieser Karriere beginnen also typischerweise mit der Erfahrung des Verlassenseins, des Treuebruchs und der Verbitterung.“460 Der Übergang zum Patienten erfolgt über mehrere Etappen, die mit jeweils anderen Agenten besetzt sind, die sukzessive den Status des Individuums als freien Menschen schmälern. 8.5. Totale Institutionen Goffmans Analyse des Lebens in totalen Institutionen steht in einem theoretischen Zusammenhang mit dem Symbolischen Interaktionismus, insbesondere der Etikettierungstheorie. Goffman erkennt, dass der wichtigste Faktor, der einen Patienten prägt, nicht seine Krankheit ist, sondern die Institution, der er ausgeliefert ist. Hier widerfährt dem Individuum eine neue Definition seiner Identität. Diese ist sozial konstruiert und so umfassend, dass z.B. Herr Schmidt, den man früher als Studienrat kannte, die Identität des Insassen XY annimmt. Weil diese Instituitonen den Menschen mit seiner ganzen Persönlichkeit absorbieren, werden sie von Goffman als „total“ bezeichnet. Totale Institutionen sind allumfassend. Ein zentrales Merkmal totaler Institutionen besteht darin, dass die Schranken, die normalerweise zwischen verschiedenen Lebensbereichen bestehen, aufgehoben sind. Alle Belange und Vollzüge des Lebens finden an einem Ort statt. Allen Insassen widerfährt die gleiche Behandlung. Goffman führt dazu aus: „Totale Institutionen sind soziale Zwitter, einerseits Wohn- und Lebensgemeinschaft, andererseits formale Organisation. (...) Sie sind Treibhäuser, in denen unsere Gesellschaft versucht, den Charakter von Menschen zu verändern.“461 Die Insassen totaler Institutionen stehen in der Gefahr, ihrer bisherigen Identität beraubt zu werden. Den Anfang nimmt dieser Prozess in allen möglichen bürokratischen Prozeduren, die von Goffman als „Demütigungsrituale“ bezeichnet werden. Neben der Beschränkung der im bürgerlichen Leben garantierten Freiräume, der Aufhebung persönlicher Autonomie über die eigene Zeit und eigene Handlungsorientierungen, tritt ein beängstigender Rollenverlust 460 461 Goffman 1961, S. 133 Goffman 1961, S. 23 233 hinzu, der sich darin ausdrückt, dass der Insasse von der weiteren Welt und ihren Erwartungen absolut getrennt wird. Die Aufnahmeprozeduren selbst sind Teil dieser Demütigungsrituale. Dazu zählen medizinische Untersuchungen, Fotografieren, Fingerabdrücke, Entkleiden, Desinfizieren usw.: „durch diese Form der Isolierung wird es möglich, den Neuankömmling zu einem Objekt zu formen, das in die Verwaltungsmaschinerie der Anstalt eingefüttert und reibungslos durch Routinemaßnahmen gehandhabt werden kann.“462 Zu den Demütigungsritualen in einigen Einrichtungen gehört auch die Verletzung der physischen Integrität der Insassen, wie z.B. körperliche Misshandlungen in Konzentrations- und Straflagern. Dabei verliert das Individuum die Grundlage früherer Selbstidentifikationen. Goffman beschreibt die Gesamtheit der Prozeduren in ihrer Funktion als „die verschiedenen Formen der Verunstaltung und Verunreinigung, durch welche die symbolische Bedeutung von Vorfällen, die sich im Beisein des Insassen ereignen, zu einer drastischen Störung seines Selbstgefühls führen.“463 Der Prozess setzt sich mit weniger direkt wirkenden Demütigungsverfahren fort, deren Wirkung von Goffman als „Zerstörung des formellen Verhältnisses zwischen dem handelnden Individuum und seinen Handlungen“464 bezeichnet wird. Dazu gehört das „Looping“, wie Goffman das Verfahren nennt, bei dem Angehörige des Aufsichtspersonals psychiatrischer Kliniken Abwehrreaktionen der Insassen herbeiführen und in der Folge neue Angriffe gegen genau diese Abwehrreaktionen starten. Weiters sind es übermäßige Reglementierung (jede Aktivität wird bis in das kleinste Detail vom Personal festgelegt, es besteht nicht der geringste Spielraum für persönliche Autonomie) und Tyrannei (das Personal hat eine unverhältnismäßig hohe Sanktionsmacht, die Sanktionswahrscheinlichkeit ist hoch, aber nicht berechenbar, so dass ständig mit Bestrafung gerechnet werden muss), die zu diesem Prozess beitragen. Daher sind „totale Institutionen verhängnisvoll für das bürgerliche Selbst des Insassen, auch 462 Goffman 1961, S. 27 Goffman 1961, S. 43 464 ebd. 463 234 wenn die Bindung des Insassen an sein bürgerliches Selbst recht unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann.“465 Goffman weist darauf hin, dass der soziale Status einer Person nach deren Entlassung nie mehr der sein wird, den das Individuum vor dem Eintritt besessen hat: „Wenn der proaktive Status (das heißt jener vor der Entlassung, Anmerkung des Verfassers) (...) ungünstig ist, wie im Falle derer, die aus Gefängnissen oder Heilanstalten entlassen werden, dann ist der Ausdruck „Stigmatisierung“ angebracht, und man kann erwarten, dass der ehemalige Insasse sich bemühen wird, seine Vergangenheit zu verheimlichen und Wiederbegegnungen (mit früheren Vertrauten, Anmerkung des Verfassers) zu vermeiden.“466 Und weiter: „Wenn der einzelne, dadurch dass er zum Insassen geworden ist, einen niedrigen proaktiven Status gewonnen hat, dann wird man ihm draußen in der Welt mit Vorbehalt begegnen, und er wird diese Erfahrung meist in einem auch für Leute ohne Stigma schwierigen Augenblick machen, nämlich wenn er sich um eine Arbeit oder eine Wohnung bemüht.“467 465 Goffman 1961, S. 53 Goffman 1961, S. 75 467 Goffman 1961, S. 76 466 235 9. Sozialer Wandel durch Umwertung der Kapitalien Goffmans Studie zeigt sehr anschaulich, wie sich gesellschaftliche Macht in den Funktionsprinzipien bestimmter Institutionen wiederfindet. Sie wirkt direkt auf die Identitäten der Menschen, die an die Institutionen gebunden sind. „Totale Institutionen“ sind natürlich ein Extremfall gesellschaftlicher Einflussnahme auf menschliche Identitäten. In den viel weniger dramatischen Zusammenhängen des alltäglichen Lebens „normaler“ Gesellschaftsmitglieder ist die Beeinflussung der Identitäten gleichwohl auch vorhanden. Und immer lässt sich ein Muster herausfinden: diejenigen Individuen oder Gruppen, die über gesellschaftlich relevantes Kapital verfügen, sind davor gefeit, gesellschaftliche Außenseiter zu werden, weil sie entweder mit der vorgängigen Wertordnung konvergieren können, also z.B. konkurrenzfähig bleiben, oder sogar die Macht besitzen, die gesellschaftliche Wertordnung nach ihren Interessen und Bedürfnissen zu gestalten. Den Besitzlosen bleibt nur die Anpassung, die gemäß des oben erwähnten sozialpsychologischen Ansatzes, der auch von Bourdieu aufgegriffen wurde, in eine Akzeptanz im Sinne von „amor fati“ umschlagen kann. Wenn dies jedoch misslingt, genügt nur eine symbolische Kennzeichnung durch die Gesellschaft, um das Individuum endgültig zum Außenseiter zu machen und im Extremfall seiner Identität zu berauben. Ohne reale Machtdifferentiale verkennen zu wollen, die den Unterdrückten oft keine andere Wahl lassen, als sich in ihr Schicksal zu fügen, möchte ich am Beispiel der Studien über Winston Parva und Asyle in totalen Institutionen deutlich machen, dass gesellschaftliche Machtdifferentiale in vielen Fällen durch nichts anderes begründet sind, als durch eine symbolische Hervorhebung, deren Legitimation aus sich selbst erfolgt. So schreibt Schwingel: „Symbolische Macht ist (...) in der Lage, soziale Differenzen zu produzieren und auszudrücken, die ihre Grundlage nicht (nur) in den unterschiedlichen materialen (ökonomischen und kulturellen) Eigenschaften von Akteuren (oder Gruppen von Akteuren) haben, sondern auf die genuine Eigenwirkung des Symbolischen zurückzuführen sind.“468 468 Schwingel 1993, S. 104 236 Aber die Bedeutungen, die den sozialen Sachverhalten verliehen werden, können sich auch wandeln, und die symbolischen Voraussetzungen für gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse (z.B. gesellschaftliche Werte) können von denen, die an ihrer Synthese beteiligt sind, auch anders interpretiert werden, so dass sich letztlich auch gesellschaftliche Macht- und Ohnmachtverhältnisse wandeln können, wenn deren symbolische Fundierung sich wandelt. Es ist daher denkbar, dass die Macht des Symbolischen auch von den Beherrschten genutzt wird. Schwingel schreibt dazu: „Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der politische Kampf von eminent praktischer um nicht zu sagen vitaler Bedeutung besonders für die dominierten Gruppen und Klassen ist, und zwar deshalb, weil (zumindest auf der Ebene der Praxis)‚ die Herrschenden immer schon ‚existieren‘ - die Beherrschten dagegen nur, wenn sie sich mobilisieren und sich mit Mitteln zur Repräsentation ausstatten.“469 Der marxistische Ansatz, wonach es nur der Bewusstwerdung (und damit der Uminterpretation bisheriger Verhältnisse) bedarf, um gesellschaftliche Differentiale „für sich“ zu wandeln, liegt bei diesem Befund nahe. Es handelt sich dabei um einen schwierigen Prozess, der auf erheblichen Widerstand der Herrschenden trifft und auch einen besonderen Kraftaufwand der Beherrschten erfordert. Entsprechend merkt Schwingel an: „Die - sozialstrukturell bedingten Schwierigkeiten, mit denen die beherrschten Gruppen und Klassen konfrontiert sind in ihrem Versuch, sich selbst öffentlich bemerkbar zu machen, der normativen Kraft des Faktischen entgegen zu treten und den Zirkel der (symbolischen) Reproduktion zu durchbrechen, sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass ihnen hierzu nicht nur die materiellen, sondern ebenso die symbolisch-kulturellen Mittel fehlen. Dies hat zur Folge, dass die dominierten Klassen, um einen politisch effektiven Kampf führen zu können, auf Verbündete angewiesen sind, die ihnen die notwendigen (symbolischen) Mittel zur Durchsetzung einer Weltsicht (und also zur Artikulation bisher unausgesprochener Interessen) zur Verfügung stellen, die sich von der eingelebten, die symbolischen (und folglich materiellen) Verhältnisse stabili469 Schwingel 1993, S. 154 237 sierenden Sicht grundlegend unterscheidet.“470 Nach Bourdieus Ansicht spielen die Intellektuellen bei diesem Kampf als Verbündete eine große Rolle. Sie sind es, die über genügend Charisma und symbolisches Kapital verfügen, um (Neu-)Definitionen gesellschaftlicher Werte vornehmen zu können und bestehende Legitimitätskonstruktionen symbolisch destruieren und neue Legitimität symbolisch konstruieren zu können. 9.1. Legitimationsprobleme Eine Gesellschaft, in der keine Anomie im Sinne Durkheims und Mertons herrscht, bietet ihren Mitgliedern ein ausreichendes Maß an Orientierung und Verhaltenssicherheit. In einer idealtypischen Konzeption (beispielsweise der von Parsons) werden Gesellschaftsmitglieder so sozialisiert, dass die vorhandenen Wertstrukturen verinnerlicht werden und deren Befolgung in der alltäglichen Rollenwahrnehmung völlig problemlos erscheint. Gesellschaftliche Institutionen bieten die dafür notwendigen Handlungsanleitungen. Habermas hat diesen Zusammenhang am Beispiel religiöser Systeme verdeutlicht. Demnach besteht die Grundfunktion „von weltstabilisierenden (...) Deutungssystemen (...) darin, Chaos zu vermeiden, das heißt Kontingenzen zu überwinden.“ Herrschaft ist nach Habermas’ Deutung als „Spezialisierung dieser ‚sinngebenden‘ Funktionen“ zu verstehen. Religion und der dazu gehörige institutionelle Apparat helfen der Konstituierung der Ich- und Gruppenidentität, da sie die Wertstrukturen vorgeben und deren Implementierung im gesellschaftlichen Prozess gewährleisten. Dabei sorgen sie dafür, dass „Grundrisiken der menschlichen Existenz verarbeitet werden konnten. (...) Krisen des Lebenszyklus und Gefahren der Sozialisation wie auch an Verletzungen der moralischen und körperlichen Integrität (Schuld, Einsamkeit, Tod).“471 Die Verinnerlichung der Werte vermittelt Verhaltenssicherheit und sichert eine kooperative Verhaltensbereitschaft in den jeweiligen gesellschaftlichen Strukturen, die immer auch geprägt sind vom Vorhandensein sozialer Ungleichheit, die eine Funktion der asymmetrischen Machtverteilung in den Gesellschaften ist. Sozialisation dient insoweit dazu, diese Ungleichheits470 471 Schwingel 1993, S. 157 Habermas 1973a, S. 163 238 beziehungen akzeptieren zu lernen, auch wenn dies auf Seiten des Individuums mit Verzicht und Unterprivilegierung einhergeht. Bourdieu hat diese Bereitschaft mit seinem Habituskonzept erklärt. Ich will ihn daher an dieser Stelle nochmals zitieren: „Mit Marx zu behaupten, dass der Kleinbürger die Grenzen seines Hirns nicht zu überschreiten vermag (...), heißt feststellen, dass sein Denken denselben Beschränkungen unterliegt, wie seine materielle Lage, dass seine Lage ihn gewissermaßen doppelt beschränkt, nämlich einmal durch die materiellen Schranken, die sie seinem Handeln auferlegt, und sodann durch die Schranken, die sie seinem Denken setzt - und damit wiederum seinem Handeln -, und die ihn dazu bringen, seine eigenen Grenzen zu akzeptieren, ja zu lieben.“472 Gesellschaftliche Ungleichheit und ökonomisch determinierte Machtverhältnisse werden mit Hilfe symbolischen Kapitals legitimiert. Der gesellschaftlichen Integration dienend verlangt „der Einsatz legitimer Macht (...) die Berücksichtigung eines Legitimationsgefälles zwischen verschiedenen Interessenbereichen.“473 Das symbolische Kapital, dem die Legitimierungsfunktion zufällt, wird zumeist von den Institutionen geliefert, die ihr Mandat entweder aus einer besonderen moralischen Berufung ableiten oder die realen ökonomischen Machtverhältnisse repräsentieren. So erfolgt die „Legitimation von Macht auch im Gewande von expliziten, moralisch oder juristisch begründeten Normen (...); aber, was Normen und Rechte aus der Binnenperspektive moralisch ‚argumentierender‘ Akteure auch immer sein mögen, es lässt sich nur zum Preis einer philosophisch-idealisierenden, das heißt von den realen historischen und sozialen Bedingungen vollkommen absehenden Sicht (so Habermas) verleugnen, dass Normen – und vor allem das allgemeinverbindliche Recht – immer auch bestimmte bestehende (oder herbeigesehnte) Kräfteverhältnisse sanktionieren und festschreiben.“474 In der idealtypischen, nicht desintegrierten Gesellschaft sind solche ungleichen Kräfteverhältnisse nicht problematisch, soweit sie hinreichend, z.B. nach Maßgabe von Vernunftkriterien, die einer allgemeinen 472 Bourdieu 1979, S. 378 Habermas 1973a, S. 91 474 Schwingel 1993, S. 171 f 473 239 Willensbildung folgen, legitimiert sind und Machtverhältnisse vorliegen, die weitgehend den Konsens der Gesellschaftsmitglieder finden. In diesem Sinne weist Schwingel darauf hin, dass Legitimation für Verhältnisse sozialer Ungleichheit oft dadurch geliefert wird, dass auf bestehende normative Strukturen verwiesen wird. Aber diese können illegitim an sich werden. Es sind gleichwohl noch immer Normen, die gesellschaftliche Verhältnisse allgemeinverbindlich regeln. Nach Habermas lassen sich aber rechtfertigungsfähige Normen von solchen unterscheiden, „die Gewaltverhältnisse stabilisieren. Soweit Normen verallgemeinerungsfähige Interessen ausdrücken, beruhen sie auf einem vernünftigen Konsens (...). Sofern Normen nicht verallgemeinerungsfähige Interessen regeln, beruhen sie auf Gewalt.“475 Soziale Systeme, in denen Herrschaftsverhältnisse bestehen, die illegitim werden und sich in Gewalt transformieren, sind vielfach dadurch gekennzeichnet, dass sich in ihnen ein Wandel der Werteordnung ereignet hat. 9.2. Hysteresiseffekte Im Zusammenhang mit der Diskussion der Identitätsperspektive in der Habitustheorie Bourdieus war der Hysteresiseffekt zur Sprache gekommen, der für das Individuum die Wirkung haben kann, dass es aufgrund der Unangepasstheit der habituellen Dispositionen des Handelns im Verhältnis zu den realen Bedingungen seiner Lebenswelt in eine Desintegrationssituation geraten kann; desintegriert in sozialer Hinsicht, wenn es ihm nicht gelingt, seine personale Identität in Einklang mit seiner sozialen Identität zu bringen, seine soziale Rolle, die ihm von der Gesellschaft übertragen wird, angemessen auszufüllen. In einer kurzlebigen und oberflächlichen Welt kann sich eine Handlungsorientierung, die sich an traditionellen Wertemustern orientiert, schnell in eine Don-Quichotterie wandeln. Schwingel deutet die Auswirkungen des Hysteresiseffektes folgendermaßen: „Selbstverständlich ist die Übereinstimmung von Habitus und Feld nicht a priori garantiert, sondern sie kann ebenso gut fehlen – was gewöhnlich zum Scheitern der habituellen Strategien innerhalb des betreffenden Feldes führt. 475 Habermas 1973a, S. 153 240 Hierbei können zwei Fälle des Scheiterns, wiederum idealtypisch, unterschieden werden: einerseits das grundsätzliche Scheitern innerhalb eines Feldes aufgrund eines sozusagen veralteten, verrückten, das heißt von Grund auf unpassenden Habitus (...); andererseits das Nichtgelingen von einzelnen Strategien, deren für den Akteur negative Folgen aber durch spätere Entscheidungen (zumindest prinzipiell) wieder ausgeglichen werden können.“476 Die Folgen dieser nicht gelingenden Assimilation von Habitus und Feld für das Individuum wurden im ersten Kapitel ausführlich beschrieben. Die Desintegration kann aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene stattfinden. Diese Situation kann gegeben sein, wenn sich der Hysteresiseffekt auf die normativen Strukturen der Gesellschaft bezieht und die soziale Realität anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Diesen Gedanken beziehe ich beispielsweise auf die Situation einer konservativen Ethik, derzufolge Wertestrukturen hochgehalten werden, die aufgrund der Unangepasstheit mit den realen gesellschaftlichen Verhältnissen desintegrierend wirken. Mead hat dieses Problem auch benannt und den Einfluss restriktiver Institutionen auf die Identitätsentwicklung gesehen. Hierfür steht folgendes Zitat: „Oppressive, stereotype und ultrakonservative gesellschaftliche Institutionen – wie die Kirche –, die durch ihre mehr oder weniger starre und unbewegliche Fortschrittsfeindlichkeit unsere Individualität zerstören oder jeden persönlichen oder originellen Ausdruck der Gedanken und des Verhaltens der einzelnen Identität oder Persönlichkeit entmutigen, sind unerwünschte, aber nicht notwendige Ergebnisse des allgemeinen gesellschaftlichen Erfahrungs- und Verhaltensprozesses. Es gibt keine notwendigen oder unüberwindlichen Gründe dafür, warum gesellschaftliche Institutionen oppressiv oder starr konservativ sein sollten, warum sie nicht vielmehr, wie das ja für viele auch zutrifft, flexibel und fortschrittlich sein und die Individualität fördern sollten, anstatt sie zu entmutigen.“477 Diese Forderung unterstreicht Mead mit dem Hinweis auf die Bedeutung von Institutionen für die Identitätsentwicklung: „Auf jeden Fall könnte es ohne gesellschaftliche Institutionen der einen oder 476 477 Schwingel 1993, S. 75 Mead 1934, S. 308f. 241 anderen Art, ohne die organisierten gesellschaftlichen Haltungen und Tätigkeiten, durch welche gesellschaftliche Institutionen geschaffen werden, überhaupt keine wirklich reife Identität der Persönlichkeit geben.“478 Die Persönlichkeit findet ihre Identität dann, wenn gesellschaftliche Institutionen, zu denen das Individuum gehört, es zulassen, dass es sich seinen Neigungen und Bedürfnissen gemäß entwickeln kann. Meads Klage ist aber genau auf den Fall gerichtet, in dem gesellschaftliche Institutionen die Bedürfnisse der Menschen ignorieren. Wenn einzelne Institutionen, mit einer partikularen Wirkung auf die gesellschaftliche Wirklichkeit betroffen sind, kann dies bewirken, dass diese Institutionen an Bedeutung verlieren. Wenn aber zentrale Institutionen, wie z.B. die staatliche Organisation, davon betroffen ist, ist die Gesellschaft an sich gefährdet. Dies wird dann als Tyrannei erlebt. In diesem Sinne liegt eine Desintegration der Identität der Gesellschaft vor, die zu deren Überwindung führt. Habermas hat dies in lapidarer Weise folgendermaßen beschrieben: „Auch soziale Systeme haben ihre Identität und können sie verlieren.“479 Weiter oben wurde Habermas zitiert, wonach es zu den Aufgaben der gesellschaftlichen Institutionen gehört, die Konstitution von Identität zu gewährleisten. Wenn diese Konstitutionsleistung misslingt und z.B. als Ergebnis der Sozialisation in desintegrierten Gesellschaften auch desintegrierte Identitäten der Gesellschaftsmitglieder entstehen, kann die mit den Mitteln symbolischer Macht unterfütterte Werteordnung in Frage gestellt werden, denn die Wirkung symbolischer Macht steht in Abhängigkeit von der Anerkennung durch die Beherrschten. Wenn aber diese, die als Opfer bestehender Legitimitätsverhältnisse anzusehen sind, sich selbst klar machen, wie arbiträr und fragwürdig die ihnen auferlegte Ordnung ist, hinterfragen sie bestehende Ordnungs- und Machtverhältnisse. Soweit die Legitimität der realen Machtverhältnisse brüchig wird, eröffnen sich die Möglichkeiten für alternative Deutungsmuster. So schreibt Schwingel: „Mit der faktischen Durchsetzung einer anderen Sicht kann – öffentlich gemachte – Kritik zu einer 478 479 a.a.O. Habermas 1973a, S. 13 242 Veränderung der bestehenden Kräfteverhältnisse beitragen. Denn schon dann, wenn die Ordnung innerhalb eines spezifischen Feldes (und damit zusammenhängend innerhalb des Feldes der sozialen Klassen) nicht mehr nach den gewohnten Schemata als selbstverständliche, das heißt als die Ordnung schlechthin, sondern als eine mögliche unter anderen, folglich als mehr oder weniger zufällig, wahrgenommen wird, werden Handlungsoptionen und -alternativen sichtbar, die vorher verdeckt waren.“480 Habermas hat das Problem der Hysteresis gesellschaftlicher Normierungsverhältnisse und deren mögliche Überwindung auch benannt: „Erst wenn die Macht der Tradition soweit gebrochen ist, dass die Legitimität bestehender Ordnungen im Lichte hypothetischer Alternativen betrachtet werden kann, fragen sich die Angehörigen einer auf Kooperation, das heißt auf gemeinsame Anstrengungen zur Erreichung kollektiver Ziele angewiesenen Gruppe: ob die fraglichen Normen die Willkür der Angehörigen in der Weise regulieren, dass ein jeder von ihnen sein Interesse gewahrt sehen kann.“481 Hinzufügen möchte ich noch, dass dieser Ansatz wohl um so verständlicher und nachvollziehbarer wird, wenn man bedenkt, dass der Mangel einer integrierten Identität auch nicht die Voraussetzungen dafür liefert, dass der Habitus die Fraglosigkeit der schicksalhaften Daseinszumutungen gewährleistet. Wozu sollte man die Grenzen des Daseins akzeptieren, geschweige denn lieben, wenn man erkennt, dass all die Opfer und Versagungen, die Demütigungen und Enttäuschungen die Folge fehlgeleiteter gesellschaftlicher Entwicklungen sind? Um dieser Frage eine vorläufige Antwort zu geben, möchte ich an dieser Stelle nochmals Habermas zitieren: „Das Schicksal erfüllt sich in der Enthüllung widerstreitender Normen, an denen die Identität der Beteiligten zerbricht, wenn diese nicht ihrerseits die Kraft aufbringen, ihre Freiheit dadurch zurück zu gewinnen, dass sie die mythische Gewalt des Schicksals zerbrechen, indem sie eine neue Identität ausbilden.“482 480 Schwingel 1993, S. 108f. Habermas 1981, S. 65 482 Habermas 1973a, S. 10 481 243 Man kann vor dem Hintergrund einer emanzipatorischen Perspektive erkennen, dass Ungleichheit im Sinne von Diskriminierung und Unterdrückung nur auf Dauer wirksam geschehen kann, wenn die Unterdrückten eine entsprechende Bereitschaft an den Tag legen, die Präpotenz der Unterdrücker zu akzeptieren. Daher vermute ich, dass immer dann, wenn Ausgrenzung nicht im Sinne eines singulären Schicksalszumutung geschieht, wenn es also eine Gruppe von Individuen trifft, die noch dazu potentiell in den Besitz von Kapitalien gelangen kann, die sich in symbolische Macht transformieren lässt, sich ein Weg zur Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse eröffnet. Verschiedene Minderheiten sind in unserer Gesellschaft auf diese Weise schon recht weit gekommen und haben wesentliche Elemente von Ausgrenzung und Unterdrückung, von denen sie früher betroffen und bedroht waren, abschütteln können. Allerdings könnte hier auch eine Gefahr liegen: in der zunehmend individualisierten Gesellschaft zeigt es sich, dass sich Schicksalszumutungen der Tendenz nach singularisieren, das heißt Individuen tragen ihre Lebensbürde zunehmend wieder alleine, da keine Solidarisierung in einer virtualisierten Gesellschaft stattfinden kann. Unter diesen Verhältnissen ist es sehr schwer, wirksame Kapitalien zu sammeln und symbolisch zu transformieren. Könnte es daher sein, dass es aufgrund fehlender gemeinsamer Interessen keine sozialen Bewegungen mehr gibt, die gesellschaftliche Machtverhältnisse reformieren können? Jedenfalls zeigt dieser Gedanke, dass trotz aller potentiellen Emanzipationsmöglichkeiten und der Relativität gesellschaftlicher Erwartungen, die es mit sich bringt, dass prinzipiell jeder Lebensstil akzeptabel sein kann, es auch weiterhin Außenseiter geben wird – nota bene: Außenseiter weniger im Sinne einer Gruppe, sondern als vereinzeltes Individuum unter vielen vereinzelten Individuen. 244 10. Das „postmoderne“ Selbst – die Krise der Identität Die Zeit ist nicht stehen geblieben, und die schrecklich-schöne und statische Welt von Winston Parva gibt es sicherlich nicht mehr, weil sich die Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung in der fortgeschrittenen Moderne an anderen Faktoren als dem Alt-Eingesessensein der Dorf-Bewohner festmachen. In der Diskussion gesellschaftlicher Verhältnisse sind mittlerweile andere Begriffe maßgebend. Dazu gehören • die Auflösung kohärenter Identitätskonzepte • Individualisierung • Enttraditionalisierung und • Wertepluralismus Jeder dieser Sachverhalte wirkt direkt auf die Identität der Menschen, und jede dieser Wirkungen ergänzt sich zu einem System, das sich zum geringsten Teil als Chance und Befreiung der unterdrückten Identitäten, die wir in den klassischen Theorien kennengelernt haben, kennzeichnen lässt. Zum weitaus größeren Teil erweist sich dieses System als große Gegenwartskrise der Identität. • Die Auflösung kohärenter Identitätskonzepte Wie bereits von mir gezeigt wurde, hat selbst Parsons in seinen späteren Jahren erkannt, dass die Identität des Menschen nicht mehr so stabil und einheitlich sein kann, wie von ihm in den 1950er Jahren vermutet wurde. Einer der Gründe hierfür liegt darin, dass die Gesellschaft vielfältiger geworden ist und damit der universelle Kosmos gesellschaftlicher Werte, die zueinander in einem Verhältnis der Konsistenz stehen, nur eine theoretische Utopie geworden ist. Der sichtbare Ausdruck dieser Entwicklung ist der Rollenpluralismus, der einem Individuum mehrere und zum Teil widersprüchliche Erwartungen zumutet. Folglich kann auch die Identität, die sich nach Parsons’ Meinung in enger Bindung an gesellschaftliche Wert- und Erwartungsstrukturen entwickelt, nicht mehr widerspruchsfrei sein. Parsons sprach dennoch von der Notwendigkeit eines angemessenen Niveaus der Integration der verschiedenen Persönlichkeitskomponenten, die der Rollenpluralismus induziert. 245 Wenn dieses Niveau nicht erreicht wird, gebricht es dem Individuum jener Integrität, die im Zusammenhang mit Parsons Konzeption von Identität steht. Parsons beschreibt damit nicht nur das hinlänglich bekannte Problem der Rollenkonflikte, sondern auch die Gefährdung der Identität durch gesellschaftliche Diskontinuitäten. Im Grunde ist hier bereits eine Überwindung seiner eigenen theoretischen Sicht angedeutet, deren Statik unerschütterlich schien und in der rein theoretisch kein Raum für gesellschaftliche Außenseiter gegeben war. Vielmehr scheint sich damit seine Sicht den Widersprüchen und Spannungen einer modernen und komplizierteren Welt zu öffnen. Erikson und Mead hatten diese Perspektive zweifellos schon viel früher eingenommen und trotz ihrer robusten Identitätskonzepte theoretisch auffüllbare Spielräume für die Ambivalenzen des Individuums mit der Gesellschaft, die sich in den (Entwicklungs-) Problemen der Identität manifestieren, gelassen, so dass letztlich doch in dieser erstmodernen483 Betrachtung das Konzept der integrierten Identität behauptet werden konnte. Davon ausgehend konnte auch die Abweichung als misslungene Integration oder verfehlte Balance definiert werden. Für die soziologische Theorie, die sich mit der Soziogenese menschlicher Persönlichkeiten befasst, wird es jedoch in der fortgeschrittenen Moderne problematisch, an dem Konzept „integrierte Identität“ der klassischen Identitätssoziologie (mit der dualen Perspektive der Integration in sich selbst und in den gesellschaftlichen Strukturen) festzuhalten. Die Gründe dafür liegen in den eingangs beschriebenen strukturellen Veränderungen der Gesellschaft selbst, auf die die Individuen zu reagieren haben. So stellt sich für Hettlage die Frage, „warum wir gerade heute so intensiv auf der Suche nach unserer Identität sind. Die Antwort wird nicht gerade erleichtert durch die Erkenntnis, dass wir es aufgrund unserer komplizierten gesellschaftlichen Verknüpfung gar nicht mit einer einzigen und eindeutigen Identität, sondern mit verschiedenen Identitäten zu tun haben.“484 Auch Joas kommt zu dieser Erkenntnis, wenn er von der „Auflösung des 483 484 vgl. Koenen 2000, S. 101 Hettlage 2000, S. 10 246 vormals kohärenten Selbst in eine fragmentierte Identität, ein Patchwork von Identitäten“485 schreibt. Bohn und Hahn dazu: „Die besondere Schwierigkeit, die sich für das Individuum (...) ergibt, ist, dass es sich als Einheit und Ganzheit in keiner realen Situation mehr zum Thema machen kann. Im Recht, in der Wirtschaft, in der Medizin, ja selbst in der Familie taucht es nur noch als Rollenträger auf.“486 Und den widersprüchlichen Rollenerwartungen, die alle Lebensbereiche des Menschen treffen, ist es geschuldet, dass eine Einheitlichkeit der Identität vielfach nicht mehr möglich ist. Dabei geht es nicht nur um verschärfte Rollenkonflikte. Diese wären in Anbetracht einer stabilisierenden gesellschaftlichen Struktur, die den Individuen handlungsleitend zur Seite stünde, verkraftbar. Diese Stabilität geht jedoch seit einiger Zeit und mit fortschreitender Dynamik verloren und wirkt sich als Labilisierung der gesellschaftlichen Institutionen aus. • Enttraditionalisierung An die Stelle stabilisierender Institutionen wie z.B. Familie, Religion, Beruf, Nationalität und Sprache und den damit verbundenen Werten treten Labels und Konsumgewohnheiten, NewSpeeches und neudefinierte und nivellierende GeschlechterRollen sowie Identifikationen mit Menschen, die von einer profitorientierten PR-Industrie zu kurzem Starruhm gelangen. Diese Faktoren sind nichts weniger als identitätszerstörend, weil sie so ephemer sind. Sie bewirken kurzlebige Identitätsfolien, die keine dauerhafte Prägung im System der personalen Identität hinterlassen. Die vielen jungen Menschen, die diesen Angeboten verfallen, die damit zum Teil auch Schaden nehmen, wenn sie z.B. eine „Schönheitsoperation“ auf sich nehmen, um ein Gesicht oder eine Figur wie Britney Spears zu haben oder ein Tattoo wie Justin Timberlake, haben gar nicht die Chance, zu einer eigenen und unverwechselbaren Identität zu gelangen. Im schlimmsten Fall verkommen sie zu misslungenen Klonen einer oberflächlichen Konsumwelt, deren Persönlichkeiten aus ephemeren Zuständen der sozialen Identität, die bestimmte kurz485 486 Joas 1997, S. 238f. Bohn und Hahn 1999, S. 35 247 fristige Zeiterscheinungen zu reproduzieren trachtet, bestehen und einer vollkommen verkümmerten persönlichen Identität, deren Ingredienzen eben nicht unverwechselbaren Identitätsaufhänger sind, die nur bei diesem einen Menschen vorliegen. Vielmehr handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Eigenschaften, wie sie etliche andere Klone der Konsumwelt besitzen: gleichartige Jobs (keine Berufe!), gleichartige Konsumgewohnheiten, gleichartige Kleidung, gleichartiges Aussehen usw. Bei Berger und Luckmann war von Habitualisierungen die Rede, die Institutionen bilden und Handlungssicherheiten vermitteln. Die fortgeschrittene Moderne zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen von gesellschaftlichen Verbindlichkeiten, die sich aus Habitualisierungen ergeben, in zunehmendem Maße freigesetzt werden. Das Unvermögen bestehender Institutionen, die Menschen gesellschaftlich zu inkludieren, bzw. sogar das Verschwinden solcher Institutionen ist als Tendenz zur Enttraditionalisierung zu deuten. Enttraditionalisierung impliziert auch den Sachverhalt, dass die Bedeutung dessen, was in der Vergangenheit galt, in der Gegenwart und in der Zukunft nicht mehr gilt bzw. gelten wird. Die in dieser Welt handelnden Individuen können nicht auf der Basis von altem Wissen, Erfahrung und Tradition ihr Leben gestalten. Diese Erfahrungssachverhalte, die hilfreiche Handlungsanleitungen für Menschen in segmentären und traditionalistischen Gesellschaftsformationen waren, haben an Bedeutung verloren. Der bereits beschriebene Hysteresiseffekt kann für die Individuen bei der Bewältigung der Anforderungen ihres Lebens sogar schädlich sein, wenn er ihnen den Zugang zu einer voraussetzungslosen Weltsicht nimmt, auf deren Grundlage sie, gleichsam vogelfrei, ihren Weg in der Gesellschaft der Postmoderne suchen können. Gross befindet daher, dass sich die Menschen entscheiden müssen, „wenn sich die Zukunft nicht mehr von selbst aus der Vergangenheit ergibt.“487 Und in der Tat fragt man sich, welchen Stellenwert die Institutionen Familie, Gesangverein und Kirchengemeinde und das in ihnen angelegte 487 Gross 2000, S. 57 248 Rezeptwissen und die ihnen eigenen Handlungsweisen zur Bewältigung des Altages in einer globalisierten Welt noch besitzen. Sie verlieren ihre Bedeutung spätestens in der dritten Generation, spätestens dann, wenn sich die Enkel nach langer und aufwändiger Ausbildung auf die Suche nach ihren Plätzen in der postmodernen Berufswelt begeben müssen. Gross weist darauf hin, dass umso mehr entschieden werden muss, je instabiler die Welt ist. Und je mehr in dieser Welt ad hoc entschieden wird, umso flüssiger werden ihre Strukturen, umso bedeutungsloser die Institutionen und Traditionen. Damit reagieren die Individuen nur auf die jeweilige neue Situation und richten sich immer von Neuem auf die Situation ein; so „konstruiert die moderne Gesellschaft in ihren entsprechenden ‚legislativen’ Organen eben neue Ordnungen für neue Gegebenheiten, für die überkommene Regeln nicht ausreichen.“488 Die vielen Entscheidungsoptionen machen das Individuum zwar freier, sie vermitteln ihm jedoch ein geringeres Maß an Sicherheit, nicht zuletzt weil es immer der kognitiven Dissonanz ausgeliefert ist, sich möglicherweise falsch entschieden zu haben. Auf diese Weise werden Lebensweisen multioptional und Gewissheiten wie die unserer Großeltern, den einzigen und richtigen Platz in ihrem Leben ein für alle Mal eingenommen zu haben, sind (glücklicherweise ?) perdu. • Individualisierung Die Zersplitterung der Persönlichkeit ist eine Begleiterscheinung tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen, die auch die Stellung des Individuums in der Gesellschaft berühren. Trotz der Schwächung der Persönlichkeit und gerade wegen der Schwächung der Institutionen, ist das Individuum in zunehmendem Maße alleine: „Schon seit geraumer Zeit hat (...) ein grundlegender Wandel im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft eingesetzt und immer weitere Schichten der Bevölkerung erfasst. Diesen Wandel, in dem sich allmählich – zum Teil inmitten andauernder traditionaler Vergemeinschaftungen und überkommener sozial-moralischer Milieus – ein Anspruch und ein Zwang zum eigenen Leben herauszubilden beginnt, bezeichnen wir als 488 Gross 2000, S. 59 249 ‚Individualisierungsprozess‘.“489 Das Individuum muss sich somit, ausgehend von den unmittelbaren Notwendigkeiten seiner Lebenssituation, seinen eigenen Weg suchen und ist auf sich allein gestellt. Die Institutionen, die im klassischen Sinne als wertewahrend anzusehen sind und auf diese Weise dem Individuum Orientierung und Sicherheit vermittelt haben, tendieren dazu, einer einheitlichen, sich an den vorherrschenden Machtverhältnissen orientierenden Linie zu folgen. Sie sind aber in ihrer sozialisatorischen Bedeutung zunehmend in den Hintergrund getreten. Vogt hat eine Beschreibung dieser Situation in der Terminologie Bourdieus geliefert und darauf hingewiesen, dass die Einbindung in institutionelle bzw. familiale Strukturen als Besitz von Sozialkapital zu begreifen sei. Genau diese Einbindung schwindet jedoch: „Waren die Netzwerke früher in starkem Maße ‚gegeben‘ aufgrund von stabilen familiären und verwandtschaftlichen Verbänden, aufgrund von enger Milieubindung, von klassenspezifischen (...) Verkehrskreisen, wuchsen die Akteure also weitgehend in traditional geprägte Netze hinein, so hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Enttraditionalisierung und Individualisierung sind die Stichworte für entsprechende Entwicklungen: die soziale und die räumliche Mobilität nimmt zu, fest gefügte Klassen und Milieus sind kaum vorzufinden, Familien werden immer kleiner (durch sinkende Kinderzahlen) und instabiler, soziale Wert- und Normhierarchien werden im gleichen Maße wähl- und gestaltbar wie biographische Verlaufsmuster. Patchworkfamilien und ‚Bastelbiographien‘ prägen die soziale Landschaft.“490 Diesen Gedanken zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Verlust sozialen Kapitals im Sinne einer Labilisierung sozialer Bindungen mit einer zunehmenden Individualisierung der Gesellschaftsmitglieder einhergeht und mit der Bedeutungsminderung bis hin zum Bedeutungsverlust traditionaler Wertmuster, die von den Institutionen, die bisher die Menschen in der traditionalen Gesellschaftsformation festgehalten haben, getragen wurden. Die Schwächung der Institutionen fordert dem Individuum ab, dass es sich außerhalb schützender und prägender sozialer Sachverhalte eine Identität selbst aufbaut. Dies verheißt zusätzliche 489 490 Hitzler 1999, S. 234 Vogt 2000, S. 94f. 250 Probleme. So schreibt Koenen: „Neben die Wahrnehmung der hergebrachten, bereits längst inkludierenden Ungleichheiten der Stände und Klassen, der Schichten und Milieus sowie der Existenz- und Reproduktionsrisiken treten neue Erfahrungen von Exklusion und Exkommunikation.“491 Die Einrichtungen der Sozialstaatlichkeit werden abgebaut und setzen viele Menschen, die z.T. seit Generationen entsprechend inkludiert waren, frei. Auch die Mechanismen der Globalisierung mögen zwar eine Inklusion geographisch weit entfernter Arbeitsmärkte und deren Subjekte implizieren. In erster und für diese Gesellschaft erfahrbarer Konsequenz werden Menschen aus den Systemen sozialer Absicherung im Rahmen der Berufswelt freigesetzt und damit ihrer gesellschaftlichen Position beraubt. Identitätsbehauptung ist unter der Bedingung des Verschwindens ökonomischer und sozialer Sicherungen einfach nicht mehr möglich, weil ein Angepasstsein an die sozialen Strukturen die einzige Möglichkeit der sozio-ökonomischen Aufrechterhaltung der sozialen Identität beinhaltet: „Wo die Angewiesenheit der ‚Systeme’ auf das ‚variable Kapital’ von Arbeitskräften und auf die politische Zustimmung von Bürgern abnimmt und die moralische Verpflichtung der politischen Gesellschaft für die Wohlfahrt ihrer Büger abgekoppelt werden kann, stellen Ambivalenz, Verweigerung und kritische Abgrenzung der Individuen gegen die ‚Systeme’ keine effektiven Machtpotentiale mehr dar.“492 • Wertepluralismus Abels sieht die Gefährdung der Identität in der „Pluralität von Orientierungen, die alle gleichberechtigt nebeneinander stehen“493, begründet. Wenn die wertvermittelnden Institutionen ihre Bedeutung verlieren, schwindet auch die Verbindlichkeit bestimmter Werte. In diesem Zustand sind gesellschaftliche Werte und Normen dekonturiert, weil sich im Verhältnis zu einer bestimmten Wertorientierung mit großer Wahrscheinlichkeit eine oder sogar mehrere alternative Wertorientierungen finden lassen, die fakultativ als Handlungsalternativen dienen können. Abels 491 Koenen 2000, S. 102 Koenen 2000, S. 103 493 Abels 1997a, S. 4 492 251 bezeichnet diese Entwicklung auch als „Destruktion von Gültigkeit“494, die als Wertepluralismus die Gesellschaft in einen anomischen Zustand bringt, der eine postmoderne Variante des Konzeptes „gefährdete Identität“ generiert. Dies mag man, wenn man so will, als ein Gewinn an Autonomie der Individuen ansehen. Es ist jedoch mit einer ganz besonderen Gefährdung verbunden: „Die Destruktion zentraler Werte gibt dem Einzelnen nur vordergründig ein Stück Freiheit zurück (gegenüber dogmatischen Denkformen), im Kern aber erhöht sie sein Risiko: die Geltung von Werten muss von ihm selbst entschieden werden, und nie kann er sicher sein, dass ihm andere darin auf Dauer zustimmen.“495 So kann eine Festlegung auf bestimmte Werthorizonte und damit auf eine bestimmte Identität schon gefährlich werden. Sie kann Karrieren blockieren und soziale Beziehungen zerstören. Und dennoch gilt es für die meisten Menschen, sich an den Zwängen des Alltags zu orientieren, sich innerhalb der Restriktionen ihrer Lebenswelt zu bewegen und nach Möglichkeit eine Konstruktion einer (temporären) sozialen Identität zu realisieren. Dabei bleibt es aber eine bemerkenswerte Erkenntnis, dass die soziale Realität keineswegs als einheitlich zu bezeichnen ist, sondern trotz der für die meisten Menschen bedrückenden Restriktionen in eine Vielfalt von Sinnund Wertzusammenhängen zerfällt: „Die Menschen orientieren sich an diesen sehr heterogenen und zum Teil antagonistischen, sozial mehr oder weniger stimmig vororganisierten Sinnkonglomeraten. Aber sie basteln diese individuell – was keineswegs bedeuten muss: besonders originell – zu ihren je eigenen Lebenswelten zusammen. Das heißt, dass das tatsächliche Handeln nicht (jedenfalls nicht mehr) durch irgendwelche sozial gültigen Ordnungen prädeterminiert ist.“496 Gleichzeitig bewirkt eine besondere, von den Massenmedien unterstützte Einstellung, der zufolge nichts auf der Welt nicht prinzipiell erfahrbar und beherrschbar wäre, dass ehemals vorhandene Gewissheiten grundsätzlich hinterfragt werden. Zu den Auswirkungen dieser vielfältigen Einflüsse auf den Menschen schreibt Hitzler, „dass der Mensch heute mental 494 ebd. Abels 1997a, S.7 496 Hitzler 1999, S. 231 495 252 typischerweise ‚im Freien‘ steht und berieselt, beregnet, überschüttet wird mit religiösen, esoterischen, chauvinistischen, nationalistischen, internationalistischen, klassenkämpferischen, konsumistischen, ökologischen, sexistischen und dergleichen Ideen mehr. Angesichts dieser breiten Angebots-Palette gibt es für die Vielzahl von – freiwilligen und auferlegten – Entscheidungssituationen, in die die alltägliche Lebenswelt des individualisierten Menschen zersplittert ist, keine verlässlichen ‚Rezepte‘ mehr.“497 Schließlich gelange ich zu dem einzigen positiven Aspekt dieser Entwicklungen, deren Auswirkungen ironischerweise nur den Außenseitern der erstmodernen Welt zugute kommen. Es ist ein Kennzeichen der fortgeschrittenen Moderne, dass Menschen durchaus Chancen zu tiefgreifenden Änderungen ihrer Lebensverhältnisse haben, dass sie sich also, mehr als dies früher der Fall war, den Zumutungen eines sozial konstruierten Schicksals entziehen können. Dies wird auch in der Diskussion über das „postmoderne Selbst“ thematisiert. Joas z.B. stellt den Gedanken in Frage, dass eine Identitätsentwicklung, die ausschließlich im Rahmen der institutionellen Vorgaben bleibt, die also von traditionellen Bindungen geprägt ist, als ideal anzusehen sei: „Im poststrukturalistisch-postmodernen Diskurs wird nicht mehr eine größere Schwierigkeit für Identitätsbildungsprozesse als Zug der Zeit beklagt, sondern umgekehrt der Zwang in der Zumutung – auch in der Selbstzumutung – von Konsistenz und Kontinuität der Person hervorgehoben.“498 Als Beispiele für diese Entwicklung benennt Joas „die postmoderne Infragestellung des Identitätskonzepts im Feminismus, in den HomosexuellenBewegungen sowie in den Debatten über Rassismus und Ethnizität ...“499 Die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit den Bewegungen einhergegangen sind, waren meistens auch darauf gerichtet, Veränderungen institutionell vorgegebener Machtstrukturen zu bewirken. Damit geht auch eine Lösung von den grundlegenden Wertestrukturen der Gesellschaft bzw. eine Vervielfältigung 497 Hitzler 1999, S. 235 Joas 1997, S. 238f. 499 ebd. 498 253 verschiedener Wertoptionen einher, was insgesamt einer Schwächung der vorherrschenden Ordnung, wenn nicht sogar deren Veränderung gleichkommt. So ist es fraglich, ob eine unbedingte Anbindung von Identität an gesellschaftliche Institutionen wünschenswert ist, vor allem dann, wenn hysteresisch geprägte Institutionen nicht im Einklang mit der realen Lebenswelt der Menschen und ihren Bedürfnissen stehen, ob es nicht vielmehr sogar wünschenswert sein kann, dass die Identität des Menschen in geringerem Maße mit Zugehörigkeiten und Interdependenzen begründet wird. Dies ist Fluch und Segen zugleich. Was sich, optimistisch betrachtet, als eine Befreiung der Individuen von gesellschaftlicher Festlegung ausnimmt, kann andererseits der Verlust an Verhaltenssicherheit und Ordnung sein. Wo universalistische gesellschaftliche Bewertungen und in deren Folge Verhaltenserwartungen fehlen, kann es (theoretisch) keine umfassende Repressionen und Ausgrenzungen geben. Und das Individuum hat die Möglichkeit und den Zwang, sein Leben so zu gestalten, dass es den Anforderungen jeweiliger „single purpose communities“ genügt, „in denen oft völlig heterogene Relevanzsysteme ‚gelten‘, von denen jedes lediglich einen begrenzten Ausschnitt seiner individuellen Erfahrungen betrifft. Keines der bereitstehenden Weltdeutungsangebote kann allgemeine soziale Verbindlichkeit beanspruchen. In jeder der vielen und vielfältigen Sinnwelten herrschen eigene Regeln und Routinen, mit prinzipiell auf die jeweiligen Belange beschränkter Geltung, Sinn steht also sehr wohl bereit. Zerbrochen hingegen ist die in vormodernen Gesellschaften ‚normale‘, umgreifende kulturelle Dauerorientierung, und das Individuum muss sich notgedrungen an je spezifischen Bezugsgruppen bzw. besser Bezugssystemen orientieren, die somit hinsichtlich ihres Wissens- und Bedeutungsaspektes wie Sinnprovinzen der individuellen Lebenswelt erscheinen.“500 So spricht Hitzler nicht von Normalität an sich, sondern von der „Normalität einer besonderen Perspektive“, entsprechend haben Werte allenfalls „Geltung für einen bestimmten Kontext (...)“501 und, so möchte 500 501 Hitzler 1999, S. 240 Hitzler 1999, S. 242 254 ich hinzufügen, für andere Kontexte eben nicht, was Fluchtmöglichkeiten eröffnet. Könnte es sein, dass der Verlust einheitlicher Werthorizonte, verbindender Institutionen, handlungsleitender Traditionen die Unmöglichkeit mit sich bringt, zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden? Nur da, wo eine einheitliche und hermetische Wertstruktur Seins- und Verhaltensdispositionen vorschreibt, kann man auch umfassend deviant werden. Wenn wirklich die Wertebeliebigkeit vorliegt, kann jede „erwählte“ Identität eine Legitimation finden, wenn es nicht gerade um eine Verhaltensabweichung geht, die als „kriminell“ indiziert ist oder die sich aufgrund des Mangels an ökonomischem und sozialem Kapital nicht durchhalten lässt. Dies hat zur Folge, dass jede Identität, auch die des gesellschaftlichen Außenseiters, diffus werden kann. Es ist zwar schwer, soziale Randbedingungen der Identität zu verändern, aber die gesellschaftliche Beurteilung bestimmter sozialer Sachverhalte lässt sich mit bestimmten sozialen Mechanismen leicht modifizieren. Ich komme daher zu dem Ergebnis, dass es in vielen gesellschaftlichen Bereichen den Außenseiter im Sinne der erstmodernen Gesellschaft nicht mehr gibt, sofern es ihm oder der jeweiligen Gruppe gelingt, sich bestimmte Kapitalien anzueignen. Aber es wäre doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein, wenn, abgesehen von den Nöten der Identität, die Mehrheit der Menschen vollständig integrierbar wäre, da sie autonom genug ist, ihre sozialen Rollen und Verhältnisse selbst zu gestalten, über die Modalitäten ihrer Zugehörigkeiten selbst zu befinden. Denn: „aus der zunehmenden Ungezwungenheit des Wählens und Entscheidens resultiert, dass das Risiko wächst, selber in die Lage zu geraten, nicht gewählt, sitzen gelassen zu werden.“502 Und das ist das Außenseiterrisiko der fortgeschrittenen Moderne. Es besteht darin, dass sich die Schwächung der Institutionen, die Pluralisierung der Werte, der Verlust von Traditionen gegen die Menschen selbst richtet, die ihrerseits keine Verbindlichkeiten im Umgang mit ihrer sozialen Umwelt für sich einfordern können. Sich selbst befreiend müssen sie die 502 Gross 2000, S. 74 255 Freiheiten der marktorientierten Welt auch gegen sich selbst wirken lassen und erfahren dabei leider viel zu oft, dass sie in einer Welt leben, in der sie seit einiger Zeit auch von politischer Seite immer mehr zur Übernahme von „Eigenverantwortung“ angehalten werden. Im Grunde ist dies ein Ausdruck der Tatsache, dass sie sich nicht mehr auf die Gesellschaft, die sich in einer vormodernen Welt durch verbindliche und verbindende Strukturen ausgezeichnet hat, verlassen können. 256 Literaturliste Abels (1997a): Abschied von der Identität. In: Hagener Materialien zur Soziologie, Heft 1 Abels (1997b): Interaktion, Identität, Präsentation. Kleine Einführung in interpretative Theorien der Soziologie. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001 Abels (2001): Einführung in die Soziologie. Band 1. Der Blick auf die Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag Abels (2001): Einführung in die Soziologie. Band 2. Die Individuen in ihrer Gesellschaft. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag Ainlay, Becker, Coleman (1986): The Dilemma of Difference – a Multidisciplinary View of Stigma. New York: Plenum Press Arendt (1970): Macht und Gewalt. München: Piper, 1981 Baurmann (1999): Durkheims individualistische Theorie der sozialen Arbeitsteilung. In: Friedrichs und Jagodzinski (Hrsg.) (1999): Soziale Integration. Sonderheft 39/1999 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag Becker (1963): Außenseiter. Zur Soziologie abweichenden Verhaltens. Frankfurt am Main: Fischer, 1981 Berger und Luckmann (1966): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer, 1996 Berthold (1997): Transitive Macht, intransitive Macht und ihre Verbindung: Hermann Hellers Begriff der Organisation. In: Göhler u.a. (Hrsg.) (1997): Institution – Macht - Repräsentation: Wofür politische Institutionen stehen und wie sie wirken. Baden-Baden: Nomos Bohn und Hahn (1999): Selbstbeschreibung und Selbstthematisierung: Facetten der Identität in der modernen Gesellschaft. In: Willems und Hahn, (Hrsg.) (1999): Identität und Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Bourdieu (1979): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997 Bourdieu (1980): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999 Clinard (1957): Sociology of deviant behavior. New York: Holt, Rinhart and Winston, 1974 Cook (1985): Moralität und Sozialität bei Mead. In: Joas (Hrsg.) (1985): Das Problem der Intersubjektivität. Neuere Beiträge zum Werk George Herbert Meads. Frankfurt am Main: Suhrkamp de Levita (1965): Der Begriff der Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971 Dahrendorf (1958): Homo Sociologicus. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1977 257 Durkheim (1893): Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999 Elias u. Scotson (1965): Etablierte und Außenseiter. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990 Erikson (1959): Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979 Feest und Blankenburg (1972): Die Definitionsmacht der Polizei. Strategien der Strafverfolgung und soziale Selektion. Düsseldorf: Bertelsmann Frey (1983): Stigma und Identität. Weinheim: Beltz Gehlen (1956): Urmensch und Spätkultur. Bonn: Athenäum-Verlag Goffman (1959): Wir alle spielen Theater. München: Piper, 1996 Goffman (1961): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991 Goffman (1963): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main, 1996 Göhler (1997): Der Zusammenhang von Institution, Macht und Repräsentation. In: Göhler u.a. (1997): Institution – Macht - Repräsentation. Wofür politische Institutionen stehen und wie sie wirken. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft Gross (2000): Außer Kontrolle?! Individualisierung, Pluralisierung und Entscheidung. In: Hettlage und Vogt (Hrsg.) (2000). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag Habermas (1973a): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979 Habermas (1973b): Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp Habermas (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2. Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997 Heckhausen (1989): Motivation und Handeln. Berlin: Springer Heitmeyer (1992): Soziale Desintegration und Gewalt. Lebenswelten und -perspektiven von Jugendlichen. In: Mitgliederrundbrief der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. Nr. 138, 12/1992 Hettlage (1991): Rahmenanalyse – oder die innere Organisation unseres Wissens um die Ordnung der sozialen Wirklichkeit. In: Hettlage und Lenz (Hrsg.) (1991): Erving Goffman- ein soziologischer Klassiker der zweiten Generation. Stuttgart: UTB Hettlage und Lenz (1991): Erving Goffman – ein unbekannter Bekannter. In: Hettlage und Lenz (Hrsg.) (1991): Erving Goffman - ein soziologischer Klassiker der zweiten Generation. Stuttgart: UTB Hitzler (1999): Die ‚Entdeckung‘ der Lebens-Welten. Individualisierung im sozialen Wandel. In: Willems und Hahn (Hrsg.) (1999): Identität und Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Joas (1980): Praktische Intersubjektivität. Die Entwicklung des Werkes von G. H. Mead. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989 258 Joas (1985): Das Problem der Intersubjektivität. Neuere Beiträge zum Werk George Herbert Meads. Frankfurt am Main: Suhrkamp Joas (1997): Die Entstehung der Werte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Kiss (1973): Einführung in die soziologischen Theorien II. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1977 Kiss (1976): Steckbrief der Soziologie. Heidelberg: UTB für Wissenschaft, Quelle Meyer Koenen (2000): Nach der „Identität“. In: Hettlage und Vogt (Hrsg.) (2000): Identitäten in der modernen Welt. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag Krappmann (1969): Soziologische Dimension der Identität. Stuttgart: Klett Verlag, 1978 Lenz (1991): Erving Goffman – Werk und Rezeption. In: Hettlage und Lenz (Hrsg.) (1991): Erving Goffman - ein soziologischer Klassiker der zweiten Generation. Stuttgart: UTB Luhmann (1975): Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag Luhmann (1977): Arbeitsteilung und Moral. Durkheims Theorie. Einleitung zu Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999 Mead (1934): Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998 Merton (1957): Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press, 1968 Merton (1995): Soziologische Theorie und soziale Struktur. Berlin: Walter de Gruyter Montada (1982): Entwicklung der Moral. In: Oerter/Montada: Entwicklungspsychologie. München: Psychologie-Verlags-Union, 1987 Parsons (1951): The Social System. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1952 Parsons und Bales (1955): Family, Socialization and Interaction Process. New York: The Free Press Parsons (1964): Sozialstruktur und Persönlichkeit. Frankfurt am Main: Fachbuchhandlung für Psychologie Verlagsabteilung, 1979 Parsons (1968): Der Stellenwert des Identitätsbegriffs in der allgemeinen Handlungstheorie. In: Döbert u.a. (Hg.) (1977): Entwicklung des Ichs, Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1980 Pfuhl und Henry (1993): The Deviance Process. New York: Aldine de Gruyter Schimank (2000): Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie. Weinheim: Juventa Verlag Schimank (2002): Das zwiespältige Individuum – zum PersonGesellschaft-Arrangement der Moderne. Opladen: Leske u.Budrich Schmid (2003): Über Techniken, andere hinters Licht zu führen. Sozialpsychologische Einblicke in das Repertoire von Täuschungen und 259 Verzerrungen. In: Hettlage (Hrsg.) (2003): Verleugnen, Vertuschen, Verdrehen, Leben in der Lügengesellschaft. Konstanz: UVK Schwingel (1993): Analytik der Kämpfe. Macht und Herrschaft in der Soziologie Bourdieus. Hamburg: Argument-Verlag Schwingel (1995): Pierre Bourdieu zur Einführung. Hamburg: junius Verlag, 1998 Speth (1997): Pierre Bourdieu – die Ökonomisierung des Symbolischen. In: Göhler u.a. (Hrsg.) (1997). Baden-Baden: Nomos-Verlagsgesellschaft Steinert (1984): Zur Aktualität der Etikettierungstheorie. In: Kriminologisches Journal, Jg. 1985 Tajfel (1982): Gruppenkonflikt und Vorurteil. Entstehung und Funktion sozialer Stereotypen. Bern: Verlag Hans Huber Tenbruck (1985): George Herbert Mead und die Ursprünge der Soziologie in Deutschland und Amerika. Ein Kapitel über die Gültigkeit und Vergleichbarkeit soziologischer Theorie. In: Joas (Hrsg.) (1985): Das Problem der Intersubjektivität. Neuere Beiträge zum Werk George Herbert Meads. Frankfurt am Main: Suhrkamp Thiersch (1969): Stigmatisierung und Verfestigung des abweichenden Verhaltens. In: Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 1969. Vogt (2000): Identität und Kapital. Über den Zusammenhang von Identitätsoptionen und sozialer Ungleichheit. In: Hettlage und Vogt (Hrsg.) (2000): Identitäten in der modernen Welt. Opladen: Westdeutscher Verlag Weber (1922): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr, 1972 Wenzel (1985): Mead und Parsons. Die emergente Ordnung des sozialen Handelns. In: Joas (Hrsg.) (1985): Das Problem der Intersubjektivität. Neuere Beiträge zum Werk George Herbert Meads. Frankfurt am Main: Suhrkamp Willems (1997): Rahmen und Habitus. Zum theoretischen und methodischen Ansatz Erving Goffmans: Vergleiche, Anschlüsse und Anwendungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Wilson (1973): Theorien der Interaktion und Modelle soziologischer Erklärung. In: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg.) (1973): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit, Bd. 1. Reinbek bei Hamburg Wiswede (1973): Soziologie abweichenden Verhaltens. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer Wittpoth (1994): Rahmungen und Spielräume des Selbst. Frankfurt am Main: Diesterweg 260 Erklärung gemäß §6 Abs. 5 der Promotionsordnung des Fachbereichs Erziehungs-, Sozial und Geisteswissenschaften der FernUniversität - Gesamthochschule in Hagen vom 31. Januar 2001 Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation „Identität und Macht – Eine theoretische Auseinandersetzung mit der Soziologie gesellschaftlichen Außenseitertums“ selbständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und andere als die in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Dissertation hat zuvor keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen. Es ist mir bekannt, dass wegen einer falschen Versicherung bereits erfolgte Promotionsleistungen für ungültig erklärt werden und eine bereits verliehene Doktorwürde entzogen wird. Bernhard Fischer 261