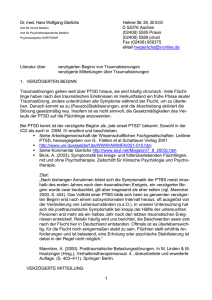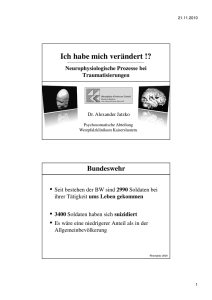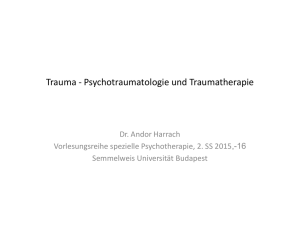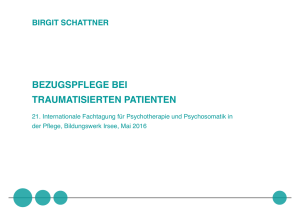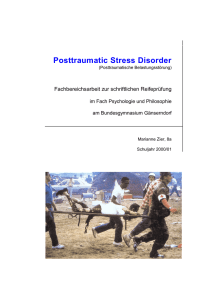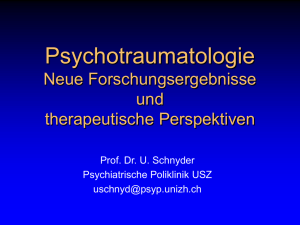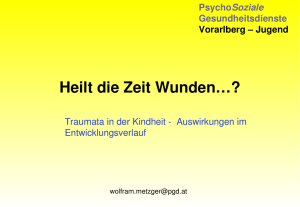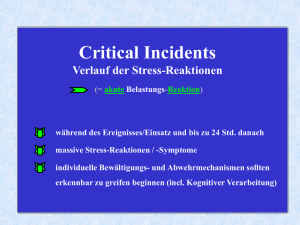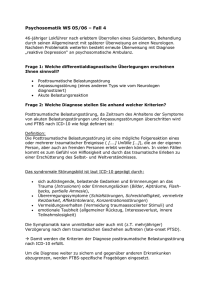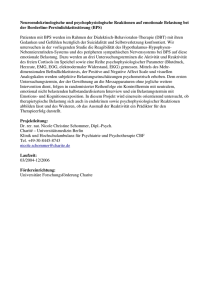Der Einfluss von Traumatisierung auf das Entstehen einer
Werbung

Aus der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Univ.-Prof. Dr. Freyberger) der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Der Einfluss von Traumatisierung auf das Entstehen einer Zwangsstörung Inaugural – Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.) der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2008 vorgelegt von: Jana Josepeit geb. am: 08.01.1980 in: Rüdersdorf bei Berlin Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Greifswald: Herr Prof. Dr. rer. nat. Heyo K. Kroemer Gutachter: Herr Prof. Dr. H.-J. Grabe (Greifswald) Herr Prof. Dr. R. D. Stieglitz (Basel) Die Disputation fand am 23. März 2009 statt. ZUSAMMENFASSUNG Hintergrund: Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Art der Assoziation und funktionellen Verknüpfung von Traumatisierung bzw. Posttraumatischer Belastungsstörung und Zwangsstörung. Einige Autoren betonten im Rahmen verschiedener Studien die Gemeinsamkeiten von OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) und PTSD (Posttraumatic-Stress Disorder): Die Überschneidung der klinischen Erscheinungsbilder, die zentrale Rolle der Angstwahrnehmung, die veränderte Risikowahrnehmung sowie neurobiologische Parallelen. Die Komorbidität beider Krankheitsbilder wurde, mit heterogenen Ergebnissen, in einigen Studien bereits untersucht. Anhand des zugrunde liegenden umfassenden Datensatzes (bestehend aus Klinikprobanden und Probanden der Allgemeinbevölkerung mehrerer Regionen Deutschlands) kann diese Arbeit daran anknüpfen, mit besonderem Fokus auf die funktionelle Verknüpfung beider Störungen. Dies war bisher eher Gegenstand einiger Fallstudien. Dabei wird von den Haupthypothesen ausgegangen, dass Zwangskranke im Vorfeld häufiger Traumatisierungen erlebt haben, anschließend häufiger eine PTSD entwickeln, wobei dann eine zeitlich enge Verknüpfung des OCD- und PTSDErkrankungsbeginns besteht und die Zwangserkrankung einen stärkeren Ausprägungsgrad erreicht als bei Probanden ohne Traumatisierung/ PTSD. Methode: Im Rahmen des DFG-geförderten Projekts „German Epidemiological Network for OCDStudies“ (GENOS) konnten seit Januar 2002 multizentrisch n=1352 Probanden untersucht werden. Hieraus wurden Interviewdaten von 225 Zwangs- und 133 Kontrollprobanden ausgewertet. Die direkten Interviews erfolgten mit dem „Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- Lifetime Anxiety for the assessment of DSMIV diagnoses“, die Fremdbefragungen mit dem „Instrument Family Informant Schedule and Criteria“ (FISC) in den jeweiligen deutschen Übersetzungen. Ergebnisse: Es zeigte sich weder eine höhere Real-Traumatisierungsrate noch eine häufigere PTSD-Diagnose bei Probanden mit Zwangsstörung verglichen mit den Kontrollen. Außerdem bestand keine Assoziation von OCD und PTSD bezüglich Trauma-Art, Erkrankungsschwere der OCD oder der Erkrankungsreihenfolge. Diskussion: Die Zwangsstörung zeichnet sich durch hohe Komorbiditätsraten aus. Es existiert jedoch anhand unserer Daten keine spezielle Subgruppierung Zwangskranker mit Traumatisierung oder gar einer PTSD. Gegebenenfalls besteht Traumatisierung/ PTSD eine in enge Assoziation Einzelfällen. von Zwangssymptomatik Möglicherweise existieren mit individuelle Vulnerabilitätsfaktoren, die die Entwicklung beider Krankheitsbilder fördern. Diskutiert werden hier insbesondere bestimmte kognitive Verarbeitungsmodelle und Emotionen wie Schuld und Scham. INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG .......................................................................................................... 1 1.1 Die Zwangsstörung – theoretische Grundlagen............................................................... 1 1.1.1 Erscheinungsbild, Komorbidität und Verlauf ................................................................. 1 1.1.1.1 Erscheinungsbild ...................................................................................................... 1 1.1.1.2 Komorbidität .............................................................................................................. 2 1.1.1.3 Verlauf....................................................................................................................... 2 1.1.2 Geschichte und ätiologische Modelle ........................................................................... 4 1.1.2.1 Geschichte ................................................................................................................ 4 1.1.2.2. Ätiologische Modelle ................................................................................................. 4 1.1.3 Epidemiologie................................................................................................................ 6 1.1.4 Diagnosestellung nach ICD-10 und DSM-iV ................................................................. 8 1.2 Traumatisierung und Posttraumatische Belastungsstörung- derzeitiger Forschungsstand ............................................................................................................... 10 1.2.1 Symptomatik, Verlauf und Komorbidität...................................................................... 10 1.2.1.1 Symptomatik ........................................................................................................... 10 1.2.1.2 Verlauf..................................................................................................................... 11 1.2.1.3 Komorbidität ............................................................................................................ 12 1.2.2 Geschichte und ätiologische Modelle der Störung ..................................................... 13 1.2.2.1 Geschichte .............................................................................................................. 13 1.2.2.2 Ätiologische Modelle ............................................................................................... 13 1.2.3 Epidemiologie.............................................................................................................. 17 1.2.4 Diagnosestellung nach ICD-10 und DSM-IV .............................................................. 18 1.3 2. Synthese und Hypothesen................................................................................................ 20 MATERIAL UND METHODEN .................................................................................. 24 2.1 Hintergrund der Studie...................................................................................................... 24 2.2 Datenerhebung .................................................................................................................. 24 2.2.1 Zusammensetzung der Stichprobe ............................................................................. 24 2.2.2 Stichprobenauswahl .................................................................................................... 24 2.2.2.1 Zwangs- und Kontrollprobanden der Untersuchungsstichprobe ............................ 24 2.2.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien .................................................................................. 25 2.2.3 Probandenrekrutierung ............................................................................................... 26 2.2.4 Durchführung und Mitarbeiter der Studie .................................................................... 26 2.3 Diagnostische Instrumente............................................................................................... 27 2.3.1 SADS-LA-IV ................................................................................................................ 27 2.3.2 Y-BOCS und Checkliste .............................................................................................. 28 2.3.3 Fremdbefragung (FISC) .............................................................................................. 29 2.4 3. Statistische Analysen........................................................................................................ 29 ERGEBNISSE ....................................................................................................... 31 3.1 Beschreibung der Stichprobe .......................................................................................... 31 3.1.1 Alters- und Geschlechterverteilung ............................................................................. 31 3.1.1.1 Alter......................................................................................................................... 31 3.1.1.2 Geschlecht .............................................................................................................. 32 3.1.2 Herkunft, Familienstand und Anzahl der Kinder ......................................................... 32 3.1.2.1 Herkunft .................................................................................................................. 32 3.1.2.2 Familienstand ......................................................................................................... 32 3.1.2.3 Kinderzahl ............................................................................................................... 33 3.1.3 3.1.4 Ausbildung .................................................................................................................. 34 Beruflicher Status ........................................................................................................ 34 3.2 Häufigkeit von Traumatisierung und PTSD in der Untersuchungstichprobe ............. 36 3.2.1 Traumatisierung bei Fällen und Kontrollen ................................................................. 36 3.2.2 PTSD ........................................................................................................................... 36 3.3 Zeitliche Assoziation des Krankheitsbeginns bei Probanden mit OCD, subklinischer und klinischer PTSD .......................................................................................................... 37 3.4 Formen der Traumatisierung ............................................................................................ 40 3.5 Der Einfluss von Traumatisierung und PTSD auf die Schwere der Zwangserkrankung ............................................................................................................................................. 41 3.5.1 Episodendauer ............................................................................................................ 42 3.5.2 Y-BOCS- Werte........................................................................................................... 43 3.5.3 Lebenszeitdiagnosen .................................................................................................. 44 3.5.3.1 OCD- Probanden ohne Trauma ............................................................................. 45 3.5.3.2 OCD- Probanden mit Trauma................................................................................. 46 3.5.3.3 OCD- Probanden mit PTSD.................................................................................... 46 4. DISKUSSION ........................................................................................................ 48 4.1 Stichprobe, Studienpopulation und Repräsentativität .................................................. 48 4.2 Material, Methoden und Studiendurchführung............................................................... 50 4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse ................................................................................. 52 4.3.1 Häufigkeit von Traumatisierung und PTSD ................................................................ 52 4.3.2 Zeitliche Assoziation bei Komorbidität von OCD und (sub- )klinischer PTSD ............ 53 4.3.3 Formen der Traumatisierung ...................................................................................... 55 4.3.4 OCD- Schwere nach Traumatisierung oder PTSD ..................................................... 56 5. LITERATUR ......................................................................................................... 60 ABBILDUNGSVERZEICHNIS DIAGRAMM 1: Reihenfolge und zeitlicher Abstand von OCD und (sub-) klinischer PTSD der OCD-Fälle ............................................................................................................................. 37 DIAGRAMM 2: mittlere OCD-Episodendauer der OCD-Untersuchungsstichprobe.............. 43 DIAGRAMM 3: Mediane des Y-BOCS-Gesamtscores der OCD-Untersuchungsgruppen ... 44 DIAGRAMM 4: Lebenszeitdiagnosen der Zwangsprobanden ohne Trauma........................ 45 DIAGRAMM 5: Lebenszeitdiagnosen der Zwangsprobanden mit Traumatisierung ............. 46 DIAGRAMM 6: Lebenszeitdiagnosen der Zwangsprobanden mit PTSD.............................. 46 Tabelle 1: Diagnosekriterien der Zwangsstörung nach ICD-10 und DSM-IV ____________ 9 Tabelle 2: Diagnosekriterien der PTSD nach ICD-10 und DSM-IV ___________________ 19 Tabelle 3: Zusammensetzung der Untersuchungsstichprobe _______________________ 31 Tabelle 4: Alter und Geschlecht der Untersuchungsstichprobe _____________________ 32 Tabelle 5: Familienstand der Untersuchungsstichprobe ___________________________ 33 Tabelle 6: Ausbildungsstand der Untersuchungsstichprobe ________________________ 34 Tabelle 7: Aktueller beruflicher Status der Untersuchungsstichprobe_________________ 35 Tabelle 8: Traumatisierung von Fällen und Kontrollen ____________________________ 36 Tabelle 9: PTSD- Häufigkeit bei Fällen und Kontrollen ____________________________ 36 Tabelle 10: Vergleich der Episodenverläufe bei komorbider OCD/ PTSD _____________ 38 Tabelle 11: Mittelwerte des Ersterkrankungsalters der OCD- Probanden______________ 39 Tabelle 12: Mittelwert des Ersterkrankungsalters bei (sub-)klinischer PTSD ___________ 39 Tabelle 13: Traumatisierungsart und PTSD- Diagnose bei Fällen und Kontrollen _______ 41 Tabelle 14: Episodendauer der Zwangserkrankung der OCD- ntersuchungsgruppen ____ 42 Tabelle 15: Mediane des Y-BOCS-Gesamtscores der OCD-Untersuchungsstichprobe ___ 44 Tabelle 16: Lebenszeitdiagnosen der OCD- Untersuchungsstichprobe _______________ 45 Tabelle 17: Statistische Auswertung der Lebenszeitdiagnosen innerhalb der OCDUntersuchungsstichprobe___________________________________________________ 47 ABKÜRZUNGEN m - männlich w - weiblich SD - Standardabweichung ± - Standardabweichung n - Anzahl MW - Mittelwert OCD - Obsessive-Compulsive Disorder PTSD - Posttraumatic-Stress Disorder ASD - Acute-Stress Disorder GAD - General-Anxiety Disorder SSRI - Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer PET - Positronen-Emissions-Tomographie MRT - Magnetresonanztomographie DSM-III-R - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, third edition revised DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth editon ICD-10 - International Classification for Mental Disorders, 10. Fassung APA - American Psychiatric Association WHO - World Health Organisation SADS-LA-IV - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- Lifetime Anxiety for the assessment of DSM-IV diagnoses FISC - Family Informant Schedule and Criteria Y-BOCS - Yale-Brown-Obsessive-Compulsive Scale SKID I,II - Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV (I,II) SHIP - Study of Health in Pomerania DFG - Deutsche Forschungsgesellschaft GENOS - German Epidemiologic Network for OCD-Studies BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung 1. EINLEITUNG 1.1 Die Zwangsstörung – theoretische Grundlagen Bei der Zwangserkrankung handelt es sich um eine bis in die 1980er-Jahre hinein in ihrer Häufigkeit unterschätzte heterogene Störung. Beschreibungen der vielfältigen Symptomatik werden durch ebenso unterschiedliche Angaben zu Erkrankungsbeginn, Komorbidität und Familiarität ergänzt. Mit der Tatsache, dass die meisten Menschen auf Nachfrage Zwänge bejahen, untermauerten Rachman (1978) und Salkovskis (1984) in ihren Studien den schmalen Grat zwischen normalem und abnormem zwanghaften Verhalten. In der jüngeren Forschung setzt hier die Diskussion um die Bedeutung subklinischer Störungsbilder an (Grabe et al. 2001; Stein et al. 1997). 1.1.1 Erscheinungsbild, Komorbidität und Verlauf 1.1.1.1 Erscheinungsbild Die Betroffenen verbringen unverhältnismäßig viel Zeit des Tages mit Zwangsgedanken und/ oder -handlungen. Beides wird von der Mehrzahl als aufdringlich und störend empfunden. Zwangsgedanken erkennen sie als eigen produzierte Vorstellungen, Gedanken, Bilder oder Impulse. Sie erscheinen ihnen aber überwiegend persönlichkeitsfremd und sinnlos. Aus Scham und Angst verstecken viele ihre Symptomatik, denn die charakteristischen Gedankeninhalte kreisen großteils um kulturell heikle Themen wie Kontamination, Aggressivität, Sexualität, Religion, Krankheit, Symmetrie und Ordnung. Die Einsicht in die Irrationalität der Gedanken veranlasst die Zwangserkrankten zu oftmals vergeblichen Unterdrückungsversuchen. Da jegliche Konzentration auf die immer wiederkehrenden Vorstellungen diese paradoxerweise verstärken, wächst auch die damit verbundene Anspannung und Angst. Um sie zu reduzieren wird versucht, die Zwangsgedanken mit bestimmten Handlungen zu neutralisieren oder ungeschehen zu machen. Da damit nur kurzfristig Erleichterung erreicht wird, beginnt der Kreislauf von neuem. Thematisch ähneln viele stereotyp wiederholten Handlungen den Zwangsgedanken: z.B. Reinigungsrituale, Kontrollieren, Zählen, Sammeln, Ordnen u. a. Als verdeckte Neutralisationsversuche gelten auch ritualisiert angewandte 1 Gedankenzwänge, welche den gleichen Effekt wie die auffälligeren Handlungszwänge anstreben. Wird die Ausführung der oft komplizierten Rituale behindert, folgt meist unerträgliches Unbehagen. Zum klinischen Bild gehören weiterhin ein den Phobien ähnelndes Vermeidungsverhalten, pathologischer Zweifel, Entscheidungsschwierigkeiten, übertriebenes Verantwortungsgefühl und Verlangsamung. Die Störung geht mit erheblichen Einschränkungen des alltäglichen und sozialen Lebens einher. Der Leidensdruck der Betroffenen ist enorm. 1.1.1.2 Komorbidität Die Zwangserkrankung besitzt eine hohe Komorbidität im Vergleich zu anderen Störungen. Im Rahmen klinischer Studien wird von mehr als der Hälfte der Zwangsprobanden mit einer oder mehrerer zusätzlicher Achse- I-Störung/-en zum Zeitpunkt der Untersuchung berichtet (Lensi et al. 1996; Rasmussen u. Tsuang 1986; Riddle et al. 1990). Auch epidemiologische Studien fanden hohe Komorbiditätsraten (Weissman et al. 1994). Dabei spielen affektive und Angststörungen eine herausragende Rolle: Angaben der Lebenszeitprävalenz für Major Depression reichen bis 67 % (Rasmussen u. Eisen 1988), wobei der Beginn vor, während oder nach dem der Zwangsstörung möglich ist (Grabe et al. 2001; Lensi et al. 1996). Angststörungen wie spezifische und soziale Phobien, Panikstörung und Generalisierte Angststörung (GAD) sind häufig und bestehen oft schon vor der Zwangsstörung, wobei der Frauenanteil dominiert (Lensi et al. 1996; Grabe et al. 2001). Die Zwangsspektrumerkrankungen (Tourette-Syndrom, Tics, Kleptomanie u.a.), die Somatisierungsstörung, Hypochondrie, Essstörungen (Grabe et al. 2000), Persönlichkeitsstörungen, dissoziative Phänomene (Grabe et al. 1999), Alkohol- und Substanzmissbrauch gelten ebenfalls als häufige komorbide Störungen (besonders in klinischen Studien) und beeinflussen den Therapieerfolg in negativer Weise. 1.1.1.3 Verlauf Typischerweise beginnt die Erkrankung frühzeitig. Bei 80% der Betroffenen treten die ersten Zwangssymptome vor dem 35. Lebensjahr auf. Das durchschnittliche Alter bei Beginn liegt zwischen 20 und 24 Jahren (Minichiello, Baer, Jenike and Holland, 1990). Anhand von Familienstudienergebnissen wird ein Subtyp mit 2 frühem Beginn in der Kindheit oder Adoleszenz diskutiert, welcher mit ausgeprägter Familiarität, männlichem Geschlecht, Ticstörung, Kontroll- und Symmetrieritualen zusammenzuhängen scheint (Hanna et al. 2005; Nestadt et al. 2000; Pauls et al. 1995; Lenane et al. 1990). Ein späterer Erkrankungsbeginn, assoziiert mit Depression, Angststörungen, verstärkt Zwangsgedanken und Waschritualen und ausgeglichener Geschlechterverteilung, bildet einen möglichen weiteren Subtyp. Der Erkrankungsbeginn folgt oftmals sogenannten life-events (Rasmussen u. Tsuang 1986; Rasmussen u. Eisen 1988), wozu die Geburt eines Kindes ebenso zählt wie eine Ehescheidung oder der Verlust eines nahestehenden Menschen. Letztere, auch als negative life-events bezeichnete Ereignisse, haben eine wichtigere Triggerfunktion für die Zwangssymptomatik als positiver erscheinende life-events (Lensi et al. 1996). Die Angaben zum OCDStörungsbeginn können von den Betroffenen negativer Lebensereignisse meist sehr genau gemacht werden, im Gegensatz zu denjenigen mit einschleichendem Erkrankungsbeginn. Der Einfluss von Stress und Krisen auf den Verlauf der Erkrankung wird oft angeführt. So finden sich generell Symptomverschlechterungen unter Stresseinwirkung (Rasmussen u. Tsuang 1986). In der Folge ergeben sich fluktuierende Krankheitsverläufe, die bei der Mehrzahl der Betroffenen beobachtet werden können. Nur für wenige gelten episodische oder sich chronisch verschlechternde Verläufe (Rasmussen u. Tsuang 1986; Rasmussen u. Eisen 1988). Eine vollständige Remission ist die Ausnahme. Nach einer Therapie berichten aber 90% der Befragten von einer Verbesserung ihrer Symptomatik. Die Tendenz zur Chronifizierung ergibt sich auch durch die lange Zeitspanne bis zur Erstbehandlung von durchschnittlich 7,5 Jahren (Rasmussen u. Tsuang 1986; Karno et al. 1988). Berichte von passageren Zwangssymptomen im Kindesalter, welche nur vorübergehenden Charakter besitzen, sind von den oben genannten Verläufen abzugrenzen. Zwangsgedanken und –handlungen scheinen selten getrennt aufzutreten (Riddle et al. 1990; Rasmussen u. Tsuang 1986). Im Verlauf der Erkrankung wandeln häufig auch deren Inhalte. Versuche prognostischer Abschätzung sind uneinheitlich. Eine Erschwerung der Therapie durch reine Gedankenzwänge und eventuell bestehende Persönlichkeitsstörungen werden genannt (Baer 1994). 3 1.1.2 1.1.2.1 Geschichte und ätiologische Modelle Geschichte 1838 beschrieb Esquirol erstmals einen Fall von Zwangserkrankung. Bis zur Jahrhundertwende sah man diese aber vorwiegend im Zusammenhang mit depressiven Störungen. Freuds Begriffsbildung der „Zwangsneurose“ 1894 begründete die analytische Sichtweise der Erkrankung. 1903 erschien „Obsessions and Psychasthenia“ von Janet, in dem er sein Phasenmodell des zwanghaften Spektrums erläuterte. Janets erste verhaltenstherapeutische Erfolge fanden vor dem Hintergrund der Theorien Freuds wenig Beachtung. Erst in den 50er-Jahren knüpfte man daran an. Drei Jahrzehnte später fand die Zwangserkrankung als eigenständige Störung Eingang in das Manual zur operationalisierten Diagnostik DSM-III (APA 1980). 1.1.2.2. Ätiologische Modelle Psychoanalytisches Modell Die psychodynamische Sichtweise der Zwangsentstehung basiert auf den Theorien Freuds. Entwicklungsgeschichtlicher Ursprung der Symptombildung ist demzufolge die anale Phase im 2.-3. Lebensjahr. In diese Zeitspanne fallende Diskrepanzen zwischen der Ich-, Über-ich- und Triebentwicklung (durch zu schnelle oder gehemmte Ich-Entwicklung oder rigide Reinlichkeitserziehung) führen zu Libidofixierung auf ebendiese Phase. Die dort entstandenen Grundkonflikte bezüglich Ambivalenzen wie Sauberkeit vs. Schmutz oder Überangepasstheit vs. Autonomiebestreben werden vom Ich als unvereinbar ins Unterbewusste verlegt. Sie bestimmen aber z.B. durch ständig präsente Abwehrmechanismen - eben die resultierende Zwangssymptomatik - das Verhalten. Ergänzend sei die autoprotektive Wirkung von Zwängen erwähnt: Gerade bei fragilem Selbsterleben und Ängsten vor Fragmentierung wie sie bei Persönlichkeitsstörungen, Psychosen und anderen Erkrankungen existieren, funktioniert die Zwangssymptomatik unter Umständen als Sicherheit gebend und stabilisierend (Grabe et al. 1999; Lang 1985, 1986). Lerntheoretisches Modell Die Zwangsstörung erscheint im Diagnosemanual des DSM-IV (allerdings anders als im ICD-10) unter den Angststörungen. Das unterstreicht die ätiologische Bedeutung der Lerntheorie, in welcher die Angst eine zentrale Rolle spielt. Dabei 4 betonte Seligman 1971 die Möglichkeit einer evolutionär bedingten biologischen „preparedness“ für bestimmte Angstinhalte. Demzufolge reichen die für Zwänge charakteristischen Kontaminationsängste oder Symmetriebedürfnisse zurück auf Urängste bezüglich Krankheit und Reviergefährdung. Sie sind löschungsresistenter und tendieren zur Generalisierung, also gelten diese Ängste als leichter übertragbar auf neue bzw. ähnliche Situationen. Die sich ab Mitte des 20.Jh. etablierende Behaviorale Theorie basiert auf dem 2Faktoren-Modell von Mowrer (1960). Intrusive (wiederkehrende, aufdringliche) Gedanken, welche schon in diesem Ansatz als in der Bevölkerung weit verbreitet gelten, fungieren zu Beginn als neutraler Stimulus, werden aber mit der darauf folgenden Angstreaktion konditioniert und so zum aversiven Stimulus. Als zweiter Schritt, auch operante Konditionierung genannt, erfolgt bei erneutem Erscheinen des Stimulus entweder Vermeidung oder ein neutralisierendes Zwangsritual. Die Ausführung dieser Rituale erfolgt im Sinne einer negativ verstärkten Reaktion. Eine Neubewertung des aversiv konditionierten Stimulus kann daher nicht erfolgen und die Verhaltensweise verfestigt sich. Hier setzt die Therapieform der Reizkonfrontation und Reaktionsverhinderung an (Meyer 1966; Rachman 1971). Optimale Erfolge bei diesem symptomorientierten Therapieansatz werden bei Wasch- und Reinigungszwängen berichtet. Die Erweiterung des Modells zum kognitiv-behavioralen Ansatz durch Clark und Salkovskis entstand aus der Beobachtung, dass oftmals verzerrte Kognitionen den Zwängen zugrunde liegen und den evtl. schon errungenen Therapieerfolg wieder vernichten. Fehlerhafte Kognitionen können sein: Übersteigertes Verantwortungs- oder Schuldgefühl, Missinterpretationen (z.B. Gefahrenabschätzung) und „ThoughtAction-Fusion“, was die Annahme bezeichnet, dass auf eigene Gedanken die ausführende Handlung unmittelbar folgen wird. Als weitere Vulnerabilitätsfaktoren werden Depression und Angstanfälligkeit genannt (Rachman, 1997). Neurobiologisches Modell Tuke räumte bereits 1884 die Möglichkeit kortikaler Dysfunktionen bei Zwangserkrankungen ein. In neuerer Zeit verfestigte die Beobachtung von Zwangssymptomatik in Verbindung mit Epilepsie, Schädel-Hirn-Trauma und Geburtstraumata den neurobiologischen Einfluss. Präzisere Aussagen zu den Zusammenhängen wurden durch Studien zu Läsionen bestimmter Hirnareale möglich, z.B. Infarkt oder Degeneration der Basalganglien (Übersicht bei Cummings u. Cunningham 1992). Bildgebende Verfahren zur Bestimmung des regionalen Blutflusses und der Stoffwechselrate ermittelten erhöhte Aktivitätsraten unter Ruhebedingungen und Symptomprovokation im orbitofrontalen Kortex, Nucl. 5 caudatus, Gyrus cinguli, thalamischen und frontalen Arealen (Übersicht bei Grabe und Freyberger 1999). Neurochemisch bewirkt eine Erhöhung der extrazellulären Serotoninkonzentration durch (selektive) Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer bei 50-70 % der Patienten eine Verbesserung ihrer Symptomatik (Goodman et al. 1992), was ein Beleg für die Rolle des Serotonergen Systems ist. Herausragende Bedeutung in der Forschung zur Pathogenese der Zwangserkrankung besitzen die Amygdala-Neuronenpopulation und das Modell der dysfunktionalen orbitofrontalen-striato-thalamischen Regelkreise. Die für Konditionierungsprozesse aversiver Stimuli wichtige Amygdala assoziiert sensorische Information mit emotionalem Inhalt. Ihre Efferenzen bewirken einerseits emotionale, vegetative und motivationale Reaktionen durch Projektion in hypothalamische Kerngebiete und den Hirnstamm. Andererseits ziehen Efferenzen über den mediodorsalen Nucleus des Thalamus zurück zum orbitofrontalen Kortex (besonders zu dessen posteriorem Teil), der durch modulatorischen Einfluss und die enge funktionelle Bindung an die Amygdalaregion an der Entstehung der Zwangsstörung beteiligt ist. Zusätzlich genannt werden Mechanismen, die inhibitorisch auf Efferenzen des mediodorsalen Nucleus des Thalamus wirken, da zahlreiche Projektionsbahnen von kortikalen Regionen, Amygdala und Basalganglien über diesen ziehen. Eine Imbalance der direkten und indirekten orbitofrontalen-striato-thalamischen Regelkreise scheint ebenfalls Zwangssymptome auszulösen. Die in diesem Modell beschriebenen „loops“ funktionieren als exzitatorische, unidirektionale Neuronenprojektionen ausgehend vom orbitofrontalen Kortex über Striatum, Globus pallidus, Thalamus zurück zum orbitofrontalen Kortex. Ein positiver Feedbackmechanismus zu letzterem, ausgelöst durch desinhibierte exzitatorische Impulse innerhalb dieser Regelkreise, scheint Perseverationen der Informationsinhalte zu produzieren. Subjektives Erleben von Zwangsgedanken und repetitives motorisches Verhalten im Sinne der Reduktion von Angst und Anspannung mag die Folge sein. 1.1.3 Epidemiologie Als „hidden epidemic“ beschrieb Jenike 1989 die Zwangsstörung (oder engl. OCD für „Obsessive-Compulsive Disorder“), infolge der überraschenden Forschungsergebnisse zur OCD-Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung seit Anfang der 80er Jahre. Vorreiterrolle besaß die „Epidemiologic Catchment Area Study (ECA)“ unter Anwendung des strukturierten Diagnostic-Interview-Schedule (DIS) mit DSM-IIIDiagnosen. Die dort ermittelte Lebenszeitprävalenzrate von 2,5% (Karno et al. 6 1988) übertraf alle bisherigen Angaben (Übersicht bei Bebbington 1998). Bis zu dem Zeitpunkt galt die Erkrankung als äußerst selten. 6-Monatsprävalenzraten lagen zuvor zwischen 0,05-0,1% (Carey et al. 1980). Ähnliche weltweite epidemiologische Studien folgten auf die ECA (Weissman et al. 1994) mit vergleichbaren Lebenszeitprävalenzen von 1,9-2,5 %. 1997 ermittelten Stein et al. in Telefoninterviews eine 1-Monatsprävalenz von 3,1% (mit dem Composite Diagnostic Interview, CIDI, auf Grundlage von DSM-IVKriterien). Die Verwendung standardisierter Interviews wie CIDI und DIS erfuhr im Nachhinein allerdings Kritik als zu wenig valide (Nelson und Rice 1997; Stein et al. 1997). Die Möglichkeit der Prävalenzüberschätzung in diesen Studien musste eingeräumt werden. In neueren Studien findet verstärkt auch die subklinische Zwangserkrankung Beachtung: Bei Grabe et al. (2000) lag deren Lebenszeitprävalenz mit 2% vergleichsweise hoch gegenüber 0,5% der vollen Zwangsdiagnose. Als Fazit werden OCD-Bevölkerungsprävalenzraten von 2-3% angegeben (Karno et al. 1988; Weissman et al. 1994; Zaudig et al. 2002). Somit gilt die Zwangserkrankung als vierthäufigste psychische Störung weltweit. Es existiert eine Vielzahl von Familienstudien allerdings mit heterogenen Ergebnissen. Angaben ohne oder mit nur minimal erhöhter OCD-Prävalenz bei Angehörigen von Erkrankten (Rosenberg 1967; Insel et al. 1983; McKeon et al. 1987) stehen den Studien mit eindeutiger Familiarität gegenüber (Lenane et al. 1990; Pauls et al. 1995; Nestadt et al. 2000; Fyer et al. 2005). Im Allgemeinen wird eine Gleichverteilung der Geschlechter angenommen. In einigen Studien scheinen Frauen geringfügig zu dominieren, was aber selten signifikante Unterschiede ergibt. Bogetto et al. (1999) beschreiben bei den Männern ihrer Studie charakteristischerweise einen schleichenden frühen Beginn, wohingegen die Frauen verstärkt einen akuten Beginn der Störung (vor allem nach stressvollen Ereignissen) angeben. Signifikante Unterschiede hinsichtlich Intelligenz und sozialer Schicht konnten nicht beobachtet werden. Unter Zwangserkrankten, und hier insbesondere bei Männern, finden sich vermehrt Unverheiratete und Geschiedene, weshalb eine eheliche Fehlanpassung angenommen wird (Rasmussen u. Eisen 1992; Lensi et al. 1996). Angaben zur Geburtsreihenfolge bleiben uneinheitlich. Einige Autoren berichten von einem signifikant erhöhten Anteil Erstgeborener und Einzelkinder unter den Betroffenen (Kayton u. Borge 1967; McKeon u. Murray 1987). 7 1.1.4 Diagnosestellung nach ICD-10 und DSM-IV Um die teilweise erheblich variierenden Diagnosestellungen in Klinik und Forschung vergleichbar zu machen, entstanden die zwei international gültigen Kriterienkataloge ICD-10 und DSM-IV mit ihren multiaxialen Diagnosesystemen. Momentan liegen die zehnte Fassung der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebenen International Classification of Mental Disorders (ICD-10) (Dilling et al. 1993 u. 1994) sowie die vierte Fassung des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) der American Psychiatric Association (APA, 1994) vor. Die Zwangsstörung erfuhr 1980 als eigenständiges operational definiertes Krankheitsbild Eingang in das DSM-III. Hier wurde sie, wie auch heute im DSM-IV, in der Klasse der Angststörungen aufgeführt. Im ICD-10 erscheint sie unter der Gruppe der Neurotischen-, Belastungs- und Somatoformen Störungen. Ein zusätzliches Subtypenkriterium bezieht sich darin auf das Vorhandensein von entweder Zwangshandlungen, Zwangsgedanken oder Mischtypen. In beiden Systemen werden Zwangsgedanken oder –handlungen vorausgesetzt, welche von dem Betroffenen als aufdringlich, unsinnig und übertrieben empfunden, aber als von ihm selbst produziert erkannt werden und gegen die er zumindest zu einem Zeitpunkt der Erkrankung Widerstand leistet. Aufgrund klinischer Beobachtungen von Patienten mit nicht vorhandener oder minimaler Einsicht in die Irrationalität der Gedanken oder Handlungen existiert im DSM-IV ein dementsprechender Subtyp. Weitere zu erfüllende Diagnosekriterien beinhalten erheblichen subjektiven Leidensdruck und massive psychosoziale Beeinträchtigungen, denen sich die Betroffenen gegenübersehen. Eine Gegenüberstellung der OCD-Kriterien beider Diagnosesysteme zeigt Tabelle 1. Das Komorbiditätsprinzip, auch mit vorhandenen Ausschlusskriterien im Falle anderer psychischer oder organisch bedingter Störungen, gilt für DSM-IV sowie für ICD-10. Die Forschung beschäftigt sich derzeit mit der Frage inwieweit die subklinische Zwangsstörung als eigenständiges Krankheitsbild in die diagnostischen Leitlinien mit einfließen sollte (Grabe et al. 2000, 2001; Stein et al. 1997). Hier herrscht noch weitgehend Uneinigkeit bezüglich der zu definierenden diagnostischen Kriterienkombination. Grabe et al. (2000) erfassten subklinischen Zwang bei positiver Eingangsfrage und mindestens einem zusätzlichen Kriterium gemäß DSM-IV (Zeitkriterium und/ oder Unbehagen beinhaltend), während für Stein et al. (1997) alle DSM-IV-Kriterien erfüllt sein mussten mit Ausnahme des Zeit- und Unbehagenkriteriums. 8 TABELLE 1: DIAGNOSEKRITERIEN DER ZWANGSSTÖRUNG NACH ICD-10 UND DSM-IV 1 Kriterium ICD-10 Diagnose F42 DSM-IV Diagnose 300.3 Obsessionen (OB) oder Kompulsionen (KO) Definition Obsessionen: wiederkehrende, persistierende Gedanken, Impulse oder Bilder, die zu einigen Zeitpunkten der Störung als aufdringlich und unangebracht erfahren werden und ausgeprägte Angst oder Leiden hervorrufen. Kompulsionen: sich wiederholende Verhaltensweisen oder geistige Handlungen, zu der sich die Person veranlaßt fühlt, als Antwort auf eine OB oder als rigide Befolgung von Regeln; sie dienen der Leidensprävention und reduktion sowie der Prävention gefürchteter Situationen, wobei diese Verknüpfung offensichtlich unrealistisch oder klar übertrieben ist. Episodendauer mindestens zwei Wochen länger andauernd Zeitaufwand während der meisten Zeit des Tages Zeitaufwand > 1h pro Tag Einsicht Anerkennen als eigene Gedanken und/ obsessionale Gedanken, Impulse oder oder Handlungen Bilder werden als Produkt eigenen Denkens angesehen mindestens ein ZG/ ZH wird gean einem Punkt des Verlaufs der Störung genwärtig als übertrieben und unsinnig werden die OB oder KO als exzessiv und anerkannt übertrieben angesehen; trifft nicht bei Kindern zu Leidensdruck Leiden wird empfunden ausgeprägtes Leiden wird empfunden Ausführung von ZG/ ZH ist von der Angstreduktion abgesehen nicht angenehm Beeinträchtigung soziale oder individuelle Leibedeutend; übliche Lebensgestungsfähigkeit, meist durch Zeitwohnheiten, berufliche/ akademische aufwand Leistungsfähigkeit oder übliche soziale Aktivitäten oder Beziehungen es wird versucht, die Gedanken, Impulse Widerstand es wurde versucht Widerstand zu leisten; gegenwärtig wird gegen oder Bilder zu ignorieren oder zu mindestens einen ZG/ ZH Widerstand unterdrücken oder sie mit anderen geleistet Gedanken oder Handlungen zu neutralisieren. Ausschluß andere psychische Störung wie Inhalt der OB bezieht sich auf eine Schizophrenie, verwandte oder affektive andere Achse-I-Störung; Störung ist Folge Störungen physiologischer Effekte, bedingt durch Substanzen oder medizinische Umstände OB sind durch exzessive Sorgen über Probleme des wirklichen Lebens begründet Spezifikation F42.0 vorwiegend ZG und GrüMit geringer Einsicht (With Poor Insight): belzwang OB und KO werden die überwiegende Zeit F42.1 vorwiegend ZH (Zwangsrituale) nicht als exzessiv oder übertrieben F42.2 ZG und –handlungen gemischt erkannt F42.8 sonstige Zwangsstörung F42.9 nicht näher bezeichnete Zwangsstörung Vorliegen von Zwangsgedanken (ZG) und/ oder −handlungen (ZH) Zwangsgedanken: stereotype Ideen, Vorstellungen oder Impulse, die aufgrund ihres Inhalts oder ihrer Sinnlosigkeit quälend erlebt werden. Zwangshandlungen/ -rituale: ständige Stereotypien, die als nicht angenehm empfunden und nicht nützlich angesehen werden. Meist werden sie als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches, schadenbringendes Ereignis erlebt. 1: Zusammenfassung der klinisch diagnostischen Leitlinien und der Forschungskriterien des ICD-10 OB=Obsession/ -en (engl. obsession) KO=Kompulsion/ -en (engl. compulsion) ZG=Zwangsgedanke ZH=Zwangshandlung 9 1.2 Traumatisierung und Posttraumatische Belastungsstörung -derzeitiger Forschungsstand- 1.2.1 1.2.1.1 Symptomatik, Verlauf und Komorbidität Symptomatik Ebenso wie die Belastungsstörung Zwangserkrankung (engl.: PTSD für wird bei der Posttraumatischen Post-Traumatic-Stress Disorder) die Heterogenität des Störungsbildes betont. So besteht die Möglichkeit bei zwei Personen eine PTSD zu diagnostizieren, ohne dass sie ein einziges deckungsgleiches Symptom besäßen. Das Störungsbild entwickelt sich als Reaktion auf einen traumatischen Stressor, speziell auf ein außergewöhnlich belastendes, extreme Angst und Hilflosigkeit induzierendes Erlebnis. Die dominierenden Symptome, zusammengefasst in syndromale Kategorien, werden im Folgenden beschrieben: Als momentan, auch diagnostisch, relevantestes Kriterium tritt ungewolltes intrusives Wiedererleben von Traumaassoziierten sensorischen Eindrücken, Bildern und Gefühlen oft in Form von so genannten Flashbacks auf, charakteristischerweise während Ruhephasen. Diese Erinnerungen können in einer solchen Intensität erscheinen, als würde das Ereignis gerade wieder stattfinden. Die emotionale Überwältigung geht häufig einher mit Angst vor Kontrollverlust, vor dem Verrücktwerden und einer erhöhten Schreckreaktion, hervorgerufen durch eine Art Daueralarmbereitschaft und der selektiven Wahrnehmung potentiell Trauma-relevanter Inhalte. Das Erleben dieser intensiven Emotionen ist verbunden mit erhöhter autonom-nervöser Übererregbarkeit. Letzteres, auch als autonomes Hyperarousal bezeichnet, stellt zusammen mit zum Konzentrationsstörungen Beispiel eine Schlafstörungen, weitere Kategorie dar. Reizbarkeit In einer und dritten Symptomgruppe imponieren ausgeprägtes Vermeidungsverhalten, Verleugnung, Entfremdungsgefühle gegenüber der Umwelt und nicht selten eine Art psychische Erstarrung („freezing“), emotionale Betäubung oder Affektverflachung („numbing“), was als Notfallreaktion angesichts der sonst überwältigenden Emotionen gedeutet wird. Vermeidende Verhaltensweisen können sich auch in übertriebenem Aktivismus oder Verharren in stereotypen Handlungen (die z.B. vor dem traumatischen Erlebnis unmittelbar wichtig waren) äußern (Horowitz 1986). Ein Wechselspiel zwischen Intrusionen (also wiederkehrenden, aufdringlichen 10 Gedanken) und Vermeidungsverhalten beschreiben viele Autoren als charakteristisch für den traumatischen Prozess (Kapfhammer 2003; Horowitz 1986; Fischer und Riedesser 1998). Bis zu einem gewissen Grad erscheinen diese Symptome in mehr oder weniger ausgeprägter Form normalpsychische Reaktionsweisen auf extreme Erlebnisse zu sein. Bei dem Versuch adäquate von psychopathologischen Traumareaktionen abzugrenzen, werden insbesondere eine lang anhaltende und psychosozial stark beeinträchtigende Symptomatik infolge fehlender sozialer Unterstützung, mangelnder Copingstrategien oder vorbestehender psychologischer Probleme als ausschlaggebende Faktoren für ein klinisches Störungsbild betont (Horowitz 1986; Fischer u. Riedesser 1998). 1.2.1.2 Verlauf Die Ausprägung einer lang anhaltenden Belastungsstörung folgt meist unmittelbar auf das traumatische Erlebnis, seltener (etwa bei 11%, McNally 1998) mit verzögertem Beginn innerhalb von sechs Monaten nach dem Ereignis. Unterschieden wird die akute posttraumatische Belastungsstörung (mit einer Dauer von unter 3 Monaten) von der chronischen Verlaufsform (Dauer über 3 Monate). Beginnt und endet die Symptomatik innerhalb eines 4-wöchigen Zeitraums nach dem traumatischen Ereignis spricht man von Akuter Belastungsstörung (ASD). Nicht alle Personen mit schwerwiegenden Traumata bilden eine PTSD aus. Interindividuelle Unterschiede und auch die Art des Traumas, Expositionsdauer und nicht zuletzt psychosoziale Umweltfaktoren tragen zu der komplexen Entstehungsgeschichte der PTSD bei. Als prognostisch ungünstig gelten zum einen peritraumatische Faktoren wie Dissoziationsphänomene (z.B. Depersonalisation und veränderte Zeitwahrnehmung) (Bremner et al.1992; Marmar et al.1994; Shalev et al.1996), Erstarrung, totaler Autonomieverlust und zeitweiliges Sich-Aufgeben (Fischer u. Riedesser 1998). Zum anderen erhöht das Vorhandensein einer Akuten Belastungsstörung, persistierende Dissoziation nach dem Ereignis sowie Hyperarousal die Wahrscheinlichkeit für eine PTSD- Diagnose (Murray et al. 2002; Harvey& Bryant 1998; Blanchard et al. 1996). Schätzungsweise ein Drittel aller Personen mit PTSD-Diagnose entwickeln einen chronischen Symptomverlauf (Fairbank et al. 1995; Kessler et al. 1995). Die durchschnittliche Erkrankungsdauer wird in der National Comorbidity Survey (Kessler et al. 1995) mit ca. drei Jahren angegeben, allerdings erfolgen bei etwa 50% aller Betroffenen Spontanremissionen im ersten Jahr (Ehlers et. al 1998). Das Risiko der Chronifizierung steigt mit der Schwere der anfänglichen Symptomatik 11 (Ehlers et al. 1998). Ebenso scheinen höhere Komorbiditätsraten mit affektiven und Angststörungen, weibliches Geschlecht und das Auftreten von emotionalem Betäubtsein mit chronischen Verläufen positiv zu korrelieren (Breslau u. Davis 1992). 1.2.1.3 Komorbidität Großen Raum in der PTSD-Forschung nimmt die Frage nach der außergewöhnlich hohen Komorbidität ein. 50-90% der Erkrankten besitzen laut Brady (1997) zusätzlich mindestens eine weitere Lifetime-Diagnose. In der Studie von Kessler et al. (1995) lagen diese Angaben für Männer bei 88 % und bei den Frauen bei 78 %. An oberster Stelle komorbider Störungen stehen Substanzmissbrauch, depressive Störungen und Angsterkrankungen, psychotische Störungen, somatoforme und Persönlichkeitsstörungen. Selbst auf somatischer Ebene existiert ein erhöhtes Risiko für Infektionen und Erkrankungen des Nervensystems (Boscarino 1997). Vielfältige Erklärungsansätze versuchen die Zusammenhänge dieser extremen Komorbidität zu ergründen. Eine offensichtliche Symptomüberlappung mit anderen Störungsbildern (hauptsächlich aus dem Affektiven und dem Angstspektrum) gilt als nicht zu unterschätzende Gefahr für Fehldiagnosen (Brady 1997, Pigott et al. 1994). Unklar ist, wie viel Einfluss einerseits mögliche Vulnerabilitätsfaktoren besitzen (im Sinne einer Prädisposition für erhöhte Traumaexposition und anschließender PTSD-Entwicklung). Andererseits fragt sich, wie stark ausschlaggebend und wegbereitend primär das Trauma oder die PTSD für solch hohe Komorbidität ist. So berichteten in der Studie von Brown und Harris (1987) 60 % der Probanden mit einer diagnostizierten psychischen Störung von einem schwerwiegenden life-event innerhalb der zwei Wochen vor Erkrankungsbeginn, wobei nicht geklärt werden konnte inwiefern unterschwellig prämorbide Vulnerabilitätsfaktoren zu diesen Ereignissen geführt haben könnten. Alternativ findet auch eine möglicherweise allen komorbiden Symptomen gemeinsam unterliegende ursächliche Neurotransmitterfunktionsstörung Erwähnung (VuksicMihaljevic et al. 1999). Kessler et al. (1995) beschreiben, dass bei primärer PTSD besonders die zusätzliche Entwicklung von Depressiven Störungsbildern (bes. Major Depression, Dysthymie) und Substanzmissbrauch typisch sei. Im Zusammenhang mit Angststörungen stellt die PTSD jeweils zur Hälfte eine primäre bzw. sekundäre Erkrankung dar, wobei insbesondere einfache und soziale Phobien vor der Belastungsstörung und sekundär Generalisierte Angststörungen (GAD) und Agoraphobien auffielen (Perkonigg et al. 2000). 12 1.2.2 Geschichte und ätiologische Modelle der Störung 1.2.2.1 Geschichte Erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts verschwand die Überzeugung der konstitutionellen Schwäche für psychische Folgen nach Traumatisierung. Jahrelanger Diskussionsgegenstand war die Frage nach primär organischer oder psychischer Grundlage der Symptomatik. 1889 verwandte Oppenheim erstmalig in seinen Berichten über Arbeits- und Eisenbahnunfälle den Begriff der „traumatischen Neurose“. Zuvor gingen Begriffe wie „Railway Spine Syndrom“ (Erichsen 1867) und „irritable heart“ (da Costa 1871) in die Literatur ein. Gemeinsam war allen die Annahme somatischer Ursachen: So erwog Erichsen Rückenmarksverletzungen durch Erschütterungen bei Eisenbahnunglücken. Charcot und Janet befassten sich mit dem Einfluss von Traumatisierung, insbesondere im Hinblick auf hysterische Phänomene. Daran anknüpfend hoben Breuer und Freud anfänglich die elementare Rolle von Traumatisierung in der Neurosenentstehung hervor. Vor dem Hintergrund des Sozialversicherungssystems Bismarcks und der beiden Weltkriege erhielt die Betrachtungsweise einer Simulation aufgrund von Rentenbegehren als Symptomursache einen hohen Stellenwert. Kardiners Untersuchungen an Soldaten des Ersten Weltkrieges flossen in sein Werk „The Traumatic Neuroses of War“ ein (1941), dessen Symptombilder schon große Gemeinsamkeiten mit der heutigen Beschreibung des Störungsbildes aufweisen. Die Traumaforschung beschäftigte sich lange Zeit vorwiegend mit Extremtraumatisierungen in Verbindung mit den beiden Weltkriegen, insbesondere den Folgen des Holocaust, und später dem Vietnamkrieg. An der Ausweitung auf Ziviltraumata war Horowitz (1986) maßgeblich beteiligt. Die Forschungsarbeiten schlugen sich in den jeweiligen Fassungen der Diagnosemanuale der APA (DSM-I bis -IV) nieder. 1.2.2.2 Ätiologische Modelle Psychoanalytisches Modell Freuds Traumadefinition (1920) fußt auf seinem „ökonomisch-energetischen Modell“. Es beschreibt das Durchbrechen der individuellen Reizschranke eines Organismus durch übergroßen Erregungszuwachs. Diese „Reizüberflutung“ erstickt 13 die in dem Moment verfügbaren Abwehrversuche und Schutzmechanismen im Keim und erschwert so adäquate Verarbeitungsprozesse. In der Folge etabliert sich ein intrapsychischer Konflikt zwischen intrusionsartigem Bewusstwerden der Traumaerinnerung als Verarbeitungsversuch und starken Abwehrmechanismen wie Vermeidung und Verleugnung. Die Intrusionen bezeichnete Freud auch als „Tendenz zum Wiederholungszwang“. Khan prägte 1963 den Begriff des „Kumulativen Traumas“: Auch eine Addition zeitlich nacheinander auftretender subtraumatischer Ereignisse kann somit den Selbstschutz des Ichs auf lange Sicht vernichten. Anna Freud betonte den Überraschungseffekt des traumatischen Ereignis, der die „Vermittlertätigkeit des Ichs außer Kraft“ setzt und zur unmittelbaren Handlungsunfähigkeit führt (1967). Die Weiterentwicklung von Freuds energetischem Traumaschwerpunkt zu einem Modell zentraler Informationsverarbeitungsprobleme gelang Horowitz 1979. Darin überschreitet unverträgliche Information die Kapazitäten der Verarbeitung insbesondere durch das Unerwartete der Situation. Die Bewältigung der traumatischen Erfahrung, laut Piaget erfolgreiche Assimilation und Akkomodation, erfordert deren vollständige Integration in das jeweilige verinnerlichte Selbst- und Weltbild. Lerntheoretisches Modell Die exponierte Stellung der Angst bei Personen mit insbesondere chronischer posttraumatischer Belastungsstörung erklären Ehlers und Clark (2000) mit der aus störungsspezifischer Traumaverarbeitung resultierender gegenwärtiger Bedrohungswahrnehmung. Das Modell der klassischen Konditionierung spielt auch hier eine wichtige Rolle. Die vormals unspezifischen Stimuli stehen in nicht selten entfernter Beziehung zur traumatischen Situation und triggern eine intensive Angstantwort nach Traumaerlebens Konditionierung und dem mit autonomen den starken Hyperarousal. Emotionen des Aufgrund von Reizgeneralisierung erfolgt eine Sensibilisierung selbst auf unterschwellige Stimuli (Paige et al. 1990). Dieses ausgeprägte assoziative Reizlernen erweckte bei einigen Wissenschaftlern die Vorstellung einer Art stabilen Traumanetzwerks, in dem die spezifischen (breit generalisierten) Erinnerungen verknüpft gespeichert vorliegen und sich gegenseitig auf subtile Weise aktivieren können (Lang 1979; Litz u. Keane 1989). Trotz des ausgeprägten assoziativen Lernens handelt es sich doch um eine selektive Wahrnehmung und führt zu einer Art Tunnelblick nur für potentiell Trauma-relevante Inhalte. Stimulusdiskrimination und Dazu verringerte kommen häufig Habituation. Die eine erschwerte Schwierigkeit der 14 Unterscheidung wichtiger von unwichtiger Information, einerseits inadäquate Übererregung angesichts neutraler Reize und andererseits Unaufmerksamkeit gegenüber existentiell wichtiger aber in dem Moment affektiv neutraler Reize, birgt die Gefahr der Retraumatisierung (McFarlane et al. 1993). Kognitive Überzeugungen, Fehlinterpretationen der Trauma-Bedeutung, oftmals verknüpft mit starken Schuld- oder Schamgefühlen, und dysfunktionale CopingStrategien halten das Störungsbild aufrecht. So existieren häufig vielfältige Verzerrungen der Selbst- und Objektwahrnehmung (unter Einbeziehung früherer Erfahrungen) hinsichtlich Themen wie Sicherheit, Vertrauen, Autonomie, Selbstwirksamkeit und Hoffnung. Kontraproduktive Verhaltensweisen wie ständiges Grübeln, Gedankenunterdrückung, Rückzug, Selbstmedikation und Vermeidung (im Sinne negativer Verstärkung) erschweren die Traumaverarbeitung. Effektive Traumatherapie Reizkonfrontation im beruht, Sinne ähnlich einer dem Zwang, Desensibilisierung zur im Kern auf Senkung des Hyperarousals, als auch auf einer kognitiven Neubewertung der TraumaBedeutungen für den Einzelnen. Neurobiologisches Modell Mittlerweile existieren schon mehrfach replizierte, wenn auch noch inkongruente Forschungsergebnisse zu den biologischen Korrelaten der PTSD. Wobei noch nicht endgültige Klarheit besteht, inwiefern die Funde PTSD- und nicht nur traumaspezifisch sind. Die Effekte intensiv- und lang anhaltender Stressoreinwirkung treten besonders in psychophysiologischer, neurohormoneller, neuroanatomischer sowie immunologischer Hinsicht auf (Übersicht bei Hull 2002). Neurohormonell führen charakteristische Dysfunktionen zu beispielsweise erhöhten Katecholaminwerten bei Reizexposition: Zentral überschießende noradrenerge Innervierung zusammen mit der peripheren Sympathikusaktivierung bedingen das schon beschriebene Hyperarousal. Diese Ergebnisse stützen Studien, in denen nach experimenteller Gabe des α 2- Antagonisten Yohimbin die PTSD-Symptomatik stark anwuchs (Bremner et al. 1997b). Des Weiteren fällt ein erniedrigter basaler Glukokortikoidwert auf, verursacht durch Dysfunktionen des Hypothalamischenhypophysären-adrenokortikalen Systems. Auch das endogene Opioidsystem scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Dessen kurzfristig, besonders peritraumatisch nützliche Mechanismen wie psychomotorische Erstarrung (freezing) und emotionale Betäubung (numbing) behindern bei hartnäckiger Persistenz die adäquate Traumaverarbeitung. 15 Die bei PTSD und OCD gleichermaßen wirksamen Selektiven-SerotoninWiederaufnahmehemmer (SSRI) zeigen eine erste neurobiologische Gemeinsamkeit dieser Störungen: Dysfunktionen des serotonergen Systems. Die Normalisierung der vormals niedrigen Serotoninwerte mittel SSRI mindert das als zwanghaft empfundene Wiedererleben des Traumas (visuell, auditiv, olfaktorisch etc.) oder damit verbundene Gedanken. Studien unter Verwendung bildgebender Verfahren, insbesondere PositronenEmissions-Tomographie (PET) und Magnetresonanztomographie (MRT) erfassten eine Reihe neuroanatomischer Besonderheiten bei PTSD-Patienten. Eine Minderdurchblutung der Hippocampusformation und des Temporallappens ging einher mit einem reduzierten Hippocampusvolumen, was mögliche bestehende Gedächtnisdefizite erklären könnte. Die integrative Funktion des Hippocampus im Sinne eines kognitiven Abgleichs neuer Reize mit bereits bestehender Erfahrung und folgender Konsolidierung des deklarativen Gedächtnisses ist erschwert. Somit werden die Erinnerungen eher als affektive Zustände in z.B. visuellen Bildern implizit gespeichert. Forschungsergebnisse Die Amygdala belegen spielt deren dabei erhöhte eine wesentliche Aktivität und Rolle. verstärkte automatische Reizantwort (Rauch et al. 2000). Eine ähnlich wichtige Stellung kommt der Amygdala bei der Zwangserkrankung zu. Bezüglich des zuvor erwähnten Hippocampusvolumens herrscht momentan noch wenig Klarheit: Kontroverse Studien von Bonne et al. (2001) und Gilbertson et al. (2002) sprechen gegen eine durch die PTSD hervorgerufene Masseveränderung des Hippocampus. Gilbertson et al. schlossen aber aus ihrer Zwillingsstudie (2002) auf eine mögliche Prädiktorfunktion einer (eventuell genetisch beeinflussten) vergleichsweise kleineren Hippocampusformation. Weitere Funde erwähnen eine auffällige hemisphärische Lateralisierung, vor allem eine Überaktivität rechtshemisphärischer limbischer Strukturen einschließlich der Amygdala (generell wichtig in der Funktion der Angstwahrnehmung) und eine verstärkte Aktivierung des visuellen Kortex. Demgegenüber existiert linksseitig eine verminderte Tätigkeit des Brocaareals (Rauch et al. 1996; Shin et al. 1997), dem die Rolle der verbalen Enkodierung emotionaler Erlebnisse zukommt. Die oft berichtete Schwierigkeit, die traumatischen Ereignisse in Worte zu fassen, findet hier eine mögliche Ursache. Zusätzlich zu den schon gezogenen Parallelen von PTSD und OCD bezüglich der Funktionen des Serotonergen Systems und der Amygdala finden sich Studien, die Personen dieser beiden Störungen vergleichen: Lucey et al. (1997) nennen Gemeinsamkeiten im verminderten regionalen Blutfluss im superioren frontalen Kortex. Die PET-Studie von Rauch et al. (1997) ermittelte erhöhten regionalen 16 Blutfluss in subkortikalen Kerngebieten und frontalem paralimbischen Gürtel bei Angststörungen im Allgemeinen. 1.2.3 Epidemiologie Die Ergebnisse epidemiologischer PTSD-Studien erscheinen zum Teil recht inhomogen und sind damit schwer vergleichbar. Verantwortlich dafür sind sicherlich die variable Festlegung des Stressorkriteriums, der Testinstrumente und -methoden. Einfluss auf die Ergebnisse haben nicht zuletzt die geographische Lage (hinsichtlich der Häufigkeit von Naturkatastrophen) und politische Situation (Kriegsgefahr etc.), in der sich die betreffende Population befindet. Angaben zur Häufigkeit, mit der ein traumatisches Ereignis erlebt wird, reichen in US-amerikanischen Studien von 40% (Breslau et. al. 1991) über 70% (Norris 1992; Resnick et al. 1993) bis 90% (Breslau et al. 1998). In europäischen Studien liegen sie mit 25% (Vanderlinden et al. 1993) und 22% (Perkonigg et al. 2000) niedriger. Das Risiko einer Traumaexposition scheint erhöht bei niedrigem Einkommen, vorbestehender depressiver Störung, Neurotizismus, Extraversion und männlichem Geschlecht (Breslau et al. 1998). Männer erleben zwar mehr traumatische Ereignisse, allerdings berichten Frauen verstärkt von Traumata mit höherem Risiko für eine spätere PTSD-Entwicklung. Tatsächlich sind Frauen zweimal häufiger von der Störung betroffen als Männer (Kessler et al. 1995), bei partieller PTSD sogar viermal so häufig (Stein et al. 1997). Frauen erfahren eher Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, wobei das Risiko einer PTSD-Entwicklung für diese Traumatypen bei 49% bzw. 23,7% sehr hoch liegt (Breslau et al. 1998). Männer berichten vermehrt von gewaltsamen Auseinandersetzungen, ernsthaften Unfällen oder Verletzungen, Kriegshandlungen oder Zeuge von Gewalttaten gewesen zu sein. Die PTSD-Risiken liegen hier niedriger (bei 16% für schwere Unfälle und Verletzungen). Geschlechtergleichheit besteht beim Erlebnis des plötzlichen Todes eines emotional nahe stehenden Menschen, was gleichzeitig auch das am häufigsten angegebene Trauma ist (bei Breslau et al. 1998 berichteten ein Drittel aller PTSD-Probanden davon). Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD sind Neurotizismus (Breslau et al. 1991; McFarlane 1989), vorbestehende Depressive oder Angststörungen - auch bei Familienangehörigen (Breslau et al. 1991; Smith et al. 1990) - und niedrige Intelligenz (McNally u. Shin 1995; Vasterling et al. 1997, 2002). Die ermittelte Lebenszeitprävalenz von Frauen variiert zwischen 10,4% (Kessler et al. 1995) und 18,3% (Breslau et al. 1998), die der Männer zwischen 5% (Kessler et al. 1995) und 10,2% (Breslau et al. 1998). In früheren epidemiologischen Studien 17 von Helzer et al. (1987) und Davidson et al. (1991) lagen die Prävalenzen wesentlich niedriger (bei 1-1,3%). Noch niedrigere Zahlen fanden Studien außerhalb der USA: Von ca. 0,6% berichten Lindal u. Stefansson (1993) in Island und Chen et al. (1993) in Hongkong. Perkonigg et al. (2000) sprechen von einer Lebenszeitprävalenz um 1,3% bei 14- bis 24jährigen im Raum München. 1.2.4 Diagnosestellung nach ICD-10 und DSM-IV Die PTSD besitzt eine besondere Stellung unter den Störungsbildern der operationalen Diagnosemanuale, da für sie ein ursächliches Traumaerlebnis unverzichtbar ist. Das DSM-III (1980) führte die PTSD in ihrer jetzigen Bezeichnung erstmals ein, als Reaktion auf die vorangegangene intensive Forschungsphase mit zahlreichen Vietnam- Kriegsveteranen. Als erstes diagnostisches Kriterium wird ein traumatischer Stressor verlangt, welcher eine direkte oder indirekte Konfrontation mit einer Todesgefahr, einer schweren Verletzung oder Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit beinhaltet. Stressorkriteriums auf Diskutiert alltäglichere wird die belastende mögliche Ausweitung Ereignisse, aufgrund des der erfahrungsgemäß ebenfalls engen Verknüpfung mit der PTSD- Kernsymptomatik. Letztere stimmt in beiden Diagnosesystemen weitgehend überein: Sie besteht aus drei syndromalen Kategorien. In der ersten steht das Wiedererleben der traumatischen Situation im Vordergrund, in der zweiten die Vermeidung daran erinnernder Stimuli, emotionale Betäubung, Interessenverlust etc. Die Kriterien des autonomen Hyperarousals fasst ein drittes Symptomcluster zusammen. Im ICD-10 (Dilling et al. 1991) liegt der Schwerpunkt verstärkt auf den Intrusionen, im DSM-IV (APA 1994) dagegen auf dem Vermeidungskriterium. Eine genaue Gegenüberstellung der beiden Kriteriensysteme zeigt Tabelle 2. Insgesamt gilt das DSM-III im Vergleich zum ICD-10 als strenger, erfasst konkret die psychosoziale Beeinträchtigung, ist konzeptionell präziser und erhält daher im klinischen Alltag meist den Vorzug. Allerdings erfüllt eine große Zahl beeinträchtigter traumatisierter Patienten die vom DSM-IV geforderte Mindestkriterienanzahl nicht, so dass die Einführung eines subsyndromalen Störungsbildes adäquat erscheint. Die Definitionen hierfür differieren. Blanchard et al. (1994) fordern zum Beispiel die Mindestzahl an Wiedererlebenssymptomen und zusätzlich entweder das Vermeidungs- oder Hyperarousalkriterium. Dieses Konzept scheint optimal zu sein (Schützwohl u. Maercker 1999). Eine andere Definition von Stein et al. (1997) beinhaltet wenigstens ein Symptom aus jeder Kategorie. Es finden sich weitere Konzepte (z.B. bei Carlier u. Gersons 1995). 18 Tabelle 2: Diagnosekriterien der PTSD nach ICD-10 und DSM-IV Kriterium Erleben eines Traumatischen Ereignisses Beispiele Symptome (auf den traumatischen Stressor folgend) ICD-10¹ Diagnose F 43.1 Betroffene sind einem kurz- oder langanhaltenden belastenden Ereignis oder Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes ausgesetzt, was bei fast jedem tiefe Verstörung/ Verzweiflung auslösen würde Natur- o. von Menschen verursachte Katastrophen, Kampfhandlungen, ein schwerer Unfall, Zeuge des gewaltsamen Todes anderer o. selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung o. anderer Verbrechen 1.) Wiederholtes Erleben des Traumas in sich aufdrängenden lebendigen Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks, Träume oder Albträume…) Selten kommt es zu dramatischen akuten Ausbrüchen von Angst, Panik oder Aggression, ausgelöst durch plötzliche Erinnerung, Wiederholung des Traumas oder der ursprünglichen Reaktion darauf, oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln 2.) Furcht vor und Vermeidung von Stichworten, die den Leidenden an das ursprüngliche Trauma erinnern können Vermeidung von Aktivitäten u. Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen können Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber Andauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit, Anhedonie 3.) entweder a) oder b) a) teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern b) anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung Ein- u. Durchschlafstörungen Reizbarkeit o. Wutausbrüche Konzentrationsschwierigkeiten Hypervigilanz - Erhöhte Schreckhaftigkeit Dauer Die Kriterien 1.,2. und 3. treten innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis o. nach Ende einer Belastungsperiode auf Leidensdruck u. Beeinträchtigung Spezifikation Latenz kann Wochen- Monate ( selten mehr als 6 Monate nach dem Trauma) betragen, bei Wenigen chronischer Verlauf und Übergang in eine Persönlichkeitsstörung; oft assoziierte Angst und Depression, Suizidgedanken, Drogeneinnahme und übermäßiger Alkoholkonsum DSM-IV Diagnose 309.81 Konfrontation mit einem traumatischen Ereignis, dass 1.) ...tatsächlichen oder drohenden Tod o. ernsthafte Verletzungen o. eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltet 2.) ...eine Reaktion mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen auslöst kriegerische Auseinandersetzungen, gewalttätige Angriffe, Entführung, Geiselnahme, Terroranschlag, Folterung, Kriegs- u. KZ-Gefangenschaft, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen, schwere Autounfälle, Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit 1.) Das Ereignis wird beharrlich auf mindestens einer der folgenden Weisen erlebt: a) wiederkehrende, eindringliche belastende Erinnerungen in Form von Bildern, Gedanken o. Wahrnehmungen b) wiederkehrende belastende Träume c) Handeln u. Fühlen, als würde das Ereignis wieder stattfinden d) Intensive psychische Belastung bei Konfrontation mit internen o. externen Hinweisreizen e) körperliche Reaktionen bei Konfrontation mit internen oder externen Hinweisreizen 2.) anhaltende Vermeidung von mit dem Trauma verbundenen Reizen oder eine vor dem Trauma nicht vorhandene Abflachung der Reagibilität Mindestens drei der folgendenden Symptome: a) bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen o. Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen b) bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten o. Menschen, die Erinnerungen daran wachrufen c) Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern d) Deutlich vermindertes Interesse o. verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten e) Gefühl der Losgelöstheit o. Entfremdung von anderen f) Eingeschränkte Bandbreite des Affekts g) Gefühl einer eingeschränkten Zukunft 3.) anhaltende Symptome erhöhten Arousals mindestens zwei der folgenden Symptome: a) Schwierigkeiten ein- o. durchzuschlafen b) Reizbarkeit oder Wutausbrüche c) Konzentrationsschwierigkeiten d) übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz) e) übertriebene Schreckreaktion Das Störungsbild (Symptome unter 1.,2. und 3.) dauert länger als einen Monat Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen Akute Störung: wenn die Symptome weniger als 3 Monate andauern Chronische Störung: wenn die Symptome mehr als 3 Monate andauern Mit Verzögertem Beginn: wenn der Beginn der Symptome mindestens 6 Monate nach dem Belastungsfaktor liegt 1: Zusammenfassung der klinisch diagnostischen Leitlinien und der Forschungskriterien des ICD-10 19 1.3 Synthese und Hypothesen Gemeinsamkeiten sowie funktionelle Verknüpfungen von Zwangsstörung und Posttraumatischer Belastungsstörung werden an dieser Stelle zusammengefasst. Anschließend erfolgt daraus abgeleitet die Zielsetzung der Arbeit. Schon das klinische Erscheinungsbild beider Störungen weist Überschneidungen auf und erschwert die diagnostische Abgrenzung (Lipinski et al. 1994). Besonders die posttraumatischen Intrusionen ähneln den Zwangsgedanken. Beide entziehen sich weitgehend willkürlicher Kontrolle und wiederholen sich beständig und ungewollt. Allerdings gründen die traumatischen Bilder und Vorstellungen anders als beim Zwang auf tatsächlichen Erlebnissen. Die Angstwahrnehmung spielt bei beiden Störungen eine zentrale Rolle. So sind sie im DSM-IV gemeinsam unter den Angststörungen, im ICD-10 zusammen unter den Neurotischen- , Belastungs- und Somatoformen Störungen aufgeführt. Im Hinblick auf die OCD-Entwicklung beschreiben Lensi et al. (1996) eine mögliche angstsensitive Veranlagung. Grabe et al. (2001) nehmen eine Prädisposition für extreme Angstantworten an, was die Nähe zu posttraumatischen Reaktionsweisen verdeutlicht. Des Weiteren scheint die Risikowahrnehmung bei OCD und PTSD verändert. So überschätzen Betroffene häufig die Gefährlichkeit der Situation, die Bedeutung ihrer Gedanken und die eigene Verantwortlichkeit. Sie neigen verstärkt zu Schuldgefühlen. Weiter oben beschriebene neurobiologische Parallelen (Rolle der Amygdala, des Serotonergen Systems, charakteristischer regionaler Blutfluss etc.) ergänzen die Gemeinsamkeiten. Die Verfestigung falscher Überzeugungen und Missinterpretationen erwachsen häufig aus negativen Life-events, von Rheaume et al. (1998) auch „bad-luckexperiences“ genannt. Negative Life-events sind zwar nicht generell gleichzusetzen mit traumatischen Ereignissen im Vorfeld einer PTSD, sie sind aber im Extremfall traumatisierend und können eine Weichenstellung zur OCD- Entwicklung bedeuten. Daher werden sie in die Betrachtungen miteinbezogen. Stressreiche Life-events vermögen allgemein die Zwangssymptomatik zu verstärken (Jones u. Menzies 1998). Die Ergebnisse der Studien zur Untersuchung der Frequenz und Schwere von lifeevents im Vorfeld einer OCD sind laut Albert et al. (2000) noch inkonsistent. 20 Einige Studien, die einen unmittelbaren Einfluss stressiger oder traumatischer Ereignisse auf den Beginn einer Zwangsstörung fanden, werden im Folgenden genannt. Hollingsworth et al. (1980) untersuchten 17 Kinder mit OCD und fanden bei 15 einen unmittelbaren Krankheitsbeginn nach einem Furcht einflößenden Ereignis und schlossen daraus auf eine primitive Abwehrfunktion des Zwangs. In der Studie von Gothelf et. al. (2004) zeigten sich signifikant mehr negative life-events bei 28 Kindern mit OCD in dem Jahr vor Störungsbeginn als bei normalen Kontrollen. Rasmussen u. Tsuang (1986) ermittelten bei 25% und Rasmussen u. Eisen (1988) bei 29% der Zwangsprobanden einen bestimmten Auslöser. Lensi et al. (1996) berichten sogar von 64,2% der Zwangsprobanden mit triggernden life-events. Treten beide Störungen auf, überschneiden sich die PTSD- und OCD- Symptome im Regelfall für eine gewisse Zeit nach dem Trauma. Aus dieser dynamischen Verbindung bleibt der Zwang oftmals in voll ausgeprägter Form allein zurück (de Silva u. Marks 1999). Funktionelle Erklärungsansätze für das Auftreten von Zwangssymptomen als Traumatisierungsfolge reichen zurück zu den Hysteriestudien von Breuer und Freud (1895). In extremer Form verweist der von Freud 1920 beschriebene „Todestrieb“ auf das zwanghafte Wiederholen traumatischer Erfahrungen. Für Kardiner (1941) fungierte die Zwangssymptomatik als „Verteidigungszeremonie“ während der Entstehung einer traumatischen Neurose. Schon bei unspezifischen aversiven Situationen lassen sich latente stereotype Antworttendenzen erkennen, die in unkontrollierbaren Situationen ausgebaut werden können und Sicherheit suggerieren (Pitman 1991). Zwänge wirken vordergründig angstreduzierend und eine äußere Struktur gebend. Es kann sogar vorkommen, dass sich der Betreffende nach einem Trauma stereotyp genau den Tätigkeiten widmet, die unmittelbar vor dem Ereignis wichtig waren. Experimente bestätigten die Auffassung, dass Intrusionen als generelle Stressantwort selbst bei geringem bis mäßigem Stress und in normalen Populationen vorkommen. Die klinische Ausprägung der Stressantwort scheint eine Extremform des normalen Prozesses zu sein (Horowitz 1971, 1975). Zwangsrituale vermögen bis zu einem gewissen Grad PTSD-Symptome und Intrusionen neutralisierend in Schach zu halten. Zwänge können auch von der Traumaerinnerung kompensieren ablenken (z.B. helfen oder mit der PTSD Ordnungsrituale in verbundene gewisser Probleme Weise bei Konzentrationsproblemen). 21 Klinisch fallen insbesondere frühe Traumata in Verbindung mit Zwangssymptomen auf (z.B. Kindesmissbrauch oder -misshandlung). Dies spiegelt sich kaum in der Literatur wider. Gründe dafür scheinen in der Forschungsmethodik zu liegen. Gezieltere Fragestellungen aufgrund des häufigen Verschweigens der Symptome und differenzierteres Erfassen einzelner Angststörungen wären aufschlussreich. Tatsache ist, dass OCD und sexueller Missbrauch anamnestisch oft zusammen bei Essstörungen und Borderline-Syndromen auftreten (Csef 2000; Yaryura-Tobias u. Neziroglu 1995). Häufig werden Zwangssymptome dabei diagnostisch nicht extra erfasst oder gehen in der Multimorbidität unter. Die im Anschluss an diese frühen Traumata entwickelten Zwänge funktionieren zum einen als Art Selbsterhaltung, Selbststabilisierung und bewahren möglicherweise vor Dekompensation. Zum anderen eignen sie sich symbolisch für eine Reinszenierung des kindlichen Traumas bzw. der ungelösten Konflikte. Je ausgeprägter die strukturellen Defizite und Selbst-Pathologie, desto häufiger erscheint eine schwere Zwangssymptomatik (Thiel u. Schüssler 1995). Diese verschiedenen Verwobenheiten von PTSD und OCD verdeutlichen die Bedeutung, die Art des funktionellen Zusammenhangs beider Störungen zu erfassen. Anhand der Dynamik lassen sich mögliche Komplikationen und Behandlungsfolgen abschätzen sowie gezielter Prognosen stellen. Eine Therapie der Diagnosekonstellation PTSD-OCD gestaltet sich aufgrund der inhaltlichen und funktionellen Verbindung schwierig. Die Verbesserung der einen Erkrankung bedeutet oftmals die Verschlechterung der anderen und umgekehrt. Die Patienten erscheinen dann möglicherweise als therapierefraktär (beschrieben bei Gershuny et al. 2002; Csef 2000). 22 Hypothesen 1.) Zwangskranke erlebten häufiger Traumatisierungen in ihrer Vorgeschichte als Kontrollprobanden. 2.) Traumatisierte Zwangskranke entwickeln häufiger eine PTSD als traumatisierte Kontrollen. 3.) Im Fall einer komorbiden Zwangsstörung und PTSD existiert eine enge zeitliche Assoziation zwischen dem Beginn beider Störungen. Die Zwangserkrankung folgt der PTSD mehrheitlich. 4.) Die Art der Traumatisierung unterscheidet sich bei Zwangskranken und Kontrollen. Möglicherweise besteht eine Prädisposition bestimmter Traumata für eine nachfolgende Zwangserkrankung. 5.) Es kommt zu einer Zunahme der OCD-Schwere bei bestehender Traumatisierung und/ oder PTSD. Die Traumatisierung/ PTSD führt zu verlängerter OCDEpisodendauer, erhöhten Y-BOCS-Werten und vermehrter Anzahl an Lebenszeitdiagnosen. 23 2. MATERIAL UND METHODEN 2.1 Hintergrund der Studie Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der Greifswalder Studie zur Untersuchung von Familiarität und Heterogenität der Zwangsstörung. Die Studienergebnisse stellen gleichzeitig einen Bestandteil des GENOS-Projektes dar, des „German Epidemiologic Network for OCD-Studies“, welches durch Kooperation und die Zusammenführung der Greifswalder Studiendaten mit denen der Universitätskliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Köln, Bonn und Homburg möglich wurde. Die DFG (Deutsche Forschungs-Gemeinschaft) förderte dieses im Jahr 2000 begonnene multizentrische Forschungsprojekt ab 2001. Eine Genehmigung durch die Ethikkommission liegt vor. 2.2 Datenerhebung 2.2.1 Zusammensetzung der Stichprobe Der im GENOS-Projekt enthaltene Datensatz stammt von insgesamt 1352 Probanden, welche zwischen Januar 2002 und März 2004 in den vier Studienzentren der Familienstudie interviewt wurden. In die vorliegende Analyse gehen nur jeweils die Indexpersonen der Familien der Zwangs- und Kontrollprobanden ein. Das bedeutet für den Stichprobenumfang den Einschluss von 225 Zwangsprobanden sowie von 133 Kontrollen. Allerdings kann es infolge fehlender Angaben seitens der Probanden zu minimalen Fallzahlschwankungen kommen. 2.2.2 2.2.2.1 Stichprobenauswahl Zwangs- und Kontrollprobanden der Untersuchungsstichprobe In den Studienzentren Bonn, Köln und Homburg erfolgte die Stichprobenauswahl innerhalb der ambulanten Kliniken der jeweiligen Universitäten. Die Kontrollprobanden konnten mit Hilfe der Einwohnermeldeämter ausgewählt werden. 176 der 225 Zwangsprobanden sowie 70 der 133 Kontrollprobanden der Untersuchungsstichprobe wurden in diesen drei Zentren untersucht. 24 Die im Greifswalder Zentrum ausgewählte Stichprobe stützt sich auf die Allgemeinbevölkerungs-Population der SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania), einer Repräsentativbefragung im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsschwerpunktes Community Medicine („Leben und Gesundheit in Vorpommern“). Bei der SHIP-Studie handelt es sich um eine interdisziplinäre epidemiologische Studie zur Prävalenzschätzung eines breiten Erkrankungsspektrums samt Risiko- und Gesundheitsfaktoren in der Region Vorpommern (John et al. 2001). Nach dem Zufallsprinzip wurden 32 Gemeinden einschließlich der Städte Greifswald, Stralsund und Anklam mit insgesamt 212,157 Einwohnern ausgewählt. Die Einwohnermeldeämter der Gemeinden ermittelten anschließend eine nach Alter und Geschlecht stratifizierte Zufallsstichprobe. Insgesamt nahmen 4310 als Probanden (68,8%) mit einer Altersspanne von 20 bis 79 Jahren an der SHIP-Studie teil. Im Zeitraum von Oktober 1997 bis März 2001 erhielten sie eine medizinische sowie zahnmedizinische Untersuchung, ergänzt um ein gesundheitsbezogenes Interview und einen Selbstbeurteilungsbogen mit Fragen zu Gesundheit und Risikofaktoren. Letzterer enthielt außer einem allgemeinen psychopathologischen Teil auch Screeningfragen bezüglich der Kernsymptomatik der Zwangsstörung, was den Ausgangspunkt für die Stichprobe der Greifswalder Zwangsstudie bildete. 593 Probanden der SHIP-Studie gaben hier mindestens eine maximale Symptomausprägung an. 49 der 225 Zwangsprobanden der vorliegenden Arbeit stammen aus der Greifswalder Untersuchungsstichprobe. Diesen Probanden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Zwangssymptomatik standen die aus der SHIP-Studie rekrutierten Kontrollprobanden ohne oder mit zumindest minimaler Symptomausprägung gegenüber. Von den 133 Kontrollprobanden der Untersuchungsstichprobe stammen 63 Personen aus dem Greifswalder Zentrum. 2.2.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien Die Diagnosestellung erfolgte anhand der Kriterien des DSM-IV. Die Zwangsprobanden erfüllten die Kriterien entweder für eine aktuelle OCD- oder OCD-Lebenszeitdiagnose, wobei die schwerste Episode in die Auswertung einging. Aus Gründen der diagnostischen Validität wurden Probanden ausgeschlossen sofern bei ihnen eine der folgenden Störungen vorlag: Aktuelle Schizophrenie, mentale Retardierung oder Demenz. 25 2.2.3 Probandenrekrutierung Im Anschluss an die Adressanforderung der in Frage kommenden Probanden erhielten diese einen Brief, in dem das Forschungsvorhaben vorgestellt und auf die Möglichkeit einer Teilnahme hingewiesen wurde. Der Brief kündigte ein für direktere Informationen vorgesehenes Telefongespräch an, welches einige Tage nach dem Eingang des Briefes stattfand. Mit Hilfe des Telefonats erfolgte eine detaillierte Aufklärung über die Studie. Mit Probanden, die einer Teilnahme zustimmten, gelang zumeist sofort eine Terminvereinbarung entweder in der Klinik oder der häuslichen Umgebung. Mit dem Einverständnis des Probanden wurden für die Familienstudie erstgradige Angehörige kontaktiert und möglichst zeitgleich mit dem Indexprobanden interviewt. Sofern es aus räumlichen Gründen nicht möglich war die Zwangs- oder Kontrollprobanden persönlich zu befragen, wurde ein Telefoninterview durchgeführt. Diese vollständiges SADS- Vorgehensweise betrifft in der Untersuchungsstichprobe sechs Zwangs- sowie einen Kontrollprobanden. Gab es keine Gelegenheit für eine direkte Befragung, bei z.B. Erkrankten oder bereits verstorbenen Probanden, erfolgte eine Fremdbefragung (FISC) mit teilnehmenden Familienmitgliedern, die in einem guten Vertrauensverhältnis zum Angehörigen standen. Eine FISC-Befragung wurde für einen Zwangsprobanden der Untersuchungsstichprobe angewandt. 2.2.4 Durchführung und Mitarbeiter der Studie Die Probandenrekrutierung, psychiatrisch-klinischen Interviews und anonymisierte Dateneingabe führten Psychiater, klinische Psychologen und Doktoranden im Fachgebiet der Psychiatrie in den vier Erhebungszentren durch. Die Interviewdauer betrug durchschnittlich drei Stunden. Im Anschluss an das Interview fanden eine ca. halbstündige neuropsychologische Testung und eine Blutentnahme für spätere molekulargenetische Untersuchungen statt. Am Ende erhielt jeder Proband einen Fragebogen, der nach dem selbständigen Ausfüllen an die Klinik geschickt werden sollte. Sofern möglich, wurde versucht mit mehreren Angehörigen nacheinander eine FISC-Befragung durchzuführen, um die diagnostische Zuverlässigkeit und Qualität zu sichern. Alle Interviewer durchliefen im Vorfeld eine intensive psychiatrisch-diagnostische Schulung und ein Training in der Anwendung der Neuropsychologischen Testung 26 anhand wöchentlicher Seminare. Einführend mit dem Interviewablauf vertraut gemacht, vermittelten eine Reihe stationärer Probeinterviews, zum Teil in Form von Doppelinterviews oder zusätzlichen Videomitschnitten, die nötige praktische Erfahrung und diagnostische Sicherheit. Die jeweils aktuellen Interviews wurden im Nachhinein besprochen und ausgewertet. 14-tägige Kolloquien der Arbeitsgruppe mit dem Studienleiter der Greifswalder Studiengruppe (dem Leitenden Oberarzt der Klinik) dienten zur Supervision und Klärung offen gebliebener Fragen, z.B. schwierige Differentialdiagnosen betreffend, und somit abschließender Diagnostik. 2.3 Diagnostische Instrumente Der Interviewleitfaden setzt sich zusammen aus dem SADS-LA-IV erweitert um Zwangsspektrumerkrankungen wie Tic- und Tourette-Störung, Körperdysmorphe Störungen und Impulskontrollstörungen, Essstörungen (SKID I), Persönlichkeitsstörungen (SKID II) und der Y-BOCS mit Checkliste. Fremdbefragungen wurden generell mit dem Family Informant Schedule and Criteria (FISC) durchgeführt. 2.3.1 SADS-LA-IV Der Großteil aller Daten wurde anhand des „Interviews zur Lebenszeitprävalenz von affektiven Störungen und Schizophrenie modifiziert zur Untersuchung von Angststörungen“ erhoben (SADS-LA-IV, „Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- Lifetime Anxiety for the assessment of DSM-IV diagnoses“). Mit diesem Instrument konnten bei allen direkt befragten Teilnehmern aktuelle sowie bereits zurückliegende Störungen (Lebenszeitdiagnosen) erfasst werden. Der SADS-LA-IV basiert auf dem 1978 von Endicott systematischer Symptomzusammenstellung der u. Spitzer hinsichtlich Research Diagnostic Criteria (RDC) entwickelten SADS-L. Die damit in operationalisierter Weise erhobenen klinischen Diagnosen verminderten die andernfalls ausgeprägte Varianz der deskriptiven und diagnostischen Evaluation von Patienten. Um die Erfassung spezifischer Angststörungen erweitert (Manuzza et al. 1986), erlaubt die neue Version des SADS-LA-IV Diagnosestellungen nach DSM-III-R und DSM-IV. Er fand häufige Verwendung innerhalb europäischer und US-Familienstudien (Leboyer et al. 1991). Die in der Studie verwendete Version wurde von Grabe et al. 1999 bearbeitet und ins Deutsche übersetzt (Diagnosestellung nach DSM-IV). Mit dem SADS-LA-IV 27 gelingt die longitudinale Darstellung der individuellen Krankheitsgeschichte und der Life-events im Lebenslauf des Probanden. Der chronologische Überblick gestattet zusätzlich eine Erfassung und Beurteilung der Beziehungen zwischen einzelnen Symptomen und Krankheitsbildern. Die psychiatrischen Erkrankungen und die Lebensereignisse erscheinen in der erweiterten Life-Chart des SADS-LA-IV. 2.3.2 Y-BOCS und Checkliste Für eine umfassende Diagnostik der Zwangsstörung wurde die Y-BOCS (YaleBrown-Obsessive-Compulsive-Scale) mit dazugehöriger Checkliste in das SADS integriert. Durch die insgesamt 58 Fragestellungen der Checkliste nach verschiedenen Zwangsgedanken und -handlungen erhält man ein differenziertes Bild individueller Zwangssymptome beim Probanden sowohl für den aktuellen Zeitraum als auch für die Vergangenheit. Es wird ein breites Spektrum an Fragen zu typischen Symptomen wie aggressiven oder sexuellen Zwangsgedanken und Symmetrie- oder Kontrollhandlungen gestellt. Zu jedem Symptom erfolgt eine Angabe zum Alter bei erstmaligem Auftreten. Die „Yale-Brown-Obsessive-Compulsive-Scale“ gilt als ein in Klinik und Forschung sehr gut abgesichertes Fremdbeurteilungsverfahren zur Erfassung von Art und Schwere der Zwangssymptomatik. Durch die Bildung eines Summenscores registriert sie Veränderungen des Schweregrades im Verlauf der Störung und ermöglicht einen interpersonellen Vergleich bei Probanden mit unterschiedlichen Denk- und Handlungszwängen. Die Originalversion von 1986 erfuhr 1989 eine Überarbeitung (Goodman et al. 1986, 1989) und orientiert sich an den DSM-III-R-Kriterien (American Psychiatric Association 1987). Die deutsche Übersetzung liegt seit 1991 vor (Hand u. BüttnerWestphal 1991). Die Y-BOCS besteht aus 19 (Originalversion) bzw. 21 Items (revidierte Version) und kommt in Form eines semistrukturierten Interviews zur Anwendung. Mit den Items 1-10 wird der Ausprägungsgrad von Denk- und Handlungszwängen anhand des eingeschätzten Zeitaufwands, des Beeinträchtigungsgrades, des Leidensdrucks, des Widerstands und der möglichen Kontrolle über die Zwänge auf einer Skala von 0 bis 4 ermittelt (0=„nicht vorhanden“ bis 4=„extrem“). Die Items 1-10 der Originalversion erreichen eine zufrieden stellende bis gute Reliabilität. Mit den Zusatzitems 11-16 werden die Einsicht in die Sinnlosigkeit Vermeidungsverhalten, der Zwangssymptomatik Entscheidungsschwierigkeiten, (Ich-Dystonie), übertriebenes Verantwortungsgefühl, Langsamkeit und pathologisches Zweifeln erfasst. Die Items 28 17 (Schwere der Gesamtstörung) und 18 (Ausmaß der Gesamtverbesserung) eignen sich für die Beurteilung des Therapieerfolgs. Entsprechend bisher publizierter Therapiestudien galten Probanden mit zeitgleichen Denk- und Handlungszwängen ab einem Gesamtwert von 16 als klinisch, darunter als subklinisch erkrankt. Traten Denk- oder Handlungszwänge isoliert auf wurde die klinische Diagnose schon ab einem Wert von 10 gestellt. 2.3.3 Fremdbefragung (FISC) Das „Family Informant Schedule and Criteria“ (FISC) kommt zur Anwendung sobald keine Möglichkeit besteht auf direktem Weg Interviewdaten von einem Probanden zu erheben. Das ist der Fall bei erkrankten oder verstorbenen Personen. In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Instrument nur bei einem der 225 Zwangsprobanden benötigt. 1986 von Manuzzi et al. entwickelt, wurde es von Grabe et. al 1996 ins Deutsche übersetzt und um Fragen zu Tic-Störung, Zwangsspektrumerkrankungen und Essstörungen ergänzt. Die Diagnosestellung erfolgt anhand DSM-IV-Kriterien. In einem semistrukturierten Interview gibt mindestens ein enger Vertrauter des Betreffenden Auskunft über den Probanden und seine klinischen Diagnosen. Hinsichtlich der Qualitätssteigerung sollten die Informationen durch Befragen eines weiteren engen Vertrauten ergänzt werden. 2.4 Statistische Analysen Bei der Studie handelt es sich um eine Fall- Kontroll- Studie. Die Informationen aller SADS-LA-IV-gestützten Interviews wurden anhand der diagnostischen Kriterien des DSM-IV kodiert, die gesammelten Daten anschließend mit dem Statistikprogramm SPSS 11.5 anonymisiert verwaltet und ausgewertet. Bei der deskriptiven Statistik kommen Mittelwertberechnungen und die zugehörigen Standardabweichungen für den Altersvergleich bei Fällen und Kontrollen zur Anwendung. Der t-Test ermöglicht anschließend die Mittelwertdifferenzen zweier unabhängiger Stichproben auf Signifikanz zu prüfen. SPSS führt dabei den LeveneTest (F-Test) durch, der die beiden Varianzen der Stichproben vergleicht. Je nach Varianzgleichheit oder –ungleichheit erfolgt die Wertung des t-Werts. Außerdem kam der t-Test auch beim Vergleich der Mittelwertdifferenzen der OCDEpisodendauer der einzelnen Zwangsprobandengruppen zum Einsatz. 29 Eine weitere wichtige Analysemöglichkeit bietet der Chi-Quadrat-Test. Mit ihm kann die Unabhängigkeit normalskalierter Daten zweier Stichproben geprüft werden. Der Chi-Quadrat-Test erlaubt die statistische Signifikanztestung hinsichtlich bestehender Unterschiede in der Häufigkeit von Traumatisierungen und PTSDDiagnosen oder bezüglich der Geschlechterverteilung, Heiratsstatus, Lebensstand, Geschwister- und Kinderzahl, Ausbildungsstand und beruflichem Status bei Fällen und Kontrollen. Darüber hinaus wurde er auch verwendet um Differenzen in der Art der Traumatisierung und den Lebenszeitdiagnosen zu prüfen. Bei niedrigen erwarteten Häufigkeiten erfolgte die Anwendung des Exakten Tests nach Fisher. Zusätzlich verwendet wurde der Mann-Whitney-Test (U-Test) als Rangfolgetest zum nichtparametrischen Vergleich zweier unabhängiger Stichproben, in dieser Arbeit betraf dies den Vergleich von Mediandifferenzen der Y-BOCS- Gesamtsumme der Zwangsprobanden. Das Signifikanzniveau lag durchgehend bei Į=0,05. 30 3. ERGEBNISSE 3.1 Beschreibung der Stichprobe Gesamt- und Untersuchungsstichprobe Der Datensatz aller Zentren umfasst 1352 Probanden. Grundlegend für die Auswertung dieser Arbeit sind die 225 OCD-Indices der Familien („alle OCD-Fälle“) sowie die 133 Indices der Kontrollfamilien („Kontrollen“). Die übrigen 994 Probanden der Stichprobe setzen sich aus den Familienangehörigen der Fälle und Kontrollen zusammen. Diese finden keinen Eingang in die statistische Analyse. Innerhalb der Gruppe der OCD-Indices erfolgt neben dem allgemeinen Gruppenvergleich mit den Kontrollindices eine differenzierte Aufschlüsselung und Untersuchung der Probanden 1.) ohne Traumatisierung („Ø Trauma“), 2.) mit Traumatisierung aber ohne anschließende PTSD („+ Trauma“) und 3.) mit nachfolgender PTSD-Diagnose („+ PTSD“). TABELLE 3 ZUSAMMENSETZUNG DER UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE OCD n Ø Trauma + Trauma + PTSD 211 8 6 gesamt 3.1.1 3.1.1.1 KONTROLLEN 225 133 Alters- und Geschlechterverteilung Alter Das mittlere Alter der Gesamtstichprobe liegt bei 39,54 Jahren (±14,96). Mit einem Durchschnittsalter von 37,43 Jahren (±12,3) unterscheiden sich alle OCD-Fälle insgesamt hochsignifikant von den Kontrollen, deren mittleres Alter 43,14 Jahre (±18,2) beträgt (p=0,001). Bei der Altersverteilung von OCD-Probanden und Kontrollen ergibt sich ein hoch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen der bis einschließlich 50jährigen bzw. der über 50jährigen (p= 0,001). Erstere enthält 84,7% der OCD-Fälle aber nur 66,9% der Kontrollen. 31 3.1.1.2 Geschlecht Bei den gesamten OCD-Fällen sowie Kontrollen besteht ein leichter Frauenüberschuss, der aber nicht signifikant ist (p=0,602). Innerhalb der OCDUntergruppen zeigt sich ein homogenes Geschlechterverhältnis (p=0,727, p=1,0, p=0,627). TABELLE 4: ALTER UND GESCHLECHT DER UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE OCD +PTSD [n=6] Fälle gesamt 37,5 (±12,3) 36,25 (±11,4) 40,33 (±11,7) 37,43 (±12,3) 43,14 (±18,2) männlich 90 (40) 4 (1,8) 2 (0,9) 95 (42,3) 60 (45,1) weiblich 121 (53,8) 4 (1,8) 4 (1,8) 130 (57,7) 73 (54,9) GESCHLECHT n (%) Statistik: 1.) OCD und Kontrollen Alter: t-Test: T=-3,219, df=203,339,p=0,001 2 Geschlecht: Ȥ = 0,272; df=1; p=0,602 3.1.2.1 KONTROLLEN + Trauma [n=8] MW-ALTER; IN JAHREN (SD) 3.1.2 [n=225] Ø Trauma [n=211] [n=133] 2.) OCD-Untergruppen: 2a) Ø Trauma u. + Trauma Alter: t-Test: T=0,282; df=217; p=0,778 2 Geschlecht: Ȥ =0,170; df=1; Fishers Exakter Test: p= 0,727 2b)Ø Trauma u. + PTSD Alter: t-Test: T=-0,555, df=215, p=0,580 2 Geschlecht:Ȥ = 0,208; df=1;Fishers Exakter Test: p=1,0 2c) + Trauma u. + PTSD Alter: t-Test: T=-0,655, df=12, p=0,525 2 Geschlecht: Ȥ = 0,389; df=1; Fishers Exakter Test: p=0,627 Herkunft, Familienstand und Anzahl der Kinder Herkunft Fast alle 358 Probanden sind deutscher Herkunft. Ein Proband kommt ursprünglich aus Afghanistan, jeweils zwei stammen aus der Türkei, Rumänien und Polen. 3.1.2.2 Familienstand Bei der Befragung des Familienstandes ergab sich ein signifikanter Unterschied: 48,5% aller OCD-Fälle, aber nur 37,6% der Kontrollen gaben an niemals verheiratet gewesen zu sein (p=0,045). Länger als ein Jahr in Ehe oder fester 32 Partnerschaft leben 40,5% der gesamten OCD-Fälle bzw. 50,4% der Kontrollen (p=0,069). 4% aller OCD-Fälle jedoch nur 0,8% der Kontrollen gaben aktuell eine Trennung an (Ȥ2=3,206; df=1, p=0,073). Nur minimale Unterschiede zeigten die Scheidungsraten: 6,2% bzw. 6,8% der Fälle und Kontrollen sind hierbei vertreten. Vergleicht man die allein lebenden OCD-Fälle (33,5%) mit den Kontrollen (23,3%) so gibt es auch hier einen signifikanten Unterschied: Ȥ2=4,154; df=1, p=0,042). Beim Familienstand ergeben sich keine signifikanten Unterschiede innerhalb der OCD-Untergruppen (p=0,724, p=0,617, p=1,0). TABELLE 5: FAMILIENSTAND DER UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE n (%) der Gruppenzugehörigkeit HEIRATSSTATUS OCD [n=225] + Trauma + PTSD [n=211] [n=8] [n=6] Nie 101 (47,9) 4 (50) 3 (50) 50 (37,6) 1 Jahr 87 (41,2) 3 (37,5) 2 (33,3) 67 (50,4) Verwitwet 2 (0,9) - - 6 (4,5) Getrennt 9 (4,3) - - 1 (0,8) geschieden 12 (5,7) 1 (12,5) 1 (16,7) 9 (6,8) Statistik: 1.) OCD (gesamt) u. Kontrollen 2 Nie: Ȥ =4,009; df=1; p=0,045 2 1 Jahr: Ȥ =3,298; df=1; p=0,069 3.1.2.3 KONTROLLEN Ø Trauma [n=133] 2.)OCD- Untergruppen 2a) Ø Trauma u. + Trauma 2 Ȥ =1,053; df=4; Fishers Exakter Test: p=0,724 2b) Ø Trauma u. + PTSD 2 Ȥ =1,581; df=4; Fishers Exakter Test: p=0,617 2c) + Trauma u. + PTSD 2 Ȥ =0,058; df=2; Fishers Exakter Test: p=1,0 Kinderzahl Gegenüber 60,8% aller OCD-Indices sind nur 40,6% der Kontrollen kinderlos, was sich als hochsignifikant erweist (Ȥ2=13,737; df=1; p=0,000). Nur etwas mehr als ein Drittel aller OCD-Fälle (36,7%) haben bis zu drei Kindern, während das ca. die Hälfte (51,9%) der Kontrollen von sich behaupten können. Innerhalb der OCD-Indices ergeben sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Kinderlosigkeit (Ȥ2=2,558; df=2; p=0,278). 33 3.1.3 Ausbildung Betrachtet man die Schul- und Hochschulausbildung der Stichprobe so haben 13,7% aller OCD-Fälle und 19,5% der Kontrollen einen Hochschulabschluss mit oder ohne Titel (Ȥ2=2,185; df=1; p=0,139). Etwa ein Fünftel (19,0%) der OCD-Fälle und ca. ein Zehntel (9,8%) der Kontrollen erreichten das Abitur, was einen signifikanten Unterschied darstellt (Ȥ2=5,367; df=1; p=0,021). Die Mehrzahl der Zwangsprobanden sind Realschulabgänger (33,2%). Diese sind mit 26,3% auch bei den Kontrollen stark vertreten. Zusammen mit den Haupt- bzw. Volksschulabgängern machen diese mehr als die Hälfte sowohl aller OCD- als auch der Kontrollprobanden aus (52,2% bzw. 51,9%). Die folgende Tabelle zeigt die differenzierte Aufschlüsselung der OCD-Probanden, innerhalb derer keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Ausbildungsstands bestehen (s. u.). TABELLE 6: AUSBILDUNGSSTAND DER UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE n (%) der Gruppenzugehörigkeit AUSBILDUNGSSTAND OCD [n=224] KONTROLLEN Ø Trauma [n=210] 5 (2,4) + Trauma [n=8] - + PTSD [n=6] - 12 (9%) 23 (11,0) 1 (12,5) 1 (16,7) 14 (10,5%) 3 (1,4) - - 12 (9%) Studium o. Abschluss 24 (11,4) - - 11 (8,3%) Abitur 43 (20,5) - - 13 (9,8%) Realschule 67 (31,9) 5 (62,5) 2 (33,3) 35 (26,3%) Haupt-/Volksschule 38 (18,1) 2 (25,0) 3 (50,0) 34 (25,6%) 7 (3,3) - - 2 (1,5%) Hochschulabschluss mit Titel Hochschulabschl. o. Titel Vordiplom Kein Abschluss [n=133] Statistik: Ø Trauma u. + Trauma 2 Ȥ =5,525; df=7; Fishers Exakter Test: p=0,601 Ø Trauma u. + PTSD 2 Ȥ =5,646; df=7; Fishers Exakter Test: p=0,517 + Trauma u. + PTSD 2 Ȥ =1,225; df=2; Fishers Exakter Test: p=0,767 3.1.4 Beruflicher Status Die Angaben zum aktuellen Berufsstatus der Probanden sind in Tabelle 7 aufgeführt. 30,8% aller OCD-Fälle und 33,1% der Kontrollen gehen einer Vollzeitbeschäftigung nach. Eine Teilzeittätigkeit gaben 8,4% aller OCD-Fälle bzw. 10,5% der Kontrollprobanden an. Auch der prozentuale Anteil an Studenten zeigte 34 einen nur geringfügigen, nichtsignifikanten Unterschied zwischen OCD-Fällen und Kontrollen (10,6% bzw. 15,0%). Hochsignifikante Differenzen ergaben sich bei dem Vergleich des Rentneranteils aller OCD-Fälle und Kontrollen (13,2% zu 29,3%): Ȥ2=14,044; df=1; p=0,000. Die Zahl der Rentner unter den Kontrollen ist also bedeutend und liegt fast so hoch wie die der Vollzeitbeschäftigten. Ebenso heterogen erscheint die Stichprobe im Hinblick auf die Zahl der vorübergehend und längerfristig unbeschäftigten Probanden: Hier überwiegen die Zwangsprobanden: Vorübergehend unbeschäftigt waren 15,4%, bei den Kontrollen hingegen nur 3,8% (Ȥ2=11,543; df=1; p=0,001). Längerfristig unbeschäftigt waren 21,6% aller OCDund 8,3% der Kontrollprobanden, ein ebenfalls hochsignifikanter Unterschied: Ȥ2=10,705; df=1; p=0,001. Als längerfristig unbeschäftigt gelten z.B. Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte oder durch die Familie unterstützte Probanden (durch z.B. Alimente). Eine differenzierte Aufschlüsselung der OCDProbanden zeigt Tabelle 7. Auch hier besteht Homogenität innerhalb der OCDUntergruppen. TABELLE 7: AKTUELLER BERUFLICHER STATUS DER UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE n (%) der Gruppenzugehörigkeit STATUS AKTUELLER BERUFLICHER OCD [n=225] KONTROLLEN Vollzeitbeschäftigung Ø Trauma [n=211] 65 (30,8) +Trauma [n=8] 2 (25,0) + PTSD [n=6] 3 (50,0) 44 (33,1) Teilzeitbeschäftigung 18 (8,5) 1 (12,5) - 14 (10,5) Berentet 26 (12,3) 4 (50,0) - 39 (29,3) Student 24 (11,4) - - 20 (15,0) 32 (15,4) - 1 (16,7) 46 (21,8) 1 (12,5) 2 (33,3) Vorübergehend unbeschäftigt Längerfristig unbeschäftigt Statistik: Ø Trauma u. + Trauma 2 Ȥ =10,646; df=5; Fishers Exakter Test: p=0,098 Ø Trauma u. + PTSD 2 Ȥ =2,979; df=5; Fishers Exakter Test: p=0,923 [n=133] 5 (3,8) 11 (8,3) + Trauma u. + PTSD 2 Ȥ =6,378; df=4; Fishers Exakter Test: p=0,164 35 3.2 Häufigkeit von Traumatisierung und PTSD in der Untersuchungsstichprobe Zur Klärung der Fragestellung in welchem Ausmaß Traumatisierungen im Leben der Fälle und Kontrollen auftraten und ob ein signifikant höherer Anteil unter den Betroffenen bei den Zwangskranken zu finden ist, sollen die von den Fällen und Kontrollen erlebten Traumatisierungen quantifiziert werden. Es schließt sich eine Untersuchung der PTSD-Prävalenz beider Gruppen an. Die statistische Signifikanzprüfung erfolgt mittels Chi-Quadrat-Testung. 3.2.1 Traumatisierung bei Fällen und Kontrollen 14 (6,2%) der OCD-Indices gaben eine Traumatisierung in der Vorgeschichte an. Dies gilt ebenso für 12 (9%) der Kontrollen, was ohne statistische Signifikanz bleibt (p= 0,324). TABELLE 8: TRAUMATISIERUNG VON FÄLLEN UND KONTROLLEN n (%) der Gruppenzugehörigkeit OCD [n=225] KONTROLLEN[n=133] traumatisiert 14 (6,2) 12 (9,0) kein Trauma 211 (93,8) 121 (91,0) Statistik: Ȥ2: 0,973; df=1; p= 0,324 3.2.2 PTSD Eine der Traumatisierung folgende PTSD zeigt sich bei sechs (2,7%) der OCDIndices sowie bei sechs (4,5%) der Kontrollprobanden. Auch hier ergibt sich kein signifikanter Unterschied (p= 0,373). TABELLE 9: PTSD-HÄUFIGKEIT BEI FÄLLEN UND KONTROLLEN n (%) der Gruppenzugehörigkeit PTSD keine PTSD OCD [n=225] KONTROLLEN [n=133] 6 (2,7) 6 (4,5) 219 (97,3) 127 (95,5) Statistik: Ȥ2: 0,878; df=1; Exakter Test nach Fisher: p= 0,373 36 3.3 Zeitliche Assoziation des Krankheitsbeginns bei Probanden mit OCD, subklinischer und klinischer PTSD Die zeitliche Abfolge der jeweiligen Ersterkrankungszeitpunkte stellt einen wichtigen Analyseaspekt komorbider Zwangserkrankung und PTSD in der Untersuchungsstichprobe dar. Damit ist in gewissen Grenzen eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit ursächlicher Beziehungen beider Störungsbilder möglich. Das Diagramm 1 verdeutlicht den zeitlichen Abstand des erstmaligen Auftretens der Zwangserkrankung bzw. PTSD eines jeweiligen Probanden. Eingeschlossen sind auch Probanden, bei denen eine subklinische PTSD diagnostiziert wurde. Subklinisch bedeutet in dem Fall das Vorhandensein von PTSD-typischen Symptomen im Anschluss an ein traumatisches Erlebnis ohne jedoch vollständig alle DSM IV- oder ICD 10-Kriterien zu erfüllen. Die Probanden, welche eine Traumatisierung erfuhren, jedoch nicht die Symptome mindestens einer subklinischen PTSD- Diagnose erfüllen, werden in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. DIAGRAMM 1: REIHENFOLGE UND ZEITLICHER ABSTAND VON OCD UND (SUB-) KLINISCHER PTSD DER OCD-FÄLLE 30 20 10 0 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=1 n=2 0J. n=1 n=1 n=1 n=1 Abstand in Jahren bei subklinischer PTSD Abstand in Jahren bei klinischer PTSD -10 -20 -30 1)OCD- Beginn nach PTSD-Beginn 2)OCD-/ PTSDBeginn selbes Jahr 3) OCD- vor PTSD-Beginn 37 Insgesamt erfasst die Abbildung zwölf Probanden mit komorbider OCD und PTSD (jeweils sechs Fälle mit klinischer sowie subklinischer Ausprägung der PTSD). Abgebildet sind der Abstand in Jahren, welcher zwischen dem erstmaligen Auftreten beider Störungen liegt und deren Reihenfolge. Dabei ergeben sich verschiedene Gruppierungen. Zur besseren Veranschaulichung erscheinen die Zeitabstände der einzelnen Gruppen (nur) in der Abbildung mit entgegen gesetzten Vorzeichen. 1.) Sechs Probanden berichteten, der Zeitpunkt des Störungsbeginns der (sub-) klinischen PTSD läge vor der Zwangserkrankung, mit Zeitspannen von 4, 6, 13, 17, 23 bzw. 26 Jahren. 2.) Bei zwei Fällen ergibt sich für beide Störungen ein Beginn im selben Lebensjahr. Die Ersterkrankungszeitpunkte liegen sogar im selben Monat, was aus dem Diagramm allerdings nicht ersichtlich wird. 3.) Vier Fälle gaben ein späteres Ersterkrankungsalter der (sub-)klinischen PTSD im Vergleich zur OCD an, mit Abständen von 11, 12, 14 bzw. 21 Jahren. Somit liegen für zwei Drittel der Probanden die Ersterkrankungszeitpunkte für OCD und PTSD über 10 Jahre auseinander, zum Teil sogar über 20 Jahre. Der Ausprägungsgrad der PTSD von subklinischem bis klinischem Störungsbild verteilt sich sehr gleichmäßig über die drei Gruppen: Jeweils die Hälfte der Probanden zeigt eine klinische (Abstände: 26, 13, 4 / 0 / 14, 21 Jahre) oder subklinische PTSD- Diagnose (23, 17, 6 / 0 / 11, 12 Jahre). Die folgende Tabelle listet die komorbiden Lebenszeitdiagnosen von OCD und PTSD der zwölf Probanden nach Gesichtspunkten des zeitlichen Überschneidens beider Störungen auf. Von Bedeutung war die Frage nach dem Wechselspiel der Krankheitsverläufe: TABELLE 10: VERGLEICH DER EPISODENVERLÄUFE BEI KOMORBIDER OCD/ PTSD KORMORBIDE LEBENSZEITDIAGNOSEN VON OCD UND PTSD, n= Anzahl der Stichprobe wenn PTSD- vor OCD- Beginn oder im selben Jahr (…)= OCD- vor PTSD- Beginn ÜBERSCHNEIDUNG KEINE gesamt ÜBERSCHNEIDUNG OCD/ PTSD Aktuelle OCD überdauert PTSD Aktuelle PTSD überdauert OCD OCD u. PTSD gemeinsam aktuell anhaltend gesamt 2 (1) OCD/ PTSD 3 5 (1) 1 - 1 2 (3) - 2 (3) 5 (4) 3 12 (4) 38 Überdauerte eine der beiden Störungen die andere, sind aktuell beide noch vorhanden oder gab es überhaupt ein zeitliches Überschneiden beider Störungen (da es sich um Lebenszeitdiagnosen handelt)? Zu diesem Zweck werden die Fälle getrennt betrachtet, zum einen die acht Probanden mit zuerst aufgetretener (sub-) klinischer PTSD und darauf folgender Zwangserkrankung und zum anderen die übrigen vier Probanden (in der Tabelle in Klammern gesetzt), die erst nach dem Beginn der Zwangserkrankung ein Trauma erfuhren und anschließend eine PTSD entwickelten. Dabei wird ersichtlich, dass die Zwangsstörung in den meisten Fällen überdauert und bis zum Zeitpunkt des Interviews anhält, sei es allein oder gemeinsam mit der PTSD. Die PTSD überdauert nur in einem Fall die OCD und tendiert besonders bei den Fällen, in denen sie zusätzlich zu einer schon bestehenden Zwangsstörung auftritt, dazu, mit dieser gemeinsam chronisch anzudauern (in drei von vier Fällen). Das zeitlich stabile Überdauern der OCD (n=7) im Vergleich zur PTSD (n=3) in der Gruppe der acht Probanden mit dem zuerst eingetretenen traumatischen Ereignis war statistisch nicht signifikant (Ȥ2: 1,905; df=1; Exakter Test nach Fisher: p= 0,375). Vergleicht man die Mittelwerte des OCD-Ersterkrankungsalters bei den traumatisierten gegenüber den übrigen Zwangsprobanden, gibt es nur minimale nicht signifikante Unterschiede (p=0,973). In Tab.12 wird das Ersterkrankungsalter der (sub-)klinischen PTSD gegenübergestellt. Es liegt geringfügig unter dem der Zwangserkrankung. TABELLE 11: MITTELWERTE DES ERSTERKRANKUNGSALTERS DER OCD-PROBANDEN OCD (n=225) MW, OCD ERSTERKRANKUNGSALTER, IN JAHREN, (SD) + TRAUMA (n=14) KEIN TRAUMA (n=210) 21,29 (+/-8,29) 21,39 (+/-11,24) Statistik: t-Test: T=0,033, df=223, p=0,973 TABELLE 12: MITTELWERT DES ERSTERKRANKUNGSALTERS BEI (SUB-)KLINISCHER PTSD (SUB)KLINISCHE PTSD (n=12) MW, PTSD ERSTERKRANKUNGSALTER, IN JAHREN, (SD) 20,17 (+/-13,57) 39 3.4 Formen der Traumatisierung Als nächstes sollen die Art und Häufigkeit der Traumaexposition von Zwangsprobanden und Kontrollen näher untersucht werden. Von besonderem Interesse ist zum einen die Frage, ob deutliche Unterschiede in der Art der Traumatisierung bei OCD-Fällen und Kontrollen bestehen, und zum anderen, ob und wenn ja welche Traumata gehäuft zu einer PTSD-Erkrankung führten. Von 210 Zwangsindexprobanden und 133 Kontrollprobanden gelang anhand der Daten eine Zuordnung der Traumata zu den in der Tabelle 10 aufgeführten sechs Kategorien. Bei den OCD-Fällen konzentrieren sich die erlebten Traumata auf die Kategorien „Unfälle“ mit fünf Probanden (2,4%), „Opfer von Gewaltverbrechen“ mit ebenfalls fünf Probanden (2,4%) und „andere Traumata“ (wie Missbrauchserfahrung eigener Kinder, des Lebenspartners oder schwere Krankheit) mit zehn Probanden (4,8%). Die sechs Fälle mit anschließender klinischer PTSD teilen sich dabei wie folgt auf: Je ein Proband erhielt diese Diagnose nach einem Unfalltrauma bzw. nachdem er ein Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Traumatische Erlebnisse aus der Kategorie „andere Traumata“ führten bei vier Probanden zu einer klinischen PTSD. Für die Kontrollen ergibt sich folgende Verteilung: Die Kategorie „Unfälle“ traf für einen Kontrollprobanden (0,8%) zu, „aktive Kriegsteilnahme“ für drei Kontrollen (2,3%). Bei drei Kontrollen (2,3%) wurde der Proband selbst, bei zwei Kontrollen (1,5%) wurde ein ihm Nahestehender „Opfer eines Gewaltverbrechens“. Sechs Kontrollprobanden (4,5%) erlebten „andere Traumata“. Von diesen 133 Kontrollprobanden führten die Traumata ebenfalls in sechs Fällen zu einer klinischen PTSD-Diagnose: Bei jeweils zwei Kontrollprobanden der Kategorien „Teilnahme an aktiven Kriegshandlungen“, „Nahestehender war Opfer von Gewaltverbrechen“ und „andere Traumata“. Statistisch ergeben sich somit zwischen den Traumatisierungen bei OCD- sowie Kontrollprobanden auch qualitativ keine signifikanten Unterschiede: Ȥ2: 9,429; df=5; p=0,093. Bei der Untersuchung auf besonders PTSD-prädisponierende Traumata zeigte sich innerhalb der OCD-Probanden sowie der Kontrollgruppe kein signifikantes Ergebnis ( Ȥ2: 5,210; df=3; p=0,157 bzw. Ȥ2: 6,67; df=4; p=0,155). 40 TABELLE 13: TRAUMATISIERUNGSART UND PTSD-DIAGNOSE BEI FÄLLEN UND KONTROLLEN n (%) der Gruppenzugehörigkeit TRAUMAART OCD [n=210] Anzahl der davon Anzahl der davon Traumata PTSD Traumata PTSD 1) Unfall 5 (2,4) 1 1 (0,8) 0 2) Naturkatastrophen 1 (0,5) 0 0 0 3) Aktive Teilnahme an Kriegshandlungen 4) Opfer von Gewaltverbrechen (z.B. sexueller o. körperlicher Missbrauch) 5) Nahestehender war Opfer von Gewaltverbrechen 6) Andere Traumata (Missbrauch 0 0 3 (2,3) 2 5 (2,4) 1 3 (2,3) 0 0 0 2 (1,5) 2 10 (4,8) 4 6 (4,5) 2 Nahestehender, Erkrankung…) 3.5 KONTROLLEN [n=133] Der Einfluss von Traumatisierung und PTSD auf die Schwere der Zwangserkrankung Im Folgenden werden die Wechselwirkungen komorbider OCD und PTSD bzw. OCD und Traumatisierung untersucht. Insbesondere soll die Schwere der Zwangserkrankung bei prämorbider Traumatisierung oder sogar gleichzeitiger PTSD-Diagnose mit Fällen ohne Traumatisierung/ PTSD verglichen werden. Als Indikatoren für die Schwere der OCD eignen sich die Episodendauer, Y-BOCSWerte und Lifetime-Diagnosen der Fälle. Diese werden nachfolgend analysiert, wobei Ȥ²-Test, t-Test und der Mann-Withney-Test (U-Test) zum Einsatz kommen. Die Untersuchungsstichprobe der Zwangsprobanden setzt sich aus folgenden auf Alter und Geschlecht kontrollierten Gruppen zusammen: I.) Zwangsprobanden ohne Traumatisierung („Ø Trauma“) II.) Zwangsprobanden mit Traumatisierung, also Probanden welche generell ein traumatisches Ereignis erlebten („+ Trauma“) Der Übersichtlichkeit halber wurden in dieser Gruppe auch die Probanden mit subklinischer Ausprägung der PTSD- Symptomatik eingeschlossen. 41 III.) Zwangsprobanden mit Traumatisierung und anschließender PTSD („+PTSD“) 3.5.1 Episodendauer Ein Kriterium, um das Ausmaß und die Schwere der vorhandenen Zwangserkrankung zu objektivieren, stellt deren Dauer dar, welche hier in Wochen angegeben wird. Sie kann für zusammengenommen alle Mittelwertvergleichen (T-Test) alle drei OCD-Fälle analysiert Untersuchungsgruppen, ausmachen, werden. Die welche anhand Episode von der Zwangserkrankung der 210 OCD-Probanden ohne Traumatisierung betrug durchschnittlich 743,61 Wochen (SD=664,60), jene der acht Probanden mit Traumatisierung 823,13 Wochen (SD=516,20). Dieser Unterschied blieb statistisch nichtsignifikant: (p=0,738). Betrachtet man die OCD-Probanden mit zusätzlicher PTSD-Diagnose, ergibt sich eine Episodendauer von 943 Wochen (SD=629,58). Auch dieser tendenzielle Anstieg zeigt keinerlei statistische Signifikanz verglichen mit den anderen beiden Gruppen: OCD mit PTSD vs. OCD ohne Trauma (p=0,469) sowie OCD mit PTSD vs. OCD mit alleinigem Trauma (p=0,702). TABELLE 14: EPISODENDAUER DER ZWANGSERKRANKUNG DER OCD-UNTERSUCHUNGSGRUPPEN OCD- PROBANDEN Ø Trauma (n=210) + Trauma (n=8) + PTSD (n=6) 743,61 (664,60) 823,13 (516,20) 943 (629,58) OCDEPISODENDAUER-MW, in Wochen (SD)) Statistik (T-Test): 1. Ø Trauma u. + Trauma: T=-0,334, df=216, p=0,738 2. Ø Trauma u. + PTSD: T=-0,725, df=214, p=0,469 3. + Trauma u. + PTSD: T=-0,392, df=12, p=0,702 42 DIAGRAMM 2: MITTLERE OCD-EPISODENDAUER DER OCD-UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE p=0,738 p=0,469 OCD- Episodendauer in Wochen p=0,702 1000 800 743,61 823,13 OCD ohne Trauma (n=210) OCD & Trauma (n=8) 600 943 400 200 0 OCD & PTSD (n=6) OCD- Probanden 3.5.2 Y-BOCS- Werte Als zweites Kriterium für den Einfluss erlebter Traumatisierung auf die Schwere der Zwangserkrankung sollen nun die Werte der „Yale-Brown-Obsessive-CompulsiveScale“ (Y-BOCS) näher untersucht werden. Für den Vergleich der Y-BOCS-Werte der verschiedenen Untersuchungsgruppen findet der Gesamtscore der Y-BOCS Verwendung. Dieser setzt sich jeweils zur Hälfte aus Schweregradeinschätzungen der Zwangshandlungen sowie –gedanken zusammen und kann im ungünstigsten Fall den Wert 40 annehmen. Wiederholt wurden alle OCD-Fälle in drei Untergruppen aufgeteilt: Die Mediane der drei Probandengruppen betragen für den Großteil der OCD-Probanden ohne Traumatisierung 18 (n=180), für die sieben Probanden mit alleiniger Traumatisierung 20. Für die sechs Probanden mit zusätzlicher PTSD liegt der Median bei 27,5. Trotz tendenzieller Zunahme unterschied sich der Y-BOCSGesamtscore der verschiedenen Untersuchungsgruppen im Mann-Whitney-Test (U-Test) nichtsignifikant: Exakte Signifikanz: 1.) p=0131 für den Vergleich der OCDProbanden ohne Traumatisierung und mit PTSD 2.) p=0,962 beim Vergleich der Nicht-Traumatisierten und Traumatisierten und 3.) p=0,147 beim Vergleich der Traumatisierten und Probanden mit PTSD. 43 TABELLE 15: MEDIANE DES Y-BOCS-GESAMTSCORES DER OCD-UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE OCD- PROBANDEN Ø Trauma (n=180) 18 MEDIAN DER YBOCSGESAMTWERTE + Trauma (n=7) 20 + PTSD (n=6) 27,5 Statistik (U-Test): 1. Ø Trauma u. + Trauma: Exakte Signifikanz: p=0,962 2. Ø Trauma u. + PTSD: Exakte Signifikanz: p=0,131 3. + Trauma u. + PTSD: Exakte Signifikanz: p=0,147 DIAGRAMM 3: MEDIANE DES Y-BOCS-GESAMTSCORES DER OCD-UNTERSUCHUNGSGRUPPEN p=0,962 Median des Y-BOCSGesamtwertes 30 p=0,131 p=0,147 25 27,5 20 15 20 18 10 5 0 Ø Trauma (n=180) & Trauma (n=7) & PTSD (n=6) OCD- Probanden 3.5.3 Lebenszeitdiagnosen Das Vorhandensein verschiedener komorbider, zusätzlich zur OCD bestehender Lebenszeitdiagnosen liefert einen weiteren Parameter zur Beurteilung des Erkrankungsausmaßes der gesamten OCD-Probanden. Die hauptsächlich vertretenen komorbiden Störungen der drei Untersuchungsgruppen wie Depression (MDD), Angststörungen (soziale und spezifische Phobien), suizidale Handlungen, somatoforme und hypochondrische Störungen sowie Essstörungen wurden in ihrer Häufigkeit erfasst und prozentual auf die Untersuchungsstichprobe aller OCDProbanden umgerechnet. Anschließend konnten mittels Ȥ²-Test bzw. Exaktem Test nach Fisher Vergleiche zwischen den einzelnen OCD-Untersuchungsgruppen vorgenommen werden. 44 TABELLE 16: LEBENSZEITDIAGNOSEN DER OCD-UNTERSUCHUNGSSTICHPROBE n (%) der OCD-Untersuchungsstichprobe LEBENSZEITDIAGNOSEN ØTrauma (n=210) +Trauma (n=8) + PTSD (n=6) 14 (6,7) 2 (25) 2 (33,3) Depression (MDD) 118 (56,2) 4 (57,1) 4 (66,7) Suizidalität 33 (15,7) 2 (25) 2 (33,3) 14 (6,7) 0 2 (33,3) Soziale Phobie 34 (16,1) 2 (25) 2 (33,3) Spezifische Phobie 38 (18,1) 0 1 (16,7) Essstörung Somatisierungsstörung/ Hypochondrie 3.5.3.1 OCD- Probanden ohne Trauma Die mit Abstand am häufigsten auftretende Lebenszeitdiagnose innerhalb dieser Probandengruppe ist die Depression. 118 von 210 Probanden berichteten, im Laufe des Lebens daran gelitten zu haben oder noch daran zu leiden. Das entspricht 56,2% der OCD-Gruppe ohne Traumatisierung. Die Spezifische Phobie nannten 38 (18,1%) der Probanden, dicht gefolgt von der Sozialen Phobie und Suizidalen Handlungen mit 34 (16,1%) bzw. 33 (15,7%) Probanden. Je 14 (6,7%) Probanden litten an Somatoformen Störungen oder Hypochondrie sowie Essstörungen. DIAGRAMM 4: LEBENSZEITDIAGNOSEN DER ZWANGSPROBANDEN OHNE TRAUMA 14 (6,7%) Essstörung 38 (18,1%) MDD 34 (16,1%) 118 (56,2%) 14 (6,7%) 33 (15,7%) Suizidale Handlungen Somatisierungsstrg./ Hypochondrie Soziale Phobie Spezifische Phobie 45 3.5.3.2 OCD- Probanden mit Trauma Auch in dieser Untersuchungsgruppe von insgesamt acht Probanden erhielten vier Probanden im Laufe ihres Lebens die Diagnose einer Depressiven Episode (57,1% der OCD-Probanden mit Traumatisierung). Jeweils zwei Probanden (25%) berichteten von einer Essstörung, Suizidalen Handlungen sowie einer Sozialen Phobie. DIAGRAMM 5: LEBENSZEITDIAGNOSEN DER ZWANGSPROBANDEN MIT TRAUMATISIERUNG 2 (25%) Essstörung 2 (25%) MDD Suizidale Handlungen Soziale Phobie 2 (25%) 4 (50%) 3.5.3.3 OCD- Probanden mit PTSD Den Hauptanteil der Lebenszeitdiagnosen bestreitet auch in dieser Gruppe die Depression: Vier der sechs Probanden mit komorbider OCD und PTSD erlebten eine depressive Episode, was prozentual 66,7% oder zwei Drittel der Probanden dieser Untersuchungsgruppe bedeutet. Je ein Drittel (33,3%) der Probanden nannte als weitere Lebenszeitdiagnose Essstörungen, Suizidale Handlungen, Somatisierungsstörung/ Hypochondrie oder die Soziale Phobie. Ein Proband (16,7%) berichtete von einer spezifischen Phobie. DIAGRAMM 6: LEBENSZEITDIAGNOSEN DER ZWANGSPROBANDEN MIT PTSD 1 (16,7%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) Essstörung MDD Suizidale Handlungen 4 (66,7%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) Somatisierungsstörung/ Hypochondrie Soziale Phobie Spezifische Phobie 46 Ein Vergleich der drei OCD-Untersuchungsgruppen hinsichtlich der Anzahl an Lebenszeitdiagnosen erfolgt mit Hilfe der Ȥ2-Testung bzw. Exaktem Test nach Fisher. Insgesamt ergeben sich hierbei für keine Gruppe signifikante Unterschiede. Bei dem Vergleich der OCD-Probanden ohne Trauma und denen mit alleinigem Trauma kommt es zu folgenden Ergebnissen: Bezüglich einer Essstörung liegt der Ȥ2-Wert bei 3,839 (p=0,108 Exakte Signifikanz). Ȥ2=0,002 (p=1 Exakte Signifikanz) errechnet sich für die Depression. Für Suizidale Handlungen gilt Ȥ2=0,503 (p=0,617 Exakte Signifikanz) und Ȥ2=0,567 (p=1 Exakte Signifikanz) für die Somatisierungsstörung bzw. Hypochondrie. Für die Soziale und Spezifische Phobie ergeben sich Werte von Ȥ2=0,443 (p=0,621 Exakte Signifikanz) bzw. Ȥ2=1,743 (p=0,356 Exakte Signifikanz). Der Gruppenvergleich der Probanden ohne Trauma und mit PTSD ergibt für die Essstörung sowie die Somatisierungsstörung/ Hypochondrie: Ȥ2=6,089 (p=0,064 Exakte Signifikanz) für die Depression: Ȥ2=0,251 (p=0,7 Exakte Signifikanz) und für Suizidale Handlungen: Ȥ2= 1,35 (p=0,249 Exakte Signifikanz). Für die Soziale Phobie gilt: Ȥ2= 1,25 (p=0,26 Exakte Signifikanz) und für die Spezifische Phobie: Ȥ2=0,007 (p=1 Exakte Signifikanz). Als nächstes werden die Probanden mit alleiniger Traumatisierung mit denen mit PTSD verglichen. Bei der Essstörung, Suizidalen Handlungen und Sozialer Phobie beträgt Ȥ2= 0,117 (p=1 Exakte Signifikanz). Für die Depression ergibt sich Ȥ2=0,124 (p=1 Exakte Signifikanz), für die Somatisierungsstörung/ Hypochondrie: Ȥ2=3,111 (p=0,165 Exakte Signifikanz) und für die Spezifische Phobie: Ȥ2=1,436 (p=0,429 Exakte Signifikanz). TABELLE 17: STATISTISCHE AUSWERTUNG DER LEBENSZEITDIAGNOSEN INNERHALB DER OCDNTERSUCHUNGSSTICHPROBE Ȥ² (p, Exakter Test nach Fisher, df=1) LEBENSZEITDIAGNOSEN OCD Ø TRAUMA u. OCD Ø TRAUMA u. OCD + TRAUMA u. + TRAUMA + PTSD + PTSD 3,839 (0,108) 6,089 (0,064) 0,117 (1,0) 0,002 (1,0) 0,251 (0,7) 0,124 (1,0) 0,503 (0,617) 1,350 (0,249) 0,117 (1,0) 0,567 (1,0) 6,089 (0,064) 3,111 (0,165) Soziale Phobie 0,443 (0,621) 1,25 (0,260) 0,117 (1,0) Spezifische Phobie 1,743 (0,356) 0,007 (1,0) 1,436 (0,429) Essstörung Depression (MDD) Suizidalität Somatisierungsstörung/ Hypochondrie 47 4. DISKUSSION 4.1 Stichprobe, Studienpopulation und Repräsentativität Zur Prüfung der Stichprobe auf Repräsentativität erfolgt ein Vergleich der demografischen Merkmale mit denen anderer Studien, um die Ergebnisse anschließend verallgemeinern zu können. Danach werden die demografischen Eigenheiten von OCD-Indexprobanden mit denen der Kontrollindices verglichen, um signifikante Unterschiede zu bewerten. Der Aufbau des Projekts entspricht dem einer kontrollierten Studie. Das Besondere der Stichprobe liegt in der Zusammenführung von klinischem und nichtklinischem Patientenklientel. So stammen die Zwangsprobanden zum Teil aus universitären Einrichtungen (n= 176) aber auch aus der epidemiologischen SHIP-Studie (n=49). Daher ist die Probandenrekrutierung nur zum Teil repräsentativ, da die Therapieangebote universitärer Einrichtungen von bestimmten Patientengruppen eher erreicht werden (z.B. Patienten, die einer Behandlung aufgeschlossener oder besser informiert gegenüberstehen oder sehr starken Leidensdruck empfinden). Die Rekrutierung der Kontrollprobanden erfolgte randomisiert durch die Einwohnermeldeämter und die SHIP-Studie. Untersuchungsstichprobe gegenüber anderen Stichproben Das mittlere Alter der Gesamtstichprobe zum Untersuchungszeitpunkt lag bei 39,5 Jahren, das der Zwangsprobanden bei 37,4 Jahren und damit im Rahmen der Ergebnisse entsprechender klinischer und epidemiologischer Studien. Dort wird das Durchschnittsalter meist zwischen 33-41 Jahren angegeben (Pauls et al. 1995; Lensi et al. 1996; Nestadt et al. 2000; Fyer et al. 2005; Cromer et al. 2007). Innerhalb der Gruppe der Zwangsprobanden besteht ein Frauenüberschuss von 57,7% gegenüber dem Männeranteil von 42,3%. Das zu den Frauen verschobene Geschlechterverhältnis findet sich typischerweise in anderen Studienergebnissen wieder. Black (1974) konnte durch Zusammenfassung von 11 Studien mit insgesamt 1336 Zwangsprobanden einen Frauenanteil von 51,4% aufzeigen. Rasmussen und Eisen (1992) erhielten bei 560 Patienten einen Frauenüberschuss von 53,8% und Cromer et al. (2007) sogar eine Frauenanteil von 62,9% bei 265 OCD-Patienten. In Betracht gezogen werden müssen die demografischen Eigenheiten der jeweiligen Länder, so beträgt in Deutschland das 48 Geschlechterverhältnis 51,09% Frauen zu 48,91% Männern (Statistisches Bundesamt 2004). Zusätzlich gelten Frauen im Allgemeinen gegenüber Therapieangeboten und auch Studienteilnahmen aufgeschlossener, was ebenfalls zu dem erhöhten Frauenanteil der Studie beigetragen haben mag. Der Ausländeranteil der Studienteilnehmer ist mit 1,9% definitiv geringer als deren Anteil an der Bevölkerung mit 8,8% (Statistisches Bundesamt 2004), aber konsistent mit anderen Studien (Cromer et al. 2007; Nestadt et al. 2000; Rasmussen und Eisen 1992). Dieser niedrige Anteil hängt vermutlich zusammen mit erschwerten Zugangsvoraussetzungen zu therapeutischen Angeboten, da von weltweit ähnlichen Prävalenzen in allen sozioökonomischen Schichten ausgegangen wird (Weissman et al. 1994). Betrachtet man den Familienstand der Zwangsprobanden, so fällt der leicht erhöhte Anteil nie Verheirateter von 48,5% auf. Ähnliche Ergebnisse lieferten bisherige Studien (Nestadt et al. 2000; Karno et al. 1988; Lensi et al. 1996). Die dafür ursächlich vermutete eheliche Fehlanpassung gilt aber nicht allein für die Zwangsstörung. Die Scheidungsrate von 6,2 % liegt im Bevölkerungsdurchschnitt (Statistisches Bundesamt 2004) und repliziert andere Studien (Lensi et al. 1996). Die erhöhte Kinderlosigkeit der Zwangsprobanden von 60,8% scheint mit den hohen Zahlen an Alleinlebenden und nie Verheirateten assoziiert zu sein und findet sich z.B. bei Nestadt et al. (2000) wieder. Der Ausbildungsgrad der OCD-Probanden reicht von Haupt- oder Volksschulbildung bis zum Hochschulabschluss. Die Mehrzahl der Probanden absolvierte einen der Realschule entsprechenden Abschluss. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausbildungssysteme der Studienländer weichen andere Studienergebnisse nicht von unseren ab (Nestadt et al. 2000; Lensi et al. 1996). Den Berufsstatus betreffend zeigen sich ebenfalls ähnliche Ergebnisse in der Literatur, insbesondere gleicht sich der hohe Anteil der Unbeschäftigten durch Arbeitslosigkeit oder Berentung (Lensi et al. 1996). Auch hier müssen die jeweiligen nationalen sozioökonomischen Voraussetzungen der Studienländer beachtet werden. Abschließend kann gesagt werden, dass unsere Zwangsprobanden denen anderer Studien in wichtigen demografischen Merkmalen gleichen. Die Repräsentativität unserer Studie wird noch erhöht durch den Anteil der aus der epidemiologischen SHIP-Studie rekrutierten Probanden. Ob trotz der Rekrutierungsmethode eine repräsentative Auswahl getroffen wurde ist nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen, zumal der Anteil der klinischen den der epidemiologischen Vergleichsstudien überwiegt. 49 Untersuchungsstichprobe Bei Zwangs- und Kontrollprobanden gibt es hinsichtlich des Geschlechts keine signifikanten Unterschiede. Zwangsprobanden Allerdings signifikant unter liegt dem das der Durchschnittsalter Kontrollen, ebenso der die durchschnittliche Kinderzahl. Auch beim Familienstand, der Ausbildung und dem Berufsstand gibt es signifikante Unterschiede. Der Anteil der allein lebenden und nie verheirateten Zwangsprobanden übertrifft den der Kontrollen. Des Weiteren absolvierten mehr Zwangspatienten als Kontrollen das Abitur. Unter den Kontrollen findet sich eine höhere Zahl an Rentnern, unter den Zwangsprobanden allerdings signifikant mehr Unbeschäftigte. Letzteres resultiert zum großen Teil aus der Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Erkrankung selbst. Die drei OCD-Untergruppen, bestehend aus Zwangsprobanden ohne/ mit Traumatisierung und PTSD, zeigen sich in allen demografischen Merkmalen homogen. 4.2 Material, Methoden und Studiendurchführung Durch die multizentrische Deutschlands unter Probandenrekrutierung Einbeziehung der an vier Krankenhäusern Allgemeinbevölkerung mittels der epidemiologischen SHIP-Studie umfasst die vorliegende kontrollierte Studie ein breites Probandenspektrum. Regionale Unterschiede hinsichtlich verschiedener Lebens- und Denkweisen aber auch regional abweichender Altersstrukturen in der Bevölkerung treten damit in den Hintergrund. Die randomisierte Rekrutierung der Kontrollprobanden ermöglicht die Annäherung an wahre Bevölkerungsprävalenzen. Insgesamt kann die Validität der Ergebnisse als hoch angesehen werden. Zur Interviewdurchführung kamen international anerkannte und etablierte Messinstrumente zur Anwendung. Ihnen liegen gute Testkriterien zugrunde. So wird die Güte und hohe Zuverlässigkeit des SADS-LA-IV durch fundierte Reliabilitätsstudien belegt: Die Interrater-Reliabilität auf Syndromebene liegt zwischen r=0,82 und r=0,99, die Test-Retest-Korrelation zwischen r=0,49 und r=0,93 (73% über r=0,7). Dabei fanden sich hohe Übereinstimmungen für die Diagnostik der Major Depression und Schizophrenie. Als weniger reliabel erwiesen sich die Erfassung von Dysthymie und besonders der Phobien, wobei möglicherweise eine fehlende Schwellendefinition der psychosozialen Beeinträchtigung eine Rolle spielt (Endicott und Spitzer 1978; Manuzza et al. 1986; Leboyer et al. 1991). 50 In der vorliegenden Studie wurde die Interrater-Reliabilität bei 15 zufällig ausgewählten Zwangsprobanden getestet. Dies entspricht 10% der face-to-faceInterviews. Zusätzlich untersuchten wir bei elf Kontrollprobanden die InterraterReliabilität, was einen Anteil von 9,5% der face-to-face-Interviews ergibt. Die Kappa-Werte als Maß der diagnostischen Übereinstimmung liegen für die Zwangsstörung bei 1,0, für die Major Depression bei 0,92, für die Panikstörung bei 1,0 und für die somatoformen Störungen bei 1,0. Die Interrater-Reliabilität beträgt für die Diagnose einer Essstörung ț=1,0, bei PTSD ț=0,84, bei Substanzabusus ț=1,0, bei Tic-Störungen ț=0,47 und bei den Spektrumerkrankungen ț=0,77. Für die Zuverlässigkeit der Y-BOCS sprechen eine Reihe psychometrischer Tests. In ihnen konnten eine hohe Interrater-Reliabilität (zwischen 0,82 und 0.96), innere Konsistenz sowie valide Erfassung der OCD-Schwere nachgewiesen werden (Goodman et al. 1989 a, b). Bei einem Probanden der Stichprobe kam das FremdbeurteilungsverfahrenInstrument Family Informant Schedule and Criteria (FISC) zur Anwendung. Eine Fehlerquelle liegt hier in der hohen Sensibilität des Befragten für eigene oder ähnliche Krankheitsbilder, welche von ihm dann eher dem Angehörigen, über den er Auskunft erteilt, zugeschrieben werden. Die Interviewblindheit erreicht insgesamt ein hohes Niveau. Sie konnte großteils dadurch gewährleistet werden, dass den Interviewern in den meisten Fällen keine Informationen zu den Probanden vorlagen. Oft fehlte selbst die Angabe der Gruppenzugehörigkeit. Allerdings gelang diese Vorgehensweise nicht in jedem Fall. Des Weiteren kamen mehrere Interviewer zum Einsatz, was systematischen Fehlerquellen entgegenwirkt. In den Interviews konnten sowohl aktuelle als auch Lebenszeitdiagnosen aller Störungen, inklusive der Zwangserkrankung, erfasst werden. Dieses retrospektive Vorgehen setzt ein gutes Erinnerungsvermögen seitens der Probanden voraus, um ein möglichst genaues Bild von Symptomatik und Erkrankungsverlauf zu erhalten. Obwohl nicht alle Interviewer langjährige psychiatrische Erfahrungen vorweisen können, erreichten die Diagnosen eine gute Sicherheit und Übereinstimmung durch intensives Interviewtraining und kontinuierliche Supervision, wobei jederzeit die Möglichkeit der Rücksprache mit erfahrenen Studienmitarbeitern gegeben war. Zu noch größerer Validität hätte die Diagnosesicherung durch Anforderung medizinischer Berichte beitragen können, was im Rahmen dieser Studie nicht praktiziert wurde. 51 4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 4.3.1 Häufigkeit von Traumatisierung und PTSD In unserer Stichprobe zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Häufigkeit traumatisierender Ereignisse zwischen Fällen und Kontrollen (6,7% vs. 9%). Ebenso erhielten die Zwangsprobanden nicht signifikant öfter die Diagnose einer PTSD (2,5%) verglichen mit den Kontrollen (4,5%). Diese Ergebnisse reihen sich in die heterogenen und widersprüchlichen Aussagen anderer Studien ein, welche die Assoziation traumatischer Lebensereignisse bei Zwangskranken untersuchten. So fanden Maina et al. 1999 diesbezüglich keine Unterschiede zwischen Fällen und Kontrollen. Demgegenüber stehen eine signifikante Häufung stressiger Lebensereignisse innerhalb eines Jahres vor Symptombeginn der Zwangsstörung bei Probanden der kontrollierten Studien von McKeon et al. 1984 und in der pädiatrischen Studie von Gothelf et al 2004. Eine Reihe klinischer und epidemiologischer Studien zur Komorbidität von OCD mit PTSD zeigten heterogene Ergebnisse. So reichen die Prävalenzen von 1,6 bis zu 34% bei Stichprobengrößen von 5 bis 910 OCD-Probanden. Denys et al. 2004 fanden eine PTSD-Häufigkeit von 1,7% bei 420 OCD-Probanden, Brown, Campbell et al. 2001, diagnostizierten bei 7% von 156 OCD-Probanden eine PTSD. Dabei handelt es sich um klinische Studien. In den epidemiologischen Studien von Andrews and Slade 2002; Perkonigg et al. 2000; Davidson et al. 1991 und Welkowitz et al. 2000, erwiesen sich die Prävalenzen diesbezüglich als höher: Bei 34% von 53 OCD-Probanden, 20% von 10, 12% von 48 bzw. 19% von 910 OCDProbanden wurden eine komorbide OCD und PTSD diagnostiziert. Mohammadi et al. 2004, beschreiben demgegenüber in ihrer epidemiologischen Studie nur bei 1,1% von 444 OCD-Probanden eine PTSD-Diagnose. Die Zahlen sind vor dem Hintergrund der verschiedenen Studienländer aufgrund unterschiedlicher PTSDBevölkerungsprävalenzen nur mit Einschränkung vergleichbar. Während sich die Fälle komorbider OCD und PTSD unserer Probandenstichprobe eher den Prävalenzen der oben genannten klinischen Studien annähern, scheinen die nichtklinischen Probanden laut Studienlage vermehrt unter der Komorbidität von OCD und PTSD zu leiden. Ursächlich mag zum Teil die Art der Datenerhebung und Diagnosevergabe sein. Das Probandenkollektiv der klinischen Studien entstammt spezialisierten Angstkliniken, in denen insgesamt diagnostische Fehlerquellen infolge häufig vorkommender Symptomüberlappungen bei OCD und PTSD möglicherweise niedriger gehalten werden können. Andererseits wäre es denkbar, dass die stabilisierende Komponente der Zwangsstörung im Falle einer komorbiden 52 PTSD die Gefahr einer psychischen Dekompensation minimiert und den Leidensdruck in Schach hält, welcher sonst eventuell früher zu einem Behandlungswunsch geführt hätte. Bei den Kontrollprobanden unserer Studie zeigt sich eine prozentual höhere Rate an Traumatisierungen und PTSD-Diagnosen als bei den Fällen. Zum einen ist die geringere Zahl der Kontrollprobanden zu beachten, zum anderen liegt das Durchschnittsalter der Kontrollen über dem der Zwangsprobanden, was bei der Erfassung von Lebenszeitdiagnosen bedacht werden muss, um Verzerrungen durch Summationseffekte auszuschließen. Eine zu voreilige Selektion potentieller Traumaexponierter mag aus der Art der Befragung resultieren. So wurde in der Eingangsfrage anhand diagnostischer Kriterien der Fokus auf extreme plötzlich eintretende Traumata gelegt, ohne repetitive (Sub-)Traumatisierungen (z.B. emotionale Vernachlässigung in der Kindheit) und subjektive Bewertungen dieser Ereignisse explizit zu erfassen. Eine Prävalenzunterschätzung könnte daraus resultieren. Für die Beantwortung der umgekehrten Frage, ob es eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Antreffen einer Zwangsstörung bei Traumatisierten gegenüber Nichttraumatisierten gibt, existieren verschiedenste Studien. So fanden Helzer et al. 1987 in der Allgemeinbevölkerung ein zehnfach erhöhtes OCD-Risiko für Probanden mit PTSD. Boudreaux et al.1998 gaben ein erhöhtes OCD-Risiko für Probanden an, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden. In dieselbe Richtung weisen die Studien von Jordan et al. 1991 und Solomon 1993. Allerdings werden für eine Reihe von Störungen ebenfalls erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeiten nach einem Trauma angenommen, so auch für die Depression (Helzer et al. 1987) und Generalisierte Angststörung, welche die hohen Komorbiditätsraten bei PTSD bestätigen. Kausale Zusammenhänge können anhand dieser Beobachtungen nicht endgültig geklärt werden. Die Bearbeitung der Frage nach einem möglichen Kausalzusammenhang von Traumatisierung/ PTSD und OCD blieb vorerst einigen Autoren von Fallstudien zu diesem Thema vorbehalten (Pitman 1993; Sasson et al. 2005 u.a.). 4.3.2 Zeitliche Assoziation bei Komorbidität von OCD und (sub- )klinischer PTSD Eine enge zeitliche Aufeinanderfolge von OCD- und (sub-)klinischem PTSDStörungsbeginn konnte nur in zwei Fällen nachgewiesen werden: Hier traten die störungsspezifischen Symptome beider Erkrankungen innerhalb eines Jahres, sogar innerhalb desselben Monats auf. Bei sechs Probanden wurde die 53 (sub-)klinische PTSD- vor der OCD-Diagnose gestellt. Vier Probanden berichteten von einer späteren PTSD- Diagnose nach OCD- Beginn. Auch zeigten sich keine unterschiedlichen Tendenzen bezüglich der Erkrankungsreihenfolge bei Probanden mit klinischem oder nur subklinischem Ausprägungsgrad der PTSD. Ebenso wie die meisten genannten Studien handelt es sich bei unserer Studie um eine retrospektive Erhebungsart, was die Erfassung besonders weit zurückreichender Ereignisse sowie genauer zeitlicher Angaben erschwert. Da in fast allen Fällen viele Jahre zwischen dem Beginn beider Störungen liegen, kann ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen traumatischem Erlebnis und Entstehung der Zwangsstörung hier als unwahrscheinlich angesehen werden. Auch wenn einige Autoren einen typischerweise verzögerten Beginn der Zwangsstörung nach einem Trauma angeben (McKeon et al. 1984), reicht dieser Erklärungsansatz für die sehr großen Zeitabstände bei den meisten unserer Probanden nicht aus. Möglicherweise fördern Veränderungen im die PTSD-Symptomatik emotionalen Erleben, und den damit verbundene Kognitionen und auf neurobiologischer/ neurochemischer Ebene erst im weiteren Erkrankungsverlauf die Entstehung der Zwangsstörung. Wichtig sind in dem Zusammenhang zum einen das jeweilige Ersterkrankungsalter beider Störungen und zum anderen der zeitliche Episodenverlauf. Auffallend ist in unserer Stichprobe das niedrige Ersterkrankungsalter der PTSD mit 20,2 Jahren. Tatsächlich erlebten viele der untersuchten Probanden das erste Trauma in der Kindheit. Bezüglich der Zwangserkrankung unterscheidet sich das Ersterkrankungsalter bei Probanden mit Trauma/ PTSD unwesentlich von dem bei Probanden ohne Traumatisierung (21,3 vs. 21,4 Jahren) und liegt im Rahmen bisheriger Forschungsergebnisse (Minichiello et al. 1990). Das Auftreten der Zwangserkrankung bei OCD-Probanden mit Trauma/ PTSD deckt sich mit dem in der Literatur beschriebenen OCD-Ersterkrankungsalter in der ersten Hälfte der dritten Lebensdekade und würde eher gegen eine spezielle Untergruppe traumatisierter Zwangskranker sprechen. Bei genauerer Betrachtung Erkrankungsreihenfolge gab PTSD-OCD es bei unter fünf den Probanden Probanden eine mit der zeitliche Überschneidung beider Störungen, aus der bei jeweils zwei Probanden die Zwangsstörung allein oder zusammen mit der PTSD hervorging. Bei einem Probanden überdauerte die PTSD allein. Drei Probanden gaben keine zeitliche Überschneidungen beider Störungen an, wobei die Zwangsstörung dieser Probanden aktuell allein anhält. Für die vier Probanden, bei denen die PTSD auf eine schon bestehende OCD folgt, überschneiden sich beide Störungen in jedem Fall. Bei drei Probanden halten OCD und PTSD gemeinsam an, bei einem 54 Probanden überdauert die OCD allein bis zum Interviewzeitpunkt. So wird ersichtlich, dass sich beide Störungen trotz weit auseinander liegender Ersterkrankungszeitpunkte durch meist stattgefundene zeitliche Überschneidungen gegenseitig beeinflussen konnten und besonders zu Chronifizierung neigen. In den überwiegenden Fällen hält die Zwangsstörung aktuell an, in einigen Fällen begleitet durch die PTSD. Diese Ergebnisse ähneln den von DeSilva und Marks (1999) häufig beobachteten Verlaufsformen bei Komorbidität von OCD und PTSD. Sie beschrieben in ihrer Studie, dass meistens die Zwangsstörung nach einer gewissen Zeit der Überschneidung beider Störungen allein und voll ausgeprägt zurückbleibt. Möglicherweise bietet die Zwangsstörung in solchen Fällen dem Patienten unterbewusst geeignetere Mittel zur Angstreduktion sowie –kontrolle als im Rahmen der PTSD, wodurch die Symptome der PTSD verdrängt werden können. Diese Sichtweise wird von Beobachtungen gestützt, bei denen die Therapieversuche der einen Erkrankung das Wiederaufflackern der anderen bedingen (s. Einleitung). In Anbetracht der kleinen Probandenzahl und daraus resultierender minimierter Aussagekraft wird die beschreibende Sichtweise der Darstellung betont. 4.3.3 Formen der Traumatisierung In den Studien von Ravizza et al. 1997 und Maina et al. 1999 bezüglich des Einflusses stressiger Lebensereignisse auf den Beginn einer Zwangsstörung, ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen Zwangsprobanden und Kontrollen eher beim Vergleich der Art des Ereignisses als bei deren Anzahl. Die qualitativen Unterschiede der Traumata zwischen Zwangsprobanden und Kontrollen unserer Stichprobe zeigen diese Tendenz ebenfalls, sie erreichen aber keine Signifikanz. Im Gegensatz zu den Zwangskranken erlitten drei (2,3%) Kontrollprobanden Traumata während Kriegshandlungen und bei zweien (1,5%) wurde ein Nahestehender Opfer eines Gewaltverbrechens. Zwangsprobanden erlitten gegenüber den Kontrollen mehr Unfalltraumata (2,4% vs. 0,8%). Einschränkend muss erwähnt werden, dass die insgesamt höhere Wahrscheinlichkeit für Kriegstraumata vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges aufgrund des höheren Altersdurchschnitts der Kontrollprobanden bedacht werden muss. Die in beiden Untersuchungsgruppen am häufigsten erlebten Traumatisierungen fallen in die Kategorie „Andere Traumata“ (Erkrankung, Missbrauch von Ehepartner oder Kind u.a.). Allerdings vereinigt diese Traumakategorie als eine Art Restkategorie eine Vielzahl möglicher, auch unterschiedlichster Erlebnisse, die 55 inhaltlich von den übrigen vier Gruppen abweichen. Eine genauere Differenzierung ließ sich anhand unseres Datensatzes nicht realisieren. Die in der Literatur vielfach beschriebene (z.B. Breslau et al. 1998) höhere PTSDPrädisposition bestimmter Traumata ließ sich anhand unserer Stichprobe nicht replizieren. Das könnte ursächlich durch den sehr komplexen Prozess der PTSDEntwicklung mit individuellem Zusammenspiel mehrerer zusätzlicher Faktoren wie z.B. durch die Länge der Traumaexposition, Umgebungsfaktoren, soziale Unterstützung im Anschluss an das Trauma bedingt sein. Diese Faktoren können jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. 4.3.4 OCD-Schwere nach Traumatisierung oder PTSD Dass traumatische Ereignisse und eine komorbide PTSD ungünstigere und schwerere Verlaufsformen der Zwangsstörung hervorrufen, bestätigten Studien von Cromer et al. 2007; McLaren & Crowe 2003; Rasmussen & Eisen 1992 sowie die Fallstudie von Sasson et al. 2005. Zur Erklärung der modulierenden Beziehung zwischen Trauma und Zwangsstörung formulierten Cromer et al. 2007 ein pathoplastisches Modell, bewusst ohne dabei auf einen möglichen ursächlichen Einfluss des Traumas für die OCD-Entstehung einzugehen. Ebenso wie Cromer et al. verwendeten wir als Indikator für die Untersuchung der klinischen Schwere der Zwangsstörung den Vergleich der Y-BOCS-Gesamtsummen. Dabei weist unser Ergebnis in dieselbe Richtung: Die Mediane der Y-BOCS-Gesamtsummen steigen tendenziell bei traumatisierten Probanden und noch mehr bei komorbider PTSD im Vergleich zu nicht traumatisierten Probanden. Dieser Anstieg erweist sich jedoch als nicht signifikant. Gleiches gilt für OCD-Episodendauer. Auch hier erreicht die Tendenz zu längerer Episodendauer bei Probanden mit PTSD keine statistische Signifikanz, stützt aber unsere Hypothese von einem ungünstigeren OCD-Verlauf. Insgesamt können für die Vergleiche zusätzlicher komorbider Störungen bei Zwangsprobanden ohne und mit Trauma/ PTSD keine signifikanten Unterschiede erhoben werden. Die Major Depression als meistgestellte komorbide Diagnose (56,2%) steigt in der Häufigkeit prozentual geringfügig an bei Fällen mit Trauma/ PTSD. Insbesondere die Essstörungen sowie Somatisierungsstörung/ Hypochondrie besitzen in unserer Stichprobe eine Tendenz zu verstärktem Auftreten bei komorbider PTSD. Dieser Unterschied erreicht keine statistische Signifikanz. In allen Gruppen waren die Phobien mit relativ hohem Anteil vertreten. Diese Ergebnisse bestätigen die in früheren Studien ( Weissman et al. 1994; Swedo et al. 1989) beschriebene häufige Komorbidität mit Depressiven- und 56 anderen Angststörungen bei einer PTSD- oder OCD-Erkrankung, ohne allerdings vermehrte Lebenszeitdiagnosen Traumatisierung/ PTSD bei OCD-Patienten nachzuweisen. In unserer mit komorbider Stichprobe liegt der Schwerpunkt diagnostizierter komorbider Angststörungen bei den Einfachen und Sozialen Phobien. Dieses Ergebnis ist hochkonsistent mit den Studienergebnissen von Shore et al. 1989; Eisen et al. 1999 und Mohammadi et al. 2006, bei denen komorbide Phobien als zweithäufigste komorbide Störung gleich nach der Major Depression auftraten. Komorbide Somatisierungsstörung/ Hypochondrie und Essstörungen wurden ebenfalls sowohl bei OCD als auch PTSD explizit beschrieben (Grabe et al. 2000; Brady 1997). Neuere OCD-Studien ergaben gegenüber bisherigen Forschungsergebnissen überraschend geringe Komorbiditätsraten: In der klinischen Studie von Denys et al. 2004 mit 420 Zwangspatienten lag sie bei insgesamt 46%, in der epidemiologischen Studie von Mohammadi et al. 2006 (440 Probanden mit OCDDiagnose) traten die häufigsten komorbiden Störungen (MDD, Phobien) nur bei 8,1-14,0% der OCD-Probanden auf. Unterschiedliche zugrunde liegende diagnostische Kriterien im Vergleich zu früheren Studien sowie kulturelle Unterschiede könnten zu diesen Ergebnissen beigetragen haben. Interessanterweise fanden Denys et al. keinen Einfluss der Komorbidität auf die klinische OCD-Schwere, dafür aber eine positive Korrelation zwischen hoher Achse-I-Komorbidität und höherem Depressions- und Angstlevel der Probanden. Hier wäre die Erfassung der prämorbiden Persönlichkeitsstruktur mit einzelnen Dimensionen im Hinblick auf z.B. erhöhte Angstbereitschaft von Interesse. Dieser dimensionale Ansatz war anhand unserer Daten nicht möglich. Hinsichtlich komorbider Persönlichkeitsstörungen betonen einige Autoren insbesondere eine verstärkte Assoziation mit z.B. ängstlich-vermeidender, zwanghafter und dysthymer Persönlichkeitsstörungen. Deren verstärkender Einfluss auf die OCD-Symptomschwere wird in der Literatur beschrieben (Mavissakalian et al. 1990; Baer & Jenike 1992). Die diagnostischen Kriterien einer komorbiden Persönlichkeitsstörung erfüllte aber letztlich keiner der untersuchten OCD-Probanden dieser Stichprobe. Insgesamt bieten die vorliegenden Daten bezüglich Y-BOCS- Gesamtsummenwerten, OCD-Episodendauer und Komorbiditätsraten innerhalb der Zwangsprobandengruppen Hinweise für einen zum Teil schwereren und längeren OCD-Verlauf ohne aber statistisch signifikante Aussagekraft zu erreichen. 57 Schlussfolgerung Zusammengefasst können die zugrunde liegenden Studienergebnisse die in anderen Arbeiten gefundene Assoziation von Realtraumatisierung/ PTSD und OCD nicht bestätigen. Es ergeben sich keine ausreichenden Belege für den ursächlichen Einfluss des Traumas/ PTSD auf den Beginn einer Zwangsstörung. Ebenso findet sich keine statistisch signifikante Erkrankungsschwere oder einer Assoziation bezüglich Trauma-Art, bestimmten zeitlichen Reihenfolge beider Störungen, obwohl die Tendenz zu einer schwereren OCD-Verlaufsform erkennbar war. Dieser Befund ist allerdings nicht spezifisch für traumatisierte Zwangkranke. Im Fall einer komorbiden PTSD/ OCD neigt in unserer Stichprobe häufiger die Zwangsstörung dazu, allein und chronifiziert die PTSD zu überdauern. Hier wäre in möglichen Folgestudien ein prospektives Studiendesign von Vorteil, um genauestens zeitliche Parameter und die gegenseitige Beeinflussung beider Störungen zu erfassen. Zusätzlich könnte eine vergleichende Untersuchung zwischen PTSD-Probanden mit verschiedensten komorbiden Störungen (außer OCD) und PTSD-Probanden mit OCD klären, inwieweit die Zwangsstörung eine auf ein traumatisches Ereignis folgende alternative Reaktionsform aus dem Formenkreis der Angststörungen ist oder ob sie eine besondere Stellung hinsichtlich Verlauf, Schwere etc. einnimmt. Denkbar wäre, dass sich die tendenziell verstärkte OCD-Symptomatik nach Traumatisierung/ PTSD allgemein aus der Komorbidität heraus erklären ließe, ohne große Unterschiede zwischen Probanden mit verschiedenen komorbiden Diagnosen (unter anderem der OCD) zusätzlich zur Traumatisierung/ PTSD festzustellen. Unsere Ergebnisse liefern insgesamt keine Hinweise auf eine spezielle Subgruppe Zwangskranker mit Traumatisierung/ PTSD. Einschränkend für die Aussagekraft muss allerdings die kleine Probandenzahl mit komorbider Traumatisierung/ PTSD und OCD der zugrunde liegenden Stichprobe betont werden. In Anbetracht der zahlreichen Fallstudien zur Assoziation von Zwangssymptomatik, Traumatisierung und PTSD scheint in Einzelfällen eine enge Kopplung zu bestehen. Möglicherweise spielen bei diesen Patienten bestimmte kognitive Überzeugungen und Gefühle hinsichtlich Schuld und Scham eine herausragende Rolle. Beidem wird in der Literatur eine große Bedeutung bei der Entstehung der Zwangsstörung sowie der PTSD im Sinne von Vulnerabilitätsfaktoren zugeschrieben (Salkovskis 1985, 1999; deSilva u. Marks 1999). In dem Zusammenhang besäße Persönlichkeitsdimensionen eine umfassende Relevanz für Untersuchung das Verständnis prämorbider möglicher Einflussfaktoren oder Vulnerabilitäten. Diese und der inhaltliche Zusammenhang 58 zwischen Art der Traumatisierung und sich entwickelnder Zwangssymptomatik ergäben weitere mögliche Untersuchungsaspekte zukünftiger Studien zu dem Thema. Sie wurden im Rahmen dieser Studie nicht untersucht, würden aber einen zusätzlichen Anhaltspunkt zur Klärung der Assoziation beider Störungen bieten. 59 5. LITERATUR 1. Albert U, Maina G, Bogetto F: Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Triggering Life Events. Eur J Psychiat 2000; 14(3):180-188. 2. American Psychiatric Association, Committee on Nomenclature and Statistics. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, DSM- IV, - 4th ed. American Psychiatric Association Washington, DC 1994. 3. Andrews G, Slade T, Issakidis C: Deconstructing current comorbidity: data from the Australian National Survey of Mental Health and Well-Being. Br J Psychiatry. 2002 Oct;181:306-14. 4. Baer L: Factor analysis of symptom subtypes of obsessive compulsive disorder and their relation to personality and tic disorders. J Clin Psychiatry 1994; 55(Suppl.3):1823. 5. Baer L, Jenike MA: Personality disorders in obsessive compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am. 1992 Dec;15(4):803-12 6. Bebbington PE: Epidemiology of obsessive-compulsive disorder. Br J Psychiatry Suppl 1998(35):2-6. 7. Black A: The natural history of obsessional neurosis. In: Obsessional States (ed. H. R. Beech). London: Methuen. 1974 8. Blanchard EB, Hickling EJ, Taylor AE, Loos WR, Gerardi RJ: Psychological morbidity associated with motor vehicle accidents. Behav Res Ther 1994; 32(3):283-90. 9. Blanchard EB, Hickling EJ, Taylor AE, Loos WR, Gerardi RJ. Psychological morbidity associated with motor vehicle accidents. Behav Res Ther. 1994 Mar;32(3):283-90. 10. Bogetto F, Venturello S, Albert U, Maina G, Ravizza L: Gender-related clinical differences in obsessive-compulsive disorder. Eur Psychiatry 1999; 14(8):434-41. 11. Bonne O, Brandes D, Gilboa A, Gomori JM, Shenton ME, Pitman RK, Shalev AY: Longitudinal MRI study of hippocampal volume in trauma survivors with PTSD. Am J Psychiatry 2001; 158(8):1248-51. 12. Boscarino JA: Diseases among men 20 years after exposure to severe stress: implications for clinical research and medical care. Psychosom Med 1997; 59(6):605-14. 13. Boudreaux E, Kilpatrick DG, Resnick HS, Best CL, Saunders BE: Criminal victimization, posttraumatic stress disorder, and comorbid psychopathology among a community sample of women. J Trauma Stress. 1998 Oct;11(4):665-78. 14. Brady KT: Posttraumatic stress disorder and comorbidity: recognizing the many faces of PTSD. J Clin Psychiatry 1997; 58(Suppl 9):12-5. 60 15. Bremner JD, Southwick S, Brett E, Fontana A, Rosenheck R, Charney DS: Dissociation and posttraumatic stress disorder in Vietnam combat veterans. Am J Psychiatry 1992; 149(3):328-32. 16. Bremner JD, Innis RB, Ng CK, Staib LH, Salomon RM, Bronen RA, Duncan J, Southwick SM, Krystal JH, Rich D, Zubal G, Dey H, Soufer R, Charney DS: Positron emission tomography measurement of cerebral metabolic correlates of yohimbine administration in combat-related posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry 1997; 54(3):246-54. 17. Breslau N, Davis GC, Andreski P, Peterson E: Traumatic events and posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults. Arch Gen Psychiatry 1991; 48(3):216-22. 18. Breslau N, Davis GC: Posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults: risk factors for chronicity. Am J Psychiatry 1992; 149(5):671-5. 19. Breslau N, Kessler RC, Chilcoat HD, Schultz LR, Davis GC, Andreski P: Trauma and posttraumatic stress disorder in the community: the 1996 Detroit Area Survey of Trauma. Arch Gen Psychiatry 1998; 55(7):626-32. 20. Breuer J, Freud S: Studies on hysteria (1893-95). In: Strachey J (ed): The Standard Edition. Hogarth Press London 1957; 2: 215-222. 21. Brown GW, Bifulco A, Harris TO. Life events, vulnerability and onset of depression: some refinements. Br J Psychiatry. 1987 Jan;150:30-42. 22. Brown TA, Campbell LA, Lehman CL, Grisham JR, Mancill RB: Current and lifetime comorbidity of the DSM-IV anxiety and mood disorders in a large clinical sample. J Abnorm Psychol. 2001 Nov;110(4):585-99. 23. Carey G, Gottesman II, Robins E: Prevalence rates for the neuroses: pitfalls in the evaluation of familiality. Psychol Med. 1980 Aug;10(3):437-43. 24. Carlier IV, Gersons BP. Partial posttraumatic stress disorder (PTSD): the issue of psychological scars and the occurrence of PTSD symptoms. J Nerv Ment Dis. 1995 Feb;183(2):107-9. 25. Charcot JM: Leçons sur les maladies du système nerveux. Paris 1884-85 (2Bde). 26. Chen CN, Wong J, Lee N et al.: The Shatin Community mental health survey in Hong Kong, II: major findings. Arch Gen Psychiatry 1993; 50:125-133. 27. Cromer KR, Schmidt NB, Murphy DL: An investigation of traumatic life events and obsessive-compulsive disorder. Behav Res Ther. 2007 Jul;45(7):1683-91. Epub 2006 Oct 25. 28. Csef H: Zwangserkrankungen. In: Egle UT, Hoffmann SO, Joraschky P (Hrsg.): Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. Schattauer Verlag Stuttgart, 2. Auflage 2000; 202-212. 29. Cummings JL, Cunningham K. Obsessive-compulsive disorder in Huntington's disease. Biol Psychiatry. 1992 Feb 1;31(3):263-70. 30. DaCosta JM: On irritable heart: A clinical study of a form of functional cardiac disorder and its consequences. Am J Med Sciences 1871; 61:17-52. 61 31. Davidson JR, Hughes D, Blazer DG, George LK: Post-traumatic stress disorder in the community: an epidemiological study. Psychol Med. 1991 Aug;21(3):713-21. 32. Denys D, Tenney N, van Megen HJ, de Geus F, Westenberg HG: Axis I and II comorbidity in a large sample of patients with obsessive-compulsive disorder. J Affect Disord. 2004 Jun;80(2-3):155-62. 33. DeSilva P, Marks M: The role of traumatic experiences in the genesis of obsessive compulsive disorder. Behav Res Ther 1999; 37:941-951. 34. Dilling H, Mombour W, Schmidt MH (Hrsg.): Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Huber Verlag Bern, 2. Auflage 1993. 35. Dilling H, Mombour W, Schmidt MH (Hrsg.): Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, Kapitel V (F). Forschungskriterien. Huber Verlag Bern, 2. Aufl. 1994. 36. Ehlers A & Clark DM: A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy 2000; 38:319-345. 37. Ehlers A, Mayou RA, Bryant B: Psychological predictors of chronic posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. J Abnorm Psychol 1998; 107(3):50819. 38. Endicott J, Spitzer RL: A diagnostic interview: the schedule for affective disorders and schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 1978; 35(7):837-44. 39. Erichsen JE: On railway and other injuries of the nervous system. H. C. Lea Philadelphia 1867. 40. Esquirol JED: Des Maladies Mentales. Lafayette Paris 1838. 41. Fairbank JA, Schlenger WE, Saigh PH et al.: An epidemiologic profile of posttraumatic stress disorder: Prevalence, comorbidity, and risk factors. In: Friedman MJ, Charney DS, Deutch AY (Hrsg): Neurobiological and clinical consequences of stress: From normal adaptation to post-traumatic stress disorder. Lippincott- Raven Philadelphia 1995. 42. Fischer G, Riedesser P: Lehrbuch der Psychotraumatologie. Reinhardt Verlag München 1998. 43. Freud A: Comments on Trauma. In: Furst S: Psychic Trauma. Basic Books New York 1967. 44. Freud S: Jenseits des Lustprinzips. Studienausgabe. Bd.3. Fischer Verlag Frankfurt am Main 1920;S.1-69. 45. Freud S.: Die Abwehrneuropsychosen. 1894a GW1. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 5.Aufl. 1977 46. Fyer AJ, Lipsitz JD, Mannuzza S, Aronowitz B, Chapman TF: A direct interview family study of obsessive-compulsive disorder. I. Psychol Med. 2005 Nov;35(11):1611-21. 62 47. Gershuny BS, Baer L, Jenike MA, Minichiello WE, Wilhelm S: Comorbid posttraumatic stress disorder: impact on treatment outcome for obsessivecompulsive disorder. Am J Psychiatry. 2002 May;159(5):852-4. 48. Gilbertson MW, Shenton ME, Ciszewski A, Kasai K, Lasko NB, Orr SP, Pitman RK: Smaller hippocampal volume predicts pathologic vulnerability to psychological trauma. Nat Neurosci 2002; 5(11):1242-7. 49. Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA: The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale 1: Development, use, and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989a; 46:1006-11. 50. Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA: The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale II: Validity. Arch Gen Psychiatry 1989b; 46:1012-6. 51. Goodman WK, McDougle CJ, Price LH: The role of serotonin and dopamine in the pathophysiology of obsessive compulsive disorder. Int Clin Psychopharmacol 1992; 7(Suppl 1):35-8. 52. Gothelf D, Aharonovsky O, Horesh N, Carty T, Apter A: Life events and personality factors in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder and other anxiety disorders. Compr Psychiatry. 2004 May-Jun;45(3):192-8. 53. Grabe HJ, Freyberger HJ: [Neurobiological Aspects of Obsessive-Compulsive disorder - An Approach for Biological Research in Psychotherapy]. Z Psychosom Med Psychother 1999; 45(1):18-30. 54. Grabe HJ, Goldschmidt F, Lehmkuhl L, Gansicke M, Spitzer C, Freyberger HJ: Dissociative symptoms in obsessive-compulsive dimensions. Psychopathology 1999; 32(6):319-24. 55. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, Rumpf HJ, Freyberger HJ, Dilling H, John U: Prevalence, quality of life and psychosocial function in obsessive-compulsive disorder and subclinical obsessive-compulsive disorder in northern Germany. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2000; 250(5):262-8. 56. Grabe HJ, Pitzner A, Freyberger HJ, Maier W: German translation and adaptation for: Fyer AJ, Endicott J, Klein DF: Schedule for affective disorders and schizophrenia- lifetime version modified for the study of anxiety disorders 1985. Updated for DSM IV (SADS-LA IV). 57. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, Rumpf HJ, Freyberger HJ, Dilling H, John U: Lifetime-comorbidity of obsessive-compulsive disorder and subclinical obsessivecompulsive disorder in Northern Germany. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2001; 251(3):130-5. 58. Grabe HJ, Ruhrmann S, Spitzer C, Josepeit J, Ettelt S, Buhtz F, Hochrein A, Schulze-Rauschenbach S, Meyer K, Kraft S, Reck C, Pukrop R, Klosterkötter J, Falkai P, Maier W, Wagner M, John U, Freyberger HJ: Obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder. Psychopathology. 2008;41(2):129-34. 59. Hand I, Büttner-Westphal H: Die Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS): Ein halbstrukturiertes Interview zur Beurteilung des Schweregrades von Denk- und Handlungszwängen. Verhaltensther 1991; 1:223-5. 63 60. Hanna GL, Fischer DJ, Chadha KR, Himle JA, Van Etten M. Familial and sporadic subtypes of early-onset Obsessive-Compulsive disorder. Biol Psychiatry. 2005 Apr 15;57(8):895-900. 61. Harvey AG, Bryant RA. The relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder: a prospective evaluation of motor vehicle accident survivors. J Consult Clin Psychol. 1998 Jun;66(3):507-12. 62. Helzer JE, Robins LN, McEvoy L: Post-traumatic stress disorder in the general population. Findings of the epidemiologic catchment area survey. N Engl J Med 1987; 317(26):1630-4. 63. Hollingsworth CE, Tanguay PE, Grossman L, Pabst P: Long-term outcome of obsessive-compulsive disorder in childhood. J Am Acad Child Psychiatry 1980; 19(1):134-44. 64. Horowitz MJ, Becker SS, Moskowitz ML: Intrusive and repetitive thought after stress: a replication study. Psychol Rep 1971; 29(3):763-7. 65. Horowitz MJ: Intrusive and repetitive thoughts after experimental stress. A summary. Arch Gen Psychiatry 1975; 32(11):1457-63. 66. Horowitz MJ, Wilner N, Alvarez W: Impact of Event Scale: A measure of subjective stress. Psychosom Med 1979; 41:209-218. 67. Horowitz MJ: Stress response syndromes, 2nd ed. Jason Aronson Northvale, NJ 1986. 68. Horwath E, Weissman MM: The epidemiology and cross-national presentation of obsessive-compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 2000; 23(3):493-507. 69. Hull AM: Neuroimaging findings in post-traumatic stress disorder. Systematic review. Br J Psychiatry 2002; 181:102-10. 70. Insel TR, Hoover C, Murphy DL: Parents of patients with obsessive-compulsive disorder. Psychol Med 1983; 13(4):807-11. 71. Janet P: Les obsessions et la psychasthenie. Alcan Paris 1903 ; No 1. 72. Janet P: Neuroses et idées fixes (Vol.1). Alcan Paris 1898. 73. Jenike MA: Obsessive-compulsive and related disorders: a hidden epidemic. N Engl J Med 1989; 321(8):539-41. 74. John U, Greiner B, Hensel E: Study of Health in Pomerania (SHIP): a health examination survey in an east German region: objectives and design. Soz.Präventivmed 2001; 46:186-194 . Jones MK, Menzies RG: The relevance of associative learning pathways in the development of obsessive-compulsive washing. Behav Res Ther 1998; 36(3):27383. 75. 76. Jordan BK, Schlenger WE, Hough R, Kulka RA, Weiss D, Fairbank JA: Lifetime and current prevalence of specific psychiatric disorders among Vietnam veterans and controls. Archives of General Psychiatry 1991; 48: 207-215 64 77. Kapfhammer HP: Posttraumatische Belastungsstörung. In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer HP (Hrsg): Psychiatrie und Psychotherapie. Springer Verlag Berlin, 2. Aufl. 2003; S.1247-1270. 78. Kardiner A: The traumatic neurosis of war. Hoeber New York 1941. 79. Karno M, Golding JM, Sorenson SB et al.: The epidemiology of obsessivecompulsive disorder in five US communities. Arch Gen Psychiatry 1988; 45(12):1094-9. 80. Kayton L, Borge GF: Birth order and the obsessive-compulsive character. Arch Gen Psychiatry 1967; 17(6):751-4. 81. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB: Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1995; 52(12):1048-60. 82. Khan MMR: The concept of cumulative trauma. Psychoanal Study Child 1963;18:286-306. 83. Lang H: Zur Struktur und Therapie der Zwangsneurose. Psyche 1986; 40:952-70. 84. Lang H: Zwang in Neurose, Psychose und psychosomatischer Erkrankung. Z Klin Psych Psychopath Psychother 1985; 33:65-76. 85. Lang PJ: A bio-informational theory of emotional imagery. Psychophysiology 1979; 16:495-512. 86. Leboyer M, Maier W, Teherani M, Lichtermann D, D'Amato T, Franke P, Lepine JP, Minges J, McGuffin P: The reliability of the SADS-LA in a family study setting. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1991; 241(3):165-9. 87. Lenane MC, Swedo SE, Leonard H, Pauls DL, Sceery W, Rapoport JL: Psychiatric disorders in first degree relatives of children and adolescents with obsessive compulsive disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1990; 29(3):407-12. 88. Lensi P, Cassano GB, Correddu G, Ravagli S, Kunovac JL, Akiskal HS: Obsessivecompulsive disorder. Familial-developmental history, symptomatology, comorbidity and course with special reference to gender-related differences. Br J Psychiatry 1996; 169(1):101-7. 89. Lindal E, Stefansson JG: The lifetime prevalence of anxiety disorders in Iceland as estimated by the US National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule. Acta Psychiatr Scand 1993; 88(1):29-34. 90. Lipinski JF, Jr., Pope HG, Jr.: Do "flashbacks" represent obsessional imagery? Compr Psychiatry 1994; 35(4):245-7. 91. Litz BT, Keane TM: Information-processing in anxiety disorders: Application to the understanding of post-traumatic stress disorder. Clin Psychol Rev 1989; 9: 243-257. 92. Lucey JV, Costa DC, Adshead G, Deahl M, Busatto G, Gacinovic S, Travis M, Pilowsky L, Ell PJ, Marks IM, Kerwin RW: Brain blood flow in anxiety disorders. OCD, panic disorder with agoraphobia, and post-traumatic stress disorder on 99mTcHMPAO single photon emission tomography (SPET). Br J Psychiatry 1997; 171:346-50. 65 93. Maina G, Albert U, Bogetto F, Vaschetto P, Ravizza L: Recent life events and obsessive-compulsive disorder (OCD): the role of pregnancy/delivery. Psychiatry Res. 1999 Dec 13;89(1):49-58. 94. Manuzza S, Fyer AJ, Klein DF, Endicott J: Schedule for affective disorders and schizophrenia- lifetime version modified for the study of anxiety disorders: Rationale and conceptual development. J Psychiat Res 1986; 20:317-325. 95. Marmar CR, Weiss DS, Schlenger WE, Fairbank JA, Jordan BK, Kulka RA, Hough RL: Peritraumatic dissociation and posttraumatic stress in male Vietnam theater veterans. Am J Psychiatry 1994; 151(6):902-7. 96. Mavissakalian M, Hamann MS, Jones B: Correlates of DSM-III personality disorder in obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiatry. 1990 Nov-Dec;31(6):481-9. 97. McFarlane AC: The treatment of post-traumatic stress disorder. Br J Med Psychol 1989; 62(Pt 1):81-90. 98. McFarlane AC, Weber DL, Clark CR: Abnormal stimulus processing in posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry 1993; 34(5):311-20. 99. McKeon J, Roa B, Mann A: Life events and personality traits in obsessivecompulsive neurosis. Br J Psychiatry. 1984 Feb;144:185-9. 100. McKeon P, Murray R: Familial aspects of obsessive-compulsive neurosis. Br J Psychiatry 1987; 151:528-34. 101. McLaren S, Crowe SF: The contribution of perceived control of stressful life events and thought suppression to the symptoms of obsessive-compulsive disorder in both non-clinical and clinical samples. J Anxiety Disord. 2003;17(4):389-403. 102. McNally RJ, Shin LM: Association of intelligence with severity of posttraumatic stress disorder symptoms in Vietnam Combat veterans. Am J Psychiatry 1995; 152(6):936-8. 103. McNally RJ: Posttraumatic stress disorder. In: Millon T, Blaney PH, Davis RD: Oxford textbook of psychopathology. Oxford University Press. Oxford , UK 1998. 104. Meyer Y: Modification of expectations in cases with obsessional rituals. Behav Res Ther 1966; 4:273-280. 105. Minichiello WE, Baer L, Jenike MA, et al.: Age of onset of major subtypes of obsessive- compulsive disorder. J Anxiety Disord. 1990;4:147-150 106. Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Rahgozar M, Noorbala AA, Davidian H, Afzali HM,Naghavi HR, Yazdi SA, Saberi SM, Mesgarpour B, Akhondzadeh S, Alaghebandrad J, Tehranidoost M: Prevalence of obsessive-compulsive disorder in Iran. BMC Psychiatry. 2004 Feb 14;4:2. 107. Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Moini R: Lifetime comorbidity of obsessivecompulsive disorder with psychiatric disorders in a community sample. Depress Anxiety. 2006 Dec 6;24(8):602-607. 108. Mowrer OH: Learning theory and behaviour. Wiley. New York 1960. 66 109. Murray J, Ehlers A, Mayou RA. Dissociation and post-traumatic stress disorder: two prospective studies of road traffic accident survivors. Br J Psychiatry. 2002 Apr;180:363-8. 110. Nelson E, Rice J: Stability of diagnosis of obsessive-compulsive disorder in the Epidemiologic Catchment Area study. Am J Psychiatry 1997; 154(6):826-31. 111. Nestadt G, Samuels J, Riddle M, Bienvenu OJ, 3rd, Liang KY, LaBuda M, Walkup J, Grados M, Hoehn-Saric R: A family study of obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 2000; 57(4):358-63. 112. Norris FH: Epidemiology of trauma: frequency and impact of different potentially traumatic events on different demographic groups. J Consult Clin Psychol 1992; 60(3):409-18. 113. Oppenheim H : Die traumatische Neurose. August Hirschwald Berlin 1889. 114. Paige SR, Reid GM, Allen MG, Newton JE: Psychophysiological correlates of posttraumatic stress disorder in Vietnam veterans. Biol Psychiatry 1990; 27(4):41930. 115. Pauls DL, Alsobrook JP, 2nd, Goodman W, Rasmussen S, Leckman JF: A family study of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 1995; 152(1):76-84. 116. Perkonigg A, Kessler RC, Storz S, Wittchen HU: Traumatic events and posttraumatic stress disorder in the community: prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychiatr Scand 2000; 101(1):46-59. 117. Pigott TA, L'Heureux F, Dubbert B, Bernstein S, Murphy DL: Obsessive compulsive disorder: comorbid conditions. J Clin Psychiatry 1994; 55(Suppl):15-27; discussion 28-32. 118. Pitman RK, Altman B, Greenwald E, Longpre RE, Macklin ML, Poire RE, Steketee GS: Psychiatric complications during flooding therapy for posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry 1991; 52(1):17-20. 119. Pitman RK: Posttraumatic obsessive-compulsive disorder: a case study. Compr Psychiatry 1993; 34(2):102-7. 120. Rachman S: Obsessional ruminations. Behav Res Ther 1971; 9(3):229-35. 121. Rachman S, de Silva P: Abnormal and normal obsessions. Behav Res Ther 1978; 16(4):233-48. 122. Rachman S: A cognitive theory of obsessions. Behav Res Ther 1997; 35(9):793802. 123. Rasmussen SA, Tsuang MT: Clinical characteristics and family history in DSM-III obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 1986; 143(3):317-22. 124. Rasmussen SA, Eisen JL: Clinical and epidemiologic findings of significance to neuropharmacologic trials in OCD. Psychopharmacol Bull 1988; 24(3):466-70. 125. Rasmussen SA, Eisen JL: The epidemiology and clinical features of obsessive compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 1992; 15(4):743-58. 67 126. Rauch SL, van der Kolk BA, Fisler RE, Alpert NM, Orr SP, Savage CR, Fischman AJ, Jenike MA, Pitman RK: A symptom provocation study of posttraumatic stress disorder using positron emission tomography and script-driven imagery. Arch Gen Psychiatry 1996; 53(5):380-7. 127. Rauch SL, Shin LM: Functional neuroimaging studies in posttraumatic stress disorder. Ann N Y Acad Sci 1997; 821:83-98. 128. Rauch SL, Whalen PJ, Shin LM, McInerney SC, Macklin ML, Lasko NB, Orr SP, Pitman RK: Exaggerated amygdala response to masked facial stimuli in posttraumatic stress disorder: a functional MRI study. Biol Psychiatry 2000; 47(9):769-76. 129. Ravizza L, Maina G, Bogetto F: Episodic and chronic obsessive-compulsive disorder. Depress Anxiety. 1997;6(4):154-8. 130. Resnick HS, Kilpatrick DG, Dansky BS, Saunders BE, Best CL: Prevalence of civilian trauma and posttraumatic stress disorder in a representative national sample of women. J Consult Clin Psychol 1993; 61(6):984-91. 131. Rheaume J, Freeston MH, Leger E, Ladouceur R: Bad luck: an underestimated factor in the development of obsessive-compulsive disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy 1998; 5, 1-12. 132. Riddle MA, Scahill L, King R, Hardin MT, Towbin KE, Ort SI, Leckman JF, Cohen DJ: Obsessive compulsive disorder in children and adolescents: phenomenology and family history. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1990; 29(5):766-72. 133. Rosenberg CM: Familial aspects of obsessional neurosis. Br J Psychiatry 1967; 113(497):405-13. 134. Salkovskis PM, Harrison J: Abnormal and normal obsessions--a replication. Behav Res Ther 1984; 22(5):549-52. 135. Salkovskis PM: Obsessional-compulsive problems: analysis. Behav Res Ther. 1985;23(5):571-83. 136. Salkovskis P, Shafran R, Rachman S, Freeston MH: Multiple pathways to inflated responsibility beliefs in obsessional problems: possible origins and implications for therapy and research. Behav Res Ther. 1999 Nov;37(11):1055-72. 137. Sasson Y, Dekel S, Nacasch N, Chopra M, Zinger Y, Amital D, Zohar J: Posttraumatic obsessive-compulsive disorder: a case series. Psychiatry Res. 2005 Jun 15;135(2):145-52. 138. Schutzwohl M, Maercker A: Effects of varying diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder are endorsing the concept of partial PTSD. J Trauma Stress 1999; 12(1):155-65. 139. Seligman ME: phobias Vol 2(3): 307-20. 140. Shalev AY, Peri T, Canetti L, Schreiber S: Predictors of PTSD in injured trauma survivors: a prospective study. Am J Psychiatry 1996; 153(2):219-25. 141. Shafran R, Ralph J, Tallis F: Obsessive-compulsive symptoms and the family. Bull Menninger Clin. 1995 Fall;59(4):472-9. and preparedness. a Behavior cognitive-behavioural Therapy. 1971 Vol 68 142. Shin LM, Kosslyn SM, McNally RJ, Alpert NM, Thompson WL, Rauch SL, Macklin ML, Pitman RK: Visual imagery and perception in posttraumatic stress disorder. A positron emission tomographic investigation. Arch Gen Psychiatry 1997; 54(3):23341. 143. Shore JH, Vollmer WM, Tatum EL: Community patterns of posttraumatic stress disorders. J Nerv Ment Dis. 1989 Nov;177(11):681-5. 144. Smith EM, North CS, McCool RE, Shea JM: Acute postdisaster psychiatric disorders: identification of persons at risk. Am J Psychiatry 1990; 147(2):202-6. 145. Solomon Z: Combat stress reactions: the enduring toll of war. New York: Plenum Press 1993. 146. Solomon Z: Twenty years after the Yom Kippur War: the belated recognition of warinduced psychic trauma. Isr J Psychiatry Relat Sci. 1993;30(3):128-9. 147. Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 2004 148. Stein MB, Forde DR, Anderson G, Walker JR: Obsessive-compulsive disorder in the community: an epidemiologic survey with clinical reappraisal. Am J Psychiatry 1997; 154(8):1120-6. 149. Swedo SE, Rapoport JL, Leonard H, Lenane M, Cheslow D: Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Clinical phenomenology of 70 consecutive cases. Arch Gen Psychiatry. 1989 Apr;46(4):335-41. 150. Thiel A, Schussler G: [Obsessive-compulsive symptoms in structural ego defects--a study exemplified by anorexia and bulimia nervosa]. Z Psychosom Med Psychoanal 1995; 41(1):60-76. 151. Tuke TH: Imperative Ideas. Brain 1894;17:179-97. 152. Vanderlinden J, Van Dyck R, Vandereycken W, Vertommen H: Dissociation and traumatic experiences in the general population of The Netherlands. Hosp Community Psychiatry 1993; 44(8):786-8. 153. Vasterling JJ, Brailey K, Constans J et al.: Assessment of intellectual resources in Gulf War veterans: relationship to PTSD. Assessment 1997; 1:51-59. 154. Vasterling JJ, Duke LM, Brailey K, Constans JI, Allain AN, Jr., Sutker PB: Attention, learning, and memory performances and intellectual resources in Vietnam veterans: PTSD and no disorder comparisons. Neuropsychology 2002; 16(1):5-14. 155. Volavka J, Neziroglu F, Yaryura-Tobias JA: Clomipramine and imipramine in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 1985; 14(1):85-93. 156. Vuksic-Mihaljevic Z, Mandic N, Mihaljevic S, Ivandic A: Symptom structure and psychiatric comorbidity of combat-related post-traumatic stress disorder. Psychiatry Clin Neurosci 1999; 53(3):343-9. 157. Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, Greenwald S, Hwu HG, Lee CK, Newman SC, Oakley-Browne MA, Rubio-Stipec M, Wickramaratne PJ, et al.: The cross national epidemiology of obsessive compulsive disorder. The Cross National Collaborative Group. J Clin Psychiatry 1994; 55(Suppl):5-10. 69 158. Welkowitz LA, Struening EL, Pittman J, Guardino M, Welkowitz J: Obsessivecompulsive disorder and comorbid anxiety problems in a national anxiety screening sample. J Anxiety Disord. 2000 Sep-Oct;14(5):471-82. 159. Yaryura-Tobias JA, Neziroglu FA, Kaplan S: Self-mutilation, anorexia, and dysmenorrhea in obsessive compulsive disorder. Int J Eat Disord. 1995 Jan;17(1):33-8. 160. Zaudig M, Hauke W, Hegerl U (Hrsg.): Die Zwangsstörung: Diagnostik und Therapie. Schattauer Verlag Stuttgart, 2. Auflage 2002. 70 Eidesstattliche Erklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Dissertation ist bisher keiner anderen Fakultät vorgelegt worden. Ich erkläre, dass ich bisher kein Promotionsverfahren erfolglos beendet habe und dass eine Aberkennung eines bereits erworbenen Doktorgrades nicht vorliegt. Datum Unterschrift Lebenslauf Persönliche Daten Jana Josepeit geboren am 08.01.1980 in Rüdersdorf bei Berlin ledig Anschrift: Kaskelstr. 31 10317 Berlin Schulbildung 09/1988 – 07/1999 06/1999 Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Berlin Allgemeine Hochschulreife Studium Hochschulen: 10/1999 – 09/2003 10/2003 – 11/2006 Medizinstudium an der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald Medizinstudium an der Universität Leipzig Prüfungen: 09/2001 09/2003 09/2005 11/2006 Physikum 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 3. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Tertiale im Praktischen Jahr Kinder- und Jugendpsychiatrie (17.10.2005 -05.02.2006) Park-Krankenhaus Leipzig, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig Innere Medizin (06.02.2006 – 28.05.2006) Klinikum St. Georg, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig Chirurgie (29.05.2006 -17.09.2006) Hospital General, Universitätskrankenhaus von Valencia, Spanien Derzeitige Tätigkeit Seit 03/2007 Berlin, 05.06.2008 Assistenzärztin in der gerontopsychiatrischen Abteilung des Krkh. Hedwigshöhe Berlin Mein herzlicher Dank gilt allen, die mich beim Erstellen dieser Arbeit unterstützt und mir mit Rat und Kritik zur Seite gestanden haben! Insbesondere möchte ich Herrn Prof. Dr. Hans Grabe für die optimale kontinuierliche Betreuung und Motivation danken! Nicht zuletzt gilt mein Dank auch meiner lieben Familie für ihre ausdauernde Unterstützung!