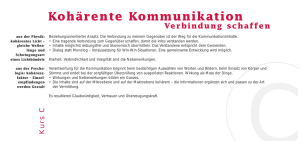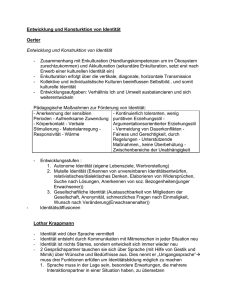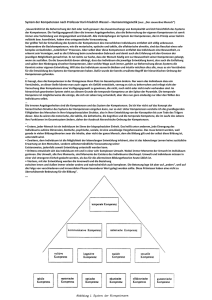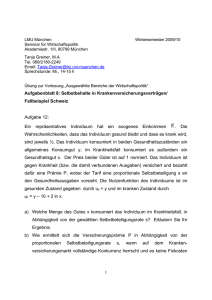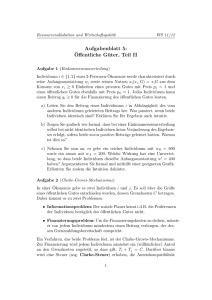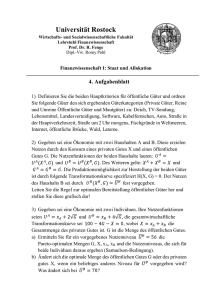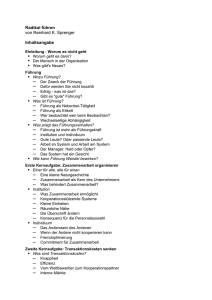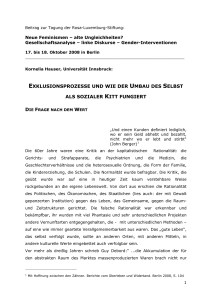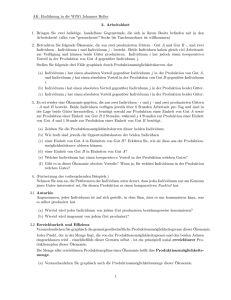Zum Thema_Wagnis Utopie
Werbung

Widerspruch Nr. 16/17 Ich - Subjekt - Individuum(1989), S.5362 Autor: Ulrich Druwe Artikel Ulrich Druwe Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft I. Die Beschäftigung mit dem Subjekt gehört zu den klassischen Problemen der Philosophie. Dabei zeigt ein Blick in die Philosophiegeschichte, daß damit zugleich immer auch die Thematisierung des Gemeinschaftlichen verbunden ist, d.h. wesentliche Aspekte des Problems „Individuum“ beziehen sich auf das Verhältnis Individuum – Gemeinschaft. (Vgl. dazu auch den Beitrag von K. Riefler in diesem Heft) Grob zusammengefaßt lassen sich drei Phasen dieses problematischen Verhältnisses beschreiben: 1. In der Antike wird die Gemeinschaft dem einzelnen vorgeordnet; 2. Seit der Renaissance hat sich diese Perspektive verändert, nun nimmt das Individuum die Vorrangstellung vor der Gemeinschaft ein; 3. Im 20. Jahrhundert werden beide Antipoden problematisch: Der Marxismus-Leninismus befindet sich spätestens seit Gorbatschow in einer Umbruchphase, weg von dem Primat der Gesellschaft und hin zum einzelnen (Vgl. dazu den Beitrag von E. Treptow in diesem Heft) und in den westlichen Ländern wird zunehmend bezweifelt, ob das Subjekt unter den Bedingungen der verwalteten und industrialisierten Welt überlebt hat bzw. überleben kann. Ulrich Druwe Im vorliegenden Aufsatz soll nun das angeblich so widersprüchliche Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft diskutiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die folgende These: Der immer wieder konstatierte Gegensatz stellt sich bei genauerer Analyse als Scheinproblem heraus: Er gehört zu einer Gruppe von Gedanken, die sich die Menschen immer wieder stellen, ohne das dahinterstehende Muster zu erkennen, weshalb man auch zu keiner Lösung kommt; Ein anderes Beispiel solcher – oft Paradoxie genannten – Gedanken ist die Henne-Ei-Paradoxie. Es soll also im weiteren belegt werden, daß der Gegensatz Individuum – Gesellschaft kein Gegensatz ist. Es empfiehlt sich dabei folgende Vorgehensweise: Zunächst wird die Genese dieses Gegensatzes kurz skizziert; anschließend soll er selbst präzisiert und wichtige Folgen erläutert werden; und drittens sollen Argumente für seine Aufhebung vorgetragen werden. II. Der Gedanke des Individualismus entspringt der Renaissance/frühen Neuzeit. Die antike und mittelalterliche Philosophie sieht den Menschen noch eingebettet in die Ontologie, in der Sein, Natur und Denken der Inbegriff auch zugleich des Möglichen sind. Der menschliche Geist denkt nichts, was nicht bereits existent wäre und die menschliche Ordnung ist notwendig Teil des allgemeinen Seins. Grundlegend ändert sich diese Auffassung erst im Spätmittelalter. Entscheidend ist hierbei der Schritt, mit dem in der Theologie die Identität von Natur und Sein aufgehoben wird: Entsprechend dem Ausmaß, mit dem in der Spekulation über die Eigenschaften Gottes der Begriff der ‘omnipotentia’ in den Vordergrund tritt und mit dem der Unendlichkeit verbunden wird, wird die Welt, so wie sie ist, zu einer der möglichen Welten, die Gott in seiner Allmacht hätte erschaffen können. Das Mögliche und vor allem das Denkmögliche deckt sich fortan nicht mehrmit dem Sein. Vor allem Nikolaus von Cues überträgt diese Gedanken auf den Menschen: Über die Ähnlichkeit mit Gott hat auch der Mensch Teil Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft an Gottes Schöpferkraft. In diesem Kontext entstehen in der Renaissance zahlreiche Traktate über die Stellung des Menschen im Sein und über seine Würde. Die vermutlich bekannteste Schrift stammt von Pico della Mirandola „De hominis dignitate oratio“ von 1486. Die zentrale These lautet dort: Gott hat den Menschen zur Mitte der Welt gemacht, er ist weder göttlich noch irdisch, sondern ein Freiheitswesen von eigener Würde. Durch die so definierte ontologische Ortlosigkeit hat der Menschen die Möglichkeit, sich zu dem zu machen, was er sein will, gottähnlich (Vernunft) oder tierähnlich (Triebe). In einer geordneten Welt ist damit der Mensch als einziges autonom. Aus dieser Perspektive auf den Menschen als einem autonomen Wesen erwächst der Individualgedanke. Zusätzliche unterstützende Faktoren, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll, waren die Entstehung der Nationalstaaten, die eine effektive Bürokratie benötigten und damit eine Säkularisierung der Bildung erzwangen; wichtig zu erwähnen ist desweiteren das Aufkommen der kapitalistischen Ökonomie, deren Träger das Bürgertum war. Neues Selbstbewußtsein, Bildung und Reichtum der Bürger sowie deren Bemühen um politische Partizipation führten zum Aufbrechen überkommener Traditionen; durch Leistung konnte der einzelne in der Gesellschaft einen Platz erreichen, seine Stellung war nicht mehr statisch, von vornherein festgelegt. Die Sicht auf das Subjekt war in der Renaissance/frühen Neuzeit von Beginn an ambivalent. Positiv gesehen wurden die Aspekte Autonomie, individuelle Freiheit und Selbstbestimmung. Damit korrespondierte aber das Negativum der Zerrissenheit des Menschen, d.h. die Trennung etwa zwischen Körper und Geist, wie es sich beispielsweise in Erasmus von Rotterdams „Enchiridion militis christiani“ von 1503 findet, sowie das Gefühl der Verlorenheit in dieser Welt, wie es sich etwa in des „Pens‚es“ von Pascal niederschlägt. Von daher kann man zusammenfassend feststellen: Was in der Renaissance über das Subjekt, das Verhältnis Körper – Geist und die Beziehung des Individuums zur Gemeinschaft gedacht Ulrich Druwe wird, fügt sich nicht zu einer Einheit. Der Freiheit steht Einsamkeit, dem Individuum die Gemeinschaft gegenüber; zusätzlich ist das Subjekt in Körper und Geist zergliedert, Triebe und Vernunft ringen miteinander, ebenso Verantwortungsgefühl und Machtanspruch. Letzteres drückt sich beispielsweise in dem Konzept des „homo faber“ aus, welches zum ökonomischen Nutzendenken und zum Streben nach Naturbeherrschung führt. Die Natur des Menschen, die Anthropologie wird in der Folge zu dem philosophischen Problem. III. Der in der Renaissance grundgelegte Anthropozentrismus löst, um dies mit Thomas Kuhn zu formulieren, in praktisch allen Bereichen des Lebens und Denkens einen Paradigmawechsel aus. Negative Konsequenzen zeigten sich, langfristig betrachtet, insbesondere im Bereich der Moralphilosophie sowie der Politischen Philosophie. Die in der frühen Neuzeit dem Menschen zugeordnete Position eines autonomen Individuums, welches seine Stellung in der Welt frei bestimmen kann, führt zu der zentralen Fragestellung in der Politischen Philosophie der Neuzeit: Sie betrifft das Verhältnis Mensch – Gesellschaft; Wie kann eine Gesellschaft gedacht werden, in der der Mensch autonom ist, wie legitimiert sich der Staat? Hier zeigt sich deutlich die Neuartigkeit des Denkens, denn in der Antike wäre das Legitimationsproblem vollkommen sinnlos erschienen. Nun aber wird das Individuum zur entscheidenden Instanz, an der Gesellschaft und Staat zu messen sind. Zwei Lösungsansätze werden in der Folgezeit konzipiert: anarchistische und vertragstheoretische Ansätze. Erstere sehen die Stellung des Individuums als so zentral an, daß jegliche Legitimation eines Staates scheitern muß. Eine konstruktive Lösung versuchen die sogenannten Vertragstheoretiker, Hobbes, Locke, Rosseau und Kant zu entwickeln. Gemeinsamer Ausgangspunkt bei ihnen ist eine individualistische Anth- Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft ropologie; danach sind alle Menschen frei, sie haben gleiche Rechte, ähnliche Fähigkeiten, wobei insbesondere die Vernunft angesprochen wird. Nachdem ein Staat begründet werden soll, konzipieren die Vertragstheoretiker zunächst einen „Naturzustand“, also einen staatsfreien Zustand, indem sich die Menschen verhalten können, wie sie wollen; im Naturzustand leben die Individuen ihrer Natur gemäß. Hier zeigen sich nun die Unterschiede in der Anthropologie der Theoretiker, Hobbes etwa vergleicht den Menschen mit einem Wolf, folglich führt der Naturzustand zu einem Krieg aller gegen alle, wie seine berühmte Formel lautet. Locke sieht den Menschen ausgeglichener, bei ihm hat er die Fähigkeit zum Guten, wie zum Bösen, im Naturzustand verhalten sich die Menschen auch sozial, allerdings in Grenzen. Zusammengefaßt ist jedoch der Naturzustand so konstruiert bei den Vertragstheoretikern, daß die Menschen ihn überwinden wollen. Gemeinsame Lösung der Theoretiker ist das Instrument des Vertrages. Hobbes formuliert einen Gesellschaftsvertrag, der zugleich auch ein Unterwerfungsvertrag ist: „Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem Menschen oder dieser Gesellschaft unter der Bedingung, daß du ebenfalls dein Recht über dich ihm oder ihr abtrittst“ (Hobbes, Leviathan, 17. Kapitel, Stuttgart 1970, S.155). Rousseaus Vertrag ist ein reiner Gesellschaftsvertrag, der jeden zum Herrscher und gleichzeitig zum Beherrschten macht. Kant schlägt einen hypothetischen Vertrag vor (Vgl. seine Schrift „Über den Gemeinspruch...“), wonach Staat und Politik dann legitim sind, wenn ihnen alle Beteiligten im Prinzip zustimmen könnten, d.h. wenn eine solche Zustimmung vernünftig wäre. Eine interessante Variante bietet Locke in seiner Abhandlung „Über die Regierung“; dort plädiert er einerseits für den sog. Urvertrag, d.h. ein Gesellschafts- und Staatsvertrag, der von allen tatsächlich abgeschlossen werden muß und der alle fundamentalen Regeln des Zusammenlebens (etwa das Mehrheitsprinzip oder Gewaltenteilung) enthalten soll. Darüberhinaus fordert Locke den sog. impliziten Vertrag. Spätere Generationen müssen gleichfalls die Möglichkeit haben, dem Staat zuzustimmen; sie machen dies implizit, d.h. durch ihr Verhalten, beispielsweise indem sie die Steuern bezahlen oder nicht emigrieren. Ulrich Druwe Die vertragstheoretische Lösung des problematischen Verhältnisses Individuum - Staat sieht also eine vertragliche Bindung der einzelnen vor. Gesellschaft und Staat sind damit das Resultat individueller Zustimmung. Das Individuum geht also der Gesellschaft voraus. Leider weist die vertragstheoretische Begründung fundamentale Schwächen auf, auf die als erster der schottische Philosoph David Hume aufmerksam machte. In seinem „Traktat über die menschliche Vernunft“ formuliert Hume: Wenn die Selbstverpflichtung über den Vertrag die Basis der Legitimation darstellt, kann der einzelne diese Zustimmung auch beliebig brechen bzw. zurücknehmen, wenn sie ihm nicht mehr vorteilhaft erscheint; mit welcher Begründung sollte ein einmal geschlossener Vertrag zeitlos gültig sein? Offensichtlich ist der Bezug auf das Individuum die einzige Möglichkeit, eine Gesellschaft oder einen Staat zu begründen, gleichzeitig ist damit die Begründung jegliches Überindividuellen ausgeschlossen. Dieser Widerspruch beschreibt das Scheitern der politischen Moderne, Staat und Recht zu legitimieren. Zu einer ähnlichen Konsequenz muß man für die Moralphilosophie kommen. Deren grundlegende Frage lautet: Warum soll der Mensch moralisch sein? bzw. was soll er tun? Aus heutiger Perspektive formuliert sind dies die entscheidenden Probleme der Metaethik und der normativen Ethik. Erstere untersucht die Begründung von Normen, letztere entwickelt sie. Die vier wichtigsten normativ-ethischen Positionen stellen der religiöse, der deontologische, der utilitaristische und der „egoistische“ (im technischen Sinn) Ansatz dar. Skizzenartig resümiert greift der erste auf göttliche Gebote zurück, der zweite bemißt die Richtigkeit von Handlungen nach ihrer Form, d.h. Handlungsfolgen werden ignoriert; paradigmatisch für diese Variante kann der Kantsche kategorische Imperativ angesehen werden. Der Utilitarismus stellt das Glück der größtmöglichen Zahl in den Mittelpunkt und der ethische Egoismus definiert die Handlungen als moralisch, die den Interessen des Individuums dienlich sind. Für alle Positionen stellt sich gleichermaßen das Problem ihrer Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft Begründung, welches auf die Metaethik verweist. Um die Relevanz des Begründungsproblems aufzuzeigen, könnte man anhand der vier normativ-ethischen Positionen fragen: 1. Woher weiß ich, was Gott richtig findet? 2. Was hat Moral mit Vernunft zu tun, lassen sich doch mit dem kategorischen Imperativ auch Handlungen ableiten, die zumindest nach allgemeiner Auffassung nicht-moralischer Natur sind? 3. Wie ermittelt man das Glück der größtmöglichen Zahl von Menschen und wieso ist eine solche Handlung dann moralischer, als eine, die nur wenigen zugute kommt? 4. Warum ist es moralisch, wenn man von den eigenen Interessen ausgeht? Die Begründung der Moral unter Bezug auf göttliche Gebote ist seit der frühen Neuzeit und spätestens seit Kant irrational geworden, wir wissen einfach nicht, was Gott will, sofern es einen gibt. Von daher wird auch für die Moral das Individuum zur letzten Begründungsinstanz; man greift folglich entweder auf seine Vernunft oder das menschliche Gefühl zurück. Für die Vernunftbegründung könnte etwa Kant angeführt werden, die Gefühlsbegründung findet sich beispielsweise bei Hume. Letztlich scheitern aber auch diese Begründungsversuche von Moral. Mit der Hinwendung zum Individuum muß akzeptiert werden, daß es verschiedene Wünsche und Bedürfnisse gibt, mit der Folge, daß Moral nicht mittels menschlichen Gefühls begründet werden kann. Mit Kant scheitert aber auch das Bemühen, Moral vernunftmäßig zu begründen, da formale Maßstäbe Inhalte voraussetzen, ohne sie begründen zu können. Der Individualismus als Kern des Projekts der Aufklärung hat zu einer moralischen Krise geführt (A. MacIntyre), weil das Individuum als Letztinstanz der Moral und der Politik diese nicht zugleich allgemein begründen kann. Individualität legitimiert nicht Allgemeines, gleichzeitig gibt es mit der Hinwendung zum Individuum keine andere Möglichkeit mehr, als den Begründungsrekurs auf den einzelnen. Ulrich Druwe IV. Mit der Vorrangstellung des Individuums geraten Politik und Moral in eine Krise. Dies wird gerade auch in der Wissenschaft deutlich, die sich, gemäß dem herrschenden wissenschaftstheoretischen Paradigma des Neopositivismus, zu Fragen der Werturteile nicht als kompetent ansieht. „Das Sein und das Sollen sind getrennte Bereiche“ formulierte Max Weber; Ableitungen von Normen aus dem Empirischen gelten als „naturalistischer Fehlschluß“ (Moore). Weil diese Krise wesentlich von der „Natur des Individuums“ abhängt, sollen die wesentlichen Aspekte dieser individualistischen Anthropologie nochmals zusammenfassend dargestellt werden. Das Individuum ist ein Wesen eigener Würde. Es besitzt Rechte, denen heute etwa in Form der Menschenrechte entsprochen wird. Seine Vernunft befähigt es, sich zu dem zu machen, was es will bzw. zu machen, was es will. Als Träger von Sprache und Handlung basieren auf ihm Gesellschaft, Kultur und Moral, d.h. alle sozialen Phänomene sind auf das Individuum zurückzuführen. Zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft bestehen von daher nur die Beziehungen, die das Individuum will, anders formuliert: Das Individuum besitzt eine ontologische Vorrangstellung vor der Gesellschaft. Vor allem seit dem 19. Jahrhundert wurden immer wieder Alternativmodelle entwickelt - um der politischen und moralischen Krise Herr zu werden -, welche das Verhältnis genau umdrehten; beispielsweise in der Theorie Marx’ wird ein solcher Ansatz deutlich, sieht er doch das Bewußtsein des einzelnen in Abhängigkeit von den umgebenden Strukturen, vor allem den ökonomischen. Die Grundelemente eines solchen Kollektivismus könnte man wie folgt zusammenfassen: Eine Gesellschaft ist eine Ganzheit, die mehr ist, als die Summe ihrer Mitglieder. Die gesellschaftlichen Traditionen, Normen, Werte, Weltsichten und Denkstile beeinflussen den einzelnen dergestalt, daß von einem autonomen Individuum nicht die Rede sein kann. Individuelles Verhalten muß daher Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft auf den sozialen Kontext zurückgeführt werden, wenn man es erklären will. Von daher bezieht die Gesellschaft eine ontologische Vorrangstellung vor dem Individuum. Für welche Variante man sich auch entscheidet, in beiden Fällen besteht ein widersprüchliches Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, beiden Konzepten ist ein Defizit gemein, welches sich auf den jeweiligen Gegenpol bezieht: Beim Individualismus kommt die Gemeinschaft zu kurz und bei Kollektivismus das Individuum, d.h. hier kann bezweifelt werden, ob der Individualbegriff überhaupt verwendet werden darf. Im folgenden soll nun ein Gedankengang vorgestellt werden, mit dem dieser Widerspruch aufgelöst werden kann. Er kann natürlich nicht sehr detailliert beschrieben werden, es soll aber wenigstens eine intuitive Idee vermittelt werden. Die zentrale These lautet dabei wie folgt: Der Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft stellt sich bei genauerer Analyse als Scheinproblem heraus. V. Der angebliche Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft ist ein altes philosophisches Problem, welches aber seit der Hinwendung zum Subjekt zu gravierenden Folgen geführt hat, beispielsweise, daß Moral nur über das Individuum begründbar ist, eine solche Begründung aber de facto keine ist, wie bereits Hume festgestellt hat, da Überindividuelles nicht individuell begründet werden kann. Die Auflösung dieses Gegensatzes liegt daher vor allem im Interesse der Moralphilosophie und der Politischen Philosophie. Um ihn auflösen zu können, enpfiehlt es sich, zunächst die Struktur dieses Gegensatzes genauer zu betrachten. Dabei fällt auf, daß er zu einer Gruppe von Gedanken gehört, die sich die Menschen immer wieder stellen, ohne (offensichtlich) das dahinterstehende Muster zu erken- Ulrich Druwe nen, weshalb solche Gedanken oft auch als Paradoxie bezeichnet werden. Eines der bekanntesten Beispiele diese Gedankengruppe ist die HenneEi-Paradoxie: Was war früher da, die Henne oder das Ei? Im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, läßt sich diese Frage eindeutig beantworten: natürlich das Ei: Eier gab es, bevor aus ihnen das Lebewesen Henne kroch. Gleichgültig, wo man die Grenze zwischen einer Noch-NichtHenne und einer Henne zieht, feststeht, daß eine genetische Kette immer im Ei ihren Ausgangspunkt nimmt. Der Eindruck der Paradoxie geht in diesem Fall auf die Sprache zurück: Man denkt abstrakt an „die“ Henne und an „das“ Ei; „die“ Henne stammt aus einem Ei, „das“ Ei geht auf eine Henne zurück. Überträgt man diese Abstraktion auf konkrete Hennen und Eier, wird das Ganze paradox. (Vgl. Zu dieser und weiteren Paradoxien U. Blau: Wahrheit von innen und außen, in: Erkenntnis 25, 1986, S.130) Dieses Beispiel illustriert den Gegensatz Individuum - Gemeinschaft; auch hier handelt es sich um ein rein sprachliches Problem: Man idealisiert sowohl die Gemeinschaft, als auch das Individuum. An sich existieren aber beide Entitäten nicht. Überträgt man nun diese Ideale auf die Realität, dann entsteht auch hier ein paradoxer Eindruck. Empirisch läßt sich jedoch klar entscheiden, daß das Gesellschaftliche dem Individuellen vorausgeht. Wann man dann vom Individuum bzw. Noch-NichtIndividuum sprechen kann, ist eine Frage der Definition, aber auch diese ist abhängig vom kulturellen Umfeld. Individualität kann daher niemals im Gegensatz zur Gemeinschaft stehen, wobei die genauere Bedeutung dieser Formulierung im folgenden detaillierter illustriert werden soll. Zum Einstieg soll nochmals auf einen vertragstheoretischen Ansatz der frühen Neuzeit zurückgegriffen werden, in dem die Linearität vom Individuum zur Gesellschaft in der Regel im Mittelpunkt der Interpretation steht. T. Hobbes gilt als der erste Staatsphilosoph, der eine Gesellschaft konsequent individualistisch begründet. (Vgl. dazu etwa den Artikel von H. Maier, in: Politische Denker, Bd.1, München 1974, S. 125-138.) Ließt Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft man Hobbes’ Überlegungen genauer, wird deutlich, daß sich mit ihnen nicht nur der Staat begründen läßt, sondern daß sie zugleich eine Begründung des Individuums darstellen, d.h. in Hobbes’ „Leviathan“ findet sich besagte Paradoxie, wonach Individualität zum Staat und umgekehrt der Staat zum individuellen Menschen führt. Nachdem die erste Argumentation – vom Individuum zum Staat – allgemein bekannt sein dürfte, soll hier kurz auf die korrespondierende Argumentation eingegangen werden. Hobbes’ Theorie basiert auf einem mechanistischen Ansatz: er will Philosophie und Staatswissenschaften more geometrico betreiben. Im ersten Buch des „Leviathan“ ist die zentrale Frage, was den Menschen zum Menschen macht, d.h. wodurch unterscheidet er sich von anderen Lebeweswen? Hobbes’ Antwort lautet: Vernunft und Sprache sind die beiden Dinge, durch die sich der Mensch von allem anderen unterscheidet. Beides erwirbt der Mensch nur im Umgang mit anderen Menschen. „Es werde oder laßt uns Menschen machen“, schreibt Hobbes in der Einleitung zum „Leviathan“: der vernünftige, sprechende Mensch ist nämlich das Resultat der Gemeinschaft. Der Staat ist folglich die Vorbedingung für den Menschen. Gesellschaft und Individuum bedingen sich damit wechselseitig. Ein solches Resultat erzielt Hobbes, weil er seine Theorie als Modell anlegt, in welcher der Faktor Zeit keine Rolle spielt. Naturzustand und Staat, der „künstliche Mensch“ wie ihn Hobbes nennt, sind beides hypothetische Konstrukte, die es in der Realität nicht gibt; gleiches gilt für die in beiden Zuständen agierenden Menschen, auch sie sind nicht empirisch-konkret zu denken. Von welchem Zustand aus man nun die Theorie verfolgt, man endet immer bei der Erkenntnis, daß das Individuum den Staat braucht und daß der Staat die Individuen benötigt (mindestens zu seiner Gründung); ohne die Individuen gibt es keinen Staat und ohne den Staat keine Individuen. Eine ähnliche Konstruktion findet sich bei Rousseau, der die Individuen in seinem Staat zugleich zu Herrschern und Beherrschten macht. Inter- Ulrich Druwe essant ist, daß beiden Theoretikern der Absolutismus- bzw. der Totalitarismusvorwurf gemacht wurde. Verkannt wird, daß beiden in ihren Theorien nur der Tatsache Rechnung tragen, daß Individualität und Gesellschaft sich wechselseitig bedingen, daß das eine ohne das andere nicht denkbar ist. Damit ist nun allerdings erst das idealtypische Denken über die Kategorien Individuum – Gesellschaft belegt. Auflösbar wird die Paradoxie erst, wenn die Problematik empirisch betrachtet wird. Hierfür soll auf die Argumente von nur zwei modernen Forschern verwiesen werden: die des Entwicklungspsychologen J. Piaget und die des Philosophen und Logikers W.V.O. Quine. Piagets zentraler Begriff ist der der Handlung. Nach seiner Theorie basiert die gesamte kognitive Entwicklung (Denken, Sprechen, Handlungsfähigkeit) auf Subjekt-Objekt-Handlungen, wobei Objekte auch andere Menschen sind. In permanenter Interaktion bildet der Mensch Handlungsstrategien, Sprache und Denkstrukturen aus, wodurch er gleichzeitig das Objekt begreift. Piaget betont zwar, daß für diesen Prozeß auch artmäßig ererbte Strukturen notwendig sind, diese sind aber nicht hinreichend, letztlich ist für die menschliche Entwicklung entscheidend „die Wirkungen und Gegenwirkungen der Individuen aufeinander.“ (J. Piaget: Die Entwicklung des moralischen Urteils beim Kinde, Frankfurt 1981, S.360 f.) Erst die Gesellschaft „zwingt“ den Menschen zur Ausprägung kognitiver Strukturen wie Sprache, abstraktes Denken oder auch moralisches Verhalten. Um dies mit Piaget zu formulieren: Die menschliche Entwicklung des Individuums ist das Resultat von Assimilations- und Akkommodationsprozessen an externe Gegebenheiten. Bezüglich des Verhältnisses Individuum – Gesellschaft argumentiert Quine mit der Sprache. Der einzelne wird in eine bestimmte Umwelt, eine Sprachgemeinschaft hineingeboren. Sprache impliziert bei Quine zugleich Wissen, Denken und praktische Handlungsmöglichkeit. Durch den Erwerb der Sprache wird der Mensch „konditioniert“, die Welt so Über den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft zu sehen, wie sie von seiner Sprachgemeinschaft gesehen wird. Sprache ist „gesellschaftliche Dressur“, die vom Menschen via Induktion aus beobachteten Anwendungen gelernt wird. Über die Sprache bzw. das Sprachlernen gelingt also die Integration zwischen Individuum und Gemeinschaft, denn jede Individualität basiert auf der Sprache, auf dem dadurch erst möglichen Denken und Handeln. Empirisch gesehen, so läßt sich resümieren, geht dem Individuum die Gemeinschaft immer voran. Diese Formulierung darf allerdings nicht so interpretiert werden, daß damit das Individuum vollständig bestimmt wäre. Die kognitive Entwicklung des Menschen ist nach Piaget eine aktive Handlung des Subjekts; kognitive Entwicklung bedeutet nicht, die Umwelt abzubilden, sondern der einzelne wirkt auf sie ein. (Vgl. Piaget: Einführung in die genetische Erkenntnistheorie Frankfurt 1970, S. 22 ff.) Er entwickelt Transformationssysteme, die mit der Realität im optimalen Fall isomorph sind. Die Handlungen des Individuums verändern damit auch die Gemeinschaft. Ähnlich sieht dies auch Quine, wenn er formuliert, daß jedes Sprachmitglied, also jeder Mensch, über eine Vielfalt subjektiver sprachlicher Verknüpfungen verfügt, die er in die Sprachgemeinschaft einbringt und sie dadurch auch verändert. Zwischen Individuum und Gemeinschaft besteht also kein Gegensatz, sondern ein koevolutionäres Verhältnis. Beide sind nicht aufeinander zu reduzieren, sondern bedingen sich gegenseitig. Ohne die Gemeinschaft kommt es aber mit Sicherheit nicht zur Ausprägung des Individuums als einem selbstbewußten Wesen, während eine Gemeinschaft sehr wohl auch aus Nicht-Individuen bestehen kann. VI. Versucht man ein kurzes Resümee, läßt sich feststellen, daß der angebliche Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft auf die Sprache zurückzuführen ist. Wird von diesem Gegensatz gesprochen, geht man vom Ideal des Individuums oder der Gesellschaft aus. Dies erzeugt eine Paradoxie, wie sich an Hobbes’ Theorie im „Leviathan“ veranschauli- Ulrich Druwe chen läßt. Betrachtet man dagegen das Verhältnis Individuum - Gemeinschaft empirisch, dann läßt sich feststellen, daß die Gemeinschaft dem Individuum immer vorausgeht. Analog zur Henne-Ei-Paradoxie geht historisch betrachtet dem Individuum die Gemeinschaft voraus; ab wann man vom Individuum sprechen kann, ist natürlich eine Frage der Definition, aber auch Definitionen sind über die Sprache historisch-kulturell vermittelt. Unabhängig von einer Umwelt ist also das Individuum nicht denkbar. Damit ist jedoch die Betrachtung des Verhältnisses Individuum - Gemeinschaft noch nicht abgeschlossen, denn der einzelne bezieht sich handelnd und sprechend immer auf die Gemeinschaft und verändert sie dadurch. Das Verhältnis Individuum - Gemeinschaft ist daher als Koevolution zu betrachten, d.h. eine Gesellschaft ist weder eine Menge von Individuen noch ein Überindividuelles Phänomen; sie ist ein System von untereinander verbundenen Individuen. Dadurch hat sie Eigenschaften, die nur teilweise auf Individuen, in der Mehrzahl jedoch auf die Wechselwirkungen zwischen den Individuen zurückzuführen sind. Ebensowenig sind Individuen autonome Einzelwesen; sie sind vielmehr auch durch ihre Funktion bestimmt, die sie in einer Gesellschaft ausüben. Soziale Phänomene sind folglich durch Individuen, Gruppen und deren Wechselwirkungen bestimmt; das individuelle Verhalten ist eine Funktion biologischer, psychologischer und sozialer Eigenschaften des „Individuums-in-der-Gesellschaft“. Literatur: Giddens, A.: Höffe, O.: Parsons, T.: Piaget, J.: Quine, W.V.O.: Die Konstitution der Gesellschaft, Frankfurt 1986 Politische Gerechtigkeit, Frankfurt 1987 Gesellschaften, Frankfurt 1975 Biologie und Erkenntnis, Tübingen 1974 Wort und Gegenstand, Stuttgart 1980