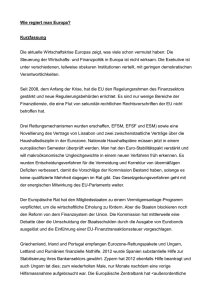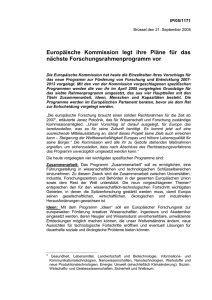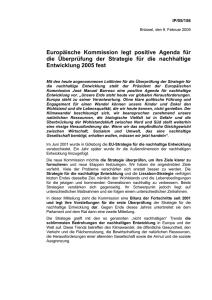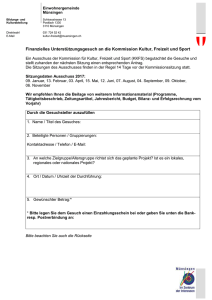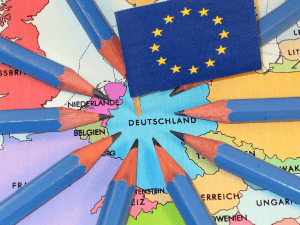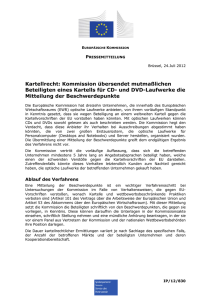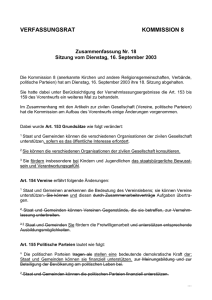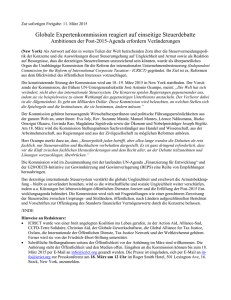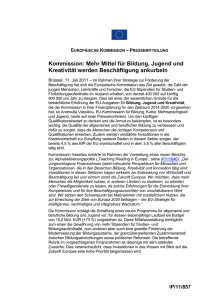mt Mvä - Neue Zürcher Zeitung
Werbung

Dienstag, 26. Mai 1964 Der Zürcher Zeitung 185. Jahrgang III Preis 25 Rp. Abendausgabe Nr. 2267 (x %mt Mvä\ 3 eituiia und schweizerisches Handelsblatt Täglich drei Ausgaben Telephon (051) 32 71 00 Ungenügend Auf polierang dienenden Beschluß beim besten Willen nicht der Charakter einer «Bedin- Am letzteu Donnerstag hat die Militär- dürfnisse anderer Truppengattungen keine kommission des Nationalrates die Botschaft Gnade, und ein Antrag, den Gesamtkredit des Bundesrates über einen Zusatzkredit für auf 1,1 Milliarden zu limitieren, in der Meidie «Mirage»-Kampfflugzeuge in Beratung nung, damit 60 70 Flugzeuge zu erhalten, gezogen. Der Bundesrat begehrt unter diesem wurde abgelehnt. Der Urheber dieses AnTitel 576 Millionen Franken an, die zu den trages, der Landesringmann Dr. S. Widmer, vor drei Jahren bewilligten 827,9 Millionen schlug sich in der Schlußabstimmung auf die hinzukommen. Von den Mehrkosten entfallen 220 Millionen auf die bis zum Ende der Beschaffung im Jahre 1968 extrapolierte Teuerung und 356 Millionen auf Mehrkosten, die sich entgegen den früheren Erwartungen nicht im ursprünglichen Kredit unterbringen ließen und teilweise auf die Entwicklung eines neuen Flugzeuges zurückzuführen sind. Nach der amtlichen Mitteilung beschloß die Kommission unter gewissen Bedingungen mit 13 gegen 5 Stimmen Eintreten auf die Vorlage und in der Schlußabstimmung nüt 13 gegen 6 Stimmen deren Gutheißung und Behandlung in der bevorstehenden Junisession. Die Bedingungen beziehen sich auf folgende Punkte: die Kommission «behält sich vor», nach Kenntnisnahme des Sclilußbcrichtcs der Expertenkommission «ergänzende Fragen zu stellen und Abklärungen zu verlangen» und darüber dem National rat abschließend zu berichten; bis dahin wird die Hälfte der Zusatzkredito gesperrt, wobei für die Freigabe der Nationalrat zuständig ist; die Teuerungsquote wird auf die bis Ende eintretende Teuerung herab- 1964 effektiv gesetzt. Das Bild der Beratungen war verwickelter, als die amtliche Mitteilung ahnen läßt. Zuerst würden die «Bedingungen» besprochen, um gewissermaßen' einen gemeinsamen Mimmalnenner der Kritik zu finden. In dieser Vorabklärung stimmten die fünf Sozialdemokraten der Sperre der Hälfte der Mehrkosten zu. Die Kommission war auch einmütig in der Forderung, sich selber als «parlamentarische Untersuchungskommission» zu etablieren, das heißt den Schlußbericht der Expertengruppe zu besprechen und als Nahtstelle zum Ratsplenum zu dienen. Die Sozialdemokraten begründeten sowohl ihren Nichteintretens- ais auch ihren Ablehnungsantrag in der Schlußabstimmung in erster Linie mit dem Argument des Zuwartens: das Geschäft sei vor der Kenntnisnahme des Berichtes der Expertenkommission noch nicht reif zur endgültigen Verabschiedung. Eine grundsätzliche materielle Opposition gegen den Zusatzkredit meldeten sie nicht oder noch nicht an. Im Verlaufe der Debatte wurden zahlreiche Zusatz- und Eventualanträge eingebracht, die entweder zurückgezogen oder abgelehnt wurden. So fanden Vorstöße zugunsten einer umfassenden Rechenschaftsablagc über die Wehrausgaben im Lichte der «Mirage»-Beschaffung oder zugunsten der Be- Berliner Theater Die seit langem als Sensation erwartete Uraufführung des Dramas mit dem langen Titel <nDie Verfolgung und Ermordung Jean Marats dar- «... Redaktion: vi. Seite der Minderheit, die, wie" gesagt, die Verschiebung der Beschlußfassung «bis nach der Behandlung des Expertenberichtes durch die Bundesversammlung» wünschte. gung» beizumessen. Der Bundesrat hat in kluger Voraussicht des Wellenganges, den die in den Annalen des Bundesstaates einmalig dastehende Bot- schaft verursachen werde, den Rettungsring einer von ihm selbst veranlaßten Untersuchung ausgeworfen, und prompt griff die Militäi'kommission sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit nach dieser Hilfe. Es ist deshalb *n der Zeit, die Dinge an den richtigen Ort zu rücken. Das zuständige und verantwortliche Departement hat drei von ihm ausgewählte Experten mit einer Untersuchung beauftragt im Einvernehmen mit dem Bimdesrat. Der Vorsitzende des Dreierkollegiums ist vom gleichen Departement schon früher als Gutachter beigezogen worden. Es handelt sich bei diesem Kollegium also weder um eine «Untersuchungskommission» noch um eine von der betroffenen Verwaltung unabhängige Instanz. Ohne der fachlichen und persönlichen Integrität der drei Herren in irgendeiner Weise nahezutreten, muß doch festgehalten werden, daß sie im Auftrag des Departements handeln, dessen Geschäftsführung in der voi-liegendcn Angelegenheit geprüft werden soll. Sie sind dem Departement und dem Bundesrat, nicht dem Parlament gegenüber verantwortlich und zur Be- Das Ergebnis der Beratungen in der Militärkommission ist enttäuschend. Die Verwaltung hat einen leichten und unverdiente7i Sieg errungen. Die Kommission ließ es sich nicht einmal verdrießen, ihr sogar die maßgebliche Mitwirkung an der Abfassung der amtlichen Mitteilung zu übertragen mit dem Ergebnis, daß im Communique nicht ein Wort, nicht eine Silbe der Kritik oder wenigstens des Unbehagens angesichts einer Kostenüberschreitung von über einer halben Milliarde steht . . Es wurde a n dieser Stelle die Auffassung verti-eten, daß der Zusatzkredit wolü oder bewilligt übel werden müsse, wenn man überhaupt einen Gegenwert für das bereits ausgegebene Geld erhalten wolle. Das heißt aber nicht, daß der Kredit sang- und klanglos über die parlamentarische Bühne gehen kann. Die Mehrheit der Militärkommission des Nationalrates wird sich auf die «Bedingungen» berufen, die sie sozusagen als disziplinarische Sanktion an ihre Zustimmung zur sofortigen Behandlung des Geschäftes im Plenum geknüpft habe. Aber worin bestehen denn diese Bedingungen eigentlich? Die Kommission ^behält sich vor», nach dem Schlußberioht der Expertenkommission «ei'gänzende Fragen» zu stellen. Das ist keine Bedingung, sondern für ein parlamentarisches Gremium, das nach der Verfassung mit der Kontrolle der Verwaltung betraut ist, eine Selbstverständlichheit. Man muß wissen, wie diese sogenannte Bedingung zustande kam. Der Kommission wurde nämlich bedeutet, daß sie nicht das Recht habe, mit der Expertenkommission direkt zu verkehren. So beschrankt sich die angebliche Verwandlung der Militärkommission in eine parlamentarische Untersuchungskommission darauf, daß sie den ihr vom Bundesrat zugeleiteten Schlußbericht besprechen wird! Und um diese Selbstverständlichkeit sicherzustellen, wird die Hälfte der Mehrkosten blockiert. Ist aber schon das Engagement der 827,9 Millionen heute ein unausweichliches Präjudiz für den Zusatzkredit geworden, so wird erst recht die Blockierung der zweiten Hälfte der Mehrkosten ohne jede materielle Bedeutung bleiben. Was schließlich die Reduktion der Teuerungsquote auf das bis Ende dos laufenden Jahres erkennbare Ausmaß anbelangt, so ist diesem der kosmetischen Die Mehrheit der Militärkommission scheint sich über die Stimmung in der Ocffentlichkeit keine genügende Rechenschaft gegeben zu haben. Im Bestreben, einen sachlich angemessenen und auch vertretbaren, vielleicht sogar unvermeidlichen Entscheid zu lale len, vernachlässigt sie die politische und. die psychologische Komponente über Gebühr. Sie ist sich offenbar nicht bewußt, daß der «Mirage», hätte man am Anfang die Gesamtkosten überblickt, vom Parlament niemals bewilligt worden wäre. In weiten Kreisen der Armee, vorab bei den für die Aufrechterhaltung des Wehrwillens und den Ausbau der Wehrbereitschaft sich verantwortlich fühlenden Offizieren, herrscht eine tiefe Erbitterung über die «Mirage»-Affäre. Der Schaden, den die Militärverwaltung damit der Armee zugefügt hat, ist unbestreitbar. Die Behandlung künftiger militärischer Begehren ist schwer beeinträchtigt, sei es weil die Vei1waltung künftig zögern wird, Kredite für andere Trappengattungen zu verlangen, sei es weil das Parlament kommenden Anträgen mißtraut. Eine politisch motivierte Verwedelungsaktion wäre nicht weniger fehl am Platze als der bereits eingeleitete Versuch, unter Berufung auf das Ansehen der Armee der Frage nach der Verantwortlichkeit auszuweichen und vor der angeblichen Allgewalt der technischen Komplexität der heutigen Rüstungsprobleme zu kapitulieren. Ganze begibt sich in einem Irrenhaus, und die Darsteller sind Irre, die gelegentlich in Ekstase ausbrechen und von den Pflegern gebändigt werden müssen. Diese Insassen des Hospizes zu Charenton spielen das tragische Ende Marats, des radikalen Wortführers der großen Revolution, der 1793, in einer Badewanne sitzend, von Charlotte Corday erstochen wurde. Zeit der Handlung (der der Aufführung im Irrenhaus) ist 1808, ein sehr frühes Datum für die moderne Therapie, die das Theaterspielen der Kranken als nützliche Ablenkung vor- den Kern des Stückes. Aber keinen sonderlich dynamischen Kern, man redet aneinander vorbei. Nicht eigentlich eine Handlung findet statt. Die Ermordung Marats ist nicht das Ergebnis eines dramatischen Konflikts, sondern ein Vorfall, ein Abschluß, hinter dem dann nur noch Bonapartc als Todesengel erscheint. Alle folgen im Marschtritt dem neuen Helden. Ist die Menschheit nicht wirklich irrsinnig? Ob Peter Weiss ein geborener Dramatiker, ein Gestalter ist, das ist noch nicht ganz sicher zu ent- gestellte durch die Schauspielgruppe des Hospizes su Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade» ist wirklieh ein exorbitantes Thcatercreignis geworden. Es bedeutet für den Autor Peter Weins, den in Schweden lebenden gebürtigen Berliner, der vor Jahresfrist mit einer unverbindlichen Kasperle- sieht. Moritat herausgekommen war, den Durchbruoh auf Warum Irrenhaus? Der Marquis von Sadc ist der Bühne. Stärker aber noch als das Werk über- dort in Verwahrung, weil seine sexuellen Exzesse zeugte die inszenatorische Leistung. Konrad Swiund seine wüsten Schriften selbst für die neue narski, der polnische Regisseur, in Berlin bereits Gesellschaft untragbar wurden. Es heißt, daß er rühmlich bekannt durch seine Inszenierung eines dort Theaterstücke verfaßte und sie von seinen brasilianischen Volksstückes, hat ein tolles Spec- kranken Schicksalsgenossen unter der Obhut des in all seiner Direktors aufführen ließ. Peter Weiss nimmt diese taculum entfesselt und dieses auch kunst- Legende zum Anlaß, das Spiel, um Marat dem Fülle auseinanderstrebender Elemente gerecht gebunden, fast zu einer einheitlichen Wir- Marquis zuzuschreiben und ihn auch zum eigentkung gebracht. lichen Gcgeaspieler des Jakobiners zu machen. InMotivierung: Vorlage. Züge die Menschheit kann nur für Sie weist nere Verwirrend ist die einer Historie hohen Stils auf und gibt sich zu- irrsinnig gehalten werden. Im «Milieu» soll sich gleich parodistisch. Es geht um Fragen der Exi- die Erkenntnis des Marquis (eines freilich nicht stenz, der gesellschaftlichen Ordnung, und es wird minder geistig- verwirrten Mannes!) spiegeln, daß Erlösung eine Kabarett-Revue aufgezogen, eine Moritaten- die Schrecknisse der Revolution zu keiner Befreiung eine neue Knesorie in Hans Sachs-Manier ; es gibt einen Chorus führen können, daß jede belung Sänger, Korruption purzeln mysticus, indessen bedeutet und die das und Mord zur vier Folge hat. Zwischen ihm, dem snobistischen Außen«Volk» verkörpern, clownsmäßig über die Bühne, Mächtigen ins seiter, der sich darauf beschränkt, das «Beobachzerren plärrend das Gehabe der eingeschaltet, und tete festzuhalten», und Marat, dem ungebrochenen Komische. Pantomimen werden alles, was sich ereignen soll, kündigt ein markt- Aktivisten, dem Vertreter einer erst sehr viel späan, oder er wartot auch ter verwirklichten sozialen Ordnung (Marx), gibt Ausrufer schreierischer Auseinandersetzungen. Sie bilden mit Kommentaren und Zwischentexten auf. Das es dialektische richterstattungverpflichtet. -.... a 11, Zürich FalkenstraBe Neuer Schritt Erhards in der Europapolitik Idee einer EWG-Gipfelkonferenz Von unserem Korrespondenten T. W. Bonn, 26. Mai Bundeskanzler Erliard kündigte in der Fraktionssitzung vom Montag, in der man für eine neue Präsidentschaft Lübkes eintrat, einen neuen Schritt in der Europapolitik an. Er will demnächst in eigener Person die Bundesrepublik im EWG-Ministerrat in Brüssel vertreten und damit auch die übrigen Regicrungs- oder Staatschefs zu einer Teilnahme ermuntern. Auf diese Weise ließe sich eine EWG-Gipfelkonferenz bewei'kstelligen, eine Idee, mit der sich Erhard seit längcrem beschäftigt. Der Bundeskanzler hofft, damit den Bemühungen für einen politischen Zusammenschluß Europas einen neuen Impuls geben zu können. Vor den CDU- und CSU-Abgeordneten erklärte er gestern, daß alles getan werden müsse, um innerhalb der Sechsergemeinschaft voranzukommen, solange Großbritannien der EWG nicht beitreten könne. Die wirtschaftliche Integration reiche nicht aus, solange kein starker politischer Wille dahin- terstehe. Das Resultat der Tegernseer Gespräche Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Barzel wie auch der Bundeskanzler bekräftigten als Resultat der Tegernseer Gespräche, daß es keine e n e u Politik gebe. Mit diesen Beteuerungen hofft man offensichtlich, der Möglichkeit neuer Differenzen in der eigenen Partei zu begegnen und insbesondere die FDP, die von der Vokabel «neue Politik» vielseitigen Gebrauch gemacht hatte, als Koalitionspartner zu zügeln. Einig waren sich die Sprechei darin, daß die Deutschlandfrage weiter auf der internationalen Tagesordnung bleiben müsse, auch wenn die Chancen vor den britischen und amerikanischen Wahlen gering sind. Erhard teilte der Fraktion mit, daß er von Präsident Johnson eine persönliche Botschaft über den Fortgang der Gespräche über die deutsche Frage erhalten habe. Johnson habe darauf hingewiesen, daß diese Gespräche mit den NATO-Beschlüssen im Haag nicht abgeschlossen seien. Erhard wird bei seinem Besuch in Washington am 11. Juni das Thema wieder aufnehmen. De Gaulles Besuch in Bonn Drei Wochen nach dem Besuch im Weißen Haus wird dann Präsident de Gaulle in Bonn erscheinen. Erhard hat gestern zur deutschfranzösischen Zusammenarbeit, auf deren Stand Adenauer besorgt hinwies, mit Nachdruck erklärt, daß es ohne diese enge Verbindung keine europäische und keine atlantische Politik gebe. Noch ist nicht auszumachen, welche europäischen oder atlantischen Fragen im Zentrum des Treffens stehen wer- Persönlichkeit emporzuziehen, hielt es vielmehr für wichtiger, den allzu vielen sogenannten Persönlichkeiten den falschen Nimbus zu nehmen. In seinem selten gespielten Stück «Mensch und Uebermensch», der Komödie vom «gezähmten Widerspenstigen», machte er mit seinem eigenen werten Ich den Anfang. n E i Zug der Anti-Eitelkeit, der aber der Eitelkeit nicht gar so ferne steht ... Er holt mächtig aus, um den grausamen Herrn der Welt, den Sexualtyrannen, zu treffen. Der Mann auf der Bühne, in dem sich Shaws aufbegehreCollage scheiden nach diesem Stück, das wie eine rischer Wille verkörpert, denkt die Macht des Weiwirkt. Aber ein Theatraliker großen Maßes ist er bes zu brechen, die mit geschlechtlichen Waffen gewiß, und es gibt in seinem Szenenwerk dichte- den Geist des Mannes unterjocht, ihn zum Sklaven rische Einzelheiten, auch manche kluge, in Knittel- und Lastträger macht Aber am Ende muß auch verse gefaßte Formulierung, manches Zeichen er der Frau, der Boa constrictor, als Jagdbeute eines Humors, der meist aus einer Kontrastwir- anheimfallen. Ist nicht selbst der vielbesungene kung, einer Verfremdung kommt wie wenn man Don Juan einfach eine Illusion? «Die ganze Welt einer Katze gegen das Fell streicht. ist mit Schlingen, Fallen, Netzen und Gruben zur Regisseur Der war in diesem Falle der legitime Gefangennahme der Männer durch die Frauen Mitschöpfer des Abends. Er hat mit bewunderns- übersät . . .» werter Präzision das Vielerlei ineinandergeschachVier Akte hat die Komödie. Sie könnte ad telt, die Aufmerksamkeit immer wieder neu entinfinitum fortgesetzt werden, sie zeigt keine Anzündet Die Szene fieberte geradezu vor Erregung deutung von dramaturgischer Grenzziehung. Schon ohne daß ein dramatischer Duktus vorhanden vor einem Vierteljahrhnndert, als ich das Stück war. Peter Mosbachcr gab den Marat, den ganzen Deutschen im Theater dem faszinierenden mit Abend hindurch in der Badewanne sitzend, mit gab es sprachlicher Vehemenz. Ernst Schröder charakteri- Ferdinand Marian in der Hauptrolle sah, unter den Zuschauern nicht allzu viele, die dem sierte den Marquis de Sade als einen «sadistisch» Aufnahmefähigunermüdlicher nachkostenden, leisen und müden Intellektuellen. Selbstironiker mit keit durch die Steppen seines Stückes folgten. Reizvoll und klar Lieselotte Rau als Charlotte Corday. Das darstellerisch Beste bot die quecksilbrige Auch diesmal konnte keine rechte Spannung aufkommen. Zur Flucht des als Opfer Ausersehenen, Vierheit der «Sänger». der mit dem Automobil durch die Länder rast Der Skeptiker Bernard Shaw wollte nichts wis- was man eben 1903 unter «rasen» verstand , sen von Nietzsches Postulat an den Willen, die steht leider das Sohneckentempo des Dramas in Neue Zürcher Zeitung vom 26.05.1964