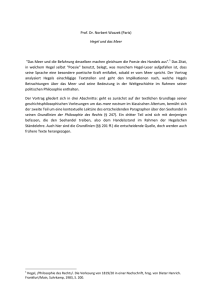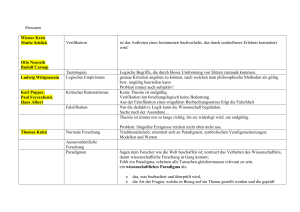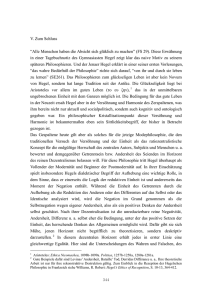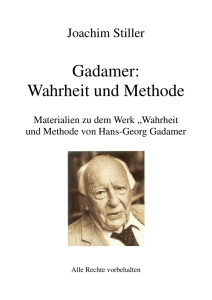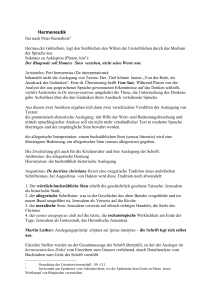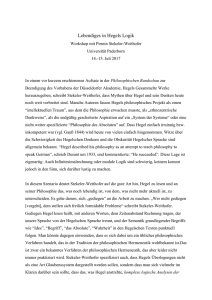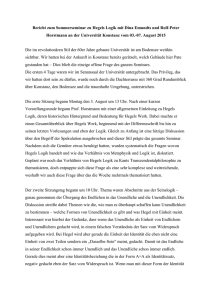Anerkennung durch Dialog: Zur ethischen Grundlage
Werbung

Kyeong-Bae Lee Anerkennung durch Dialog: Zur ethischen Grundlage des Verstehens in Gadamers Hermeneutik kassel university press Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Erziehungswissenschaft / Humanwissenschaften der Universität Kassel als Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr. phil.) angenommen. Erster Gutachter: Prof. Dr. Hans-Georg Flickinger Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Wolfdietrich Schmied-Kowarzik Tag der mündlichen Prüfung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar Zugl.: Kassel, Univ., Diss. 2007 ISBN print: 978-3-89958-648-0 ISBN online: 978-3-89958-649-7 URN: urn:nbn:de:0002-6493 © 2009, kassel university press GmbH, Kassel www.upress.uni-kassel.de Druck und Verarbeitung: Unidruckerei der Universität Kassel Printed in Germany 30. November 2007 Für meine Mutter Vorwort Im Vorwort könnte der Verfasser die Entstehungsgeschichte des Verfassten ankündigen, wie das Verfasste zustande kommt, wer sein Gesprächspartner im spürbaren Werdegang war, wie der philosophische Denkanstoß, der von vornherein nur embryonal geblieben ist, zu seiner eigenen Form hingeführt wird. Denn jedes Sinngewebe hat ihre eigene Entstehungsgeschichte, die die gesamten Phasen skizziert. Für die vorliegende Anfertigung meiner Arbeit habe ich in erster Linie Prof. Dr. Hans-Georg Flickinger, der mit mir diesen langen Weg durchgängig zusammengeht, zu danken. Ohne seinen unentbehrlichen Anstoß und seine dauerhafte Betreuung wäre die Dissertation zu dieser vorliegenden Form nicht durchführbar gewesen. Er war immer bei dem gesamten Entstehungsprozess meiner Arbeit mit den vielen Gesprächen, die mir die wissenschaftlichen Impulse verliehen und mich zur fachlichen Erkenntnis ermutigt haben. Ihm gilt mein besonderer Dank. Ich verdanke auch Prof. Dr. Wolfdietrich SchmiedKowarzik, der mir in der Arbeitserstellungszeit viele philosophische Anlässe zum anderen Denkhorizont gegeben und die persönliche Unterstützung gewährt hat. Außerdem gilt mein Dank auch Prof. Dr. Thomas Göller und Prof. Dr. Gottfried Heinemann, die beide im Dissertationsverfahren mit mir über die Grundeinsicht der Arbeit kritisch, aber hilfsreich diskutiert haben. Mein Lerngang, der durch die philosophischen Diskussionen mit den Professoren/in, Prof. Dr. Heidrun Hesse, Prof. Dr. Stefan Majetschak und apl. Dr. Heinz Eidam erfüllt wird, verpflichtet mich auch zum persönlichen Dank. Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Mutter und meines Bruders wäre mein langjähriges Studium nicht leichter gewesen. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. In den schwierigen Phasen haben meine Frau und meine Tochter, Han-Ul, mich stets emotionell unterstützt und mir den Mut gegeben. Ihnen gilt mein herzlicher Dank. Schließlich danke ich auch meiner jüngsten Tochter, Ga-ram, die noch ihren ersten Blick auf die Welt erwartet. Kassel, im November 2007 Lee, Kyeong-Bae Tag der Disputation: 30. 11. 2007 Inhaltsverzeichnis Einleitung .................................................................................................................................. 1 Erster Teil: Hegel–Repräsentation in Gadamers philosophischer Hermeneutik ............ 13 I. Die Bedeutung der ontologischen Erfahrung vor dem Hintergrund der Ontogenese des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie des Geistes.......................................................... 19 I - 1. Wohin soll das Bewusstsein führen? - Das Ziel der dialektischen Darstellung .............. 19 I - 2. Die Erfahrung des Bewusstseins: Der Verstand im relativen Verhältnis........................ 26 I - 3. Zum ontologischen Wesen von Selbst und Leben: Die Wechselbeziehung des Selbstbewusstseins ................................................................................................................... 30 II. Das Prinzip der Anerkennung in der früher Zeit ................................................................. 37 II - 1. Der Begriff der Liebe in der Frankfurter Zeit: Das Streben nach der Befreiung vom Leiden an der Zerrissenheit ...................................................................................................... 40 II - 2. Die Perspektive der politisch–gesellschaftstheoretischen Philosophie in der frühen Jenaer Zeit ................................................................................................................................ 47 2 – 1. Die Selbstnegation und die Selbstidentifizierung im Naturrechtsaufsatz ...................... 47 2 – 2. Liebe und Anerkennung als das Prinzip der Sozialbeziehung zwischen den Subjekten im „System der Sittlichkeit“..................................................................................................... 52 III. Das Anerkennungsverhältnis in der Geistesphilosophie 1803/04, 1805/06....................... 64 III – 1. Die mediale Intimbeziehung zwischen Ich und Du ..................................................... 69 III – 2. Die freiwillige Reintegration des Ichs ins Wir–Bewusstsein....................................... 89 IV. Die Anerkennungsbewegung zum Lebensganzheitshorizont als ontologischer Grundlage für die Lebendigen in der Phänomenologie des Geistes ........................................................ 106 IV – 1. Das Anerkennungsverhältnis des Selbstbewusstseins in der ungestillten Sehnsucht nach dem Lebensganzen......................................................................................................... 106 IV – 2. Die anerkennende Gewissensdialektik von dem „Schönen“ und dem „Bösen“ ........ 123 Exkurs zur Ethos–Ethik: Die Sittlichkeit als eine Lebensform (Rüdiger Bubner) ................ 137 V. Resümee – Von einer reflexiven Abgeschlossenheit zum spielerischen Reflexionsverhältnis der ästhetischen Erfahrung ................................................................... 151 Zweiter Teil: Die ontologische Struktur der hermeneutischen Erfahrung im Verstehensmodell ................................................................................................................. 161 I. Die Geschichtlichkeit der Erfahrung des hermeneutischen Bewusstseins ......................... 166 I – 1. Die ontologische Grundlage der Erfahrung: Die Rehabilitierung der Vorurteile als die Vorstruktur des Verstehens .................................................................................................... 166 1 – 1. Gadamers Kritik am neuzeitlichen Ideal des Objektivismus und des Subjektivismus 167 1 – 2. Die unentrinnbare Angewiesenheit des menschlichen Verstehens auf das hermeneutische „Vor“ ............................................................................................................ 181 I – 2. Die Wirkungsgeschichte als das Prinzip des Verstehens: Die überlieferte Tradition und die Rekonstruktion in Auseinandersetzung mit der Vergangenheit....................................... 197 I – 3. Das distanzierende Verstehen und die Sinnrekonstruktion .......................................... 217 I – 4. Das Bewusstsein der Endlichkeit und die hermeneutische Offenheit .......................... 229 II. Die Zirkelbewegung und die Erwartung der Sinnganzheit ............................................... 239 II – 1. Wagnischarakter im Verstehen: Die Hin– und Herbewegung zwischen dem Eigenen ................................................................................................................................................ 239 II – 2. Der Sinnhorizont der Erwartung auf den Sinnvollzug ................................................ 247 II – 3. Die Horizontverschmelzung als die wahrhafte Verständigung ................................... 255 Dritter Teil: Vom Verstehen des Textes zur Verständigung im Dialog .......................... 263 I. Die dialogische Verständigung als die Gemeinsamkeitsbildung durch die sprachliche Vermittlung ............................................................................................................................ 268 I – 1. Die Universalität der Sprache, in der wir sind.............................................................. 268 I – 2. Hören auf das Ungesagte, das wir im Gesprächsverhältnis ständig aussagen wollen .. 293 I – 3. Dialog als Urphänomen des Denkens: Woran orientiert sich die dialogische Gesprächsführung?................................................................................................................. 304 II. Die dialogische Ethik im Gesprächsverhältnis.................................................................. 327 II – 1. Aristoteles’ phronesis in Bezug auf den Platonischen Dialog .................................... 327 II – 2. Praktische Applikation als die Vollzugsform des dialogischen Verstehens................ 344 Ein kurzer Ausblick ............................................................................................................. 351 Literaturverzeichnis............................................................................................................. 354 Einleitung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Gadamers philosophischer Hermeneutik und zwar unter einer Grundthese: Dialog ist ethisch. Die aufgestellte These bedarf keiner Demonstration, die durch das logische Schlussverfahren bewiesen werden soll, sondern sie schließt von Anfang an vor allem den Fragehorizont, was ein Dialog ist, ein. Sie weist überdies auf die inhaltliche Annahme hin, dass der Dialog die ontologische Grundlage stiftet, auf der das Ethische sich verwirklicht und konkretisiert. Nun könnte hier ohne die weiteren Bestimmungen von „Dialog als Ethik“ die Rede sein. Aber Gadamers philosophische Hermeneutik ist von vornherein dialogisch und zugleich dialektisch, insofern sie die Grundstruktur der menschlichen Erfahrung als die offene Bewegung im „Zwischen“ von Wiederholung und Differenz auffasst. Wenn hier einerseits gezeigt wird, dass sie im Grunde dialogisch ist, besagt dies, dass das hermeneutische Verstehen von der erfahrenen Begegnung mit dem Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit ausgeht. Da das hermeneutische Verstehen im Prinzip auf die Sachwahrheit in der dialogischen Teilnahme des Gesprächspartners abzielt, kann man andererseits sagen, dass philosophische Hermeneutik auch dialektisch ist. Der hermeneutische Anspruch in dieser Dialogdialektik stellt die ethische Verhaltensweise aller Beteiligten, die nicht von einem abgeleiteten Dritten, sondern von der jeweils gegenwärtigen Dialogsituation verlangt wird, in den Vordergrund, weil jeder der Beteiligten die ethische Verantwortung für seinen Anderen, nämlich einerseits das Zuhören auf die Andersheit und andererseits die daraus folgende Beantwortungspflicht, übernimmt, damit er sich nicht nur über seinen Anderen, sondern auch über sich selbst verständigen kann. Von daher wird sich zeigen, dass der Dialog sich immer schon auf einer ethischen Grundlage bewegt, sofern die menschliche Erfahrung mit dem unendlichen Bezug auf den Anderen zustande kommt. Im Allgemeinen gilt, dass die Hermeneutik von vornherein auf die Frage abzielt, was Verstehen sei. Mit dieser Aufgabenstellung will sie nicht eine exakte Methodik aufstellen, sondern dasjenige, was im Verstehen passiert, wie Verstehen stattfindet, phänomenal darstellen. Deshalb wurde öfter gesagt, Hermeneutik sei die „Kunst des Verstehens“. Aber diese Kunst verweist keinesfalls auf eine Art und Weise der Beherrschung einer ihr zugeordneten Methode oder den Besitz eines erstarrten Wahrheitskriteriums. Vielmehr geht Hermeneutik vom Einwand gegen das Ideal des naturwissenschaftlichen Methodenbewusstseins aus, das sich auf die unentbehrliche Spaltung von Subjekt und Objekt, nämlich auf eine Objektivitätsinstanz stützt. Von diesem Ausgangspunkt aus fasst sie das 1 Verstehen als die menschliche Welterfahrung ins Auge. Aus der hermeneutischen Sicht ist das Verstehen mithin die existenzielle „Seinsweise“ des Menschseins. So ist es das unentrinnbare Grundphänomen aller Erfahrungen, nämlich der menschliche Weltbezug selbst. Im Anschluss an ihre Grundauffassung von der existenziellen Umgangsstruktur der menschlichen Erfahrung mit der Welt, bemüht sich Hermeneutik um die Bewahrung des Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit. Hierbei zeigt die Unabgeschlossenheit des Verstehensverlaufes bzw. die Unaufhebbarkeit der Andersheit uns dasjenige an, was die Hermeneutik sich fragt. Die Unerschöpfbarkeit des Anderen ist der Grundbestandteil der Hermeneutik, weil die Hermeneutik sich immer die Frage stellt, was zu verstehen ist. Wenn alles endgültig verstanden werden könnte, dann gäbe es keine hermeneutische Erfahrung. Aber wir dürfen dabei nicht die Tatsache aus den Augen verlieren, dass die Idee einer absoluten Vollendung des Verstehens auf das eschatologische Ende der menschlichen Erfahrung verweist und dass das Verstehen die unendliche Bewegtheit in seiner Selbstbeziehungsstruktur findet, insofern es sich immer wieder auf das Verstandene zurück beziehen muss. Aus diesem Grund fragt die Hermeneutik nach dem Missverstehen und dem Nicht–Verstehen als Rahmenbedingungen für das Verstehen. Was die Nichtverstehbarkeit angeht, gibt es in der hermeneutischen Sicht nichts, das absolut nicht zu verstehen wäre. Denn das Nicht–Verstehen selber rückt das zu Verstehende in den Vordergrund: Was nicht verstanden wird, das schließt unmittelbar den Impuls des Verstehenwollens ein. Aufgrund seiner Auffälligkeit verleiht das Nicht–Verstehen uns den Anstoß, dass wir verstehen wollen und müssen. Allerdings müssen wir bemerken, dass dasjenige, das vollständig unverständlich ist, jenseits des Verstehens liegt. Aus der hermeneutischen Sicht setzt die prinzipielle Verstehbarkeit unseren Willen zum Verstehen voraus. 1 Bei uns geht es um das Missverstehen. 1 2 Zur wohlwollenden Hermeneutik, die von Georg Friedrich Meier verlangt wird, vgl. Wolfgang Künne, „Prinzipien der wohlwollenden Interpretation“, in: Intentionalität und Verstehen, hrsg. v. Forum für Philosophie Bad Homburg, Frankfurt a. M. 1990, S. 212 – 236. Uns ist auch die jüngste Debatte, die mit Derridas Nachfrage bei Gadamer begonnen hat, bekannt. Innerhalb des umstrittenen Diskussionsrahmens, der im Pariser Symposium im Jahr 1981 stattfand, hat Derrida hauptsächlich nach der hermeneutischen Willensstruktur zum Verstehen eine verdächtige Frage gestellt, wenn es auch in der Anfangsphase von Derridas Fragestellung um Heideggers Nietzsche–Interpretation gegangen war. Derridas These lautete: Der gute Wille zum Verstehen sei auch der Wille zur Macht. Im Anschluss an den Verdacht hinsichtlich der Machtstruktur im menschlichen Verstehensversuch hat die Dekonstruktion darauf hingewiesen: Das Verstehen muss das Missverstehen sein. So muss jedes Verstandene unabdingbar in den Zustand eines Verlustes an Glaubwürdigkeit verfallen sein. Vgl. Jacques Derrida, „Guter Wille zur Macht (I) – Drei Fragen an Hans– Georg Gadamer“, S. 56 - 58 und ders., „Guter Wille zur Macht (II) – Die Unterschriften interpretieren (Nietzsche/Heidegger)“, in: Text und Interpretation – Deutsch–französische Debatte mit Beiträgen von J. Derrida, Ph. Forget, M. Frank, H. – G. Gadamer, J. Greisch und F. Laruelle, München 1984, S. 62 – 77. Zudem zu Derridas Denkposition in Verbindung mit dieser Debatte, vgl. Heinz Kimmerle, „Gadamer, Derrida und kein Ende“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie (Jg. 16), hrsg. v. J. Simon, Stuttgart 1991, S. 59 – 69 und auch Derrida unter der philosophiegeschichtlichen Denklinie, ders., „Ist Derridas Denken Ursprungsphilosophie? – Zu Habermas’ Deutung der philosophischen >>Postmoderne<<“, in: Die Frage nach dem Subjekt, hrsg. v. M. Frank u. a., Frankfurt a. M. 1988, S. 267 – 282. In der Festrede zur Gedenkfeier an Sofern wir etwas verstehen wollen, trifft uns stets die Gefahr des Missverständnisses. Da das menschliche Verstehen ins Missverstehen gefallen sein kann, bedarf das Verstehen am Leitfaden der wechselseitigen Einwirkung im Dialogverhältnis der hermeneutischen Anstrengung, in deren Verlauf alle Vormeinungen durch die innere Selbstkritik überprüft werden und wir vermittels der Selbstkorrektur den richtigen Zugang zur Welt und die treffende Umgangsweise mit dem Anderen finden können. In der unaufhörlich suchenden Orientierung am Selbstverständnis setzt die hermeneutische Verständlichkeit keine vollständige Ich–Objektivierung in Gang, sondern ist im unerschöpfbaren Fremdbezug verwurzelt. So können wir sagen, dass das Verstehen das des Anderen ist. Im wechselseitigen Verhältnis zu jeweils Anderen steht das menschliche Verstehen immer zwischen der Aneignung und der Differenz: Das Verstehen vollzieht sich in der Bewegung, die als der hermeneutische Zirkel bezeichnet wird. In der hermeneutischen Perspektive der unauflösbaren Zirkelbewegung des Verstehens meint die Aneignung hier jedoch nicht die endgültige Aufhebung der Andersheit, sondern sie kommt immer mit der Bewahrung der Andersheit des Anderen zu sich selbst. 2 So geht es beim hermeneutischen Gadamer am 15. Feb. 2003 in Heidelberg hat Derrida auch Gadamers Perspektive auf den inneren Dialog in den Vordergrund gestellt, wenn es auch in seiner Rede hauptsächlich um die Interpretation zu Paul Celans Gedicht „Atemwende“ geht. Die hermeneutische Denkstruktur des inneren Dialogs zugestehend, sagt Derrida: „Und doch war ich mir sicher, daß wir von nun an auf eine merkwürdige, aber innige Weise etwas teilen würden. Vielleicht eine Teilhaberschaft. Damals schon hatte ich eine Vorahnung: Was Gadamer wahrscheinlich einen >>inneren Dialog<< genannt hätte, sollte in jedem von uns weitergeführt werden, manchmal wortlos, unmittelbar in uns oder indirekt.“ (S. 8) Vgl. Jacques Derrida, „Der ununterbrochene Dialog: Zwischen zwei Unendlichkeiten, das Gedicht“, in: Jacques Derrida Hans–Georg Gadamer Der ununterbrochene Dialog, hrsg. v. Martin Gessmann, Frankfurt a. M. 2004, S. 7 – 50. Darüber hinaus hat Habermas in einer anderen Denkrichtung den eigenen Anspruch auf die „Tiefenhermeneutik“, die von Alfred Lorenzer begründet wurde, gegen die hermeneutische Vorstruktur erhoben. Damit hat er die therapeutische Funktion der Psychoanalyse, die Kommunikationsstörung in den gesellschaftlichen Machtverhältnissen aufzuklären, als das Vorbild des menschlichen Verstehens bevorzugt. Vgl. Jürgen Habermas, „Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt a. M. 1971, S. 120 – 159. Aber dennoch ist es leicht vorzustellen, dass die Tiefenhermeneutik immer schon auf die noch tieferen Schichten gerichtet ist und um ihrer selbst willen den Begründungsanspruch auf die letzte Instanz erhoben hat. Auch zum Denkansatz der objektiven Hermeneutik, die wir die objektive Sozialforschung nennen sollten, gegen die Subjektivität in der Tiefenhermeneutik, vgl. Ulrich Oevermann, „Die objektive Hermeneutik als unverzichtbare methodologische Grundlage für die Analyse von Subjektivität. Zugleich eine Kritik der Tiefenhermeneutik“, in: >>Wirklichkeit<< im Deutungsprozeß – Verstehen und Methode in den Kultur– und Sozialwissenschaften, hrsg. v. Thomas Jung und Stefan Müller–Doohm, Frankfurt a. M. 1993, S. 106 – 189. 2 Vgl. Manfred Frank, Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und Textinterpretation nach Schleiermacher, Frankfurt a. M. 1985, S. 21 Anm. 11, S. 33. Dort weist er darauf hin, dass Gadamers Dialog aufgrund seines Universalsubjektivitätscharakters unmittelbar mit Hegels Absolutem Geist identisch sei. Hinsichtlich des Stellenwerts des Anderen im hermeneutischen Verstehensvorgang hat er auf das Verhältnis der Gadamerschen Hermeneutik zu Hegels subjekttheoretischen, systemphilosophischen Ansprüchen sein Augenmerk gerichtet. An dieser Stelle glaubt er von nun an, dass Gadamers Dialog, wie die Homogenität des absoluten Wissens in Hegels Systemphilosophie sich gezeigt hat, die Individualität des Anderen letztendlich auch aufzuheben scheint. Sein Vorwurf gegen Gadamers Dialogdenken ist deshalb mit der Kritik an der „Horizontverschmelzung“ zugespitzt. So verstanden scheint auch Gadamers Aufnahme von Hegels Formel, Selbsterkenntnis im „Anderssein“, insbesondere eine totale Vermitteltheit zu skizzieren, an deren Endpunkt die Andersheit mit dem Erreichen des Einverständnisses als Horizontverschmelzung aufgesaugt wird. Aber sein verkürzter Einwand gegen Gadamers Hermeneutik hat m. E. zwei wichtige Punkte aus den Augen 3 Verstehen immer um den unabschließbaren Bezugspunkt aller Betroffenen, der bei Gadamer als das „hermeneutische Zwischen“ bezeichnet wird. Das Zwischen zeigt sich als das unendliche Wechselverhältnis, in dessen Licht das Verstehen als solches stattfindet. Dies gibt uns auch den entscheidenden Hinweis, dass dem Verstehen die Anerkennung der unaufhebbaren Andersheit des Anderen stets zugrunde liegt. Darüber hinaus müssen wir in Anknüpfung an Gadamers Grundeinsicht in den Ereignischarakter des Verstehenssinns bemerken, dass die Unaufhebbarkeit der Andersheit nicht eine bloße Forderung der Hermeneutik ist, sondern die hermeneutische Grundbedingung für die menschliche Erfahrung prägt. Von daher lässt sich sagen, dass das hermeneutische Verstehen nie zu Ende kommt, seine Grenze bereits anerkennt: Die absolute Vollendung des Verstehens des Anderen ist mithin ein Grenzfall. Aus der hermeneutischen Einsicht in die mitkonstitutive Funktion der Andersheit des Anderen in jedem Verstehensakt können wir nunmehr auf die Ethik eingehen, die in Gadamers Dialoghermeneutik erarbeitet werden soll. Die Ethik des dialogischen Verstehens, 3 wie es genannt werden soll, vollzieht die Anerkennungsbewegung im Blick auf den Lebensvollzug. Da die Anerkennungsbewegung sich innerhalb des unabschließbaren Gesprächsverhältnisses zwischen dem Antworten und dem Vernehmen vollzieht, geht das dialogische Verstehen ohne den ethischen Impuls nicht weiter. Außerdem haben wir bereits gesehen, dass das hermeneutische Verstehen allererst von der Anerkennung des Anderen, 3 4 verloren: Einer ist die hermeneutische „Offenheit“ gegen Hegels systemphilosophische, teleologische Abgeschlossenheit. Der Andere ist in Gadamers Begriffsgebrauch „die hermeneutische Reflexion“, wenn Gadamer die Selbsterkenntnis im Anderssein als den Grundzug der Reflexivität der hermeneutischen Erfahrung aufgefasst hat. Die hermeneutische Reflexion ist bei Gadamer die Wiedererkenntnis des hermeneutischen Bewusstseins, dass es seine geschichtliche Abhängigkeit, Begrenztheit erkennt. Hier ist die Wiedererkenntnis des hermeneutischen Bewusstseins weder die Wiedergabe des Ur-Ich noch die Rückkehr zum unhintergehbaren Grund, sondern sie ruft das Vergessene in Erinnerung, d. h. sie ist ein reflexiver Rückgang zum verlorenen Selbst mit Hilfe der unauflöslichen Mitkonstruktion der Andersheit des Anderen. In diesem Sinne fängt die hermeneutische Reflexion, Gadamer zufolge, weder mit dem „Nullpunkt“ an, noch kommt sie zu einem Ende. Zu Gadamers Denkansatz zur ethischen Haltungsweise im hermeneutischen Dialogverhältnis in Bezug auf Gadamers Denkentwicklung, vgl., Hans–Georg Flickinger, „Pädagogik und Hermeneutik – Eine Revision der aufklärerischen Vernunft“, in: Praktische Philosophie und Pädagogik, Kasseler Philosophische Schriften 37, hrsg. v. Heinz Eidam u. Frank Hermenau, Kassel 2003, S. 120 - 131. Zur Ethik der „Interpretation“, vgl., Michael Hofer, Nächstenliebe, Freundschaft, Geselligkeit – Verstehen und Anerkennen bei Abel, Gadamer und Schleiermacher, München 1998, insb. S. 119 ff. Bezüglich der Interpretationsethik lautet seine These, dass die Hermeneutik im Prinzip darauf hinweist, „eine Ethik der Interpretation auszuarbeiten, ja die Hermeneutik insgesamt und somit den Verstehensakt als ethisches Unterfangen aufzuweisen.“ (S. 11 – 12) Im kurzen Selbstanzeigen über diese Arbeit bemerkt er, dass „durch die generelle Unterbelichtung der Selbstbewusstseinsthematik [...] sich die neuere Hermeneutik über weitere Strecken um ein beträchtliches Begründungspotential im Rahmen einer >>Ethik der Interpretation<< [bringt], die Verstehen begründen und Anerkennung sichern will.“ Vgl., ders., „Michael Hofer: Nächstenliebe, Freundschaft, Geselligkeit. Verstehen und Anerkennen bei Abel, Gadamer und Schleiermacher. München 1998, S. 298“, in: Dilthey – Jahrbuch, Bd. 12, Göttingen 2000, S. 275 – 277. Unter dieser Hypothese der Selbstbewusstseinskonzeption hat er versucht, die subjekttheoretische Begründung unter drei verschiedenen Argumentationsrichtungen, d. h. „epistemologisch“, „erkenntnistheoretisch“, „konstitutionstheoretisch“, aus der Hermeneutik zu erarbeiten. nämlich von der Bereitschaft zum Verstehen des Anderen ausgeht. An dieser Stelle ist nunmehr festzuhalten, dass die Annahme des Anderen als Partner den dialogdialektischen Weg 4 von Selbstbehauptung und Selbstüberprüfung, von Bejahung und Verneinung eröffnet, dass der hermeneutische Sinnvollzug sich durch den sich entfaltenden Prozess zur Selbsterkenntnis bzw. zur bewussten Anerkennung der Andersheit ereignet. Im Anschluss an den engen Zusammenhang von Verstehen und Anerkennen legt die philosophische Hermeneutik ihr Augenmerk über die Textinterpretation hinaus zur ethischen Haltung und zur zwischenmenschlichen Verständigung im Gesprächsverhältnis, kurzum, über die theoretische hinaus zur praktischen Philosophie, weil das Verstehen als die menschliche Erfahrungsweise bereits auf den Fremden, den Anderen angewiesen ist. Insofern hat das Verstehen den Fremden, den Anderen zu seinem Gegenstand und umgekehrt nimmt der Fremde bzw. der Andere seinen Stellenwert als ein Grundelement des Verstehens ein. Das hermeneutische Verstehen sieht deshalb nicht nur die Interpretation der schriftlich fixierten Texte und der Kunstwerke als seine Aufgabe an, sondern stellt vor allem die zwischenmenschliche und zwischenkulturelle Verstehensaufgabe in den dialogischen Prozessen in den Vordergrund. Angesichts dessen geht es in der Hermeneutik um die Andersheit in der stetigen Distanzierung zum Eigenen, weil der Andere nur mit Bezug auf das Selbst, nämlich ein Anderer für den Eigenen im oszillierenden Wechselverhältnis ist: Dass der Andere als Anderer gezeigt und aufgefasst wird, setzt deshalb voraus, dass er in Bezug auf das Selbst als Anderer anerkannt, verstanden wird. So gesehen ist der Andere nur gegenüber dem Selbst als Anderer und der Fremde ist auch nur gegenüber dem Eigenen als Fremder. Für Gadamer ist der Andere im Dialog weder das substanzielle Subjekt noch die andere Person, die an sich unhintergehbar fixiert bleibt, sondern der Andere ist immer schon ins Gesprächsverhältnis eingelassen. Mit dem Eintritt ins Gespräch ist der Andere nicht mehr die reflexiv erworbene Ichheit als ein evidentes Personalpronomen in jedem Urteilssatz, sondern der Andere ist selber darin nur ein Aufrufendes „du“ oder ein Sagendes „ich“. Hinter diesem dialogischen Austausch von Aufrufen und Sagen bleibt das Selbst unthematisiert. Aber 4 Vgl., Herbert Schnädelbach, „Dialektik und Diskurs“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, Jg. 12, hrsg. v. J. Simon, Stuttgart 1987, S. 1 – 24. Hier hat er in erster Linie versucht, die Dialektik von dem Dialog, sozusagen dem Diskurs abzusondern. Im Anschluss an diese Unterscheidung hat er andererseits den Anspruch auf die metaphysische Vernünftigkeit, in seinen Worten, „negative Metaphysik“ erhoben. Denn der Dialog, auf den die Hermeneutik aufmerksam gemacht hat, habe in seinen Augen die ‚dialektische’ Zugänglichkeit für die Wahrheit unterschätzt. Aber sein Konzept zur negativen Metaphysik in Orientierung an Adorno lässt m. E. den ständig thematisierten Wahrheitsanspruch im dialogischen Suchen außer Acht. Zur hermeneutischen Erwägung gegen den Anspruch von H. Schnädelbach, vgl., Jean Grondin, „Ist die Hermeneutik eine Krankheit? – Antwort auf Herbert Schnädelbach“, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 45, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 1991, S. 430 – 438. Hierbei kommt es noch mehr darauf an, die Wahrheit mit dem hermeneutischen Bewusstsein der Geschichtlichkeit der menschlichen Vernünftigkeit philosophisch in Verbindung zu bringen. 5 dennoch ist anzunehmen, dass das Selbstwissen in jedem Ich–Sagen immer „da“ ist. 5 Damit deklariert die ontologische Differenz von nun an keinen unüberwindbaren Abgrund, sondern sie selber ist bereits auf den dialogischen Spielraum der Verstehbarkeit bezogen. Dass Gadamers philosophische Hermeneutik ohne die Ethik nicht verstehbar ist, dass sie die ethische Grundlage in unserem lebensweltlichen Dialogverhältnis achtet, dies basiert von vornherein auf dem hermeneutischen Bewusstsein, dass die existentielle Erfahrung der Unaufhebbarkeit der Andersheit eine ontologische Grundvoraussetzung für das Verstehen sei. Insofern liegt die Anerkennung der Andersheit nicht in der sollenslogischen Handlungsdimension, die immer aus einem begründeten Prinzip deduktiv abgeleitet wird, sondern das Verstehen selber ist die Anerkennungsbewegung, die die ethischen Implikationen sichtbar macht. Gadamers Auffassung, derzufolge das menschliche Verstehen sich immer schon im Anerkennungsverhältnis befinde, dass das Verstehen als ein menschlicher Wesenszug in der Welt deshalb ethisch sei, erlaubt es nunmehr uns mit Hegel auseinanderzusetzen, ja auf Hegels Konzeption zur geschichtlichen Selbstentwicklung und zur wechselseitigen Anerkennungsbewegung zu rekurrieren. Hierbei geht es insbesondere um Hegels Denken der Geschichtlichkeit der Erfahrung des Bewusstseins, nämlich die ontogenetische Ausbildung des Selbstbewusstseins und die Wechselseitigkeit bei der Selbstausbildung in seiner Phänomenologie des Geistes. Gemäß Gadamers Einsicht in die wechselseitige Angewiesenheit der menschlichen Erfahrung auf die Andersheit habe Hegels Philosophie eindrucksvoll bewusst gemacht, dass unsere Erfahrung sich geschichtlich und wechselseitig entfaltet und entwickelt, dass die Selbstausbildung des Selbstbewusstseins deshalb mit dem stetigen Bezug auf die Andersheit des Anderen verbunden sei: Das Bewusstsein von Ich steht mithin im zwischenmenschlichen Bezug. An diese Denkweise Hegels knüpft Gadamers Hermeneutik an; aber dennoch ist die Aufnahme des Hegelschen Denkens in die Hermeneutik weder eine reproduktive Wiederherstellung noch eine restaurative Wiedergabe, weil die 5 6 Zu den subjektivitätstheoretischen Selbstbewusstseinsmodellen unter der modernphilosophischen Denktradition von Descartes über Kant, Fichte, Hegel bis zu Husserl, Heidegger, vgl., Klaus Düsing, „Strukturmodelle des Selbstbewußtseins – Ein systematischer Entwurf“, in: Fichte – Studien, Bd. 7, hrsg. v. Klaus Hammacher u. a., Amsterdam 1995, S. 7 – 26. Vom Zirkeleinwand gegen die modernen Subjektivitätstheorien ausgehend hat er hier in Orientierung an Husserls „phänomenologisches Horizontmodell“ und Heideggers existenzielles „In–der–Welt–Sein“ sein Konzept für das Selbstbewusstseinsmodell vorgelegt. Sein Denkansatz zum „Mitbewusstsein“ erlaubt uns zu erwähnen, dass das Selbstbewusstsein ein „begleitetes“ Bewusstsein, wie es genannt werden soll, sei. Es ist eine Tatsache, dass wir ein Bewusstsein von etwas haben, wenn wir etwas wahrnehmen. Aber es liegt auch auf der Hand, dass das Bewusstsein von Ich sich innerhalb eines solchen Wahrnehmungshorizontes unthematisch mitbewegt. Keiner kann davon sprechen, etwas ohne das Selbst wahrzunehmen und bewusst zu machen. Das bedeutet, dass das Selbst als Subjekt im Bewusstsein von etwas immer dabei bleibt, aber dennoch davon keine klare Vorstellung haben muss. Hermeneutik es von vornherein als ihre Aufgabe ansieht, die alte Überlieferung dem gegenwärtigen Anspruch angemessen zu vergegenwärtigen. So behält Gadamers Hermeneutik besonders die anerkennende Wechselwirkung unter den Menschen im bewussten Rückgang zum Selbst in Hegels Philosophie im Auge. Zugleich distanziert sich Gadamers Hermeneutik kritisch vom reflexionsphilosophischen, teleologischen Denkzug in Hegels Philosophie: Das Subjekt weiß dort mit seiner reflexiven Denkkraft vollständig um sich selbst und ist zudem mit sich selbst substanziell verschlossen. Hegel glaubte den grundsätzlichen Zirkel zwischen „ich denke“ und „ich bin“ mit der Reflexionskraft des denkenden Ichs aufbrechen zu können. 6 Aber aus Gadamers hermeneutischer Sicht ist Hegels philosophischer Anspruch auf die totale Vermittlung zwischen dem Sein und dem Denken, nämlich die vollendete Einigkeit von der Wahrheit und der Geschichte in einem homogenen System, eine überfordernde Ermächtigung der subjektiven Reflexivität. Für uns wird deshalb ersichtlich, dass die teleologische Ontogenese von Anbeginn in Hegels Systemphilosophie auf das „absolute Wissen“ gerichtet ist, dem das Ideal der Reflexionskraft des denkenden Ichs zugrunde liegt. Im Anschluss an die teleologische Intention können wir auch bemerken, dass dahinter Hegels Glaube an die subjektive Allwissenheit vorausgesetzt ist. Auf dem ausgeführten Endpunkt, wo das denkende Ich das bewusste Selbstwissen ergreift, geht das absolute Wissen selber auch über den geschichtlichen Wandel hinaus, d. h. es ist über das Sein hinweg übergeschichtlich. In 6 Zu Hegels Selbstbewusstseinstheorie im Deutschen Idealismus, vgl., Walter Schulz, „Das Problem des Selbstbewußtseins in Hegels System“, in: Philosophisches Jahrbuch, Jg. 91, hrsg. v. Hermann Krings, Heinrich Rombach u. a., Freiburg/München 1984, S. 1 – 15. Hier betont er, dass Hegels Subjektivitätstheorie zuerst im Zusammenhang mit seinem gesamten System verstanden werden muss. Denn sie selbst skizziert die Negation der selbstsüchtigen Einzelheit und den ontogenetischen Aufstieg zur intersubjektiven Ordnung, in Hegels Wort, zum absoluten Geist. Im Anschluss an die subjektphilosophische Formel des Selbstbewusstseins, dass das Bewusstsein sich seiner selbst bewusst ist, liegt Hegels Einsicht darin, dass das Ich von etwas als Meinigem weiß, und dass das Ich darin von mir weiß. Hierbei ist Hegels Grundüberlegung bereits vorausgesetzt, dass das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein ein und dasselbe sind. Solche gelungene Gleichwertigkeit zwischen dem Bewusstsein und dem Selbstbewusstsein garantiert von nun an die reflexive Selbstdurchsichtigkeit und die Selbstumsetzung in Freiheit. Aber wir können den reflexionsphilosophischen Denkzug der Selbstbestimmung des Subjekts vor allem in Fichtes Subjektivitätsphilosophie finden. Es kann hier zuerst gezeigt werden, dass Fichtes Konzept für das philosophische Ich–Bewusstsein von der Frage, wie das Selbstbewusstsein ohne die unendliche Iteration gedacht werden kann, ausgeht, während seine Vorgänger sie aus den Augen verloren haben, weil solche Theoretiker nur die prinzipielle Begründungsfunktion im Selbstbewusstsein betrachten. Fichtes Erwägung dieser Frage weist darauf hin, dass das Bewusstsein von ‚Ich’ von vornherein die reine Tätigkeit sei, die im Prinzip von der Zirkularität des subjektiven Reflexionsaktes abgetrennt ist. Dass das Ich von vornherein tätig ist, heißt bei Fichte, dass von „Ich“ immer gesprochen wird, wenn ich in einem Sprachakt „ich bin“ sage. Von daher lässt sich sagen, dass von „Ich“ dort immer vorher gesprochen wird, wo das Ich zu sich selbst „ich“ sagt. Das Ich–Sagen zeigt von nun an einen gleichzeitigen Akt von dem Wissenden und dem Gewussten. Denn „ich bin“ ist ohne das Ich–Bewusstsein nicht sagbar, aber das gewusste Ich–Sagen ist dennoch ohne die Vorbedingung des Ich–Seienden unmöglich. Unter seiner Einsicht in solche gleichzeitige Tätigkeit zwischen dem Ursprünglichen und dem Abgeleiteten hat Fichte versucht, die Zirkelstruktur der Präposition, dass das Ich sich auf sich selbst reflektierend besinnen soll, in die Ich–Identität seiner Releta umzusetzen. Zu Fichtes Selbstbewusstseinstheorie, vgl., Dieter Henrich, „Fichtes ursprüngliche Einsicht“, in: Subjektivität und Metaphysik – Festschrift für Wolfgang Cramer, hrsg. v. D. Henrich und Hans Wagner, Frankfurt a. M. 1966, S. 188 – 232. Gleichwohl ist im Auge zu behalten, dass Fichte die spekulative Deduktion des Ich–Bewusstseins, auf deren Sphäre das „Sich–Setzen“ als die sich selbst bestimmende Tätigkeit stets zur vollendeten Zurückführung auf die ursprüngliche Ichheit tendiert, entwickelt. 7 Gadamers Hermeneutik hingegen lässt der vorreflexive Sinnhorizont sich ständig hinter dem Erfahrungsverfahren des verstehenden Subjekts entdecken, aber dennoch von uns nie ganz einholen. Unter Gadamers Perspektive auf Hegels Systemphilosophie werden wir zunächst auf Hegels Gedankengang eingehen. Vorweg ist hier festzuhalten, dass die Erfahrung des Bewusstseins bei Hegel die prozessuale, deshalb geschichtliche Selbstentfaltung aufzeigt, dass die Geschichtlichkeit der Erfahrung die Eingebundenheit in der Andersheit, nämlich die ständige Wechselbeziehung zwischen den beiden Bestandteilen einschließt, und dass der Weg der geschichtlichen Selbstausbildung des Bewusstseins zum Selbstbewusstsein sich deshalb als die wechselseitige Anerkennungsbeziehung, die den Anderen in seiner Andersheit beständig begleitet, erscheint. Damit bestätigt die Anerkennung der Angewiesenheit der Selbsterfahrung auf die unaufhebbare Andersheit bei Hegel die integrative Selbstumwandlung in „ein gegenseitiges Anerkennen, welches der absolute Geist ist“ 7 , nämlich in den zwischenmenschlichen Sinnhorizont. Aus diesem Grund besteht Gadamers Anliegen zur Aufnahme von Hegels Denken nicht darin, dass das Selbstbewusstsein in seiner ontogenetischen Erfahrungsgeschichte seine letzte Instanz geltend macht, sondern fokussiert auf die dialektische Wechselseitigkeit, in deren Dynamik das Spannungsverhältnis zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen nicht aufgehoben wird. Darüber hinaus ist im Blick zu behalten, dass die Erfahrungsgeschichte des Bewusstseins bei Hegel nicht nur die Selbstmodifikation, sondern auch den unendlichen Wandel des Gegenstandsfeldes, ja die Selbsthinführung zur anderen Erfahrungsstufe skizziert. Entlang dieser geschichtlichen Erfahrungsphasen wird der Anstoß zum Wirklichkeitsbezug vom Bewusstsein selber hergestellt, weil es mit jedem gelungenen Wissen zugleich seine Grenze markiert, sich auf die Eingeschränktheit der jetzigen Erfahrungslage besinnt. Da das Bewusstsein hierbei als dasjenige verstanden wird, das die Begrenztheit seiner Erfahrung innerlich bewusst macht, legt seine geschichtliche Selbsterfahrung einen ständigen Bezug auf den Anderen als seinen Anderen und damit zugleich eine unabschließbare Übertragung der Andersheit auf den eigenen Gesichtspunkt offen. Für unseren Zusammenhang genügt es hier vor allem darauf zu achten, dass der Übergangsmotor nicht die Aufwendigkeit der Gegenstandserkenntnis ist, sondern in dem Prozess der immanenten Selbstkritik und –besinnung verankert ist. Der Dialog stiftet den Sinnvollzugshorizont des „gegenseitigen Anerkennens“, weil er nicht nur aus dem ontologischen Einbezogensein auf die Begegnung mit dem Anderen besteht, sondern auch sich im ununterbrochenen Übersetzungsverhältnis befindet. Aus der 7 8 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Werke in 20 Bände, hrsg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 3, Frankfurt a. M. 1986, S. 493. Im folgenden abgekürzt: PhdG. hermeneutischen Sicht ist das menschliche Verstehen selber der dialogische Umgang mit seiner eigenen Welt. Angesichts dessen soll gezeigt werden, dass der Vollzug der wechselseitigen Anerkennung immer schon auf das dialogische Verstehen angewiesen ist. Gleichwohl ist der dialogische Sinnvollzug, der von allen Beteiligten selber verlangt wird und gestaltet werden muss, entsprechend dem geschichtlichen Situationswandel immer diskontinuierlich. Denn es gibt im Prinzip kein Ende des Dialogs: Jeder thematisierte Dialog schließt aufgrund seiner formalen Begrenztheit unabdingbar mit einem bestimmten Zeitpunkt ab. Ein jeweilig geschlossener Endpunkt des Dialogs verweist hier deshalb nicht auf die abgeschlossene Absolutheit, wo, wie bei Hegel, alles in eins verschlungen wird, sondern versichert sich des wiederholenden Anfangs des unthematisch verborgenen Sinnhorizontes. Von daher wird klar, dass der Dialog sich immer schon mit dem inneren Gespräch, das Gadamer so häufig betont hat, mitbewegt. Wenn der Dialog den unabgeschlossenen Austausch von der Vernehmung der Andersheit und der daraus folgenden Beantwortung darstellt, dann könnte man sagen, dass der Dialog von vornherein einen spekulativen Sinnhorizont bildet, in dem alle Beteiligten ihren Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit anerkennen und sich selbst in ihrer eigenen Andersheit erkennen. Der Dialog mithin leitet den inneren Rückgang auf sich selbst, der nicht an dem unhintergehbaren Ur–Ich orientiert ist, sondern die Selbstumsetzung in den inneren Dialog mit seinem eigenen Anderen erschließt. Infolgedessen lässt sich sagen, dass der Dialog, der seine Internalisierungsdynamik bereits einschließt, dessen Andersheit nicht entzieht, sondern stets begleitet. So trägt der Dialog, in dessen Sinnnetzwerk das Erkennen bzw. das Anerkennen sich vollzieht, die lebensweltliche Praxis, die auf eine ethische Grundlage verweist. Bevor wir uns Gadamers philosophischer Hermeneutik näher zuwenden, handelt der erste Teil vom Anerkennungsverhältnis in Hegels Philosophie, das von vornherein die ontologische Erfahrungsstruktur umfasst. Er geht in Anknüpfung an Gadamers Denkansatz zur hermeneutischen Erfahrung über, weil die Anerkennungsbewegung durch die Überwindung der selbstsüchtigen Ichheit hindurch den Aufstieg zum übersubjektiven Ordnungssystem bzw. zur anerkannten Freiheit, nämlich die Beziehung auf die Lebensganzheit bestätigt. Um die Anerkennungstheorie, die von Hegel in jeder Entwicklungsphase seines Denkens unterschiedlich konzipiert wird, sichtbar zu machen, werden wir hier zuerst seinen Gedankengang von der frühen Frankfurter Zeit über die Jenaer Realphilosophie bis zur Phänomenologie verfolgen. Von dieser Untersuchung erhoffe ich mir, dass wir verstehen können, wie Hegels eigene Philosophiekonzeption verschiedene Konzeptionsumwandlungsphasen durchläuft und welchen Stellenwert seine 9 Anerkennungstheorie überdies im geschichtlichen Wandel seines Denkens annimmt. Hegels Denkanliegen zum zwischenmenschlichen Bezug stellt sich nunmehr so unterschieden dar: 1. Liebesbeziehung als die ontologische Begegnung mit dem unmittelbaren Gegenüber in der Frankfurter Zeit, 2. Anerkennungsverhältnis als ein medialer Bezugspunkt zwischen den Betroffenen in der Jenaer Zeit, 3. Anerkennungsbewegung unter den Menschen und Verzeihung in Gottes Liebe unter der ontogenetischen Erfahrungsgeschichte in der Phänomenologie. Wenn wir deshalb Hegels verschiedene Anerkennungskonzeptionen aus Gadamers Sicht der ontologischen Erfahrung behandeln wollen, ist der Versuch, Hegels theoretische Entwürfe separat wiederherzustellen, sinnlos. Vielmehr geht es für unseren Zusammenhang darum, sie unter einer Entwicklungslinie verständlich zu machen. Dementsprechend müssten wir feststellen können, dass Hegels Anerkennungstheorie ihren eigenen Übergangsweg vom Liebesverhältnis als einer unmittelbaren Anerkennungsbeziehung über den Kampf um Anerkennung unter der Konfliktsituation zur wechselseitig anerkannten Versöhnung skizziert. Nur so wird schließlich gezeigt, dass die Anerkennungsbewegung selber die geschichtliche Selbsterfahrung des Bewusstseins ist, d. h. dass das Anerkennungsverhältnis als solches die ontologische Grundlage der Selbstausbildung des Bewusstseins ist. Im zweiten Teil geht es uns hauptsächlich um die Grundstruktur des hermeneutischen Verstehens. Aus der hermeneutischen Sicht ist die menschliche Erfahrung unabdingbar mit ihrer eigenen Geschichte verbunden: Die Erfahrung steht von vornherein im Horizont der Geschichtlichkeit. Von daher ist für uns entscheidend darauf zu achten, dass die menschliche Erfahrung bzw. das hermeneutische Verstehen im wesentlichen Sinne die Anerkennung der ontologischen Angewiesenheit auf die Andersheit ist. Da der Andere als der hermeneutische Gegenstand nunmehr auf die geschichtlich tradierte Überlieferung verweist, ist die Andersheit des Anderen für das hermeneutische Verstehen nicht mehr jenseits von uns, sondern sie ist der Andere für uns, nämlich unsere eigene Andersheit. Die Andersheit ist deshalb in der hermeneutischen Sicht zwar die ontologische Vorgegebenheit, aber sie lässt das Unerschöpfbare immer noch hinter sich, weil das geschichtlich Vorgegebene hier kein Unhinterfragbares mehr ist, auf das das hermeneutische Verstehen stets zu reduzieren sei, sondern den Motivationshorizont etabliert, von dem das Verstehen immer schon ausgeht und in den es bereits hineingeworfen ist. So steht das hermeneutische Verstehen zwischen dem geschichtlich Tradierten und unserer Gegenwärtigkeit, d. h. es liegt im Gespräch zwischen uns und unserem Anderen. Dieses dialogische Zwischen zeigt sich deshalb als die Grundstruktur der hermeneutischen Erfahrung des menschlichen Daseins. Da das Zwischen 10 selber die unabschließbare Bewegung und die Andersheit in diesem dialogischen Zwischen mitkonstitutiv ist, blicken wir mit Bezug auf unseren Anderen ständig zu demjenigen hinüber, was vor uns geschehen ist. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Gadamerschen Dialogik, die von Anbeginn einen ethischen Anspruch untermauert. Insbesondere handelt es sich hier um den Dialog und die ethische Implikation, die nicht vom deduktiven Prinzip hergestellt, sondern dem Dialogvorgang selber immanent ist. Sobald wir uns der ethischen Grundlage im dialogischen Wechselverhältnis von Sprechen und Hören näher zuwenden, werden wir sehen, dass ihm der ethische Impuls im Gespräch mit dem Anderen bereits zugrunde liegt, weil Sprechen notwendig „etwas“ mitteilt, und damit stets auf den Anderen gerichtet ist. Um den Anderen verständlich zu machen und zu verstehen, sollen wir allererst den Anderen erreichen und ihm zuhören. Hieraus folgt dialogethisch die verantwortungsbewusste Haltung aller Dialogteilnehmer; einerseits das Ernstnehmen der Andersheit, andererseits die Pflicht zur Beantwortung: Verantwortlichkeit also. Was wir sagen können, dies ist von unserer Andersheit vorweg bestimmt, weil das Sprechen selber nicht nur auf den Anderen gerichtet ist, sondern auch auf den geschichtlich tradierten Sprachhorizont angewiesen ist. Es kommt deshalb von nun an in den Blick, dass ein dialogischer Austausch von Sprechen und Hören von vornherein dem menschlichen Sozialisierungsprozess zugehört, dass das miteinanderSprechen-Können selber bereits auf das Zugehörigsein zu einem Sprachkreis verweist, in den wir seit je her hineingeboren sind. Die ethische Aufgabe, die allen Beteiligten gegeben wird, kann mithin nur durch die angemessene Haltung innerhalb der Handlungsrahmenbedingungen und durch das praktische Wissen um die sich ständig verändernde Dialogsituation erfüllt werden. Im Anschluss an Gadamers Einsicht werden wir auch sehen, dass die hermeneutische Angemessenheit in jeder Dialogsituation immer schon von der Sprache selber erschlossen ist, weil die Sache für uns nur vermittels der Sprache zu Worte kommt. Im Sinne von: „Kein ding sei wo das wort gebricht.“ 8 Dass wir existenziell endlich sind, dies bestätigt die offenkundige Tatsache, dass es für uns kein Letztes gibt. Aber trotzdem lässt die Besinnung auf unsere existenzielle Endlichkeit uns in den offenen Sinnraum der unendlichen Suche nach der Wahrheit eintreten. Und das Selbsteintreten in den gemeinsamen Sinnhorizont, wo der Sinngehalt, den die Welt uns verleiht, sich zeigt, lässt uns auch unsere Existenz befragen, uns für unsere unaufhebbare 8 Stefan George, „DAS WORT“, in: Gedichte, hrsg. v. Ernst Osterkamp, Frankfurt a. M./Leipzig 2005, S. 221. Heidegger hat den letzten Vers dieses Gedichtes unter seiner eigenen Auffassung verstanden. So sagt er: „Es gebricht heißt: es fehlt. Kein Ding ist, wo das Wort fehlt, nämlich das Wort, das jeweils das Ding nennt.“ Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, 13. Aufl., Stuttgart 2003, S. 163. Daran anschließend können wir sagen: Das Wort allein nimmt das Ding als Ding an, d. h. das Wort lässt das Ding existieren. 11 Andersheit offen halten. Das Bewusstsein der ontologischen Endlichkeit eröffnet die endlose Seinsmöglichkeit, die wir suchen. 12 Erster Teil: Hegel–Repräsentation in Gadamers philosophischer Hermeneutik „Wir müssen endlich wieder lernen, wie man ein richtiges Gespräch führt. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe für die Philosophie. Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.“ 1 „Wenn wir als Aufgabe erkennen, mehr Hegel als Schleiermacher zu folgen, muß die Geschichte der Hermeneutik ganz neu akzentuiert werden.“ 2 Mit seiner Berufung auf und Aktualisierung von Hegels Philosophie, insbesondere der Geschichtlichkeit der Erfahrung des Bewussteins in Bezug auf den Bildungsanspruch innerhalb der Tradition der Philosophie des geschichtlich–hermeneutischen Denkens, setzt der zweite Teil von Gadamers Hauptwerk Wahrheit und Methode hauptsächlich dort an, wo die ontologische Grundlage der hermeneutischen Erfahrung im menschlichen Verstehen behandelt wird. Wenn wir zunächst von Schleiermachers „allgemeiner Hermeneutik“ ausgehen, werden wir sehen, dass er sich mit der Sprachproblematik als der Grundvoraussetzung für die Hermeneutik beschäftigt hat. Somit kann man sagen, dass es Schleiermacher ist, der den spezifischen, produktiven Charakter der Sprache im Auslegungsprozess herausgefunden hat. Im Anschluss an diesen Denkansatz glaubte er auch, „die universellen Regulativitäten“ in der Hermeneutik formal aufstellen zu können, „die die praktische Auslegungsarbeit steuern“ sollten. 3 Mit dieser epistemologischen Aufforderung zu einem Kanon der Interpretation lässt die Sprache sich bei ihm anhand ihrer zwei Seiten betrachten: Die eine Seite bezieht sich auf den „Universalitätsanspruch“, in dem das Sprachfeld der Hermeneutik als eine Art „letzte Instanz“ der Interpretation bezeichnet wird. Somit wären alle Sprachäußerungen nach Schleiermacher auf die vorgegebene Syntax oder den kodifizierten Sprachgebrauch reduzierbar. Das bedeutet: Der Sprachausdruck entspricht bereits den gemeinsamen Regeln in der Kommunikationsgesellschaft, weshalb man die totale Verständigung in Bezug auf die Weltanschauung als eine überindividuelle Dimension potenziell erreichen kann. Eine solche sprachliche Universalität im Interpretationsgang hat Schleiermacher als „die grammatische 1 Hans–Georg Gadamer, „Über Chancen und Grenzen der Philosophie“, in: Spiegel, Nr. 8, 21. 02. 2000, S. 305. Ders., Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, GW 1, Tübingen 1999, S. 177. Gadamers Schriften werden unter der Sigle GW mit der Angabe von Band– und Seitenzahl zitiert. 3 Manfred Frank, „Einleitung“, in: F. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, hrsg. v. M. Frank, Frankfurt a. M. 1977, S. 9. 2 13 Interpretation“ bezeichnet. Hier stellt sich die Sprache auch als „ein individuelles Allgemeines“ dar. 4 Hieran schließt die Tatsache an, dass die Sprache freilich die individuelle Innerlichkeit zum Ausdruck bringt, während die grammatische Interpretation, die die reguläre Allgemeinheit der Sprache bereits impliziert, in einem universellen System des prinzipiellen Sprachgebrauchs verwurzelt ist. Von daher soll und kann ein kongenialer Interpret, Schleiermachers Ansicht zufolge, das Innere, nämlich die Seele des Sprechers oder Autors, mit der Sprache verstehen und auslegen. Mit dieser zweiten Seite, die bei ihm als „die psychologische Interpretation“ 5 bezeichnet wird, ist gemeint, dass der Interpret mit dieser künstlichen Methode die individuelle Besonderheit, die ein Autor durch den Gebrauch seiner eigenen Sprache zum Ausdruck bringt, herausarbeiten und das der Sprache innewohnende Urkonzept eines Textes nachkonstruieren können soll. Dementsprechend kann Schleiermacher mithin von einem „Besserverstehen“ im Vergleich zum Urheber sprechen. In diesem Zusammenhang erhebt Gadamer den Einwand gegen Schleiermachers reproduktive Reduktion der Textinterpretation auf den Urheber, nämlich die subjektive Seite 6 , indem er schreibt, dass der Interpret „die Texte unabhängig von ihrem Wahrheitsanspruch als reine Ausdrucksphänomene“ betrachten muss. (GW. 1, S. 200) Damit sieht Gadamer zugleich die übergeschichtliche Universalität in Schleiermachers Hermeneutik. Über Schleiermachers Anspruch auf die Universalität im hermeneutischen Verstehen schreibt Gadamer auch: „Das ist Schleiermachers Schranke, bei der die historische Weltanschauung nicht stehen bleiben konnte.“ (GW. 1, S. 201) Mit diesem kritischen Einwand gegen Schleiermachers „allgemeine Hermeneutik“ wird deutlich, dass Gadamers philosophische Hermeneutik von der Geschichtlichkeit der Erfahrung des Bewusstseins in Hegels Philosophie, vor allem in der Phänomenologie des Geistes, als der grundlegenden Integrationsstruktur im menschlichen Verstehen ausgeht, da sich Hegels Begriff des Geistes aus Gadamers Perspektive grundsätzlich auf die „denkende Vermittlung mit dem gegenwärtigen Leben“ in seiner geschichtlichen Entwicklung stützt. (GW. 1, S. 174) In diesem Zusammenhang ist die „dialektische Bewegung“ bei Hegel, in deren Prozess das Bewusstsein durch „den Weg der Verzweiflung“ hindurch zum Selbst gelangt, „eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird.“ (PhdG., S. 72 u. 78) Durch den Prozess der Selbstkorrektur und der Selbstüberprüfung 4 Ebd., S. 38. Vgl. Ebd., S. 39 – 57. 6 Vgl. Karl–Otto Apel, Transformation der Philosophie, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1976, S. 199. Hier hat er Schleiermachers Theorie über die Interpretation, das Verstehen, dahingehend verstanden, dass sie mit dem Vorwurf gegen die isolierte Subjektivität, wie Hegels Kant–Kritik, konfrontiert wird, weil sie „die Einheit und Evidenz eines methodisch solipsistisch konzipierten Gegenstandes – bzw. Selbstbewußtseins“ zu erarbeiten trachtet. 5 14 hindurch, gelangt das Bewusstsein zu einem Sinnhorizont, der das Leben in seiner Ganzheit begreift. Vor diesem Sinnhorizont – um diesen Horizont zu erreichen, sollte das Bewusstsein die Enttäuschung und das Leiden auf allen Stufen der Erfahrung ertragen haben – findet das Bewusstsein seine lebendige Ganzheit, die alle Gegensätze in sich vereint und von sich aus überwunden hat. Somit kann hier gezeigt werden, dass Hegels dialektische Bewegung in der ontogenetischen Entstehungsgeschichte der Erfahrung des Bewusstseins „ein Geschehen der ständigen Horizonterweiterung“ ist, „welche dadurch zustande kommt, daß das Bewußtsein seine Horizonte stets aufs neue thematisiert.“ 7 Gadamer begreift dabei Hegels Substantialität des Geistes als die geschichtliche Vorgegebenheit, die als ontologische Grundlage für die Erfahrung des Bewusstseins, besser gesagt des Subjektes, fungiert, da wir auf unserer Suche nach der Wahrheit einen phänomenalen Ort in der Geschichte, an der wir teilnehmen oder mit der wir schon immer verbunden waren, finden könnten. Gadamers Äußerung zufolge „habe sie (= die Aufgabe der philosophischen Hermeneutik, KBL) den Weg der Hegelschen Phänomenologie des Geistes insoweit zurückzugehen, als man in aller Subjektivität die sie bestimmende Substanzialität aufweist.“ (GW. 1, S. 307) Obwohl Gadamer innerhalb der hermeneutischen Denktradition die Geschichtlichkeit der Erfahrung des Bewusstseins in Hegels Philosophie mit Recht aktualisiert hat, setzt er sich auch von der „totalen Selbstvermittlung der Vernunft“ in Hegels Dialektik der Reflexion kritisch ab. 8 (GW. 1. S. 351) Die Erfahrung des Bewusstseins zielt bei Hegel auf das Bewusstsein von sich selbst durch die dialektische Bewegung der zu sich selbst kommenden Reflexion ab. Diese Bewegung führt sich selbst schließlich zu einem Ende, an dem die abgeschlossene Absolutheit vollzogen ist und mit der zugleich das vollendete „Sichwissen“ gelungen ist. (GW. 1, S. 307) Alle Stufen, die das Bewusstsein im gangbaren 7 8 Michael Theunissen, „Begriff und Realität“, in: Seminar: Dialektik in der Philosophie Hegels, hrsg. v. Rolf– Peter Horstmann, Frankfurt a. M. 1978, S. 327. Dennoch stellt sich für uns die Frage, ob die Horizontverschmelzung im Sinne von Gadamers philosophischer Hermeneutik als die „Horizontverschiebung“ verstanden werden muss oder ob sie auch als „Horizonterweiterung“ verstanden werden kann. Wenn man die Horizontverschmelzung unter der Horizonterweiterung versteht, könnte von der Entfaltung der Horizonte unserer Erfahrung oder vom sich selbst entwickelnden Besserverstehen in Bezug auf die Erfahrung des Bewusstseins in Hegels Philosophie die Rede sein. Gleichwohl, Jean Grondins Bericht zufolge, spricht Gadamer in einem Brief nicht „von der Erweiterung“, sondern „von der Verschiebung“. Diesbezüglich: Jean Grondin, Hermeneutische Wahrheit ?. Zum Wahrheitsbegriff Hans–Georg Gadamers, Weinheim 1994, S. 159 – 160. Die Formulierung „Horizontverschiebung“ sei im Sinne Gadamers vor allem als kritische Gegenposition gegen den dogmatischen Glauben an den grenzenlosen Fortschritt in der Aufklärungszeit zu verstehen. Vgl. zum Verhältnis von Gadamers philosophischer Hermeneutik und Hegels Dialektik. Karl–Otto Apel, „Reflexion und Materielle Praxis. Zur erkenntnisanthropologischen Begründung der Dialektik zwischen Hegel und Marx“, in: Hegel – Studien/Beiheft 1, hrsg. v. Hans–Georg Gadamer, Bonn 1984, (2. Aufl.), S. 151 – 166 und dazu ders., Hans–Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“, in: Hegel–Studien, Bd. 2, hrsg. v. Friedhelm Nicolin u. Otto Pöggeler, Bonn 1963, S. 314 – 322 und Wolfhart Pannenberg, „Hermeneutik und Universalgeschichte“, in: Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften, hrsg. v. Hans–Georg Gadamer u. Gottfried Boehm, Frankfurt a. M. 1978, S. 283 – 319. 15 Prozess der Erfahrung bzw. im Reflexionsverhältnis zu sich selbst durchlaufen soll, sind schließlich bei Hegel unter dem absoluten Wissen subsumiert, das, wie Hegel selber in der Phänomenologie geschrieben hat, „der sich als Geist wissende Geist“ sei. Alle Stufen der dialektischen Bewegung werden schließlich, an der Endstation des absoluten Wissens angelangt, lediglich zur „Schädelstätte des absoluten Geistes“, obwohl das Bewusstsein seinen adäquaten Gegenstand in allen Stufen des gängigen Prozesses konstruiert und durch die Erkenntnis von der Unvollständigkeit dieser Konstruktion zu etwas anderem übergeht. Die Gesamtheit dieser Bewegung bei Hegel ist die Absolutheit des Sichwissens. (PhdG., S. 591) Aus dieser Bewegung der sich reflektierenden Hinführung zum absoluten Wissen um sich selbst resultiert das asymmetrische Verhältnis in Hegels abgeschlossener Systemphilosophie auf zweierlei Seiten: Einerseits das Verhältnis des subjektiven Bewusstseins zum absoluten Geist, andererseits das des Individuums als eines Mitglieds der Gesellschaft zum Staat. 9 Gadamer betont zu Recht, dass Hegels Dialektik, die die Absolutheit des Sichwissens vollendet vollbracht hat, die „Erfahrung der menschlichen Endlichkeit“, nämlich die unüberwindbare Grenze unserer Erfahrung, übersehen und übersprungen hat. (GW. 1, S. 363) Gadamers Ansicht zufolge befindet sich die menschliche Erfahrung immer schon von vornherein im Wissen um unsere Endlichkeit, weshalb „nicht die Erfahrung zu Ende und eine höhere Gestalt des Wissens erreicht (Hegel), sondern in ihr (= die Idee einer vollendeten Erfahrung, KBL) ist Erfahrung erst ganz und eigentlich da.“ (Ebd.) Das Bewusstsein von unserer Endlichkeit und der unerreichbaren Vollkommenheit in unserer Erfahrung dürfen wir ihm zufolge nicht für mangelhaft halten, sondern wir müssen diese Unvollkommenheit und diese Endlichkeit als das „Wesen des geschichtlichen Seins, das wir sind“ bedingungslos annehmen. (GW. 1, S. 307) In diesem Sinne ist das hermeneutische Verstehen nicht die restlose Reflexionsbewegung, wie Hegel gedacht hat, sondern lässt immer etwas hinter sich, enthält nämlich immer das noch zu Verstehende in sich. Deshalb geht es bei Gadamer um die hermeneutische Offenheit für die potenzielle Zukunft in der kritischen Auseinandersetzung der gegenwärtigen Erfahrung mit der vergangenen Vorgegebenheit. Aus diesem Grund ist „im Gespräch sein“ Gadamers Ansicht zufolge, ein realer Ort der Offenhaltung unserer ontologischen Erfahrung für die Zukunft, weil unser Gespräch grundsätzlich die Anerkennung des Gesprächspartners, nämlich den Anspruch auf die Berücksichtigung der Eigentümlichkeit des Anderen, impliziert, ohne die Andersheit des Partners zu verletzen und wir als die 9 Vgl. zur ausführlichen Darlegung der Asymmetrie in Hegels Philosophie: Ludwig Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg/München 1979, S. 278 – 285. 16 Teilnehmer am Gespräch im Verlauf des Gesprächs erleben, dass das endgültig letzte Wort keineswegs gefunden werden kann. Die zweite Berufung Gadamers philosophischer Hermeneutik auf Hegels Philosophie ist die Anerkennungstheorie, die dem Gesprächsverhältnis in Gadamers Dialoghermeneutik strukturell zugrunde liegt. Hegel legt die Basis für ein intersubjektives Anerkennungsverhältnis, in dem die Verständigung aus dem Ich–Du–Verhältnis heraus in die freiwillige Integration des Ichs in die Gesellschaft im Ich–Wir–Verhältnis münden soll. In dieser gegenseitigen Anerkennungsbewegung erfüllt der Betroffene den eigenen Bildungsanspruch dadurch, dass das Sich–Finden durch die Anerkennung des Anderen zustande kommt und damit zugleich die gegenseitig anerkennende Selbstbeschränkung eingelöst wird. Die Erfahrung der Anerkennung lässt sich bei Hegel nunmehr auf zweifache Weise betrachten: Erstens als Liebesbeziehung und zweitens als Kampf um Anerkennung. Der Liebesbeziehung mißt Gadamer dabei jedoch die wichtigere Bedeutung zu, da sie als „das unmittelbare Verhältnis von Mann und Frau“ das musterhafte Exemplar der zwischenmenschlichen Wechselbeziehung zum Ausdruck bringt, während der Kampf um Anerkennung aus der symmetrischen Beziehung zwischen den Beteiligten unweigerlich eine ungleiche macht. (GW. 1, S. 349) Daran anschließend stützt sich der gangbare Prozess des hermeneutischen Verstehens im Gesprächsverhältnis Gadamers Ansicht zufolge auf die Freundschaft und die Solidarität, die im Grunde aus der Anerkennung des Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit und auf der Seite der Geschichtlichkeit der menschlichen Erfahrung aus der Anerkennung der geschichtlichen Vorgegebenheit entsteht, mit der wir immer schon verknüpft sind. An dieser Stelle richtet Gadamer seinen Blick auf die Hegelsche Anerkennungstheorie, indem er sich auf die ontologische Erfahrung des hermeneutischen Verstehens im Gesprächsprozess bezieht, deren Ziel es ist, die Position des Anderen zu verstehen und das Recht des Anderen anzuerkennen. In einem solchen Prozeß des Sich– Hineinversetzens würde man nicht nur die Position des Anderen verstehen, sondern auch sich selbst. Aufgrund der ontologischen Erfahrung des sich–hineinversetzenden Verstehens im Gespräch zieht Gadamer auch die Möglichkeit in Betracht, „dass der andere Recht haben könnte“, die wiederum eine unmittelbare Anerkennung erfordern würde. Im Anschluss an diese ontologische Erfahrung der wechselseitigen Verständigung im Gespräch, die die Zugehörigkeit des Ichs zum Du und des Ichs zum Wir konstituiert, bezieht Gadamer den substanziellen Wahrheitsbegriff auf die Sprache. Mehr noch als das, ist es die unendliche Suche nach Wahrheit bzw. der die Wahrheit tragenden Sprache, die mit ihrer eigenen Geschichtlichkeit verbunden ist, die er in das hermeneutische Verstehen integrieren will, 17 während die Anerkennungsbewegung bei Hegel auf den teleologischen Endzweck hinausläuft. Dabei muß man jedoch betonen, dass diese kritische Einschätzung aus der Überbewertung des Kampfs um Anerkennung in Hegels Phänomenologie entsteht und prinzipiell nur der Reflexivität entspricht, die der Hegelsche Begriff der Erfahrung enthält. In diesem Zusammenhang sagt Gadamer, dass er aufgrund des hermeneutischen Verstehens im Dialog, nämlich der gegenseitigen Verständigung im unendlichen Prozess der Suche nach Wahrheit und Übereinstimmung, „zum Anwalt der >schlechten Unendlichkeit<“ 10 bei Hegel wurde. Um den Einfluß Hegels auf Gadamers philosophische Hermeneutik deutlich zu machen, werde ich im ersten Teil meiner Arbeit, wie bereits erwähnt, auf zwei Bereiche eingehen, in denen sich Gadamer in seiner Hermeneutik auf Hegels Philosophie bezieht: Einerseits die ontologische Grundlage in der ontogenetischen Entstehungsgeschichte der Erfahrung des Bewusstseins, andererseits die Anerkennungsbewegung, die von vornherein den geschichtlichen Bildungsprozess, der die ontologische Erfahrung voraussetzt, mit einschließt. Gadamer hat sich in einigen seiner Aufsätze und zum Teil auch in seinem Hauptwerk Wahrheit und Methode mit diesen beiden Seiten der Hegelschen Philosophie beschäftigt. In dieser Auseinandersetzung hat Gadamer sich auch mit den Jugendschriften Hegels und der Phänomenologie des Geistes beschäftigt. Vor diesem Hintergrund sieht er die zentrale Aussage der Hegelschen Dialektik in der Geschichtlichkeit der Erfahrung, die auf der Grundlage der Ontologie beruht. In Bezug darauf möchte ich die folgenden Fragen formulieren: Inwiefern ist die Philosophie Hegels innerhalb des Diskussionsrahmens von Gadamers philosophischer Hermeneutik immer noch aktuell? Welchen Stellenwert nimmt Hegels Philosophie in Gadamers philosophischer Hermeneutik ein? Oder anders formuliert: Inwieweit lassen sich die ontologischen Grundzüge der menschlichen Erfahrung in der Hegelschen Entstehungsgeschichte des Selbstbewusstseins nachzeichnen? Welchen Einfluß hat Hegels Anerkennungstheorie auf Gadamers Dialoghermeneutik? Und schließlich: Wie kommt es zur Entstehung eines lebendigen Sinnhorizontes aus der Verschmelzung zwischen den einzelnen Teil-Horizonten? 10 Hans–Georg Gadamer, „Das Erbe Hegels“, in: Das Erbe Hegels. Zwei Reden aus Anlaß der Verleihung des Hegel – Preises 1979 der Stadt Stuttgart an Hans –Georg Gadamer am 13. Juni 1979, Frankfurt a. M. 1979, S. 39. 18 I. Die Bedeutung der ontologischen Erfahrung vor dem Hintergrund der Ontogenese des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie des Geistes I - 1. Wohin soll das Bewusstsein führen? - Das Ziel der dialektischen Darstellung Hegels Idee der Phänomenologie des Geistes können wir zunächst als einen dynamischen Prozess bezeichnen, durch den hindurch der Gegensatz zwischen dem absolut Wahren als dem „an-sich-sein“ und dem davon isolierten Subjekt aufgelöst wird. Vor diesem Hintergrund sieht Hegel die Aufgabe der zeitgenössischen Philosophie darin, dass sie „das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist“, leisten können muß. Diese Aufgabe der Phänomenologie, deren Ziel das vollständige Erkennen des Wahren ist, gelangt damit gleichzeitig zum Ergebnis, dass das Bewusstsein sich selbst zum Gegenstand hat und somit die Wahrheit in sich selbst finden kann: Auf diesem Weg kann die Ebene „absoluten Wissens“ erreicht werden und wird so in den Stand der Wissenschaft erhoben. Das absolute Wissen, das bei Hegel als „Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins“ zum Ziel der Phänomenologie wird, ist am Ende der Darstellung Bewusstsein vom Selbst. Mit anderen Worten: Das absolute Wissen ist nun das sich auf sich beziehende Bewusstsein, nämlich ein Ich, das sich zum allgemeinen Bewusstsein erhebt. Das bedeutet, einen Weg zu beschreiten, auf dem das Ich durch den Unterschied in sich selbst überhaupt erst zum Selbst gelangt und somit die absolute Versöhnung mit dem eigenen Ich erreicht. Die Vergegenständlichung des eigenen Selbst und die damit in Zusammenhang stehende Erkenntnis des eigenen Bewusstseins als die Gestalt des absoluten Wissens kann Hegel zufolge somit auch aus dem sich selbst erkennenden Bewusstseinsmodell heraus als das „einheimische Reich der Wahrheit“ bezeichnet werden. (PhdG., S. 138) Das Selbstbewusstsein verfügt bereits über das Bild des Absoluten in sich, weil es von außen zum inneren Selbst zurückkehrt und somit eine unendliche Bandbreite an Variationen in Bezug darauf, wie das Selbst das Andere erfährt und das Allgemeine anerkennt, in sich vereint. An dieser Stelle begnüge ich mich mit dieser kurzen Skizze, da die Erfahrungsgeschichte der Wechselbeziehung des Bewusstseins des Selbst später näher diskutieren werden wird. Bezüglich der Erfahrungsgeschichte des Bewusstseins werden wir zunächst der „Einleitung“ der Phänomenologie unsere Aufmerksamkeit schenken, stellt Hegel doch das grundsätzliche Anliegen der Phänomenologie hier dar. Wie bekannt, beginnt Hegel seine Einleitung mit der Kritik am Kantischen Dualismus. Tatsächlich hat Hegel sich jedoch bereits mit Beginn seiner Jugendarbeiten mit der kritischen Philosophie Kants, der so genannten 19 Reflexionsphilosophie, kritisch auseinandergesetzt. 11 In Hegels Augen hat das erkennende Subjekt sich in der Kantischen Erkenntnistheorie vom Objekt dichotomisch distanziert. Die Dualismen Kants weisen nunmehr selbstverständlich darauf hin, dass die Sinne des Subjekts einerseits vom äußerlichen Objekt affiziert werden und der kategorialische Begriff andererseits vom Subjekt im aktiven Verstandesakt autonom konstruiert werden muss. Indem Kants epistemologische Frage sich dabei auf die Trennung zwischen „Spontaneität und Rezeptivität“ gründet, bringt einzig die Erkenntnis des Verstandes die formelle Konstruktion der Verbindung zwischen dem Erkenntnissubjekt und dem Erkenntnisobjekt hervor. Von ihr ist Hegels Perspektive zufolge der Inhalt abstrahiert, so dass das Ding „an–sich“, das bei Hegel das zu erkennende Wahre „an-sich“ ist, unkenntlich geworden ist. Hegel versucht in seiner Einleitung, das irreführende Verfahren der Kantischen Deduktion zu kritisieren und vor allem den Gegensatz zwischen dem Subjekt und dem Objekt zu überwinden. Diese Hegelsche Argumentation gegen die Kantische Abstraktion der formellen Kategorien von jeglichen Inhalten spielt für die gesamte Konzeption seiner Philosophie, insbesondere der Phänomenologie, eine große Rolle. Den epistemologischen Dualismus betreffend schreibt Hegel: „ [...] vorzüglich aber dies, daß das Absolute auf einer Seite stehe und das Erkennen auf der andern Seite für sich und getrennt von dem Absoluten doch etwas Reelles [...]“ (PhdG., S. 70) Dieser Äußerung Hegels zufolge hat der Kantische Dualismus eine nahezu unüberbrückbare Kluft zwischen der kategorialen Form und ihrem Gegenstand zu Beginn der Fragestellung nach „der Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis“ geschaffen. Durch diese unüberbrückbare Kluft gelangt die erkenntnistheoretische Grundfrage wiederum in den Vordergrund, die Hegel „das Werkzeug und das Mittel“ des Erkennens nannte. (PhdG., S. 68) Das Ziel der erkenntnistheoretischen Aufgabe, die sich selbst am Wissen des Wahren orientiert, führt dann unvermeidlich in die Irre, wenn das Erkennen bloß als Werkzeug und Mittel betrachtet wird. In diesem Fall benötigt das Erkennen einen von außen kommenden Maßstab, der darüber entscheidet, ob es wahr oder falsch ist. Um es noch deutlicher zu machen: Die irreführende Vorstellung, hierbei handele es sich nur um ein Werkzeug und 11 Vgl. Wolfgang Bonsiepen, Der Begriff der Negativität in den Jenaer Schriften Hegels, in: Hegel – Studien Beiheft 16, hrsg. v. Friedhelm Nicolin/ Otto Pöggeler, Bonn 1977, S.135. Es gibt hingegen auch eine andere Interpretation. Zu dieser Interpretation: Ludwig Siep, Der Weg der Phänomenologie des Geistes – Ein einführender Kommentar zu Hegels >>Differenzschrift<< und >>Phänomenologie des Geistes<<, Darmstadt 2000, S. 74. Er betont, dass Hegel sich mit der Kantischen Philosophie direkt in Bezug auf die Methode der Darstellung nicht auseinandersetzen wollte. Nach seiner Auffassung habe Hegel jedoch versucht, über den Dualismus vom Jakobinismus noch präziser zu debattieren. 20 Mittel des Erkennens, führt das erkennende Subjekt zur „Prüfung der Erkenntnis“ (PhdG., S. 69), ob das Werkzeug und das Mittel dem zu erkennenden „an-sich-sein“ gerecht wird. Bei dieser Prüfung stellt sich immer wieder die Frage nach dem Maßstab, der angelegt werden soll. Diese Schwierigkeit soll bei Hegel durch die entstehungsgeschichtliche Darstellungsmethode, bekanntlich die Dialektik, vermieden werden. Anders ausgedrückt: die Wissenschaft muss die Spur der Erscheinung des Bewusstseins nachzeichnen können, um den Gegensatz zwischen der zu prüfenden Position und dem angewendeten Maßstab ausräumen zu können, so dass wir einem erneuten Abgleiten in die unüberbrückbare Kluft der Dichotomie entgehen können. Denn die Wissenschaft selbst ist es, die bei Hegel im geschichtlichen Verlauf des sich selbst darstellenden Prozesses zum Vorschein kommt. Sie geht als eine absolute jedoch der Erscheinung stets voraus. Daher kann sie allein die sich negierende Darstellung des „erscheinenden Wissen[s]“ vollbringen. Diesen skeptischen Weg vom Erfahrenen zur neuen, weiteren Erfahrung betreffend, schreibt Gadamer: „Die Negativität der Erfahrung hat also einen eigentümlich produktiven Sinn, […] sondern er (= ein beliebig aufgelesener Gegenstand, KBL) muß so sein, daß man an ihm ein besseres Wissen nicht nur über ihn, sondern das, was man vorher zu wissen meinte, also über ein Allgemeines gewinnt.“ (GW. 1, S. 359) Die hermeneutische Erfahrung, die prinzipiell das Bewusstsein der Endlichkeit der menschlichen Erfahrung mit einschließt, hat daher denselben Charakter wie der Weg der Verzweiflung in Hegels Begriff der Erfahrung, der die prozessuale Geschichtlichkeit beinhaltet. Dementsprechend meint die menschliche Erfahrung im Prozess des hermeneutischen Verstehens einerseits die unendliche Veränderung des gegenständlichen Bereiches, die vom Erfahrenden erwartet wird, andererseits aber die Erweiterung des Horizontes des Erfahrenden selber durch das Scheitern der Erwartung. Aus diesem geschichtlichen Prozess heraus entsteht immer wieder die neue unerwartete Erfahrung und macht damit zugleich die gesamte Erfahrung unserer Lebensganzheit bzw. den ganzen Prozess unseres Lebens aus. Auf diese Weise wird das „sich-äußern“ des „erscheinenden Bewusstseins“ im Verlauf der Darstellung der Phänomenologie die Reihe seiner verschiedenen Gestalten durchlaufen. (PhdG., S. 73) Dieser Prozess ist damit auch die Ursache für die Dialektik als skeptischer Modus der „bestimmten Negation.“ (PhdG., S. 74) Seine Stufen vollends erfahrend, sich selbst und seine Gegenstände in jeder Phase verändernd, wird das erscheinende Bewusstsein zu seiner Endstation, nämlich dem „absoluten Wissen“, gelangen. Dass die Vollendung des Bewusstseins im Verlauf durch seine verschiedenen 21 Gestalten konsequent realisiert und vollzogen werden kann, ist der Grundgedanke der Phänomenologie. „Das natürliche Bewusstsein“ hält sich, Hegel zufolge, am Vorhandensein fest und weicht dem Neuen aus, weil es unfähig ist, seine eigene Wahrheit zu erkennen. Die Hinführung des natürlichen Bewusstseins zum absoluten Wissen stellt sich aus der Perspektive des Bewusstseins als Selbstnegation, d. h. als skeptischer Weg dar. Es muss aber diesen skeptischen Weg durchschreiten, um das wahre Selbst zu erreichen, das erst nach dieser leidvollen Erfahrung in den Blick kommen wird. Dies drückt Hegel folgendermaßen aus: „Er (= Der Weg, KBL) kann deswegen als der Weg des Zweifels angesehen werden oder eigentlicher als der Weg der Verzweiflung; […] ein gehöriges Wiederverschwinden des Zweifels und eine Rückkehr zu jener Wahrheit erfolgt, […]. Sondern er ist die bewußte Einsicht in die Unwahrheit des erscheinenden Wissens, dem dasjenige das Reellste ist, was in Wahrheit vielmehr nur der nicht realisierte Begriff ist.“ (PhdG., S. 72) Der skeptische Modus, gewissermaßen „der Weg der Verzweiflung“, weist nunmehr auf die „bestimmte Negation“ hin, bei der das natürliche Bewusstsein sein Wahres überprüft und sich selbst aufhebt. Dieser Verzweiflungsweg des Bewusstseins bezeichnet zunächst den Schritt zur Übereinstimmung mit dem wahren Selbst und führt daher zur Selbsterkenntnis. Dadurch, dass diese Selbstherausarbeitung des Bewusstseins als der selbsterkennende Prozess nicht eine verwüstete Selbstvernichtung bedeutet, sondern vielmehr seinen Wendepunkt zum Wahren darstellt, impliziert die Selbstnegation von vornherein die Bestimmtheit der Negation, ganz hegelianisch, „die Identität der Negativität mit sich“. 12 Nach Hegel ist dabei „eine neue Form gelungen und in der Negation der Übergang gemacht.“ (PhdG., S. 74) Das Bewusstsein 12 Vgl. Dieter Henrich, „Anfang und Methode der Logik“, in: ders., Hegel im Kontext, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 1971, S. 86ff. und dazu ders., „Formen der Negation in Hegels Logik“, in: Hegel-Jahrbuch 1974, Köln, S. 24ff. u. S. 253-254. In diesen beiden Interpretationen, besonders seinem Aufsatz „Formen der Negation“ versucht er, die Bedeutung der Negation in Hegels Logik durch die begriffliche Unterscheidung klar zu machen, da der Negationssinn als ein Konglomerat anzusehen sei. Seiner Ansicht zufolge müssen wir deswegen zuerst Hegels Begriff der Negation in den verschiedenen Negationstypen verstehen. Darüber hinaus betont er, dass Hegels Gedankengang durch die Kombinationen der Negation und der Negativität schrittweise die Vollständigkeit seines Systems gewonnen habe. Die „Bestimmtheit“ bezieht sich bei Hegel auf die Negation vom Anderen im Ablauf der inneren Differenz vom Anderen. Sie beinhaltet hier schon die erste Negation. Die erste Negation, die sich auf die Beziehung der Andersheit bezieht, verwandelt sich auch gleichzeitig in die Selbstbeziehung mit der Elimination der Andersheit des Anderen. Diese doppelte Negation verweist bei Hegel darauf, dass sich das Selbst auf das Andere in der Andersheit an sich wechselseitig bezieht und in diesem Verlauf zu sich selbst kommt. Die Negation der Negation hat es mit der Rückkehr zur Identität mit sich selbst, gewissermaßen mit der Affirmation der Verneinung zu tun. Die negative Rückkehr zu sich selbst ist auch als „Motor“ der Selbstverwirklichung des Geistes vorstellbar. 22 leistet mit dieser negierenden Negation die Selbstprüfung seiner Erfahrung, deren Reihenfolge die Vollständigkeit des Selbsterlebnisses bedeutet. Das Bewusstsein muss den Selbstverlust im unausweichlichen Übergang zur Selbsterkenntnis notwendigerweise erfahren. Eine solche unvollendete Selbsterkenntnis des Bewusstseins hat m. E. innerhalb der umfassenden Erfahrungsgeschichte die Bedeutung einer ontologischen Erfahrung. 13 Freilich müssen wir dann über den Hegelschen Lebensbegriff des Geistes nachdenken, weil die Spur des Bewusstseins auch aus der Perspektive der Selbstverwirklichung des Geistes heraus verfolgt wird. Sein Ziel ist der aufhebende Übergang des Bewusstseins und zugleich die Vereinigung mit dem Bewusstsein auf jeder Stufe der Selbstverwirklichung des Geistes. Wir sehen, dass die Darstellung der Selbstprüfung des Bewusstseins aus der Perspektive des Bewussten die Frage aufwirft, ob eine Erfahrung, bei der das Bewusstsein notwendigerweise unter dem Selbstverlust gelitten hat und zu sich selbst gekommen ist, wesentlich oder unwesentlich ist. Das erscheinende Bewusstsein macht eine Erfahrung, in der es zuerst das „an-sich-sein“ als den Gegenstand anschaut und dann versucht, das Gewusste in sich selbst zu überprüfen. Der dialektische Prozess der Selbstprüfung des Bewusstseins führt dazu, dass in der Wechselwirkung zwischen dem Bewusstsein und dem „an-sich-sein“ in Wahrheit eine ontologische Erfahrung enthalten ist, weil es sich um die Überprüfung handelt, ob der Inhalt des Wissens dem Gegenstand entspricht. In der Selbsterfahrung unterscheidet das Bewusstsein das Wesentliche vom Unwesentlichen und es gewinnt mit der Überwindung der Verzweiflung seine neue Gestalt. Dies führt nicht nur zu seiner eigenen Veränderung, sondern auch zur Veränderung seines Gegenstandes. Die Selbstüberprüfung des Bewusstseins, die die Selbsterfahrung korrigiert, verwandelt das alte Wissen auf der Grundlage der ontologischen Erfahrung in ein neues Wissen, in dem das alte sich bewährt und verändert hat. So gesehen agiert die Selbstprüfung nicht mit einem von außen kommenden Maßstab, sondern enthält vielmehr ihren Maßstab in sich selbst. In dem Maß, wie sich das Bewusstsein verändert, verändert sich auch der Maßstab. Der Maßstab wird im Prozeß der Annäherung des Bewusstseins an das wahre Wissen aus dem Bewusstsein selbst hergestellt. Im Transformationsprozeß transportiert es sich selbst auf die jeweils neue Stufe. Aus der Perspektive des Betrachters sehen wir diesem Übergang vom alten zum neuen zu, während 13 Vgl. Herbert Marcuse, Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit, Frankfurt a. M. 1932, S. 262 ff., dazu Ludwig Siep, „Die Bewegung des Anerkennens in der Phänomenologie des Geistes“, in: G. W. F. Hegel Phänomenologie des Geistes, hrsg. v. Dietmar Köhler/Otto Pöggeler, Berlin 1998, S. 108-109. Marcuse hat insbesondere die Erfahrungsgeschichte des Bewusstseins auf den ontologischen Aspekt hin ausführlich interpretiert. Nach ihm darf der Übergang vom Bewusstsein zum Geist bei Hegel nicht vor dem Hintergrund der erkenntnistheoretischen Position verstanden werden, da sich das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein als das Leben notwendig mit dem allgemeinen Ich, sozusagen dem Geist als der ontologischen Wesentlichkeit, verbinden. 23 dem das Bewusstsein seine prüfende Darstellungsabfolge vornimmt und sich selbst zur Selbsterkenntnis führt. Vom Standpunkt des Bewusstseins aus, sind „wir“ nur das „reine Zusehen“ (PhdG., S. 77), jedoch verhält sich die Prüfung des erscheinenden Bewussteins auch hier so, dass wir der vor uns entfalteten Erfahrung des Bewusstseins prüfend zuschauen, ob das „für-es-sein“ dem „an-sich-sein“ entspricht, also das Wissen dem Gegenstand gemäß ist. Demgegenüber werden wir im Verlauf des Wandels der Perspektive der Selbsterfahrung des Bewusstseins den Blickwinkel zu unserem eigenen Tun verändern müssen. Denn das Bewusstsein weiß selbst noch nichts von der Selbstentwicklung der Begriffe, obwohl es, sich selbst prüfend, das Unwesentliche in sich aufheben kann. Bei der notwendigen Anhebung des natürlichen Bewusstseins hin zur Wissenschaft, 14 sollen wir selber das Unwesentliche, das sich notwendigerweise aus der Bildung des Bewusstseins heraus ergibt, herausfiltern. Durch „das Weglassen“ unseres Zutuns können wir die Erscheinung des absoluten Wissens als solches erreichen. Mit unserem Zutun werden die Irreführung des Bewusstseins und unsere Einfälle korrigiert. Einzig mit unserem Zutun bringt das Absolute deshalb sein Wesen zur Erscheinung. 15 Dies Tun ist die Selbstverwirklichung des Geistes und es leitet, mit Hegels Worten, „die Umkehrung des Bewusstseins.“ (PhdG., S. 79) Durch dieses Tun wird die dialektische Darstellung garantiert und erreicht die Vollständigkeit der Erfahrung des Bewusstseins. Über die Idee der Darstellung der Phänomenologie bzw. die Vollständigkeit der Erfahrung des Bewusstseins, die durch die notwendige Anhebung des natürlichen Bewusstseins zur Wissenschaft erreicht wird, schreibt Hegel im folgenden Satz deutlich: „Indem es (= das Bewusstsein, KBL) zu seiner wahren Existenz sich forttreibt, wird es einen Punkt erreichen, auf welchen es seinen Schein ablegt, mit Fremdartigem, das nur für es und als ein Anderes ist, behaftet zu sein, oder wo die Erscheinung dem Wesen gleich wird, seine Darstellung hiermit mit eben diesem Punkt der eigentlichen Wissenschaft des Geistes zusammenfällt; und endlich, indem es selbst dies sein Wesen erfaßt, wird es die Natur des absoluten Wissens selbst bezeichnen.“ (PhdG., S. 80 – 81, meine Hervorhebung) 14 Vgl. zum Verhältnis der Phänomenologie, zur Logik in Hegels System, Heidegger, Holzwege, Frankfurt a. M. 1977, S. 181 und dazu Otto Pöggeler, Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes, Freiburg/München 1973, S. 212. Das absolute Wissen, das am Ende der Phänomenologie zur Wissenschaft gelangt, ist schon der Begriff, der sich in der Logik Hegels darstellt. Im Anschluss an die Logik kann man somit behaupten, dass Hegel die Phänomenologie des Geistes als die Einleitung ins System oder zumindest als die Voraussetzung der Logik konzipiert hat. Trotzdem ist es m. E. merkwürdig, dass man auch über die Entfernung der Phänomenologie vom späten Hegel diskutieren kann. Denn Hegel selbst bezeichnete die Logik später als „die Wissenschaft der Voraussetzung der Voraussetzungslosigkeit“. In der Logik bedürfen die Begriffe daher nicht mehr der Begründung, sondern setzen sich vielmehr selbst. Entsprechend bedarf die Logik nicht mehr der Vorbereitung, um den Begriff selbst zu erreichen. 15 Vgl. Martin Heidegger, Holzwege, S. 190ff. 24 Das Bewusstsein geht bei Hegel, wie oben schon dargelegt, durch alle Stufen seiner Erfahrung den Weg vom Unterschied zu sich selbst bis hin zur Rückkehr zu sich selbst, nämlich das Wissen um sich selbst, hindurch. Hegels dialektische Bewegung der Erfahrung des Bewusstseins bildet strukturell eine Bewegung des Kreises, wie Hegel selber häufig beschrieben hat, die immer von sich selbst ausgeht, zu sich selbst zurückkehrt und deshalb das abgeschlossene System genannt werden kann. Hinsichtlich der hermeneutischen Erfahrung hingegen sagt Gadamer, dass die Erfahrung „ihre eigene Vollendung nicht in einem abschließenden Wissen, sondern in jener Offenheit für Erfahrung, die durch die Erfahrung selbst freigespielt wird, hat.“ (GW. 1, S. 361) An dieser Stelle setzt sich Gadamer von Hegels Idee über die Teleologie der Erfahrung des Bewusstseins ab, die mit „einem Punkt“ bzw. dem absoluten Wissen abgeschlossen ist. Gadamers Äußerung zufolge zeichnet sich Hegels absolutes Wissen auch dadurch aus, „überhaupt kein Anderes, Fremdes mehr außer sich“ zu haben. (Ebd.) Bei dieser kritischen Distanzierung von Hegels absoluter Vollständigkeit der Erfahrung will Gadamer von der Endlichkeit der menschlichen Existenz aus das Wesen der hermeneutischen Erfahrung ableiten. Indem die hermeneutische Erfahrung sich immer auf das Bewusstsein der Endlichkeit der menschlichen Erfahrung bezieht, beinhaltet die prozessual geschichtliche Entfaltung der menschlichen Erfahrung im hermeneutischen Verstehen daher die Offenheit für eine weitere Erfahrung. Diese Offenheit für eine weitere Erfahrung bedeutet im Prinzip die Unvollständigkeit der menschlichen Erfahrung und somit, dass noch etwas übrig bleibt, das es zu verstehen gilt. Auf diese Weise weist die hermeneutische Erfahrung der Offenheit, nämlich der unerreichbaren Vollkommenheit, immer auf das Neue hin. 25 I - 2. Die Erfahrung des Bewusstseins: Der Verstand im relativen Verhältnis Wie bereits gezeigt wurde, führt die dialektische Darstellung der verzweifelnden Erfahrung des Bewusstseins auf seine durch es selbst vermittelte Selbsterkenntnis hin. In ihr erlebt es in jeder Phase der Erfahrung seinen Selbstverlust und findet zugleich das zu sich kommende Selbst als das Wahre wieder. In diesem Verlauf der Rückkehr zu sich selbst, bringt das Bewusstsein seine vielfältigen Facetten schließlich zu einer Einheit. Kurz gesagt: das Ziel der Erfahrung ist die Überwindung der Einseitigkeit und die Wiederherstellung des „bei-sichselbst-seins“. Die erste Etappe dieses Ganges kommt bei Hegel als das „Bewusstsein“ vor, in das die drei Bereiche, nämlich „die sinnliche Gewissheit“, „die Wahrnehmung und Kraft“ und „Verstand“ eingeschlossen sind. Das Bewusstsein kommt zum Selbstbewusstsein als dem Wahren als solchem erst nachdem es die erste Etappe durchlaufen hat, wobei alle drei Bereiche sich wechselseitig aufeinander beziehen. Um die Verborgenheit des wahren Selbst zu erhellen, soll das natürliche Bewusstsein von vornherein die Erfahrung des Leidens ertragen. Diesbezüglich will ich mich hier zunächst auf die Stufe des natürlichen Bewusstseins in Bezug auf die Idee der Phänomenologie konzentrieren, um den entstehungsgeschichtlichen Charakter der Erfahrung des Bewusstseins zu skizzieren. Im Anschluß daran werde ich die Entstehung und damit auch die Erfahrung des Selbstbewusstseins im Leben als der vorweggenommenen Gestalt des Geistes ausführen. Was die sinnliche Gewissheit betrifft, die die erste Gestalt des natürlichen Bewusstseins ausmacht, so handelt es sich bei ihr zunächst um das „Wissen des Unmittelbaren oder Seienden.“ (PhdG., S. 82) Das Bewusstsein fasst als die abstrakte Empfänglichkeit nur das reine Vorhandensein ins eigene Auge. Dementsprechend hält dieses empfängliche Bewusstsein daran fest, dass Dies für sich allein seine Wahrheit sei. Dennoch tritt diese Unmittelbarkeit als solche bloß als „die abstrakte und ärmste Wahrheit“ auf. (Ebd.) Anders formuliert, nimmt das Bewusstsein auf dieser Erfahrungsstufe das Etwas lediglich als das noch Unbestimmte aus dem Vorhandensein auf. Da unser gewöhnliches Bewusstsein sich jedoch dazu bringen läßt, die gegenwärtige Erfahrung im Alltag auszudrücken, spricht das empfängliche Bewusstsein, um seine jetzige Wahrheit zu benennen, den erfahrenen Inhalt gerade heraus aus. Wenn dieses Bewusstsein z. B. im Hinblick auf seine eigene Erfahrung sagt: „das Jetzt ist die Nacht“ oder „das Hier ist der Baum,“ muss es mit diesem Ausspruch zugleich beweisen, warum es sich in Bezug auf Zeit oder Raum genau so verhält. (PhdG., S. 84 u. S. 85) In diesem Sinn ist das Bewusstsein zeitlich diesem Jetzt-Sein oder räumlich diesem Hier-Sein unterworfen. Dadurch, dass das Bewusstsein jedoch aus dem 26 Vorhandensein das bestimmte Jetzt bzw. Hier auswählt und damit zugleich von dem spricht, von dem es weiß, dass es sich in dem Widerspruch befindet, der zwischen Bejahung und Verneinung in der Aussage liegt. Mit Hilfe des Aussagens und des Aufzeigens, dass das Jetzt die Nacht ist, werden wir das veränderte Jetzt erfahren können, was dann bedeutet, dass dieses Jetzt nicht die Nacht, sondern der Mittag ist. Die Aufforderung, unser Wissen in Worte zu fassen, führt dazu, dass die sinnliche Unmittelbarkeit die Täuschung über unser Wissen entlarvt. Das Bewusstsein erfasst, dass das ausgesagte und aufgezeigte Jetzt als solches nun die Wahrheit ist. Dies drückt Hegel aus, indem er sagt: „Das Aufzeigen ist das Erfahren, daß Jetzt allgemein ist.“ (PhdG., S. 89) Durch die sich selbst ausweisende Erfahrung in der sinnlichen Gewissheit weiß das Bewusstsein, dass seine Wahrheit nicht im ärmsten Sein der leeren Kopula liegt. Vielmehr ergibt sich das Wahre des Bewusstseins zum jeweiligen Zeitpunkt aus dem konkreten Prädikat, gewissermaßen den vielfältigen Eigenschaften. Die neue Bewusstseinsform, die aus dem widersprüchlichen Kulminationspunkt der sinnlichen Gewissheit entsteht, ist die Beobachtung des Dinges mit den Eigenschaften, das den Titel „die Wahrnehmung“ trägt. Das Bewusstsein, welches Hegel die Wahrnehmung nannte, konzentriert sich hier auf die innere Eigenschaft des Objekts. Es handelt sich deswegen bei ihm um das Allgemeine der vielfältigen Eigenschaften, das die Vielheit in die innere Einheit transportiert. Das Bewusstsein, das nun das Wahre benennen will, stellt die Frage nach dem zusammengefassten Allgemeinen, mit dem die Einheit des Dinges und ihre mannigfaltigen Eigenschaften verbunden sind. Dass dieses einfache Allgemeine als die beide „zusammenfassende Dingheit“ auftritt, drückt Hegel folgendermaßen aus: „Dies Salz ist einfaches Hier und zugleich vielfach; es ist weiß und auch scharf, auch kubisch gestaltet, auch von bestimmter Schwere usw.“ (PhdG., S. 95) Dieser Äußerung Hegels zufolge ist das „auch“ hier ein Medium, dass dieses Salz als ein selbständiges Ding mit dem wahrgenommenen Vielen in Verbindung bringt. Indem dieses „auch“ sich jedoch zugleich auf die Mannigfaltigkeit bezieht, erscheint es im wahrnehmenden Bewusstsein nicht nur als ein Ding, sondern auch als Gleichgültigkeit. Dementsprechend schließt ein einfaches „auch“, z. B. „auch scharf“, ein anderes „auch“ aus, weil jedes „auch“ als die Dingheit nunmehr auch ein „für-sich-sein“, nämlich ein Selbständiges ist. Anders gesagt, entspricht dieses „auch“ einem „nebeneinander-sein“, das in den Augen des Bewusstseins einerseits die Eigenschaft der Zugehörigkeit zu einem Ding und andererseits die einer Materie als solche hat. Es liegt auf der Hand, dass dieses Salz gar nicht weiß sein kann, 27 „insofern“ wir unser Augenmerk auf die Eigenschaft „scharf“ richten. (PhdG., S. 101) Dieses „insofern“ führt das wahrnehmende Bewusstsein zu einem Widerspruch in sich, da es von Anfang an das Anliegen des Bewusstseins war, mit seiner Wahrnehmung nach der allgemeinen Eigenschaft zu suchen. Nachdem das Bewusstsein nun diese Erfahrung gemacht hat, erscheinen ihm die verschiedenen Mannigfaltigkeiten nun eher als einfache allgemeine Einheit. Die neue Gestalt des Bewusstseins, die aus diesem Widerspruch und der Erkenntnis der Unerreichbarkeit entstanden ist, ist bei Hegel der Verstand. Der Verstand stellt die Frage nach der Auffassung des Begriffs, der die ausgeschlossenen Mannigfaltigkeiten in die notwendige Relation versetzt. Der Verstand, der sich aus der Täuschung des wahrnehmenden Bewusstseins ergibt, wendet seine Aufmerksamkeit der einfachen allgemeinen Innerlichkeit zu. Diese Innerlichkeit ist noch immer „die Einheit des für-sich-seins und des für-ein-anderes-seins“, die bei Hegel zuerst mit dem Kraftbegriff gefasst ist. (PhdG., S. 108) Denn nach der Einsicht des Verstandes macht die Kraft ein zusammengesetztes Ding aus oder zerlegt dieses Zusammengesetzte auseinander. Diese Erscheinung ergibt sich aus dem Wesen der Kraft als der einheitlichen Innerlichkeit, da die Kraft als solche beide extreme Gestalten aufweist. Diese Extreme sind im wesentlichen zum einen die sich entfaltende und zum anderen die verschwindende Kraft. Beim Zurückdrängen der Kraft in sich selbst, ist sie verschwunden. Bei der Entfaltung nach außen hingegen vereint die Kraft als Medium die vielen. (PhdG., S. 111) Demnach kann man sagen, dass die Erscheinung der Kraft im Prinzip als zwei verschiedene Kräfte zum Vorschein kommt. Mit Hilfe der „Erklärung“ des Gesetzes versucht der Verstand nunmehr, sich „das Spiel der Kräfte“ zu erschließen, indem die Kraft ihre „Äußerung und Zurückdrängung in-sich“ wechselseitig leistet. (PhdG., S. 115 u. S. 116, S. 125) Bei dem Versuch der Erklärung des Gesetzes ist der Verstand jedoch deshalb in einen Widerspruch geraten, weil die Kräfte in der erscheinenden Welt wechselseitig aufeinender wirken, während das Gesetz immer wieder aufs neue auf alle Fälle gleich angewendet werden soll. Dementsprechend gibt das Bewusstsein den Versuch auf, das Wahre an der Erscheinung aufzuzeigen. In dieser Hinsicht geht es über sich selbst hinaus. Mit diesem unübertrefflichen Hinausgehen wirft das Bewusstsein zunächst aber einen vergeblichen Blick auf „die übersinnliche Welt“, gewissermaßen auf das Jenseits der erscheinenden Welt, obwohl es das Wahre schon mit sich selbst hat. In diesem Sinn bringt diese Blickrichtung des Bewusstseins wiederum auch eine Leere hervor, so wie der Gegenstand der sinnlichen Gewissheit sich als das ärmste Allgemeine gezeigt hatte, ohne den konkreten Inhalt zu enthalten, da die 28 Verwandlung des Bewusstseins ins Übersinnliche den Gegensatz zwischen dem Diesseits und dem Jenseits erzeugt: zum einen das Unruhige, zum anderen der leere Stillstand. Um diesen Gegensatz wieder rückgängig zu machen, soll das Bewußtsein den Übergang zu seinem eigenen Inneren vollziehen. Mit der Umkehrung in sich selbst wird für das Bewusstsein erreicht, dass das stillstehende Gesetz nicht mehr das vollkommene Wahre ist, da sich dieses Gesetz von der dynamischen Wirklichkeit unterscheidet. Ganz im Gegenteil: das Wahre des Bewusstseins ist nunmehr „das in-sich-verkehrt-sein“, anders ausgedrückt: „das Ungleiche des Gleichen.“ (GW. 3, S. 39) Hinsichtlich „der verkehrten Welt“, also der Umkehrung im Bewusstsein selber, sagt Hegel: „Das Bewußtsein eines Anderen, eines Gegenstandes überhaupt, ist zwar selbst notwendig Selbstbewußtsein, Reflektiertsein in sich, Bewußtsein seiner selbst in seinem Anderssein.“ (PhdG., S. 135) Nimmt man diesen Hegelschen Satz in seiner vollen Bedeutung, liegt es auf der Hand, dass die bisherige dialektische Bewegung des Bewusstseins auf das Lebendige hinzielt. Dieses Lebendige weist nach Gadamer auf das „sich–gegen–sich–selbst-gekehrt[e]“ Sein, nämlich das Verhältnis mit sich selbst hin, da es als das Selbst die Identität mit sich und zugleich die Unendlichkeit des Unterschiedes in sich enthält. Nach der Ankunft beim Lebendigen liegt der Erfahrung des Bewusstseins nicht mehr die Möglichkeit der Erkenntnis des äußerlichen Gegenstandes zugrunde. Vielmehr liegt sie der Selbsterkenntnis und der Selbstkorrektur zugrunde, die aus dem notwendigen Verlauf der Erfahrung folgt. Aufgrund dieses Sachverhaltes äußert sich Gadamer wie folgt: „Die Seinsweise des Lebendigen entspricht darin der Seinsweise des Wissens selber, das das Lebendige versteht.“(GW. 3, S. 45) Daher wird die Behauptung gewagt, dass der Übergang zum Selbstbewusstsein in der Phänomenologie Hegels aus dem notwendigen Prozess der dialektischen Bewegung des Bewusstseins, noch konkreter formuliert, aus der Innerlichkeit des Verstandes heraus entstanden sein muss. 16 16 Vgl. Otto Pöggeler, „Selbstbewusstsein als Leitfaden der Phänomenologie des Geistes“, in: G. W. F. Hegel Phänomenologie des Geistes, hrsg. v. Dietmar Köhler/Otto Pöggeler, Berlin 1998, S. 133. Insbesondere glaubt er in diesem Zusammenhang, dass Hegel sich, im Grunde genommen, mit dem sich selbst auffassenden und lebendigen Selbstbewusstsein beschäftigt hat, obwohl die drei Gestalten des Bewusstseins im 1. Kapitel (A.) bei uns die Frage nach der Erkenntnis vom Objekt zu stellen scheinen. Auf der Stufe des Verstandes könnte die Kraft als der zusammenfassende Knoten geradewegs ins Leben führen, weil die Struktur der verständlichen Erfahrung erstens gerade der Selbsterfahrung des lebendigen Selbst in Beziehung zur Einheit der Identität mit dem Unterschied steht, zweitens das Wissen von der Welt und dem Selbst insgesamt das Handeln des Menschen selbst ist. 29 I - 3. Zum ontologischen Wesen von Selbst und Leben: Die Wechselbeziehung des Selbstbewusstseins Das Selbstbewusstsein ist das sich von sich selbst unterscheidende Ich, das sich zugleich auf sich selbst bezieht. Das Ich bleibt zunächt in der Beziehung, so wie die Kräfte auf der Ebene des Verstandes aufeinander wirken. Die Kraft des Verstandes verbleibt im relativen Verhältnis, in dem ein Ding zu seiner Existenz kommt oder zum Verschwinden gebracht wird. Bei der Aufforderung zur Erklärung dieses Verhältnisses wird das Bewusstsein ins Innere zurückgedrängt. Es dreht sich in Richtung auf seine eigene Innerlichkeit hin, d. h. es übt das zu sich selbst kommende Tun aus. Das Bewusstsein hält nunmehr nicht länger an der Gegenständlichkeit des äußeren Gegenstandes fest, sondern findet das Selbst als das Wahre wieder: Es macht sich selbst zum Gegenstand. Mit dieser Selbstvergegenständlichung tritt das Bewusstsein von sich selbst in dieser Phase der ontogenetischen Erfahrung des Bewusstseins zum Vorschein. Hierin erfährt das Selbstbewusstsein, dass es sich von sich selbst unterscheidet und vom eigenen „anders-sein“ zu sich selbst kommt. Das Selbst entzweit sich. Es stößt sich zwar von sich selbst ab, identifiziert sich in diesem Vorgang jedoch zugleich mit sich selbst. Mit dem Selbst als der Selbstentzweiung und Selbstidentifizierung zugleich, tritt „das einheimische Reiche der Wahrheit“ vor uns zutage. (PhdG., S. 138) Jedoch begründet das Selbst bei Hegel nicht mehr die transzendentale Subjektivität, obgleich es sich immer auf sich selbst bezieht. Denn das Selbst hält nicht an der leeren Tautologie „Ich bin Ich“ fest, sondern bezieht sich in der Beziehung auf sich selbst und zugleich auf das sich negierende Tun. (Ebd.) Der erste Versuch des Selbst, den Gegensatz im Bewusstsein zu überwinden und die Einheit mit sich selbst herzustellen, heißt bei Hegel „die Begierde“, die das Moment der Versöhnung in sich trägt. (PhdG., S. 139) Das Selbst zeigt sich in der Doppelseitigkeit der Begierde: Zum einen treibt die Begierde das Ich zur Überwindung des Gegensatzes zwischen dem Subjekt und dem Objekt an. Im Moment der zu befriedigenden Begierde trifft das Ich jedoch auf der anderen Seite das selbständige Andere, sozusagen dasselbe Lebendige: Das begehrende Ich muss für seine Selbsterhaltung den äußeren Gegenstand verzehren. Folglich findet es sein Anderes im Verlauf der Befriedigung der Begierde, das ebenfalls die Negation des Gegenstandes ist. Indem das Ich das sinnliche Selbstgefühl nur durch die Befriedigung des eigenen Strebens erreicht, ist es sein oberstes Ziel, sich das Andere anzueignen und zu vernichten, auch wenn das Andere seinerseits ein selbständiges Lebendiges ist. Mit anderen Worten: Das Ich hält das lebendige Andere sowohl für ein Mittel, als auch für einen 30 Gegenstand, der für das eigene Leben verzehrt werden muss. An dieser Stelle macht das Ich jedoch zwangsläufig die Erfahrung, dass das lebendige Andere nicht gänzlich vernichtet werden darf, da das Ich sich selbst in der vollständigen Vernichtung des Anderen nicht finden können wird. Mit diesem Moment der Begierde ist das Ich ins „Bestimmen des Lebens“ eingetreten, denn das Ich strebt mehr noch nach dem Leben als nach der Beherrschung über das Andere. (PhdG., S. 140) Nachdem das Ich sich auf das Spielfeld des Lebens begeben hat, weiß es zugleich, dass es von vornherein vom lebendigen Anderen abhängig ist. Besteht das Ich auf seinem sinnlichen Gefühl, muss es für die egoistische Befriedigung seiner eigenen Begierde das Andere, nämlich den lebendigen Gegenstand, vernichten und aufzehren. Indem das Ich jedoch nach dem Wiederreichen des Lebendigen durch das Andere anerkannt werden will, macht es die Erfahrung, dass es kein „sich–finden“ im Anderen und die Anerkennung durch das Andere geben kann, ohne selbst das überlebende Andere zu sein. Denn das Ich, das sich selbst egoistisch behauptet, wird schließlich nicht nur das Andere, sondern vielmehr sein eigenes Leben selber zerstören: Das Ich würde dann jegliches „außer–sich-sein“ zerstören, wenn ihm dafür nur die natürliche Begierde nach dem Verzehren bliebe. Das Moment der Überwindung dieser natürlichen Unmittelbarkeit ist bei Hegel geradezu das Bewusstsein vom lebendigen Anderen. Auf diese Weise lernt das Ich, dass seine Existenz unter allen Umständen vom Leben des Anderen abhängt, so dass das Ich sich selbst im Anderen findet und durch das Andere auch die Anerkennung seiner Selbständigkeit erfährt. Aufgrund dieser Erfahrung verzichtet das Ich darauf, auf seiner hartnäckigen Selbstbehauptung zu bestehen. Für den Moment des „sich–anschauens“ im Anderen begibt sich das Ich selbst nun voll ins Leben, anders gesagt, verzichtet es um seiner selbst willen auf seine natürliche Unmittelbarkeit. Das Ich, das an dieser Stelle durch die Aufhebung der natürlichen Selbstbehauptung in der Lebendigkeit versunken ist, bezieht sich nun auf die Lebensganzheit, in der das Ich sich erzeugen lässt und das Andere erlebt: Das Ich lebt nur im Verhältnis zur Entfaltung des Lebens. Das Leben als das Ganze enthält somit den Charakter des unendlichen Unterschiedes und der Integration. 17 Auffallend ist, dass die ontologische Struktur des Lebens sowohl die Entzweiung als auch die Identifizierung mit sich selbst aufweist. Im ununterbrochenen Verlauf der dynamischen Bewegung des Lebens, sozusagen „im beständigen Austausch von Assimilation und Selektion“, hat es jedes Ich mit dem Anderen und seiner Umgebung zu tun. Diese Bewegung des Lebens weist darauf hin, dass die Gattung als die Grundlage der 17 Vgl. Charles Taylor, Hegel, Frankfurt a. M. 1983, S. 203ff. Nach seiner Behauptung habe Hegel von Anfang des Kapitels „Selbstbewußtsein“ an auf die totale Integrität abgezielt. Anders gesagt, liegt der Integritätsbegriff dem Streben des Selbst fundamental zugrunde. 31 Seinsweise des Einzelnen zeitlich voran geschritten ist. (GW. 3, S. 50ff.) Diese Struktur des Lebens betreffend sagt Hegel: „Das Leben in dem allgemeinen flüssigen Medium, ein ruhiges Auseinanderlegen der Gestalten wird eben dadurch zur Bewegung derselben oder zum Leben als Prozeß. Die einfache allgemeine Flüssigkeit ist das Ansich und der Unterschied der Gestalten das Andere.“ (PhdG., S. 141) Und ergänzend dazu: „Denn da das Wesen der individuellen Gestalt, das allgemeine Leben, und das Fürsichseiende an sich einfache Substanz ist, so hebt es, indem es das Andere in sich setzt, diese seine Einfachheit oder sein Wesen auf, d. h. es entzweit sie, und dies Entzweien der unterschiedslosen Flüssigkeit ist eben das Setzen der Individualität.“ (PhdG., S. 142) Das Leben ist, wie so eben betont, der Prozess, der alles Lebendige in der unendlich flüssigen Entzweiung erzeugt, in der alles Lebendige integriert ist. Im Prozess der Erfahrung, die sich maßgeblich auf dem Leben aufbaut, erlebt jedes Einzelne zugleich das ganze Leben wie auch die „einfache flüssige Substanz.“ (PhdG., S. 140) Zu diesem Zweck hebt das Einzelne die unmittelbare Begierde, nämlich die abstrakte Selbständigkeit, auf. Das Einzelne erkennt sich selbst nur in dem gewissen Bewusstsein, dass sein „für-sich-sein“ oder sein „anerkanntwerden“ sich aus dem Leben als der Gattung ergibt, weil jedes Einzelne sich, wie oben bereits erwähnt, nur durch die unmittelbare Begegnung mit dem Anderen anschauen kann. Es liegt auf der Hand, dass das Ich sich um seiner selbst willen bei der unmittelbaren Begegnung mit dem lebendigen Anderen auf das Gattungsleben, in dem es sich selbst bestätigen und das Andere erfahren kann, einlässt. Auf der anderen Seite ist das ganze Leben als das „einfache allgemeine Medium“ oder die „allgemeine Flüssigkeit“ (Ebd.) für die Gliederung in die einzelnen Gestalten verantwortlich. 18 Das flüssige Leben besteht in dem schrittweisen Hervortreten der einzelnen Gestalten und auch in seinem Tod. In diesem Sinn ist das Leben der fundamentale Schauplatz, auf dem jeder zur Welt und zum Tode kommt. Hier wird vor allen Dingen deutlich, dass das allgemeine Leben als ein unaufhörlicher Kreislauf von 18 Vgl. H. Marcuse, Hegels Ontologie, S. 261. Nach seiner Position sind diese drei Bestimmungen, d. h. „das einfache allgemeine Medium“, „allgemeine Flüssigkeit“ und „einfache flüssige Substanz“, die der Ontologie Hegels, weil der Lebensbegriff bei Hegel zuallererst als der Geist selbst auftritt, der sich von sich selbst abstößt und sich zu sich selbst verhält. Deshalb verweist der Prozess des Lebens auf die Selbstverwirklichung des Geistes. 32 Erzeugen und Tod die ontologische Grundlage für alle Lebendigen ist. Das Medium des allgemeinen flüssigen Lebens teilt zudem die Einheit der Gliederung in die einzelnen Gestalten auf, in denen jedes Ich seine je eigene Besonderheit, d. h. seine Natürlichkeit, negiert. Diese Einheit ist bei Hegel „die einfache Gattung.“ (PhdG., S. 143) Somit stellen wir fest, dass das Leben, das die mediale Einheit des Selbst mit dem Anderen realisiert, bereits das Vorbild des Geistes ist. Dass das Leben hier jedoch bereits die Selbstentwicklung oder den Charakter des Geistes bestätigt, stellt sich nicht in der Form da, dass der Geist in dieser Stufe des Selbstbewusstseins bereits verwirklicht ist. Der Hegelsche Begriff des Geistes wird sich, dem Ablauf seiner textimmanent kompositorischen Konstellation zufolge, erst am Ende der Phänomenologie offenbaren. (GW. 3, S. 49) 19 Dennoch kann man bereits jetzt sagen, dass das geistige Leben schon der von Hegel selbst vorweggenommene Begriff des Geistes ist. Nach der doppelten Negation, einerseits der Selbstnegation durch die unentrinnbare Betroffenheit mit dem unmittelbaren Gegenüber und andererseits der Negation des Anderen in den kompletten Lebenszusammenhängen, kehrt das Ich in sich selbst zurück. Anders formuliert, will das Ich zunächst dieses sich selbst behauptende Selbst in der Negation des Anderen bewahren und damit zugleich sich selbst in der Selbstnegation finden, da das Ich die Anerkennung durch das Andere anstrebt. Dieser Prozess kann als die Rückkehr zum ontologischen Wesen von Selbstbewusstsein und Leben angesehen werden. Aus dieser ständig sich selbst negierenden Erfahrung lernt das Ich, dass „das Selbstbewußtsein seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein erreicht.“ (PhdG., S. 144) Daraus, dass das Ich von der unausweichlichen Abhängigkeit vom Anderen im Verlauf der wechselseitigen Anerkennung weiß, ist zu schlußfolgern, dass diese intersubjektive Anerkennung im allgemeinen Bewusstsein, also unserem gemeinsamen Bewusstsein, verankert ist. Die Anerkennung als Ich–Du–Beziehung hat zwangsläufig die Ich–Wir–Beziehung zur Folge, da das Ich immer schon in der Wir–Dimension als einem ontologischen Sinnganzheitshorizont eingebettet ist. Diese wird das Ich auf diesem Weg zu der Erkenntnis dessen führen, was der 19 Vgl. Otto Pöggeler, Hegels Idee, S. 248, S. 283. Auf diesen beiden Seiten macht er vor allem auf die gesellschaftliche und religiöse Rolle des Geistes im Verhältnis zum gesamten System der Phänomenologie aufmerksam. Diese Rolle wird später im Kapitel über den Geist oder die offenbare Religion realisiert, obwohl der Lebensbegriff im Selbstbewusstsein schon als der Inbegriff des Geistes erscheint. In diesem Sinn könnte das „Leben“ Gottes und das göttliche „Erkennen“ als die Ausbreitung und Ausstrahlung der göttlichen „Liebe“ aufgefasst werden. Aber das Bewusstsein soll, wie in der Einleitung beschrieben, den Weg zur Selbstverzweiflung, d. h. zur Selbstnegation bis hin zum notwendigen Übergang zur Station des Geistes erfahren. Auch Gadamer glaubte, dass die Wahrheit von Selbstbewusstsein und Leben in der Etappe des erscheinenden Geistes erreicht wird, in der sich die Einheit des Selbst mit dem Bewusstsein bildet. Dagegen bringt L. Siep seinen Zweifel zum Ausdruck, dass der Hegelsche Lebensbegriff mit dem „animalischen Leben“ oder dem „metaphysischen Leben“ verbunden sei, so wie sich das „Wahre“ beim frühen Hegel zeigt. Diesbezüglich vgl. L. Siep, Der Weg der Phänomenologie des Geistes, S. 100. 33 Geist selbst als die absolute Freiheit bedeutet. Den Begriff des erscheinenden Geistes vorwegnehmend, äußert sich Hegel wie folgt: „Was für das Bewußtsein weiter wird, ist die Erfahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewußtsein[e], die Einheit derselben ist; Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. Das Bewußtsein hat erst in dem Selbstbewußtsein, als dem Begriff des Geistes, seinen Wendungspunkt, auf dem es aus dem farbigen Scheine des sinnlichen Diesseits und aus der leeren Nacht des übersinnlichen Jenseits in den geistigen Tag der Gegenwart einschreitet.“ (PhdG., S. 145) In diesem Zusammenhang führt das intersubjektive Anerkennungsverhältnis dem Bewusstsein vor Augen, dass es die wechselseitige Anerkennung mit der Anerkennung vom allgemeinen Bewusstsein zu tun hat; dem Ich im Wir und dem Wir im Ich. So gesehen kann man sagen, dass der Geist als die absolute Harmonisierung des Subjekts mit der Substanz hier vorweggenommen wird, obwohl dieses Ziel erst am Ende der Phänomenologie ausführlich realisiert wird. Hegel stellt überdies mit dem vorweggenommenen Begriff des Geistes die Wechselbeziehung zwischen Herr und Knecht als die berühmte Dialektik der zwei verschiedenen Formen des Selbstbewusstseins dar. Schon aus dieser Erörterung der Ich–Wir–Beziehung geht folglich hervor, dass der Kampf um Anerkennung der verschiedenen Ausprägungen des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie nicht direkt ins Rechtsverhältnis übergeht, weil die Idee der Phänomenologie, das Bewusstsein von der Einheit des Ich mit dem allgemeinen Bewusstsein, wie es oben erwähnt wurde, erst auf der Ebene des Geistes zum Ziel führen wird. Folglich führt die gegenseitige Anerkennung in der Phänomenologie nicht zur Harmonie, also der Versöhnung des Individuums mit der Gesellschaft. Vielmehr geht dieses Anerkennungsverhältnis mit dem noch nicht aufgelösten Widerspruch zu Ende. An dieser Stelle kann man sich wiederum in Erinnerung rufen, dass Hegel die Entstehungsgeschichte des einzelnen Bewusstseins in der Phänomenologie ausführen wollte, während der frühe Hegel das Rechtsverhältnis von der intersubjektiven Wechselbeziehung vornehmlich aus der Jenaer Geistesphilosophie ableitet. Warum Hegel die interpersonelle Wechselbeziehung im Rechtsverhältnis im Kapitel „Selbstbewusstsein“ der Phänomenologie nicht abhandelt, ergibt sich m. E. aus der Gesamtkonzeption der Phänomenologie. 34 Mit dem oben angedeuteten Problem, das aus dem Systementwurf der Phänomenologie, anders gesagt, deren ontogenetischem Charakter entstanden ist, kann man davon ausgehen, dass sich das Herr– und Knechtverhältnis in der Phänomenologie als ein brutaler Kampf zeigt. In der Tat gibt es in der Phänomenologie die Struktur des revolutionären und tödlichen Kampfes, dessen Prozess man auch als einen Klassenkampf sehen kann. Kojève hat aus der Anerkennungstheorie Hegels eigene Aspekte herausgearbeitet, die man anthropologisch und geschichtlich nennen kann. In Kojèves Augen beginnt die existenzielle Grundlage des Menschen inmitten der verzehrenden Begierde, mit dem „das Daseiende zerstörenden und negierenden Tun.“ Demzufolge gründet sich die Existenz des Menschen bei ihm zu Beginn lediglich auf das animalische Leben. So gesehen folgt die menschliche Existenz seiner Ansicht nach einzig aus dem brutalen Kampf oder dem Prestigekrieg. Demzufolge kann weder der Krieger–Herr noch der dem Herrn unterworfene Knecht, sondern nur der durch die Arbeit sich selbst bewusste Knecht, die wesentliche Existenz des Menschen verwirklichen und den wahrhaften Fortschritt der menschlichen Geschichte erreichen. An dieser Stelle gibt Kojève uns aus der materialistischen Perspektive gesehen den Hinweis, dass Hegels Anerkennungstheorie in der Phänomenologie nichts anderes als der Kampf der Klassen ist, der die komplette Geschichte der Menschheit durchzieht, die Menschengattung somit insgesamt zur Emanzipation von der primitiven Klassenarbeit hinströmt. 20 Im Gegensatz dazu geht es Gadamer um die ontologische Perspektive, die sich aus der unmittelbaren Begegnung mit dem Anderen, sozusagen der alltäglichen Sitte, ergibt. Auf der gesellschaftlichen Ebene und in der alltäglichen Lebenswelt, in der wir unsere Anderen treffen und erleben, hat man dann ein Gefühl des Leidens, wenn das eigene Benehmen durch den Anderen verkannt oder die Anerkennung von anderem verweigert wird. Dieser alltägliche Umgang mit dem Anderen in der Lebenswelt steht auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Liebe oder der Vertrautheit zueinander. Somit kann man sagen, dass der Grundstein der zwischenmenschlichen Beziehung, die sich aus dem natürlichen Bedürfnis nach Liebe ergibt, in der Familie gelegt ist. Die unmittelbare Begegnung von Mann und Frau, die in die Familie als dem ersten Modus der Versöhnung miteinander übergehen wird, beinhaltet offensichtlich das Moment der Liebe. (GW. 1, S. 349, GW. 3, S. 56) Im Anschluss an Gadamers Einsicht können wir nunmehr davon ausgehen, dass der wechselseitigen Anerkennung des jeweiligen 20 Vgl. Alexandre Kojève, Hegel, Frankfurt a. M. 1975, S. 55 – 62, S. 70. Zum Einspruch gegen die marxistischen und materialistischen Interpretationen von Hegels „Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft“, Henning Ottmann, „Herr und Knecht bei Hegel – Bemerkungen zu einer missverstandenen Dialektik“, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, hrsg. v. Hans Michael Baumgartner, Otfried Höffe, Meisenheim/Glan 1981, S. 365 – 366. 35 Selbstbewusstseins bei Hegel eine „emotionelle Beziehung“ zugrunde liegt, 21 wie die Liebe in der Familie und die Solidarität im Rechtsverhältnis vorausgesetzt ist. So müssen wir nicht nur auf das „Selbstbewußtsein“ der Phänomenologie, sondern auch auf Hegels Jenaer Geistesphilosophie unser Augenmerk werfen. Von hier aus wird der Kampf um Anerkennung auf dem alltäglichen Spielfeld der gesellschaftlichen Sitte, als eine Intimbeziehung zwischen Gebendem und Nehmendem, Beleidigendem und Beleidigten in Betracht gezogen werden müssen: Die Anerkennung als die Aufforderung, sich selbst zum Menschen zu werden, wird durch die Verkennung und die Verachtung durch den Anderen aus der unmittelbaren Beziehung unter den Menschen in der alltäglichen Lebenswelt vereitelt. Anders formuliert darf der Anerkennungskampf, der darin besteht, das Selbst im Anderen wieder zu finden, nicht nur auf dem Weg zum kriegerischen, revolutionären und brutalen Kampf stattfinden. Vielmehr werden wir der Begierde nach dem Leben, also dem Willen des Selbst, das Leben zu erhalten, dessen Antrieb für die Versöhnung das Motiv der Liebe ist, unsere Aufmerksamkeit schenken müssen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit das Leben und die Liebe die Fähigkeit besitzen, das einzelne Subjekt mit dem allgemeinen Bewusstsein zu vereinigen. In Hegels Darstellung vom Übergang von der menschlichen Natürlichkeit über die egozentrische Eigensinnigkeit hin zur Harmonie mit dem Anderen in der Gesellschaft, begegnen wir dem wieder, das damit zugleich zeigt, welche Rolle dabei die Liebe in Bezug auf das ethisches Moment spielen sollte. Ich werde zunächst Hegels Versuch einer gesellschaftlichen Vereinigung von der Frankfurter Zeit bis hin zur frühen Jenazeit verfolgen: einerseits anhand des Lebens Jesu, anderseits durch die Uminterpretation der antiken Ansätze im Rahmen der praktischen Philosophie. Daran anschließend soll die wechselseitige Beziehung in der Jenaer Geistesphilosophie in Bezug auf die ontologische Struktur der interpersonellen Erfahrung beleuchtet werden. Dazu werde ich zunächst auf die Liebesbeziehung unter den Subjekten auf der gesellschaftlichen Ebene in Bezug auf Hegels Denkentwicklung in der Gesellschaftstheorie eingehen. 21 Vgl. Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M. 1992, S. 283 – 285. 36 II. Das Prinzip der Anerkennung in der früher Zeit Will man Hegels Denkentwicklung von der Frankfurter bis zur Jenaer Zeit hin untersuchen, muss man zunächst von den Fragestellungen ausgehen, warum Hegel die Philosophie von Kant und Fichte unter der veränderten Situation seiner Epoche kritisch akzeptiert hat und auf welchem Weg er unter dem Einfluß seiner Freunde im Tübinger Stift, Schelling und Hölderlin, zu seinem eigenen Standpunkt gelangte. In Bezug auf die beiden Philosophen Kant und Fichte leistet Hegel, um es hier kurz zu erwähnen, zum einen Kritik an der isolierten Subjektivität und zum anderen weist er auf die Grenzen des Reflexionsaktes hin, da die Reflexion seiner Meinung nach zu einer dauerhaften Trennung führt 22 und trotzdem die Philosophie doch auf „das ungeteilte Leben“, 23 nämlich die vollständige Vereinigung unter den Lebendigen abzielen soll. In seiner kritischen Ausrichtung gegen die beiden Philosophen macht Hegel hauptsächlich in seinen Jugendarbeiten, vor allem in den Fragmenten über „Religion und Liebe“ und im „Geist des Christentums“ auf den Aufstieg von der endlichen Lebendigkeit zum unendlichen Leben als der vollendeten Harmonie, d. h. die Erhebung von der unauflösbaren Entgegensetzung unter den endlichen Lebendigen zur vollständigen Vereinigung im Leben zugunsten der Liebe, aufmerksam. In seinem Streben nach der absoluten Harmonie des Lebens sieht Hegel die ursprüngliche Fähigkeit, „das endliche Leben in das unendliche Leben“ schließlich zu überführen, an dieser Stelle nicht in der Philosophie, vor allem nicht in der Reflexionsphilosophie, sondern vielmehr versucht er, die absolute Vereinigungskraft in der Religion zu finden. In diesem Kontext schreibt Hegel, dass „die Philosophie eben darum mit der Religion aufhören muß.“ (Früh., S. 422 – 423) Nachdem Hegel in seinen Jugendschriften die vollständige Vereinigung des Lebens aus dem Erlebnis der Religion, dem religiösen Liebesgefühl, zu gewinnen versucht hatte, wandte er noch in der Jenaerzeit seine frühe Jugendkonzeption der Philosophie auf die politisch–gesellschaftstheoretische Philosophie an. „Das Bedürfnis der Philosophie“ habe, wie es von K. Rosenkranz berichtigt wurde, die epochale Wirklichkeit, „ihren (=Philosophie, KBL) Zusammenhang mit dem Leben und den politischen Wissenschaften“, anpassend darzustellen. 24 Vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass die politisch–gesellschaftliche Philosophie, vor allem der Naturrechtsaufsatz und das „System der Sittlichkeit“, in der ersten 22 23 24 Vgl. zum Hegelschen Begriff der Reflexion in früher Zeit, Rüdiger Bubner, „Problemgeschichte und systematischer Sinn einer Phänomenologie“, in: Hegel – Studien, hrsg. v. Friedhelm Nicolin und Otto Pöggeler, Bd. 5, Bonn 1969, S. 134 – 135. G.W.F. Hegel, Frühe Schriften, in: Werke in 20 Bände, hrsg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1986, S. 420, Im folgenden abgekürzt: Früh. K. Rosenkranz, G. W. F. Hegels Leben, Darmstadt 1998, S. 179. 37 Jenaer Zeit in Hegels Denkentwicklung zur Phänomenologie des Geistes – zumindestens in Bezug auf die interpersonelle Anerkennung im Rahmen der praktischen Philosophie – einen wichtigen Stellenwert hat. Daran anschließend versucht Hegel in Jena sein System der Philosophie aufzubauen, konkreter noch, seine eigene Konzeption der gesamten Philosophie so zu gliedern wie sein späteres System. Der Äußerung von Rosenkranz zufolge, hat Hegel in seiner Vorlesung in Jena sein System der Philosophie in die folgenden vier Teile aufgeteilt: „1) die Logik oder die Wissenschaft der Idee als solcher(= Logik und Metaphysik), 2) die Naturphilosophie oder die Realisation der Idee, die sich zunächst in der Natur ihren Leib erschafft(= die physische Natur), 3) die sittliche Natur als der reale Geist(= Philosophie des Geistes), 4) die Religion als die Resumption des Ganzen in Eins, als die Rückkehr zur ersten Einfachheit der Idee(= Philosophie des absoluten Geistes).“ 25 Bezüglich dieser Aufteilung des Hegelschen Systems der Philosophie, behauptet Heinz Kimmerle, dass die frühen Hegelschen Systementwürfe auf dem Weg zur Phänomenologie des Geistes ursprünglich den Charakter der „embryonalen Gestalt“ 26 hatten. So schrieb er in einem anderen Aufsatz, dass „diese(= die spätere Auffassung, KBL) als das Telos jener(= der früheren Auffassung, KBL) erscheint.“ 27 Im Gegensatz dazu bemerkt Rolf P. Horstmann zu der Annahme von Kimmerle, dass Hegels Naturbegriff in der Jenaer Zeit in dem Naturrechtsaufsatz und dem „System der Sittlichkeit“ eine Zweideutigkeit aufweisen: Hegel sei in beiden Arbeiten „von dem umfassenden Naturbegriff, d. i. einerseits der physischen Natur, andererseits der sittlichen Natur, ausgegangen.“ Aus diesem Grund merkt Horstmann auch an, dass es Hegel in der frühen Jenazeit, vor allem im Rahmen der politisch-gesellschaftlichen Philosophie, für nötig hielt, die Einführung in das Bewusstsein darzustellen, um die Sittlichkeit im gesellschaftlichen Leben ausführlich zu vollziehen. 28 Nichts desto trotz wird deutlich, dass Hegel die vollendete Vereinigung im gesellschaftlichen Zusammenleben, die interaktive Anerkennung unter den Mitgliedern der 25 26 27 28 Ebd. Heinz Kimmerle, „Zur Entwicklung des Hegelschen Denkens in Jena“, in: Hegel – Studien Beiheft 4, hrsg. v. Hans–Georg Gadamer, Bonn 1984 (2. Aufl.), S. 31. Er ging in diesem Aufsatz davon aus, dass „die Studien zur Verfassung Deutschlands“ in den Jahren 1801 – 1804 in der Hegelschen Denkentwicklung zur späten Bewusstseinsphilosophie eine entscheidende Rolle spielen. Seiner Ansicht nach scheinen uns diese Studien im Prozess der Hegelschen Denkentwicklung zunächst einen Anknüpfungspunkt an die Ansätze der Jugendzeit mit dem Philosophiesystem in der Jenaer Zeit anzubieten. Auch mag der Denkansatz der systematischen Abgeschlossenheit in diesen Studien in der Konzeption des Philosophiesystems der späteren Enzyklopädie konsequent widerspiegelt werden. Ders., „Anfänge der Dialektik“, in: Der Weg zum System, hrsg. v. Christoph Jamme und Helmut Schneider, Frankfurt a. M. 1990, S. 274. In diesem Zusammenhang hat er ein Fragment in den „Studien zur Verfassung Deutschlands“ von Hegel in der Jenaer Zeit, das in die gesamten Arbeiten eingeordnet werden kann, präziser interpretiert, um seinen Erwartungen im obigen Aufsatz gerecht zu werden. Rolf Peter Horstmann, „Probleme der Wandlung in Hegels Jenaer Systemkonzeption“, in: Philosophie Rundschau (19), hrsg. v. Hans–Georg Gadamer u. Helmut Kuhn, Tübingen 1972, S. 112 – 113. 38 Gesellschaft, nach wie vor als das Ziel der Philosophie, zumindestens der praktischen Philosophie, sieht und dass der Naturrechtsaufsatz und das „System der Sittlichkeit“ dafür in dieser Systementwicklung eine wichtige Rolle spielen, wobei damit jedoch die polemische Auseinandersetzung über Hegels Konzeptumwandlung nach wie vor nicht gelöst ist. Mit dem Ziel, die endliche Einzelheit des natürlichen Menschseins zu der unendlichen Ganzheit des Lebens zu erheben, versucht Hegel im Naturrechtsaufsatz, der im kritischen Journal der Philosophie (1802/03) erschien, die gesamten Phänomene des Sittlichen in einer kritischen Auseinandersetzung mit Kants, Fichtes und Hobbes Naturrechtsauffassung detailliert zu analysieren und aus dem Resultat der Interpretation seine politisch-gesellschaftliche Philosophie zu entwickeln. Im „System der Sittlichkeit“, das nahezu zeitgleich mit dem Manuskript des Naturrechtsaufsatz verfaßt worden sein soll, konzipiert Hegel anhand des Schemas der Subsumtion von Anschauung und Begriff unter dem Einfluss von Schelling, die konkrete Einheit zwischen der Einzelheit und der Allgemeinheit auf der Stufe der in der Gestalt des Begriffs enthaltenen Anschauung. Hinsichtlich dieser Denkentwicklung Hegels hoffe ich, im folgenden deutlich machen zu können, inwieweit die Liebesbeziehung für Hegel beim Übergang von der Frankfurter zur Jenaer Zeit, zu der freiwilligen Integration des einzelnen Subjekts in die Gesellschaft führen kann und wie das Liebesgefühl auch im Verhältnis zu der interaktiven Anerkennung im Rechtsverhältnis entsprechend darzustellen ist, d. h., wie das einzelne Subjekt im Falle eines Rechtskonflikts den Selbstverzicht und die Selbsthingabe im Laufe der Vergesellschaftung bildungsgeschichtlich erlernen kann. Damit möchte ich zeigen, inwieweit Hegel auch nach der so genannten Konzeptionsumwandlung zur Bewusstseinsphilosophie hin, das unauflösbare Spannungsverhältnis von Ich und Du in der anerkennenden Wechselbeziehung vor dem Horizont des gesellschaftlichen Zusammenlebens beibehält. 39 II - 1. Der Begriff der Liebe in der Frankfurter Zeit: Das Streben nach der Befreiung vom Leiden an der Zerrissenheit In „Entwürfe über Religion und Liebe (1797/98)“ versucht Hegel, uns mit den beiden Begriffen „Liebe und Leben“ den Übergang von der Entzweiung über die Entgegensetzung bis hin zur Wiedervereinigung zu präsentieren. Jedoch darf die Liebe, die gegenüber der Zerrissenheit im gesellschaftsgeschichtlichen Leben die Vereinigung wiederherstellt, hier nicht als jene total vermittelte Einheit gefasst werden, wie dies im sich begreifenden Begriff und dem sich denkenden Denken beim späten Hegel geschieht. Vielmehr handelt es sich bei dem Begriff, wie ihn Hegel in seiner Frankfurter Zeit verstanden hat, um das alltägliche Verhältnis z. B. zwischen den Liebenden im gesellschaftlichen Leben, hat er in diesen kurzen Schriften die konkreten Gestalten der Liebe doch so dargestellt. Durch die Analyse der Phänomene der Liebe führt er die Liebe als Vereinigungskraft der Realität und der Wirklichkeit ein. Hegels Begriff der Liebe bezeichnet hier im eigentlichen Sinn die Fähigkeit, die Mannigfaltigkeit im Leben in sich aufzunehmen und mit den anderen eins zu sein. Das Leben überwindet die in ihm enthaltene Entzweiung, indem die Liebe im Leben jegliche Unterschiede in ihre Vereinigung mit einbezieht. Mit dieser Konzeption konzentriert sich Hegel in den frühen Fragmenten auf das Begriffspaar „Liebe“ und „Leben“, um die liebevolle Gesellschaft als die wiederherzustellende Harmonie im Leben zu skizzieren. In diesem Zusammenhang spricht sich Hegel unter dem Einfluss der Hölderlinschen Vereinigungsphilosophie gegen die transzendentale Moralität Kants aus. Hölderlin hat einen entscheidenden Einfluß auf den frühen Hegel „beim Übergang zu seinem eigenen, von Kant und Fichte schon im ersten Schritt abgelösten Denken“, wie D. Henrich bemerkt. Hegel entwickelt sich jedoch schließlich in eine andere Richtung als Hölderlin, um seine eigene Denkfigur konstruieren zu können. 29 Mit dieser umfangreichen Konzeption kritisiert Hegel im Fragment über „Moralität, Liebe, Religion“ das moralische Gebot, - der Imperativsatz, der der Soll-Logik folgt, wird in der Kategorie von „Du sollst“ oder „Du sollst nicht“ formuliert - das von dem Lebendigen abstrahiert. Nach der Ansicht Hegels ist der Begriff der Moralität gemäß der individualistischen Morallehre Kants unvollständig, da dieser Moralbegriff die lebendige Tätigkeit entbehre: Die Morallehre Kants habe den Trieb und das Bedürfnis des Menschen außer Acht gelassen. Der Mensch hat in der Tat die Sehnsucht nach dem Unendlichen oder Absoluten. Gleichzeitig hat er jedoch auch unterschiedliche Bedürfnisse – so gesehen können 29 D. Henrich, „Hegel und Hölderlin“, in: ders., Hegel im Kontext, S. 11. 40 wir uns als ein Doppelwesen bezeichnen - und will diese Bedürfnisse befriedigt wissen. Indem die Moralität von den konkreten Handlungen der Subjekte getrennt ist, erscheint sie uns immer als ein „durch ein Achtung oder Furcht erweckendes Objekt“. (Früh., S. 240) Zufolge der Maxime dieser Moralität, die stets in der abstrakten Form verharrt und deshalb von der Wirklichkeit isoliert ist, finden wir uns selber als die Handelnden in der Gesellschaft immer nur auf der Ebene einer idealisierten Subjektivität, nämlich der leeren Abstraktion, die weder Trieb noch Sehnsucht, geschweige denn die Begierde kennt, wieder. Demzufolge beinhaltet diese formale Moralität des Gegensatzes zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Endlichem und Unendlichem bzw. zwischen Freiheit und Notwendigkeit für Hegel keine lebendige Vereinigung. Dementsprechend richtet Hegel seine Aufmerksamkeit auf die Fähigkeit der Liebe, um aus der Zerrissenheit im Leben die Harmonie wiederherzustellen. Im Fragment über „Liebe und Religion“ weist Hegel uns zunächst auf „Schuld und Schicksal“ als die beiden Ursachen für die Zerrissenheit im Leben hin. In Bezug auf die Schuld kann man sich relativ leicht mithilfe des Strafgesetzes verständigen, da sich klar definieren läßt, wem die Schuld zugeschrieben werden kann, wer für die Schuld verantwortlich ist und warum man sich aufgrund verbrecherischer und unmoralischer Handlungen anhand der Betrachtung vom konkret-zeitlichen Geschehen schuldig fühlen muß. Darüber hinaus will man auf der Grundlage des Schuldbewusstseins durch die Strafe die Vereinigung mit der „Gottheit“, sozusagen dem allgemeinen Moralbewusstsein, erreichen. Beim Schicksal verhält es sich jedoch so, dass es als Ursache für die Trennung außerhalb des Menschen liegt und für ihn nicht sichtbar ist. Das Schicksal sei, so Hegel, deshalb eine „unbekannte Macht“. (Früh., S. 243) Hier wird gezeigt, dass diese Macht für das handelnde Individuum im voraus nicht berechenbar ist, der Mensch ihrem Angesicht jedoch immer schon gegenübersteht. Somit wird das Individuum bei jeder erneuten Handlung gezwungen, sich dafür zu entscheiden, ob es die Versöhnung mit dem von ihm selbst nicht anerkannten Gesetz annimmt oder im Festhalten an den eigenen Gesetzen zum Verbrecher wird, der vom geltenden Gesetz verurteilt wird. Denn ein Verbrecher richtet sich z. B. gegen das Schicksal als „die unbekannte Macht“ bzw. die gegenwärtigen Institutionen, wenn ihm diese Macht als das Unakzeptable oder Abstrakte erscheint und er folglich eine neue Macht beansprucht, um sein eigenes Selbst zu behaupten. Deswegen tritt der Gegensatz im Schicksal bei Hegel im Grunde als die „ewige Trennung“ auf, die unüberbrückbar ist. (Früh., S. 244) In Hegels Augen vermag es allein die Religion, die „eins mit der Liebe“ ist, als Religion der Liebe die ewige Trennung in Harmonie zu überführen, indem Gott in der Religion „eins mit unserem Wesen“ ist. (Ebd.) Aber hier gibt Hegel uns hinsichtlich des Liebesbegriffes nur sehr wenige 41 Hinweise; die Liebe wird er später noch als die wirkliche Gestalt der Versöhnung beschreiben. Letztlich beendet Hegel das Fragment mit dem Ausdruck, Liebe sei „ein Wunder, das wir nicht zu fassen vermögen.“ (Ebd.) Trotz dieser Äußerung wollte Hegel in diesem Fragment m. E. die Liebe in den Blick rücken, die allein es vermag, sämtliche Gegensätze in der harmonischen Versöhnung aufzulösen und alle Unterschiede in sich zu vereinen. Somit wird die Fähigkeit der Liebe im weiteren Fragment zu einer Versöhnungskraft. Im Fragment über „Die Liebe“ widmet Hegel zunächst sein Interesse noch mehr dem gesellschaftlichen Bereich, indem er die Rechtsverhältnisse in der Gesellschaft thematisiert. Was eigentlich eine Rechtsbeziehung im gesellschaftlichen Leben ist, zeigt Hegel anhand des Beispiels, in dem ein Individuum sich in einer Konfliktsituation gegen die Anderen richtet: Zunächst will es die Anderen von seinem Eigentum ausschließen, um seine Selbstheit zu behaupten und zu erhalten, wenn beide z. B. hinsichtlich des Besitzes miteinander in Konflikt geraten sind. In diesem Konfliktzustand ist eine völlige Verständigung, die aus der Liebe resultieren soll, undenkbar. Dementsprechend sieht Hegel die Ursache einer solchen Auseinandersetzung in der Gesellschaft allein in einem trieborientierten Standpunkt. Dasselbe gilt nach Hegel auch für die „Reflexion“, da sie ebenso wie der Verstand und die Vernunft als Ziel ihres Erkenntnisvermögens nur Gegensätze und Trennung zur Folge hätten – hier kann man erkennen, dass Hegel dieses Erkenntnisvermögen lediglich als die Fähigkeit einer Zuordnung und deshalb einer Rechnung ansieht. Denn genauso wie der Verstand und die Vernunft verhaftet die Reflexion, dem Standpunkt Hegels zufolge, immer am Unterschied zwischen dem Bestimmenden und dem Bestimmten, dem Einschränkenden und dem Eingeschränkten. In Bezug auf die Kategorie der Kausalität könnte man, genau genommen, die Ursache als das Bestimmende der Wirkung nennen, aber auch umgekehrt die Wirkung als das Bestimmende der Ursache bezeichnen, da die Ursache, begrifflich gesehen, von der Wirkung bestimmt ist. In diesem Sinn ist die Reflexion ebenso wie die Rechtsverhältnisse bei Hegel noch immer ein Anlaß für Gegensätze. Um diese Gegensätze aufzulösen, wirft Hegel seinen Blick auf das Potential des Lebens. Anders ausgedrückt, beinhaltet das Leben bereits, so wie Hegel das gesamte Leben sah, sein eigenes Heilmittel in sich, auch wenn uns diese Ausdrucksweise in der heutigen Zeit sehr metaphorisch erscheint. Das Leben wird deshalb bei ihm als die „vollendete Einigkeit“ bezeichnet (Früh., S. 246): Das Leben stellt mit der Liebe die Harmonie wieder her, sofern es die eigene Fremdheit und die ewig bei sich selbst produzierte Mannigfaltigkeit in sich vereint. So können seine Verletzungen und Trennungen in der Ewigkeit des fließenden Lebens wieder geheilt werden. Bei dem Weg des Lebens hin 42 zur Vereinigung bedeutet die Liebe hier auch die Fähigkeit, einen Konflikt in die Harmonie mit einzubeziehen und alle Widersprüche in der Einheit des Lebens aufzuheben. Der Äußerung Hegels zufolge ist es zunächst bezeichnend, dass die Liebe „dem Entgegengesetzen allen Charakter eines Fremden raubt“, unter dem Namen der Liebe „das Leben sich selbst ohne weiteren Mangel findet“, und schließlich „das Lebendige das Lebendige fühlt“. (Ebd.) Der letzte Satz gibt bereits, wie Hegel erwähnt, einen Hinweis darauf, dass die Liebe einfach ein Gefühl ist, in dem das Leben die völlige Identität der Unterschiede erlebt und sich selbst rekonstruiert. Der Weg des Lebens zur Selbstrekonstruktion durch die Liebe wird bei Hegel in der Darstellung des Gefühls der „Scham“ noch sehr viel offensichtlicher. Das Schamgefühl zeigt sich zunächst als eine moralische und sittliche Emotion: Man empfindet die Scham als die natürliche Reaktion bei dem Verstoß gegen eine Sitte. In diesem Fall ist man in den „Zorn“ auf sich selbst geraten, der aus der Liebe entsteht. Die Scham versetzt mich mitunter in die drastische Feindseligkeit mir selbst gegenüber, ohne bei der Liebe zu sein. Im alltäglichen Leben schäme ich mich, wenn ich gegen die übliche Sitte und die gesellschaftliche Etikette, z. B. die Gepflogenheit des Grüßens, verstoßen habe. Umgekehrt gerate ich dann aber in wütenden Widerstreit gegen die Anderen, wenn ich mich durch die Anderen verachtet und entwürdigt erlebe. So gesehen kann das Schamgefühl, wie oben erwähnt, nur mit der Liebe als der absoluten Selbsthingabe die moralisch–sittliche Funktion leisten, da das Individuum im Gefühl der Liebe oder beim Verlieben ineinander auf seine Selbstbehauptung verzichtet und sich bereitwillig für das Geliebte opfert. Die Liebe allein ist es, die uns den Verzicht auf den egoistischen Rechtsstandpunkt ermöglicht und dabei zugleich die Selbstaufopferung für den Anderen lehrt. Die Liebe, aus der das Schamgefühl bei jedem Menschen entsteht, zeugt bei Hegel von der emotionellen Tendenz zu dem Unendlichen und der Fähigkeit der Vereinigung mit dem sittlich–institutionellen Leben. In Bezug auf die Selbsthingabe und den Selbstverzicht zitiert Hegel aus Shakespeares „Romeo und Julia“: „je mehr ich gebe, desto mehr habe ich usw.“ (Früh., S. 248) Die Liebe ist also die Versöhnung mit allen subjektiven Lebensformen im ganzen Leben. Dass die Liebe, die sinnvolle Vereinigung im ganzen Leben aus jeder Selbstbehauptung abzuleiten und die Trennung, die Entgegensetzung aufzuheben fähig ist, drückt Hegel im „Geist des Christentum“ so aus: „Sein <ist> die Synthese des Subjekts und Objekts.“ (Früh., S. 326) 30 In diesem Zusammenhang versucht Gadamer mit der 30 D. Henrich, „Hegel und Hölderlin“, S. 27ff., S. 38. Er weist darauf hin, dass Hegel zunächst seinen Lebensbegriff unter dem Einfluss des „Seinsbegriff“ Hölderlins als die die Zerrissenheit überwindende Versöhnungskraft und die innere Einheit bezeichnet und damit zugleich die Auffassung über das Leben im späten Hegel durch die Selbstbewegung des Geistes ersetzt. Und dazu Friedrich Hölderlin, Frühe Aufsätze und Übersetzung, in: Sämtliche Werke 17, >Frankfurter Ausgabe<, hrsg. v. Michael Franz, Gerhard Steimer 43 Erklärung über „Liebe und Leben“ in den Jugendschriften Hegels, die Geschichtlichkeit und die Bewegung des Geistes in der Phänomenologie des Geistes zu erfassen, der immer weiter zu sich selbst kommt und bei sich selbst noch reichhaltiger wird. Gadamers Ansicht zufolge ist das Leben in der Liebe ein „geistig–geschichtlicher Vollzug“, in dem das Ich mit der Fremdheit des Du versöhnt wird und sich selbst finden kann. Diese Fähigkeit des Lebens, dessen Liebe eine menschliche Daseinsform ist, so wie er die Anschauung vom Du als die Versöhnung mit dem Du bezeichnet, ist bei Gadamer eindeutig die Kraft des Geistes, der den Widerspruch mit sich selbst auflöst und zu sich selbst zurückkehrt. (GW. 4, S. 390 ff. und S. 475) Hier könnte der Grund dafür liegen, warum Hegel bei der Darstellung über die Wir– Perspektive in der Einleitung der Phänomenologie auf den absoluten Geist vorgreift und das Selbstbewusstsein als das Vorbild der Selbstbewegung des Geistes in der Einleitung des Selbstbewusstseins zu zeigen versucht. Aber ich will mich hier mit der Formulierung des Problems oder seiner Vorahnung begnügen, weil ich auf diese Frage in Kapitel IV noch eine präzisere Antwort zu geben versuchen werde. In diesem Kapitel werde ich hauptsächlich die Frage verfolgen, inwiefern die Anerkennungsbeziehung in Hegels Kapitel „Selbstbewusstsein“ im Vergleich zur Liebe und zum Leben in seinen Jugendschriften konsequent uminterpretiert werden kann. Darüber hinaus können wir den Liebes– und Lebensbegriff Hegels auch in dem Fragment über den „Geist des Christentum“ finden. Hegel kritisiert zunächst auf der Grundlage der Liebesreligion Jesu die „positiven“ Gebote der Juden und damit zugleich auch die „formelle Tugend“ Kants. Weil die jüdischen Gebote, die durch die Lehre von der Liebesgemeinschaft Jesu überwunden werden, in der Tat der menschlichen Neigung und Handlung widersprechen, sollte das jüdische Volk leeren Geboten unterworfen werden, die unter Umständen dem Handeln nicht angemessen sind. Nach der Ansicht Hegels wollte Jesus sein Volk mit dem Einwand gegen die Positivität der jüdischen Gebote dazu auffordern, nicht die Herrschaft der Gebote über die menschliche Neigung und Begierde zu suchen, sondern vielmehr die Versöhnung dieser Neigungen und Begierden mit dem Gesetz, also der allgemeinen Sitte. Mit der Lehre Jesu, die sich gegen den Zwang der jüdischen Gebote richtete, kritisiert Hegel zugleich die formelle Tugend Kants. Die Kantische Tugend kann für Hegel die Entgegensetzung und die Trennung nicht aufheben, sondern führt den Gegensatz und D. E. Sattler, Frankfurt a. M. 1991, S.156. Von Anbeginn dieses Aufsatzes mit dem Titel „Seyn Urtheil Möglichkeit“ an, schreibt er: „Seyn -, drückt die Vereinigung des Subjeckts und Objects aus.“ In diesem Kontext verwendet er den Begriff „Seyn“ zunächst im Zusammenhang mit der Kritik am Kantischen und Fichteschen transzendentalen Ich. Mit seinem Begriff des „Seyn“ versucht er m. E., das Unendliche oder das Absolute anzubieten, das der Ich–Identität, nämlich dem reinen Ich als der Identität des Ich mit dem Nicht– Ich, zugrunde liegt. 44 zur Wirklichkeit in eine unüberbrückbare Kluft. In diesem Sinn bezeichnet Hegel die kantische Tugend als „ein Sollen“ und sagt, dass „das eine zum Herrschenden, das andere zum Beherrschten wird“. (Früh., S. 321 und S. 326) Deswegen geht Hegel im Fragment über den „Geist des Christentums“ davon aus, dass der Geist der Liebe allein es vermag, im politisch-gesellschaftlichen Leben die Versöhnung mit dem Schicksal und dem Fremden herbeizuführen. In diesem Zusammenhang befasst sich Hegel mit der Vereinigung des Lebens, die aus dem der Liebe entgegengesetzten Konflikt unter den Menschen wiederherzustellen ist. Um den Konflikt und den Streit in der Gesellschaft zu beschreiben, spricht Hegel auch von „Schuld und Schicksal“ des Verbrechens. Mit diesem Terminus richtet Hegel im Lichte der Erklärung über die griechische und shakespearsche „Tragödie im Sittlichen“ 31 den Blick auf die Sünde, die Vergebung, die göttliche Verzeihung bzw. die Begnadigung als den einheitlichen „Motor“ des Lebens. Hegel bezeichnet zunächst den Widerstand des Verbrechens gegen die positiven Gebote oder die abstrakten Gesetze als ein tragisches Schicksal. Diese Trennung des Lebens kann allein durch die Liebe aufgehoben werden, da der dem eigenen Schicksal widerstehende Verbrecher sich nur „in der Wiederherstellung des lebendigen Bandes, eines Geistes der Liebe“, der Scham, der Scheu und der Strafe bewusst wird. (Früh., S. 357) Einem solchen wieder erlangten Bewusstsein von der ethischen Verantwortung entsprechend wird der Rechtsstreit unter den Menschen auch im „Gefühl der Harmonie“ des Lebens überwunden und die individuellen Rechtsstandpunkte stimmen in der Harmonie des gesamten Lebens überein. (Früh., S. 363) Darüber hinaus leitet Hegel aus der Lehre Jesu auch noch die Freundschaft, die Nachbarschaft und die Solidarität 32 unter den Menschen ab, wenn er sagt: „Liebe, fordert Jesus, soll die Seele seiner Freunde sein: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt; daran wird man erkennen, daß ihr meine Freunde seid“. und dazu noch weiter: „Die Liebe zu dem Nächsten ist Liebe zu den Menschen“. (Früh., S. 362) 31 32 Vgl. Otto Pöggeler, „Hegel und die griechische Tragödie“, in: Hegel – Studien Beiheft 1, hrsg. v. Hans–Georg Gadamer, Bonn 1984, Aufl., 2, S. 286 – 289. Vgl. Andreas Wildt, „Hegels Kritik des Jakobinismus“, in: Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, hrsg. v. Oskar Negt, Frankfurt a. M. 1970, S. 284 – 285. 45 Von der christlichen Gemeinschaft aus will Hegel die altruistische Harmonie der Mitglieder der Gesellschaft miteinander herstellen. Dabei kommt die christliche Gemeinschaft bei ihm als eine der Liebe und eine Gestalt der freundschaftlich–solidarischen Beziehungen unter den Menschen in Betracht, weil die Beteiligten in dieser Gemeinde miteinander selbstlos waren, wie ein Club oder ein Verein in der modernen Gesellschaft, der durch dieselbe Zielsetzung zusammengehalten wird. Beim Eingehen auf die Gesellschaftstheorie Hegels im folgenden Kapitel, stellt sich nun die Frage, inwiefern die Liebe als Gefühl bei Hegel in der Argumentation der politisch–gesellschaftstheoretischen Philosophie sukzessiv noch immer verankert bleibt? Und mit welchem Stellenwert sie und das Leben im Naturrechtsaufsatz „System der Sittlichkeit“ Hegels eine Rolle spielt? 46 II - 2. Die Perspektive der politisch–gesellschaftstheoretischen Philosophie in der frühen Jenaer Zeit 2 – 1. Die Selbstnegation und die Selbstidentifizierung im Naturrechtsaufsatz In seinem Aufsatz „Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts“ 33 entwickelt Hegel sein Programm der politisch–gesellschaftlichen Philosophie – aus dem Zusammenhang und der Konsequenz der Forschung in den Jugendschriften heraus – im Rahmen der praktischen Philosophie. Damals war er „mit Schelling im wesentlichen einverstanden“, 34 d. h. er lehnte sich an die Schellingsche Terminologie mindestens bis zum „System der Sittlichkeit“ im Ablauf seiner Denkentwicklung an. In diesem Aufsatz versucht Hegel die antike Gesellschaftstheorie, genauer, die platonisch–aristotelische Konzeption in der praktischen Philosophie im Unterschied zu den Ansätzen des modernen Naturrechts zu erklären. In Hegels Augen ist das neuzeitliche Verständnis des Naturrechts in der isolierten Subjektivität verankert. In diesem Sinn haben sowohl Hobbes, als auch Kant und Fichte das vereinzelte Individuum als das fundamentale Prinzip der Vergesellschaftung von Menschen, der Äußerung Hegels zufolge, als „das Erste und Höchste“ angelegt. (Nat., S. 454) Beide Konzeptionen sind im Grunde den atomistischen Gesichtspunkten verhaftet geblieben; die abgeschlossene Einzelheit bzw. die idealisierte Subjektivität wird als die grundsätzliche Quelle des gesellschaftlichen Aufbaus vorausgesetzt. Hegel richtet daher seinen Blick auf die antike und traditionelle Gesellschaft, nämlich die Polis, die freilich den modernen Sozialsituationen, die durch die politischgesellschaftlichen Ereignisse z. B. der französischen Revolution, stark verändert sind, angemessen umformuliert werden soll. Dadurch, dass Hegel das Vorbild für das soziale Zusammenleben unter den Menschen in der antiken Polis sah, beginnt er den Aufsatz gleichermaßen mit der Kritik am Hobbesschen Naturzustand, an der Kantischen Morallehre und der Fichteschen Sittenlehre. So stellt er beim Eintritt in die immanente Auseinandersetzung mit Hobbes 35 fest, dass das eigentliche Gesellschaftsmodell Hobbes auf der Basis der „Fiktion des Naturzustands“ aufgebaut sei. (Nat., S. 447) Darüber hinaus nennt Hegel das Hobbessche Denkmodell „empirisch“ in dem Sinn, dass der Mensch bei Hobbes 33 34 35 G. W. F. Hegel, „Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften“, in: Jenaer Schriften 1801 – 1807, hrsg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1986, im folgenden wird diese Arbeit so abgekürzt: Nat. K. Rosenkranz, Hegels Leben, S.162. Vgl. Ludwig Siep, „Der Kampf um Anerkennung – zu Hegels Auseinandersetzung mit Hobbes in den Jenaer Schriften“, in: Hegel – Studien, hrsg. v. Friedhelm Nicolin und Otto Pöggeler, Bd. 9, Bonn 1974, S.155 - 161. 47 nur als die an den eigenen Bedürfnissen verhaftete Existenz bezeichnet wird, wenn Hobbes den Kampf aller gegen alle als die Prämisse der menschlichen Gesellschaftsbildung nennt. Aus dieser Vorstellung des Kampfes aller gegen alle im Naturzustand heraus, hat er schließlich den Staatsvertrag begründet. Doch diese Gesellschaftskonzeption vom Naturzustand enthielt für Hegel keine innere Notwendigkeit der Selbstaufhebung des chaotischen Naturzustands, 36 weil Hobbes aus dem Kampf aller gegen alle die Schlußfolgerung zog, dass das treibende Individuum im Konflikt nur durch die Furcht vor dem Tod getrieben sei und infolge dieser Todesangst zur Knechtschaft bereit sei. Mit anderen Worten: Das Individuum hat sich, dem Hobbesschen Begriff des Staatsvertrags zufolge, der fremden Herrschaft unterworfen, da sich der Staat in einem permanenten Kriegszustand befindet, in dem sich die Individuen im gegenseitigen Kampf um ihrer jeweiligen Ziele und ihrer Selbstbehauptung willen befinden. Demgegenüber arbeitet Hegel mit dem Begriff der Sittlichkeit 37 als die unverzichtbare Hoffnung während des Konfliktzustandes auf das Leben und die Möglichkeit der Verwirklichung der subjektiven Freiheit. Diesen Begriff führt er in diesem Aufsatz allerdings unter dem Einfluss der antiken, praktischen Philosophie von Platon und Aristoteles ein. Auch erinnert Hegel an die Morallehre Kants – freilich im Zusammenhang mit der Kritik an dessen Tugendlehre in den Fragmenten über die „Liebe“ bzw. im „Geist des Christentums“ – und an Fichtes Sittenlehre, die er „formell“ nennt. Im Rahmen der praktischen Philosophie seien Kant und Fichte, Hegels Ansicht zufolge, notwendigerweise zur formellen Leerheit gelangt, weil beide Philosophen das Gesetz auf die „absolute praktische Vernunft“ stellen wollten, die von „aller Materie des Willens“, also dem konkreten Inhalt der Handlung, abstrahiere. (Nat., S.461) Hegel verweist in Bezug auf Fichtes Sittenlehre darauf, dass dieser den „Zwang“ als einen unentbehrlichen Bestandteil in der prozessualen Einheit der einzelnen Willen mit dem allgemeinen Wille gesehen hat, so dass das rechtliche System der Gesellschaft bei Fichte durch einen von außen kommenden, transzendentalen Gewaltakt errichtet werden muss. (Nat., S.472) Beide Ansätze, sowohl der „empirische“ als auch der „formelle“, bleiben daher dem Begriff der isolierten Subjektivität und dem ausschließlichen Handlungsvermögen des Menschen verhaftet. Daraus ergibt sich für Hegel konsequenterweise, dass das Zusammenleben von Menschen im neuzeitlichen Naturrecht nicht als einheitliche Sittlichkeit gedacht wird, die erst nach einer organischen Entwicklung erreicht werden kann, sondern als 36 37 Vgl. Ebd., S.159. K. Rosenkranz, Hegels Leben, S.173, wo er sagt, dass „zum ersten Male [...] Hegel nun öffentlich den Ausdruck Sittlichkeit für diejenigen Formen des praktischen Geistes […]“ einführe. 48 die äußerliche Verkettung von Menschen. Deswegen muss „der fremde Herr“ oder „der äußerliche Zwang“ in beiden Ansätzen notwendigerweise hinzufügt werden. Diesen Einwand gegen den Atomismus im neuzeitlichen Naturrecht findet Hegel in der „absoluten Sittlichkeit“ als der lebendigen Vereinigung der einzelnen mit dem allgemeinen Willen, die die antiken Stadtstaaten als eine musterhaft harmonisierte Sittengesellschaft darstellen. (Nat., S. 480) Dementsprechend drückt er die Vorraussetzung für die sozialen Wechselbeziehungen unter den Subjekten folgendermaßen aus: „[D]ie absolute sittliche Totalität ist nichts anderes als ein Volk.“ (Nat., S.481) Demzufolge geht er davon aus, dass die Triebe und Bedürfnisse aller Subjekte zunächst in dem lebendigen Spielraum des eigenen Volks, in dem die Sitte bereits vorhanden ist, ihre Erfüllung finden; anders gesagt, dass das Volk ein einheitlicher Ort und ein lebendiges Netzwerk ist, in dem die Bedürfnisse und Triebe der im egozentrischen Privatinteresse verhafteten Menschen miteinander kollidieren. Dementsprechend zitiert Hegel einen berühmten Satz von Aristoteles: „Das Volk ist eher der Natur nach als der Einzelne.“ (Nat., S. 505) Dessen ungeachtet kann, anders als die antike Polis, die moderne Gesellschaftsform bei Hegel nicht in der indifferenten Gestalt haften bleiben, in der die Subjekte die direkte Harmonie mit dem eigenen Volk fühlen. Denn das Subjekt zeigt sich einerseits als Beteiligter der Gesellschaft im Horizont der Versöhnung mit dem gesellschaftlichen System, andererseits als der handelnde Einzelne zur Befriedigung des eigenen Bedürfnisses. Hier handelt es sich für Hegel um „das Verhältnis der organischen zur unorganischen Natur.“ (Nat., S. 487) In Hegels Augen soll das dem modernen Zeitgeist entsprechende Gesellschaftssystem dadurch anerkannt werden, dass jedes Mitglied der Gesellschaft im Verlauf der gegenseitigen Wechselwirkung des Konflikts im bereits vorhandenen Zusammenleben Schritt für Schritt zur intersubjektiven Anerkennung und wertvollen Erkenntnis der sozialen Sitte kommt. Die Lebendigkeit der Sittlichkeit muss bei Hegel deshalb auch eine der „Zonen des Sittlichen“ 38 aufweisen, die nichts anderes ist als 38 Vgl. Rolf-Peter Horstmann, „Über die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft in Hegels politischer Philosophie“, in: Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, hrsg. v. Manfred Riedel, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1975, S. 283. In diesem Hegelschen Kontext könnte von der griechischen „Tragödie im Sittlichen“ die Rede sein. Hegels Darstellung von der Tragödie im Sittlichen verweist freilich auf den Rechtsstreit in der gesellschaftlichen Rechtsform, den Hegel bereits mit der Kritik am abstrakten Positivismus im Judentum behandelt hat. Am Ende des Naturrechtsaufsatzes stellt Hegel in Bezug auf die Tragödie der „Orestie“ von Aischylos das Problem der Rechtsform in Frage. In der Orestie spielen beide Parteien, die gleichermaßen den Anspruch auf Gerechtigkeit und legitime Rechtsstandpunkte erheben können, eine zentrale Rolle: einerseits Agamemnon, Orest und Apollo als der Gott vom ewigen Licht, die die Öffentlichkeit, das Staatsgesetz und die gesellschaftliche Gerechtigkeit verteidigen. Andererseits Klytaimnestra und die Erinnyen als die Göttinnen der Rache, bei denen das Recht der Familie, die emotionale Beziehung und das Privatrecht den entscheidenden Wert haben. Dieser Konflikt zwischen dem Privatrecht bzw. der Mutterliebe und der Allgemeingültigkeit, der Öffentlichkeit bzw. dem Staatsrecht, macht in dieser Trilogie die tragische Geschichte und den unauflösbaren Widerstreit aus. Durch den tragischen Prozess führt die Göttin Athene den Rechtsstreit endlich zur Versöhnung. Der Weg zur Wiederherstellung der Vereinigung scheint bei Aischylos 49 das Andere der Gesellschaft, d. h. das Bedürfnis und die zu seiner Befriedigung notwendige Arbeit der Subjekte. (Nat., S. 499) Die Vergesellschaftung des Subjekts muss daher bei Hegel die doppelte Richtung des Strebens ermöglichen, d. i. einerseits das Streben nach dem eigenen Bedürfnis, andererseits das nach der Harmonie mit der Gesellschaft. Der Prozess der Vergesellschaftung darf bei ihm nicht die individuelle Freiheit verletzen, sondern muss ein emanzipatorisches Motiv aufweisen, aufgrund dessen die Mitglieder der Gesellschaft sich selbst durch das dialogische Handeln mit den Anderen von der Negativität und der Unendlichkeit der Bedürfnisse befreien können oder anders formuliert geht es darum, „im Risiko, sein Leben aufs Spiel zu setzen, die Chance der Erlangung der eigenen Freiheit“ 39 zu erreichen. Bezüglich des Übergangs von der Negativität und der Endlichkeit des menschlichen Strebens hin zu den gesellschaftlichen Handlungsnormen, d. h. über die Erfahrungsgeschichte der subjektiven Ich-Identifizierung im Prozess mit den Organisationsformen der Gesellschaft, zerbricht Hegel sich den Kopf und sagt das folgende: „Das Lebendige unter dieser Form des Negativen ist das Werden der Sittlichkeit und die Erziehung nach ihrer Bestimmtheit das erscheinende fortgehende Aufheben des Negativen oder Subjektiven, […].“ (Nat., S. 507) So gesehen stellt sich für das Subjekt zunächst die notwendige Aufgabe der Aufhebung des eigenen Selbst, die es als den Samen der Reintegration in die Gesellschaft bereits in sich enthält. Im sozialen Zusammenleben lernt das Subjekt nach und nach, dass seine egozentrischen Bemühungen und sein Streben erfolglos und schließlich nicht durchführbar sind. Aus dieser Erkenntnis heraus wendet das Subjekt seine Aufmerksamkeit den „lebendigen vorhandenen Sitten“ zu. (Nat., S. 508) Für Hegel ist entscheidend, wie die Indifferenz 39 und die Unendlichkeit als zwei verschiedene Phänomene auf der eine Art religiöse Erlösung zu enthalten. In Bezug auf diese Aischyleische Tragödie geht es bei Hegel um zwei Punkte: Hegel sieht erstens in der antiken Tragödie die tragischen und leidenden Elemente im Übergang zur Sittlichkeit. Die Tapferkeit von Orestes als der Hauptfigur dieser Tragödie erlangt keine Gerechtigkeit, Sittlichkeit, ohne das Leiden zu durchlaufen. Nur im Angesicht der Todesangst kann er sich der öffentlichen Sitte öffnen. Mit der sittlichen Tapferkeit, der Bereitschaft, sich selbst für die staatliche Gerechtigkeit zu opfern, kann diese Hauptperson des tragischen Schicksals die Versöhnung der „doppelte[n] Natur“ zur Erscheinung bringen. (Nat., S. 495) Für Hegel gilt es an dieser Stelle zu sehen, dass die Natürlichkeit, das Privatinteresse bzw. der Rechtsstandpunkt nur durch die Tapferkeit im Angesicht der Todesangst überwunden werden kann, dass die Sittlichkeit des Gemeinwesens nur durch die Selbstaufopferung gestiftet wird. Hegel kommt mit dieser dramatischen Szene zweitens zu der Einsicht, dass das Verbrechen eine negative Handlung im Sittlichen ist. Orestes spielt, so wie das tragische Schicksal in Shakespeares Drama Hamlet die Rolle des Verbrechers zuschreibt, den Muttermörder. Diese verbrecherische Handlung impliziert im Sinn Hegels die Zerstörung der Ich–Identität. Die Zerstörung des Ich, die aus der Unterbrechung mit der eigenen Herkunft entsteht, zwingt den Verbrecher, die Frage nach dem Leben selbst zu stellen. Aus dieser zerstörenden Handlung ist die grundsätzliche Fragestellung der Ich–Identität entstanden. W. Bonsiepen, Der Begriff der Negativität, S. 85. 50 Gesellschaftsebene notwendig und harmonisch zugleich zur Vereinigung gelangen können, ohne dass die individuelle Freiheit in diesem Vereinigungsprozess verletzt wird. „Die absolute Sittlichkeit“ erscheint daher bei Hegel als das in der bestehenden Organisationsform lebendige Seiende, als die sich mit der Wirklichkeit bewegenden Sitten und das diesen angemessene Subjekt. Diese kritische Untersuchung über die neuzeitlichen Naturrechtslehren enthält noch nicht den Schlüssel zur Problemlösung im Rahmen der praktischen Philosophie, obwohl Hegel mit diesem Aufsatz ursprünglich das Ziel verfolgt hatte, die Harmonie der Individuen mit der Gesellschaft mit Bezug auf das Vorbild der antiken Sittengesellschaft darzustellen. Hier entwickelt er sein Programm der politisch–gesellschaftlichen Philosophie noch unter den Einflüssen einerseits von Schellings Terminologie bzw. Einsicht in die Natur 40 und andererseits von Hölderlins Resultaten der Interpretation der griechischen Literatur aus der Perspektive einer Vereinigungsphilosophie. In diesem Sinn kann man im Anschluss an die Behauptung von Axel Honneth sagen, dass Hegel „die angemessenen Mittel“ in seinem System noch nicht angelegt hat. 41 Erst nach der Rezeption und der Auslegung von Fichtes Anerkennungslehre 42 gewinnt der Begriff der intersubjektiven Anerkennung für Hegel seinen Stellenwert. Er gewinnt ihn aus der Lebendigkeit der Sittlichkeit als der inneren Struktur des Aufeinanderbezogenseins der Vergesellschaftung und der sich wiederholenden Negativität der Subjekte. 40 41 42 Vgl. zur Schelling–Rezeption des Naturbegriffes im Zusammenhang der Darlegung von Hegels Naturrecht, und zur Zweideutigkeit von Hegels Naturbegriff im Unterschied zu Schellings Auffassung, Rolf-Peter Horstmann, „Probleme der Wandlung in Hegels Jenaer Systemkonzeption“, S.108 – 113. Vgl. Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, S. 25 – 29 und dazu ders., „Moralische Entwicklung und sozialer Kampf – Sozialphilosophische Lehren aus dem Frühwerk Hegels“, in: Zwischenbetrachtung, hrsg. v. ders., Thomas McCarthy, Claus Offe u. Albrecht Wellmer, Frankfurt a. M. 1982 (Aufl. 2), S. 562, und dazu L. Siep, Anerkennung als Prinzip, S.146. Vgl. Andreas Wildt, Autonomie und Anerkennung – Hegels Moralität im Lichte seiner Fichte–Rezeption, Stuttgart 1982, S. 312 ff. 51 2 – 2. Liebe und Anerkennung als das Prinzip der Sozialbeziehung zwischen den Subjekten im „System der Sittlichkeit“ Nach der kritischen Uminterpretation und Rezeption Fichtes und Hobbes konzipiert Hegel das „System der Sittlichkeit“, das von Rosenkranz so benannt wurde und damals als unveröffentlichtes Manuskript vorlag, 43 das aber noch immer unter dem Einfluss der antiken Ansätze im Bereich der politisch–gesellschaftlichen Philosophie so wie auch der Naturrechtsaufsatz steht. Das Ziel dieses Manuskriptes ist nach Hegels Terminologie „die absolute Sittlichkeit“, 44 die einerseits von der Einzelheit zur Allgemeinheit übergegangen ist, andererseits aber auch die Allgemeinheit der Einzelheit zugänglich macht. Diesen Zweck bezeichnet Hegel geradezu als „ein und nur ein Verhältnis“, 45 das in diesem Manuskript das Einssein des Begriffs mit der „Anschauung“ – von da aus wäre es vorstellbar, dass Hegel sich noch immer an Schelling orientiert – ist; anders formuliert, dass die soziale Integration des natürlichen Individuums in das Volk durchaus in Erfüllung gegangen ist. Das Ziel dieses Entwurfs, wie Hegel selbst geschrieben hat, „die Idee der absoluten Sittlichkeit zu erkennen“ (SdS., S. 3), ist die Einheit des Einzelnen mit dem Volk als die konkrete Gestalt des allgemeinen Geistes, was bedeutet, dass die Binnenstruktur der Versöhnung des einzelnen Subjekts mit dem „Gott des Volks“ (SdS., S. 49) in den Vordergrund gestellt wird. Um dies zu veranschaulichen, stellt Hegel hier das Schema der wechselseitigen Subsumtion von Begriff und Anschauung dar. Noch konkreter formuliert, können die wechselseitigen Subsumtionsverhältnisse auf den folgenden Stufen erfasst werden: Zunächst ist das Allgemeine als ein indifferentes Sein im Einzelnen verborgen, nämlich in der Gestalt des Gefühls des Einzelnen nicht ganz zu erfassen; zweitens ist das Allgemeine vom Einzelnen abgehoben, lässt sich von der Indifferenz zur Differenz hinführen; und schließlich wird diese Differenz als die Selbstdifferenzierung auf der Seite des Allgemeinen vorgenommen, so dass das Allgemeine zugleich zu sich selbst zurückgekehrt ist, womit die Integration des Einzelnen 43 K. Rosenkranz, Hegels Leben, S. 124. Uns ist bereits bekannt, dass Hegel diese Sittlichkeit als „zweite Natur“ in seiner späten Rechtsphilosophie bezeichnet hat. Damit können wir feststellen, dass der Einfluss Aristoteles’ praktischer Philosophie auf Hegels Denkweg von dem „Naturrechtsaufsatz“ über das „System der Sittlichkeit“ hin zur Rechtsphilosophie konsequent wirksam ist. In seiner Rechtsphilosophie sagt Hegel: „Der Boden des Rechts ist überhaupt das Geistige und seine nähere Stelle und Ausgangspunkt der Wille, welcher frei ist, so dass die Freiheit seine Substanz und Bestimmung ausmacht und das Rechtssystem das Reich der verwirklichten Freiheit, die Welt des Geistes aus ihm selbst hervorgebracht, als eine zweite Natur ist.“ Nun kann hiermit bei Hegel gezeigt werden, dass die Sittlichkeit als zweite Natur ein grundsätzliches Faktum des Menschseins, das wir deshalb unbedingt annehmen müssen, ist, wie die erste Natur als ein animalischer Trieb, wenn wir so sagen würden, die elementare Seite des menschlichen Lebens bildet. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel, Bd. 7, Frankfurt a. M. 1986, S. 46, § 4. 45 G. W. F. Hegel, System der Sittlichkeit. Critik des Fichteschen Naturrechts, hrsg. v. Horst D. Brandt, Hamburg 2002, S. 3, im folgenden abgekürzt: SdS. 44 52 ins Volk bzw. der Volksgeist hier zum Vorschein kommt. Bei der Darstellung des stufenförmigen Übergangs von der Natürlichkeit des einzelnen Subjekts zum allgemeinen Volk steht Hegel überdies unter dem Einfluss von Aristoteles’ politisch–gesellschaftlichen Philosophie. 46 Bei ihm kommt es nicht darauf an, dass der Staat als die konkrete Gestalt der absoluten Sittlichkeit der Not– und Verstandesstaat ist, sondern sich vielmehr in den vielfältigen Lebensformen der Individuen konkretisiert und realisiert. Dementsprechend konzentriert sich Hegel in Teil III „Sittlichkeit“ auf die allgegenwärtigen Systemformen des Volkes, die Verfassung und die Regierungsform. Hegel unterteilt das „System der Sittlichkeit“ in die drei folgenden Komponenten: Die „natürliche“, „relative“ und „absolute“, Sittlichkeit. Auf der Stufe der natürlichen Sittlichkeit bleibt das Individuum zunächst im lebhaften, aber abstrakt–allgemeinen Trieb verhaftet. Von daher macht es nur mit der Befriedigung seiner Triebe in sich die Erfahrung, „daß der Begriff und die Anschauung Eins ist.“ (SdS., S. 4) Im Prozess der Befriedigung der Triebe begegnet es zwar dem Anderen, betrachtet diesen Anderen aber lediglich aus der Perspektive des Geschlechterverhältnisses. In diesem Zusammenhang findet es den Anderen im Gefühl der Liebe, aber trotzdem nur im indifferenten Naturzustand. Der Terminologie Hegels zufolge wird diese Stufe als „die Subsumtion des Begriffs unter die Anschauung“ ausgedrückt. (SdS., S. 5) In diesem Geschlechterverhältnis zeugt es seine Nachkommen, anders formuliert, reproduziert es die Gattung. Diese Handlung ist eine instinktive und animalische der je einzelnen Individuen. Der zweite Teil, der als „Das Negative, oder die Freiheit, oder das Verbrechen“ benannt wird, (SdS., S. 33ff.) stellt bereits die interpersonelle Wechselbeziehung dar, in der sich das Handeln aller Beteiligten auf deren egoistischen Eigensinn zurückführen lässt. Somit befindet sich jeder im Widerspruch zum Anderen und verteidigt seine Eigentümlichkeit gegen diesen. Hier scheitert die erste Sittlichkeit oder die menschliche Natürlichkeit in der Sittlichkeit, wie der Titel bereits andeutet. Diese Stufe können wir mit dem Ausdruck Hegels „die Subsumtion der Anschauung unter den Begriff“ nennen. (SdS., S. 23) Auf dieser Stufe bemüht sich das einzelne Subjekt nicht um die harmonische Verständigung mit dem Anderen und den Respekt vor dem Anderen, sondern schließt vielmehr den Anderen von seinem Privateigentum aus und verletzt dessen Persönlichkeit. Aus dieser Gegensätzlichkeit oder gegenseitigen Vernichtung heraus entsteht die absolute Sittlichkeit als das Allgemeine in Folge einer inneren Notwendigkeit. Zudem kommt, dass die 46 Vgl. L. Siep, Anerkennung als Prinzip, S. 162, und A. Honneth, Kampf um Anerkennung, S. 51. Der Äußerung Sieps zufolge, verwendet Hegel die Aristoteles–Konzeption von der politisch–gesellschaftichen Philosophie mehr im „System der Sittlichkeit“ als im Naturrechtsaufsatz. 53 Natürlichkeit des Menschen bereits das Potential zur Sittlichkeit enthält, wenn wir uns daran erinnern, dass Hegel von der natürlichen Sittlichkeit ausging. Im Konflikt soll das Subjekt sein ganzes Leben riskieren, weil der Andere auch sein Leben riskiert, um das Privatrecht und sein Eigentum zu verteidigen. Deshalb haben alle am Konflikt Beteiligten Todesangst, wissen also um die Möglichkeit des Todes, der jederzeit gleichermaßen vor ihnen liegt. Aus diesem Bewusstsein von der möglichen Todesgefahr heraus, stellt das Subjekt auch den höchsten Wert des allgemeinen Lebens oder zumindest die Bedeutung des eigenen Lebens in Frage. In diesem Sinn schreibt Hegel, „so muß diese, (= die Negation, KBL) daß das Ganze auf dem Spiel sei, zu einem Ganzen gesteigert werden.“ (SdS., S. 41) Daran anschließend wird der Unterschied zwischen dem Begriff und der Anschauung zur „intellektuelle[n] Anschauung“ (SdS., S. 48), sozusagen zur begriffenen Anschauung erhoben. Vor dem Horizont der erreichten Angemessenheit von Begriff und Anschauung kann „der Gott des Volks“, die Volksreligion selbst konkretisieren und entwickeln. (SdS., S. 49) Mit der obigen Übersicht über die Komposition des „Systems der Sittlichkeit“ müssen wir die Familie, die Arbeit und die Negation des Verbrechens als die Momente des Übergangs zur absoluten Sittlichkeit noch detaillierter erklären. Dabei wird die Rolle der Liebe in der personellen Interaktion und die der affektiv-emotionalen Reaktion der Familienmitglieder auf den verbrecherischen Akteur im Aufbau der Gesellschaft verdeutlicht. Für Hegel bildet, entsprechend Schellings Idee der „intellektuellen Anschauung“, die natürliche Sittlichkeit, die von Beginn an in der Natürlichkeit des Menschen verankert ist, die Grundlage für den Übergang zur absoluten Sittlichkeit: Die „erste Potenz“, die die Momente der Sittlichkeit impliziert, aber noch nicht ausführlich entwickelt, stellt sich zuerst als die Gestalt unseres „Gefühls“ dar. Von hier aus ist das Gefühl nicht nur die Befriedigung des einzelnen Privatinteresses, sondern liegt auch der gesellschaftlichen Handlung zugrunde. Das heißt, dass das Gefühl bei Hegel beide Seiten in sich enthält: Erstens erscheint das Gefühl als die Ursache des einzelnen Bedürfnisses, wie Hegel schreibt, „das Gefühl der Trennung“, das den Anderen vom eigenen Interesse ausschließen will. Gemäß dem Gefühl der Begierde steht das einzelne Subjekt von vornherein dem anderen Subjekt gegenüber. Zweitens ist die Sittlichkeit das bereits im Gefühl Verborgene, nämlich das dem Gefühl innewohnende Vorhandensein. Dementsprechend nimmt Hegel das Gefühl als „die praktische Potenz“ an, in deren Entfaltung das einzelne Subjekt den Anderen findet und der wechselseitigen Beziehung auf den Anderen bedarf. (SdS., S. 5) Das Subjekt taucht zunächst als das Handelnde, nämlich das Arbeitende auf, um das eigene Leben zu erhalten. Die Arbeit als die Handlung des Einzelnen zur Selbsterhaltung hat 54 hier auch eine doppelte Bedeutung: Sie zeigt sich einerseits als die einfachste und direkteste Begegnung mit der Natur, in der das Subjekt lediglich den Gegenstand seines Bedürfnisses verzehrt. Das ist der einfach vernichtende Akt des Subjektes gegenüber den Objekten. Andererseits ist sie auch eine produktive Handlung, obwohl sie auf der Seite des Objekts negiert wird. Mit dieser produktiven Handlung führt die ideelle Absicht das Subjekt vom Objekt zum real gewordenen Produkt hin, womit sich das Subjekt damit zugleich als Besitzer der Produkte behauptet. Im produzierenden Ablauf steht das einzelne Subjekt dem natürlichen Objekt jedoch nicht nur für die Befriedigung seines Bedürfnisses gegenüber, sondern auch anderen lebendigen Subjekten, die dieselbe Handlung wie es selbst vollziehen. Die Blickrichtung hin zum Anderen lenkt nunmehr das einzelne Subjekt in die andere Richtung einer distanzlosen Wechselbeziehung. In dieser Reaktion aufeinander erfährt das Subjekt nicht nur den Umgang mit dem lebendigen Anderen, sondern vielmehr auch die Anerkennung durch diesen. Die interpersonelle Reziprozität wird bei Hegel deshalb in dieser Stufe als „das differenzlose Gefühl“, nämlich die Liebe im Gesellschaftsverhältnis bezeichnet. (SdS., S. 12) Die Liebe in der Familie betreffend - durch die Konstruktion der Familie weicht das Subjekt erst vom vorgesellschaftlichen Zustand ab – äußert sich Hegel folgendermaßen: „Die Vernichtung der eigenen Form ist gegenseitig, aber nicht absolut gleich; es schaut sich jedes in dem anderen an, als zugleich ein fremdes, und dieses ist die Liebe.“ (SdS., S. 12) Durch die Selbsthingabe, wie der obige Satz uns zeigt, bewahrt das Subjekt die Fremdheit des Anderen in der Liebesbeziehung, obwohl die Liebe im Geschlechterverhältnis die antagonistische Entgegensetzung der Subjekte zur emotionalen Harmonie bzw. dem Vorbild der gesellschaftlichen Verbindung miteinander erhebt. Was die Liebe im Geschlechterverhältnis angeht, so setzt die Liebe die Verschiedenheit des Anderen voraus. In diesem Fall kann die Liebe dauerhaft lebendig sein. Mit anderen Worten: Nur wenn das Subjekt mit seinem Bedürfnis nach Liebe dem Anderen gegenüber Respekt vor der Fremdheit und der Eigentümlichkeit des Anderen erweist, kann diese Liebe zu einer lebendigen und tiefsinnigen werden. In diesem Zusammenhang bezeichnet Gadamer deshalb die Liebe als „eine konkrete Allgemeinheit“. (GW. 4, S. 390) Nach der Erfahrung der Liebe im Geschlechterverhältnis, nämlich der Eheschließung zwischen Mann und Frau, ist das Subjekt der noch immer in der Fremdheit verharrenden Liebe in die wahrhafte Liebe eingebettet, die durch die Zeugung des eigenen Kindes gelungen ist. Im Verhältnis von „Eltern und Kindern“ sieht das Subjekt das wahre Resultat der Liebe 55 zueinander, da es erkennt, wohin die Möglichkeit der sinnvollen Beziehung zwischen den Menschen führt und wie das Selbst aufeinander bezogen ist. Daran anschließend soll das Subjekt in der Person eines Elternteils mit der Erziehung und dem Wachstum des Kindes auch die Negation seiner selbst erfahren, da die subjektive Eigentümlichkeit des Kindes – denn das Kind hat mit seiner Geburt zugleich auch eine eigene Individualität – von vornherein anerkannt werden muss. Darüber hinaus eröffnet sich für die Eltern im Verlauf der Bildung des Kindes die Möglichkeit, sich selbst zu finden. Folglich ist die Konstruktion der Familie, in deren Organisation alle Glieder die absolute Hingabe an den anderen lernen und den gemeinsamen Anteil an den Familiengütern fordern können, für Hegel „die allgemeine Wechselwirkung und Bildung der Menschen.“ (SdS., S.13) Im Sinn Hegels verweist daher die Liebe auf „das praktische Gefühl“. (SdS., S. 6) Indem die Erziehung in der Familie auf die Selbständigkeit und die Persönlichkeit des Kindes abzielt, muss die naturwüchsige Einheit von den Gliedern der Familie überwunden werden. Daher folgt auf die Überwindung dieser „Vereinigung des Gefühls“ das „Anerkennen“ 47 im Sozialverhältnis. (SdS., S. 13) Dennoch hat uns dieses Beispiel gezeigt, dass die Familie ihr Vorbild des unmittelbaren, aber auch vereinigten Anerkennungsverhältnisses unter den Subjekten, in der emotionellen Intimbeziehung fand, da das Subjekt in der Familie durch das Liebesverhältnis bereits die altruistische Selbsthingabe an den anderen und die Selbstaufopferung lernt. Nach der Zeugung bzw. dem Erziehungsprozess des Kindes als dem Resultat des natürlichen Gefühls der Liebe und der Aufhebung der emotional–natürlichen Verbindung innerhalb der Familie, muss das Subjekt von der indifferenten Verbindung, der affektiv– distanzlosen Vereinigung in der Familie, zum differenzierten Rechtsverhältnis übergehen. In der „Mitte“ der Transformation ins Sozialverhältnis steht das Kind, dessen Übergang daher den doppelten Sinn hat: Die gefühlvolle Liebe von Mann und Frau ist erstens durch die Geburt des Kindes in die natürliche, aber allgemein unbedingte Liebe zwischen „Eltern und 47 56 In diesem Kontext hat Hegel erstmals den Begriff der Anerkennung im „System der Sittlichkeit“ verwendet. Anschließend können wir darauf hinweisen, dass Hegel die Fichtesche Terminologie „Anerkennung“ nach seiner Uminterpretation und Rezeption positiv aufgenommen hat. Fichte hat in seiner Schrift über die „Grundlage des Naturrechts“ das wechselseitige Rechtsverhältnis unter den Personen in der Gesellschaft als „Selbstbeschränkung“ verstanden, die aus dem Bewusstsein vom Anderen entsteht. Deswegen ist bei ihm die Person im Sozialverhältnis „durch ihre (= Personen, KBL) wechselseitige Anerkennung“ definiert und bedingt. Dementsprechend führt die wechselseitige Anerkennung unter den Menschen im Rechtsverhältnis die Glieder der Gesellschaft auf die Allgemeinheit hin. Diese Einsicht Fichtes in die Rolle der Anerkennung beim Übergang des einzelnen Bewusstseins zum allgemeinen Bewusstsein hat Hegel in Bezug auf die Anerkennung im „System der Sittlichkeit“ übernommen. Darüber hinaus hat er auch gesehen, dass die Sittlichkeit im Sozialverhältnis den interpersonellen Interaktionen, nämlich den wechselwirkenden Handlungen, zugrunde liegt und das gegenüber dem Anderen entgegengesetzte Subjekt seine isolierte Selbstheit im Angesicht der allgemeinen Institutionen durch die Bewegung der Anerkennung konstituiert. Johann Gottlieb Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, in: Fichte Werke, hrsg. v. Immanuel Hermann Fichte, Bd. III, Berlin 1971, § 12, und dazu Vgl. A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 321ff. Kind“, wie Hegel erwähnt, in „die reale Vernünftigkeit der Natur“ eingebettet. (SdS., S. 14) Die Liebe, die aus dem sexuellen Unterschied entsteht, ist in der indifferenten, nämlich der natürlichen Anschauung, bereits enthalten. Zweitens ist die Familie als die distanzlose Organisation der Liebe, in der die Subjekte emotional aufeinander bezogen sind und die Dinge, die für den Lebensunterhalt nötig sind, gemeinsam besitzen, ihrerseits notwendigerweise ins Rechtsverhältnis eingebettet. Das Subjekt, das die gemeinsame Produktion und den kollektiven Genuss in der Familie erfahren hat, begegnet im Verlauf der Arbeit für das Leben der Familie anderen Gemeinschaften der Liebe. In der Selbsteinbettung ins Rechtsverhältnis müssen alle Subjekte die implizite Negation des egoistischen Privatinteresses erfahren, wie dies die Mitglieder der Familie zugunsten der Liebe zu den aufeinander bezogenen Wesen tun. Nach der negativen Bedingtheit gelangen die Subjekte zur wechselseitigen Anerkennung ihres „Personenseins“, die die Voraussetzung für die Tauschbeziehung des Besitzes im Sozialverhältnis ist. (SdS., S. 28) Unter der Voraussetzung der bloß „negativen Freiheit“ unter reziproken Bedingungen stimmt das Subjekt mit dem „Tauschwert“ überein und schließt den „Vertrag“ ab. Bleiben die Subjekte in der aufeinander beschränkten Symmetrie im Sozialverhältnis, so sind sie alle bei Hegel ein „freies Wesen“. (SdS., S. 28) Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Subjekte in den konventionellen Institutionen nur durch die begrenzende Selbstnegation zur Freiheit kommen können. Im zweiten Teil macht Hegel auf „das Verbrechen“ aufmerksam, das die im symmetrischen Verhältnis konstruierte Gemeinsamkeit bzw. das aus dem „Anerkennen des Lebens“ selbst entstandene Zusammenleben zerstört. (SdS., S. 28) Die zerstörende Handlung des Verbrechers verursacht nunmehr „den Kampf um Ehre“. In diesem Vorgang kommt es für alle Beteiligten nicht auf die eigene Ehre, sondern vielmehr auf die der ganzen Familie oder der Gruppe an. Somit sei die Behauptung gewagt, dass das Subjekt im familialen Intimbereich als der natürlichen Sittlichkeit, die somit vorgesellschaftlich wäre, durch sämtliche Kompositionen des „Systems der Sittlichkeit“ bereits die Anerkennung durch den Anderen, gewissermaßen die anderen Mitglieder der Familie, gewonnen hat,48 obwohl das anerkannte Zusammenleben stets von der verbrecherischen Handlung spannungsvoll bedroht wird. Auf die Negation der „natürlichen Sittlichkeit“, quasi die Aufhebung der im Gefühl verhafteten Vereinigung, folgt daher die Subsumtion der Anschauung unter den Begriff im zweiten Teil. Die grenzenlose Begierde, d. h. die grenzenlose Behauptung der negativen Freiheit der Individuen kommt auf dieser Stufe zum Vorschein. Hier handelt es sich erneut um die negierende Handlung zwischen den atomisierten Subjekten des Rechtsverhältnisses, in 48 Vgl. L. Siep, Der Kampf um Anerkennung, S. 170. 57 dem sich das Subjekt als die Einzelheit gegen die durch das wechselseitige Anerkennen etablierte Ganzheit richtet. Somit macht das einzelne Subjekt bei der Entstehung der negierenden Handlung des Verbrechens zugleich die Erfahrung, dass die Anerkennung in der „natürlichen Sittlichkeit“, vor allem in der Familie, eine unvollständige oder unmittelbare nur unter den emotional verbundenen Mitgliedern ist. Hegel bezeichnet den ersten Typ der destruktiven Handlung als „die natürliche Vernichtung“, sozusagen die „Verwüstung“. Lediglich macht diese destruktive Handlung schließlich den Akt der „zwecklose[n] Zerstörung“ aus, der sich aus dem bedingungslosen Gegenstoß gegen die gebildete Sittlichkeit ergibt und den pathologisch verblendeten Hass gegen die „Gebildeten“ im Busen trägt. (SdS., S. 34-36) Solcher pathologischen Zerstörung mangelt es deshalb, Hegels Ansicht zufolge, an dem Moment der wechselseitigen Anerkennung im Rechtsverhältnis, da auch die ontologische Basis für das soziale Handlungsverhältnis unter den Menschen von diesem Akt der uneingeschränkten Verwüstung zerstört werden kann. Mit dieser Auffassung nennt Hegel den zweiten Typ der negativen Handlung, nämlich „Beraubung“ und „Diebstahl“. (SdS., S. 315) Diese verbrecherische Handlung sei jedoch im Sinn Hegels das notwendige Motiv auf dem Wege zur absoluten Sittlichkeit, das die an der Gesellschaft beteiligten Subjekte, die im Rechtsverhältnis verankert sind, erfahren müssen. Unter den Bedingungen der sich selbst negierenden Handlung in Verbindung mit dem Anderen hat das Subjekt das Bewusstsein, dass sein Recht durch den Anderen anerkannt werden muss, um die nur in der subjektiven Möglichkeit gebliebene Freiheit wirklich zu realisieren. Diese Selbstnegation kann man als die „negative“ Freiheit bezeichnen. Abgesehen davon hat die negative Handlung des Verbrechens, die Hegel hier ins Zentrum stellt, zuallererst mit der Verletzung der Persönlichkeit, noch dazu mit der Verachtung des Eigentumsrechts durch den sozialen Anderen zu tun, wie es bereits im Rechtsverhältnis der Familie etabliert wurde. In der verbrecherischen Handlung verletzt der Verbrecher absichtlich die Persönlichkeit des Anderen, da die Person bereits das Eigentumsrecht durch ihr besitzergreifendes Handeln zum Ausdruck bringt. Folglich ist die Verletzung des Eigentums nichts anderes als die Beleidigung der anerkannten „Person“, die sich auf die gegenseitige Anerkennung im Rechtsverhältnis gründet. Die verletzte Person muss nunmehr die Bereitschaft zeigen, das eigene Leben auf dem Konfliktfeld einzusetzen, um das eigene Recht und das eigene Leben vor der Bedrohung durch den Anderen zu schützen: Das die beleidigende Handlung erleidende Subjekt soll jetzt auf die rechtswidrige Handlung des Anderen reagieren. Aus diesem wechselseitig aufeinander wirkenden Handlungsverhältnis entsteht daher, Hegel zufolge, der Kampf der Person gegen die Person im Rechtsverhältnis. 58 Mit seinem Recht auf Widerstand kann das Subjekt im Verlauf der kämpferischen Auseinandersetzung auch die Legitimität der Vergeltung, nämlich die rächende Gerechtigkeit, fordern. Die Konfrontation, die aus der beraubenden Handlung des Verbrechens resultiert, beruht bei Hegel ihrerseits auf der Wiedererlangung der Beteiligung am „Leben“ und der „ganze[n] Persönlichkeit“, weil der Konflikt im Rechtsverhältnis, die Verletzung des Eigentumsrechts, schließlich auf den Kampf um die Ich-Identität bzw. die Integrität der eigenen Autonomie hinausläuft. (SdS., S. 41) Anschließend daran geht der Kampf um das Eigentum im Rechtsverhältnis nunmehr in den Kampf um „Ehre“ über, weil die Beraubung des Eigentums hier zuallererst als eine Verletzung der „ganzen Persönlichkeit“, der eigenen Ehre, angesehen wird. Durch die Verteidigung des verletzten Subjekts gegen die Beraubung gelangt das Subjekt schließlich zu dem Bewusstsein, dass die verbrecherische Handlung die eigene Ehre verletzt hat, welche durch die positive Identifizierung mit seinen Eigenschaften und seinem persönlichen Charakter und durch die Art und Weise, wie es mit Situationen umgeht, gebildet wird. Folglich „[wird] durch die Ehre“, wie Hegel geschrieben hat, „das Einzelne zu einem Ganzen und Persönlichen.“ (SdS., S. 42) Die Ehre ist deshalb im Sinn Hegels nichts anderes als die Ganzheit der Persönlichkeit, bei der das Subjekt mit sich selbst identifiziert ist, seine Eigentümlichkeit ausbildet und zum Bewusstsein vom Anderen gelangt. Auf diese Weise macht das Subjekt die Erfahrung, dass sich seine eigentümliche Besonderheit nicht mehr auf seine isolierte Subjektivität gründet, sondern von der anerkannten Ganzheit abhängt: Jedes einzelne Subjekt gelangt zu dem Bewusstsein, dass die eigene Besonderheit nur durch die wechselseitige Anerkennung erhalten werden kann. Das Subjekt setzt sich gegen den Angreifer zur Wehr, um die verletzte Ehre wiederherzustellen. Dabei versucht es, seine wertvolle Menschenwürde durch den Anderen zu gewinnen. Der Äußerung Hegels zufolge muss das Subjekt dafür sein „Leben auf das Spiel“ setzen und das Leben des Gegners gleichermaßen gefährden. (SdS., S. 43) Aber diese Tapferkeit, die selbst die Todesangst überwunden hat, bezieht sich nicht mehr auf das Privatinteresse, sondern vielmehr auf die Ehre der Familie, die affirmative Möglichkeit, die eigene Freiheit in der Gemeinschaft zu realisieren. Denn die Familie ist bereits die Ganzheit, die die wechselseitige Anerkennung in der natürlichen Sittlichkeit erfüllt und in deren Liebesbeziehung die Mitglieder sich als miteinander Gleiche anerkennen. In diesem Sinn spielt das Subjekt nicht als das isolierte, sondern als „Glied eines Ganzen“ seine Rolle. (SdS., S. 45) In der tapferen Bereitschaft zum Tod für die Ehre der Gemeinschaft, lernt das Individuum die Selbstaufopferung und den Verzicht auf das egoistische Privatinteresse, so wie die großen Helden der griechischen 59 Stadtstaaten tapfer um die Ehre ihres Volkes kämpfen. 49 So ist bei Hegel die Voraussetzung für die vollständige Integration in die Gesellschaft, in „die absolute Sittlichkeit“, dass das Subjekt die Negation seiner eigenen Besonderheit vollzieht. Durch den geschichtlichen und gesellschaftlichen Lernprozess der Selbstnegation hindurch, gelangt das Subjekt nun auch als ein Glied des Volkes zum allgemeinen Bewusstsein, dem Geist der allgemeinen Sittlichkeit. Im Hinblick auf den Erziehungsprozess des Subjekts zur absoluten Sittlichkeit, vor allem angesichts der freiwilligen Integration ins Volk, könnte man davon sprechen, dass zunächst die von der Familie vermittelte Liebe die erste musterhafte Kontur der Vergesellschaftung skizziert. Daran anknüpfend wird für das Volk zweitens die emotionale Intimbeziehung, d. h. die Solidarisierung mit dem sozialen Anderen, wie sie bereits beim Aufbau der Familie ihre hervorragende Funktion geleistet hat, möglich. Schließlich wird auch die distanzlose Vereinigung des Individuums im Rechtsverhältnis mit den gesellschaftlichen Institutionen durch die „solidarisch-freundliche“ Beziehung möglich. 50 Nach dem „System der Sittlichkeit“ geht Hegel den Schritt zur „Bewusstseinsphilosophie“ im Systementwurf von 1803/04, vor allem im Fragment über die „Philosophie des Geistes“. In diesem Systementwurf zeigt er im Rahmen der Gesellschaftstheorie auch, wie die gesellschaftliche Harmonie durch die Konflikte der Individuen untereinander bzw. der Gemeinschaft oder der Gruppe mit einer anderen Gruppe usw. hindurch erreicht werden kann, womit das einzelne Subjekt zugleich Zugang zum sittlichen Allgemeinen findet, also den allgemeinen Geist erkennen und anzuerkennen vermag. Wenn wir zugunsten unseres eigenen Lebens zusammenleben und das gemeinsame Aufeinander-Bezogen-Sein im geteilten Lebensraum die ontologische Grundlage dafür bildet und wir daher den wechselseitigen Respekts als eine anerkennende Handlungsnorm benötigen, in der der Widerspruch, der das Leben zerstört, aufgehoben ist, dann sollten wir zunächst dieses orientierungsleitende Handlungsmuster erkennen und akzeptieren können. Indem Hegel den intellektuellen Bildungsprozess des Subjektes, sozusagen die Erfahrungsgeschichte des stufenweisen Übergangs des Einzelnen zum Allgemeinen, in diesem Systementwurf behandelt, versucht er die Fähigkeit der Erkenntnis des Allgemeinen aus dem „Bewusstsein“ als der ontologischen Grundlage der Erfahrung zu entwickeln. In den Augen Axel Honneths jedoch, vollzieht Hegel die Umwandlung ins Bewusstsein, das als Charakter der homogenen Individualisierung oder der Monologisierung der Vergesellschaftung bezeichnet werden kann, „mit dem Preis des Verzichtens auf einen 49 50 Vgl. Anm. 38. Vgl. A. Wildt, Hegels Kritik des Jakobinismus, S. 277 – 280, und dazu A. Honneth, Kampf um Anerkennung, S.44 und S.46. 60 starken Intersubjektivismus“. 51 Die Subjektivität Hegels als „Prinzip der neuen Zeit“ wird auch bei Habermas in der Selbstbeziehung aufgegriffen, die die in sich reflektierende Bezugnahme des Subjektes auf sich ist, d. h. den Unterschied zu sich selbst und die Identität mit sich selbst als die Gestalt der Rückkehr zu sich deutet. Anschließend daran unterstellt Habermas, dass Hegel „nach dem Muster der Selbstbeziehung eines erkennenden Subjekts“, nach dem Paradigma von der Subjekt-Objekt Beziehung, den absoluten Geist als die egozentrische Subjektivität aufgefasst hat und damit sowohl den allgemeinen Geist als auch die erkennende Struktur des Subjektes im Modell der sich auf sich selbst beziehenden Einheit begriffen hat. Folglich wird das einzelne Subjekt bei Hegel mit dem allgemeinen Subjekt gleichgesetzt. Der Äußerung von Habermas zufolge ist der absolute Geist Hegels daher nichts anderes als die „höherstufige Subjektivität“. 52 Gleichwohl hält Hegel m. E. den Zwiespalt zwischen den doppelsinnigen Denkansätzen, bei denen einer im Prinzip der Subjektivität verankert ist und der andere nach dem intersubjektiven Handlungsmodell im Leben gründet, nach der Denkentwicklung zum Bewusstsein im Systementwurf 1803/04 aufrecht. So gesehen kann man davon ausgehen, dass Hegels Begriff des Bewusstseins im Systementwurf 1803/04 die ontologische Basis der Ich-Identifizierung im Rahmen der Gesellschaftstheorie darstellt; diese wird durch das verwobene Netzwerk mit dem Anderen und der Gesellschaft zugleich gebildet. Andererseits kann man Hegels Denkentwicklung zum Bewusstsein die präzisierte Analyse der Erfahrungsphänomene, die er mit Blick auf den Bildungsprozess des Bewusstseins durchgeführt hat, entnehmen, auch wenn das vermutlich bedeutet, dass das intersubjektive Aggregat zwischen den isolierten Individuen nach dem Systementwurf 1803/04 seine zentrale Stellung verloren hat. Hegel bezeichnet auch in der Geistesphilosophie 1803/04 noch deutlich die Sprache, die Arbeit und die Liebe in der Familie als die „Potenzen“, „Mitte“ des Bewusstseins der intersubjektiven Wechselbeziehung, obwohl er hier den Wechsel zur Konzeption der Bewusstseinsphilosophie ansetzt. 53 In diesem Systementwurf betrachtet Hegel die absolute Sittlichkeit als das allgemeine Bewusstsein, den so genannten „sittlichen Geist“, 54 den das einzelne Bewusstsein im Anerkennungsverhältnis erreichen muss. In diesem Zusammenhang entstehen die erscheinenden Gestalten der Sittlichkeit, d. i. des Geistes, die bei Hegel von vornherein nicht als starres Insichbestehen, sondern als das sich entfaltende „Einssein“ gefasst 51 A. Honneth, Ebd., S. 53. Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M. 1986, (3. Aufl.), S. 27 und S. 53. 53 Vgl. Wolfdietrich Schmied–Kowarzik, „Die Bedeutung der ‚Mitten’ des Bewusstseins (Sprache, Arbeit, Familie) in Hegels Systementwurf von 1803/04 und die spätere veränderte Konzeption“, in: Die Eigenbedeutung der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels, hrsg. v. Heinz Kimmerle, Berlin 2004, S. 135 – 147. 54 G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe I – Das System der spekulativen Philosophie, hrsg. v. Klaus Düsing und Heinz Kimmerle, Hamburg 1986, S. 225, im folgenden abgekürzt: JSE I. 52 61 werden (JSE I., S. 183) und somit den inneren Modifikationen der Medien des Bewusstseins entstammen. Es ist der Schauplatz des Leidens, auf dem das Bewusstsein die dynamische Bewegung der Beziehung auf sich selbst als das Andere und auf das Andere als sich selbst, entwickelt. Das Bewusstsein ist bei Hegel der „Begriff des Geistes“ (JSE I., S.183), der jedoch nicht das unterschiedlose und in sich festhaltende Sein ist. Dieses tritt in den Unterschied an sich selbst und in das Geschehen in der Lebenswelt dadurch ein, dass die prozessuale Bewegung des Unterscheidens und der Rückbeziehung auf sich selbst stattfindet. Der Geist im Sinn Hegels erscheint hier als das „Bewusstsein“, d. h., dass das Bewusstsein zumindest am Anfang der „Philosophie des Geistes“ nicht als die abgesonderte Einzelheit, sondern als das allgemeine Bewusstsein dargestellt wird. Diesbezüglich kann man sagen, dass dem Geist bei Hegel die Bedeutung des die Ganzheit des Lebens umfassenden Sinnnetzwerks mit dem daraus folgenden Gedanken, dass „das Wahre das Ganze ist“, zukommt. (PhdG., S. 24) Der Geist als ein lebendiger Sinnganzheitshorizont erlebt die ontogenetische Geschichte des Ganzen des Lebens. Gleichzeitig entfaltet sich die Verbundenheit mit dem Leben selbst auf nachvollziehbare Weise auf dem Schauplatz des Lebens. Demzufolge kann man davon ausgehen, dass Hegels Begriff des Bewusstseins in der „Philosophie des Geistes“ zunächst so etwas wie ein Grundmodell des Geistes war. Darüber hinaus bezeichnet Hegel den Begriff des Bewusstseins als die Einheit der Gegenteile; einerseits „das sich Bewusstseiende“, andererseits „das, dessen es sich bewusst ist.“ (JSE I., S. 189) Aus dieser Dastellung gilt es nun zu erkennen, dass Hegel diesen Begriff des Bewusstseins später als das Selbstbewusstsein verstanden hat. Anders formuliert: Hegel ist davon überzeugt, dass das Bewusstsein nicht in der unüberbrückbaren Entfernung vom Anderen oder dem Objekt bleibt, sondern dass es die Faktizität seiner selbst darstellen und den negierenden Übergang zum Wahren in sich selbst motivieren kann. Im Anschluß daran beschreibt Hegel das Bewusstsein als „die Identität in dem Anderssein“. 55 Das subjektive Ich als das Selbstbewusstsein kann sich deshalb aus dem Einlassen auf die negative geschichtliche Bewegung heraus selbst ausbilden und sich selbst dabei in die Gesellschaft einbinden. Das mit dem Leben verbundene Selbstbewusstsein ist immer mit sich selbst nur dadurch identifiziert, dass es sich in einer endlosen Wechselbeziehung befindet, was bedeutet: Die Andersheit in sich selbst und das Selbst im Anderen finden zu können. Das Selbstbewusstsein bildet sich, um es noch deutlicher zu sagen, stets unter dem kontinuierlichen Einfluss von und der unaufhörlichen Wechselwirkung 55 62 Ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III, in: Werke in 20 Bänden, hrsg. v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 10, Frankfurt a. M. 1986, S. 199, im folgenden abgekürzt: Enzy. III. mit den Anderen. Gadamer liefert für Hegels Begriff des Selbstbewusstseins den entscheidenden Hinweis, indem er sagt, „dass es (= das Selbstbewusstsein, KBL) seine Identität als >Lebendiges< nur in der beständigen Auflösung des Anderen und Selbstauflösung in das Andere hat, also als Teilhaben an der Unendlichkeit, dem Kreislauf des Lebens.“ (GW. 3, S. 52) 63 III. Das Anerkennungsverhältnis in der Geistesphilosophie 1803/04, 1805/06 Durch Hegels Texte Philosophie des Geistes 1803/04, 1805/06, die in diesem Kapitel behandelt werden, werden wir noch deutlicher verstehen, was Hegel mit seinem Begriff der „Anerkennung“ gemeint hat, wie „das ganze Bewusstsein“ als „Einheit der Einzelheit“ (JSE I, S. 187) noch genauer begrifflich dargelegt werden kann, mit welchem Entwicklungsprozess der Geist als das Allgemeine, das „das Besondere selbst enthält“, 56 sich selbst erweitert, anders gesagt, wie der objektive Geist als „die Grundlage unseres menschlichen Lebens“ 57 in den Formen der gesellschaftlich–konventionellen Institutionen und Organisationen realisiert wird. Nach seiner Konzeption hat Hegel ebenso in den Jenaer Systementwürfe[n] III wie in den Jenaer Systementwürfe[n] I, die er als die Fragmente vorgelegt hat, den systematischen Entwicklungsweg von der Naturphilosophie zur Geistesphilosophie beschrieben. Was diesen gesamten Entwicklungsprozess betrifft, gehört die Charakteristik der Selbstartikulierung und –differenzierung zum Geist. Demnach lässt der Geist sich selbst auf die Natur als seine fremde Andersheit, aber dennoch von vornherein auf sein Selbst hin verlegen, weil die Natur bei Hegel als eine Gestalt der Selbstentäußerung des Geistes erfasst wird. Der Geist kehrt dabei durch die Selbstartikulierung und –differenzierung als seinem Entwicklungsweg zu sich selbst, zum „wissend[en] Wissen“, „Wissen des Geistes von sich“, zurück. (JSE III. S. 261) In dieser dynamischen Bewegung der Selbstentäußerung und des Zurückkommens zu sich selbst führt der Geist bei ihm einen ständigen Wiederholungsprozess durch, damit er sich selbst zum „wirklich[en] Geist“ macht, „der sich selbst und den Gedanken von sich enthält“. (JSE III. S. 259) In diesem Sinn hat Hegel am Anfang dieser Arbeit mit seinem vorweggenommenen Einblick in das Darstellungsziel formuliert: „Der Geist ist dieses mit sich Vermittelnde, er ist nur als aufhebend das, was er unmittelbar ist, davon zurücktretend.“ (JSE III. S. 171) Im Verlauf der Selbsthinführung zur wissenden Bewusstwerdung des Geistes kommt dem Hegelschen Begriff des Geistes einerseits die Eigenschaft der Selbstbeziehung des Geistes auf sich selbst – hier können wir bei Hegel den Charakter der Abgeschlossenheit des Geistes finden 58 - jedoch andererseits die unvermeidbaren Stationen der Selbsteinbettung in das Anderswerden zu. Deswegen hat Gadamer in der „Analyse des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins“ in seinem Werk Wahrheit und Methode über den Hegelschen Begriff des 56 G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe III. – Naturphilosophie und Philosophie des Geistes, hrsg. v. Rolf– Peter Horstmann, Hamburg 1987, S. 177. Im folgenden abgekürzt: JSE III. 57 Hans–Georg Gadamer, „Hegels Philosophie und ihre Nachwirkung bis heute“, in: ders., Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt a. M. 1976, S. 45. 58 Vgl. Gerhard Göhler, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Frühe politische Systeme, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1974, S. 419. 64 Geistes gesagt, dass „das Leben des Geistes [...] vielmehr darin [besteht], im Anderen sich selbst zu erkennen.“ (GW. 1, S. 352, meine Hervorhebung) Hinsichtlich des Anderswerdens des Geistes versteht Gadamer unter Hegels Begriff „Geist“ den der „geschichtlichen Arbeit“, um sich mit sich selbst auf einer einheitlichen Dimension der lebendigen Sinnganzheit zu versöhnen, dabei die „Erfahrung, die Wirklichkeit erfährt und selber wirklich ist.“ (Ebd.) Aufgrund Gadamers Einsicht können wir den Begriff des Geistes in Hegels Philosophie des Geistes als das stets anders gewordene Selbst, das auf dem notwendigen Weg zum gesamten System durch die kontinuierlich sich entfaltende und sich auf sich selbst zurückführende Wiedererkenntnis wandelt, erfassen. Der Text, in dem Hegels Idee der Philosophie des Geistes entfaltet ist, ist für Hegels praktische Philosophie entscheidend, 59 denn dort wird die Anerkennung, die den höchsten Stellenwert hat, „zum grundlegenden Prinzip von Vergesellschaftung überhaupt“. 60 Was die Überlieferungsgeschichte betrifft, ist diese Schrift von Hegel selber nicht veröffentlicht worden, war sie seinerzeit von ihm doch lediglich als Manuskript für eine Vorlesung verfaßt worden. Aufgrund dieser Überlieferungsgeschichte ist umstritten, ob die Überschrift im ersten Teil der Philosophie des Geistes „Subjektiver Geist“, 61 die vom ersten Herausgeber, Johannes Hoffmeister, vorgelegt wurde, oder „Der Geist nach seinem Begriff“ oder „Der Geist in seinem Begriff“, 62 die vom neuen Herausgeber, Rolf–Peter Horstmann, vorgeschlagen wurde, Hegels eigentlichen Entwürfen dieser Schrift entsprachen. Hegel selbst sorgte für den Anlaß dieser Debatte, da seinem Manuskript die Überschrift gänzlich fehlt. Der erste Herausgeber, Johannes Hoffmeister, hat die Überschrift „Subjektiver Geist“, die nicht zufällig an das späte System der Enzyklopädie anknüpfte, schließlich gestrichen. In der Tat scheint es auch mir zweifelhaft, dass Hegels Konzeption der Philosophie des Geistes unmittelbar in systematischer Kongruenz zu der späten Enzyklopädie stehen soll, obwohl es, wie er oben in Bezug auf seinen Begriff des Geistes schon gesagt hat, zum Teil Ähnlichkeiten mit dem späten System zu geben scheint: Hegel hat die drei Fachbereiche „Anthropologie“, „Phänomenologie“ und „Psychologie“ unter dem Titel „Subjektiver Geist“ in der Enzyklopädie III umfangreich untersucht. Außerdem hat er hier auf „die Erkenntnis des Geistes“ abgezielt (Enzy. III, S. 397), so wie das Ziel in der Philosophie des Geistes die wissende Einheit von „Intelligenz“ und „Wille“, die Bewusstwerdung des Geistes ist. Trotz 59 Vgl. Herbert Schnädelbach, Hegels praktische Philosophie – Ein Kommentar der Texte in der Reihenfolge ihrer Entstehung, Darmstadt 2000, S. 117. 60 Ebd., S. 129. 61 G. W. F. Hegel, Jenaer Realphilosophie, hrsg. v. Johnnes Hoffmeister, Hamburg 1969, S. 179. 62 Rolf–Peter Horstmann, „Einleitung“, in: G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe III. Naturphilosophie und Philosophie des Geistes, S. XVIII – XIX. 65 dieser Ähnlichkeit kommen, A. Wildt zufolge, die elementaren Medien, Sprache, Werkzeug, Liebe und Familie im Diskussionsfeld der Anerkennung in der Enzyklopädie III nicht vor. 63 So gesehen, liegt es auf der Hand, dass Hegels fruchtbare Beiträge zur praktischen Philosophie in der Philosophie des Geistes 1803/04, 1805/06, in der das Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen im Konflikts– und Versöhnungsverlauf der Anerkennung stattfindet, aus unserer Sicht übersehen wird, wenn wir Hegels Philosophie des Geistes vor dem Horizont der systematischen Kongruenz mit der späten Enzyklopädie zu behandeln trachten. Im Anschluss an diese Debatte ist es für uns unerläßlich, dass wir zunächst die gesamte Komposition von Hegels Texten unter dem Gesichtspunkt der Geistesphilosophie betrachten, um Hegels Konzept in diesen beiden Texten herauszuarbeiten. Was hauptsächlich die Philosophie des Geistes 1805/1806 betrifft, handelte Hegel zunächst „Intelligenz“ und „Wille“ unter dem Titel „Der Geist nach seinem Begriff“ ab, um sich dann dem „Anerkanntsein“, den Rechtsverhältnissen und den institutionellen Horizonten auf der gesellschaftlichen Ebene unter dem Titel „Wirklicher Geist“ zuzuwenden. Im ersten Teil geht es Hegel darum, die drei „Mitte[n]“ Sprache, Werkzeug und Familie deutlich zu machen, durch die das Individuum nicht mehr an der individuellen Subjektivität, noch deutlicher formuliert, an der isolierten Individualität festhält, sondern sich selbst auf die Anderen bezieht und sich auf die höhere Stufe der Sittlichkeit im bildungsgeschichtlichen Entfaltungsprozess seines Bewusstseins begibt. In diesen drei „Medien“ spielt das Anerkennungsverhältnis eine wichtige Rolle: In seinem Verlauf gewinnt das Individuum nicht nur das Bewusstsein von seinem selbständigen Selbst, sondern nimmt sich selbst auch als das beim Anderen Sein und das mit dem Anderen verschränkten Selbst wahr. Diesbezüglich hat Habermas festgestellt, dass „die Kategorien Sprache, Werkzeug und Familie drei gleichwertige Muster dialektischer Beziehungen bezeichnen.“ Außerdem hat er geschrieben, dass „der dialektische Zusammenhang von sprachlicher Symbolisierung, Arbeit und Interaktion den Begriff des Geistes bestimmt“. 64 Habermas zufolge sind diese drei Kategorien bei Hegel mindestens in der Jenaer Geistesphilosophie vom Begriff des Geistes unabhängig und deshalb haben sie 63 Vgl. zu diesen Debatten Klaus Roth, Die Institutionalisierung der Freiheit in den Jenaer Schriften Hegels, Berlin 1991, S. 81–82, und A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 344, Anm. 87, und auch J. Habermas, Technik und Wissenschaft als >Ideologie<, Frankfurt a. M. 1969, S. 10, Anm. 3. Hier hat er „abstrakter Geist“ als den inhaltsgemäßen Titel für diese Überschrift vorgeschlagen, weil man diese Jenaer Systementwürfe seiner Ansicht nach dem späten System nicht aufrichtig unterwerfen kann. Grundsätzlich werde ich in dieser Arbeit die Ausgabe von Horstmann verwenden, da es bei mir hauptsächlich um die Problematik der Anerkennung geht und es mit Ausnahme des Problems der Überschrift im ersten Teil inhaltlich fast keine Differenzen zwischen den beiden Ausgaben gibt. 64 J. Habermas, Ebd., S. 9 – 10. (Hervorhebung von mir). 66 ihre jeweilige Eigentümlichkeit als substanzielle Elemente. 65 Mit anderen Worten: Habermas tendiert hypothetisch dazu, dass der Geist bei Hegel von den unreduzierbaren und unhintergehbaren Elementen aus, – die sprachliche Symbolisierung, Werkzeug und Interaktion - als den wesentlichen Grundlagen von vornherein konstruiert wird und diese Elemente auch im Bildungsprozess des Geistes als die jeweilige Substantialität selbständig bleiben können. Hinsichtlich Habermas’ hypothetischer Tendenz fragt sich auch A. Wildt, „welcher Zusammenhang zwischen den drei Mitten des Geistes besteht“, 66 wenn die drei Elemente ohne die Reduktion aufeinander parallel gleichgesetzt sind. Dementsprechend müssen wir uns m. E. zuallererst mit den Fragen beschäftigen, wie oder inwiefern das individuelle Subjekt im Verlauf der wechselseitigen Anerkennung die drei Medien anwendet, sich selbst findet und erkennt, was es in diesem Prozess erfährt, verliert und gewinnt, wie es sich selbst auf die anderen bezieht, um sich schließlich selbst auf der gesellschaftlichpolitischen Ebene zu erkennen. Bei diesen Fragestellungen wird deutlich, dass wir die drei Medien als die zu verschränkenden Elemente im Anerkennungsverhältnis und in der Selbstentfaltung des Geistes erfassen müssen, da dem Individuum im Verlauf dieses Bildungsprozesses im Wesentlichen das sich selbst Wissen im Anderen verdeutlicht wird. Somit kann man festhalten, dass der Geist auf diese drei Elemente angewiesen ist; sein Vorhandensein bedeutet, dass er damit als das erscheinende Dabeisein und das teilhabende Sein zugleich aufgefasst wird. In der Folge hat Hegel mit den obigen Medien auf das holistische Wissen vom theoretischen und praktischen Bewusstsein abgezielt. Dieser Anspruch auf die einheitliche Ganzheit wird bereits in Hegels früher Konzeption mit dem Begriff „das ungeteilte Leben“ beschrieben. Dieses einheitliche Wissen betreffend, sagt Hegel: „Jene erste gebundene Existenz des Bewußtseins als Mitte ist sein Sein als Sprache, als Werkzeug und das Gut. Oder als einfaches Einssein: Gedächtnis, Arbeit und Familie.“ (JSE I, S. 193) 65 Vgl. Zur Kritik dieser These Habermas’, H. Schnädelbach, Hegels Praktische Philosophie, S. 156 – 157. Hier begreift er die Medien, „Sprache“, „Werkzeug“ und „Interaktion“, als „Moment des Geistes“, um sich „begrifflich und ihrem Wesen nach“ selbst zu entfalten. Seiner Ansicht nach kann man der „Konsequenz des notwendigen Verzichts auf die Ambition, in der Gesellschaftstheorie in die Perspektive des Absoluten einzutreten“ entgegenkommen, wenn die Medien als „die systematische Unabhängigkeit“ voneinander und die einander gleichgesetzten Kompetenzen, die autonom den Geist konstruieren, verstanden werden. 66 A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 327. 67 Dieser Äußerung zufolge muss das subjektive Bewusstsein zunächst alle Medien durchlaufen, zum einen die ideellen, zum anderen die praktischen. 67 Im Verlauf dieses Erfahrungs– und Bildungsprozesses kann es somit seiner selbst auf dem höheren Niveau des „sich in einer andern solchen Totalität, Bewußtsein, sich als sich selbst Erkennens“ bewusst werden. (JSE I, S. 217) Dabei scheint der Geist bei Hegel zusammen mit dem Bildungsvorgang des subjektiven Bewusstseins sich selbst entwickeln zu können und auch an diesem Prozess des Bewusstseins bereits teilgehabt zu haben. Durch diesen Entwicklungsprozess erscheint der Geist bei ihm sich selbst als „Wirklicher Geist“, der „die erfüllte Freiheit“ und damit zugleich „der seiner selbst gewisse Geist“ ist. (JSE III, SS. 252 – 253) Auf dieser Stufe des Geistes, die den gesamten Vorgang der Bildung des individuellen Bewusstseins als die Voraussetzung in sich enthält, hat Hegel den Übergang vom Rechtsverhältnis über das sich als Gewalt auswirkende Gesetz zur staatlichen Verfassung als der verwirklichten Gestalt des Geistes unter dem Titel „Wirklicher Geist“ behandelt. Nach diesem zusammenfassenden Überblick stellt sich die Frage, welche grundsätzliche Erfahrung das Subjekt im Prozess des wechselseitigen Sich–Versetzens gemacht hat, welche Rolle die Liebe, die der emotionellen Beziehung als dem wesentlichen Moment der Eheschließung zugrunde liegt und jedes individuelle Familienmitglied im Binnenraum der familialen Intimität nicht nur zum Bewusstsein vom Selbst, sondern auch zu dem des Anderen hinführt, im Anerkennungsverhältnis spielt. Was hat die daraus folgende Kindererziehung der Eltern mit den gesellschaftlichen Institutionen und Normen zu tun? Wie kann der Familienverband als die Gemeinschaft des Gefühls im gesellschaftlichen und staatlichen System als der Sphäre der Sittlichkeit konstruktiv repräsentiert werden? Diese Fragen im Hinterkopf behaltend, werde ich meine Aufmerksamkeit im folgenden Hegels Problematik der interaktiven Intersubjektivität zuwenden. 67 Vgl. H. Schnädelbach, Hegels Praktische Philosophie, S. 121. Hier hat er alle Medien im ersten Teil der Philosophie des Geistes unter zwei Aspekten betrachtet: Formell gesehen: Sprache – Gedächtnis, Werkzeug – Arbeit, Familiengut – Liebe und Familie. Die eine begriffliche Sichtweise gehört der ideellen Seite des Bewusstseins an, die andere der realen Seite des Bewusstseins. Damit wird deutlich, dass Hegel in seiner Philosophie mit der Aristotelischen Tradition der Philosophie den unaufgelösten Gegensatz von der Theorie und der Praxis zu überwinden versucht hat. 68 III – 1. Die mediale Intimbeziehung zwischen Ich und Du Bevor Hegel die Tätigkeit des wollenden Subjekts in der vorgesellschaftlichen Sphäre betrachtet, geht er zunächst auf das Erkenntnisvermögen des subjektiven Bewusstseins unter dem Namen der „Intelligenz“ ein. Daran anschließend beschäftigt er sich mit der einheitlichen Beziehung von Sprache und Gedächtnis, die beide als „I. Potenz“ in der Geistesphilosophie 1803/04 bezeichnet werden. „Die Anschauung“ ist die erste Gestalt des subjektiven Bewusstseins, die aufrichtig gegenüber dem äußeren Gegenstand in Raum und Zeit steht. Deswegen gehorcht sie der herrschenden Einschränkung von Raum und Zeit, ist gewissermaßen räumlich und zeitlich bestimmt. Dabei handelt sie sich um den unendlichen Gegensatz von dem Anschauenden und dem Angeschauten. Die zweite Gestalt des subjektiven Bewusstseins, die von diesem unendlich fließenden Gegensatz aus zu sich selbst zurückkommt, ist „die Einbildungskraft“. Die Einbildungskraft, die Hegel selber „vorstellende Einbildungskraft“ genannt hat, positioniert den äußeren Gegenstand bildhaft vor sich selbst. (JSE III, S. 171) An diesem Punkt ist der äußere Gegenstand aus der Unmittelbarkeit des Seienden, dem oberflächlichen Schein, in die Innerlichkeit des Bewusstseins erhoben. Das Bewusstsein ist bei Hegel nunmehr verinnerlicht und zu sich selbst zurückgekehrt. Hier hat sich die Gegenständlichkeit des Gegenstands in die Innerlichkeit des subjektiven Bewusstseins verlagert. Bei der Verinnerlichung des äußeren Gegenstandes mit Hilfe der Vorstellungskraft ins Ideelle des subjektiven Bewusstseins wird die Außenwelt nunmehr zum Gegenstand des Subjekts und vom tätigen Subjekt aus ideell, aber dennoch bildhaft, reproduziert. So gesehen führt die objektive Außenwelt zuallererst zur Subjektivierung, weswegen der Gegensatz von Subjekt und Objekt im Verlauf der ideellen Subjektivierung des Objekts überwunden wird, obwohl diese Überwindung des Gegensatzes zunächst nur einseitig stattfindet. Diese erste Gestalt der Übertragung der objektiven Außenwelt auf das Subjekt zeigt sich beim Erscheinen des „Zeichen[s]“. (JSE III, S. 174) Die andeutende Handlung des Subjekts meint die Verwandlungsaktion des äußeren Dinges ins ideelle Symbol, sozusagen die Entäußerung des handelnden Subjekts durch die Namensgebung. Mit anderen Worten: Das Subjekt hat erstens beim unmittelbaren, aber subjektiven Referenzverhältnis zur objektiven Außenwelt den Gegenstand bildhaft und ideell aufgenommen und zugleich symbolisiert. Zweitens wird der Gegenstand vom Innern des Subjekts aus repräsentativ dargestellt, von den subjektiven Sprachakten, die den Dingen Namen geben, wiederhergestellt. Durch subjektive Sprachakte als kategorisch ordnende Namensgeber wird der Gegenstand in Hegels Augen vom Subjekt 69 aus rekonstruiert, wird mit dem Sprechen phänomenal und kategorisch auseinanderdividiert. Der Äußerung Hegels zufolge ist diese subjektive Symbolisierung der imaginierten Außenwelt, nämlich die ideellsprachliche Auffassung des Subjekts über das Objekt, „die erste Schöpferkraft“ des Geistes. (JSE III, S. 175) Durch diese schöpferische und repräsentative Symbolisierung der Außenwelt bezieht sich der Geist nun nicht mehr auf die Unmittelbarkeit des Gegenstandes, sondern „verhält sich zu sich selbst.“ (Ebd.) Dementsprechend zeigt sich der Gegenstand in der Bedeutung, die er für das Ich als den Geist selbst hat. So wird der Geist im „Reich der Namen“ zum erwachten. (Ebd.) Im flexiblen und variablen Reich der Namen ordnet das Ich als der Geist selber mit dem „Gedächtnis“ die symbolisierten, vielfältigen Dinge kategorisch an. Hierbei glaubte Hegel, dass das Ich sich selbst in diesem kategorisch angeordneten Dinge, anders gesagt, in den bezeichneten Namen, anschauen könne. Aus diesem Grund nennt Hegel das „sich selbst zum Dinge Machen“ des Ichs. Infolgedessen können wir auch die zweite Gestalt der nach außen erscheinenden Überwindung des Gegensatzes von Subjekt und Objekt erkennen. Dem Ich kommt nunmehr die Selbstvergegenständlichung und –objektivierung zu. Im Konsensprozess von Ich und Außenwelt, der zum einen in dem strukturellen Modell des „das Ding zum Ich zu Machen[s]“, nämlich der ideellen Symbolisierung des Gegenstands, zum anderen in dem des „das Ich zum Dinge zu Machen[s]“, sozusagen der sich selbst entäußerten Vergegenständlichung stattfindet, kommt die allgemeine kategorische Ordnung dem Ich zu, womit die Zufälligkeit zwischen dem Ich und dem Gegenstand, anders gesagt, die willkürliche Ausprägung der Privat–Sprache überwunden ist. Denn das Ich kann relativ leicht in die Lage versetzt werden, die Sprache in der unmittelbaren Gegenüberstellung mit dem Gegenstand willkürlich und irreführend zu privatisieren, falls das Subjekt nur in der privaten ideellen Sprachschicht verhaftet ist. Mit dieser Einsicht in die Gefährlichkeit der Privatisierung der Sprache schreibt Hegel im folgenden über die Verallgemeinerung der Sprache bzw. die allgemeine Überwindung der Willkürlichkeit der Sprache: „Diese Richtung auf den Namen hat also die entgegengesetzte Bedeutung, daß nämlich die Richtung auf Ich, Aufheben desselben als des fürsichseienden, d. h. willkürlichen, tätigen gesetzt ist – es ist gesetzt die Allgemeinheit, mit gleichem Wert, gleichem Aufgehobensein des tätigen Ichs und des Gegenstandes […]“ (JSE III, S. 181, meine Hervorhebung) So gesehen wird die Sprache bei Hegel zunächst unter den gemeinsamen Rahmenbedingungen für den allgemein übereinstimmenden Sprachkreis, an dem wir allesamt 70 gleichermaßen teilnehmen, zum Thema gemacht. Daran anschließend verweist Hegel darauf, dass die Sprache im Volk, die die Sozialisierung jedes Betreffenden vor dem kulturellen und konventionellen Hintergrund leistet, „als ideelles, allgemeines Bewusstsein vorhanden“ ist, wenn die Rede vom Volksgeist als „wirklichem Geist“ ist. (JSE I, S. 226) Auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der wir mit der Sprache den anderen begegnen und unser Denken mitteilen, ist die Sprache nicht nur der Vermittler unter den Subjekten, sondern der Sinnträger des Denkens bzw. der Sachwahrheit. Deswegen ist die Sprache bei Hegel als „die Mitte der Intelligenzen, Logos, das vernünftige Band derselben“ bestimmt. (SdS, S. 18) Die Gestalten der Sprache, die die Wahrheit der Sache selbst im Herzen trägt und uns selbst miteinander verbindet, erscheinen bei Hegel vielfältig. In Hegels Augen sprechen wir nicht nur über die Sache selbst, wie er in „Stimme des Bewußtseins“ (JSE I, S. 202) oder „die tönende Rede“ (SdS, S. 18) gezeigt hat, sondern wir wenden auch die Miene, Gebärde, Geste usw. auf das Kommunizieren miteinander an. Demzufolge wird das kommunizierende Handeln des Subjekts nun bei Hegel zum „beweglichen, ideellen Spiel“, sozusagen „Spiel in einem anderen“. (SdS, S. 17) Im Anschluss an die Einsicht in die Sprache des jungen Hegels können wir feststellen, dass die Sprache bei ihm zunächst ein Vehikel ist, das unser Denken, die Stimme des menschlichen Inneren zum Ausdruck bringt und auch ein Vermittler, der das Ich mit dem Anderen verbindet. Insofern die Wahrheit der Sache selbst nur durch die sprachlichen Begriffe zum Ausdruck gebracht wird, sich die Sache selbst nur mit der Sprache darstellt und zeigt, hat Gadamer Hegels Dialektik unter „dem spekulativen Geist der Sprache“ verstanden, obwohl Hegel, Gadamers Ansicht zufolge, mit der begrifflichen Sprache immer wieder„nur das Reflexionsspiel ihrer Gedankenbestimmungen“ widerspiegeln und überprüfen will. (GW. 1, S. 472) Von diesem Gesichtspunkt Gadamers aus betrachtet wird klar, dass die Sprache in Hegels Philosophie nicht nur den Begriff der reflexiven Einsichten oder die logischen und beweisenden Reflektionen, die das Bewusstsein auf den Weg zur vernünftigen Auffassung bringen, einschließt, sondern sie muss auch damit wesentlich „Vollzug von Sinn, als Geschehen der Rede, der Verständigung, des Verstehens“ sein. (GW. 1, S. 473) Von Hegels Einsicht in die Sprache können wir das kommunikative Handeln bzw. die sprachlich dialogische Interaktion zwischen den Subjekten unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ableiten. Die Sprache ist unter den Einschränkungen der Geschichtlichkeit und der Kultur an die nachfolgenden Generationen überliefert und deshalb ist sie einem Volk in einem spezifischen Sprachraum überlassen. Innerhalb dieses Sprachkreises begegnet das Ich seinem Anderen im Gesprächsverhältnis, versteht den 71 Anderen und erreicht mit dem Anderen die gemeinsame Verständigung. Die überlieferte Sprache lässt uns ins lebendige Gesprächsfeld vor dem alles kalkulierenden Reflexionsakt hinabgleiten. Durch die interaktiven Sprachakte hindurch erwarten wir damit die menschlichen Verhaltensweisen in der alltäglichen Lebenswelt, die von vornherein den ethischen Anspruch aller Beteiligter implizieren. An dieser Stelle kann man feststellen, dass die Sprache, die aus der vorgegebenen Tradition, aber dennoch aus der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit den überlieferten Traditionen entsteht, uns selbst zum interpersonellen Handlungsrahmen, zur bedeutsamen Verständigung zwischen den Menschen führt. 68 Im Teil „Wirklicher Geist“, in dem der Volksgeist prinzipiell thematisiert wurde, sagt Hegel über die Sprache: „Die Sprache ist nur als Sprache eines Volks, ebenso Verstand und Vernunft. Nur als Werk eines Volks ist die Sprache die ideale Existenz des Geistes, in welcher er sich ausspricht, was er seinem Wesen [nach] und in seinem Sein ist; sie ist ein Allgemeines, an sich Anerkanntes, im Bewußtsein aller auf dieselbe Weise Widerhallendes; jedes sprechende Bewußtsein wird unmittelbar darin zu einem andern Bewusstsein. Sie wird ebenso ihrem Inhalt nach erst in einem Volke zur wahren Sprache, zum Aussprechen, was jeder meint.“ (JSE I, S. 226, meine Hervorhebung) Diese Sätze Hegels geben uns m. E. auch den Anlass, unsere Aufmerksamkeit auf Gadamers Einsicht in die „Sprache im Gespräch“ in der Hermeneutik zu richten. (GW. 1, S. 449) Aber ich werde mich im folgenden damit zufrieden geben, kurz zusammenzufassen, wie oder inwiefern Hegels Einsicht in die Sprache als „Sprache eines Volkes“ in Anknüpfung an den Gesichtspunkt der philosophischen Hermeneutik aktuell diskutiert werden kann, da Gadamers Sprachlichkeit in Bezug auf das Verstehen im dritten Teil dieser Arbeit noch thematisiert werden wird. Bei Gadamer ist die Sprache zunächst „autonom“, deswegen drückt sie sich selbst aus, bietet sie sich selbst dar. Die Sprache, in der wir sind und leben, ist aus ihrem Innern selbständig heraus gewachsen, weswegen sie das Wort an uns richtet. Diesbezüglich 68 Vgl. J. Habermas, Technik und Wissenschaft als >Ideologie<, S. 30 – 37, und damit den Beitrag von Charles Taylor, der in seiner Arbeit bei der Erklärung des Zusammenhangs von der Ich–Identifizierung und der wechselseitigen Anerkennung des Subjekts „den dialogischen Charakter menschlicher Existenz“ als die wichtigste Eigenschaft erfasst hat. Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt a. M. 1997, S. 21ff. Dagegen hat Klaus Roth in seiner Arbeit darauf hingewiesen, dass sich der Sprachgebrauch von Menschen immer auf die intellektuell–potenzielle Einzelheit zurück beziehen soll, die kommunikative einheitliche Verständigung zwischen dem Sagenden und dem Zuhörenden deshalb nicht als die intersubjektive Wechselbeziehung des kommunikativen Handelns gelten dürfe, sondern als „Einheit des abstrakt–allgemeinen Geistes in sich“ erfasst werden müsse. Klaus Roth, Die Institutionalisierung der Freiheit in den Jenaer Schriften Hegels, S. 93. 72 sagt Gadamer selbst, dass „die Sprache sich weigert, missbraucht zu werden“, dass sie von vornherein das, „was sprachlicher Brauch ist, vorschreibt.“ (GW. 2, S. 192, S. 196) Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass wir uns die Sprache grammatisch gar nicht aneignen können und sie somit nicht beherrschen können, sondern wir vielmehr zu der Sprache gehören und die Sprache dabei jenseits der Grammatik und der Sprachregeln bleibt. In Bezug auf diese „Universalität der Sprachlichkeit“ spricht Gadamer davon, so wie Hegels Äußerung, „in welcher er sich ausspricht“ über „das Zur-Sprache-Kommen der Sache selbst“, (GW. 1, S. 384) dass wir nur in der Sprache angeben können, was wir denken, was die Sache selbst ist und wie sie ist. Dadurch wird die Sache selbst in der Sprache als einem Vermittler nachvollzogen, indem die Sache selbst ihre Wahrheit mit der Sprache ausgesagt hat und aussagt. Was Hegels Bezeichnung „Widerhallendes“ betrifft, das als die gemeinsamen und überlieferten Stimmen der interaktiven Personen im gesellschaftlichen Sprachkreis als der verwirklichten Gestalt des Volksgeistes gelten muss, können wir auf Gadamers wechselseitige Beziehung unter den Mitgliedern, die zwangsläufig „einer Sprachgemeinschaft angehören“, im Gesprächsverhältnis anwenden. (GW. 1, S. 447) Bei Gadamer steht außer Frage, dass die Sprache unsere Kommunikationsform in der Gesellschaft darstellt und wir durch sie zur gemeinsamen Verständigung über die vor uns stehenden Dinge und über uns selbst kommen können. Wir sprechen in unserem gesamten Leben über die latenten Situationen, d. h. die Sachverhalte, die uns selbst um– und einschließen, die bei uns selbst sind. In diesem endlosen Dialogprozess begreifen wir sowohl uns selbst als auch die vor uns liegenden Umstände. Dementsprechend sind wir selbst an diesem Sachverhalt beteiligt und legen ihn aus, obwohl wir die Sache selbst nicht völlig erhellen und zum Ende führen können. Deswegen können wir die Wahrheit der Sache selbst nur im ständigen Übergangsprozess, „der das Leben der Menschen von der Familie, der kleinen Wohn – und Lebensgruppe, bis zu der schließlichen Entfaltung einer Wortsprache in größeren sprachlichen Gemeinschaften führt“, suchen. (GW. 8, S. 354) Im unendlichen Prozess der Suche nach der Wahrheit, dem angemessenen Wort, kann ich zur Übereinstimmung mit dem Du gelangen und auf der Basis eines solchen übereinstimmenden Zusammenseins stellt sich eine überindividuelle Gemeinsamkeit her, „soziale Solidarität“. (GW. 2, S. 188) In diesem unendlichen Gesprächsverkehr zwischen Ich und Du, d. h. diesem „widerhallenden“ dialogischen Abspielen, bei dem ich dich frage und dir zuhöre, fühlen wir uns zu einer bestimmten Sprachgemeinschaft zugehörig, finden wir daraus folgend unsere Gemeinsamkeit. Daran anschließend können wir sehen, dass das dialogische Sinnnetzwerk, mit dem wir bereits verbunden sind, aus dem sich unsere Gemeinsamkeit 73 konstituiert, in Hegels Worten ein Spielplatz, auf dem sich der Volksgeist als der erscheinende Geist bewegt und das dialogische Sprachspiel unter den Mitgliedern die geistige Gemeinsamkeit bildet, uns zum gemeinsamen Einverständnis führt. Wenn man aus dieser Interpretation im Zusammenhang mit Gadamers philosophischer Hermeneutik, die ich oben kurz dargestellt habe, schließen kann, dass sich die Sprache bei Hegel im Prinzip auch auf den Dialog der intersubjektiven Personen im gesellschaftlichen Rahmen bezieht, dann können wir an dieser Stelle feststellen, dass Hegels Denkansatz zur Sprache selber bereits in der kommunikativen Praxis in einer kulturellen Sprachgemeinschaft fundamental, zumindest keimhaft verwurzelt ist, obwohl er die „Intelligenz“, in der das Verhältnis von Gedächtnis und Sprache problematisiert wird, in die „theoretische“, d. h. die inhaltlose Form eingeordnet hat. Es ist auch eine Tatsache, dass er den Inhalt dieser Form nur im dialogischen Handlungsraum des praktischen Bewusstseins füllen zu können glaubte. In diesem Gedankengang soll sich das theoretische zum praktischen Bewusstsein erheben und erst danach kann „das Bewusstsein als Bewusstsein des Einzelnen“, in Hegels Worten, „[dem] anderer einzelner“ begegnen und gegenüberstehen. (JSE I, S. 208) Hegels Idee der Einheit von dem theoretischen und dem praktischen Bewusstsein durch die Hinführung der „Intelligenz“ zum „Willen“ wird einerseits von Spinozas „Voluntärphilosophie“ und andererseits von Fichtes „Theorie des Naturrechts“, wie die Interpreten A. Wildt und Klaus Roth in ihren Arbeiten erwähnen, inspiriert. Mit der einheitlichen Hinwendung des theoretischen Bewusstseins zum praktischen Bewusstsein lässt sich das in sich festgehaltene tätige Subjekt als die inhaltlose Form, deswegen das leere Unbestimmte, das nur bei sich selbst gebliebene Sein, zu der praktischen Handlungsdimension, in der es seinem Anderen begegnen und seinen Mangel erfüllen kann, leiten. Dementsprechend hat Hegel den Übergangsprozess des theoretischen zum praktischen Bewusstsein als solchen als die Selbstkonkretisierung und –verwirklichung der inhaltslosen „Intelligenz“ angesehen. Damit glaubte er, die unüberbrückbare Kluft zwischen dem theoretischen und dem praktischen Bewusstsein, die insbesondere bei Fichte nicht überwunden wird, überbrücken zu können. 69 Das scheint Hegel in den folgenden Sätzen ausdrücken zu wollen: „Das Wollende will, d. h. es will sich setzen, sich als sich zum Gegenstande machen. (meine Hervorhebung) Es ist frei, aber diese Freiheit ist das Leere, Formale, Schlechte. … α) ist es das Allgemeine, Zweck; β) ist [es] das Einzelne, Selbst, Tätigkeit, Wirklichkeit, γ) ist es die Mitte dieser beiden, der Trieb.“ (JSE III, S. 186) 69 Vgl. A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 344 ff. Klaus Roth, Ebd., S. 95 ff. 74 Von dieser ersten Beschreibung Hegels ausgehend, die von Anbeginn an unter dem Titel „Wille“ auftaucht, können wir aus dem Ausdruck „Das Wollende will“ schlußfolgern, dass das lebendige Subjekt aus dem Gefühl des Mangels entsteht. Aus diesem Gefühl des Mangels heraus will das Subjekt „sich setzen“, d. h. ein Ziel setzen, um den Mangel auszugleichen. Mit anderen Worten: Es tendiert und neigt zum Gegenstand seines Mangels, es strebt um seiner Selbsterhaltung willen dem natürlichen Gegenstand entgegen. Beim Versuch des Ausgleichs seines Mangels setzt es sich sein Ziel im Hinblick darauf, was es im Moment will. In Bezug auf dieses Ziel der Anfüllung der Leerheit des Selbst, wird das wollende Subjekt bei Hegel als das sich-selbst-entscheidende aufgefasst. Infolgedessen lässt sich mit Hegel sagen, dass das Subjekt ein Handelndes ist, das seinen inneren Zweck nach außen entfalten und verwirklichen will, aus diesem Grund selbständig wird. In dieser Zuneigung zur Selbstverwirklichung erfährt das Subjekt, Hegels Ansicht zufolge, das „sich als sich zum Gegenstand Machen“. Das bedeutet, dass das Subjekt, das aus der Motivation seiner Selbsterhaltung heraus und mit seinen eigenen Zielen vor Augen handelt, bei Hegel das Bewusstsein seiner selbst dadurch erhält, dass es in jeder neuen Situation, die eine Entscheidung von ihm fordert, immer wieder aufs neue durch den Vorgang der Selbstverwirklichung, die stets durch die Triebbefriedigung zustande kommt und einen Prozess des Lernens und Bildens durchschreitet, hindurchgeht.70 Aus diesem Grund bildet der Trieb bei Hegel das Fundament der subjektiven Handlung. 70 Vgl. A. Wildt, Ebd., S. 347, Klaus Roth, Ebd., S. 100 – 103. Beide Interpreten haben dieselbe Behauptung in ihren Arbeiten aufgestellt, die besagt, dass Hegels Begriff des „Triebs“ in der Geistesphilosophie 1805/06 von dem Begriff der „Begierde“ oder dem „Bedürfnis“ unterschieden werden muss. Nach ihnen hat Hegel den Begriff „Trieb“ vom „Neospinozismus“, der im Rahmen der Subjektivitätstheorie prinzipiell hervorgehoben ist, übernommen. Vor allem der Ansicht von K. Roth zufolge, entspricht der Wille bei Hegel gerade dem Geist an sich als dem allgemeinen Substanzsubjekt. Damit bezieht sich der Begriff „Trieb“ auf die einheitliche Verbindung der „Seele“ mit dem „Körper“, als die zwei Elemente des Menschen, daher ein „bewußtes Streben“. Diese Interpretation beider Autoren wird m. E. richtig klar, wenn wir den Zusammenhang dieses Begriffsfelds „Trieb“, „Begierde“ und „Bedürfnis“ innerhalb der Geistesphilosophie 1803/04, 1805/06 betrachten, weil Hegel selber in diesen beiden Texten die Begierde als „animalisch“ oder „tierisch“ bezeichnet, der Trieb in diesem Zusammenhang bei ihm als ein wesentliches Element gefasst wird, das die Einheit von dem Ich und dem äußeren Gegenstand vollzieht. (JSE I, S. 210, JSE III, S. 187) Für mich stellt sich jedoch die Frage, warum Hegel die Begierde im Kapitel „Selbstbewußtsein“ in der Phänomenologie des Geistes noch einmal als das Selbstbewusstsein, nämlich „selbständiges Leben“, anders gesagt, als ein Fundament der Handlung des Selbstbewusstseins hervorgehoben hat. (PhdG, S. 143) Kann man in Bezug auf die obigen Interpretationen sagen, dass Hegel den Rahmen der „Subjektivitätsphilosophie“ nur im Hinblick auf die veränderte Verwendung des Begriffsfelds „Trieb“, „Begierde“ und „Bedürfnis“ verlassen hat, obwohl es auch in der Phänomenologie noch immer um den Bildungsprozess und die Selbsterfahrung des Ich geht. Zur Bedeutung der „Begierde“ in der Phänomenologie, vgl., Werner Marx, Das Selbstbewusstsein in Hegels Phänomenologie des Geistes, Frankfurt a. M. 1986, S. 26 – 35. Hier hat er die Begierde in der Phänomenologie als ein Element der moralischen und sittlichen Handlungsfähigkeit von Menschen aufgefasst, weil „die menschliche Begierde eigentlich nicht auf den Gegenstand, sondern auf sich selbst, auf ein „Selbst“ geht“. Seiner Ansicht nach bezieht sich die Begierde deshalb zumindest in der Phänomenologie immer auf die subjektive Handlung, um den Lebensvollzug zu erlangen und das Selbstgefühl zu gewinnen. 75 Aus dieser nachdenklichen Skizzierung über die individuelle Handlung der Triebbefriedigung versucht Hegel den Bildungsprozess des Subjekts vom zweiten Medium Werkzeug-Arbeit, nämlich der instrumentellen Erfahrung des Subjekts, abzuleiten. In diesem Bildungsprozess lässt sich das Subjekt als das arbeitende, kurz gesagt, als das auf die Selbsterkenntnis durch die produktiv operierende Beziehung auf den natürlichen Gegenstand hin gerichtete bezeichnen. Das wollende Subjekt, dem schon bewusst ist, was es selber für die Selbsterhaltung tun muss, wonach es gelegentlich strebt, steht dem natürlichen Gegenstand gegenüber und verzehrt ihn. Hier findet es die Erfüllung seines Triebs und sein Selbstgefühl. In diesem Verlauf der subjektiven Neigung zum Gegenstand des Triebs hin, hat es den Gegenstand nicht nur unmittelbar verzehrt, sondern ihn auch seinem Handlungszweck gemäß erarbeitet und ausgearbeitet. Bei der Aus– und Erarbeitung des Dinges schafft es sein Produkt, nämlich sein „Werk“, das den leeren Trieb mit seinem Gegenstand zu einer Einheit verbindet. (JSE III, S. 188) Das Subjekt findet nunmehr sich selbst in seinem Werk wieder. Daran anschließend wird das triebhafte Subjekt gezwungen, sich selbst im wiederkehrenden Verlauf der Produktion und Reproduktion weiter zu bilden, um über die unmittelbare Triebbefriedigung hinaus Vorräte für das künftige Leben anzulegen. Aus dieser Notwendigkeit und diesem Selbstanspruch heraus, entsteht das „Werkzeug“, in Hegels Worten, als die Mitte von „Einzelheit“ und „Allgemeinheit“. Mit Werkzeug meint er die einheitliche Vermittlung beider Seiten, einerseits die tätige Komponente als das arbeitende Subjekt, andererseits die passive Komponente als der natürliche Gegenstand. (Ebd.) In diesem Sinn wird das Werkzeug nicht nur zu einem Teil des vom triebhaften Subjekt geschaffenen Werkes im Arbeitsprozess, sondern auch zu einem Mittel, das die individuellen Arbeitskräfte schont. Aus diesem Grund muss das arbeitende Subjekt den Gebrauch des Werkzeugs erlernen, nicht nur um seine Arbeitskraft durch den Gebrauch des Werkzeugs zu schonen, sondern auch um zur Bewusstwerdung seiner Selbst durch sein Werk zu gelangen. Denn das Werkzeug ist aus der Sicht des arbeitenden Subjekts sein Werk und das Subjekt betrachtet damit zugleich auch das Resultat seiner Arbeitshandlung, nämlich die erfolgreiche Durchführung seiner Tätigkeit im Werk und im Werkzeug, das vom Subjekt geschaffen wird. Infolgedessen erfährt das Subjekt bei Hegel durch den produzierenden Arbeitsprozess hindurch das „sich zum Dinge Machen“, anders gesagt, spiegelt das Subjekt sich selbst in seinem Produkt wider, erkennt seine Fähigkeit und sich selbst. (JSE III. S. 189) In diesem Übergangsprozess vom Trieb über die Binnenstruktur von Arbeit– Werkzeug hin zur sich selbst erkennenden Selbsterfahrung, die sich selbst in ihrem Werk anschaut, gelangt das Subjekt nicht nur zur Subjekt–Objekt–Beziehung, sondern auch zur 76 interaktiven Intersubjektivitätsbeziehung. Denn das Subjekt hat die unmittelbare Beziehung von Subjekt und Objekt in seiner Produktion überschritten und gelangt über diese Grenze der einfachen Arbeit hinweg zu der Fähigkeit, das Naturgesetz zu erfassen und die Naturkräfte rational zweckmäßig zu benutzen. Im Anschluss an diese ideelle Fähigkeit erlangt das arbeitende Subjekt bei Hegel zugleich die reelle Fähigkeit, eine komplizierte und auf Koordination basierende Produktion zu erarbeiten und zu erfinden. Deswegen spricht er vom mechanischen Maschinenaufbau des Subjekts, um „es (= das Werkzeug, KBL) zu einem selbsttätigen zu machen“. (JSE III, S. 190) Hegel betrachtet die subjektive Einsicht in das Naturgesetz und die subjektive Anwendung der Naturkräfte auf die Maschine auch unter der Voraussetzung der Intersubjektivität, d. h. der wechselseitigen Anerkennung der Subjekte, da er das subjektive Bewusstsein, das das Naturgesetz erkennt und die Naturkräfte benutzt, als „List“ bezeichnet und damit zugleich die List als den „weibliche Charakter“ bestimmt. Darüber hinaus ist die List als der weibliche Charakter, die das „theoretische Zusehen“, deshalb das „in sich zurücktretende Ich“ ist, bei Hegel vom Willen getrennt, da der Wille die innere List nach außen gebracht hat. Aus diesem Grund stellt Hegel auf der intersubjektiven Ebene „zwei Charaktere“, nämlich zum einen den männlichen und zum anderen den weiblichen dar. 71 (JSE III. S. 190 – 191) In diesem Zusammenhang können wir den intersubjektiven Charakter in Hegels Begriff von Werkzeug-Arbeit in folgendem Zitat näher beleuchten: „Es (= das Werkzeug, KBL) ist das, worin das Arbeiten sein Bleiben hat, was von den Arbeitenden und Bearbeiteten allein übrig bleibt und worin ihre Zufälligkeit sich verewigt; es pflanzt sich in Traditionen fort, indem sowohl das Begehrende als das Begehrte nur als Individuen bestehen und untergehen.“ (JES I. S. 211, meine Hervorhebung) Aus dieser obigen Auffassung Hegels geht hervor, dass das individuelle Erlernen des Gebrauchs des Werkzeugs, die individuelle Arbeitshandlung für die Selbsterhaltung, nicht die einseitige Beziehung zwischen der tätigen Komponente und der passiven Komponente, d. h. die beherrschbare Kontrollierbarkeit des einzelnen Subjekts gegen den Gegenstand, sondern bereits die „existierende Allgemeinheit des praktischen Prozesses“, anders formuliert, die Abhängigkeit des arbeitenden Subjekts vom interpersonellen Wechselverhältnis, meint. Demzufolge bettet diese Abhängigkeit von der Interaktion das arbeitende Subjekt in das traditionelle Überlieferungsverhältnis ein. Das Werkzeug wird folglich nicht einfach zum 71 Vgl. A. Honneth, Kampf um Anerkennung, S. 61 – 63. 77 Produkt des Individuums, sondern zur gemeinsamen Erbschaft eines Volkes, ähnlich wie die Sprache „Sprache eines Volks“ war. Das Werkzeug, das „sich in die Traditionen fortpflanzt“, wird als das geschichtliche Erzeugnis des Volksgeistes durch die Weitergabe von Generation zu Generation, in deren Verlauf sich der Volksgeist vor dem geschichtlichen Horizont seines kulturellen Spielraums hin– und herbewegt, wiederholt und erneuert. An dieser Stelle hat die Selbsterfahrung ebenso sehr auf der Seite des Ichs, als auch auf der Seite des Geistes bei Hegel mit der jeweils eigenen Geschichtlichkeit zu tun, obwohl es sich hier um die instrumentelle Selbsterfahrung, gewissermaßen die einbahnige Subjekt–Objekt–Beziehung im Bildungsprozess des triebhaften Subjekts, handelt. Zu beachten ist, dass die Erfahrungsgrundlage unseres geschichtlichen Lebensprozesses, also die instrumentelle Erfahrung, sich aus unserer Tradition und Herkunft, aus der Geschichtlichkeit, mit der wir alle bereits verbunden sind, zusammensetzt. In diesem Zusammenhang spricht Gadamer vom „Kind seiner Zeit“ und „Sohn seiner Heimat“, wie beim späten Hegel in der Geschichtsphilosophie von „Sohn des Zeitgeistes“ die Rede ist, wenn Gadamer die wechselseitige Wirkung zwischen Vergangenheit und Gegenwart bzw. die Abhängigkeit unseres heutigen Bewusstseins von der Vergangenheit als die ontologische Grundlage unserer Erfahrung vor Auge hat. (GW. 2, S. 21) Gadamers Perspektive zufolge steht das geschichtliche Leben des Hegelschen Geistes damit zunächst im dialogischen Umgang mit dem überlieferten Vergangenen und gleichzeitig in der gegensätzlichen Auseinandersetzung mit seiner herkömmlichen Spur. Durch die Aneignung dieser Spur hindurch kann der geschichtliche Geist seinen Blick auch für seine Zukunft öffnen. Davon abgesehen mag Hegels Philosophie beinhalten, dass sie uns, „die im geschichtlichen Leben des Einzelnen wie des Gesamt jeweils neu sich stellende Aufgabe, sich mit seiner Geschichte zusammenzuschließen“ überträgt, indem Gadamer Hegels Einsicht in die Geschichtlichkeit des Geistes als den großartigen Beitrag zur Philosophie bezeichnet hat. (GW. 4, S. 394) Nach den bisherigen Auffassungen vom Subjekt, auf der einen Seite vom intellektuellen Subjekt, auf der anderen Seite vom handeln wollenden Subjekt, d. h. nach dem Trieb strebenden Subjekt, richtet Hegel seine Aufmerksamkeit auf die Liebe, Familie und das Familiengut, die „III. Potenz“. Die Entwicklung der Maschine aufgrund des Einblicks in die Naturgesetze und die rational zweckmäßige Benutzung der Naturkräfte zum Geschlechtsverhältnis zwischen Mann und Frau, haben bei Hegel „eine einfache genetische oder logische Konsequenz“. 72 In Bezug auf diesen Übergangsprozess können wir vor allem zwei Aspekte Hegels betonen: Das Bewusstsein des wollenden Subjekts hat sich selbst erstens 72 A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 353. 78 in Hegels Argumentationsgang in zwei Extreme aufgeteilt, zum einen den weiblichen Charakter als das zuschauende Wissen, zum anderen den männlichen Charakter als die operierende Macht gegen die Natur. Das Bewusstsein des wollenden Subjekts hat sich zweitens im Bildungsprozess der instrumentellen Selbsterfahrung naturwüchsig darauf besonnen, dass seine Arbeitshandlung im Prinzip auch von der interpersonellen Interaktion abhängig ist. Mit anderen Worten: Das Erlernen des Werkzeuggebrauchs enthält bereits die wechselseitige Beziehung zwischen dem Ich und dem Du als einen horizontalen und vertikalen Lernprozess der interaktiven Disziplin. Das arbeitende Subjekt lernt so im Produktionsprozess, dass der Andere ebenso sehr der Gegenstand meines Triebes ist, als ich auch der Gegenstand seines Triebes bin. Im Anschluss an diese systematische Entwicklung ist die Liebe als die sexuelle Interaktionsform, mit Hegels Worten geradezu das „sich im Anderen Wissen“, d. h. die Liebe als die menschliche Verbindlichkeit zwischen Ich und Du meint die Rückkehr von der Arbeit als der Begierde nach dem äußeren Gegenstand zu sich selbst und damit zugleich die Begierde nach dem mit sich selbst gleichzusetzenden Subjekt. (JSE III. S.209) Die Liebe bzw. die Familie befindet sich in Hegels System der Jenaer Geistesphilosophie nicht bloß auf der vorgesellschaftlichen Ebene, weil sie systematisch vor dem „Anerkanntsein“ steht. Vielmehr dürfen wir daraus den Hinweis entnehmen, dass Hegel durch den Liebesbegriff, nämlich die Familie als die Gemeinschaft der Liebe, nicht nur die einheitliche Dimension von „Intelligenz“ und „Wille“ 73 erkannt hat, sondern diese Gemeinschaft als ein Vorbild des Staates, d. h. als eine exemplarische Verkehrsform der absoluten Sittlichkeit vor dem staatlichen Horizont sah. 74 Darüber hinaus kann man sagen, dass die Liebe und die Familie im Bildungsprozess des Subjekts durch das Anerkennungsverhältnis bzw. in der Vergesellschaftung des Individuums nicht nur die einzigen Elemente sind, sondern zudem den wichtigsten Stellenwert innehaben. 75 73 Vgl. G. Göhler, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Frühe politische Systeme, S. 436. Vgl. J. Habermas, Technik und Wissenschaft >Ideologie<, S. 10 – 19. und ders., Wahrheit und Rechtfertigung, S. 187 – 189. Er hat die Liebesbeziehung in dieser Arbeit als ein musterhaftes Exemplar des einheitlichen und konkreten Verhältnisses der Allgemeinheit zu der Einzelheit und der Besonderheit, damit zugleich in jener Arbeit noch deutlicher als das „sittliche Verhältnis“ bezeichnet. Mit diesen beiden Arbeiten auch Siegfried Blasche, „Natürliche Sittlichkeit und bürgerliche Gesellschaft. Hegels Konstruktion der Familie als sittliche Intimität im entsittlichen Leben“, in: Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, hrsg. v. Manfred Riedel, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1975, S. 312ff. Hier hat er den Vorrang der Kleinfamilie in der „bürgerlichen Gesellschaft“ im sittlichen System und das Primat der Familie und des Staats für den sittlichen Lebensvollzug grundsätzlich in Beziehung zu Hegels Rechtsphilosophie untersucht. Obwohl er das sittliche Modell in der Familie nur in Hegels Rechtsphilosophie gesehen hat, könnte sein Beitrag m. E. zu einer Interpretation vom sittlichen Leitfaden der „Familie“ in der Geistesphilosophie 1803/04, 1805/06 beitragen. 75 Vgl. Hegels Diagnose von der Vergesellschaftung des Individuums durch die Selbsterfahrung im Anerkennungsprozess unterschied sich bei ihm auf zwei Weisen: Die erste Form ist die Liebe als die naturwüchsige und gegensatzlose Versöhnung, die zweite ist der Kampf um Anerkennung als die wieder 74 79 Nun stellt sich die Frage, was genau eigentlich bei Hegel die Liebe ist, enthält sein Liebesbegriff doch eine Anleitung zum Ethisch-Sittlichen. Die Liebe ist bei Hegel, wie bereits erwähnt, die anerkennungsbedürftige Begierde nach dem mit sich selbst identischen Subjekt, deshalb die Überwindung des einseitigen Strebens nach der Außenwelt und die Hinwendung von außen zum Inneren, d. h. vom äußeren Ding zum interpersonellen Gegenüber. In dieser Liebesbeziehung findet das Ich zunächst den mit sich selbst gleichzusetzenden Anderen und weiß damit zugleich von sich selbst im Anderssein. Daran im Anschluß lernt das Individuum, dass sein existenzielles Dasein unausweichlich von dem Anderssein abhängt, d. h. dass das Individuum durch das Andere anerkannt werden soll. Dass das Individuum das Sich–Wissen im Anderen und den Selbstverzicht im Anerkennungsverhältnis zwischen dem Liebenden und dem Geliebten erlebt hat, bedeutet bei Hegel, dass der existenzielle Hintergrund des Individuums auf der Anerkennung durch das Andere beruht. Mit anderen Worten: Der erste, ja einzige Anspruch an eine solche Liebesbeziehung ist die, dass ich für dich sein soll und umgekehrt du für mich sein sollst, um jedes Selbst im Anderen zu wissen. Im Anschluss an diese freiwillige Bereitschaft zur Selbsthingabe wird die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau nicht mehr zum Genussverhältnis, sondern zum Selbstverzicht bzw. zur Sorge füreinander. Beide Subjekte empfinden daher in der wechselseitigen Liebesbeziehung, in der das Gefühl vom einen die Zuneigung zum Anderen empfindet und durch die Reaktion vom Anderen anerkannt ist, bereits das Anerkanntsein. Dementsprechend sieht Gadamer die wechselseitige Liebesbeziehung bei Hegel so: „Das unmittelbare Verhältnis von Mann und Frau ist das natürliche Erkennen des gegenseitigen Anerkanntseins“. (GW. 1, S. 349) Indem das Subjekt sein Wesen außer sich selbst anschaut, ist es daher ein sich selbst im Anderen „Erkennen“, 76 auf dessen Ebene das Subjekt sein wahrhaftes Wesen in der intersubjektiven Wechselbeziehung erfasst. Das Subjekt erkennt dabei die überindividuelle Dimension im bildungsgeschichtlichen Verlauf der Selbsterfahrung des subjektiven Bewusstseins, in der das Subjekt auf seinen egozentrischen Trieb verzichtet und mit dieser Überwindung der isolierten Ichheit sein Wesen in der gesamten Verschränkung mit dem zuneigenden Anderen anzuschauen lernt. Das Erlebnis der emotionalen Intimbeziehung der Liebe führt das liebende und geliebte Subjekt zu dem Bewusstsein hin, dass das Subjekt von vornherein beim Anderen ist, im Anderen selbständig ist und damit in dieser Beziehung zugleich den Anderen auch als erkennende Rückkehr zum selbständigen Selbst durch den kämpferischen und feindseligen Gegensatz gegen den Anderen. G. Göhler, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Frühe politische Systeme, S. 436ff., u. L. Siep, Anerkennung als Prinzip, S. 54 – 55. 76 Vgl. H. Schnädelbach, Hegels Praktische Philosophie, S.131. Seiner Äußerung zufolge hat Hegel hier den Begriff „Erkennen“ in seiner biblischen Nebenbedeutung verwandt. Deswegen gilt Hegel diese Bedeutung des Erkennens als die Vollständigkeit der Liebe zwischen Mann und Frau, schließlich als die Eheschließung, eine vollzogene Ausgestaltung der Liebe im Gesellschaftsverhältnis. 80 das Selbständige annimmt. Den Übergang vom egozentrischen Trieb zur höheren Stufe der Sittlichkeit in der Liebesbeziehung beschreibt Hegel folgendermaßen: „Dies Erkennen ist die Liebe. Es ist die Bewegung des Schlusses, so daß jedes Extrem vom Ich erfüllt; unmittelbar so im Anderen ist, und nur dies Sein im Anderen vom Ich sich abtrennt und ihm Gegenstand wird. Es ist das Element der Sittlichkeit, noch nicht sie selbst, es ist nur die Ahndung(= Ahnung) 77 derselben. Jedes nur als bestimmter Willen, Charakter oder natürliches Individuum, sein ungebildetes natürliches Selbst ist anerkannt.“ (JSE III. S.193) Dieser Äußerung Hegels zufolge prägt das Subjekt seine Ich-Identifizierung in der willentlichen Zuneigung zum Anderen aus, in deren Verlauf das Sich-Versetzen in den Anderen stattgefunden hat und das Sichwissen durch den Selbstverzicht ausgebildet wird. Das Subjekt lässt sich dabei auf die überindividuelle Dimension der sittlichen Institutionen mit seiner Erfahrung der Liebe ein. Für uns liegt es zudem auf der Hand, dass die IchIdentifizierung bereits mit der Wechselbeziehung mit dem Anderen stattgefunden hat, da das Subjekt in der Liebe, in der Anerkennung durch den Anderen prinzipiell von sich selbst weiß, so wie es zugleich seine Selbständigkeit als die Selbständigkeit des Anderen vorfindet. So gesehen resultiert die Ich-Identifizierung und die Selbsteinbettung in das überindividuelle Zusammenleben der Sittlichkeit, Hegels Ansicht nach, direkt aus der intersubjektiven Anerkennung der Liebe, die mit dem natürlichen Gefühl verbunden ist. So kann man sagen, dass die Familie im Grunde die sittliche Organisation ist, die sich auf dem natürlichen Gefühl gründet, so wie Hegel später in seiner Rechtsphilosophie die Familie zusammen mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staat als einen der drei Bestandteile der Sittlichkeit beschrieben hat. Die emotional miteinander verbundenen Beteiligten lassen sich selbst bereits mit der Eheschließung auf das gesetzliche Sinnnetzwerk der Gesellschaft ein, da die Familie nicht nur auf der Liebe, dem natürlichen Gefühl, sondern auch auf der Eheschließung, den institutionellen Normen der Gesellschaft, gegründet ist. Hegel spricht demzufolge von der Ehe als „Vermischung der Persönlichkeit und Unpersönlichkeit des Natürlichen.“ (JSE III. S.219) Denn die Familie als die Gemeinschaft der Liebe ist nicht nur das Zusammenleben zwischen Mann und Frau, das durch die emotionale Zuneigung und das Liebesgefühl gegenüber dem Anderen aufgebaut wird, aus diesem Grund natürlich anerkannt ist, sondern sie ist mit ihrem natürlichen Potential bzw. der emotionalen Zuneigung von vornherein auch 77 G. W. F. Hegel, Jenaer Realphilosophie, hrsg. v. J. Hoffmeister, Hamburg 1969, S. 202. 81 auf die Institutionen der Gesellschaft bezogen. In diesem Sinn sieht Hegel die Familie als den einheitlichen Horizont von dem natürlichen Gefühl und der Sittlichkeit der Gesellschaft. Von diesem Gesichtspunkt aus kann man behaupten, dass Hegel die Familie in der modernen Gesellschaft als „Gefühlsmodell“ verstanden hat, wenn er den Einwand gegen das Kantische Modell der Familie erhebt. Denn die Familie bei Kant besteht im Prinzip als Rechtsverhältnis zwischen Mann und Frau. Dagegen ist die Familie bei Hegel „nicht Verbindung durch einen Kontrakt“. (Ebd.) 78 Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass die Liebe bzw. die Familie das Subjekt, die Familienmitglieder bereits in das überindividuelle Anerkennungsverhältnis und den vorgegebenen Horizont der Sittlichkeit mit einbeziehen. Damit prägt das Subjekt zugleich seine Ich-Identifizierung aus und erkennt ebenso sein selbständiges Selbst wie die Selbständigkeit des anderen Beteiligten. Aus diesem Grund ist Hegel davon überzeugt, dass die Sittlichkeit der Gesellschaft von der menschlichen Natürlichkeit abgeleitet werden kann, weil er hier zuerst die Liebesbeziehung als das „Element der Sittlichkeit“ vorgefunden hat. Aus Hegels Sicht enthält die Liebesbeziehung zwei Elemente: Erstens lernt das Individuum, dass sein Selbst mit dem Anderen im Bildungsprozess des Bewusstseins, im Verlauf der Ich-Identifizierung, bereits verknüpft ist und dass seine Selbständigkeit auch nur durch das Anerkanntwerden durch den Anderen und zugleich durch die anerkennende Annahme des Anderen als seinem Partner unter der Voraussetzung des Selbstverzichts gewonnen wird. Zweitens bezieht sich der Aufbau der Familie, die Eheschließung selbst, bereits auf die sittliche Sphäre der Gesellschaft, weil die Liebe von Mann und Frau automatisch mit der Eheschließung als der Anerkennung von der Gesellschaft besiegelt wird. So gesehen ist m. E. hierin der Hinweis enthalten, dass Hegels zwei Anerkennungsformen in der Liebesbeziehung bereits beides sein können: Einerseits das emotionale Anerkennungsverhältnis, andererseits das gesetzliche und sittliche Anerkennungsverhältnis. So ist das Sittlichsein im Familienverband bei Hegel „das Element der Sittlichkeit“, jedoch „nicht sie selbst“, weil das Sittliche in der Familie nur die unmittelbare Form der Sittlichkeit darstellt, die absolute Sittlichkeit im Staat jedoch durch das Konfliktfeld des Rechtsverhältnisses wiederhergestellt werden kann, mit Hegels Worten, vermittelt werden muss. Dennoch verhält es sich bei Hegel de facto zweifelsohne so, dass die Sittlichkeit im Grunde in der Liebesbeziehung, anders gesagt, in der menschlichen Natürlichkeit verankert ist, noch deutlicher, die Sittlichkeit eine menschliche Natürlichkeit 78 Vgl. Zu Hegels Auffassung über die Kleinfamilie in der modernen Gesellschaft als Gefühlsmodell in Verbindung mit der Kantischen Einsicht in die Familie im Rechtsverhältnis, Axel Honneth, „Zwischen Gerechtigkeit und affektiver Bindung. Die Familie im Brennpunkt moralischer Kontroversen“, in: ders., Das Andere der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 2000, S. 193 – 215. 82 darstellt, da Hegel selbst, wie bereits erwähnt, von der Sittlichkeit als „eine gedoppelte Natur“ im Naturrechtsaufsatz oder als die „unorganische Natur“ spricht. 79 (JSE I. S. 214) Aus den bisherigen Überlegungen, die ich entwickelt habe, geht hervor, dass das Individuum zunächst seine Ich-Identifizierung in der Liebesbeziehung als dem emotionalen Anerkennungsverhältnis ausbildet, dass die gesellschaftlichen Verkehrsformen in der sittlichen Sphäre im Prinzip mit der emotionalen Intimbeziehung in der familialen Binnenstruktur, mit der Wechselwirkung der Anerkennung zu tun haben. Schließlich wird deutlich, dass die Sittlichkeit in der anerkennenden Intimbeziehung unter den Mitgliedern der Familie nicht nur dem embryonalen Ansatzpunkt der absoluten Sittlichkeit zugeordnet ist, sondern auch als die zugrunde liegende Eigenschaft der Menschlichkeit, d. h. als die menschliche Natürlichkeit bezeichnet werden kann. Gleichzeitig können wir zu dem Resultat gelangen, dass die Liebesbeziehung und die emotionale Intimbeziehung in der Familienverwandtschaft das Muster bzw. ein Motor des Übergangs zur allgemeinen Sittlichkeit auf der gesellschaftlichen Ebene, ein Vorreiter zur normativen Wechselbeziehung in der bürgerlichen Gesellschaft und die antizipierte Vorstruktur der absoluten Sittlichkeit im Staat ist. Wir haben in Bezug auf die Liebesbeziehung zwischen den Menschen bereits gesehen, dass die Ich-Identifizierung, einerseits das selbständige Selbst im Anderen zu sehen und andererseits das Sich-Wissen durch den Selbstverzicht zu erlangen, bei Hegel unter der prinzipiellen Voraussetzung möglich ist, dass das Ich den Anderen als den Dialogpartner und das Anerkanntsein annimmt. Aus dieser Anerkennung des Anderen als einem Dialogpartner entsteht die Familie, die ein Interaktionsfeld bildet, in das die Individuen eingebunden sind und in dem sie ihre Individualität zunehmend herstellen. Dieses ideale und institutionelle Verhältnis der Liebe soll sich bei Hegel nunmehr nach der Realität, die durch „unmittelbare Dingheit“ vermittelt ist, richten. Die Liebe bzw. die Familie soll hier zur „erfüllte[n] Liebe“ werden. (JSE III. S. 194) Dies berücksichtigend, unternimmt Hegel den Versuch, über das „Familiengut“ im familialen Intimbereich nachzudenken. Nach der Eheschließung fordern die Familienmitglieder „die gegenseitige Dienstleistung“ und alle machen um ihrer selbst willen vielmehr für alle den eigenen Dienst. (Ebd.) Hierbei wird der Familienkreis durch dieses vergegenständlichte Resultat der Dienstleistung garantiert und geschützt. Ihnen allen gelten diese Dinge auch als „Mitte der Liebe“ und als gemeinsamer Besitz, d. h. „Familienbesitz“. (Ebd.) In diesem Sinn löst sich der Gegensatz der Triebe in diesem Familienbesitz auf. Mit anderen Worten: Der Trieb zwischen den Menschen, der zu seiner 79 Zudem auch in Hegels Rechtsphilosophie, vgl. Anm. 44 in dieser Arbeit. 83 Selbsterhaltung noch immer nach dem äußeren Gegenstand strebt, ist erst hier im Familienbesitz miteinander verbunden, d. h. er hat die einheitliche Trieberfüllung unter den Mitgliedern der Familie gefunden. Deswegen wird dieser Familienbesitz dann zum allgemeinen und gemeinsamen Gut, weil er durch die gemeinsame Arbeit aller Mitglieder geschaffen wird. Hegel drückt dies mit den Worten aus: „Es (= dies dritte, d. h. das Familiengut, KBL) ist wie das Werkzeug die allgemeine Möglichkeit des Genusses, und auch die allgemeine Wirklichkeit desselben; es ist ein unmittelbar geistiger Besitz.“ (JSE III. S. 195, meine Hervorhebung) Dadurch, dass der Familienkreis mit jeder Dienstleistung den gemeinsamen Besitz erhalten kann, erkennen alle Mitglieder zunächst „das Sein für Andere“, die Selbstaufopferung für das gegenseitige Subjekt im Anerkennungsverhältnis, mit dem das reale Ding, die vergegenständlichte Liebe vermittelt wird. Dementsprechend wird der gemeinsam vergegenständlichte Besitz vom triebhaften Subjekt nicht mehr verzehrt und zerstört, sondern wird ständig aufrecht erhalten und ist nach wie vor allgemein, so wie das Werkzeug über die Besonderheit des Erfinders hinaus durch das Erlernen des Nachfolgers als Erbschaft an ein Volk übergeben wird. An dieser Stelle wird das Familiengut auch durch die „Erbschaft“ der Familienverwandtschaft dem Nachfolger übergeben. Mit dieser Erbschaft der Familie ist die Natürlichkeit der Mitglieder der Familie auch überwunden, die schicksalhaft und zwangsläufig sterben. (JSE III. S. 221) Hinsichtlich dieses Aspekts fällt auf, dass das Familiengut bei Hegel nicht nur der Gegenstand des Genusses der gegenwärtigen Generation, sondern auch der Vorrat und die Vorbereitung für die künftige Generation, den künftigen Nachfolger ist und auch als die Erbschaft der Familienverwandtschaft, die nicht nur das Eigentum, sondern auch den „geistigen Besitz“ der Familie, z. B. die Gebräuche, die Familientradition, die Sprache, das sittliche Benehmen, die Verhaltensweise usw. einschließt, von Generation zu Generation ununterbrochen weitergegeben wird. Im Verlauf der Besitzergreifung und der Erbschaft zwischen den Mitgliedern der Familie wird der Andere im Grunde ausgeschlossen, wie Hegel die Familie „als Ganzes einem anderen in sich geschlossenen Ganzen“ gegenüber stellt. Jeder Familienverband zeigt sich zumindest in Verbindung mit dem Familienbesitz als die ausschließende und deshalb selbständige „Individualität“. (JSE III. S. 196) Deswegen steht ein Familienverband dem anderen gegenüber und hat ein Verhältnis des Gegensatzes zu ihm. An diesem Punkt können wir uns an Hegels Formulierung über den „Kampf um Ehre“ im „System der 84 Sittlichkeit“ erinnern. Von diesem nahe liegenden negativen Gegensatz unter Familien abgesehen, müssen wir zunächst der Geburt des Nachfolgers als der Einheit der Liebe unsere Aufmerksamkeit zuwenden, weil die Ausstrahlung der Elternliebe die direkte Rückkehr und die Verinnerlichung der Liebe meint. Nach der Geburt des Kindes gelangt die Liebe von Mann und Frau zum „erkennenden Erkennen“ zu ihrer realen Vergegenständlichung, durch deren Erlebnis beide das einheitliche Bewusstwerden von ihrer Liebe selbst erfahren. Hegels Ansicht zufolge schauen die Eltern das Erzeugnis ihrer Liebe und die wesentliche Vollständigkeit der Liebe in ihren Kindern an. Dieser Vorgang enthält ebenso den biologischen Reproduktionsvorgang, die erneute Zeugung der Familienmitglieder, wie die Kindererziehung, in deren Verlauf das Kind auch als ein neues Mitglied der Gesellschaft die Bereitschaft zeigt, sich auf die Vergesellschaftung einzulassen. Erst nach der Geburt ihres Nachfolgers finden die Eltern deshalb ihre Liebe, mit Hegels Worten, als „selbstbewußte Einheit“. (JSE III, S. 195) Mit anderen Worten: Die Liebe kann aus Hegels Sicht mit der Zeugung des Kindes die vollständige Einheit von der Selbstheit und der Gegenständlichkeit erlangen. Diesbezüglich können zwei Aspekte besonders betont werden: Durch die Geburt des Kindes als der vollständigen Einheit wird die Liebe von Mann und Frau zunächst widergespiegelt und gelangt zum Bewusstsein.80 Damit wird zugleich auch das einheitliche 80 Vgl. Dieter Henrich, „Selbstbewusstsein. Kritische Einleitung in eine Theorie“, in: Hermeneutik und Dialektik, Bd. I, hrsg. v. Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl, Tübingen 1970, S. 280–284 und ders., „Fichtes >Ich<“, in: ders., Selbstverhältnis, Stuttgart 1993, S. 71 und S. 76–77. Um die ontologische Voraussetzung in der Bewusstseinstheorie zu verdeutlichen, kann man m. E. auf die Bewusstseinstheorie von Dieter Henrich zurückgreifen, der die Reflexionsaktivität dem Gedankengang Fichtes folgend behandelt hat. Aus seiner Sicht handelt es sich nicht um eine Isoliertheit des Bewusstseins, sozusagen die egoistische Identität des Bewusstseins mit sich selbst, sondern entscheidend ist, woher das Selbstwerden des Bewusstseins kommt, wie das Bewusstsein gleichzeitig das Selbst überwinden und zu einer höheren, bewussten Synthese gelangen kann. In Bezug auf die Herkunft des Ichs, hat er das Sein des Ichs als den ontologischen Hintergrund vorausgesetzt. Wir können deshalb unser Sein als wir selbst gar nicht verleugnen, selbst wenn wir uns nach der unhintergehbaren Grundlage des Ich-Seins fragen. An dieser Stelle wird der Satz „wir sind >Ich<“ bei ihm zur ersten unhinterfragbaren Voraussetzung. Vor dem Hintergrund des Bewusstseins vom Ich und des Selbstseins des Bewusstseins wird die Reflexionsaktivität ausgebildet. Damit spiegelt sich zugleich das Bewusstsein im Reflexionsprozess zum Selbst wider. Im Rahmen der gesellschaftlichen Handlung hat der reflektierende Vorgang des Bewusstseins auch die beiden Tendenzen, „seine organisierende Funktion zu ergreifen und sich zu interpretieren als das Wesen, das der Reflexion und eines durch Reflexion kontrollierten Handelns fähig ist.“ Dabei hat es der reflexive Vorgang des handelnden Subjekts mit der Aktivität des Subjekts selbst und mit der reflexiven Suche nach der legitimen Angemessenheit zu tun. In diesem Vorgang hat sich das Bewusstsein selbst zum Grund der Handlung gemacht und die reflexive Selbstüberwindung in der Widerspiegelung des Selbst durch das Andere erreicht, um „die Selbsterkenntnis“, „sich selbst zu gewinnen“. Um dabei die reflexive Selbstüberwindung und die reflexive Rückkehr des Bewusstseins zu sich selbst noch präziser darzulegen, durch deren Bewegung das Bewusstsein über seine Leerheit „der bloßen Bewusstheit“ hinaus gegangen ist, beruft sich Dieter Henrich auf Fichtes „Auge-Metapher“. Das Auge gibt seiner Ansicht nach dem Menschen als dem Selbstbewusstsein „die Orientierungsfähigkeit“, die menschliche „Aktivität als solche“, abzuleiten und anzuweisen. In diesem Sinn drückt er die reflexive Handlung des Bewusstseins auf zwei Weisen aus: Einerseits das „Auge der Aktivität“, d. h. „seiner Sicht“, andererseits die „Aktivität als solche“. Wenn das Auge sich als das Sehvermögen nicht mehr an seinem Inneren, sondern an seinem Äußeren orientiert, werden wir uns für das entscheiden, was uns in den Blick gekommen ist, streben wir nach dem Entschiedenen. Daher wird die Handlung des bewussten Subjekts zunächst durch die Sicht des Auges wegweisend gelenkt. Zugleich ist seine Handlung damit auch durch die Sicht des Auges, die Widerspiegelung 85 Bewusstwerden von „Intelligenz“ und „Wille“ in der Liebesgemeinschaft, die mit der Geburt des Kindes vollständig wird, erreicht. An dieser Stelle können wir Hegels Idee der Bildung, im eigentlichen Sinn Selbstausbildung, die sich m. E. musterhaft in der Kindererziehung zeigt, unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Ich möchte mich hier auf Gadamers hermeneutische Aspekte 81 berufen und möchte die Kindererziehung als den Bildungsprozess des Kindes bei Hegel im Zusammenhang mit dem Spracherwerb des Kinds in Gadamers Hermeneutik darstellen. Das Kind hat beim Heranwachsen im Binnenraum der familialen Intimität das Material seines Bewusstseins offensichtlich von seinen Eltern übernommen. Eine wichtige unter den übernommenen Sachen ist beim Kind die Sprache. Mit Hilfe der Mutter lernt das Kind im Prinzip die eigene Sprache. In dieser Beziehung wird das Kind von vornherein zum Dialogpartner der Mutter, obwohl „das Kind das volle Sprachvermögen noch nicht hat“. Aber dennoch fragt die Mutter das Kind, was es ihr sagen will und das Kind zeigt seiner Mutter mit dem unartikulierten Laut, Fingerzeichen, Gebärden usw., was es meint. Diese Hin– und Herbewegung zwischen Mutter und Kind hat im Wesentlichen dialogischen Charakter, der prinzipiell die wechselseitige Anerkennung und Respekt voraussetzt. In diesem Gespräch, das grundsätzlich aus der Dialektik von Frage und Antwort besteht, gelangen die Mutter und das Kind zur einheitlichen Verständigung, das Kind lernt von seiner Mutter die Sprache und hört seiner Mutter zu. Umgekehrt erfährt die Mutter in diesem dialogischen Prozess, dass das Kind so etwas, was sie selber gar nicht bemerkt hat, „besser als sich selbst erkennt“. 82 (GW. 8, S. 354 – 357) Im Anschluss an das Sprechenlernen des Kindes im Gespräch zwischen der Mutter und dem Kind ist es notwendig, dass wir uns daran erinnern, dass Hegel im obigen Zitat das Familiengut als den „geistigen Besitz“ bezeichnet hat. Das Kind lernt in dieser Erziehung im familialen Interaktionsfeld, im Vorbereitungskurs für das neue Mitglied der Gesellschaft nicht nur die Muttersprache, sondern auch die sittliche Verhaltensweise und den des Selbst im Anderen, reflexiv auf sich selbst zurückbezogen. Wenn die Darstellung des Bewusstseins von Dieter Henrich in Bezug auf die Liebesbeziehung von Mann und Frau und die Eltern–Kind–Beziehung bezogen wäre, wäre diese Selbsterfahrung des Bewusstseins m. E. im familialen Interaktionsfeld die gleiche, in dem Mann und Frau, die sich beide im Anerkennungsverhältnis befinden, unter den wechselseitigen Einwirkungen aufeinander, die darin bestehen, das sich das Selbst durch die Reaktion des Gegenübers selbst anschaut. Dementsprechend geschieht die prozessuale Selbstentfaltung des Bewusstseins in der Kindererziehung als der Eltern–Kind–Beziehung mit derselben Struktur, in deren Verlauf die Eltern ihre Selbstheit durch die Reaktionsweise des Kindes widerspiegeln und umgekehrt das Kind seine Selbstheit in seinen Eltern, im Widerhall der Eltern auf sich selbst findet und herstellt. Zum kritischen Einspruch gegen den Aspekt von Henrich, Axel Honneth, „Liebe und Moral. Zum moralischen Gehalt affektiver Bindung“, in: ders., Das Andere der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 2000, S. 232 – 234. 81 Vgl. Zum hermeneutischen Aspekt über die Kindererziehung und die sittliche Vergesellschaftung des Kindes im familialen Intimbereich, Paul Redding, Hegel’s Hermeneutics, Ithaca/London 1996, S. 191ff und Axel Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, Stuttgart 2001, S. 88 – 90. 82 Zum spekulativen Wechselverhältnis zwischen dem Zuhören und dem Ungesagten in Gadamers Dialoghermeneutik, vgl. Kap. I – 2 vom III. Teil in dieser Arbeit. 86 Handlungswegweiser, der seine Neigungen, Bedürfnisse und Begierden anleitet. In diesem pädagogischen Gesprächsverhältnis 83 hat das Kind nicht nur die materielle Erbschaft, sondern auch die geistige Erbschaft übernommen, die für die Vergesellschaftung die Voraussetzung ist und als ein handlungsorientierter Wegweiser im sozialen Lebensfeld fungieren wird. Durch diesen Bildungsprozess hindurch wird die Familie zunächst durch den biologischen Zuwachs des Nachfolgers naturhaft aufgelöst, da die Eltern schicksalhaft sterben werden. Damit wird sie Hegels System zufolge durch die Vergesellschaftung des Nachfolgers und durch die Übertragung des familialen Intimbereichs auf die soziale Lebenswelt unweigerlich abgebaut. Von dieser Selbstwerdung des Kindes und der Auflösung der Familie hat Hegel das Anerkennungsverhältnis im Rechtsverhältnis abgeleitet, da die Familie noch immer in der „unmittelbaren Einheit“ ohne den Gegensatz des extremen Willens verbleibt und diese Einheit durch den Anerkennungsprozess im Rechtsverhältnis, in dem das Subjekt als das Selbständige, das freie Recht, bestimmt ist, wiederhergestellt und vermittelt werden soll. Aus diesem Übergangsprozess vom vernetzten Sittenfeld der familialen Intimität zum Kampf um Anerkennung, in dessen Konfliktverlauf das Subjekt als die Rechtsperson, das selbständige Wesen durch den Anderen anerkannt werden kann, entsteht bei Hegel zunächst der „wissende Wille“, d. h. der ganzheitliche Horizont des Bewusstwerdens von „Intelligenz“ und „Wille“. (JSE III. S. 203) Dieser Horizont verweist bei Hegel auf den „wirkliche[n] Geist“, nämlich den erscheinenden Geist als die vermittelte Sittlichkeit, auf dessen Schauplatz das Ich dem Anderen den sittlichen Anspruch zum Gebot macht und die sittliche Handlungssphäre den handelnden Subjekten. (JSE III, S. 204) Fasst man die bisherigen Überlegungen zusammen, so sind „Sprache“, „Arbeit“ und „Liebe und Familie“ die elementaren Medien, die die sittliche Lebensganzheit ausprägen können. Damit ist die Familie zugleich auch die Gemeinschaft der Liebe, die durch die ontologische Erfahrung der Anerkennung aufgebaut wird, ein realer Ort, an dem die beiden anderen Medien, Sprache und Arbeit, durch die Liebesbeziehung, die Kindererziehung und die Erbschaft konkretisiert und konstruiert werden, da die Beteiligten nicht nur die Arbeit für die Anderen leisten, sondern auch ihren Dialogpartner in der Gemeinschaft der Liebe finden. Die Gemeinschaft der Liebe, die das Gespräch miteinander und die Arbeit für die Anderen beinhaltet, basiert auf der Anerkennung durch die unmittelbare Begegnung, die durch das 83 Zur pädagogischen Funktion des Gesprächs, die Beteiligte zum Ethischen hinführen, vgl. Hans–Georg Flickinger, „Pädagogik und Hermeneutik – Eine Revision der aufklärerischen Vernunft“, in: Praktische Philosophie und Pädagogik, Kasseler philosophische Schriften 37, hrsg. v. Heinz Eidam u. Frank Hermenau, Kassel 2003, S. 120 – 131. 87 Liebesgefühl das Gegenüber anschaut und damit alle Beteiligten zu dem überindividuellen Sinnhorizont, auf dem im Prinzip die egozentrische Subjektivität überwunden ist, führt. 88 III – 2. Die freiwillige Reintegration des Ichs ins Wir–Bewusstsein Hegel nimmt nun die systematische Hinwendung von der gegensatzlosen Liebesbeziehung zum distanzierten und kontroversen Anerkennungsverhältnis im Rechtsverhältnis in dem Teil „Wirklicher Geist“ vor. Aus der Sicht Hegels sollen die zwei Seiten im Anerkennungsmodell gleichwertig betont werden: Das Subjekt wird einerseits im Verlauf des Bildungsprozesses seines Bewusstseins durch die emotionale Vereinigung, die unmittelbare Anerkennung ohne Gegensatz im familialen Interaktionsfeld von vornherein anerkannt. Obwohl der Familienkreis bereits die Anerkennung im familialen Intimbereich bietet, ist es für Hegel unerlässlich, dass das Subjekt seine Selbständigkeit im sozialen Umfeld durch die Distanzierung vom Anderen bestätigt, um die höhere Dimension der Einheit vom einzelnen Willen und dem allgemeinen Willen zu erreichen. Aus diesem Grund stellt sich das Subjekt von sich aus auf den Kampf um Anerkennung ein, obwohl es bereits die anerkannte Selbständigkeit und das Anerkennungsverhältnis erfahren hat. In diesem distanzierten Anerkennungsverhältnis soll das Subjekt seine Identität durch die Anerkennung durch den fremden Anderen in den gesellschaftlichen Verkehrsformen ausprägen. So ist die IchIdentifizierung des Subjekts im lebenslangen Bildungsprozess ebenso in der familialen Liebesbeziehung wie im gesellschaftlichen Bezugssystem bei Hegel „die fundamentale Voraussetzung der Theorie der Anerkennung“. 84 Um ein Moment der Anerkennungsmodi zu erschließen, geht Hegel zunächst auf das ökonomische Verhältnis von „Tausch“, „Wert“ und „Geld“ auf dem Markt ein. Der Kampf um Anerkennung findet bei Hegel unter der Voraussetzung statt, dass das Subjekt immer schon als freie Selbständigkeit anerkannt ist, da das Subjekt als ein frei wollendes Selbst bereits im Bildungsprozess zum wissenden Geist, in dem die Intelligenz mit dem Willen, das theoretische Bewusstsein mit dem praktischen Bewusstsein, einheitlich verbunden ist, im Binnenraum der familialen Intimbeziehung anerkannt ist. Unter diesen Rahmenbedingungen kann es sich im sozialen Lebensraum bezogen auf die Anerkennung des Anderen als Rechtsperson lediglich auf die ökonomischen und rechtlichen Verkehrsformen beziehen. Für die Erlangung der Anerkennung des Anderen muss es sich im Verlauf des Konflikts durch die interaktive Wechselbeziehung durchsetzen. Deswegen kann man geltend machen, dass der Kampf um Anerkennung „nur ein Moment“ 85 im gesamten und kompletten Bildungsprozess des menschlichen Subjekts darstellt. An diesem Punkt ist die Rede vom Anerkennungsverhältnis im gesellschaftlichen Binnenraum als „Arbeit Aller und für Alle, und 84 85 L. Siep, Anerkennung als Prinzip, S. 64. A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 359. 89 Genuss Aller“. (JSE III, S. 205) Dieser Äußerung zufolge ist es selbstverständlich, dass sich das Subjekt im ökonomischen und rechtlichen Bezugssystem nicht unmittelbar an der Konfliktsituation orientiert, sondern eher die Solidarität und die Freundschaft der Gesellschaft vorausgesetzt, um überhaupt mit dem Anderen innerhalb des gesellschaftlichen Interaktionsfelds Geschäfte machen zu können und sich zu verständigen. Daran anschließend hat das triebhafte und darum arbeitende Subjekt die Einzigartigkeit seines eigenen Bedürfnisses überwunden und damit nicht nur der eigenen Triebbefriedigung, sondern auch dem Bedürfnis des Anderen im ökonomischen Verkehr den Blick zugewandt. Das Subjekt weiß darum, dass sein Bedürfnis nur durch die Arbeit des Anderen befriedigt werden kann, weil seine Begierde von vornherein mannigfaltig und immer neugierig ist. In dem Teil „Wirklicher Geist“ geht es bei Hegel auch um die einheitliche Übereinstimmung des einzelnen Willens mit dem allgemeinen Willen. Der Grund dafür ist hier zunächst die gegenseitig anerkannte Interaktion unter den Personen, die bereits als Rechtspersonen, als Eigentumsbesitzer, insbesondere im Wirtschaftsverkehr, vom Anderen bestätigt sind. Auf der gesellschaftlich-ökonomischen Ebene, in der alle Beteiligten gegenseitig als Rechtspersonen anerkannt sind, begegnet das Subjekt dem Anderen mit seinem überflüssigen Produkt am Markt. Unter dieser Bedingung findet die institutionell normierte Gemeinsamkeit im Rechtsverhältnis, z. B. „Tausch“, „Wert“, „Geld“, statt. Im Bereich des ökonomischen Güteraustauschs erwartet das Subjekt vom Handelspartner, dass das Produkt seiner Arbeit von diesem Partner anerkannt wird und beide durch die geltend machende Schätzung des Wertes der Waren zu einem allgemeingültigen Einverständnis gelangen. In diesen verschränkten Handelsbeziehungen gibt es nur die Ich-Identität des Subjekts. Die gesellschaftliche Wirklichkeit des Subjekts, auf dessen Status die wechselseitige Anerkennung als Besitzer des Erzeugnisses durch die eigene Arbeit beruht, hat das Vertrauen zueinander und die gegenseitige Freundlichkeit bereits hinter sich gelassen. Das Subjekt erfährt in diesem Verlauf der übereinstimmenden Schätzung des Tauschwertes und der gegenseitigen Anerkennung als Rechtspersonen, dass die Befriedigung seines Bedürfnisses von dem durch die Arbeit des Anderen erzeugten Produkt abhängt und seine Arbeit das Bedürfnis des Anderen befriedigt, mit Hegels Worten, dass „Jeder also die Bedürfnisse vieler befriedigt, und die Befriedigung seiner vielen besonderen Bedürfnisse die Arbeit vieler anderer ist.“ (JSE III, S. 206) So erlangt das Subjekt seine Ich-Identifizierung als das freie Selbst, die Selbsterkenntnis im Anderen im Prozess dieses Güteraustauschs. Indem das Subjekt zum allgemein-gemeinsamen Einverständnis mit dem Handelspartner bei der Schätzung des Wertes in den Handelsbeziehungen gelangt und lernt, die Selbstverwirklichung 90 nur im anderen Selbst zu erreichen, verinnerlicht es nun auf der Seite des materiellen Dinges denselben einheitlichen Wert und damit auch die internalisierten Gesellschaftsnormen. Dieser vereinbarte materielle Wert ist bei Hegel das Geld als der „materielle, existierende Begriff“. (JSE I, S. 230) Mit dem Geld wird der ideell abstrakte Wert von Seiten aller Subjekte übereinstimmend und allgemein hergestellt und damit gelangen alle Betroffenen zugleich zu den ideell normierten Verkehrsformen, die sich von der materiellen und gegenständlichen Unmittelbarkeit entfernen. Im Hinblick auf die einheitliche Idealisierung der vereinbarten Einschätzung des Wertes und die Internalisierung der Gesellschaftsnormen hat Hegel auch das Vertragsverhältnis vor Augen. Mit diesem Vertragsverhältnis finden wir m. E. den Kulminationspunkt der Vertrautheit und der gesellschaftlichen Solidarität, die die erste Voraussetzung für die Selbsterhaltung und –verwirklichung der Gesellschaftsnormen sind, in Hegels Anerkennungstheorie, da der Vertragsabschluss erst dann möglich ist, wenn die Vertragspartner einander vertraut sind. Mit einem beliebigen Vertragspartner einen Vertrag abzuschließen meint, noch keine konkreten Gegenstände miteinander auszutauschen, sondern vielmehr dem Wort des Vertragspartners und dem Versprechen von den künftigen Leistungen zu vertrauen. Dementsprechend bezieht sich diese verinnerlichte Anerkennung des Vertragspartners im Vertragsabschluss geradezu auf die Vertrautheit, die Verlässlichkeit, die Freundschaft, die das menschliche Zusammenleben möglich macht. Eine solche gesellschaftliche Solidarität lieg diesem unentbehrlichen Vertrauen zugrunde, worauf der Vertragspartner sein Wort halten wird. In diesem Sinn nennt Hegel den Vertrag den „ideellen Tausch“ oder „einen Tausch des Erklärens“, der durch den kommunikativen Austausch der Worte zustande kommt. (JSE III, S. 209 - 210) Darüber hinaus benennt Hegel die in dem Vertragsverhältniss enthaltene Gefahr, die sich aus der unmittelbaren Distanz vom gegebenen Wort und der konkreten Leistung des Vertragspartners ergibt, da der Vertrag mit Hegels Worten noch immer nur „Sollen als Sollen“ ist (JSE III, S. 210), nämlich nur ein wörtliches Versprechen zur künftigen Leitung ist, wobei immer sein kann, dass das Wort konkret erfüllt wird oder nicht, obwohl der Betroffene die höhere Stufe der Selbstverwirklichung und der Ich–Identifizierung vor dem gesellschaftlichen Horizont durch die obige Vertrautheit des Anderen erreichen zu können glaubt. Das Subjekt kehrt mit seiner negativen Verhaltensweise, nämlich dem Vertragsbruch, zum egozentrischen und ausgeschlossenen Selbst zurück, wie die Familie bei der Besitzergreifung die andere familiale Gemeinschaft von sich selbst ausschließt und sich ihr gegenüberstellt. Der Vertragsbruch, der sich der egozentrischen Selbstheit entzogen hat, meint die einseitige Zerstörung des im Vertrag zum Ausdruck gebrachten allgemeinen Willens, der 91 notwendigerweise durch die konkrete Leistung realisiert werden muss. Mit diesem Vertragsbruch tritt deshalb auch der Widerspruch zwischen dem Willen des Einzelnen und dem allgemeinen Willen zutage. Dennoch sollte dieser Widerspruch zum allgemeinen Willen auf die Weise des Imperativs überwunden werden und die versäumten Pflichten sollten erfüllt werden, da die Allgemeinheit durch den Vertragsabschluss bereits geprägt ist. Deswegen lässt sich der allgemeine Wille durch den „Zwang“ der Vertragserfüllung gegenüber dem einzelnen Willen zum Ausdruck bringen. Mit anderen Worten: Der vertragsbrüchige Einzelne wird vom allgemeinen Willen gezwungen, sein gegebenes Wort durch seine Leistung zu erfüllen, umgekehrt zeigt sich der allgemeine Wille in diesem Zwangsprozess als der reale, erscheinende, latente Wille. Der allgemeine Wille, d. h. der erscheinende Geist realisiert sich selbst, wie bereits erwähnt, zunächst durch die negierende Handlung des einzelnen Willens im sozialen Umfeld, d. h. das Verbrechen des Einzelnen im bereits etablierten Zusammenleben der Gesellschaft und gibt sich damit selbst zu erkennen. Hier wird ersichtlich, dass Hegel erstens durch die negative Verfügung der Zwangsgewalt den Zugang des einzelnen Willen zum allgemeinen Willen zu finden versucht. Zweitens stellt er durch die negative Tätigkeit des vertragsbrüchigen Einzelnen die Selbstverwirklichung des allgemeinen Willens als die höhere Dimension der Verbürgung der subjektiven Freiheit und der gesellschaftlichen Solidarität dar. Aus dieser Überlegung heraus stellt Hegel seine Einschätzung des Vertragsbruchs dar, nämlich nicht nur, dass der Gegensatz von dem einzelnen Willen und dem allgemeinen Willen zum Vorschein kommt, sondern dass die Vertragspartner mit dem Auftauchen des Widerspruchs ihre Aufgabe darin sehen, die Konfrontation miteinander, also den Kampf gegen den Verbrecher auszutragen. Durch den Vertragsbruch befindet sich ein Vertragspartner im Gefühl des Leidens, nämlich durch den anderen Vertragspartner verachtet und beleidigt worden zu sein. Ein Vertragspartner erfährt damit durch den Vertragsbruch, dass seine Persönlichkeit vom anderen Interaktionspartner verletzt wird. Sein Eigentum war zunächst von den ökonomischen und rechtlichen Verkehrsformen durch die anderen Interaktionspartner anerkannt worden, weshalb er als Person im institutionellen Rechtsverhältnis durch die anerkannte Zustimmung als Eigentümer bestimmt worden war. Demzufolge fordert ein Vertragspartner dem vertragsbrüchigen Partner die Erfüllung des Vertrags aggressiv ab. Damit stellt er sich diesem Partner zugleich kontrovers gegenüber. Mit dieser aggressiven Forderung und der im Konflikt enthaltenen Konfrontation geraten beide Interaktionspartner in „den Kampf um Anerkennung“, in dessen Verlauf die Partner durch die wechselseitige Anerkennung ihre eigene Persönlichkeit, nämlich die eigene Ich-Identität 92 wiederherstellen müssen und gleichzeitig im vom Anderen Anerkanntsein das eigene Selbstgefühl wiedergewinnen. Betrachtet man die Phänomene des Kampfs um Anerkennung noch genauer, stellt sich das Subjekt dem Interaktionspartner in einer Geste der aggressiven Selbstbehauptung gegenüber, reagiert auf das Verbrechen mit dem Empfinden, dass seine Persönlichkeit und sein eigener Sinn des Lebens von diesem Interaktionspartner verletzt und beleidigt worden sind. Dieses Gefühl der Persönlichkeitsverletzung und des Leidens führt die beiden Interaktionspersonen in die unbehagliche Situation, in der das eigene Leben bedroht und die Todesgefahr in Kauf genommen wird. Jedoch muss die wechselseitige Anerkennung der Rechtspersonen aus der bereits ausgebildeten Wechselbeziehung der Intersubjektivität im Binnenraum der familialen Intimbeziehung und im Vertrauen miteinander am Markt wiederhergestellt werden, da die beiden Akteure nicht nur die Zerstörung des eigenen Besitzes erleiden könnten, sondern auch die Zerstörung der eigenen physischen Existenz, den eigenen Tod in dieser unbehaglichen Situation der gegenseitigen Todesbedrohung über sich ergehen lassen zu müssen. Diese gegenseitige Verletzung und Beleidigung betreffend, drückt sich Hegel wie folgt aus: „[…] die Verletzung meiner Ehre und Lebens [erscheint] als etwas Zufälliges. – Aber diese Verletzung ist notwendig […]“ (JSE III, S. 213) Diesbezüglich wird klar, dass die Verletzung und die Beleidigung im Rechtsverhältnis zunächst unvermeidbar sind, um die wechselseitige Anerkennung überhaupt erst möglich zu machen. Das Subjekt kommt nicht umhin, dabei im Übergangs- und Lernprozess zur Sittlichkeit die Verletzung und die Verachtung durch den Anderen im Anerkennungsverhältnis zu erleiden. Infolgedessen kann man m. E. die Behauptung wagen, dass dieses subjektive Leiden an der Verachtung und der Persönlichkeitsverletzung uns selbst zur höheren Dimension des Gesetzes, der Institutionen leitet, auch wenn diese Hinführung des Einzelnen zur ethisch–sittlichen Wir– Dimension hier nur in negativer Weise zustande kommt. Das handelnde Subjekt begegnet völlig zufällig dem Anderen auf der gesellschaftlichen Ebene und kann in diesem Spielraum durch den anonymen Anderen anerkannt werden oder durch ihn verachtet und beleidigt werden. Mit dieser Zufälligkeit als einer Rahmenbedingung dafür, dass die interaktiven Personen im sozialen Umfeld, auf dessen Spielfeld sowohl die wechselseitige Anerkennung als auch die Verachtung stattfinden kann, betroffen werden, ist es möglich, den Freiraum für die freiwilligen Handlungssubjekte offen zu halten. In der gegebenen Situation, die durch die Selbstentscheidung der freien Subjekte bestimmt ist, entdeckt das Subjekt den Sinn des Lebens und das sittliche Leben. Anders formuliert, mit der autonomen Zufälligkeit seiner freiwilligen Selbstentscheidung besitzt das Subjekt die Fähigkeit, „in einer von ihm(= Zufall, KBL) mitbestimmten Situation die 93 Notwendigkeit des sittlichen Lebens zu vollziehen“. 86 Die miteinander kämpfenden Subjekte erfahren, wie bereits erwähnt, deshalb in der gleichen Besinnung auf die potenzielle Zerstörung des eigenen Besitzes und auf die existenzielle Todesbedrohung, dass ihre eigenen Rechte bereits in den ökonomischen und rechtlichen Verkehrsformen anerkannt sind, sie durch den Bildungsprozess der Selbstnegation und der Selbstüberwindung ihre eigene Freiheit nur vor dem gesellschaftlich-sittlichen Horizont gewährleisten können, der prinzipiell auf der intersubjektiven Verbindung der rechtlichen Subjekte zueinander beruht. An dieser Stelle wird de facto klar, dass Hegel zunächst den sich selbst negierenden Weg der frei entscheidenden Subjekte zur Selbstüberwindung und zum Selbstverzicht im Kampf um Anerkennung darstellt und von der vollständigen Garantie der Freiheit der einzelnen Subjekte die harmonische Einheit mit dem sittlichen Ganzen, die sich der menschlichen Existenz versichert, abzuleiten versucht. Im Hinblick auf die Wiederherstellung des gegenseitigen Respekts, die Gewährleistung der Autonomie der Selbstentscheidung, bei der sich die Subjekte zufällig gegenseitig miteinander konfrontieren oder wechselseitig anerkennen, im Hinblick auf die von dieser Zufälligkeit bestimmte Situation, in der das sittliche Zusammenleben zwangsläufig auftaucht, kommt uns der Begriff des „Zwanges“ erneut in den Sinn. Dieser Zwang entsteht bei Hegel m. E. zunächst aus der emotionalen Innerlichkeit des vertragsbrüchigen Subjekts, das aufgrund seines Versäumnisses der zu leistenden Pflichten Schuldgefühle hat und aufgrund dieses Verstoßes gegen die versprochenen Pflichten Scham empfindet. Der Zwang resultiert zweitens aus der affektiven Anforderung an die durch den Vertragsbruch verletzte und zerstörte Partnerschaft, da beide Vertragspartner durch den Vertragsabschluss als den ideellen Tausch ihre Absicht zur Gemeinsamkeit zum Ausdruck gebracht hatten. Aus diesem Grund können wir m. E. davon ausgehen, dass Hegel nicht so sehr den Zwang der äußeren, „abstrakten“ Gesetze, sondern vielmehr den inneren emotionellen Druck als Zwang angesehen hat, wenn er den Zwang als ein unentbehrliches Moment der Erscheinung des allgemeinen Willens betrachtet. Diesbezüglich kann uns Hegels Idee der „Auflösung“ der Familie auf der gesetzlichen Ebene wiederum behilflich sein. Aus Hegels Sicht sollte die Familie nach der Eheschließung vor dem Horizont des „leeren Gesetzes“ und des „steifen Gesetzes“ auf jeden Fall „unauflöslich“ sein. (JSE III, S. 220) Die moderne Familie gründet jedoch, Hegels Ansicht zufolge, auf der freiwillig fixierten Liebe der Partner, die als autonome Personen grundsätzlich über das Recht der freien Selbstentscheidung verfügen. 86 Vgl. Zum Begriffsfeld von Zufälligkeit und Notwendigkeit in Hegels Logik und damit auch zum Stellenwert dieser Begriffe im Rahmen Hegels praktischer Philosophie, Dieter Henrich, „Hegels Theorie über den Zufall“, in: Hegel im Kontext, S. 157-186, besonders S. 171-176. 94 Indem die moderne Familie im wesentlichen von der aus der Liebe resultierenden Selbstentscheidung der beiden Personen abhängt, ist sie als eine vereinzelte Einheit bei Hegel von vornherein auflösbar und enthält nach Hegel bereits das wesentliche Moment der Auflösung in sich. In diesem Konflikt mit dem sich verändernden gegenwärtigen Zeitgeist, der auf dem weltgeschichtlichen Schauplatz des Weltgeistes als „Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit“ 87 , wie Hegel in seiner Geschichtsphilosophie formulierte, aufbricht, erscheinen die institutionellen Normen und Sitten eines Volkes bei ihm mit ihrer eigenen Geschichtlichkeit 88 . Aus Hegels Sicht geraten die institutionellen Normen und Sitten zwangsläufig dann in eine Konfliktsituation, wenn der Volksgeist in diesen alten Institutionen nicht mehr enthalten ist. Aus diesem Grund müssen die Normen und Sitten bei Hegel in der geschichtlichen Entfaltung des Zeitgeistes permanent den sich ständig verändernden Umständen angepasst und konstruktiv erneuert werden. Diesbezüglich schreibt Hegel: „Diese freie Lebendigkeit und das reine Gesetz sind in Wechselspiel miteinander; das reine Wollen ist das Resultat der lebendigen Bewegung“. (JSE III, S. 219) Darüber hinaus erhalten wir auch darauf einen Hinweis, dass der welthistorische Held, der in Hegels Geschichtsphilosophie aus der tragischen Auseinandersetzung mit dem alten Weltgeist den neuen Zeitgeist ableitet, mit dem Verbrecher an dem Punkt übereinstimmt, dass beide Charaktere gleichsam dem allgemeinen Willen gegenüberstehen. 89 In der Folge verdankt das Gesetz seine Existenz als die verwirklichte Gestalt des allgemeinen Willens dieser Negativität des Verbrechers, in deren Verlauf er lernt, sich selbst dem allgemeinen Willen aufzuopfern und die Selbstnegation zu ertragen, um seine willentliche Freiheit und Selbständigkeit zu verwirklichen. Aus diesem Grund drückt sich Hegel in Bezug auf die konstruktive Wiederherstellung und die konkretisierte Wiedererkenntnis durch die negative Handlung des Verbrechers wie folgt aus: „Aber dies Verbrechen ist die Belebung, die Betätigung - Erregung zur Tätigkeit des allgemeinen Willens. Der allgemeine Willen ist tätig; die anerkannte Tätigkeit ist allgemein, 87 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, hrsg. v. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel, Bd. 12, Frankfurt a. M. 1986, S. 32. 88 Vgl. Exkurs dieser Arbeit in Bezug auf die Normengeschichtlichkeit. 89 Vgl. Ludwig Siep, „Zum Freiheitsbegriff der praktischen Philosophie Hegels in Jena“, in: Hegel in Jena, Hegel – Studien Beiheft 20, hrsg. v. Dieter Henrich und Klaus Düsing, Bonn 1980, S. 220 – 223. 95 nicht einzelne, d. h. sie ist ein Aufheben des einzelnen. Strafe ist dieses Umschlagen.“ (JSE III, S. 215) Hegel leitet, wie aus den obigen Sätzen hervorgeht, den Motor der Entwicklung 90 zum staatlich verfassten Gesetz hin vom Verbrechen ab, da sich der Verbrecher nun nicht mehr gegen den einzelnen Willen des Anderen, z. B. einen Vertragspartner, richtet, sondern durch seine egozentrische Handlung gegen den allgemeinen Willen verstößt, der bereits auf der gesellschaftlichen Normenebene existiert. Der Verbrecher will durch die verbrecherische Handlung wie „Gewalttätigkeit“, „Raub“, „Diebstahl“, „Injurie“ usw. seinen eigenen Trieb befriedigen, dennoch ist diese Begierde von vornherein nicht realisierbar, da das Verbrechen direkt gegen den allgemeinen Willen verstößt. Aus diesem Grund bezeichnet Hegel das Verbrechen als „die Belebung“, „die Betätigung“ des institutionellen Gesetzes. Diese „Belebung“ und „Betätigung“ des Gesetzes konkretisiert sich in der Gestalt der Bestrafung des Verbrechers. Damit werden gleichzeitig der durch das Verbrechen verletzte allgemeine Wille und die gesellschaftliche Solidarität mit der gerechtfertigten Bestrafung des Verbrechers wiederhergestellt. In diesem Sinn ist die Strafe, so Hegel, „Wiedergeltung als des allgemeinen Willen“. Darüber hinaus ist der Verbrecher bei Hegel auch „Intelligenz“. (Ebd.) Aufgrund der instrumentellen Nutzung seiner Intelligenz kann der Verbrecher überhaupt erst seinen eigenen Willen „zum Trotz dem allgemeinen Willen“ nutzen wollen. Dennoch erkennt er zugleich seine verbrecherische Handlung, nämlich was er getan hat, weil er selber ein Intelligenter ist. Affirmativ gesehen bringt der Verbrecher den allgemeinen Willen, der jedoch noch immer in der Form des Zwangs oder der Gewalt verharrt, zur Erscheinung. Doch der Verbrecher lässt sich selbst zugleich im negativen Sinn durch die von der Gesellschaft gerechtfertigte Bestrafung auf seine Selbstverfeinerung und die negierende Selbstvereinigung ein: Der allgemeine Wille wird nur durch das negative Moment des Verbrechens verkörpert; zugleich erlangt der Verbrecher jedoch durch den Bildungsprozess der Selbstnegation gleichsam seine positive Selbstheit. Die dialektische Relevanz der Begriffe Positivität und Negativität, Verbrechen und Strafe betreffend, sagt Hegel: „[…] als Macht des Gesetzes, das ich anerkenne; d. h. die negative Bedeutung meiner hat ebenso sehr positive; ich bin ebenso darin erhalten – Es kommt mir ebenso zu gute - ich bin 90 Vgl. A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 363. 96 nicht nur in meinem Gedanken erhalten, - Ehre - sondern auch in meinem Sein.“ (JSE III, S. 226) An dieser Stelle handelt es sich bei Hegel zunächst noch immer um den „Zwang des Gesetzes“, das jedoch von allen Beteiligten anerkannt ist. Dieser Zwang des Gesetzes meint bereits den institutionalisierten Zwang des Gesetzes, dem sich das Individuum freiwillig unterwirft und bei dem es sich aus diesem Grund vom Gesetz nicht verletzt oder von ihm als einer äußeren Macht unterworfen fühlt. Hegels Ansicht zufolge gelangt das Individuum von hier aus auf eine höhere Stufe, nämlich „sich im Allgemeinen anzuschauen“. (JSE III, S. 226, Am Rande 2) Auf dieser Stufe ist das Individuum zur Einheit mit der überindividuellen Allgemeinheit gelangt und die wesentliche Freiheit in seinem verborgenen Inneren erwacht, die durch das Prinzip der negativen Beziehung der Bestimmtheit bzw. Entgegensetzung erlangt werden kann. Offensichtlich bedeutet diese Freiheit, dass das Individuum im interpersonellen Anerkennungsverhältnis, einerseits in der Wechselbeziehung mit dem gesellschaftlichen Handlungspartner, andererseits im vergesellschafteten Zusammenhang mit den institutionellen Organisationen, negierend definiert ist, in dieser dialektischen Bewegung der negativen Bewusstheit sich selbst freigibt und damit zugleich den anderen Handlungspartner wieder freilässt. Auf diesem Selbstverwirklichungsweg zur Freiheit vollzieht das Individuum einerseits die interaktive Anspielung auf den Gesellschaftspartner, andererseits die versöhnende Teilnahme am institutionellen Gesetz und an den Organisationsordnungen. So gesehen kann man m. E. davon ausgehen, dass die sich selbst negierende und ausbildende Freiheit des Subjekts, nämlich das sittliche Verhältnis unter den Gesellschaftspartnern, in dessen Sinnnetzwerk sich die subjektive Freiheit selbst verwirklicht, nur unter der Voraussetzung des vollständigen Anerkennungsverhältnisses und der freiwilligen Teilnahme an den geschichtlich vorhandenen Institutionen und Organisationen stattfinden kann. Mit der Errungenschaft dieses wechselseitigen Anerkennungsverhältnisses können sich alle Beteiligten an dieser sittlichen Sphäre nach Hegel als das Subjekt der voneinander abhängigen Befreiung verstehen und sich innerhalb dieser Rahmenbedingung untereinander versöhnt wissen. Im Hinblick auf die negative Positivität, 91 die im Verlauf des Bildungsprozesses des Ichs zum Ausdruck kommt, ist bei Hegel von entscheidender Bedeutung, dass die Positivität der Negation im konkreten Verwirklichungsprozess des Gesetzes als des sittlichen Geistes ein Motor der Selbstentfaltung des Geistes ist und diese Selbstentwicklung des Geistes auch unter 91 Vgl. Zur Bedeutung der Bestimmtheit und der Negation in Hegels Logik, Anm. 12. 97 den geschichtlichen Rahmenbedingungen des Volksgeistes, der in den institutionellen Formen des Gesetzes und den konventionellen Sitten realisiert wird, von statten geht. Der Geist in der Gestalt des Gesetzes als die sittliche Sphäre kommt bei Hegel in den konkret geschichtlich bedingten Situationen zum Vorschein und zeigt sich anläßlich konkreter Zufälle. In dieser Selbstentfaltung ist der Geist, mit Hegels Worten, deshalb „das reine Leben“. (JSE III, S. 228) Demzufolge steht der Geist auch im Prozess dieser lebendigen Selbstdifferenzierung und Rückkehr zu sich selbst dem anders gewordenen Selbst gegenüber. Mit anderen Worten: Der Geist behält aus dem Gegensatz von dem Selbst und seinem Anderen einen Unterschied in seinem Selbst zurück und kehrt durch die Selbstüberwindung dieses Gegensatzes zu der sich das Andere angeeigneten Selbstheit zurück. Aus der Perspektive der konkreten Entfaltung der Geschichte heraus betrachtet, entsteht die Zerstörung der lebendigen Harmonie der Gesellschaft aus den Institutionen oder den bereits institutionalisierten Gesetzen selbst heraus, falls der Volksgeist die alten Modi der Institution für ungültig erklärt und insofern alle Beteiligten an diesem Volksgeist nach dem neuen Zeitgeist und nach dem neuen Aufbau der dem Zeitgeist entsprechenden Institution suchen und streben. In diesem geschichtlichen Entwicklungsprozess stellt der Geist durch diese negative Auseinandersetzung mit dem anders werdenden Selbst, nämlich die sich selbst negierende Selbstgestaltung, seine Wahrheit wieder her und erkennt auch die in seinem Inneren verborgene Harmonie von dem Selbst und dem Anderen, nämlich die subjektive Substantialität, wieder. In diesem Sinn findet Hegel die negative Selbstentäußerung und die damit im Zusammenhang stehende Selbstverwirklichung des Geistes in der „Rechtspflege“ und dem „Prozeßgang“ wieder, da diese zu sich selbst kommende Bewegung des Geistes immer mit der konkreten Geschichte und der zufälligen Situation, in der der Staat als die sittliche Sphäre tätig und lebhaft ist, zu tun hat. Nach der Darstellung des Übergangs zur „peinlichen Rechtspflege“ formuliert Hegel das folgende: „Diese Macht über alles Dasein, Eigentum und Leben, und ebenso den Gedanken, das Recht und das Gute und Böse, ist das Gemeinwesen, das lebendige Volk. Das Gesetz ist lebendig, vollkommenes, lebendiges, selbstbewußtes Leben; als der allgemeine Willen, der Substanz aller Wirklichkeit ist, Wissen von sich als allgemeiner Macht alles Lebendigen und aller Bestimmung des Begriffs alles Wesens.“ (JSE III, S. 229) Hegels Auffassung beruht, wie bereits erwähnt, auf dem „Prozeßgang“ in der „peinlichen Rechtspflege“, der sich auf die konkrete Anwendung der allgemeinen Normen in der 98 sittlichen Sphäre, auf die zufälligen, jedoch konkreten Tatsachen bezieht. 92 In dieser Anwendungsprozedur darf das Gesetz deshalb keine „absolute Bestimmung“ sein. (JSE III, S. 228) Aus der Perspektive dieser Art der Anwendung betrachtet, soll das Gesetz Hegels Ansicht zufolge, unter allen Umständen zeitlich begrenzt sein, weswegen es passieren kann, dass das Gesetz sämtliche richterlichen Ansprüche der Juristen und Betroffenen nicht erfüllt. Das Gesetz muss seinem Geltungsanspruch lediglich durch die reale Anwendung auf die vielfältigen Tatbestände nachkommen und es muss sich selbst an den lebendigen Maßstab der Gegenwart im Verlauf dieses Anwendungsprozesses anpassen. So gesehen finden wir hier einen Hinweis darauf, dass „im Verstehen so etwas wie“, mit Gadamers Worten, „eine Anwendung des zu verstehenden Textes auf die gegenwärtige Situation des Interpreten stattfindet“. (GW. 1, S. 313) So gesehen ist das Gesetz, so wie die Anwendung des Textes im Verstehen, durch seine Anwendungsleistung auf den gegenwärtigen Fall lebendig geworden und es ist im engen Zusammenhang mit der sich bewegenden Lebenswelt auch zu einem lebendigen bestimmt. Aus diesem Grund wird die Aufgabe „der Konkretisierung des Gesetzes“ und „die Aufgabe der Applikation“ bei Gadamer direkt zur „Aufgabe des Auslegers“. (GW. 1, S. 335) Das Gesetz und die institutionalisierten Normen müssen in der prozessualen Auseinandersetzung mit den vergangenen und gegenwärtigen Zufällen anwendbar sein und sie müssen auch durch die Anwendung auf alle besonderen Fälle zum Ausdruck gebracht werden können: Das Gesetz liegt immer schon im Zwischenraum von Vergangenem und Gegenwärtigem; es darf keinesfalls eine abstrakte Formalität, nämlich „eine absolute Bestimmung“ als der letztbegründete Imperativ sein. Das Gesetz muss sich deshalb im Umgang mit der konkreten Gegenwart selbst übertragen und auslegen können. Auf diese Weise macht sich das Gesetz selbst lebendig. Im Anschluss an die Anwendungsfunktion des Geistes auf die gegenwärtig konkrete Situation stellen wir fest, dass sich der Geist als ein ontologischer Sinnganzheitshorizont, in den wir immer schon eingebunden sind und in dem wir uns selbst ausbilden, darstellt. Da der Geist, der in der sittlichen Form des Gesetzes und in einem Volk, das sich in einer Gegenwart befindet, die seine Herkunft mit einschließt, ebenso wie das subjektive Bewusstsein und der Volksgeist sich selbst in einem Selbstausbildungsprozess von seinem Innern differenziert und sich zugleich mit sich selbst identifiziert, zeigt der Geist sich bei Hegel als „das lebendige Volk“, das Leben des Geistes. Dieser lebendige Volksgeist findet seine Entfaltung in den staatlich verfassten Institutionen und Organisationen und seine konkrete Ausgestaltung im Staat. Deswegen ist das Leben des Geistes in seiner eigenen Zeitlichkeit bzw. 92 Zum Anwendungsproblem der juristischen Hermeneutik in Gadamers Dialoghermeneutik, vgl. Kap. II – 2 von III. Teil in dieser Arbeit. 99 Geschichtlichkeit entfaltet und erreicht die höchste Ebene der einheitlichen Versöhnung der Einzelheit mit der Allgemeinheit, auf der die Einzelheit durch die Selbstnegation mit der Allgemeinheit eins wird und die Allgemeinheit durch die negative Selbstäußerung an der Einzelheit teilhat, selbst in der Notwendigkeit der Einzelheit erscheint. 93 Dieses lebendige Leben des Geistes lässt sich im kontinuierlichen Übergangsprozess auf das konkrete Handlungsnetzwerk ein, an dem alle Gesellschaftsmitglieder teilgenommen haben und auf das sie sich freiwillig eingelassen haben. Aus der Perspektive eines solchen miteinander verwobenen Teilnehmens am Allgemeinen betrachtet, kann das Leben des Geistes wie auch das natürliche Leben des Menschseins in jeder Generation, den besonderen und geschichtlichen Situationen entsprechend angepasst, immer wieder aufs neue ausgebildet und regeneriert werden. Alle Gesellschaftsmitglieder können sich unter der Bedingung des Respekts für das Rechtssystem und die Handlungsnormen freiwillig in die Gesellschaft integrieren und mit dieser bewußten Integration in die gegenwärtigen Handlungsrahmenbedingungen ihr eigenes Bezugssystem angesichts der geschichtlich bestimmten Situation errichten. Aus diesem Grund ist es „eines der großen Verdienste Hegels“, Gadamers Ansicht zufolge, dass er die Dialektik der Selbstüberwindung und der Selbstnegation des Subjekts mit dem eigenen Streben nach dem allgemeinen Geist und umgekehrt die der negativen Selbstdifferenzierung und der Selbstverwirklichung des Geistes im Subjekt in seiner Philosophie deutlich gemacht hat. 94 Aus Gadamers Sicht hat der objektive Geist, z. B. das Gesetz, die Institution, Bräuche und selbst Bestattungsrituale oder 95 die Spannungsverhältnis der Grußsitten usw. bei Hegel nur in der „Solidarität“, „Liebe“, „Freundschaft“, grundsätzlich mit dem nicht endgültig auslöschbaren wechselseitigen Anerkennung von Ich und Du konfroniert sind, die Fähigkeit, sich selbst in den gesellschaftlichen Verkehrsformen zu verwirklichen und sich selbst auf die Gesellschaftsmitglieder zu übertragen. Anders formuliert, bringen alle Gesellschaftsmitglieder „in der Gestalt staatsbürgerlicher Solidarität zugleich den >>Geist eines Volkes<<“ 96 zur Erscheinung. Indem sich das Leben des Geistes, wie bereits erwähnt, bei Hegel immer auf die Herauslösung aus seinen ursprünglichen Vorgaben und auf die gegenwärtigte Anwendbarkeit in der flexiblen und variablen Geschichtsschwelle bezieht, schreibt Gadamer, dass „Hegel 93 Die notwendige Dynamik zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung betreffend, schreibt Hegel auch in seiner Rechtsphilosophie: „Die Individuen sind als Bürger dieses Staates Privatpersonen, welche ihr eigenes Interesse zu ihrem Zweck haben. Da dieser durch das Allgemeine vermittelt ist, das ihnen somit als Mittel erscheint, so kann er von ihnen nur erreicht werden, insofern sie selbst ihr Wissen, Wollen und Tun auf allgemeine Weise bestimmen und sich zu einem Gliede der Kette dieses Zusammenhangs machen.“ G. W. F. Hegel, Rechtsphilosophie, S. 343, § 187. 94 H.–G. Gadamer, „Hegels Philosophie und ihre Nachwirkung bis heute“, S. 48. 95 Ebd., S. 47. 96 J. Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, Frankfurt a. M. 1999, S. 206. 100 damit eine entscheidende Wahrheit ausspricht, sofern das Wesen des geschichtlichen Geistes nicht in der Restitution des Vergangenen, sondern in der denkenden Vermittlung mit dem gegenwärtigen Leben besteht“. (GW. 1, S. 174) Während der vorliegende Absatz den Geist aus der Perspektive seiner Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit auffasst, muss der Geist nunmehr auch aus der Perspektive seiner Räumlichkeit, also der Regierung als der entäußerten Gestalt des Volksgeistes, ins Blickfeld gerückt werden, da der Geist seinen höchstentfalteten Horizont durch die konkrete Ausgestaltung des Staates erreicht, der das kollektive Bewusstsein, das von jedem einzelnen Bewusstsein, aber dennoch von dem der Gemeinsamkeit zugrunde liegenden Bewusstsein abgeleitet ist, bildet und die Rolle eines vernetzten und handlungsorientierten Spielraums der Sittlichkeit spielt. Diesbezüglich sagt Hegel: „Dem Geist ist der Staat überhaupt Gegenstand seines Tun und Bemühung, und Zweck“. (JSE III, S. 246) Der Geist erreicht seine Lebendigkeit, indem er die Gesellschaftsmitglieder in Bezug auf seine konkreten Phänomene wie z. B. Gesetz, Institution, Organisation usw. sorgfältig respektiert. Durch diese lebendige Konkretisierung ermöglicht der Geist seinen Mitgliedern, in die sittliche Sphäre, nämlich in die institutionalisierten Normen als Handlungswegweiser, einzusteigen, die die jeweilige Besonderheit der Einzelnen stets berücksichtigen. Somit zeigt sich der Geist als ein Vermittler zwischen der sittlichen Dimension und dem Einzelnen und prägt dabei die ontologische Grundlage für das menschliche Zusammenleben. Als das sittlich Gemeinsame ermöglicht er allen Gesellschaftsmitgliedern die Teilhabe, weshalb er sich den Einzelnen zu erkennen gibt. Für uns zeigt sich hier, dass der Geist in den Formen des Gesetzes, der Institutionen und der Organisationsordnungen nicht nur die verfügbare Macht über alle Mitglieder innehat, sondern auch die verschiedenen, individuellen Charaktere umfasst. Alle Beteiligten können ihn als den Beschützer des Rechts ansehen, da sich alle Beteiligten einzig unter diesen Bedingungen auf den Geist als die staatlich verfasste Form verlassen können. Darüber hinaus steht der Geist als der staatliche Verwalter des Gesetzes für Gnade und Verzeihung. Der Geist äußert sich bei Hegel nicht so sehr durch die übermäßige und steife Formalität als vielmehr durch den Verzicht auf die Ausübung des Strafrechts bei den Betroffenen. Mit anderen Worten: Der Geist erscheint den Gesellschaftsmitgliedern durch die Begnadigung und die Verzeihung des Verbrechens. Durch diese begnadigende Ausstrahlung wird der Geist von allen Beteiligten wiederhergestellt und wieder erkannt. 97 Durch den dynamischen Bewegungsprozess zur synthetischen Harmonie hin, in dessen Verlauf sich der Geist auf seine Bestimmtheit beschränkt und zugleich diese eingeschränkte Grenze aufhebend überschreitet, erreicht der 97 Vgl. L. Siep, Anerkennung als Prinzip, S. 94 – 96. und G. Göhler, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Frühe politische Systeme, S. 451. 101 Geist die wissende Einheit vom Einzelnen und Allgemeinen, die Selbstbewusstwerdung der Freiheit. In diesem Sinn formuliert Hegel: „Der Geist ist so die erfüllte Freiheit. […] der seiner unmittelbar bewußte Geist“. (JSE III, S. 252) Das Individuum erkennt auch, wie der Geist sich auf dieser höchstentfalteten Stufe selbst als Freiheit gezeigt hat, die immer beim Allgemeinen bleibt und vom Allgemeinen abhängt. An dieser Stelle wird es notwendig, dass wir uns auf die bisherigen Überlegungen Hegels Idee der Anerkennung im Bildungsprozess des Subjekts betreffend beziehen. Das grundsätzliche Strukturelement der Selbstentwicklung des Geistes ist bei Hegel einerseits das Sich–anders-Werden, nämlich die negative Selbstentäußerung und andererseits die gleichzeitige Rückkehr zu sich selbst, d. h. die positive Selbstbestimmung. In diesem Prozess einer von sich selbst nach außen gerichteten Bewegung und einer von außen zu sich selbst kommenden Bewegung, einer sich selbst immer wiederherstellenden und erfrischenden Bewegung, gelangt der Geist zu der Erkenntnis der Notwendigkeit, sich mit seinesgleichen bewusst zu werden. Dieses lebendige Leben des Geistes zeigt sich zum einen auf der Seite der gesamten Bildungsstationen in der Liebesbeziehung und kommt auf der anderen Seite im Anerkennungsverhältnis im Rechtsverhältnis zum Vorschein. Doch auf dieses Anerkennungsverhältnis wird m. E. bei Hegel nur unter der Voraussetzung, dass die Anerkennung bereits im familialen Interaktionsfeld stattgefunden hat, verwiesen. Das handlungsfähige Subjekt hat im Binnenraum der familialen Intimbeziehung die Aufgabe verwirklicht, sich selbst im Anderen anzuschauen und sich selbst beim Anderen auszubilden und widerzuspiegeln, ebenso wie die sprachliche und die instrumentelle Fähigkeit. Das einzelne Subjekt strebt nach dem mit sich selbst gleichgesetzten Selbstbewusstsein in der Liebesbeziehung. Von diesem natürlichen Streben aus nimmt es seinen Anderen als Dialogpartner wahr und seine Handlung vollzieht sich in dieser sprachlich vernetzten Kommunikationsdimension. Vor diesem existenziell ontologischen Hintergrund, dass das Subjekt nicht mehr bei sich selbst allein sein darf, sondern von vornherein mit dem Anderen zusammen ist, lernt das Subjekt, dass seine Ich-Identifizierung nur durch die unendliche Anerkennung durch den Anderen stattfinden kann. Vor dem Hintergrund dieses eigenen Anspruchs auf Anerkennung erkennt das Subjekt seinen Anderen gleichsam auch an. Für uns wird hier deutlich, dass sich die Familie auf diese wechselseitige Anerkennung, die der Liebesbeziehung von Mann und Frau zugrunde liegt, gründet. An dieser Stelle bildet sich das Subjekt mit dem liebenden Partner in der kommunikativen Handlung selbst aus und leistet damit nach der Eheschließung zugleich den wechselseitigen Dienst der Sorge für die Triebbefriedigung und das gegenseitige Wohlergehen, um das Selbst zu erhalten. In dieser 102 vorgesellschaftlichen Gemeinschaft des Gefühls zeugen die Ehepartner ihren eigenen Nachfolger, das Kind. Mit der Geburt des Kindes finden die Eltern die reale Vollendung ihrer Liebe durch das Kind. In diesem familialen Interaktionsfeld sorgen die Eltern zunächst elementar für die natürliche Erhaltung des Kindes und sie vermitteln ihrem Nachfolger durch die Erziehung die Sprache, die gesellschaftlichen Verhaltensweisen, das instrumentelle und wirtschaftliche Eigentum usw. An dieser Stelle besteht die Kindererziehung darin, dem Kind die Sprache und die Mittel der biologischen Erhaltung zu vermachen, insbesondere in dieser familiären Atmosphäre für seine Sozialisation zu sorgen, damit das Kind lernt, sich an sein soziales Umfeld und den gesellschaftlichen Lebenskontext anzupassen. Entscheidend ist, dass die Familie als der reale Ort der emotionalen Intimbeziehung die wechselseitige Anerkennung überhaupt erst möglich macht. Diese vorgesellschaftliche Gemeinschaft des Gefühls steht für jedes Mitglied innerhalb des Sozialisierungsprozesses an erster Stelle, da dieser emotionale Intimbereich die Mitglieder mit Solidarität, Liebe und Freundschaft vertraut macht. Ohne diese emotionalen Elemente könnte die menschliche Gesellschaft nicht existieren. Unter dieser Rahmenbedingung der wechselseitig aufeinander bezogenen Anerkennung im familialen Intimbereich ist das Subjekt bei Hegel als Person und als Eigentümer im Rechtsverhältnis anerkannt. Im Rechtsverhältnis taucht es mit seinem schrankenlosen Trieb, seiner grenzenlosen Begierde nach Triebbefriedigung auf. Aus dieser egozentrischen und nicht enden wollenden Selbstbehauptung heraus bricht der Konflikt hervor. Um seinen eigenen Trieb zu befriedigen, richtet sich das Subjekt zunächst aggressiv gegen seinen Gesellschaftspartner. In dieser kontroversen Situation erfahren die Subjekte gleichsam eine Todesbedrohung. Aus einer solchen unbehaglichen Situation der wechselseitigen Todesbedrohung heraus treiben die Subjekte sich selbst zwangsläufig in die wechselseitige Anerkennung im Rechtsverhältnis, in die anerkannte Dimension der Gesellschaft. Diese leidvolle und unbestimmte Situation, in der das Subjekt der ständigen Todesangst ausgesetzt ist und von der Gefahr des zufällig chaotischen Umfeldes bedroht wird, führt alle Betroffenen Handlungsmuster hin. 98 schließlich zum handlungsorientierten Wegweiser, zum Im Anschluß daran errichten die Subjekte ein kollektives Bewusstsein, mit dem sie sich alle einverstanden erklären. Auf diesem Baustein gründen sie spontan die Gesellschaft, die den höchstentfalteten Horizont der Sittlichkeit erreicht, ohne ihre Individualität zu verletzen. Umgekehrt erlebt das Subjekt, dass die egozentrische und isolierte Subjektivität überwunden werden muss, um das Selbst zu erhalten, sich mit sich selbst zu identifizieren und insbesondere die bedrohlichen Umstände hinter sich zu lassen. In diesem 98 Vgl. A. Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, S. 73 – 80. 103 Bildungsprozess der Selbstnegation und der Selbstüberwindung lernt das Subjekt, dass die Freiheit immer mit der Erkenntnis der verborgenen Harmonie von Ich und Du und Ich und Wir zu tun hat. Vor diesem Hintergrund der Erkenntnis der Freiheit integriert sich das Subjekt in das sittlich verbundene Netzwerk, das solidarische und freundschaftliche Zusammenleben, das auch das Subjekt konstituiert. Aus diesem Grund können wir unseren Blick nun auf das Anerkennungsverhältnis von Herr und Knecht in der Phänomenologie des Geistes richten. Ich möchte mich hierbei auf Hegels Konzeption der Anerkennung zwischen den Subjekten als Selbstbewusstseinsträger in Anknüpfung an Gadamers Auslegung von Hegels Anerkennungstheorie in der Phänomenologie des Geistes berufen und werde damit auch versuchen, die Intersubjektivität der hermeneutischen Erfahrung in Bezug auf Hegels Anerkennungstheorie darzustellen. Dahingehend möchte ich auch die Fragen aufwerfen, ob die emotionale Liebesbeziehung im Anerkennungsverhältnis der Phänomenologie ihren Stellenwert verliert und ob man infolgedessen behaupten kann, dass es nur die Charakteristik des Kampfes in der Anerkennung der Phänomenologie gibt. Bevor ich auf die Problematik der Anerkennung in der Phänomenologie eingehe, möchte ich den Diskussionsrahmen der Probleme von Hegels Konzeptionsumwandlung, die zwischen dem der Phänomenologie vorliegenden Denkansatz zum zwischenmenschlichen Anerkennungsverhältnis und der Anerkennungstheorie in der Phänomenologie liegt, zusammenfassend darstellen. Habermas beschäftigt sich zunächst mit „der Dialektik von Herr und Knecht“, die die intersubjektive Struktur der wechselseitigen Anerkennung erschließt. Damit sagt er zugleich, dass die Phänomenologie des Geistes den Jenaer Programmen, insbesondere in Bezug auf Hegels einzige Einsicht in den Begriff des Geistes, entstammt, 99 während er zu Beginn seines Aufsatzes von 1967 mit der These beginnt, dass „Hegel in den beiden Jenenser Vorlesungen für den Bildungsprozess des Geistes eine eigentümliche, später preisgegebene Systematik zugrunde gelegt hat“. 100 Der Kampf um Anerkennung bezieht sich A. Honneth’ Ansicht zufolge, auf die Entwicklung der Moral und der Sittlichkeit, die sich Schritt für Schritt in der Selbstentwicklung des Geistes vollzieht und auf „die einzige Funktion der Bildung des Selbstbewusstseins“, weshalb Hegel, aus A. Honneth‘ Sicht, sich hauptsächlich im Kapitel „Selbstbewusstsein“ der Phänomenologie um die Erhellung der Selbsterfahrung des Bewusstseins bemüht und damit im Großen und Ganzen auf den Charakter der Intersubjektivität in seinen frühen politisch-philosophischen Schriften verzichtet. 101 Davon abgesehen hat Herbert Schnädelbach in seiner Arbeit behauptet, 99 J. Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, S. 188, S. 201 und S. 209ff. Ders., Technik und Wissenschaft als >Ideologie<, S. 9. 101 A. Honneth, Kampf um Anerkennung, S. 104. 100 104 dass „dies(= die Dialektik der Anerkennung, KBL) erst im >>Herrschaft/Knechtschaft<< Kapitel der Phänomenologie des Geistes wirklich ausgeführt ist“. 102 Außerdem beschäftigen sich L. Siep und A. Wildt selbst mit diesem systematischen Knotenpunkt der Jenaer Geistesphilosophie mit der Phänomenologie unter dieser bestimmten Bedingung. 103 Aber ungeachtet der verschiedenen und komplizierten Diskussionen zwischen den Autoren kann man m. E. andeutungsweise Anerkennungsverhältnisses davon in Anknüpfung ausgehen, dass an Hegel Gadamers die wichtige Idee des Rolle der intersubjektiven Anerkennung im Bildungsprozess des Geistes noch immer in der Phänomenologie klargestellt und damit zugleich nicht nur den Kampf um Anerkennung, sondern auch die Liebesbeziehung im Anerkennungsverhältnis umfassend erfasst hat. Wenn wir überdies über diese systematische Problematik in Hegels Gesamtsystem nachdenken, dann wird in der Tat deutlich, dass Hegel die Liebesbeziehung im Kapitel „Familie“ der Rechtsphilosophie beschrieben hat. Gleichwohl lässt er die dynamische Bewegung der interpersonellen Anerkennung außer Acht. 104 Umgekehrt wird ebenso deutlich, dass er auch den „Zweikampf“ in der Enzyklopädie beschrieben hat (Enzy. III. S. 222), aber dennoch dabei die Motivation der Liebesbeziehung übersehen hat. Davon abgesehen werde ich im nächsten Kapitel auf die obige Frage in Anknüpfung an Gadamers Aspekte eingehen, da es sich hier nicht so sehr um Hegels Anerkennungskonzeption im Gesamtsystem oder die Debatte über Hegels Konzeptumwandlung der Anerkennung, sondern vielmehr um die interaktive Intersubjektivitätsstruktur in der Phänomenologie aus der hermeneutischen Perspektive heraus handelt. 102 H. Schnädelbach, Hegels Praktische Philosophie, S. 132. Vgl. L. Siep, Anerkennung als Prinzip, S. 68ff. A. Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 365ff, daran anschließend zum sukzessiven Zusammenhang der Phänomenologie mit der Geistesphilosophie 1805/06, Henning Ottmann, „Herr und Knecht bei Hegel“, S. 380 – 382. 104 Für uns ist es umstritten und fraglich, ob Hegel die reale, ja soziale Anerkennungsbeziehung seit der Phänomenologie tatsächlich zur Seite geschoben hat. Denn wir können das Anerkennungsverhältnis als Grundlage für die Sozialbeziehung selbst aus Hegels Rechtsphilosophie herauslesen. In seiner Rechtsphilosophie drückt sich Hegel folgendermaßen aus: Die Rechtsperson, so Hegel, „sei eine Person und respektiere die anderen als Personen.“ G. W. F. Hegel, Rechtsphilosophie, S. 95, § 36. Auch zur sozialen Anerkennungsbeziehung in Hegels Rechtsphilosophie, vgl. Michael Theunissen, „Die verdrängte Intersubjektivität in Hegels Philosophie des Rechts“, in: Hegels Philosophie des Rechts – Theorie der Rechtsformen und ihre Logik, hrsg. v. Dieter Henrich u. Rolf–Peter Horstmann, Stuttgart 1982, S. 317 – 381. 103 105 IV. Die Anerkennungsbewegung zum Lebensganzheitshorizont als ontologischer Grundlage für die Lebendigen in der Phänomenologie des Geistes IV – 1. Das Anerkennungsverhältnis des Selbstbewusstseins in der ungestillten Sehnsucht nach dem Lebensganzen Das Kapitel „Selbstbewußtsein“ hat einen herausragenden Stellenwert in Hegels Phänomenologie, da es „die basale Intersubjektivität“ als den Grundzug der menschlichen Handlung darstellt, wie Hegel selbst den Übergang zum Selbstbewusstsein als „Wendungspunkt“ bezeichnet hat. (PhdG., S. 145) Daran anschließend gibt Gadamer mit Recht in seinen Hegel–Auslegungen diesem Kapitel „Selbstbewusstsein“ den maßgeblichen Charakter, der als der das ganze System der Phänomenologie führende Leitfaden bezeichnet werden kann. Dieses Kapitel „Selbstbewußtsein“ nimmt für Gadamer deshalb „eine zentrale Stellung im Ganzen des phänomenologischen Weges“ ein. (GW. 3, S. 47) 105 Es wird auch deutlich, dass die vielfältigen Untersuchungen und Interpretationen über dieses Kapitel „Selbstbewußtsein“ in Abhängigkeit von dem je spezifischen Eigeninteresse der verschiedenen Forschungsrichtungen unterschiedlich ausfallen, genauso wie die entscheidende Rolle dieses Kapitels im ganzen Werk mit ganz unterschiedlichen Attributen versehen wird: marxistisch, existenzialanalytisch, phänomenologisch, ontotheologisch. 106 105 Vgl. Werner Marx, Das Selbstbewußtsein in Hegels Phänomenologie des Geistes, S. 18 – 22. Er bezeichnet das Kapitel „Selbstbewußtsein“ als „Prinzip des ganzen Werkes“, wie Gadamer gesagt hat, weil das Selbstbewusstsein den Bezugspunkt der faktischen Erfahrungen des Bewusstseins ausmacht und damit dem Selbstbewusstsein zugleich das begreifende Wissen um sich selbst zukommt, wenn das Ziel dieses Werkes die bestimmende Bewusstwerdung des Geistes ist, die Endstation „das absolute Wissen“ durch die ständige Selbstüberprüfung und die sich innerlich wiederholende Selbstkorrektur, kurzum, wenn der Zweck der Darstellung der Phänomenologie das Wissen des Geistes um sich selbst ist. 106 Vgl. Zur marxistisch–geschichtsphilosophischen Interpretation, A. Kojève, Hegel, S. 48 – 89. Demgegenüber gelten Hennig Ottmann in seinem Aufsatz die marxistischen Auslegungen über das Kapitel „Selbstbewußtsein“ als eine Art und Weise der missverstandenen Leseart, obwohl er auch die überwiegende Rolle des Anerkennungskampfes im geschichtlichen Verlauf der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates vor dem Hintergrund des politisch–philosophischen Standpunktes aufzuklären versucht. Hennig Ottmann, „Herr und Knecht bei Hegel. Bemerkungen zu einer missverstandenen Dialektik“, S. 365 – 384. Zur existenziellen Interpretation, Wolfgang Janke, „Herrschaft und Knechtschaft und der absolute Herr“, in: Philosophische Perspektiven, Bd. 4, hrsg. v. Rudolph Berlinger, Eugen Fink, Frankfurt a. M. 1972, S. 211 – 231, vor allem S. 217 - 229. In seiner eigenen Interpretation stellt er interessanterweise den „absoluten Herr“ bzw. die Todesfurcht und –bedrohung als die zentrale Stellung der Erfahrung der Anerkennung zwischen beiden Extremen fest. So gesehen ist die Angst begrifflich von der Furcht zu unterscheiden. Nach ihm ist die Angst zufällig und temporär. Im Gegensatz dazu hat es die Furcht mit dem „ganzen Wesen“ zu tun, weil sie das Erschrecken vor der Todesbedrohung weckt, d. h. die Bedrohung, die von der Tatsache ausgeht, dass die menschliche Existenz dazu bestimmt ist, von Anfang an im Angesicht des Todes zu leben. Deswegen wird die innerliche Überwindung der Furcht vor dem Tode als einer absoluten Vernichtung zum Moment der Emanzipation der Menschen, seiner Äußerung zufolge, der „Freiheit zum Tode“. Zu den Perspektiven der Subjektivität bzw. der einzelnen Ichhaftigkeit, Werner Becker, „Hegels Dialektik von ‚Herr und Knecht’“ in: ders., Selbstbewußtsein und Spekulation, Freiburg 1972, S. 110 – 123, und damit auch Walter Schulz, „Das Problem des Selbstbewußtseins in Hegels System“, 106 Davon abgesehen bemüht sich Gadamer um eine hermeneutische Auslegung von „Selbstbewußtsein“, die nur unter Berücksichtigung der historisch bestimmten Bedingungen, die für die jeweilige Interpretation und Verstehensweise relevant sind, zustande kommen kann. Dies ist nicht nur von Bedeutung, um die unmittelbare Anwendung auf die sozialgeschichtlichen Phänomene herzustellen, sondern um zu einer Darstellung des idealisierten Denkmodells von Hegel in der Anerkennungsbewegung zwischen den Menschen zu gelangen. Deshalb ist fraglich, ob das Herrschaft–Knechtschaft–Verhältnis der wirklichen Historie der Menschheit entspricht und inwiefern sich die geschichtsphilosophische Sicht auf die materialistische Geschichtsauffassung anwenden lässt. Mit anderen Worten: Von der Intersubjektivität unter den Subjekten ausgehend, nimmt Gadamer zunächst das Herrschafts– Knechtschafts–Verhältnis bei Hegel als „eine ideale Genealogie“ an. Gleichzeitig betrachtet er das wechselseitige Anerkennungsverhältnis als die Anschauung zu dem sozialen Gegenüber durch die unmittelbare Begegnung. Daran anschließend stützt er den gesamten gelebten Sinnhorizont des „erscheinenden Geistes“ auf die gesellschaftliche, gemeinsame Solidarität und Freundschaft in der Liebe, die Vertrautheit. Außerdem können wir nicht darauf verzichten, uns den ontogenetischen Prozess vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein in Erinnerung zu rufen, der hauptsächlich im I. Kapitel in dieser Arbeit behandelt wurde, bevor wir auf das Anerkennungsverhältnis zwischen den Subjekten als Selbstbewusststräger eingehen. Den Weg vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein hat das Bewusstsein durch die drei Hauptstufen, „die sinnliche Gewissheit“, „Wahrnehmung“ und „Verstand und Kraft“ hindurch, auf denen es mit jedem Gegenstand auf passende Weise zu tun hat und bei der Entlarvung des innerlichen Widerspruchs zum nächsten Gegenstand übergeht, geführt. Gleichwohl ist das Bewusstsein bei Hegel, Gadamers Ansicht zufolge, jedoch von vornherein nicht mehr von der Äußerlichkeit des Gegenstandes abhängig, d. h. es hat zu seinem Gegenstand nicht bloß einen Gegenstand, also einen außer ihm sich befindlichen Gegenstand, sondern ist von Anbeginn in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 39, hrsg. v. Hans Michael Baumgartner, Otfried Höffe, Meisenheim/Glan 1985, S. 1 – 15. Zu den ontotheologischen Perspektiven, Karen Gloy, „Bemerkungen zum Kapitel „Herrschaft und Knechtschaft“ in Hegels Phänomenologie des Geistes“, in: Philosophisches Jahrbuch (91.), hrsg. v. Hermann Krings, Ludger Oeing–Hauhoff, Heinrich Rombach, Arno Baruzzi, Alois Halder, Freiburg/München 1984, S. 187 – 213. Sie versucht das Kapitel „Selbstbewußtsein“ unter einem ontotheologischen Aspekt auszulegen, denn hier handelt es sich ihr zufolge um die Lebensganzheit, gewissermaßen die Totalität der gesamten Lebenszusammenhänge, in der sich das Menschsein nicht nur aufeinander bezieht, voneinander abhängig ist, sondern auch die Einheit mit der Gottheit erreichen kann. Deswegen spielen Furcht, Zittern und Erschütterung auch eine wichtige Rolle im Zugang des Menschen zur allgemeinen Lebensganzheit im menschlichen Dasein. Dennoch ist bereits bekannt, dass Heidegger das Selbstbewusstsein in Hegels Phänomenologie mit dem onto–ego–theo–logischen Begriff des Seins aufgefasst hat, obwohl er seine eigene Erhellung des Seins vom teleologisch–eschatologischen Grundzug des Hegelschen Seinsbegriffs abzusetzen versucht. M. Heidegger, Hegels Phänomenologie des Geistes, GA. 32, hrsg. v. Ingtraud Görland, Frankfurt a. M. 1980, S. 203 – 213. 107 bei Hegel „Selbstbewußtsein“. (GW. 3, S. 30) Denn das Bewusstsein ist ein Knotenpunkt der faktischen Erfahrung und kann damit zugleich, Gadamers Ansicht zufolge, vor allem in Bezug auf die Verkehrtheit der Verstandesgesetze als „das Leben“ bezeichnet werden. (GW. 3, S. 37) Diese Umkehrung des Bewusstseins zum Leben hin, bezieht der Verstand, der eine Station der Erfahrung des Bewusstseins war, in sich selbst mit ein, indem er schon jenseits der erscheinenden Welt seine Wahrheit sucht und auch aus der Relation zwischen der Anziehungskraft und Abstoßungskraft die innere Gesetzlichkeit der Welt zum Vorschein zu bringen versucht. Kurz gesagt, versucht der Verstand die Wahrheit in der „verkehrten Welt“, die jenseits der erscheinenden Welt und das Gegenteil der seienden Welt ist, zu finden. Doch diese Verkehrtheit, sozusagen die erste, die vom Verstand als die wahre Welt wahrgenommen wird, muss die erscheinende Welt unbedingt zurückrufen, um die wahre Welt zu erklären, da das Verstandesgesetz nur im Verhältnis zu den erscheinenden Kräften erläutert und festgehalten werden kann. In diesem Zusammenhang erfährt das Bewusstsein die Überwindung des unüberbrückbaren Gegensatzes, der zwischen der sinnlichen und der übersinnlichen Welt liegt. So lange die gegensätzliche Spaltung zwischen beiden Welten im Bewusstsein selbst nicht aufgelöst wird, das Bewusstsein nur in eine von beiden Welten versunken ist, handelt es sich um den unauflösbaren Kreislauf der Verkehrung. Mit diesem Widerspruch wird für uns deutlich, dass die wahre Welt eine einheitliche ist, die den Gegensatz zwischen der sinnlichen und der übersinnlichen Welt überwunden hat. Daran anschließend sieht Gadamer selbst die wahre Welt als „die als Ideal entworfene Wahrheit und die eigene Verkehrtheit“, anders gesagt, wird die wahre Welt zur Einheit der vom denkenden Subjekt aufgefassten Welt mit der seienden Realität. (GW. 3, S. 42) Diese einheitliche Welt, die „die Verkehrtheit der Verkehrung“ durchgesetzt hat, hat nunmehr das auf sich selbst bezogene Sein als ihr wahres vor Augen. Wenn die Verkehrtheit begrifflich betrachtet wird, enthält sie de facto bereits die Selbstbezogenheit, insofern die erste Verkehrung die Möglichkeit der Umkehrung nur in Beziehung auf das Verkehrte hat und umgekehrt. Dieser Gegensatz in sich selbst und deshalb das Sich–Verhalten meint prinzipiell das lebendige Selbst, sozusagen das Leben. Gadamer zufolge ist der ganze Lebenszusammenhang der „Einheit von Denken und Sein“ bei Hegel die wahre Welt, in der das lebendige Selbst sich nicht nur auf sich selbst bezieht, sondern auch den Anderen findet. (GW. 3, S. 48) Hegels Konzeption dieser wahren Welt als die Lebensganzheit betreffend, spricht Gadamer davon, „dass in ihr (= die richtige Welt, KBL) Leben ist und sich im unendlichen Wechsel, in der beständigen Unterscheidung seiner von sich selbst die Einheit des Selbstseins erhält“. (GW. 3, 108 S. 45) Mit dieser Wiederherstellung der Lebensganzheit stellt Gadamer auch fest, dass Hegels Hauptthese „Bewußtsein ist Selbstbewußtsein“ bewiesen ist. Wenn wir den wahrheitssuchenden Übergangsprozess vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein in Hegels Phänomenologie verkürzt zusammenfassen, ist das Bewusstsein von Anbeginn an nicht vom Gegenstand, vom Außer-Sich-Seienden abhängig, sondern hat mit sich selbst, d. h. seinem Selbstbewusstsein, zu tun, da das Bewusstsein sich auf das Bewusstsein vom Bewussten bezieht, d. h. das Selbstbewusstsein, das wir als das Bewusstsein über das Gewusste bezeichnen können, hat sich implizit zu seinem Gegenstand. Daraus resultiert, dass das Verhältnis des Bewusstseins zum Anderssein direkt das auf sich selbst Bezogensein ist. Vom bisherigen Entwicklungsprozess aus, kommt dem Bewusstsein das Wissen um sich selbst bzw. das Bewusstsein vom Selbst zu, so dass die Unterschiedenen unmittelbar ihren Unterschied zu sich selbst enthalten und daher mit sich selbst identisch sind. Obgleich das Bewusstsein zum Selbst wird und in sich selbst zurück kehrt, meint das zum Selbst gewordene Bewusstsein jedoch bei Hegel keine Ichhaftigkeit, die der solipsistisch– isolierten Subjektivität anhaftet. Im Gegenteil ist das selbst mit einbezogene Bewusstsein schon immer mit dem Anderen verbunden. Daher schreibt Hegel: „es (= Ich, KBL) ist es selbst gegen ein Anderes, und greift zugleich über dies Andere über, das für es ebenso nur es selbst ist.“ (PhdG. S. 138, meine Hervorhebung) Hegels Ansicht zufolge ist das nur mit der eigenen Ichheit verknüpfte Ich, d. h. das Ich, das lediglich im in sich verschlossenen Verhältnis zum atomisierten Ich hängen geblieben ist, „nicht Selbstbewußtsein.“ (Ebd.) Das Selbstbewusstsein wird deshalb bei ihm als „das Wissen von sich selbst, im Verhältnisse zu dem Vorhergehenden, dem Wissen von einem Anderen“ verstanden. Es richtet sich daher auf sich selbst und umgekehrt auf den Anderen, anders gesagt, das Selbstbewusstsein ist das gewisse Bewusstsein von sich selbst in der unverzichtbaren Verbindung zu dem Anderen. Das Selbstbewusstsein, das nur der Selbigkeit verhaftet ist, kann bei Hegel keinesfalls um sich selbst wissen, weil es von vornherein ontologisch nicht nur im Verhältnis zum Anderen steht, sondern auch sich selbst nur im verflochtenen Zusammenhang mit dem Anderen finden kann. Diesen ontologischen Grundzug des Selbstbewusstseins betreffend, sagt Gadamer, „[i]n der Punktualität des seiner selbst gewissen Selbst ist noch nicht das wahre Wesen, als Geist und Vernunft, erkannt.“ (GW. 3, S. 49) Daran anschließend gibt Hegel dem Selbstbewusstsein die Charakteristik der Lebendigkeit, da es sich von sich selbst entzweit und erst durch diese „Abstoßung von sich 109 selbst“ zu sich selbst zurückkehrt. (PhdG. S. 139) Diese Lebendigkeit des Selbstbewusstseins zeigt sich bei Hegel ursprünglich als die Lebensganzheit, der jedes einzelne Selbst zugehörig ist, in der es seinen eigenen Charakter erhält. Für uns bedeutet eine solche dynamische Bewegtheit der Lebendigkeit des Lebendigen, dass das Lebensganze sich um sich selbst dreht, d. h. den Unterschied in sich macht, sein Anderssein, das im Grunde das Selbst ist, in sich selbst wieder hineinbettet. Nun liegt es auf der Hand, dass Hegel ebenso das Leben wie das Selbstbewusstsein als das eine Sein derselben Bewegung bezeichnet, die sich zur Differenz gleich hinführt, zugleich zu sich selbst zurückkehrt, d. h. seine Identität wiederherstellt. Kurzum machen die beiden Momente, sowohl das Leben als auch das Selbst, so wie wir das Lebensganze als die lebendige Allgemeinheit und das Selbst als die lebendige Einzelheit bezeichnen können, grundsätzlich dieselbe Bewegung der Selbstentzweiung und der Rückkehr zu sich selbst im Kreislauf des ganzen Lebenszusammenhangs aus. Die Gleichheit von beiden Elementen betreffend drückt Gadamer sich daher so aus, dass „die Strukturgleichheit der Lebensbewegung des Lebendigen mit dem Selbstbewußtsein lehrt, daß das Selbstbewußtsein in Wahrheit gar nicht die Punktualität des >Ich gleich Ich< ist, sondern, wie Hegel sagt, >>Ich das Wir und Wir das Ich ist<<, das heißt Geist“. (GW. 3, S. 51) In diesem Zusammenhang kann man betonen, dass Hegels Grundeinsicht in das Selbstbewusstsein sich auf die Auffassung des intersubjektiven Anerkennungsverhältnisses stützt, anders formuliert, Hegels Kapitel „Selbstbewußtsein“ von Anbeginn an von der zwischenmenschlicher Intersubjektivität ausgeht, d. h., dass alle Subjekte zuallererst voneinander abhängig sind, gewissermaßen in zwischenmenschliche Ketten gelegt sind. Das Selbstbewusstsein, das bereits in den kompletten Lebenszusammenhang als die ontologische Basis für sein eigenes Leben eingebettet ist, ist bei Hegel auch „das Selbstbewußtsein der Begierde“. (GW. 3, S. 53) Das Selbstbewusstsein als ein lebendiges Leben braucht den Gegenstand als etwas anderes Seiendes für die Selbsterhaltung und daher tritt das Selbstbewusstsein der Begierde nach dem Anderssein unmittelbar als „das Bewußtsein des Mangels“ 107 auf. Mit anderen Worten: Das Selbstbewusstsein bezieht sich zwar auf sich selbst, aber es ist auch geradezu auf das außer sich seiende Andere gelenkt, weil es um das Nichtsein und das Nötigsein weiß. Dieses Selbstbewusstsein der Begierde taucht in zwei Formen auf: Einerseits das Selbstbewusstsein der Begierde nach dem Gegenstand um der biologische Selbsterhaltung willen, andererseits die nach dem anderen Selbstbewusstsein, das mit sich selbst gleichberechtigt ist. Die Struktur der Selbstbewegung der Begierde stellt sich daher im Selbstbewusstsein auf den Mangelzustand hin, doppelseitig dar. Im Bewusstsein 107 W. Marx, Das Selbstbewußtsein in Hegels Phänomenologie des Geistes, S. 27. 110 des Bedürfnisses, des Mangelzustandes richtet sich das Selbstbewusstsein der Begierde auf etwas Anderes als sich selbst, d. h. dass das Selbstbewusstsein weiß, was ihm fehlt, was ihm nötig ist. Dies veranlasst es, seinen Blick auf das andere zu werfen. An dieser Stelle kann man davon ausgehen, dass die Begierde bei Hegel das Selbstbewusstsein zur praktischen Handlung, zur gegenseitigen Reaktion auf die vollständige Verwirklichung hinführt, davon weit entfernt, die Begierde als eine Motivation der subjektiven Handlung fungiert, durch die das handelnde Selbst die Übereinstimmung mit dem Anderen und dem Allgemeinen auf der praktischen Ebene der verflochtenen Reaktion erreichen kann. Die erste Begierde bei Hegel ist dasjenige Selbstbewusstsein, das sich dem Gegenstand seines Bedürfnisses unmittelbar gegenüber befindet. Das begehrende Selbst konzentriert sich in diesem Augenblick auf die zu befriedigende Begierde und richtet sich dabei auf die bestimmten Dinge. Um seines Überlebens willen ist das Selbst die von dem Ding abhängige Existenz, die die Dinge verzehrt, ißt und vernichtet. Auf dieser Stufe hat das Selbst bei Hegel lediglich den „Charakter des Negativen“ (PhdG. S. 139), da die menschliche Existenz als ein Selbstbewusstsein durch die Ernährung, die Vernichtung des Gegenstandes bzw. die Befriedigung der Begierde ihr erstes Gefühl von einem Selbst erlangt. Mit anderen Worten: Das Selbst der Begierde erreicht zunächst mit der Befriedigung der Begierde die erste Station des Selbstgefühls, d. h., hier fühlt sich das Selbst trotz seiner Abhängigkeit vom Anderssein lebendig. So kann sich das Selbst lediglich aufgrund dieser biologischen Begierdebefriedigung als ein Lebendiges bestätigen: Indem die menschliche Lebensweise unmittelbar in die biologische Begierde einbezogen ist, ist das Selbst zunächst seiner selbst in dieser Befriedigung bewusst und hat sich selbst in diesem Augenblick lediglich durch den negativen Akt gefunden. Gleichwohl stellt sich die Begierde jedoch – auch wenn es um die biologische Selbsterhaltung für das Überleben der menschlichen Existenz geht – dem Selbst in verschiedenen Situationen immer wieder anders dar, da sich die Befriedigung der Begierde als ein Grund für das Selbstgefühl in unendlich vielfältiger Manier auf das Anderssein beruft, gewissermaßen in die unauflösbare Kette der Phänomene der Begierde versunken ist. Darüber hinaus gelangen die Phänomene der Begierde bei Hegel auf die zweite, noch wesentlichere Stufe im gesamten Übergangsweg, auf der das Selbstbewusstsein „die Gleichheit seiner selbst mit sich“ erblickt und sich auf ein „Lebendiges“ bezieht. (PhdG. S. 139) Das bedeutet: Das Selbstbewusstsein der Begierde findet die Möglichkeit der wirklichen und wahrhaften Begierdebefriedigung nur in der gemeinsamen Handlungssphäre, in der das Selbst sich mit seiner Handlung verursachenden Begierde in das Verhältnis zu einem anderen lebendigen, gleich sich selbst durch die Begierdebefriedigung erhaltenden und sich selbst behauptenden 111 Selbst, hineinversetzt. Das Selbst macht mithin die Erfahrung, dass die eigene Begierde nur mit dem gleichberechtigten Anderen zusammen verwirklicht werden kann, da die Begierde sich bereits auf das andere Selbstbewusstsein der Begierde gerichtet hat. Angesichts der Intensität, die dem Wesen der Begierde zugrunde liegt, erblickt das Selbst den ihm gleichgestellten, gegenüberstehenden Anderen. Diesbezüglich sagt Gadamer: „Auch die Begierde, die wirkliches Selbstbewußtsein sucht, kennt zwar – als Begierde – nur sich selbst und sucht nichts als sich selbst im Anderen, aber sie vermag nur sich selbst in ihm zu finden, wenn dies Andere selbständig ist und ihm das gewährt, seinerseits nicht auf sich zu bestehen, sondern von sich absehend >>für das Andere zu sein<<“. (GW. 3, S. 53) Aus Gadamers Sicht liegt es auf der Hand, dass das begehrende Selbst bei Hegel zunächst im die Begierde befriedigenden Handlungsverlauf sein Selbstgefühl, d. h. seine auf sich selbst bezogene Selbstheit erreicht. Zweitens findet sich das Selbst nur im mit sich gleichgesetzten Anderen wieder, in dem es sich zu erkennen lernt. Drittens nähert sich das Selbst schließlich diesem Anderen als dem mit sich gleichberechtigten Selbst an. An dieser Stelle kann man formulieren, dass die Begierde das Selbst zum Wissen um sich selbst und zugleich um das Andere motiviert. Nach der Darstellung über die Zuneigung des Selbst zum Anderen, motiviert durch die Begierde in der Einleitung zum Kapitel „Selbstbewußtsein“, beginnt Hegel nunmehr das Kapitel, das die Überschrift „Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft“ trägt, mit dem folgenden Satz: „Das Selbstbewußtsein ist an und für sich, indem und dadurch, dass es für ein Anderes an und für sich ist; d. h. es ist nur als ein Anerkanntes.“ (PhdG. S. 145) Der oben zitierte Satz deutet in erster Linie darauf hin, dass das Selbst, das von vornherein die dem Anderen entgegenkommende Begierde innehat, seine existenzielle Grundlage im Verhältnis zum Anderen, noch präziser, in dem wechselseitigen Anerkennungsverhältnis findet. Anders formuliert, bezieht sich das Selbst stets auf seinen Anderen, damit es seine Selbständigkeit gewinnt, so lange es sie noch nicht hat. Die existenzielle Seinsweise des Selbst stellt sich nunmehr, mit Hegels Worten, einerseits als „Für sich sein“, sozusagen Selbständigsein und andererseits als „Sein für Anderes“, nämlich Zugehörigkeit zum Anderen, noch präziser gesagt, Abhängigkeit vom Anderen dar. Hegels Äußerung zufolge ist die latente Wechselbeziehung zwischen den selbständigen Subjekten bereits als eine ontologische Grundlage für den Handlungsvollzug, in dem wir uns immer schon befinden, vorausgesetzt, 112 da das Selbst, das seiner selbst bewusst ist, die eigene Selbständigkeit nur vor dem Horizont der wechselseitigen Anerkennung erhalten kann. Das Selbst bildet deshalb seine Identität, nämlich sein Für-Sich-Sein nur durch die basale Intersubjektivität als eine grundsätzliche Seinsweise des lebendigen Selbst aus. Insofern erreicht das Selbst „die vollkommene Freiheit“ im handlungsorientierten Spielraum und ist als sein wahres Wesen, als „Freies Sein“ realisiert. In diesem Sinn ist das Selbst bei Hegel „An und für sich Sein“, d. h., dass die ontologische Grundlage für seine Existenz bereits mit dem Anderen verbunden ist. Es nimmt das Selbst als sein absolutes Wesen wahr. Von hier aus gelangt das Selbst zu dem Bewusstsein, dass das wahre Wesen und die wahrhaften Phänomene in der Tat auf der vorhandenen Verknüpfung mit dem Anderen basieren. Die Phänomene der „Bewegung des Anerkennens“ haben bei Hegel daher mit dem wahren Wissen um sich selbst und zugleich mit dem Bewusstsein vom Anderen zu tun. (PhdG. S. 146) Indem das Selbst im Grunde seiner Selbständigkeit bedarf und um seine Selbständigkeit zu behaupten, auch die Anerkennung durch das Andere benötigt, wird die Existenz des Anderen unbedingt vorausgesetzt. Somit ist die Anerkennungsbewegung Unterschiedenen“ ausgerichtet. bei (PhdG. Hegel S. auf 145) „die Durch Doppelsinnigkeit diese Verdoppelung des des Selbstbewusstseins, die die Andersheit des Anderen von sich selbst differenziert, nämlich den Unterschied in sich selbst ausmacht, schafft das Selbst in der Bewegung des Anerkennens den interagierenden Handlungsspielraum, in dem die Erwartungen an die künftigen Handlungen, die handlungsorientierten Anstöße usw. möglich sind. Diese ontologische Grundlage für die Anerkennungsbewegung und das Selbstsein als ein immer schon mit dem Anderen VerknüpftSein berücksichtigend, sagt Gadamer von der gegenseitigen Angewiesenheit des Selbst auf die unaufhebbare Andersheit: „Sein eigenes Selbstbewußtsein hängt von dem Anderen ab, nicht wie der aufzuhebende Gegenstand der Begierde, sondern es hängt in einem geistigeren Sinne von ihm als Selbst ab.“ Und damit setzt er fort, „ist [es] nicht nur die Bestätigung des eigenen Selbst, sondern auch die des Anderen.“ (GW. 3, S. 55) Daher kann man davon ausgehen, dass Gadamer die ontologische Grundlage als ein vorreflexives Verhältnis, das bei Hegel in der Anerkennungsbewegung verborgen ist, akzentuiert. Die Verdoppelung des Selbstbewusstseins ist nunmehr bei Hegel auf die Bewegung des Anerkennens des gedoppelten Selbst übertragen, nämlich zum gegenseitig verflochtenen Anerkennungsverhältnis übergegangen. Im Verlauf dieses Übergangs zum Bewusstsein vom Anderen kann man m. E. zwei Elemente ausmachen, die Hegel in der Anerkennungsbewegung enthalten sieht: Einerseits die Liebesbeziehung, zumindest die affektive und emotionale Beziehung zwischen den Menschen und andererseits die Erfahrung 113 des Kampfes zwischen den Personen in den Konfliktsituationen, die eigene Selbstbehauptung, die den Anderen ausschließt. Dem ersten unter den zwei Phänomenen der Anerkennungsbewegung entspricht die gegensatzlose Liebesbeziehung im familialen Intimbereich, mit der sich der frühe Hegel, wie wir schon in dem obigen Kapitel gesehen haben, ausführlich beschäftigt. Aus diesem Grund stellt sich auch die Frage, ob Hegel die Liebe als das wesentliche Moment der wechselseitigen Anerkennung in der Phänomenologie außer Acht lässt, da der Kampf in der Anerkennungsbewegung in diesem Kapitel vorgelegt wird. Gleichwohl gibt Hegel der Anerkennung hier die Struktur, nicht ohne den Modus der Liebe als die Selbsthingabe für die Anderen und das Wissen um sich selbst im Anderen. Das erste Phänomen der Anerkennungsbewegung beruht, Hegel zufolge, deshalb darauf, dass das Selbstbewusstsein „sich selbst verloren“ und dabei „sich selbst im Anderen“ angeschaut hat. (PhdG. S. 146) In diesem Zusammenhang kann man sagen, dass Hegel den Selbstverlust in der Selbsthingabe für die Anderen, die Selbstvergessenheit in dieser Selbstaufopferung als ein Phänomen der Anerkennung darstellt, bedeutet, dass die Selbsthingabe und die Selbstvergessenheit geradezu der Liebesbeziehung beim frühen Hegel entsprechen. Darüber hinaus handelt es sich hier nach Hegel freilich um das Sich–Anschauen im Anderen, auf dessen Horizont das Selbst sich selbst im Gefühl des geliebten Anderen finden will, den geliebten Anderen auch mit sich selbst grundsätzlich gleichsetzt. Dies bedeutet allerdings die wechselseitige Anerkennung. 108 Das zweite Phänomen der Anerkennungsbewegung taucht im sich gegenseitig ausschließenden Kampf zwischen den Selbständigen im Verlauf des Konfliktes auf. Dieser Kampf um Anerkennung jedoch, bei dem es grundsätzlich um die Begierde nach der Ausschließung des Anderen aus sich selbst geht, nämlich den begehrenden Versuch, „das andere selbständige Wesen aufzuheben“, bezieht sich, wie bereits bekannt, dennoch in der Phänomenologie weder auf den Kampf um Ehre noch auf den gegensätzlichen Konflikt unter den Subjekten für die Besitzergreifung im Rechtsverhältnis. Der Kampf um Anerkennung, den Hegel hier eingeführt hat, fängt zwar mit der unauflösbaren Begierde nach der grenzenlosen Vernichtung, der Aufhebung der Selbständigkeit des anderen Selbst an, dennoch ist bei Hegel zusätzlich von entscheidender Bedeutung, dass ein Selbst sich selbst in seinem Anderen innerhalb des reziproken Handlungsrahmens wiederfinden kann. Um sich selbst im Anderen wiederfinden zu können, müssen beide Selbstsubjekte ihrerseits miteinander gleich 108 Vgl. zu diesem Interpretationsvorschlag, L. Siep, Die Bewegung des Anerkennens, S. 111 ff. und ders., Der Kampf um Anerkennung, S. 194, Anm. 57, und damit auch zum Hegelschen Begriff der Liebe im Anerkennungsverhältnis zwischen den Subjekten in der Phänomenologie, Alfred Elsigan, Sittlichkeit und Liebe. Ein Beitrag zur Problematik des Begriffs des Menschen bei Hegel, Wien/München 1972, S. 132 ff. 114 gesetzt sein, anders gesagt, muss der Andere ebenso sich selbst wie ein Selbst sich selbst erkannen. In diesem Falle kann das eine Selbst beim anderen gleichermaßen frei und selbständig bleiben. Aus diesem Grund „entläßt“ das Selbst mit Hegels Worten, „also das Andere wieder frei“. (PhdG. S. 146) Durch den Anerkennungsprozess hindurch wird vor allem deutlich, dass das eine Selbst durch den Anderen als freies und selbständiges Sein erkannt und damit zugleich anerkannt wird, also daher, dass beide sich selbst anerkennen, gelangen sie zum wechselseitig anerkannten Freisein. Damit überträgt Hegel die wechselseitig freie Anerkennung auf das gegenseitig verschränkte Tun zwischen den interaktiven Subjekten. An dieser Stelle wird deutlich, dass alle sich gegenüberstehenden handelnden Subjekte von vornherein mit dem handelnden Anderen verbunden sind und die Handlungsmotivation, die sich ein handelndes Selbst gibt, durch die Handlungspartner wieder erkennbar und interpretierbar ist, kurzum, die beiden Extreme unausweichlich voneinander abhängig sind. Diesbezüglich schreibt Hegel: „Jedes sieht das Andere dasselbe tun, was es tut; jedes tut selbst, was es an das Andere fordert, und darum, was es tut, auch nur insofern, als das Andere dasselbe tut; das einseitige Tun wäre unnütz; weil, was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann.“ (PhdG. S. 147) „Das Tun des Einen“ spiegelt sich in dem „Tun des Anderen“ innerhalb des Handlungsspielraums, in dem beide Handlungspartner sich selbst gleichermaßen als selbständig und frei bestimmt haben. Dabei fordern beide eine übereinstimmende Verhaltensweise von sich. Hierfür können wir das folgende Beispiel anführen: Wenn das Verhalten eines Handlungspartners gegen die vereinbarte Handlungsweise in den Handlungsräumen verstößt und deswegen den Anderen beleidigt und in der Folge ein Handlungspartner als Reaktion auf den Anderen gegen seine Beleidigung ihm den Blick zuwendet, erkennt er sich selbst in dieser Reaktion des Anderen und versucht, seine Verhaltensweise schließlich zu verbessern. Im Hinblick auf das Alltagserlebnis bietet uns Gadamer in Bezug auf die wechselseitig anerkennende Handlung in diesem Satz Hegels eine merkwürdige Auslegung: „Man denke an das Gefühl der Demütigung, wenn jemand einen nicht wiedergrüßt, sei es, daß er einen nicht kennen will – eine schreckliche Niederlage des eigenen Selbstbewußtseins -, sei es, daß er einen wirklich nicht kennt, sondern daß man ihn verwechselt und verkannt hat – auch kein schönes Gefühl.“ (GW. 3, S. 56) Davon abgesehen führt Hegel die Anerkennungsbewegung in „den Kampf auf Leben und Tod“, in den ein Selbst den Anderen hineintreibt und aus dem sich die 115 „Ungleichheit“ zwischen beiden Selbsten ergibt, hinein. (PhdG. S. 147 u. S. 149) Im Kampf auf Leben und Tod, in den das eine Selbst den Anderen hineinzwingt, muss sich ein bezwungenes Selbst durch die Bereitschaft zum „Daransetzen des eigenen Lebens“ bestätigen, nämlich sein Leben aufs Spiel setzen, da es ihm in diesem Augenblick nur um die Selbstbestätigung vor dem Gegenüberstehenden geht. (PhdG. S. 148) Gadamers Ansicht nach spielt der Tod bei Hegel „die systematische entscheidende Rolle“. (GW. 3, S. 56) Denn die Anerkennungsbewegung führt nunmehr zum übermäßigen Widerstand gegeneinander in den lebensgefährlichen Konfliktsituationen. Beide Betroffenen, die vor Todesfurcht zittern, sind voneinander getrennt. In diesem Fall kann das eine Selbst die Selbstbestätigung, die Anerkennung durch den Anderen. nur dann gewinnen, wenn der Andere aufgehoben, beseitigt wird. Aber diese Beseitigung bzw. die brutale Vernichtung des Lebens des interaktiven Partners ist unmöglich, da eine Anerkennung ohne das Leben des Handlungspartners unmöglich ist. Deswegen spricht Hegel von der „Selbständigkeit ohne die absolute Negativität“. (PhdG. S. 149) Um von dem Anderen anerkannt zu werden, macht das eine Selbst im Anerkennungsprozess die deutliche Erfahrung, dass das Leben des Anderen nicht vernichtet werden darf, obwohl es zunächst sein eigenes Leben in den Kampf, in dem seine biologische Existenz negativ aufgehoben werden könnte, einbringt. Kurzum bedarf die Anerkennung des Selbst als das selbständige Freie unabdingbar der Existenz des Anderen. Mit anderen Worten: Die erste Bedingung für die Anerkennung ist das Leben, das unvermeidbar das Erzittern vor der Todesfurcht enthält, da die geforderte Anerkennung ohne das Leben nicht erreichbar wäre. In diesem Moment von Leben und Tod stabilisiert sich die Anerkennungsbewegung bei Hegel im Herr–Knecht–Verhältnis. Hegels Darstellung des Herr–Knecht–Verhältnisses im Anerkennungsprozess zeigt m. E. die Ungleichheit zwischen beiden Handlungsextremen, wie die Überschrift dieses Kapitels bereits angedeutet hat. Die Überschrift des vorliegenden Kapitels trägt bekanntlich das Verhältnis von „Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins“. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass sich Hegels Grundgedanke weder an der Entstehung der Herrschaft in der vorgeschichtlichen Gesellschaft, noch an der geschichtsphilosophischen Anwendung auf die geschichtlichen Entwicklungsphasen der Menschheit orientiert. Vielmehr beruht Hegels Denkansatz sowohl im vorliegenden Kapitel als auch in diesem gesamten Werk auf „einem exemplarischen Lernen oder Erfahrung“ des Selbstbewusstseins. 109 So gesehen besteht der Kernpunkt des Herrschaft–Knechtschaft–Verhältnisses darin, wie das knechtische Bewusstsein im Erfahrungsprozess bzw. in der Erfahrung der Anerkennung zwischen den 109 Otto Pöggeler, Hegels Idee, S. 259. 116 Gegenüberstehenden über die Unselbständigkeit hinaus zur Selbständigkeit gelangt, da die wahre Anerkennung, wie der erste Satz dieses Kapitels bereits angedeutet hat, auf der Seite der Knechtschaft vollendet ist. Das bedeutet, dass das knechtische Bewusstsein grundsätzlich den gangbaren Weg von dem „Sein für Anderes“ zu dem „Für-sich-selbst-sein“ durchschreitet, nämlich die Einheit von dem „Sein für Anderes“ und dem „Für-sich-selbst-sein“ in der Erfahrung des Bewusstseins erlangt, während die Herrschaft, die nur das Moment des „Fürsich-seins“ kennt, in ihrem ganzen Entfaltungsprozess in der Unselbständigkeit versunken ist. So gilt Gadamer Hegels Grundkonzeption über das Herrschaft–Knechtschaft–Verhältnis als „eine >idealtypische< Konstruktion“. 110 (GW. 3, S. 57) Dementsprechend ist der Ursprung der Ungleichheit in der Anerkennungsbewegung des Selbstbewusstseins bei Hegel zunächst das Wechselspiel zwischen Leben und Tod. Die eine Seite meistert im Konfliktverlauf ihr „An–das–Leben–Geknüpftsein“, d. h. ist bereit, ihr Leben unter riskanten Kampfsituationen aufs Spiel zu setzen. Dabei zwingt sie die Anderen auch ins Schlachtfeld hinein, wobei beide Betroffenen die Lebensgefahr ertragen müssen. Der andere Pol, der vom attackierenden Handlungspartner in die unbehagliche Situation hineingetrieben wird, zittert vor Todesangst und ist damit zugleich auf das eigene Überleben zurück geworfen. Daraus folgt, dass die eine Seite sich selbst als den Herrn bezeichnet, während die andere als der Knecht auftritt, d. h. der Herr mit seinem Selbständigsein den Knecht als seinen einzigen Handlungspartner überwältigt, wohingegen der Knecht dem Herrn unterworfen, seinem Unselbständigsein verfallen ist. Der Herr zwingt den Knecht als einen Diener, für sein eigenes Überleben zu dienen und für die Erhaltung seines natürlichen Lebens bzw. für die Beschaffung der Lebensmittel Sorge zu tragen. So „bezieht sich der Herr mittelbar durch den Knecht auf das Ding“, weil der Herr auf der ersten Stufe der Erfahrung der Anerkennung „die Macht über dies Sein“ hat. (PhdG. S. 151) „Die Macht über dies Sein“, die der Herr mit der Selbstbestätigung über seine Selbständigkeit innehat, meint in diesem Kontext geradezu die Macht über das Leben. Der Herr beherrscht deshalb nicht nur das Leben des Knechtes, sondern auch das Sein des Dinges, indem er die Überwindung der Abhängigkeit von seiner Begierde nach dem Leben im Kampf erwiesen und dadurch die Unabhängigkeit von den Gegenständen der Befriedigung der Begierde präsentiert hat, während der Knecht von seiner Begierde nach dem Überleben im Kampf abhängig ist und dabei auch die Abhängigkeit von den Gegenständen der Befriedigung der Begierde zum Ausdruck bringt. Der Ansicht des Herrn zufolge muss der Knecht nunmehr die Dinge allein erarbeiten, um beide Begierden befriedigen zu können, umgekehrt bezieht sich der Herr nur 110 Vgl. Ebd. S. 264. 117 auf den vom Knecht bearbeiteten Gegenstand. Kurz gesagt, ist der Herr geradezu die Macht über die Gegenständlichkeit, demgegenüber ist der Knecht die Unterwerfung unter diese Gegenständlichkeit. In diesem Fall sind der Herr und der Knecht durch den bearbeiteten Gegenstand miteinander verbunden. An dieser Stelle hat der Herr nunmehr nur „die reine Negation“, den „Genuß“, weil er nicht mehr dem Ding als dem „selbständige[n] Sein“, sondern dem Ding als dem unselbständigen Sein, nämlich dem ausgearbeiteten Gegenstand der Begierde gegenübertritt und lediglich durch die Vernichtung dieses bearbeiteten Gegenstandes zu seinem Selbstgefühl kommt und sich selbst bestätigt. (Ebd.) Für diesen reinen, vernichtenden Genuss hat der Herr daher „den Knecht zwischen es (= Ding, KBL) und sich eingeschoben“. (Ebd.) Daraus folgend können wir die Wechselbeziehung des Herrn angesichts eines doppelseitigen Verhältnisses verstehen: Einerseits die Beziehung auf den Knecht durch das Sein, nämlich das Leben, andererseits die auf das Sein, also das Leben durch den Knecht. Darüber hinaus führt das Verhältnis von Herr und Knecht bei Hegel auch zu einem Resultat eines „einseitige[n] und ungleiche[n] Anerkennen[s]“, d. h. der Asymmetrie zwischen beiden Extremen im Anerkennungsverhältnis. (PhdG. S. 152) Für uns kommt es vor allen Dingen auf „ein verkehrtes Selbstbewußtsein“, nämlich auf die Verkehrung in der Erfahrung der Anerkennung des Selbst an. (GW. 3, S. 58) In Bezug auf die Verkehrung der Erfahrung des Selbst von Herr und Knecht sind hier zwei Aspekte zu betonen: Um als Herr anerkannt sein zu werden, braucht er zum einen notwendigerweise den anerkennenden Anderen. Doch dieser Andere ist von dem Herrn selbst in die Unselbständigkeit getrieben worden, da der Herr dem Anderen im Konfliktverlauf dessen Selbständigkeit genommen und ihn verknechtet hat. Nun zeigt sich, dass dieser Herr als das selbständige Sein nur durch den unterworfenen Anderen, den Knecht als das unselbständige Sein, anerkannt wird. In diesem Fall kann der Herr sein Bedürfnis nach Anerkennung durch die andere Selbständigkeit niemals erfüllen, da der Knecht, der andere Handlungspartner, über keinerlei Selbständigkeit verfügt. Um überleben zu können, bedarf der Herr andererseits der Arbeit des Knechtes, noch präziser gesagt, benötigt er den ausgearbeiteten Gegenstand für die Befriedigung seiner Begierde, da dieser nicht direkt auf dem natürlichen Ding beruht und er deshalb nur durch die Bearbeitung des Knechtes sein natürliches Leben weiter leben kann. Hier kann man „die Bedürfnisgemeinschaft“ 111 von Herrschaft und Knechtschaft erkennen, da der Knecht sich einerseits für das Leben durch die Unterwerfung unter die Herrschaft verbürgt hat, um für die Befriedigung der Begierde des Herrn zu sorgen und sich andererseits um sein eigenes 111 W. Marx, Selbstbewußtsein in Hegels Phänomenologie des Geistes, S. 80. 118 Weiterleben kümmert. Weit davon entfernt, ist der Herr in die Abhängigkeit vom Knecht, die Unterwerfung unter den Genuss und die Befriedigung der Begierde geraten, schließlich der Unselbständigkeit verfallen, indem er sich, wie bereits erwähnt, auf sein eigenes Sein, d. h. sein eigenes Leben nur durch den Knecht bezieht, den Gegenstand für seinen Genuss nur durch die Bearbeitung durch den Knecht gewinnt und verzehrt, das Streben nach dem Genuss damit zunehmend verstärkt und er in einen unauflösbaren Kreislauf verstrickt wird. Infolgedessen ist der Herr nicht nur in die Abhängigkeit vom Knecht versunken, sondern auch an das Ding selbst, nämlich den Gegenstand für seinen Genuss gefesselt. In diesem Moment ist die Knechtschaft deshalb zur „Wahrheit des selbständigen Selbstbewußtsein[s]“ gekommen, da sie ein „in sich zurückgedrängtes Bewußtsein“, ein „aus seinem Außersichsein auf sich selbst zurückgekommenes Bewußtsein“ ist. (PhdG. S. 152 u. GW. 3, S. 59) In Bezug auf diese Rückkehr des wahren Selbstbewusstseins zu sich selbst oder seiner Innerlichkeit kann man m. E. weiter schlußfolgern, dass die Abhängigkeit vom Ding als solchem, die Unterwerfung unter den Gegenstand für den Genuss nicht nur beim Herrn zu finden ist, sondern auch die fundamentale Problematik der modernen Menschheit in der technischen Welt ist, da wir gegenwärtig in einem Übermaß von Verbrauchsgütern leben und dieser Konsum, der infolge der Zunahme unseres unendlichen Strebens nach Genuss und Wohlstand überflüssigerweise produziert wird, uns unterjocht. Daraus folgt, dass wir uns selbst an die von uns produzierten Dinge ketten. Diesbezüglich sagt Gadamer, dass „die Kette der Dinge zerbrochen werden muß, wenn Freiheit sein soll.“ (GW. 3, S. 64) Angesichts dieser Abhängigkeit vom Ding als solchem ist der Herr nunmehr vom interaktiven Schauplatz der Erfahrung der Anerkennung des Selbst ausgeschlossen, da er nicht den selbständigen Anderen, sondern nur den unselbständigen, ihm unterworfenen Anderen gesehen hat, obwohl er sich selbst als ein „Für-sich-selbst-sein“ bestimmt hat. Das wahre Anerkennungsverhältnis ist bei Hegel, wie wir schon erwähnt haben, das gegenseitige Wechselspiel unter den gleichberechtigten Subjekten, d. h., was der Herr gegen den Knecht tut, das soll der Knecht gegen den Herrn in seiner Handlungsweise ebenso tun können und umgekehrt. Aber in diesem Herr-Knecht-Verhältnis gibt es kein gegenseitiges Wechselspiel und keinen wechselseitigen Einfluss aufeinander. Um ein Anerkanntes sein zu können, soll das Selbst nicht nur das „Für-sich-selbst-sein“, sondern auch das „Sein für Anderes“ sein. Mit anderen Worten: Das Selbst muss sich selbst als ein selbständiges Wesen in der intersubjektiven Beziehung durch das andere selbständige Selbst bestätigen und sich selbst in diesem Anderen anschauen können. Demzufolge müssen beide Beteiligten an dieser 119 symmetrischen Beziehung die Erfahrung machen, dass meine Selbstbestätigung nur von der Anerkennung durch meinen Anderen, nämlich dem Du meiner selbst, unumgänglich abhängt und umgekehrt. Insofern wird das knechtische Bewusstsein nunmehr durch den Bildungsprozess hindurch diese wahre Anerkennung erreichen, weil es sich aus dem „Sein für Anderes“ zu dem „Für-sich-selbst-sein“ im Verlauf dieses Anerkennungsprozesses entwickelt. Die wahre Anerkennung des Selbst, die Einheit zwischen beiden Momenten wird nicht vom Herrn, sondern vom knechtischen Bewusstsein vollständig vollzogen. Nun beginnt die Selbstwerdung des knechtischen Bewusstseins, die Repräsentation der latenten Selbständigkeit bei Hegel mit dem „absoluten Herr“, d. h. mit der „Furcht des Todes“. (PhdG. S. 153) Dieser Herr ist der endgültige, der jedem Selbst einmal schicksalhaft widerfahren wird. Die absolute Furcht vor dem Tod vermag nach wie vor das „ganze Wesen“ des Selbst aufzulösen. Aus diesem Grund des unentrinnbaren Schicksals zittert jeder vor dem absoluten Herrn. Aus dieser Angst vor der absoluten Macht über das Leben, nämlich der Negationsmöglichkeit alles Daseins, haben alle Selbständigen vor diesem Herrn niedergekniet. Doch diese Angst hat von Anbeginn an nur das knechtische Bewusstsein erfahren, nicht das herrische, da diese negierende Macht das knechtische Bewusstsein in die Unterwerfung unter das herrische hineingetrieben hat. Mit der leidenden Erfahrung wird das knechtische Bewusstsein gezwungen, an der unmittelbaren Dinghaftigkeit festzuhalten. Dennoch, durch die Beziehung mit diesem fremden Ding weiß es über „das absolute Flüssigwerden alles Bestehens“, während das herrische immer noch an die natürliche Dinghaftigkeit gefesselt ist. Dadurch, dass das knechtische Bewusstsein erfährt, dass diese negierende Macht des absoluten Herrn alle Daseienden bis in die menschliche Existenz zu vernichten vermag, hat es die Fähigkeit, dem erzwungenen Festhalten an den Dingen zu entgehen und gleichzeitig zu sich selbst zurückzukommen, nämlich „sich selbst zum Gegenstand zu machen“. Mit dieser Rückkehr zu sich selbst bzw. der Selbstvergegenständlichung wird das knechtische Bewusstsein zu allererst zum Selbst. Daran anknüpfend wirft es nicht mehr dem vorübergehenden, verschwindenden Zufall, sondern der permanenten Ewigkeit seinen Blick zu. Das knechtische Bewusstsein ist von nun an durch die Rückkehr zu sich selbst in „das arbeitende Bewußtsein“ versetzt, d. h., dieses Bewusstsein wird zum „Bewußtsein des Könnens“, indem es sich zunächst seiner selbst in seiner Selbständigkeit bewusst wird und alsbald von der Unmittelbarkeit der natürlichen Gegenständlichkeit befreit wird. (PhdG. S. 154 u. GW. 3, S. 61) Auf dieser Stufe präsentiert es von vornherein eine zweifache Fähigkeit: Das arbeitende bzw. knechtische Bewusstsein ist zum einen das formende, das dem 120 natürlichen und deshalb unmittelbaren Gegenstand die Form geben kann und sich selbst in diesem geformten Gegenstand erblickt. Mit anderen Worten: Das arbeitende Bewusstsein hat die primäre Fähigkeit, das natürliche Ding, den augenblicklichen Zufall in das beständige Fortbestehen umzuwandeln, sich selbst in diesem von sich selbst konstruierten Gegenstand, nämlich in seinem Werk, wieder zu finden. In Bezug auf die unmittelbare Begierde ist der Gegenstand nur entleert, hat vor der unmittelbaren Negation der Begierde kein Fortbestehen, während das arbeitende Bewusstsein in das Wissen um sein „Können“ eintritt, dass seine Begierde zunächst eingeschränkt werden muss, dass es durch diese Einschränkung der Begierde den Gegenstand bearbeiten kann und ihm so seine dauerhafte Form gibt und sich schließlich selbst in der gegenständlich ausgearbeiteten Gestalt wieder erkennen kann. Bei Hegel ist das arbeitende Bewusstsein deshalb „gehemmte Begierde“, die eigentlich auf die reflexive Internalisierung des Bewusstseins verweist. (PhdG. S. 153) Mit anderen Worten: Die Überwindung der äußerlichen Unmittelbarkeit wird nunmehr zu „einer Befreiung des eigenen Selbstbewußtseins“. (GW. 3, S. 62) Das Bewusstsein erlangt damit zum anderen die Fähigkeit, den Weg von der bearbeitenden Beziehung mit dem fremden Gegenstand zum sich–selbst–Bilden zu gehen, sich selbst in diesem Bildungsprozess auf ein lebendiges Selbst zu verlagern. In diesem sich selbst konstruierenden Bildungsprozess erlangt das Bewusstsein die Selbständigkeit bzw. das Bewusstsein vom freien Selbst und gleichzeitig das vom Anderen: Aufgrund der bestimmten Einschränkung der Begierde erlangt das Bewusstsein nicht nur die Rückkehr zu sich selbst, sondern auch zum Anderen, kurzum, die Einheit von dem „Für-sich-selbst-sein“ und dem „Sein für Anderes“. Anders gesagt hat das Selbst in diesem zu vollbringenden Prozess nicht nur das Wissen um „Das kann ich“, das Selbständigsein des freien Willens, sondern es bezieht sich auch als ein Lebendiges auf den Anderen, d. h. findet ebenso wohl das außer sich Seiende, ja das Fremde wie das mit sich selbst identisch seiende Wesen. (GW. 3, S. 62) In diesem Sinne bleibt das Selbst, so Gadamer, „in der Freiheit des Könnens“, in der nicht nur die Fremdheit, sondern bald schon die Eigenheit aufgehoben wird, so dass beide den höheren einheitlichen Horizont der Lebensganzheit gemeinsam vor Augen behalten können. 112 Vor diesem harmonischen 112 Hier kann man vor allen Dingen sagen, dass die „Freiheit des Könnens“ in Gadamers Dialoghermeneutik von vornherein das praktische Können, das im Grunde darum weiß, dass die Freiheit begrenzt ist, darstellt. Aus dieser Sicht geht es nicht um die grenzlose Freiheit, sondern um das Halten des Gleichgewichts in der begrenzten Freiheit. Zum praktischen Können in Gadamers Denken, vgl. Hans–Georg Gadamer, „Theorie, Technik, Praxis, in: ders., Über die Verborgenheit der Gesundheit, Frankfurt a. M. 1993, S. 7–49. Das Bewusstsein des Könnens, das aus hermeneutischer Sicht mit dem wirkungsgeschichtlichen Bewusstsein zu tun hat, trifft immer schon auf seinen bestimmten Handlungszusammenhang, in dem der existenzielle Entwurf in seiner Seinsmöglichkeit realisierbar ist und es findet deshalb seine Freiheit nur unter der geschichtlich und gesellschaftlich bedingten Situation. Somit hat das praktische Können von vornherein eine ethische Konnotation. Nun sagt Gadamer: „Sich theoretisch verhalten zu können gehört also selbst zur 121 Horizont des Lebensganzen weiß das Selbst, mit Gadamers Worten, dass „ich und du dasselbe sind“, wie „Tun des Einen“ und „Tun des Anderen“ bei Hegel gleich sind, d. h. was das eine tut, das tut das Andere gleich und umgekehrt. (Ebd.) Um sich selbst als das freie Selbständige anschauen zu können, muss das Selbst nunmehr durch die Selbstprüfung und die Selbstkorrektur den Weg des Leidens zum „Bewusstsein der Freiheit“ beschreiten. Auf diesem Weg leitet es aus der innerlichen Enthaltsamkeit, wie es Hegel mit seinem Wort „gehemmte Begierde“ ausgedrückt hat, die allgemeine Gemeinsamkeit ab, in der alle Beteiligten, die als das selbständige Selbst aufeinander bezogen sind, sich selbst gleich bestimmen und verwirklichen können. Da jeder Beteiligte hieraus gelernt hat, dass seine Freiheit immer schon auf seinen Anderen angewiesen ist, geht es bei allen Beteiligten nicht nur um die eigene Selbständigkeit und die eigene Freiheit, sondern es kommt auch auf die gemeinsame Freiheit in der gesellschaftlichen Sphäre an. In diesem Sinn hat die allgemeingültige Verständigung zwischen allen Beteiligten mit der „Gemeinsamkeit der Freiheit“ 113 zu tun, in der jeder Einzelne, sich selbst erhaltend, sich auf den Anderen bezieht, ohne einen Selbstverlust zu erleiden, und die gemeinsame Allgemeinheit in sich aufnimmt. 113 Praxis des Menschen. Es ist ohne weiteres klar, daß es die >theoretische< Gabe des Menschen war, die es ihm möglich machte, von den unmittelbaren Zielen seiner Wünsche Abstand zu gewinnen, seine Begierde zu hemmen, wie es Hegel genannt hat, und damit ein >gegenständliches Verhalten< zu begründen, das sich sowohl in der Herstellung von Werkzeugen wie in der menschlichen Sprache ausbildet. In ihm entspringt als eine weitere Abstandnahme die Möglichkeit, all sein Tun und Lassen, als ein gesellschaftliches, auf die Zwecke der Gesellschaft hinzuordnen.“ (S. 30) W. Marx, Ebd., S. 99. 122 IV – 2. Die anerkennende Gewissensdialektik von dem „Schönen“ und dem „Bösen“ Da das wechselseitige Anerkennungsverhältnis zwischen Herr und Knecht im Kapitel „Selbstbewußtsein“, wie wir oben gesehen haben, nur vom knechtischen Bewusstsein einseitig vollendet wird und das durch diesen sich selbst negierenden Weg erreichte Bewusstsein damit auch nur auf das unerreichbare Unendliche ohne die lebendige Wirklichkeit fixiert ist, wird hier vor allem deutlich, dass die hier gelungene Anerkennung ein defizitäres Verhältnis ist. Um Hegels gesamten Denkansatz zum wechselseitigen Anerkennungsverhältnis in der Phänomenologie des Geistes in Anknüpfung an Gadamers Hermeneutik komplett und supplementär zu skizzieren, müssen wir nunmehr Hegels Gewissensdialektik 114 unsere Aufmerksamkeit zuwenden, wobei er die „gegenseitige Anerkennung“ als die konstruktive Gestalt des absoluten Geistes unter dem Titel „c. Das Gewissen, Die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung“, das vor dem letzten Teil der Phänomenologie, dem VII. Teil „Die Religion“, eingeordnet ist, thematisiert. 115 Vor der Darstellung über das Anerkennungsverhältnis in der Gewissensdialektik, gewissermaßen „das böse Gewissen und seine Verzeihung“, sollte der weitere Verlauf der Bewegung des Selbstbewusstseins, der auf die Erfahrung des Selbstbewusstseins im Herrschaft– Knechtschaft–Verhältnis folgt, zusammengefasst werden, da „das religiöse Bewusstsein“, mit dem „das unglückliche Bewusstsein“ zusammenhängt, sich aus dieser Entfaltung ergibt. 116 Nachdem das Bewusstsein die eigene Freiheit in der Bewegung des Anerkennens zwischen 114 115 116 Vgl. Dietmar Köhler, „Hegels Gewissensdialektik“, in: G. W. F. Hegel Phänomenologie des Geistes, hrsg. v. ders. und Otfried Höffe, Berlin 1998, S. 209 – 225 und dazu, Hermann Lübbe, „Zur Dialektik des Gewissens nach Hegel“, in: Hegel–Studien Beiheft 1, hrsg. v. Hans–Georg Gadamer, Bonn 1984 (2. Aufl.), S. 241 – 261. H. Lübbe versucht besonders, Hegels sozialphilosophischen Ansatz in Bezug auf die Gewissensdialektik in der Rechtsphilosophie auf die liberalistische Perspektive hin auszulegen. Seiner Ansicht zufolge geht es bei Hegels Auffassung über die Gewissensproblematik in der Theorie der Moralität um die Frage, wie die individuelle Gewissensfreiheit als ein unaufhebbares Grundrecht im institutionellen Gesellschaftssystem bestimmt werden kann. Hegels Begriff des Gewissens hat daher nach H. Lübbe die Funktion als die letzte Instanz für die autonome Handlung des moralisch sich selbst entscheidenden Subjekts. Bei dieser subjektiven Selbstentscheidung handelt es sich auch um die Angemessenheit der subjektiven Handlungsnormen, der eigenen Gewissenhaftigkeit am geltenden Maßstab der Regeln und Gesetze, dem normativen Guten. Auf die gesamten Stufen der Erfahrung des Bewusstseins rückblickend, schreibt Hegel selbst über dieses Kapitel im letzen Teil der Phänomenologie, „das absolute Wissen“: „Dieser (= Begriff, KBL) ist an der Seite des Selbstbewußtseins selbst auch schon vorhanden; […] Er ist also derjenige Teil der Gestalt des seiner selbst gewissen Geistes, der in seinem Begriff stehen bleibt und die schöne Seele genannt wurde.“ (PhdG. S. 580) Dieser Selbstankündigung Hegels zufolge, können wir andeutungsweise die These aufstellen, dass das Kapitel „Das Gewissen“ als die Endstation der gesamten Entfaltung der Phänomenologie betrachtet werden kann. Von einem Gesichtspunkt der Interpretation von Hegels Phänomenologie aus betrachtet, kann daher gesagt werden, dass der Teil „(BB) Der Geist“, der m. E. der praktische Geist genannt werden sollte, vor dem Übergang zum absoluten Wissen als der wissenschaftlichen Erkenntnis der Endzweck der Phänomenologie ist. Vgl. L. Siep, Der Weg der Phänomenologie des Geistes, S. 110 – 118. 123 dem Herrn und dem Knecht erfahren hat, begibt es sich selbst in den Prozess vom „Stoizismus“ über den „Skeptizismus“ hin zum „unglücklichen Bewußtsein“. Im Stoizismus zeigt das Bewusstsein seine eigene Freiheit nur in der abstrakten Denkform. Infolgedessen sieht dieses reine „denkende Wesen“ von der Wirklichkeit als seinem konkreten Inhalt ab und hält deshalb nur an der „einfachen Wesenheit des Gedankens“ fest, ohne lebendig zu sein und die sich selbst negierende und deshalb entwickelnde Bewegung, die Selbstdifferenzierung, zu durchlaufen. (PhdG. S. 157) Dennoch ist der Stoizismus in erster Linie ein Freiheitsdenken, d. h. dass er, so Hegel, „die Freiheit im Denken“ als „den reinen Gedanken“, der deshalb nur die inhaltlose Form ist, in den Vordergrund stellt. (PhdG., S. 158) Nach der Erfahrung der Inhaltslosigkeit im stoischen Denken errichtet das skeptische Bewusstsein den Widerspruch zwischen Denken und Tun, Hegels Äußerung zufolge, „das gedoppelte widersprechende Bewußtsein der Unwandelbarkeit und Gleichheit und der völligen Zufälligkeit und Ungleichheit mit sich“. (PhdG. S. 162) Bei der Entlarvung des in sich verborgenen Widerspruchs kreist dieses Bewusstsein um die verwirrende Selbstnegation, die im unhaltbaren Zweifel an der Wesenheit und der Wahrheit, im unauflösbaren Gegensatz zwischen dem Realen und dem Idealen, den Dingen und dem Denken liegt. In dieser Erfahrung seines unauflösbaren Gegensatzes, anders gesagt, vor allem mit der Kenntnis von seiner Endlichkeit und seiner Beschränktheit, führt das Bewusstsein sich selbst bei Hegel zum religiösen Bewusstsein hin, das, wie wir schon im Moment des Todes als dem absoluten Herrn im Herr–Knecht–Verhältnis gesehen haben, nach dem ewigen Unwandelbaren strebt. Die negative, substanzlose Bewegung des Bewusstseins bzw. die unendliche Hin– und Herbewegung der unruhigen Negation führt das Bewusstsein nunmehr zu der Sehnsucht nach dem substanziellen „Unwandelbaren“. Gleichwohl ist dieses Bewusstsein lediglich durch die Sehnsucht nach dem unerreichbaren Jenseits im religiösen Glauben erfüllt und deshalb befindet es sich noch immer im Widerspruch zwischen dem „Wandelbaren“ und „Unwandelbaren“. Mit anderen Worten: Dieses gläubige Bewusstsein als das religiöse wendet seinen sehnsüchtigen Blick in Richtung auf die göttliche Ewigkeit hin, denn dort will sich das endliche Selbst mit der unendlichen Göttlichkeit vereinen. Doch trotz dieser unermüdlichen Sehnsucht nach der göttlichen Ewigkeit ist seine Wirklichkeit von der Unendlichkeit, Göttlichkeit immer noch weit entfernt, eher an das Leiden an der Sünde gefesselt. Aufgrund dieses unauflösbaren Selbstwiderspruchs nennt Hegel dieses Bewusstsein hier „das unglückliche“. Das unglückliche Bewusstsein leidet nach Hegels Vorstellung permanent unter dem unentrinnbaren „Schmerz über dieses Dasein und Tun“ in seinem ganzen Leben. (PhdG. S. 164) Das unglückliche Bewusstsein spürt zunächst jenen Schmerz, 124 der sich einerseits aus dem ontologischen Zwiespalt zwischen der ewigen Göttlichkeit und seiner irdischen Existenz und sich andererseits aus dem völlig zufällig stattfindenden Wandel der Wirklichkeit ergibt und glaubt, diesen Zustand nur durch die „Andacht“ oder das Andenken an das reine Sein, das von der wirklichen Lebendigkeit weit entfernt ist, überwinden zu können. Diese Möglichkeit, seine Endlichkeit mit der Göttlichkeit zu vereinen, findet das unglückliche Bewusstsein deshalb in der asketischen Selbstnegation, auf deren Weg seine Begierde, Triebe und die Tatsache der erscheinenden Welt usw. vertilgt werden sollen. Durch die Askese, also die „Verzichtleistung“, die sich auf sich selbst bezieht, alleine, glaubt dieses religiöse Bewusstsein nunmehr die Vereinigung mit der Göttlichkeit erlangen zu können. Überdies wird „Sein Genuß“, wie Hegel schreibt, unabdingbar zum „Gefühl seines Unglücks“, obwohl das Unglück grundsätzlich in der grenzenlosen Vertilgung aller Naturen steht. (PhdG. S. 174) Durch diese absolute Selbstvernichtung geht dieses Bewusstsein zur selbstlosen Substanzialität über. Doch trotz der Selbstlosigkeit in Gestalt des Bewusstseins bildet die „wirklich vollbrachte Aufopferung“, sozusagen die Selbstopferung des Bewusstseins, die Basis für das gewissenhafte Handeln, da die Besinnung auf die innere Moralität durch diese Selbstverzichtsleistung zustande kommt. (PhdG. S. 176) Vor der Darstellung über das böse Gewissen und seine Verzeihung im VI. Teil der Phänomenologie, hat Hegel Einspruch gegen die zeitgenössischen Perspektiven, 117 vor allem gegen die Kantische Moralität erhoben, die sich auf das Postulat der Unsterblichkeit der erhabenen Seele des Menschen und der als das höchste Gute geltenden Substanz stützt. Nach seiner Kritik an der abstrakten Allgemeinheit, dem unerfüllbaren Anspruch auf die allgemeine Egalität in der französischen Revolution, 118 fordert Hegel selber den Übergang der absoluten Freiheit „in ein anderes Land des selbstbewußten Geistes“, nämlich zu der Auseinandersetzung mit dem moralischen Bewusstsein seiner Zeit. Diese Forderung Hegels kommt zustande, da der abstrakte Anspruch auf die unbedingte Berücksichtigung der individuellen Rechte und die darauf gestützte Egalität in der französischen Revolution, Hegels Ansicht zufolge, automatisch die negative Zerstörung, nämlich die sich permanent verändernden Institutionen und Gesetze unterstützt. (PhdG. S. 441) Daran anschließend weist 117 118 Vgl. Zu Hegels Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Intellektuellen, insbesondere den Romantikern, D. Köhler, Ebd., S. 213 – 216 und dazu L. Siep, Ebd., S. 211 – 214, auch zu Hegels Konzeption vom Gewissen, dem moralischen Bewusstsein in der kritischen Auseinandersetzung mit der Fichteschen Gewissensethik und der religiös begründeten Gewissensethik Schellings, Christian Iber, „Religiös begründete Moral in Hegels >>Phänomenologie<< und Schellings >>Freiheitsschrift<<“, in: Hegel – Jahrbuch 2001, Phänomenologie des Geistes, Erster Teil, hrsg. v. Andreas Arndt, Karol Bal und Henning Ottmann, Berlin 2002, S. 225 – 231. In seiner Rechtsphilosophie hält Hegel die allgemeine Egalität in der französischen Revolution für „die Furie des Zerstörens“. Er schreibt, dass „das Volk in der Revolution die Institutionen, die es selbst gemacht hatte, wieder zerstört hat, weil jede Institution dem abstrakten Selbstbewußtsein der Gleichheit zuwider ist.“ G. W. F. Hegel, Rechtsphilosophie, § 5. 125 Hegel unter dem Titel „die moralische Weltanschauung“ darauf hin, dass das Postulat der „Harmonie der Moralität und der Natur“, sozusagen der Anspruch auf die Einheit der menschlichen Existenz mit der alle Wesen erschaffenden Gottheit, die sehnsüchtige Erwartung des Bewusstseins an die reine Pflicht und das reine Denken, wie das stoische Bewusstsein versucht hat, in sich enthält. (PhdG. S. 445) Gleichwohl soll dieses höchste Postulat auch dem Bewusstsein als die eigene „Glückseligkeit“ gelten. Aus diesem Grund stellt sich hier in Bezug auf die Kantische Moralität die Frage, wie der Mensch als die endliche Existenz der reinen Pflicht als dem höchsten Gut, die ihm damit zugleich die Glückseligkeit bringt, begegnen kann. Mit dieser Frage an Kant geht Hegel auf „die Verstellung“ des moralischen Bewusstseins ein, wobei das moralische Bewusstsein, so ähnlich wie das skeptische Bewusstsein die Erfahrung gemacht hat, sich in die verwirrenden Widersprüche zwischen der reinen Pflicht als dem Zweck der individuellen Handlung und der Realität als dem Inhalt der Handlung zu verstricken. An dieser Stelle erfährt das moralische Bewusstsein im Verlauf der pflichtgemäßen Handlung einerseits den Gegensatz zur wirklichen Handlungssituation, nämlich die konkreten Handlungsrahmenbedingungen und andererseits bei der unter den flexiblen Handlungsumständen ausgeübten Tat den Gegensatz zur reinen Pflicht. In diesem Zusammenhang schreibt Hegel über das moralische Bewusstsein: „Das moralische Bewußtsein ist als das einfache Wissen und Wollen der reinen Pflicht im Handeln auf den seiner Einfachheit entgegengesetzten Gegenstand, auf die Wirklichkeit des mannigfaltigen Falles bezogen und hat dadurch ein mannigfaltiges moralisches Verhältnis. Es entstehen hier dem Inhalt nach die vielen Gesetze überhaupt und der Form nach die widersprechenden Mächte des wissenden Bewußtseins und des Bewußtlosen.“ (PhdG. S. 448) Hier tritt das Gewissen bei Hegel zunächst als das moralische Bewusstsein auf. Hingegen weiß das menschliche Gewissen um seine Pflicht, seine eigene Handlung mit der Allgemeinheit in Übereinstimmung zu bringen. Diese Pflicht gründet daher auf dem religiösen Gehalt des Gewissens ebenso wie des unglücklichen Bewusstseins, das als das religiöse Bewusstsein bezeichnet werden kann. Da es im Grunde keinen Bezugspunkt auf die konkrete Handlungssituation gibt, tritt das Gewissen mit Hegels Worten als „das negative Eins“ auf, das das Selbst durch die negative Vertilgung der hin– und hertreibenden Verlegung wiederherstellt und deshalb „einfaches pflichtmäßiges Handeln“ ist, das der Gestalt des moralischen Bewusstseins zugrunde liegt. (PhdG. S. 467) Doch wenn das Gewissen von vornherein mit dem 126 menschlichen Handeln verknüpft ist, handelt es sich hier keinesfalls um die in sich verborgene reine Pflicht, sondern die tatsächliche Pflichterfüllung durch den Handelnden selbst, da jeder Handelnde immer schon das Handlungskriterium, das als Handlungszweck und –pflicht verfolgt werden soll, nicht nur in sich selbst hat, sondern auch von sich selbst die Erfüllung dieses Kriteriums als Handlungszweck im realen Handlungsverfahren erwartet. Der Handelnde, der seinem Gewissen gemäß danach sucht, was er in einem konkreten Fall tun soll, nimmt die reine, aber nur formale Pflicht, aus Hegels Sicht, als „das wesentliche Moment“ zur Handlung an. Dennoch handelt es sich bei seiner Annahme lediglich um die eigene Überzeugung von dieser Gewissenhaftigkeit, da die von seinem Gewissen gesuchte Pflicht in diesem Moment inhaltslos ist, d. h. den Handlungsbezug zur Realität verloren hat. Aus diesem Grund muss der Handelnde sich selbst notwendigerweise in die reale Handlungssphäre integrieren, um seine Pflicht zu erfüllen, „sich zu anderen zu verhalten“. (PhdG. S. 470) Seine eigene „Überzeugung des Gewissens von ihr“ (= der reinen Pflicht, KBL), soll der Handelnde von nun an in den Handlungsräumen der wechselseitigen Anerkennung den Anderen mitteilen können, die ebenso wie er ihre eigene Überzeugung vom Gewissen haben. (Ebd.) Denn diese Überzeugung ist im wesentlichen bei jedem Handelnden als Maxime für seine ethischmoralische Handlung verantwortlich. In diesem Fall muss das pflichterfüllte Gewissen durch die von der eigenen Überzeugung realisierten Handlung von den Anderen als Handlungspartner anerkannt werden. Da die menschliche Handlung auf der eigenen Überzeugung von der gewissenhaften Pflicht im realen Handlungsspielraum basiert, gründet sie sich zugleich auf die freie Willensentscheidung, die der Gewissensfreiheit zugrunde liegt. Mit Hilfe der Verwirklichungs– und Konkretisierungsfunktion der Handlung überträgt das Gewissen seine verpflichtende Maxime für die ethisch-moralische Haltung in die Wirklichkeit, bringt seine private Überzeugung von der reinen Pflicht im gemeinsamen Gespräch mit Anderen zur Sprache. Die in Sprache übersetzte Handlung wird geradezu zu einem Verstehensgegenstand und regt zugleich die verständliche Einschätzung der Anderen an, die sich auf die eigene Gewissheit über die reine Pflicht bezieht. In diesem Handlungsnetzwerk, das die wechselseitige Verständigung über sämtliche existierende Handlungsweisen ermöglicht, konfrontiert das handelnde Gewissen sich nunmehr mit der allgemeingültigen Pflicht, weil seine Gewissheit über die ethisch-moralische Handlung zunächst von der gemeinschaftlichen Moralvorstellung als dem Stützpunkt jeder einzelnen Gewissheit abhängt: Wenn ein nach seinem Gewissen handelndes Individuum z. B. seine eigene Überzeugung von den gültigen Handlungsnormen auf den Raum der Handlungsgemeinschaft ohne den Widerspruch gegen die allgemeine Pflicht übertragen will, 127 kann ein solcher Handlungsanspruch nur dann erfüllt werden, wenn die eigene Überzeugung entweder mit den vorgegebenen Handlungsnormen der Gemeinschaft von vornherein übereinstimmt oder die Gemeinschaft die Freiheit des Handlungsindividuums auf der Basis ihrer institutionalisierten Freiheitsidee bedingungslos anerkennt und akzeptiert. Aber ein solcher Handlungsanspruch enthält immer auch die Gefahr zum unauflösbaren Konflikt zwischen den beiden Handlungsparteien, nämlich zwischen Ich und Du bzw. zwischen Ich und Wir: Die private Gewissheit über die ethisch–moralische Handlungsweise wäre einerseits beim anderen Handlungspartner im anerkennungsbedürftigen Spielraum unakzeptabel. Darüber hinaus könnte die durch die private Gewissheit angestoßene Handlung andererseits immer gegen das allgemein öffentliche Moralbewusstsein verstoßen. Denn die Gewissheit über das Ethische und das Moralische ist hier im Grunde privatisiert, obwohl sich die ethisch– moralische Handlung immer schon in der tradierten Gemeinschaft befindet. Im Angesicht dieser permanent existierenden Gefahr ist das Gewissen unweigerlich in die Partikularität, die verschiedenen Standpunkte verstrickt. An dieser Stelle erkennt das Handlungsgewissen seine Besonderheit im Gegensatz zu den Anderen. Durch diese Besonderheit ist es sich sowohl seiner selbst als auch eines Anderen bewusst. Das Gewissen läßt sich auf das gegenseitige Wechselspiel über. diesem Anerkennungsverhältnis In ein, geht Wechselspiel in ein treten wechselseitiges die einander gegenüberstehenden Extreme, „das handelnde Bewußtsein“ und „das beurteilende Bewußtsein“ bei Hegel auf. (PhdG. S. 488) Wenn auch ein gewissenhaft handelndes Individuum, mit Hegels Worten das handelnde Bewusstsein, die Tatsache als das Resultat seiner Handlung für ethisch, moralisch pflichtgemäß hält, kann der die Handlungstatsache beurteilende Andere, der seinerseits auch seine eigene Handlungsmaxime hat, einer solchen Selbsteinschätzung widersprechen. Was das handelnde und das beurteilende Gewissen betrifft, verkündet das beurteilende Gewissen ungeachtet der Tatsache, dass es keinen legitimen Maßstab für sein Urteil vorlegen kann, dass das handelnde Gewissen böse und heuchlerisch sei. Das handelnde Gewissen hingegen argumentiert, dass seine Handlungstatsache im Prinzip der allgemeingültigen Pflicht angemessen sei. Dieses widersprüchliche Phänomen betreffend sagt Hegel: „Diesem Festhalten an der Pflicht gilt das erste Bewußtsein als das Böse, weil es die Ungleichheit seines Insichseins mit dem Allgemeinen ist, und, indem dieses zugleich sein Tun als Gleichheit mit sich selbst, als Pflicht und Gewissenhaftigkeit ausspricht, als Heuchelei.“ (PhdG. S. 485) 128 Von Seiten des handelnden Gewissens hingegen ist das beurteilende Gewissen böse und heuchlerisch, da das handelnde Gewissen nach seiner eigenen Überzeugung von der reinen Pflicht das Beurteilende verurteilt, so wie das beurteilende Gewissen die Tat des handelnden Gewissens beurteilt hat. An dieser Stelle wirft das handelnde Gewissen dem beurteilenden vor, seine Tat zu verurteilen, obwohl dem beurteilenden Gewissen selbst „die Kraft der Entäußerung“, gewissermaßen die Kraft der Verwirklichung der Pflicht fehlt. Außerdem ist das beurteilende Gewissen in die peinliche Situation geraten, „die Herrlichkeit seines Inneren durch Handlung und Dasein zu beflecken.“ (PhdG. S. 483) Nach einem solchen Ereignis der extremen Polarität zwischen beiden Parteien begeben sich sowohl das handelnde wie auch das beurteilende Gewissen auf den Weg von der steifen Unmittelbarkeit hin zur sittlichen Bildung bzw. der miteinander versöhnenden Anerkennung. Sobald die Einseitigkeit, zu der die beiden Extreme verdammt waren, zu Tage kommt, wird das gewisse Wissen, das jedem der Pole fehlt, die beiden zwingen, sich selbst ins anerkennende Wechselverhältnis bzw. in die aufeinander bezogene Selbstverzichtsleistung zu begeben. Hier wird sich das wechselseitige Anerkennungsverhältnis wie folgt darstellen: Zunächst schlägt das beurteilende Gewissen als „schöne Seele“ bei seiner Beurteilung über das handelnde Gewissen auf zwei Arten ins Böse um: Indem das beurteilende Gewissen einerseits hartnäckig auf seiner Gewissheit besteht, mit Hegels Worten „das harte Herz“ nicht aufgibt, verliert es von selbst seine Potenz der praktischen Applikation, obwohl das handelnde Gewissen es so formuliert, dass die jetzige Tat vom allgemeingültigen Moralbewusstsein getrennt ist. (PhdG. S. 484 u. S. 490) Andererseits will das beurteilende Gewissen seine Handlungslähmung und seine Scheu nicht zugeben, die vom handelnden Gewissen verurteilt wird. Hinsichtlich dieser Ablehnung des Eingeständnisses seiner Handlungslosigkeit und seiner Schüchternheit verfällt das beurteilende Gewissen ebenso wie das handelnde in „das böse Bewußtsein“, weil es sich selbst seiner Einseitigkeit noch nicht bewusst ist. (PhdG. S. 485) Von daher steht sich das beurteilende Gewissen selbst im Weg, gelangt zwangsläufig in die zwiespältige Situation, entweder seine versteinerte Gewissheit, „das harte Herz“ aufzugeben oder von dem handelnden Gewissen anerkannt zu werden. Die Anerkennung und die Aufgabe, die in diesem Moment ausgeführt werden muss, kann bei Hegel nur dadurch zustande kommen, dass beide Gewissen bereit sind, Verzicht zu üben. Anders gesagt, muss das beurteilende Bewusstsein mit dem Eingeständnis seiner Unfähigkeit, die zu erledigenden Dinge nicht erledigen zu können, seine Schuld zugeben, die durch sein hartnäckiges Bestehen auf seiner Haltung zustande gekommen war. Gleichzeitig mit diesem 129 Akt muss er dem handelnden Bewusstsein verzeihen. Umgekehrt muss das handelnde Bewusstsein seine Bosheit, die sich aus der Trennung von dem allgemeingültigen Moralbewusstsein ergibt, bekennen und das beurteilende Bewusstsein als „schöne Seele“, die Hegels Äußerung zufolge die „göttliche Stimme“ in der religiösen Gemeinde ist, anerkennen. (PhdG. S. 481) In Bezug auf diese Vergebung und die versöhnende Anerkennung sagt Hegel in den folgenden Sätzen: „Die Verzeihung, die es dem ersten widerfahren läßt, ist die Verzichtleistung auf sich, auf sein unwirkliches Wesen, dem es jenes Andere, das wirkliche Handeln war, gleichsetzt und es, […] Böses genannt wurde, als gut anerkannt oder […], wie das Andere das fürsichseiende Bestimmen der Handlung.“ (PhdG. S. 492) Weiter setzt er fort: „Das Wort der Versöhnung ist der daseiende Geist, […] - ein gegenseitiges Anerkennen, welches der absolute Geist ist.“ (PhdG. S. 493) Wenn wir diese Sätze Hegels wörtlich nehmen, nämlich dass „das Wort der Versöhnung der daseiende Geist“ ist und „ein gegenseitiges Anerkennen, welches der absolute Geist ist“, in der Selbsthingabe und der Selbstaufopferung zu finden ist, dann können wir m. E. feststellen, dass das Gewissen zunächst, wie bereits erwähnt, seine überzeugte Gewissheit der reinen Pflicht durch die Sprache zum Ausdruck bringt, nämlich die eigene Überzeugung der Pflichtmäßigkeit durch die Sprache zu rechtfertigen sucht. Im Gesprächsverhältnis hat die schöne Seele das Bekenntnis des handelnden Gewissens „vernommen“ und zugleich durch diesen Akt des Zuhörens die Handlungstatsache verstanden, dem Bösen verziehen und wieder für gut befunden. Darüber hinaus erfährt das handelnde Gewissen, dass das beurteilende Gewissen als die schöne Seele im Verlauf des gegenseitigen Wechselspiels zugrunde geht, so lange es lediglich an seiner inhaltslosen reinen Pflichtmäßigkeit festhält und es nur durch seine Anerkennung bzw. durch sein Ja–Sagen Eingang in die konkrete Wirklichkeit findet. 119 Man kann sagen, dass die beiden Extreme, die zu Beginn ohne eine gemeinsame Wechselbeziehung ausschließlich mit ihrem gegenseitigen Widerstand beschäftigt waren, sich durch die sprachliche Übereinstimmung gegenseitig verzeihen, ihre Bekenntnisse vernehmen 119 Vgl. Heidrun Hesse, „Institution und Anerkennung – Zur Aktualität eines Hegelischen Begriffs“, in: Metaphysik und Hermeneutik – Festschrift für Hans–Georg Flickinger zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Heinz Eidam u. a., Kassel 2004, S. 351 – 363. 130 sowie ihre wechselseitige Anerkennung, „deren Echo“, wie Hegel sagt, zu sich selbst verhallend „zurückkommt.“ (PhdG. S. 483) Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die Sprache selbst als Vermittler zwischen beiden Polen und zwischen dem einzelnen Selbstbewusstsein und dem allgemeinen Selbstbewusstsein in Hegels Gewissensdialektik eine entscheidende Rolle spielt, 120 da sie, wie bereits erwähnt, ihre ethische Versöhnungsfunktion und ihre gemeinschaftliche Bindungskraft im gegenseitigen Gespräch, das wir insbesondere im III. Teil dieser Arbeit unter Gadamers dialoghermeneutischer Perspektive noch näher betrachten werden, entfaltet. Diesbezüglich schreibt Hegel selbst: Die Sprache ist „das Dasein des Geistes“, und „[sie] tritt nur als die Mitte selbständiger und anerkannter Selbstbewußtsein[e]“ auf. (PhdG. S. 478 u. S. 479) Ausgehend von den bisherigen Überlegungen können wir m. E. behaupten, dass die intersubjektive Versöhnung von vornherein immer auf die sprachliche Bejahung ausgerichtet ist, dass die wechselseitige Anerkennung selbst ein Ausdruck des absoluten Geistes ist und dass der absolute Geist umgekehrt selbst ein Sinnganzheitshorizont der wechselseitigen Anerkennungsbeziehung ist. Die moralische Gemeinsamkeit zwischen den beiden, die wir nun als den absoluten Geist bezeichnen können, wird bei Hegel durch das Hören auf das Schuldbekenntnis und den Akt der Verzeihung, durch die intersubjektive Anerkennung, wiederhergestellt. Diesbezüglich schreibt Hegel am Schluss dieses Kapitels: „Das versöhnende Ja, worin beide Ich von ihrem entgegengesetzten Dasein ablassen, ist das Dasein des zur Zweiheit ausgedehnten Ichs, das darin sich gleich bleibt und in seiner vollkommenen Entäußerung und Gegenteile die Gewißheit seiner selbst hat; - es ist der erscheinende Gott mitten unter ihnen, die sich als das reine Wissen wissen.“ (PhdG. S. 494) In diesem Zusammenhang geht die Stufe der Selbstentwicklung des Geistes in der Phänomenologie mit der Verzeihung des Bösen und der Aussprache über das Bekenntnis der Einseitigkeit zur Religion über. „Der erscheinende Gott“, nämlich die Offenbarungsreligion, taucht von nun an bei Hegel als ein Vermittler zwischen dem einzelnen Moralbewusstsein und dem allgemeingültigen Moralbewusstsein bzw. der allgemeinen und öffentlichen Moralvorstellung auf. Auf der Basis dieser göttlichen Vermittlung wird die Entzweiung zwischen den beiden Extremen durch die Gottesliebe und die göttliche Verzeihung des Bösen überwunden und kommt zurück zur einheitlichen Versöhnung in der Liebesgemeinde, wie Hegels berühmtes Diktum besagt: „Die Wunden des Geistes heilen, ohne daß Narben 120 Vgl. L. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 129 – 131. 131 bleiben.“ (PhdG. S. 492) Nach ihrem Eintritt in die Gemeinschaft der Liebe setzen die beiden ihren reflexiven Weg der Selbstkorrektur fort und haben dabei die gesamten Lebensbezüge der Lebendigen permanent vor Augen. Die vollständige Anerkennung als die reziproke Selbstbeziehung des Geistes in der Gewissensdialektik liegt deshalb der „ewigen Liebe“ Gottes zugrunde. Mit anderen Worten: Die harmonische Übereinstimmung der individuellen Gewissensfreiheit mit der gesellschaftlichen Lebensordnung kommt, nach Hegels Ansicht, in der Gemeinschaft der Liebe, die die ideelle Gottesverzeihung und Gottesliebe als die konstruktive Vollständigkeit der Wechselbeziehung des Geistes auf sich selbst verwirklicht, zustande. (PhdG. S. 574) In diesem Zusammenhang wird klar, dass das selbständige Selbst, das von vornherein über die Freiheit seines Gewissens verfügt, sich in der harmonischen Übereinstimmung mit dem sittlichen Gewissen seinen freien Handlungsspielraum schafft, in dem es einerseits seine freie Willensentscheidung gegen die totalitäre Herrschaftsgesellschaft verteidigen und andererseits die freiwillige Integration ins öffentliche Normenordnungssystem ausüben kann. Vor diesem überindividuellen Sinnhorizont ist das Allgemeine dem Einzelnen nicht mehr fremd, sondern vielmehr ist das Allgemeine geradezu das Einzelne, mit Hegels Worten: „Ich im Wir“ und „Wir im Ich“. Ein solcher lebendiger Sinnganzheitshorizont, in dem das Wir mit dem Ich und das Ich mit dem Wir wechselseitig verbunden ist, in dem wir immer schon leben, mit dem wir immer schon vertraut sind, wird zunächst zum Netzwerk der Realisierbarkeit der Freiheit. Es wird deutlich gezeigt, dass alle Beteiligten an dieser Handlungssphäre bereits in „die Solidarität des sittlichen Geistes“, „die Gemeinsamkeit der Sitte“, die das menschliche Zusammenleben ermöglicht, eingetreten sind. (GW. 3, S. 63) 121 Denn wenn die gemeinschaftliche Solidarität und die menschliche Verbindlichkeit bedroht oder zerstört sind, dann muss der freie Handlungsspielraum, den alle Handlungssubjekte verteidigen und erhalten wollen, notwendigerweise verschwinden. Um unseren freien Handlungsspielraum weiter zu erhalten, sind wir deshalb aufgefordert, unsere zwischenmenschliche Solidarität unter Beweis zu stellen und zu bewahren. Denn das Wir wird durch das Ich in diesem solidarischen Gemeinschaftsraum nicht nur errichtet, sondern auch konkretisiert und umgekehrt hat das Ich das Wir nur auf dieser ontologischen Grundlage für das menschliche Zusammenleben erkannt und anerkannt. Bisher haben wir insbesondere in Anknüpfung an Gadamers Denkansatz gesehen, wie das Selbstbewusstsein seine Selbständigkeit und seine Freiheit im gegenseitigen Anerkennungsverhältnis zum allgemeinen Willen erkennt, inwiefern der ontogenetische 121 Vgl. damit auch Otto Pöggeler, Hegels Idee, S. 289. 132 Selbstausbildungsprozess des Selbst auf den Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit angewiesen ist; womit die Bewegung der Anerkennung ausgeführt wird und von welcher Bedeutung das Lebensganze der Lebendigen für die Verwirklichung der Anerkennung ist. Nun werden wir uns Gadamers Rezeption der Hegelschen Anerkennungstheorie zuwenden, aufgrund derer Gadamer unter besonderer Berücksichtigung des Hegelschen Begriffs vom „Leben“ seine Hermeneutik konzipiert hat. Den vereinigten Sinnganzheitshorizont vom sich selbst ausbildenden Selbst und dem Wir, dem allgemeinen Willen, entnimmt Gadamer jedoch weder dem Endstadium der Phänomenologie, noch dem späten Hegel, sondern dem frühen Hegel, insbesondere Hegels Jugendschriften der Frankfurter Zeit. (GW. 3, S. 50) 122 Mit anderen Worten: Gadamers Einsicht in Hegels Begriff des Lebens richtet sich nicht auf „das absolute Wissen“ als einen Endzweck der total vermittelten „Reflexion in sich“, die von vornherein die in sich verschlossene Selbstgewissheitsstruktur innehat, - das können wir als „die abgeschlossene Absolutheit der Reflexivität in Hegels Systemphilosophie“ bezeichnen -, sondern auf die Lebensganzheit als die vollständige Vereinigung zugunsten der Liebe, wie sie Hegel in seiner Frankfurter Zeit formuliert hat. Trotz seiner teleologischen Züge scheint sich der Begriff des Lebens auch für Hegel als eine unendliche Bewegung, die nicht zum Ende kommt, darzustellen. Aus diesem Grund hat Hegel in seiner Phänomenologie das Lebensganze als „die Entzweiung in die selbständigen Gestalten“ und „das sich entwickelnde und seine Entwicklung auflösende und in dieser Bewegung sich einfach erhaltende Ganze“ beschrieben. (PhdG. S. 140 u. S. 142) So zeigt Hegel, dass das Leben seinen inneren Urquell, der das Leben immer wieder lebendig macht, hat. Im Hinblick auf diese Bestimmung des Lebens bei Hegel weist Gadamer darauf hin, dass das Leben als ein endlos aufeinander bezogenes Ganzes als „die Weise des Fortbestands der Gattung“ verstanden werden muss und dass das einzelne Selbst als das Lebendige zugleich auch „die Strukturidentität“ des Lebensganzen aufweist. (GW. 3, S. 50 – 51) 123 Anders formuliert, entfaltet das Selbst dieselbe zirkuläre Bewegung zwischen der Selbstdifferenzierung und der Rückkehr zu sich selbst, die das Lebensganze ausmacht. So beschreibt Gadamer die Wechselbeziehung zwischen dem Ich und dem Wir so, dass „es (= das Selbstbewusstsein, KBL) seine Identität als >Lebendiges< nur in der beständigen Auflösung des Anderen und Selbstauflösung in das Andere hat, als Teilhabe an der Unendlichkeit, dem Kreislauf des Lebens.“ (GW. 3, S. 52) In diesem Lebensvollzug versöhnt 122 123 Vgl. ders., „Selbstbewußtsein und Identität“, in: Hegel – Studien, Bd. 16, hrsg. v. Friedhelm Nicolin und ders., Bonn 1981, S. 194. Hier weist er auf das Verhältnis der Jugendschriften Hegels zum Kapitel „Selbstbewusstsein“ in der Phänomenologie im eigenen Interpretationsvorgang hin. Vgl. H. Marcuse, Hegels Ontologie, S. 270. 133 sich das gebildete Selbst nunmehr mit der Fremdheit des Anderen und entwickelt seine Ich– Identität aus der Begegnung mit dem fremden Anderen heraus weiter. An dieser Stelle können wir feststellen, dass der Lebensvollzug, der nur durch die Verwirklichung und Konkretisierung des eigenen Lebenssinns erreicht werden kann, immer im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben steht und dass jeder Handlungsvollzug in der Folge durch die interaktive Anerkennungsbeziehung innerhalb der gesamten Lebensbezüge stattfindet. Vor diesem Hintergrund des ganzen Lebenszusammenhangs fasst Hegel in seiner Frankfurter Zeit, in der die Liebe als Versöhnungsfunktion und Verbindlichkeitskraft zwischen den Getrennten verstanden wurde, den Begriff des Lebens aus einer ontologischen Perspektive ins Auge. Hier schreibt Hegel über das Leben: „[…] in der Liebe ist dies Ganze nicht als in der Summe vieler Besonderer, Getrennter enthalten; in ihr findet sich das Leben selbst, als eine Verdopplung seiner selbst, und Einigkeit desselben; das Leben hat, von der unentwickelten Einigkeit aus, durch die Bildung den Kreis zu einer vollendeten Einigkeit durchlaufen; […]“ (Früh., S. 246, Meine Hervorhebung) Hier fungiert die Liebe, wie der zitierte Satz zeigt, in Form eines grenzenlosen Assimilationsprozesses, der das eine Selbst an das andere und das Einzelnen an das Allgemeine angleicht, so dass schließlich ein vereinigter Lebensganzheitshorizont entsteht. Die Liebe verfügt über die Fähigkeit, auf dem Weg zum Lebensganzen, Grenzen zu überschreiten und den Liebenden und den Geliebten zur gegensatzlosen Versöhnung zu führen, da sie beide Liebenden in ein vereinigtes Gefühl ohne die negative Aufhebung der differenten Individualität hineinführt. Kurzum, in der Liebesbeziehung sind die Betroffenen zwar selbständig, also individuell verschieden, doch sind sie durch das Liebesgefühl zugleich eins: Deshalb fühlt das Lebendige in der Liebe das andere Lebendige und findet sich selbst in diesem geliebten Lebendigen wieder. So ist die Liebe das miteinander verbundene Gefühl, in dem die gesamte Lebendigkeit des Liebenden widerhallt und wiederhergestellt wird. Von daher verfügt das eine Selbst über die intime Verbindlichkeit mit dem anderen in seinen ganzen Lebensbezügen. Mit Hilfe der Versöhnung und der bindenden Kraft der Liebe, erlangt das Leben die „vollendete Einigkeit“, durch deren Licht es die eigene Fremdheit und die in sich selbst bestehende Verschiedenheit in sich selbst wieder einbettet. Auf dem Weg von einem einzelnen Lebendigen zum Lebensganzen ist die Liebe deshalb mit ihrer außerordentlichen Orientierungskraft, Gadamers Ansicht zufolge, „nicht eine abstrakte, sondern eine konkrete 134 Allgemeinheit.“ (GW. 4, S. 390) Vor diesem gemeinsamen Horizont des „ungeteilten Lebens“, vor dem die Getrennten eins sind, haben das Ich und das Du grundsätzlich verschiedene Eigenschaften und Eigentümlichkeiten. Ohne ihre jeweilige Selbständigkeit zu verletzen, üben sie in der unmittelbaren Begegnung einen wechselseitigen Einfluss aufeinander aus und gestehen sich die vollständige gegenseitige Anerkennung zu. So wird verständlich, dass das Lebensganze im Grunde von einer ursprünglichen Urquelle, die längst vor allen Reflexionen besteht, aus der alle Lebendigen entstehen und in die sie alle immer schon integriert sind, ausgeht. Vor diesem existenziell ontologischen Hintergrund versetzen sie alle das eigene Leben auf die Ebene des Lebensganzen, sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Lebensganzen, d. h. sie nehmen in Form dieser Auseinandersetzung am gemeinsamen Sinnhorizont der Lebensganzheit teil. Nun zeigt sich das Lebensganze auch als die vollendete Gemeinsamkeit, zu der alle Getrennten zurückkehren, mit der sie permanent eins werden. Mit Gadamers Rekurs auf den frühen Hegel betrachtet, läßt sich hiermit sagen, dass Gadamer besonders aus seiner ontologischen Perspektive die symmetrische Struktur in Hegels Anerkennungstheorie entdeckt. Denn ich schaue mich selber in der unmittelbaren Begegnung mit dem Du an, d. h. finde in diesem Liebesgefühl gleichermaßen mich wie Dich. Und dann finde ich in der unmittelbaren Begegnung mit meinem Anderen außerdem das Wir als die ontologische Grundlage für meine Existenz vor. Insofern kommt der allgemeine Wille zur Selbstentäußerung in der tätigen Teilnahme der Einzelnen und in der gewissen Teilhabe an den Einzelnen zum Vorschein. Das ontologische Zusammenleben, das sich im wechselseitigen Anerkennungsverhältnis etabliert, ist deshalb ein ausgezeichneter Ort, an dem wir uns, ohne sich die unaufhebbare Andersheit des Anderen zu eigen zu machen, miteinander verbinden und zueinander verhalten können. Gadamers Grundkonzeption innerhalb des Diskussionsrahmens der gesellschaftstheoretischen Philosophie nochmal zusammengefasst, ist das ontologische Lebensganze als der gesamte Sinnhorizont der gemeinschaftlichen Solidarität und Freundschaft, die sich auf die zwischenmenschliche Vertrautheit und Verlässlichkeit, gewissermaßen die Liebesbeziehung stützt, die Bedingung für das menschliche Zusammenleben. Doch ist es auch eine Tatsache, dass sich die Herkunft selbst mit ihrer je individuellen geschichtlichen Lebensweise permanent auf die gegenwärtige Lebenslage überträgt. Da die geschichtlich überlieferten Sitten den Anspruch auf praktische Anwendung im konkreten Handlungsraum erheben, leisten sie damit die grundsätzliche Funktion, jeder Handlungsweise einen Orientierungsrahmen zu liefern, d. h. jedem Handelnden einen bestimmten Wegweiser zu geben. Aufgrund dieser Anwendungsleistung sind sie aber auch in 135 einer flexiblen und variablen Handlungssituation eingebunden. Die herkömmlichen Sitten selbst erfüllen deshalb im angemessenen Umgang mit dem konkreten Fall ihren Geltungsanspruch. In demselben Sinn wird das Lebensganze von allen Lebendigen als den Teilen konstituiert. Gleichwohl finden die Teile nur in ihrem Ganzen ihre ontologische Grundlage: Sie haben nur mit ihm zusammen ihre existenzielle Seinsmöglichkeit. Das Ganze ist mithin nicht ein bloßes Aggregat der Teile, sondern wird zur ontologischen Basis für das Sein der Teile, hat auch die Teile zu seiner konkreten Wirklichkeit. Gadamers Einsicht in den Lebensganzheitshorizont für alle Lebendigen, die an Hegels früher Auffassung vom Leben angeknüpft, weist schließlich darauf hin, dass die Handlungssubjekte die allgemeine Gemeinsamkeit durch die eigene Tätigkeit aufbauen, dass die Gemeinde, der Verband, der Club usw. als die allgemeingemeinsame Handlungssphäre nur durch die Teilnahme der einzelnen Teile, nämlich durch die Anerkennung der Mitglieder bzw. den Respekt der Teile auf das Ganze erhalten werden kann. Das führt auch zu der Konsequenz, dass ich um meiner selbst willen Dich als meinen Partner annehme und damit das Wir auch als ein mich und Dich schützendes Netzwerk erkenne. 136 Exkurs zur Ethos–Ethik: Die Sittlichkeit als eine Lebensform (Rüdiger Bubner) Wenn die Verwirklichung unseres freien Willens von der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Institution abhängig ist, in der wir bereits leben, muss die Frage formuliert werden, wie die gesellschaftlichen Normen oder die normativen Institutionen begründet werden können und ob die Möglichkeit der Normenbegründung mit der „transzendentalen Formalität“ oder mit der „vorgegebenen und zu entwerfenden Geschichtlichkeit“ zu tun hat. Jene Tendenz liegt nahe an der idealen, ahistorischen Konstruktion der gesellschaftlichen Normativität jenseits der Geschichte des menschlichen Zusammenlebens, an dem wir schon immer beteiligt sind. Diese hingegen richtet sich auf die geschichtlichen Zusammenhänge als eine ontologische Bedingung für den Aufbau und die Verbesserung der Normen, die unsere Handlungen stets anleiten. Bei der Darstellung der strittigen Kontroverse zwischen „Moralität und Sittlichkeit“, möchte ich in diesem Exkurs insbesondere Bubners Argumentationsgang bzg. des Zusammenhangs zwischen Normen und Geschichte nachzeichnen. Im Ablauf dieser Debatte tendiert Habermas dazu, seine Diskursethik auf den Kantischen Formalismus zu stützen, während R. Bubner m. E. den „Bildungsanspruch,“ „die Normengeschichtlichkeit“ und „die Übersetzbarkeit der Normen“ im Zusammenhang mit der klassischen Philosophie, vor allem Hegels Sittlichkeit und der Idee der praktischen Philosophie in der philosophischen Hermeneutik, darstellt. 124 Ich möchte in diesem Exkurs allerdings versuchen, Bubners Konzept der historisch geprägten Sittlichkeit nachzuvollziehen, das den Hegelschen Einwand gegen Kants formalistische, gewissermaßen „deontologische“ Moralität wieder aktuell werden läßt. Mit dieser Aktualisierung der Hegelschen Sittlichkeit erhebt Bubner auch den Einspruch gegen die moralische Formalität in Habermas’ Diskursethik. Diesbezüglich versucht er die handlungsorientierten Gesellschaftsnormen auf die Geschichtlichkeit und die Gewohnheit zu stützen. Um Bubners Argumentationsgang noch präziser zu veranschaulichen, 124 Vgl. Herbert Schnädelbach, „Was ist Neoaristotelismus?“, in: Moralität und Sittlichkeit – Das Problem Hegels und die Diskursethik, hrsg. v. Wolfgang Kuhlmann, Frankfurt a. M. 1986, S. 38 - 63, und dazu, Jürgen Habermas, „Über Moralität und Sittlichkeit – Was macht eine Lebensform >rational<?“, in: Rationalität, hrsg. v. Herbert Schnädelbach, Frankfurt a. M. 1984, S. 218 - 235, insbesondere S. 227. H. Schnädelbach hat zunächst die gegenwärtigen Vertreter und Anwälte der Hegelschen Sittlichkeit gegen Kants transzendentale Moralphilosophie unter dem Namen des „Neoaristotelismus“ zusammengefaßt, weil sie, seiner Ansicht zufolge, im engeren Denkzusammenhang mit den Aristotelischen Ansätzen zur praktischen Philosophie die Hegelsche Konzeption der Sittlichkeit wiederherzustellen versuchen. Davon abgesehen erhebt Jürgen Habermas in seinem Aufsatz gegen Bubners Konzeption von Sittlichkeit einen scharfen Einwand. Seiner Auffassung zufolge stelle Bubner weder „die Sittlichkeit, die den Horizont einer jeweils gegebenen Lebenswelt“ übertritt, noch „den hermeneutischen Traditionalismus“ dar, sondern vielmehr habe Bubner nur die neoaristotelische Konzeption von der vernünftig konstruierbaren Ethos–Ethik mit der Grundprämisse entwickelt, dass das Gute bereits in der Welt sei. 137 werde ich zunächst die „kognitivistische und formalistische Ethik“ 125 von Habermas pointieren. Im Anschluss an diese zusammenfassende Darstellung der transzendentalpragmatischen Diskursethik, werde ich Bubners Einsicht in die subjektive Handlungsfähigkeit, den Gesellschaftsnormen angemessen zu handeln, nach folgenden begrifflichen Kriterien Schritt für Schritt abhandeln: Den Rückgriff auf die vom Ethos hergeleitete Ethik, den sittlichen Anspruch auf den ineinander übergehenden geschichtlichen Bildungsprozess, die Geschichtlichkeit von Normen und schließlich die Übersetzbarkeit der Maximen in die historisch geprägten Normen. Um seine Diskursethik gegen Bubners Einspruch zu verteidigen, geht Habermas von der schlichten Bezugnahme auf Hegels Kritik an Kants Moralphilosophie in den folgenden vier Punkten aus: 1. Die inhaltliche Leere des Formalismus der Kantischen Ethik. 2. Ihr abstrakter Universalismus, aus dem Anwendungsprobleme hinsichtlich des kategorischen Imperativs folgen, da diese Allgemeingültigkeit des kategorischen Imperativs stets über die einzelnen, konkreten Realitäten hinausgeht. 3. In diesem Kontext liegt auch die Ohnmacht des bloßen Sollens. Denn das moralische Sollen entfernt immer vom Sein, das als eine wirkliche Lebensform des menschlichen Daseins in der Welt bezeichnet werden kann und die fragwürdige Trennung zwischen Sollen und Sein besteht damit notwendigerweise in der Frage, ob das Sollen das wirkliche Sein tatsächlich hin– und herbewegen kann oder ob das Sein dem fremden Sollen unbedingt unterworfen werden muss. 4. Aus dieser Trennung resultiert schließlich die Gefahr des Terrorismus der reinen Gesinnung. 126 Unter diesem Gesichtspunkt, der einerseits Hegels Einwand gegen Kants praktische Philosophie aufnimmt und sich andererseits teilweise der Geschichtlichkeit der Sittlichkeit in Hegels praktischer Philosophie versichert, richtet Habermas’ Versuch sich in Bezug auf Kants Transzendentalphilosophie auf die Ausformulierung seiner transzendentalpragmatischen Diskursethik. In diesem Umgang mit Kants Moralphilosophie glaubt er auf die Probleme der Letztbegründung der Moralität erneut konstruktiv antworten zu können. Um die Kognitivität und die universelle Formalität der Diskursethik darzustellen, stellt Habermas die bedingte Voraussetzung für die Normbegründung wie folgt dar: 125 Vgl. J. Habermas, „Moralität und Sittlichkeit. Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu?“, in: Moralität und Sittlichkeit – Das Problem Hegels und die Diskursethik, hrsg. v. Wolfgang Kuhlmann, Frankfurt a. M. 1986, S. 17-18. 126 Vgl. Ebd., S. 16. 138 „Jede gültige Norm muß der Bedingung genügen, daß die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen jedes Einzelnen voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen zwanglos akzeptiert werden kann.“ Aus dieser allgemeingültigen Voraussetzung glaubt er auch die folgende Hypothese der Diskursethik ableiten zu können: „Jede gültige Norm müßte die Zustimmung aller Betroffenen, wenn diese nur an einem praktischen Diskurs teilnehmen würden, finden können.“ 127 In Bezug auf die beiden Grundsätze, die Geltungsansprüche erhoben haben, sollen die Gesellschaftsnormen, die den Institutionen innewohnen, nach Habermas überprüft werden. Mit anderen Worten: Wir könnten so verstehen, dass die handlungsorientierten Normen innerhalb der Lebenswelt nur durch den postulierten Aufruf zum theoretischen Sollen wieder moralisch gerechtfertigt werden können. In diesem Zusammenhang spricht Habermas analog zur erkenntnistheoretischen Wahrheit von der „kognitiven Ethik“, 128 ohne jedoch auf die Frage einzugehen, wie dieses erkennende Subjekt die mit den gesamten Handlungszusammenhängen verflochtenen Normen beurteilen und rekonstruieren kann. Diese Urteilsform des erkennenden Subjekts muss sich deshalb ausschließlich auf die unhintergehbare Subjektivität gründen, wenn die Normen lediglich gemäß einem transzendentalen Moralprinzip vom Subjekt gedacht und verstanden werden. Dadurch, dass Habermas von einer Gleichsetzung der moralischen Handlungsfähigkeit des Subjekts und seinem Erkenntnisvermögen ausgeht, erstreckt sich seine Diskursethik schließlich auf den nicht tragbaren Anspruch ans Subjekt. Anhand der obigen Hauptthesen will Habermas die „Formalität und Universalität“ seiner Diskursethik beweisen. Die Formalität entspricht der menschlichen Vernunft, da alle Beteiligten an den Kommunikationsprozessen, die dem moralischen Sollen gemäße Normen erfüllen können müssen. Umgekehrt sollen alle Menschen die Normen begründen können müssen, wenn sie „ein vernünftiges Wesen“ sind. In diesem Kontext betrachtet Habermas alle Subjekte, die an den Kommunikationen beteiligt sind, so, dass ihre Tendenz auf die Verbesserung der Argumentationssituation und die kooperative Suche nach der Wahrheit abzielt, da sie bereits die vernünftig Urteilenden sind. Mit der Einsicht in die kommunikativ handelnden Subjekte spricht Habermas die Universalität der Diskursethik an. 127 128 Ders., „Über Moralität und Sittlichkeit – Was macht eine Lebensform >rational< ?“, S. 219. Ders., „Moralität und Sittlichkeit“, S. 17. 139 Seiner Ansicht nach muss die Ethik, die gemäß einem begründeten Moralprinzip aufgebaut ist, über jede historische Epoche, jede gewöhnliche Kultur und jede besondere Situation hinaus allgemeingültig begründet werden. 129 Die Diskursethik, die durch die kontrafaktischen Relationen mit der Kognitivität, der Formalität und der Universalität rekonstruiert ist, kann, wie Habermas zugegeben hat, nur unter den Bedingungen der „idealisierenden Unterstellungen“ 130 erfolgreich realisiert werden, die alle Beteiligten im Idealfall vernünftigerweise erfüllen wollen. Unter diesen Bedingungen kann die ideale Sprachgemeinschaft aufgebaut werden, in der sich alle Subjekte, die in erster Linie die vernünftige Erkenntnisfähigkeit und moralische Handlungsfähigkeit in sich enthalten, auf die rationale Kommunikationsform wechselseitig beziehen, die ein Moralprinzip in sich vereint. 131 Im Hinblick auf Habermas’ transzendentalpragmatische Diskursethik kann man sagen, dass der kognitive Anspruch unter den drei Ansprüchen annulliert werden kann, da die übrigen Ansprüche, die Formalität und die Universalität nur bei einer strengen Trennung von den erkennenden Subjekten „transzendental und formalpragmatisch“ definiert werden können. 132 Diesbezüglich besteht bei ihm der unauflösbare Gegensatz zwischen der Kognitivität und der universellen Formalität: Entweder soll das Subjekt sich selbst nach der Durchsetzung aller Handlungsmodi, Motivationen, Folgen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen usw. auf den transzendentalen Horizont der idealen Kommunikationsgemeinschaft einstellen können, wenn man es auf die Kognitivität aufmerksam macht. Wenn das Subjekt damit auch durch den Erfahrungsprozess hindurch den transzendentalen Horizont erkennt, dann könnte die Kommunikationsgemeinschaft nicht mehr transzendental und formal sein. Oder wenn man die ideale Kommunikationsgemeinschaft auf Seiten der transzendentalen Formalität ansiedelt, dann kann der Charakter der Kognitivität aus der argumentativen Ebene der Diskursethik ausgeschlossen sein, da die formale Universalität der idealen Sprachgemeinschaft zunächst die kognitiven Dimensionen überschreitet, die jenseits der Geschichtlichkeit der menschlichen Erfahrung liegen. 133 So gesehen ist noch immer fraglich, wie man dieser idealen Kommunikationsgemeinschaft entgegengehen kann oder inwiefern sie zustande kommen könnte. In Bezug auf die ahistorische Letztbegründung von Habermas sagt Bubner, dass Habermas um den Preis des konkreten historischen Geschehens oder mit der willkürlichen 129 Vgl. Ebd., S. 18. Ders., Ebd., S. 19. 131 Vgl. Ebd., S. 19 und S. 23. 132 Vgl. H. Schnädelbach, „Was ist Neoaristotelismus?“, S. 59. 133 Zur Kritik an der konsenstheoretischen Stellungnahme von Habermas’ Diskursethik im Verhältnis zu Kants Denkansatz zur deontologischen Ethik, vgl. Albrecht Wellmer, Ethik und Dialog – Elemente des moralischen Urteils bei Kant und in der Diskursethik, Frankfurt a. M. 1986, S. 51 ff. 130 140 Ausgrenzung des Realen die Möglichkeit der idealen Sprachgemeinschaft beweist. Bubners Äußerung zufolge will Habermas auf die transzendentale Autonomie der Vernunft nicht verzichten, selbst wenn er sich auf die Realität der Normbegründung bezieht. Daraus resultiert die Versteinerung der Vernunft. 134 Im Anschluss an die kritische Auseinandersetzung mit der ahistorischen, nämlich transzendental–pragmatischen Diskursethik von Habermas, beginnt Bubner nun mit der Begriffsgeschichte der Ethos–Ethik. Durch diese geschichtliche Beobachtung will er die Ähnlichkeit der Aristotelischen Konzeptionen der praktisch–politischen Philosophie mit der Hegelschen Sittlichkeit noch präziser darstellen. Aristoteles’ Äußerung zufolge ist der Begriff der Ethik geradezu aus dem Ethos abgeleitet: So schreibt er in Die Nikomachische Ethik: „Die Tugend ist also von doppelter Art, verstandesmäßig und ethisch. Die verstandesmäßige Tugend entsteht und wächst zum größeren Teil durch Belehrung; darum bedarf sie der Erfahrung und der Zeit. Die ethische dagegen ergibt sich aus der Gewohnheit; daher hat sie auch, mit einer nur geringen Veränderung, ihren Namen erhalten.“ 135 Nach dieser Aristotelischen Definition der Ethik, stützt die Ethik sich im wesentlichen auf das Ethos (nämlich die Gewohnheit, die Gewöhnung), das daher unsere Verhaltensweise und Haltung im Alltagsleben bestimmt. Man kann sagen, dass die Handelnden innerhalb der ethischen Entscheidungssituationen in ihren Handlungsmodi und Verhaltensweisen stets auf das latente Gute bzw. die lebendige Natürlichkeit des Guten zurückgreifen. Das handelnde Subjekt kann daher durch die ethische Erfahrung, die sittliche Reife und die reflexive Internalisierung der sozialen Gewohnheit gebildet werden. Dieses Verständnis des Begriffs von Ethos–Ethik wird, der Untersuchung von Karl–Heinz Ilting zufolge, dem deutschen Sprachraum übergeben, ohne daß der Begriff irgendeinen Bedeutungswandel erfährt: Das Ethos zeigt sich als „Sitte“ mit derselben begrifflichen Herkunftswurzel. 136 Im Hinblick auf die menschliche Handlung wird das Ethos zu einer Institution und bildet damit die geschichtlich–ontologische Grundlage, auf der die subjektive Handlung ihre Ergebnisse voraussehen und das Ziel erreichen kann. Das handelnde Subjekt setzt sich bei der Konkretisierung der Handlung immer ein Ziel und verfolgt konsequenterweise das gesetzte Ziel. Aufgrund des Bedürfnisses danach, dass sich die Handlung tatsächlich auch vollzieht, 134 135 136 Vgl. Rüdiger Bubner, „Rationalität als Lebensform“ (Anhang), in: ders., Handlung, Sprache und Vernunft, Frankfurt a. M. 1982, S. 315. Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, übers. v. Olof Gigon, 4. Aufl., München 2000, Kap. I, II. Buch, 1103 a 14 – 19. Vgl. Karl–Heinz Ilting, Naturrecht und Sittlichkeit, Stuttgart 1983, S. 115 – 124. 141 verlangt das handelnde Subjekt die Bestätigung seines Handlungsumfeldes und geht davon aus, dass es auf die Reaktion der Anderen zählen kann, da der lebendige Handlungsspielraum, in dem sich unsere Handlung hin– und herbewegt und kompliziert ineinander verwoben ist, auf der ständigen Verwechslung und deshalb auch auf dem unbestimmt–unruhigen Zustand beruht. Aus dieser unruhigen Unsicherheit und unbestimmten Wandlung im Feld der Handlung entsteht auch das Bedürfnis jedes handelnden Subjekts nach der „Normfestlegung“. Anders formuliert, streben alle handelnden Subjekte nach den handlungsorientierenden Normen und Ordnungen unter den wechselnden, hin und herschwankenden Handlungsräumen, die als die Schauplätze die gesamten Handlungszusammenhänge in sich enthalten, damit die Subjekte sich unter den bestimmten Bedingungen der Handlung ihrer Zielerfüllung versichern können. Somit kann man sagen, dass die „Regelungsbedürftigkeit“ und die „Regelungsfähigkeit“ 137 außerhalb des historischen Kontextes der Handlung uns auf der lebensweltlichen Ebene nicht gegeben werden, sondern vielmehr von vornherein innerhalb der lebensweltlichen Handlungsrahmenbedingungen entstehen, wenn man auf die Frage nach der Entstehungsgeschichte der ethischen Norm und Institution antworten will. Bubner bemerkt deshalb, dass „die Ordnung des existenten Rahmens, innerhalb dessen wir uns praktisch bewegen, ist.“ 138 Die Normen und die sozialen Ordnungen, die als die angestrebte Basis der kollektiven Handlungen und des Gesellschaftslebens eine wichtige Rolle spielen, sind nicht auf der isoliert–idealen Subjektivität und der transzendentalen Formalität begründet, sondern resultieren vielmehr aus der intersubjektiven Übereinstimmung, den lebendigen Strukturen des Zusammenlebens. In diesem Zusammenhang schlägt Bubner vor, die Normen als „die gewollte Übereinstimmung zwischen den subjektiven Handlungsmaximen vieler Einzelner“ zu verstehen,139 da die Handlungsmaximen der Praxis der handelnden Subjekte die Handlungsrichtung zeigen. Um den Handlungsvollzug zu erreichen, ist es somit notwendig, zwischen den Maximen übereinzustimmen und die Normen zu schaffen, mit denen die Handlung der Subjekte verbunden ist. Wenn die Handlungsverhältnisse und –weisen von Hause aus als die Ermöglichung des kollektiven Handelns und der Normbegründung betrachtet werden, zeigt sich das Ethos als die gewohnten Institutionen, die historisch geprägt sind und den geschichtlich–veränderten Situationen gemäß jeweils wieder neu errichtet werden. Die Ethos–Ethik beschäftigt sich daher mit den konkreten Lebensformen und den Institutionen, die sich aus der Gewohnheit historisch ergeben und entwickeln. Anders gesagt, 137 138 139 R. Bubner, Geschichtsprozesse und Handlungsnormen, Frankfurt a. M. 1984, S. 174. Ders., Welche Rationalität bekommt der Gesellschaft ?, Frankfurt a. M. 1996, S.171. Ders., „Norm und Geschichte“, in: Neue Hefte für Philosophie, Heft 17, hrsg. v. ders., Konrad Cramer, Reiner Wiehl, Göttingen 1979, S.111 – 112. 142 verwandelt das Ethos ein „vorfindliches Faktum“ 140 in einen Gegenstand der Ethik. Die Ethik muss nun an den Ethos anknüpfen, das von jedem handelnden Subjekt für seine Handlungssicherheit angestrebt wird, das die Aufgabe der Ermöglichung des Soziallebens übernommen und konstruktiv ausgebildet hat. Es wird nun von dem geschichtlich ineinander übergehenden Bildungsprozess des Subjektes die Rede sein, da die Institution, Bubners Ansicht zufolge, im Grunde sowohl das Vorgegebene als auch die Gewohnheit ist. Durch den Bildungsprozess hat sich das sittlich handelnde Subjekt in den normativen Horizont, der bereits durch das geschichtliche, gemeinsame Zusammenleben zustande gekommen ist, hineinbegeben. Im Einbezogensein in die gemeinschaftlichen Institutionen hat das Subjekt die Fähigkeit zum wissenden Umgang mit der traditionellen Dimension der Sitten und gilt den Anderen als Seinesgleichen. Das Subjekt muss damit im Verlauf der sozialen Handlungen zugleich lernen, seine nackte Subjektivität durch die gesellschaftlichen Normen in das eigene Sozialleben hinein zu verlagern. Anders formuliert, lernt das handelnde Subjekt durch die Vergesellschaftung die egozentrische Begierde aufzuheben und die Handlung der Anderen bzw. die gesellschaftliche Sitte rücksichtvoll zu respektieren. In diesem Bildungsprozess ist das Subjekt zu der Auffassung gelangt, dass das soziale Lebensfeld allein, in dem die intersubjektive Wechselbeziehung entfaltet wird, seine Freiheit garantieren kann. Wenn das handelnde Subjekt - die Handlung entsteht allerdings nur aus seinem inneren Willen – durch den Handlungsvollzug bzw. die Erfüllung seines entworfenen Handlungsziels zum Wohlgefühl oder Bewusstsein von Freiheit gekommen sein sollte, dann wird die normative Festlegung für die Befriedigung aller Handelnden gefordert, da das Subjekt selbst alle Handlungsweisen verlangt, mit denen die Subjekte mehr oder weniger übereinstimmen können. In diesem Zusammenhang kann also behauptet werden, dass die institutionelle Organisation, z. B. der Staat einen freien Spielraum in sich enthält, 141 in dem die Subjekte sich selbst einerseits ins 140 141 Ders., Geschichtsprozesse und Handlungsnormen, S.181. Vgl. Axel Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, S. 7-16. Hier versucht er ergänzend, Hegels Idee der Sittlichkeit in der Rechtsphilosophie in Bezug auf die Diagnose der sozialen Pathologie zu reaktualisieren. Mit diesem Ziel verkündet er zunächst den Zweifel an Hegels sozial–politischer Philosophie, vor allem das Vorurteil gegenüber Hegels Staatsbegriff, von dem das heutige Diskussionsmilieu schwer überschattet wird. Seiner Ansicht zufolge scheint Hegels Staatsbegriff die individuelle Freiheit in der Diskussion über die sozial–politische Philosophie beschränken zu wollen, noch radikaler formuliert, zu opfern, um die Autorität des Staates zu verbürgen. Aus der Sicht der Kritiker an Hegels sozial–politischer Philosophie, liegt schließlich auf der Hand, dass Hegels Rechtsphilosophie eine antidemokratisch–konservative Konzeption entfaltet. Im Hinblick auf die allgemeinen Einwände gegen Hegels Staatsbegriff, stützt sich jedoch der Staat bei Hegel, Bubners Ansicht zufolge, weder auf die autonome, deshalb isolierte Subjektivität, noch auf die Beschränkung der individuellen Freiheit, sondern vielmehr fungiert er als ein grundlegender Spielraum, in dem alle Subjekte die eigene Besonderheit verwirklichen und miteinander ausspielen. Somit benötigen die Subjekte unbedingt den Staat als existentielle Grundlage, wenn sie die Freiheit, die Autonomie und die Besonderheit überprüfen wollen. Diesbezüglich, R. Bubner, Welche Rationalität bekommt der Gesellschaft?, 143 Konfliktfeld der Begierden versetzen und gleichzeitig andererseits die Selbstverwirklichung bzw. die gemeinsame Lebensform in der Gesellschaft finden. Das handelnde Subjekt beteiligt sich an dem kollektiven Spielraum der intersubjektiven Handlungen, sofern die Ich–Identität im Verlauf der Sozialisierung nicht zerstört worden ist. Und umgekehrt kann man sagen, dass alle Beteiligten am sozialen Handlungsfeld durch alle Lebenszusammenhänge hindurch ihre Ich–Identifizierung progressiv und permanent herstellen, da das Subjekt mit der Erwartung der Reaktion von den gleichberechtigten Anderen, die Realisierbarkeit des inneren Willens und das freie Selbst erkennen kann. Jeder Handelnde verlangt deshalb die institutionelle Basis, die sich unter den gesellschaftlich–konkreten Situationen verändern kann. Auf dieser Basis kann das Subjekt die Handlungsweise der Anderen voraussehen und seine künftige Reaktion entwerfen. Diese ontologische Grundlage der sozialen Praxis verankert sich im menschlichen Zusammenleben mit der intersubjektiven Vertrautheit, Verlässlichkeit und mit dem Verstehen des wandelnden Laufes der Wirklichkeit. Darüber hinaus kann die Freiheit der Gesellschaftsmitglieder aus Bubners Sicht unter der „Autonomie des sittlichen Staates“ 142 real verwirklicht werden. Alle Subjekte haben auch verschiedene soziale Rollen in der Gesellschaft inne, bei denen sie die Chance der Selbstverwirklichung auf der gesellschaftlichen Handlungsebene sehen: In Bezug auf die sozialen Handlungen üben alle Subjekte auf den verschiedenen Gesellschaftsebenen entweder als Vater, Mutter, Lehrer, Student usw. die eigene, aber auch gleichzeitig verschiedene Sozialrollen aus. Gleichwohl ist es eine Tatsache, dass sich jedes handelnde Subjekt schließlich selbst im gelungenen Handlungsvollzug, der mit der Erfüllung der jeweiligen Sozialrolle einhergeht, verwirklicht. Für uns läßt sich daher schwer sagen, ob jede Sozialrolle auf einem einzigen Handlungsmuster gegründet werden kann. Aber wenn wir die Handlungsphänomene in der alltäglichen Lebenswelt betrachten, liegt es auf der Hand, dass alle handelnden Subjekte auf der Gesellschaftsebene agieren und auf die Anderen reagieren. Damit bilden sie ihre eigenen Lebensformen, die bei ihnen zur Grundlage der Handlung werden. Durch die so ausgebildete Lebensform hindurch, die den Subjekten als handlungsorientierender Wegweiser vorgegeben wird, identifiziert sich das Subjekt auch mit sich selbst. Das heißt, dass das Subjekt in der Erfüllung der Sozialrolle im gesamten S. 156 und ders., Polis und Staat, Frankfurt a. M. 2002, S. 153 – 173. Hier versucht er insbesondere, den Staatsbegriff des späten Hegel in Verbindung mit dem frühen Hegelschen Begriff des Lebens darzustellen. In diesem Interpretationsvorgang sollte man, Bubner zufolge, die Institutionen bzw. die staatlichen Einrichtungen als die ontologische Bedingung für die subjektive Selbstverwirklichung und die Sozialisation gelten lassen, weil wir immer schon in diesen staatlichen Institutionen als unserer vertrauten Lebenswelt leben. 142 Ders., Polis und Staat, S. 171. 144 Lebensraum nicht nur seine Lebensform ausbildet, sondern auch die ausgebildete Lebensform als einen Wegweiser der Handlung verfolgt. Im Anschluss an die Identifizierung und die Selbstverwirklichung des handelnden Subjekts vor dem soliden Hintergrund der Institutionen, die die verschiedenen Handlungsmodi präsentieren, müssen wir auch darüber nachdenken, inwiefern die „Willensentscheidung“ 143 (Prohairesis) und die „Klugheit“ (Phronesis) bei Aristoteles beim Aufbau der Normen, die jeweils von den geschichtlichen Handlungsrahmenbedingungen abhängen, eine zentrale Rolle spielen. Das handelnde Subjekt hat im Grunde die Fähigkeit, bei seiner Handlung frei nach seinem Willen zu entscheiden und sich die von der Situation geforderten Maßstäbe anzueignen. In diesem Sinn schreibt Aristoteles: „Prinzip des Handelns als Ursprung der Bewegung (nicht als Zweck) ist der Wille; Prinzip der Willensentscheidung ist das Streben und der Begriff des Zweckes. Darum ist eine Willensentscheidung weder ohne Vernunft und Denken noch ohne ethisches Verhalten möglich. Denn ein rechtes Verhalten und das Gegenteil davon existiert nicht ohne Denken und Charakter.“ 144 Die Handlung wird immer durch den Willen realisiert. Der Wille zeigt sich demnach als die Quelle der Handlung. Der strebende Wille enthält überdies beim Handeln bereits den „Zweck“ in sich, der auf die Befriedigung und auf die Selbstverwirklichung des handelnden Subjekts verweist. Im Verlauf der Realisierung des inneren Willens hat es die Handlung auch mit „der Klugheit“ zu tun, die als Anleitungskraft der rationalen Handlung eine Rolle spielt. Das handelnde Subjekt verfolgt kein animalisches Streben, sondern Rationalität und 143 Diesbezüglich müssen wir Gadamers Stellungnahme zur hermeneutischen Praxis bedenken. Gadamer unterstellt zunächst, dass Hermeneutik im Grunde genommen „ein praktisches Bestandstück“ der Tätigkeit des Verstehens ist. Dementsprechend legt er den Zusammenhang der Begriffe Prohairesis, Phronesis und Praxis in Aristoteles’ Ethik aus. Nach ihm bedeutet Prohairesis die freie Wahl des tätigen Menschen. Der Mensch hat von vornherein die Freiheit der wollenden Entscheidung beim Handeln, die grundsätzlich nicht als notwendiges Naturgesetz bestimmt werden kann. Er ist also fähig, bewusst eine von den Möglichkeiten zu wählen und willentlich die Selbstentscheidung auf die Handlung hinzuführen. Aber die menschliche Praxis wird nicht nur von der Prohairesis gebildet, sondern die Praxis bezieht sich auch auf „den Lebensvollzug (Energeia) des Lebendigen überhaupt“. Dementsprechend beinhaltet die Praxis im Ganzen die Lebensformen, die Handlungsweise und die Verhaltensweise der handelnden Menschen im Gesellschaftsleben. Deswegen ist die Praxis das gesellschaftliche Zusammenleben in der überindividuellen Dimension, der alle Lebendigen und die Verhaltensweise aller entsprechen sollen. Aufgrund dieser Beziehung zwischen Prohairesis und Praxis geht es beim handelnden Menschen um das „praktische Wissen“, die Klugheitsüberlegung als Phronesis. Phronesis weist also auf das Wissen und das Vermögen hin, alles Handeln in den latenten Situationen angemessen zu leiten und Rat zu erteilen. Mit Phronesis erreicht der Mensch sein Handlungsziel, ohne im Widerspruch zur Praxis zu sein. Vgl. Hans–Georg Gadamer, „Hermeneutik als praktische Philosophie“, in: Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. I, hrsg. v. Manfred Riedel, Freiburg 1972, S. 327 – 329. 144 Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, 1139a 31-35. 145 überdenkt die Angemessenheit seiner Wahl in einer gegebenen Situation. Deswegen kann man sagen, dass die Handlung nur im Verhältnis zur Leistung der Klugheit besteht. Diesbezüglich kann der Ablauf einer Handlung z. B. auf der Basis einer Schlussfolgerung betrachtet werden. Wenn man über den allgemeinen Gegenstand des inneren Willens – wir können dies den Obersatz nennen – vor seinem Handeln verfügt, muss man dabei die angemessenen Mittel unter den gegebenen Umständen wählen: Wenn man an das allgemeine ‚Süß’ als einen Obersatz denkt, dann tendiert man beim Handeln notwendigerweise zum Mittelsatz ‚Kuchen ist süß’, als das beste rationale Mittel, dessen sich das Subjekt bewusst ist. 145 Nach der bestimmten Wahl realisiert das Subjekt den inneren Willen als das zu Befriedigende mit der Handlung. So erreicht jede Handlung ihr Ziel durch die rationale Applikation hindurch in der allgemeingültigen Lebensganzheit und erfüllt so den Anspruch auf Legitimation. Dementsprechend handelt es sich für Bubner um das „Wiedererkennen“, das auf die Situation der Selbsterfahrung des handelnden Subjekts im praktischen Leben verweist, in der das handelnde Subjekt, das mit seinem eigenen Willen während des Handelns verbunden ist, das Gleichgewicht zwischen dem egozentrisch–verschlossenen Trieb und der rationalen Entscheidung hält und es ihm gelingt, seine Klugheit in der Auseinandersetzung mit den vorgegebenen Handlungssituationen anzuwenden. In Bubners Augen bezieht sich das Wiedererkennen auf den geschichtlichen Bildungsprozess des Subjekts, in dem sich das sich selbst wieder erkennende und rekonstruierende Subjekt vom nackten Bewusstsein über das egoistische Selbstinteresse im Rechtsverhältnis zu den überindividuellen Handlungsnormen in der Gesellschaft, anders gesagt, zum Horizont der gesamten Sinnganzheit emporgehoben hat. In diesem Bildungsprozess oder dem sich selbst wieder erkennenden Prozess des Selbst, erscheinen die Institutionen als das Gebiet des objektiven Geistes im subjektiven Bewusstsein. Eine solch einheitliche Verschmelzung zwischen dem subjektiven und dem objektiven Geist meint m. E. die einheitliche Übereinstimmung des Subjekts mit den gesellschaftlichen Normen und Sitten in der praktischen Lebenswelt. In diesem Sinn deutet das Wiedererkennen bei Bubner auf die Einsicht hin, „daß die Institutionen Geist vom Geist des Subjekts sind.“ 146 Darüber hinaus bringt das Wiedererkennen, das nahezu als eine Geschichte der Erfahrung des Bewusstseins verstanden werden kann, bei Bubner nicht nur das einzelne Subjekt zur Einsicht in das Allgemeine, sondern erscheint auch als die Wiederherstellung der Selbstheit des Subjekts. Anders formuliert bedeutet das Wiedererkennen des Subjekts, was die Übertragung 145 Vgl. zur Orientierungsrolle im konkreten Handeln der formell–logischen Schlussfolgerung, R. Bubner, Handlung, Sprache und Vernunft, S. 261. 146 Ders., Welche Rationalität bekommt der Gesellschaft?, S.160. 146 der Einzelheit auf die Allgemeinheit betrifft, keine Vernichtung der Besonderheit des Einzelnen, sondern vielmehr die zu sich selbst kommende Rückkehr, nämlich die Ausprägung der Ich–Identität in der praktischen Lebenswelt. Das Wiedererkennen weist daher von vornherein auf die sich selbst umwälzende und dennoch sich selbst ausbildende Sinnganzheit des subjektiven Bewusstseins hin. In diesem Prozess wird dem Einzelnen seine Besonderheit gewährt, ohne dass die Freiheit der subjektiven Willensentscheidung von außen beschränkt wird. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit nun der „Normgeschichtlichkeit“ Bubners zuwenden, da sowohl die Institutionen als auch die Normen wie die begriffliche Bewegung der „Sache selbst“ 147 in der Hegelschen Logik den Charakter der subjektiven Selbstbewegung haben. Die Normen weisen dieselbe Bewegungsstruktur auf wie der geschichtlich ineinander übergehende Bildungsprozess des Subjekts in Auseinandersetzung mit den vorhandenen Strukturen. Somit kann man sagen, dass die Normen sich in Abhängigkeit des Verlaufs der Geschichte und der Veränderung der Situationen Schritt für Schritt selbst entfalten und bewegen. Die Normen werden als Voraussetzung und Bedingung für den Handlungsvollzug auch vom handelnden Subjekt in der bestimmten Situation produziert und bewahrt: Wenn das handelnde Subjekt die eigene Handlung vollziehen will, spielen die Normen bzw. die Institutionen zunächst als Bedingung für die subjektive Handlungsermöglichung eine Rolle und umgekehrt, sie entstehen auch dann aus dem Bedürfnis des Subjekts nach dem Handlungsvollzug. Daher muss die Normfestlegung vor dem geschichtlichen Horizont der subjektiven Handlungsmaximen verstanden werden. Wenn die Frage danach gestellt wird, ob das Subjekt der vorhandenen Handlungssituation gemäß angemessen, richtig handelt und diese Frage im Rahmen der gesellschaftlichen Norm und der praktischen Philosophie beantwortet wird, bezieht sich die menschliche Praxis auf die ethische Einsicht in die gesamte Verflechtung unter den Subjekten in allen Handlungszusammenhängen. In diesem Sinn sagt Bubner m. E.: „praktische Vernunft ist Vernunft in der Geschichte.“ 148 Bubners Ansicht zufolge bietet die praktische Vernunft Orientierung für die Handlung des Subjekts im praktischen Leben für das „Gute Leben.“ Diesbezüglich sind die Handlungsnormen auch der zugrunde liegende Wegweiser, der das einzelne Subjekt zum menschlichen Zusammenleben und zum gesellschaftlich Guten führt. Daher kann die Behauptung gewagt werden, dass sich die Handlungsnormen aus dem Handeln selbst ergeben, welches die überindividuelle Ordnung 147 Vgl. zur Interpretation der Sache selbst als die Bewegung der Begriffe in Hegels Logik, ders., „Die „Sache selbst“ in Hegels System“, in: ders., Zur Sache der Dialektik, Stuttgart 1980, S. 54 - 60. 148 Ders., „Rationalität, Lebensform und Geschichte“, in: Rationalität, hrsg. v. Herbert Schnädelbach, Frankfurt a. M. 1984, S. 207 und auch ders., „Norm und Geschichte“, S. 119. 147 der jeweiligen Gesellschaftsebene gemäß der traditionellen Überlieferung mit der gegenwärtigen Situation verbindet und dabei die Regeln für die intersubjektiven Verhaltensweisen im Gesellschaftsleben allmählich zu rekonstruieren in der Lage ist. Dementsprechend erweisen sich die Normen für das handelnde Subjekt als Basis der Möglichkeit des praktischen Erlebens mit den Anderen, während dem das subjektive Bewusstsein Schritt für Schritt reichhaltiger wird. Geht man im Hinblick auf die Normengeschichtlichkeit noch weiter, sind die Normen immer vom „Geltungsanspruch“ 149 abhängig, da die Normen nur im Verhältnis zu den jeweils bestehenden Fakten angewendet werden können. Betrachtet man die geschichtliche Erfahrung der Menschen noch genauer, trifft man auf den bestehenden Widerspruch zwischen den Normen und dem Anspruch der Geltung. Dieser Widerspruch wiederum führt uns zu dem Anspruch, dass die Normen in Bezug auf die geschichtliche Wirklichkeit angemessen sein sollten. Darüber hinaus überprüft das handelnde Subjekt innerhalb der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Anwendbarkeit der Normen und den Zusammenhang der Normen mit der bestimmten Zeit. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Norm nicht in der Lage ist, die jeweilige Vielfältigkeit der unterschiedlichen Handlungsebenen und der verschiedenen Kulturen vollends zu berücksichtigen, obwohl die Norm in Bezug auf die jeweilige Situation Geltungsanspruch besitzt. Da sich die Lebensbedingungen in Abhängigkeit vom geschichtlichen Verlauf ändern und das handelnde Subjekt unter den veränderten Lebensbedingungen ein neues Handlungsmuster benötigt, unterliegt jede Norm dem Einfluss der Geschichte. Auch wenn sich das handelnde Subjekt unter den veränderten Lebensbedingungen die neue Norm aneignet und es ihm deshalb möglich wird, aus dem Vergangenen auszubrechen, kann das Neue nur in sukzessiver Auseinandersetzung mit dem vergangenen gebildet werden. Mit anderen Worten: Die neue Lebensbedingung bringt das angemessene Handlungsmuster hervor und konstruiert die neue Norm. Dennoch ergibt sich die neue Norm nur aus dem engen Zusammenhang mit den vergangenen Lebensformen. Somit wird deutlich, dass die Entstehung der Norm nicht die Elimination des Vergangenen, sondern das konstruktive Verständnis des Vergangenen bedeutet. Wenn auch die Legitimität jeder Norm nur im Zusammenhang mit dem Anspruch der lebendigen Gegenwart bewiesen werden kann, steht die neue Norm immer noch unter dem fortwirkenden Einfluss der Vergangenheit, so wie die lebendige Gegenwart mit dem überlieferten Vergangenen verbunden ist. 149 Ders., Geschichtsprozesse und Handlungsnormen, S. 265. 148 Nun können wir bei Bubner im Anschluss an den „Geltungsanspruch“ die „Rationalitätsleistungen“ und die „Gesichtspunkte“ 150 der Beteiligten aus den Handlungszusammenhängen ableiten. Was zunächst die Rationalitätsleistungen betrifft, bezieht sich die sittliche Welt bei ihm auf die Verbesserung und die Verfeinerung der Rationalität, aus der die Normen unter Berücksichtigung der geschichtlichen Situation abgeleitet und verwirklicht werden. Die Normen sind in verschiedene Einzelteile zerlegt, insofern sie die Sinnganzheit aller Handlungszusammenhänge in sich selbst noch nicht vereinen und unter den verschiedenen Bedingungen der vorgegebenen Situationen rekonstruiert werden müssen. Trotz dieser Einzelteile sieht das handelnde Subjekt nur in Bezug auf die Normen die Möglichkeit der allgemeinen Praxis und des Handlungsvollzugs, da die Normen allein es vermögen, zunächst die vielfältigen Handlungen aller Subjekte musterhaft in den einheitlichen Horizont des Lebensganzen einzubeziehen und das Subjekt mit der Verfolgung des handlungsorientierten Anleiters die eigene Handlung nachvollziehen zu können glaubt. In diesem Zusammenhang verlieren die relativen und partikulären Normen ihre handlungsweisende Rolle, da sie für die Verwirklichung der allgemeinen Praxis offen bleiben. Infolgedessen müssen die Normen im Zusammenhang mit dem Lebensganzen und dem Gesellschaftsleben aller handelnden Subjekte als Handlungswegweiser die führende Rolle übernehmen. Wenn die Normen, die auf die verschiedenen Handlungsebenen einwirken, damit in das gesamte System integriert werden, anders gesagt, in das Gesellschaftssystem übergegangen sind, kann die systematisierte Norm dem handelnden Subjekt auch wieder Freiräume schaffen. Diesbezüglich handelt es sich für Bubner um die „Gesichtspunkte“ aller Beteiligten am Gesellschaftsleben, die hier als die Interpreten der Normen auftreten. Die Normen müssen vom handelnden Subjekt, das die Normen von vornherein als das eigene Handlungsmuster annimmt, auf den unterschiedlichen Gesellschaftsebenen konkretisiert werden können. Auch wenn die Normen in Form von institutionellen Systemen auftauchen und das Subjekt sich bei seiner Handlung diesen Systemen zwangsläufig unterwerfen muss, müssen die Normen doch zunächst durch die Handlung des Subjekts in den konkreten Handlungsspielräumen erkannt und akzeptiert werden. In diesem Sinn werden die Normen bei der Anwendung auf der konkreten Handlungsebene notwendigerweise vom handelnden Subjekt interpretiert. Das unterworfene Subjekt muss im Verlauf des Veränderungsprozesses der geschichtlichen Situation fähig sein, die Normen zu interpretieren, bevor die Normen einen unerträglichen Zwang auf das handelnde Subjekt ausüben. Mit der Möglichkeit der Interpretation der Normen wird dem Subjekt zunächst ein Spielraum überlassen, in dem die 150 Ebd., S.267 - 269. 149 Handlung überhaupt erst möglich wird. Zudem erhält das Subjekt innerhalb dieses Spielraums die Möglichkeit, die Lebendigkeit bzw. die Flexibilität der Normen zu erfassen. Denn die Normen müssen dem Handelnden auf der Gesellschaftsebene konkret einleuchten, damit die Abstraktion des Systems aufgehoben werden kann. An dieser Stelle geht Bubner auf „die Übersetzbarkeit der Normen“ ein. Die Übersetzbarkeit der Normen bezieht sich bei ihm zunächst nicht auf die subjektiv entworfene Abstrahierung der Normen, sondern auf die der Intersubjektivität zugrunde liegende Etablierung der Normen. Das handelnde Subjekt steht zunächst beim Handeln, wie wir bereits gesehen haben, unter dem Einfluss der vorgegebenen Sitte. Das Subjekt findet eine allgemeine Lebensform vor, bei der die Menschen einen gegenseitigen Einflußs aufeinander ausüben und sich ihre Handlungen wechselseitig aufeinander auswirken. Daraus folgend gibt die allgemeine Lebensform dem Subjekt Handlungssicherheit und eröffnet ihm die Möglichkeit, künftige Handlungsverläufe zu erkennen. Hier erscheint die allgemeine Lebensform in Form der Institution, die vom handelnden Einzelnen, nämlich dem isolierten Subjekt, gar nicht aufgebaut werden kann. Aus diesem Grund werden die Institutionen, in denen sich das Gesellschaftssystem konkretisiert, durch die gemeinsame Verbindung mit allen Subjekten etabliert und installiert. Somit zeigt sich, dass die Institutionen, die die existentielle Basis der Gesellschaft bilden, die „Bedingung der Möglichkeit“ des intersubjektiven Handelns sind. In diesem Sinn schreibt Bubner: „Überall dort, wo der Einzelne sein Handeln mit Intersubjektivität verbindet, kommen Institutionen seinen Zielsetzungen entgegen: ihr Zweck wird sein Zweck.“ 151 Dieser Äußerung Bubners zufolge kann die Übersetzbarkeit der Normen auf zweierlei Weise verstanden werden: Die absolute Übersetzung richtet sich erstens auf die Übereinstimmung des einzelnen Subjekts mit den Institutionen als dem Gesellschaftssystem. Zweitens muss die Institution immer durch die kollektive Handlung und das Bedürfnis des handelnden Subjekts nach dem Handlungsziel gestützt werden, um die Normen auf die Gesellschaftsebene zu übertragen. Mit dieser zweiten Perspektive weist er im Anschluss an Hegels Begriff eindeutig auf „ein unhinterfragbares >>es gibt<<“, nämlich „die Stellung des objektiven Geistes in der Zeit“ 152 hin. Dieses besteht darin, hegelianisch betrachtet, einen Blick auf den objektiven Geist zu werfen, der sich unter den Bedingungen der geschichtlichen Situation angemessen verwirklicht. 151 152 Ders., Ebd., S. 282. Ders., Welche Rationalität bekommt der Gesellschaft?, S. 165. 150 V. Resümee – Von einer reflexiven Abgeschlossenheit zum spielerischen Reflexionsverhältnis der ästhetischen Erfahrung An dieser Stelle fassen wir zunächst die bisherigen Überlegungen der Geschichtlichkeit der ontologischen Erfahrung des Bewusstseins bzw. der wechselseitigen Anerkennungsbewegung in Hegels Philosophie unter Gadamers hermeneutischem Denkansatz zusammen. Mittlerweile haben wir gesehen, dass der ontogenetische Selbstausbildungsprozess des Bewusstseins zum reflexiv zu sich selbst zurückkehrenden Selbstbewusstsein für Hegel auch die Grundstruktur der ontologischen Erfahrung des Menschen angesichts einer historisch spezifischen Situation, die für das hermeneutische Verstehen in Gadamers philosophischer Hermeneutik charakteristisch ist, bildet. Denn wenn die Erfahrung des Bewusstseins, dessen Hauptaufgabe es ist, sich seiner selbst bewusst zu werden, auf die sich wandelnden Erfahrungssituationen angewiesen ist, spielt jede Situation in jeder geschichtlichen Phase der Erfahrung des Bewusstseins ihre entscheidende Rolle als ontologische Grundlage, die dem prozessualen Verzweiflungsweg des Selbstbewusstseins dadurch, dass sich das Subjekt dieser Erfahrung auf jeder Entwicklungsstufe das, was es hinter sich gebracht hat, bewusst macht, und gibt damit den Anstoß zur Selbstentfaltung hin zu einem anderen Erfahrungshorizont. Kurz gesagt, ist der Motor der dialektischen Selbstausbildung des Selbstbewusstseins hier das Bewusstmachen, das jeder gelungenen Erfahrung des Bewusstseins immer fehlt. Wenn wir außerdem in Anknüpfung an Gadamers Hermeneutik die ontologische Grundlage für die ontologische Selbsterfahrung des Bewusstseins, die sich selbst dem geschichtlichen Entfaltungsprozess gemäß darbieten soll, nicht vom vollendeten Ende dieser Erfahrungsgeschichte her, sondern von ihrem Verlauf aus betrachten, können wir sehen, dass sie sich auch bei Hegel nie voll ausschöpfen lässt, obwohl Hegels Konzept des geschichtlichen Lernprozesses des Selbstbewusstseins zum Geist im Grunde darin besteht, den fortschreitenden Erfahrungsweg mit der bewussten Vollständigkeit des Geistes zu Ende zu führen. Dennoch kann man sagen, dass der geschichtliche Erfahrungsverlauf des Bewusstseins, den Hegels Phänomenologie des Geistes detailliert skizziert hat, noch immer, wie bereits erwähnt, den Charakter der ontologischen Erfahrung impliziert, da es sich hier im Prinzip um die Geschichtlichkeit der Erfahrung, die bei Hegel, Gadamers Ansicht zufolge, die Integrationsleitung vollbringt und nicht die Restitution des Urbildes vollzieht, sondern den ständig neuen und anderen Sinnhorizont erschließt, handelt. Aus Gadamers Sicht konstituiert die Wechselseitigkeit der Erfahrung des Selbstbewusstseins, nämlich die Anerkennungsbeziehung bei Hegel, andererseits auch das 151 Grundelement der ontologischen Erfahrung des menschlichen Seins. Es wurde bereits gezeigt, dass Hegels Auffassung von der wechselseitigen Anerkennungsbeziehung im wesentlichen den geschichtlichen Lernprozess des Selbstbewusstseins in den Vordergrund stellt. Dass die Grundstruktur der Erfahrung des Selbstbewusstseins sich in ihrer Wechselseitigkeit befindet und dass das Selbstbewusstsein sich in die gegenseitige Bezüglichkeit als ein sich selbst ausbildendes Sinnnetzwerk einlässt, bedeutet, dass das Selbstbewusstsein sich bereits im unentbehrlichen Wechselverhältnis zum Anderen befindet. In diesem reziproken Spielraum bildet das Selbstbewusstsein nicht nur sich selbst durch die verschiedenen Anerkennungsformen hindurch aus, sondern findet auch unmittelbar seinen Anderen. Um sich selbst als ein freies Selbständiges zu erkennen, muss das Selbstbewusstsein im Verlauf seines Bildungsprozesses die unvermeidbare Konfrontation mit der Andersheit des Anderen erfahren. Gadamer sieht den entscheidenden Punkt in Hegels Grundanliegen zur zwischenmenschlichen Anerkennungsbeziehung darin, dass das Sich–im-Anderen–Anschauen im Laufe der geschichtlichen Selbstausbildung den hervorragenden Modus der kritischen Selbstüberwindung der eigenen Isoliertheit, nämlich der reflexiven Selbsterkenntnis, in deren Stufe das Selbstbewusstsein weiß, womit es sich identifizieren soll, bildet. Dadurch, dass das Selbstbewusstsein die dauerhafte Anerkennungsbewegung zwischen der sich von der naiven Banalität befreiten Selbstüberwindung und der internalisierten Selbstidentifizierung durchläuft, bestimmt es sich, nach Hegel, schließlich als einen freien Menschen. Da wir Gadamers philosophische Hermeneutik später noch genauer betrachten werden, haben wir uns im Zusammenhang mit der Hegelschen Anerkennungstheorie im Hinblick auf Gadamers dialoghermeneutische Perspektive insbesondere auf die Liebesbeziehung als das unmittelbare Finden des ontologischen Gegenübers auf der Basis des gegenseitigen Rechtsverhältnisses konzentriert. Denn wenn sich das Selbstbewusstsein, um seine Selbständigkeit zu erkennen, in das unvermeidbare Anerkennungsfeld einlässt, zumal wenn das Anerkennungsverhältnis unter den Menschen eine zirkuläre Bewegtheit zwischen dem Selbstbezug und dem Fremdbezug aufweist, erfordert das Sich-Einlassen auf das Anerkennungsverhältnis zuallererst die freiwillige Bereitschaft zum Annehmen des Anderen als Partner, nämlich zum Verstehen des Anderen, was durch den geschichtlichen Prozess geschieht. Da die Liebesbeziehung innerhalb des den Anderen ausschließenden Rechtskonfliktes hier die ontologische Erfahrung der Verlässlichkeit, ja Freundschaft, die das menschliche Zusammenleben ermöglicht, bedeutet, spielt sie als eine der beiden Bestandteile des zwischenmenschlichen Anerkennungsverhältnisses in Gadamers Dialoghermeneutik eine entscheidende Rolle. Denn ungeachtet des erbitterten Streits mit dem Gesprächspartner im Dialogverhältnis über die 152 Dialogsache, zu der alle Betroffenen dazu gehören, vor allem z. B. in einer diplomatischen Verhandlung, verweist, wie das Anerkennungsverhältnis oben gezeigt hat, das Sich-Einlassen auf das Gespräch mit dem Anderen von vornherein nicht nur auf die Bereitschaft zum Verstehen des Anderen, sondern befindet sich immer schon im fortdauernden historischen Durchgangsweg von der kritischen Erprobung der eigenen Position zur Verständigung über den Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit und über sich selbst. Auch wenn Gadamer einerseits die Geschichtlichkeit der Selbsterfahrung des Bewusstseins und andererseits die Bewegung der gegenseitigen Anerkennung in Hegels Philosophie als die musterhafte Struktur der ontologischen Erfahrung des Menschseins verstanden und deshalb in seine Dialoghermeneutik aufgenommen hat, so hat er doch auch darauf geachtet, dass Hegels Systemphilosophie, gegen die sämtliche Hegel–Kritiker Vorwürfe erhoben haben, eine reflexive Abgeschlossenheit aufweist. Von der in sich geschlossenen Selbstgewissheit der subjektphilosophischen Reflexivität und der systemphilosophischen Abgeschlossenheit in Hegels Philosophie, hat Gadamer sich jedoch kritisch distanziert. In Hegels Philosophie wurde zunächst gezeigt, dass das Bewusstsein seine Aufgabe durch den gesamten Prozessverlauf hindurch bis zum Ende, an dem es sich als ein freies und selbständiges Selbst erkennt, erfüllt. Somit können wir feststellen, dass die dialektische Entwicklungslogik in diesem Prozess verborgen ist. Wenn die Anerkennungsbewegung zwischen den beteiligten Parteien nunmehr vor allem zur unmittelbaren Vereinigung mit dem allgemeinen Willen tendiert, muss eine solche Anerkennungsbewegung den Entwicklungsweg über die tiefere, höhere, ja bis hinaus zum höchsten, letzten Endzweck, auf dessen Stufe sich der absolute Geist selbst vollendet, manifestiert und erkennt, durchsetzen. Im Anschluss an diesen teleologischen Denkvorgang erhebt jeder Hegel–Kritiker den Einspruch, dass Hegels Philosophie eine systematische Homogenität, nämlich die systemphilosophische Abgeschlossenheit, die immer mit der totalen Vermitteltheit zwischen Wirklichkeit und Denken bzw. Wahrheit und Geschichte vollendet ist, aufweist. So gesehen kann man sagen, dass das Selbst sich selbst in der prozessualen Anerkennungsbewegung als ein freies nur nachträglich bestimmen und erkennen kann, erst nachdem es den Selbsterfahrungsprozess, während dem es sich selbst negiert, im Verhältnis zum allgemeinen Willen durchlaufen hat. Im Anschluß treffen wir auf die unerwartete Gefahr, die darin besteht, dass der entwicklungslogische Verfahrensverlauf der Anerkennungsbewegung die Individualität des Selbst als ein freier und besonderer Mensch zunehmend vernichten und schließlich der staatlichen Machtherrschaft unterwerfen kann. 153 Im Anschluss an diese Hegel–Kritik können wir hier auch Schellings kritischer Bezugnahme auf Hegels dialektische Entwicklungslogik der Selbstnegation, die im Grunde mit Hegels Wissenschaft der Logik zu tun hat, unsere Aufmerksamkeit zuwenden. 153 Hier handelt es sich um die zwei Hauptpunkte in der Hegel–Kritik des späten Schellings: Einerseits die Unterscheidung zwischen der „negativen“ und der „positiven“ Philosophie, die „die freie Begegnung mit dem wirklichen Prinzip selbst sein muß“, 154 andererseits die ungelöst bleibende Systemfrage in Bezug auf Hegels Begriff der Realität. Aus Sicht des späten Schellings kann Hegels Philosophie nicht mehr die absolute Philosophie sein, sondern sie ist lediglich die negative Philosophie, sofern sie für Schelling die realen Gegenstände im bloßen Denken negativ einholt, d. h. das Denken in dieser Philosophie seinen Gegenstand von sich selbst aus logisch und begrifflich herstellt. Denn wenn eine Philosophie, Schellings Ansicht zufolge, de facto absolut wäre, sollte sie unter allen Umständen die negative und die positive Philosophie gleichermaßen umfassen können. Für ihn gilt das begriffliche Denken nunmehr als dasjenige, das alles in sich selbst negierend aufnimmt und deshalb nur um sich selbst kreist. Dies berücksichtigend, merkte der späte Schelling gegenüber Hegels Konzept für den „Begriff“ in dessen Logik kritisch an, dass der „Begriff alles sei und nichts außer sich zurücklasse“. 155 Ausgehend von dieser Hegel–Kritik stellt Schelling seine Unterscheidung der negativen und der positiven Philosophie ins Zentrum seines eigenen Denkens. Im Hinblick auf eine solche Unterscheidung hat er auch zugegeben, dass es Hegels philosophisches Verdienst war, die negative Philosophie, also diejenige Philosophie, die das Reale auf das „reine Denken“, das in seinem Vollzug mit seinem Sein und sich selbst eins ist, vollkommen zurückführt, als ein unabdingbares Paradigma der Philosophie zu erarbeiten. Infolgedessen erhebt Schelling später aber auch einen Anspruch auf die positive Philosophie in dem Sinn, dass die negative Philosophie nur im notwendigen Übergangsweg zur positiven Philosophie ihre Berechtigung hat. Aus diesem Denkansatz Schellings zur positiven Philosophie können wir schlußfolgern: Wo die Philosophie ihre prinzipielle Negativität gegenüber der Wirklichkeit in ihrem unvordenklichen Existieren durchschaut und sich aus dieser, der sie ja in der Praxis angehört, erkennt, da vermag sie zu einer „positiven Philosophie“ fortzuschreiten, die sich als ein Begreifen aus Wirklichkeit und Geschichte 153 154 155 Vgl. Wolfdietrich Schmied–Kowarzik, Bruchstücke zur Dialektik der Philosophie – Studien zur Hegel – Kritik und zum Problem von Theorie und Praxis, Düsseldorf 1974, S. 119 – 136. Ders., „Anhang. Ansätze einer materialischen Kritik der Hegelschen Logik bei Schelling“, in: ders., Die Dialektik der gesellschaftlichen Praxis – Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie, Freiburg/München 1981, S. 247 – 261. Auch zudem Rolf–Peter Horstmann, Die Grenzen der Vernunft – Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des Deutschen Idealismus, 2. Aufl., Weinheim 1995, S. 245 – 268. Schmied–Kowarzik, Bruchstücke zur Dialektik der Philosophie, S. 126. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Schriften von 1813 – 1830, Bd. 10, in: Schelling Ausgewählte Werke, Darmstadt 1989, S. 409. 154 versteht und die Schelling daher auch gelegentlich als eine auf die freie Tat des erfahrenden Denkens gegründete „geschichtliche Philosophie“ bezeichnet.“ 156 Nach dieser Feststellung, dass Hegel in der negativen Philosophie die absolute Philosophie gesehen hat, ist Schelling später, wie von Schmied–Kowarzik formuliert, der Frage nach der systematischen Inkompatibilität zwischen dem Begriff als der logischen Idee und der Natur, nämlich der Realität, in Hegels Philosophie nachgegangen. Im Hinblick auf die ungelöste Systemfrage in Hegels Philosophie schreibt Schelling später: „[…] Für so verdienstlich man daher auch die Anwandlung anschlagen muß, die Hegel hatte, die bloß logische Natur und Bedeutung der Wissenschaft, die er vor sich fand, einzusehen, so verdienstlich insbesondere es ist, daß er die von der früheren Philosophie im Realen verhüllten logischen Verhältnisse als solche hervorgehoben hat, so muß man doch gestehen, daß in der wirklichen Ausführung seine Philosophie (eben durch die Prätension auf objektive, reale Bedeutung) um ein gut Theil monströser geworden ist, als es die vorhergehende je war, […].“ 157 Dieser Satz bezieht sich nunmehr nicht nur auf den Endpunkt der dialektischen Denkbewegung als der absoluten Einheit von dem Begriff bzw. der Idee und der Realität bzw. der Wirklichkeit, sondern auch auf den absoluten Anfang als das unbedingte Erste der logischen Denkbewegung in Hegels Logik. Denn wenn der Begriff bzw. die Idee durch den logischen Entwicklungsweg hindurch in der Tat die vollkommene Identität mit der Realität bzw. der Wirklichkeit erreicht oder wenn Hegels Logik zumindest diesen Entwicklungsweg, auf dem sich der Begriff als die sich selbst wissende Idee erkennt, konsequent darstellt, soll diese absolute Einheit vor jedem logischen Verfahren bereits als ein absolutes Prinzip im Anfangspunkt, das als Darstellungswegweiser innerhalb des dialektischen Vorgangsrahmens fungieren muss, vorausgesetzt werden. Sodann ist der absolute Anfang, der sich selbst als das „unvermittelte Unmittelbare“, als Voraussetzungslosigkeit bezeichnet, damit zum Vorausgesetzten, nämlich zum Vermittelten geworden. Nun geht es bei Schelling nicht darum, „das absolute Prinzip“, nämlich den voraussetzungslosen Anfang bei Hegel im logischen Denkvollzug zu bestimmen, sondern darum, „das absolute Prinzip als auch ein über das Denken mächtiges anzuerkennen“. Es geht um „die Bejahung der Vorausgesetztheit des Prinzips im Denkakt“, da das erste Prinzip nicht vorbestimmt ist, sondern durch das Denken gesucht werden soll. 158 Daran anschließend richtet der späte Schelling seine Grundeinsicht dahin, „daß das wirkliche Denken immer auf die entgegenstehende Wirklichkeit, die dem 156 Schmied–Kowarzik, „Anhang. Ansätze einer materialischen Kritik der Hegelschen Logik bei Schelling“, S. 258. 157 Schelling, Ebd., S. 410, meine Hervorhebung. 158 Schmied–Kowarzik, Bruchstücke zur Dialektik der Philosophie, S. 127. 155 Denken vorausliegende Existenz, bezogen ist, die es niemals voll in seine Denkbestimmungen aufzuheben vermag.“ 159 So stellt Schelling schließlich auch die ambivalente Unvollkommenheit von Hegels philosophischem System fest. Denn in seinen Augen war es überflüssig, dass Hegel vor der Logik die Realphilosophie konzipiert hat und nach der Logik noch die Geistesphilosophie in Abgrenzung zu der Naturphilosophie geschrieben hat, wenn die Logik im Grunde die absolute Identität zwischen der Idee und der Realität, die vollendete Einheit zwischen dem Begriff und der Wirklichkeit bzw. der Natur, bereits erreicht hat. Unter dem Titel „Die Grenze der Reflexionsphilosophie“ in Wahrheit und Methode, setzt Gadamer, so wie später Schelling Hegels Philosophie der negativen Philosophie zugeordnet hat, Hegels reflexionsphilosophischem Gedankengang die „hermeneutische Reflexion“ 160 entgegen. Dort fokussiert Gadamer seine Kritik auf die totale Vermitteltheit der zu sich selbst zurückkehrenden Selbsterkenntnis in Hegels Denkmodell der reflexiven Selbsteinsicht des Selbstbewusstseins. Gadamers kritische Distanz zu der reflexiven Verschlossenheit des Selbstbewusstseins in Hegels Subjektphilosophie bahnt sich unter der Fragestellung an: „Werden wir damit nicht gezwungen, Hegel recht zu geben, und muß uns nicht doch die absolute Vermittlung von Geschichte und Wahrheit, wie sie Hegel denkt, als das Fundament der Hermeneutik erscheinen?“ (GW. 1, S. 347) Wenn Gadamer auch Hegels Denkmodell von der reflexiven Selbsterkenntnis im „Anderssein“ bzw. von den wechselseitigen Einwirkungen auf den Anderen seiner selbst als einem Grundmodus der ontogenetischen Selbstausbildung des Selbstbewusstseins in seine Konzeption für das hermeneutische Bewusstsein aufgenommen hat, bahnt das hermeneutische Bewusstsein sich den anderen Weg als die dialektische Reflexionsbewegung des Hegelschen Subjekts, durch die hindurch es die vollständige Selbstgewissheit, die unerschütterlich und unhintergehbar ist, erreicht. Dahinter liegt Gadamers Grundanliegen zur Kritik am neuzeitlichen Wissenschaftsbegriff, nämlich am Subjektivismus und am Objektivismus, mit der wir uns später beschäftigen werden. 161 Sofern die Struktur der reflexiven Selbsterkenntnis des Subjekts sich immer noch auf die grundsätzliche Spaltung von Subjekt und Objekt gründet, d. h. auf dem Grundstein, „sich selbst zum Gegenstand [zu] machen“, aufgebaut ist, muss das Subjekt in seiner Reflexionsbewegung eine doppelte Objektivierung erfahren: Einerseits die Selbstobjektivierung, ja das Selbst als sein Objekt, andererseits das bestimmte Objekt, das von 159 Schmied–Kowarzik, Ebd., S. 256. Vgl. Michael Hofer, „Hermeneutische Reflexion? – Zur Auffassung von Reflexion und deren Stellenwert bei Hans–Georg Gadamer“, in: Gadamer Verstehen / Understanding Gadamer, hrsg. v. Mirko Wischke u. Michael Hofer, Darmstadt 2003, S. 57 – 83 u. dazu Riccardo Dottori, Die Reflexion des Wirklichen – Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer, Tübingen 2006, S. 557 – 586. 161 Vgl. Kap. I – 1. Die ontologische Grundlage der Erfahrung vom II. Teil in dieser Arbeit. 160 156 seinem Anderen ausgeschlossen ist. Zweifelsohne wird uns hier gezeigt, dass die Verdoppelung der reflexiven Selbstvergegenständlichung des Subjektes mehrschichtig ist, da das Subjekt in der sich selbst ausbildenden Reflexionsbewegung die Möglichkeit, sich selbst zum Gegenstand zu machen, nicht nur von sich selbst, sondern auch immer schon von seinem Anderen her ableitet. Darüber hinaus müssen wir uns selbst in Bezug auf die subjektive Selbstreflexivität fragen, inwiefern sich das unmittelbare Ichsein, das den absoluten Ausgangspunkt der Reflexionsbewegung prägt, von sich selbst unterscheiden kann, wenn es keinen Anstoß des Anderen zur Reflexion gibt; ob das Subjekt überhaupt die vollständige Selbstobjektivierung als die Grundbedingung für die totale Zurückführung auf sich selbst ohne die bloße Vernachlässigung des eigenen Anspruchs auf die Aufbewahrung der Unmittelbarkeit erlangen kann, wenn die Grundmotivation der Reflexionsbewegung auf die Andersheit des Anderen angewiesen ist. Somit stellen wir fest, dass die reflexive Selbstvergegenständlichung des Bewusstseins von Anbeginn an nicht nur die Differenz von seinem Unmittelbaren, sondern auch die von seinem Anderen aufweist. So befindet sich die Selbstreflexion grundsätzlich in der unauflösbaren Bewegtheit von dem Selbstbezug und dem Fremdbezug. Aus Gadamers Sicht kommt der Rückzug des Bewusstseins zu sich selbst deshalb nicht durch die vollkommene Selbsterkenntnis, durch die sich selbst gänzlich einholende Reflexionsbewegung zustande, sondern ist immer schon auf ein unendliches Fortschreiten ausgerichtet, das stets vom nie ganz auflösbaren Fremdbezug motiviert ist. Wenn Gadamer sich auch, wie bereits erwähnt, von Hegels homogener Systemganzheit und insbesondere von der vollkommenen Selbsteinsicht durch die reflexive Selbsterfahrung des Selbstbewusstseins kritisch distanziert hat, gilt Gadamer die Reflexionsstruktur des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins auf dem tendenziellen Weg zum Selbstwissen als eine notwendige Selbstbewegung, die nicht diejenige, die sich nachträglich auf sich selbst zurückführt und sich auf dem nur um sich selbst kreisenden Selbstbezug vollendet erkennt, sondern von ihrer inneren Intention her gefördert wird. Denn das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein verhält sich auch zu sich selbst, jedoch nur durch seinen Eintritt in den Lebensvollzug, welcher stets selbstbezüglich von statten geht. Da das hermeneutische Bewusstsein das bewusste Wissen davon ist, dass es bereits in die lebensweltlichen Bezüge einbezogen ist, d. h. dass es sich immer schon unter bestimmten Umständen befindet, ist seine reflexive Selbsterkenntnis nicht die absolute Übertragung des Verstandenen auf das Denken, sondern befindet sich in dem unerschöpflichen Prozess des Verstehens des Verstandenen unter den wirkungsgeschichtlichen Bedingungen, in dessen Verlauf das Verstandene auf jeden Fall immer wieder neu erfahrbar wird. Insofern geht die 157 hermeneutische Reflexionsbewegung des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins nicht von der absoluten Voraussetzungslosigkeit, sondern immer schon von der vorreflexiven Voraussetzung, die nie ganz einholbar ist, aus. Die hermeneutische Reflexion wird deshalb nicht aus dem deduktiven Prinzip abgeleitet, sondern als die praktische Applikation auf ihren betroffenen Fall bereits aufgrund der gemeinsamen Überzeugungen von dem gesellschaftlichen und geschichtlichen Überlieferten vorausgesetzt. Dementsprechend steht das hermeneutische Bewusstsein immer schon unter dem wirkungsgeschichtlichen Einfluss und ist sich seiner Endlichkeit in der unentrinnbaren Bedingtheit bewusst. Aus diesem Grund kann man sagen, dass das hermeneutische Bewusstsein, das seine Reflexionsbewegung im Wissen um seine Grenzen leitet und durch die reflexive Anwendung auf seinen konkreten Fall den Blick ins Innere wendet, des richtigen Wissens in der bestimmten Situation bedarf. Da die hermeneutische Reflexion das bewusste Wissen um ihre geschichtliche Begrenztheit ist, da die reflexive Selbsterkenntnis des hermeneutischen Bewusstseins sich nicht in der Verschlossenheit vollzieht, sondern sich mit der sich ständig verändernden Situation mit bewegt, wird ersichtlich, dass diese hermeneutische Selbsterkenntnis über ihre Grenze hinaus immer wieder weitergeht und nicht begrenzt werden kann. In Gadamers philosophischer Hermeneutik hat die hermeneutische Reflexion des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins zunächst ihren ausgezeichneten Ort da, wo sie sich vollzieht, nämlich im Spielverhältnis und im Gesprächsverhältnis. Sofern die beiden Verhältnisse als die Grundstruktur der hermeneutischen Erfahrung des geschichtlich bedingten Menschseins von vornherein auf die unvermeidbare Angewiesenheit auf die Andersheit, nämlich auf die wechselseitige Beziehung der gleichzeitigen Reaktionen verweisen, sind sie aus der hermeneutischen Sicht strukturell gleich. Für uns liegt nunmehr auf der Hand, dass sich das hermeneutische Bewusstsein auf seinem jeweiligen Standpunkt deshalb bereits auf dem Spielfeld befindet, da das Bewusstsein in seiner bestimmten Intentionalität dasjenige, was im Weltbezug geschehen ist, bewusst macht und seinen Rückzug auf sich selbst nicht auffällig gestaltet, dabei aber dennoch stets begleitet wird. Indessen gilt Gadamer das Spielverhältnis als der Grundmodus der ästhetischen Erfahrung, 162 162 Zum ästhetischen Spiel, vgl. Ruth Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels – Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst, Frankfurt a. M. 2000, S. 7 – 72. Wenn er hier unter dem eigenen Verständnis von Schlegels These, Gadamers Denkansatz zur ontologischen Erfahrung im ästhetischen Spielverhältnis zu kritisieren versucht hat, hat er absichtlich oder unfreiwillig Gadamers Betonung auf die Endlichkeitserfahrung des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins und auf die ununterschätzbare Seinsvalenz des Kunstwerks ignoriert. Er hat außerdem unter der „Langsamkeit“ das ästhetische „Verweilen bei“ in Gadamers Hermeneutik verstanden. Aber aus hermeneutischer Sicht geht es nicht um die Geschwindigkeit des Verstehens, also weder um die Langsamkeit, noch um die Schnelligkeit, sondern es handelt sich bei Gadamer um die ontologische Seinsweise der menschlichen Erfahrung, einerseits das Teilnehmen des Darstellenden am Dargestellten und das Teilhaben des Dargestellten am Darstellenden, die 158 noch genauer, als die existenzielle Seinsweise der menschlichen Erfahrung. Mit seiner emphatischen Aussage vom „Primat des Spieles gegenüber dem Bewußtsein des Spielenden“ erhebt Gadamer in diesem Zusammenhang einen Einwand gegen die verfügbare Herrschaft des Subjekts über die ästhetische Erfahrung. (GW. 1, S. 110) Wenn auch jeder Spieler sein Spiel spielt, verläuft das Spiel doch nicht gemäß der geplanten Absicht des Spielers. Das Spiel hingegen stellt sich selbst dar, weil es sich immer schon mit dem gleichursprünglichen Verhältnis zwischen Zug und Gegenzug hin- und herbewegt. Nun kann man sagen, dass das subjektive Bewusstsein mit dem Eintritt ins Spiel den reflexiven Rückzug auf sich selbst nur unter den spielerischen Rahmenbedingungen, die von seinem Mitspieler, genauer, von der Spielsituation her vorgegeben sind, erfährt und dass das Spiel in seiner Selbstdarstellung den Spieler von der kausal verketteten Zweckorientierung befreit. Eine solche begrenzte Freiheit befindet sich in der Seinsmöglichkeit der subjektiven Wahlentscheidungsfreiheit, die immer schon vom reflexiven Situationswissen her erschlossen ist. Das Spiel bedarf nur der amüsanten Bereitschaft der Teilnehmer zum Mitspielen. Das Sich-Einlassen auf das Spiel hängt zwar von der Lust auf die Teilnahme am Spiel ab, jedoch verlangt das Spiel auch das Ernstnehmen der jeweiligen Spielsituation, das jeden einzelnen Spieler zur übersubjektiven Dimension, wo er sich selbst vergisst, hinführt. Bezüglich der „Selbstvergessenheit“ im Spiel, wird noch gezeigt werden, dass das Spiel nicht vom Subjekt, nämlich vom geplanten Zweck aus gespielt wird, sondern von sich selbst aus spielerisch abläuft. Infolgedessen schafft das Spiel seinen eigenen Spielraum, den nur die Spielregeln beherrschen. In Anknüpfung an Johan Huizingas Denkanliegen zum Spiel als einer anthropologischen Kategorie schreibt Gadamer nunmehr: „Es macht den Spielcharakter menschlicher Spiele aus, daß Regeln und Forderungen aufgestellt werden, die nur in der Geschlossenheit der Spielwelt gelten. […] Innerhalb des Spieles freilich haben diese Regeln und Forderungen ihre eigene Verbindlichkeit, die man so wenig verletzen kann wie irgendwelche uns bestimmenden und verbindlichen Regeln des Zusammenlebens sonst.“ (GW. 8, S. 87) 163 Obwohl das Spiel de facto einen imaginären Spielraum konstruiert, ja in diesem 163 im Grunde den spekulativen Sinnganzheitshorizont bildet. Somit ist auch entscheidend, dass Gadamers Ansatzpunkt nicht mehr zur neuen Begründung einer Ästhetik, ja Wissenschaft der Schönheit, sondern zu den Phänomenen der ästhetischen Erfahrung, nämlich der ontologischen Erfahrung des Schönen, tendiert. In Gadamers Augen hat die ästhetische Erfahrung in ihrem Wechselverhältnis denselben Stellenwert wie die Erfahrung des überlieferten Textsinns und der sprachlichen Erfahrung im Gespräch mit dem Anderen. Ganz ähnlich sagt J. Huizinga in seinem Buch: „Innerhalb des Spielplatzes herrscht eine eigene und unbedingte Ordnung. […] Es schafft Ordnung, ja es ist Ordnung. […] Diese innige Verknüpfung mit dem Begriff der Ordnung ist vielleicht der Grund, daß das Spiel, […], zu solch großem Teil innerhalb des ästhetischen Gebiets zu liegen scheint. Das Spiel, so sagen wir, hat eine gewisse Neigung, schön zu sein. Der ästhetische Faktor ist vielleicht identisch mit dem Drang, eine geordnete Form zu schaffen, die das Spiel 159 Sinne von der alltäglichen Lebenslage mehr oder weniger distanziert ist, hat das Spiel im Grunde eine lehrreiche Funktion, da jeder Beteiligte mit dem freiwilligen Sich-Einlassen die Spielregeln erlernt und sich ihnen unausweichlich im weiteren Spielverlauf unterwirft. So bildet der Spielraum, der immer schon von den eigenen Regeln des Spiels begrenzt ist, den souveränen Sinnhorizont, vor dem jeder Teilnehmer das Wie der zwischenmenschlichen Verhaltensweise, nämlich dasjenige, den Anderen in jeder bestimmten Situation ernst zu nehmen, lernt. Aufgrund einer solchen zwischenmenschlichen Verbindlichkeit im Spielverhältnis, verläuft das Spiel zwar jeweils auf seine je eigentümliche Weise anders und neu, doch das Spiel bleibt damit auch stets nachvollziehbar und wiederholbar. Analog zum Charakter dieser Selbstdarstellung des Spiels können wir feststellen, dass die Nachvollziehbarkeit im ständigen Anders–sein–Können den potenziellen Weg der offen bleibenden Selbsterkenntnis im wechselseitigen Reflexionsfeld bahnt. In Gadamers Auffassung vom nie ganz einholbaren Selbstwissen durch die hermeneutische Reflexionsbewegung im wechselseitigen Spielverhältnis geht es deshalb immer um den mitkonstitutiven Anteil der unangeeigneten Andersheit, da die hermeneutische Reflexion im Grunde die des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins war und das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein von vornherein aus der hermeneutischen Sicht bedingt ist. in allen seinen Gestalten belebt.“ Johan Huizinga, Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg 1987, S. 19. 160 Zweiter Teil: Die ontologische Struktur der hermeneutischen Erfahrung im Verstehensmodell „[…] daß der eigentliche Sinn unserer Endlichkeit oder unserer Geworfenheit darin besteht, daß wir nicht nur unserer historischen Bedingtheit, sondern vor allem der Bedingtheit durch den anderen gewahr werden. Gerade in unserem ethischen Bezug zum anderen wird uns klar, wie schwer es ist, den Anforderungen des anderen gerecht zu werden oder bloß gewahr zu werden. Die einzige Weise, unserer Endlichkeit nicht zu erliegen, ist, sich dem anderen zu öffnen, dem ‚Du’ zuzuhören, das vor uns steht.“ 1 Die philosophische Hermeneutik versucht zunächst, den naiven Dogmatismus des naturwissenschaftlichen Methodenbewusstseins und den neuzeitlichen Glauben an die fundamentale Gewissheit der Subjektivität zu erklären, anders gesagt, einen abgeschlossenen Monolog einerseits in der Naturwissenschaft, andererseits in der neuzeitlichen Subjektphilosophie philosophisch zu reflektieren und kritisch zu überwinden. Hierbei richtet sie ihren Blick auf einen unumgänglichen Fragehorizont und damit zugleich auf eine andersartige Annäherung, nämlich auf einen neuen Zugang zur Sinnwelt gegenüber dem wissenschaftlichen Methodenanspruch. Aus dieser kritischen Auseinandersetzung folgt Gadamers Grundeinsicht in die ontologische Struktur der menschlichen Erfahrungen. In der Folge gelangt das menschliche Verstehen nicht nur zu umfassenderen und komplexeren Verfahrensvorgängen, mit anderen Worten, zu dialektisch ineinander übergehenden Erfahrungsprozessen, sondern es verweist auf immer neu situierte Grundlagen, die von den vorwissenschaftlichen Sinngefügen geprägt, also geschichtlich, kulturell tradiert sind. Gadamer gilt das Verstehen als solches als allgemeines Grundphänomen des Menschseins, da wir bereits in die geschichtlich strukturierte Erfahrung eingebettet sind. Aufgrund dieser Einsicht in die geschichtliche Bedingtheit der menschlichen Erfahrung geht es ihm weder um die methodische Exaktheit, noch um ein letztbegründetes Wahrheitskriterium, sondern um die Angemessenheit der Sache im unendlichen Verlauf der Wahrheitssuche. 1 Hans–Georg Gadamer, Die Lektion des Jahrhunderts – Ein philosophischer Dialog mit Riccardo Dottori, Münster 2002, S.33. 161 Aus hermeneutischer Sicht ist das Verstehen, das die angemessene Annäherung an den Sachsinn und den offenen Zugang zur Sinnwelt sucht, der Inbegriff aller möglichen Modi der menschlichen Erfahrungen. Diesbezüglich kann man sagen, dass das Menschsein überhaupt, Heideggers ontologischer Auffassung zufolge, das „Sich–Verstehen“ und das „Sich– Auslegen“ sei oder Ch. Taylor’s anthropologischer Perspektive zufolge, „ein sich selbst interpretierendes Tier“.2 So gesehen darf der „Text“ im engeren Sinn nicht mehr nur auf das schriftlich geschriebene Werk beschränkt sein, sondern soll für alle sinnfähigen Gegenstände des Verstehens, einschließlich der sprachlichen und nicht–sprachlichen gelten. Kurzum kann man das Verstehen in der Hermeneutik als die zugrunde liegende Lebenspraxis des menschlichen Daseins bezeichnen; es hat deshalb sämtliche Sinnzusammenhänge zu seinem Gegenstand. In diesem Sinn bezeichnet der Text sämtlichen Sinngehalt, mit dem der Verstehende angemessen umzugehen versucht, sobald er verstehen will. So gesehen lässt sich sagen, dass das Verstehen nicht von einem voraussetzungslosen Nullpunkt ausgeht, sondern von vornherein mit der geschichtlich tradierten Überlieferung als seiner vorreflexiven, vorwissenschaftlichen, vorgesellschaftlichen Bedingtheit zu tun hat. Mit anderen Worten: Das Verstehen konfrontiert uns aus einer bestimmten Perspektive heraus, die an die vorgegebene Verstehenssituation geknüpft ist, mit seinem zu Verstehenden. Denn das Verstehen findet immer schon in dieser Begegnung, in deren Vollzug statt. Aus der existenziellen Begegnung der menschlichen Wahrheitserfahrung gewinnen wir das Bewusstsein, dass die Geschichte nicht nur die ontologische Grundlage unserer Erfahrung ist, sondern immer auch über uns selbst hinausragt. Hier ist die Geschichtlichkeit der menschlichen Erfahrung zum einen die jeweils bestimmte Grundlage für eine wechselseitige Anerkennungsbeziehung als die Erfahrung des Anderen. Wenn deshalb gezeigt werden kann, dass die menschliche Erfahrung unabdingbar vom geschichtlichen Kontext abhängig ist, dann müssen wir auch annehmen, dass sie den Anerkennungsbezug, nämlich das Wechselverhältnis zwischen dem Vergangenen und dem Gegenwärtigen, in ihrer Grundstruktur aufweist: Sie sorgt andererseits von vornherein für eine Auflösung der Grenzen, d. h. offenbart permanent den möglichen Sinn der tradierten Bedingtheit, da sie sich in einer unendlich fortlaufenden Bewegung befindet. Nun kann man sagen, dass sich das menschliche Verstehen im interaktiven Sinnraum zwischen unserer offenen Chance auf die Teilhabe am Wahrheitsgeschehen und der unaufhebbar bedingten Sichtweise bewegt. In diesem medialen Zwischenspiel von beiden polarisierten Komponenten wirft das Verstehen seinen Blick stets auf den Wahrheitssinn als einen Vollzugssinn. Gleichwohl hat diese Sicht auf die Wahrheit in der philosophischen 2 Ch. Taylor, „Interpretation und die Wissenschaften vom Menschen“, in: Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften, hrsg. v. H. – G. Gadamer u. Gottfried Boehm, Frankfurt a. M. 1978, S. 184. 162 Hermeneutik kein vorherbestimmtes Ziel, sondern vielmehr bezieht sich der erwünschte Wahrheitsvollzug im hermeneutischen Verstehen auf eine je einstimmige Sinnganzheit, die sich unter der bestimmten Bedingungen der Verstehenssituation entfalten und auch für die andere Sinnmöglichkeit offen halten muss. Eine solche Hermeneutik sieht es damit auch als ihre Aufgabe an, nicht nur den schriftlich geschriebenen Text zu verstehen und auszulegen, sondern sich vielmehr von vornherein mit dem Anderen zu verständigen und ihn kommunikativ zu erreichen. Das bedeutet: Die Hermeneutik zielt im Grunde auf die Gemeinsamkeit der Sinnsuche mit dem Anderen in der vorgegebenen Gesprächssituation ab. Aus Gadamers Sicht gilt selbst im Kontext des Textverstehens der Text als jeweiliger Gesprächspartner. Angesichts dessen erweitert sich die begriffliche Bedeutung vom Text, wie bereits erwähnt, auf alle sinnfähigen Gegenstände. Infolgedessen ist jede Verstehenspraxis bei Gadamer von vornherein ein Gespräch mit dem Anderen und reicht damit zugleich in die Lebenspraxis der alltäglichen Lebenszusammenhänge hinein. Hierbei handelt es sich nunmehr um die ethische Verständigungspraxis unter den Beteiligten im Dialogverhältnis. Wenn wir unter einer bestimmten Situation miteinander sprechen und dem Gesprächspartner die eigene Überzeugung mitteilen, wenn wir die Handlung des Anderen verstehen oder umgekehrt dem Anderen unsere eigene Haltung verständlich machen, wollen und müssen wir uns zuallererst um eine Verständigung über uns selbst bemühen, obwohl die Gefahr des Nicht–Verstehens und des Missverstehens in diesem unermüdlichen Versuch vorhanden ist: Um mit dem Anderen zusammen zu handeln und zu leben, müssen wir zuerst den Anderen als unseren Gesprächspartner annehmen und uns miteinander kommunikativ verstehen. Dies ist die grundsätzliche Voraussetzung für die Bildung von Gemeinsamkeit, die allen anderen Urteilen vorausgeht. Nur in diesem wechselseitigen Dialogverhältnis können wir über einen bestimmten Punkt streiten und diskutieren. Anders formuliert, können wir nur in diesem dialogischen Verlauf des Nachfragens und der Unterstellung die mögliche Gefahr des Missverstehens vermeiden, zumindest mildern, da der Dialog in seinem eigenen Entwicklungsprozess unsere dogmatische Eigensinnigkeit und unsere naive Zufriedenheit mit einem einmal gefundenen Sinngehalt ständig erschüttert. So gesehen ist das Verstehen des Anderen, die dialogische Verständigung nicht nur das Telos der hermeneutischen Verstehenspraxis, sondern auch die wesentliche Grundlage für das menschliche Zusammenleben. Aus der hermeneutischen Sicht sind alle Beteiligten am Dialog immer schon mit dem gemeinsamen Sinnnetzwerk verwoben, das als das den Weltsinn freilegende ‚Zwischen’ 163 vorgegeben ist, von vornherein über die eigensinnige Einzelheit hinausgeht und sich deshalb als eine Wir–Dimension darstellt. Aufgrund dieser Verbundenheit mit der Gemeinsamkeit stellt der hermeneutische Dialog die Anerkennung unserer unentrinnbaren Endlichkeit in den Vordergrund und appelliert an die Anerkennung des Eigenrechts des Anderen. Aufgrund dieses Aspekts dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass der hermeneutische Dialog mit der Hegelschen Bewegung des Anerkennens, wie wir bereits gesehen haben, Schritt hält,3 da er nicht nur dasselbe Strukturmoment aufweist, d. h. den Weg der unmittelbaren Begegnung mit dem ontologischen Gegenüber durch Nachfragen und strittige Diskussionen zur Gemeinsamkeit in seinem Sachverhalt bahnt, sondern dieses wechselseitige Anerkennungsverhältnis auch das Leitmotiv für seine Entwicklung bildet. Die gegenseitige Anerkennung, also die genuine Intersubjektivität, findet in diesem offenen Dialogprozess ihren speziellen Ort, an dem die Beteiligten, ohne sich die Andersheit des Anderen anzueignen, ihr Eigenrecht behaupten, zueinander verhalten und zum potenziellen Einverständnis gelangen können. Die ethische Haltung in Bezug auf Gadamers Einsicht in die Bildung von Gemeinsamkeit durch das dialogische Wechselverhältnis, die Hegels Auffassung von der intersubjektiven Anerkennungsbeziehung im Gesellschaftsverhältnis berücksichtigt, bedeutet, dass dem hermeneutischen Dialog die Anerkennung des Anderen, sozusagen die Verlässlichkeit der Wahrheitssuche des Anderen zugrunde liegt, dass diese Anerkennung sich aus der Anerkennung der existenziellen Endlichkeit des Menschen und aus der darauf gegründeten Zusage über die Grenze unserer Erkenntnis ergibt. So gesehen ist der Andere bzw. der Fremdsinn, Gadamers Ansicht zufolge, nicht mehr ein objektivierbares Ding, ein stillschweigendes Objekt, sondern spricht uns immer schon an und ist so gesehen bereits in ein interaktives Verhältnis mit uns eingetreten. Demzufolge vollzieht sich das Wahrheitsgeschehen im Verstehen bzw. die gemeinsame Sinnstiftung in der dialogischen Verständigungspraxis, nicht mehr jenseits dieses verketteten Sinnraums, sondern immer schon mit dem wachsamen Verweilen in diesem interaktiven Zwischenspielraum, in dem wir unsere 3 Zum Anerkennungsproblem in Gadamers Hermeneutik vgl. Axel Honneth, „Von der zerstörerischen Kraft des Dritten – Gadamer und die Intersubjektivitätslehre Heideggers“, in: Hermeneutische Wege – Hans–Georg Gadamer zum Hundertsten, hrsg. v. Günter Figal, Jean Grondin u. Dennis J. Schmidt, Tübingen 2000, S. 307 – 324. In diesem Aufsatz hat er zunächst die intime von der anonymen Beziehung im Anerkennungsverhältnis unterschieden. Mit dieser Unterscheidung wollte er Gadamers Einsicht in das intersubjektive Wechselverhältnis im Dialog, in die daraus folgende Forderung an die ethische Haltung, auf die intime Beziehung begrenzen. Hiermit hat er den notwendigen Anspruch auf das Dritte, wie im Titel angedeutet, in der anonymen Beziehung erhoben. Aber bei Gadamer geht es, soweit ich verstehe, um den inneren Lernprozess im wechselseitigen Dialogverkehr. Deshalb fragt er sich selbst immer nach dem Guten in Bezug auf die Aristotelische Ethik, das der Frage nach der Gerechtigkeit voraus gehen soll und dieses Gute darf sich in Gadamers Augen nie auf einem äußeren Dritten begründen, sondern soll durch den geschichtlichen Bildungsprozess aus seinem Inneren herauskommen. In diesem Dialogprozess soll sich die Anonymität auf die intime Übereinstimmung übertragen. 164 Überzeugung vorlegen und auf die Stimme des Anderen hören können. Wir müssen deshalb berücksichtigen, dass Gadamers Hermeneutik nicht nur verständlich machen will, wie das Wahrheitsgeschehen, das sich über die Grenze der Textinterpretation hinaus universell ereignet, mit und bei uns stattfindet, sondern dass sie auch einräumt, dass dieses Wahrheitsgeschehen über unsere reflexive Verständlichkeit hinausragt. Im Anschluss an das oben vorweggenommene Verständnis will ich nunmehr auf die Grundstrukturen des menschlichen Verstehens in Gadamers philosophischer Hermeneutik eingehen. Hierbei geht es mir um drei Punkte: Erstens die Geschichtlichkeit als die ontologische Grundlage für die menschlichen Erfahrungen überhaupt; zweitens den Sinnganzheitshorizont als die Vollzugsform jeder Verstehenspraxis; und drittens die hermeneutische Offenheit für den Anderen. Aus dieser Perspektive hoffe ich, dass wir schließlich sehen werden, dass dem Verstehen bei Gadamer das interaktive Dialogmodell zu Grunde liegt, dass sich die menschliche Verstehenspraxis im dialogischen Modus der intersubjektiven Wechselseitigkeit vollzieht und dass dieses dialogische Verstehensverhältnis nicht nur die primäre Wechselseitigkeitsstruktur der intersubjektiven Anerkennungsbewegung impliziert, sondern auch für den lebendigen Sinnraum in dieser Bewegung sorgt. Im Anschluß daran stellt sich die Frage: Unter welchen Bedingungen ist das Verstehen überhaupt möglich? Von welcher Bedeutung ist die hermeneutische Offenheit bzw. die Horizontverschmelzung in Gadamers Hermeneutik? Wie und inwiefern kann das dialogische Anerkennungsverhältnis den Gemeinsinn im offenen Prozess finden und etablieren? Wo findet die Bewegung des wechselseitigen Anerkennens den vitalen und hervorragenden Sinnraum für ihre Erfüllung? 165 I. Die Geschichtlichkeit der Erfahrung des hermeneutischen Bewusstseins I – 1. Die ontologische Grundlage der Erfahrung: Die Rehabilitierung der Vorurteile als die Vorstruktur des Verstehens Vorweg ist festzuhalten, dass das hermeneutische „Vor“, nämlich die Vorstruktur im Grunde die ontologische Angewiesenheit der menschlichen Erfahrung auf die Andersheit bedeutet. Denn wenn das menschliche Verstehen aus hermeneutischer Sicht hauptsächlich mit dem tradierten Überlieferten, das wir nicht als ein befremdendes Anderes, das keinen Bezug zu uns hat, sondern als unseren Anderen, der immer schon auf uns bezogen ist, annehmen können, zu tun hat, verweist das hermeneutische Vor von vornherein auf den geschichtlichen und kontextabhängigen Fremdbezug unserer Erfahrung. Aus diesem Grund ist für unseren Zusammenhang hier entscheidend, darauf zu achten, dass die hermeneutische Vorstruktur die Grundstruktur der ontologischen Erfahrung des Menschseins, nämlich die „Erkenntnis des Erkannten“, von der Aristoteles in seiner Metaphysik ausgeht, bedeutet. Diesbezüglich hat Aristoteles, den ich hier zitiere, geschrieben: „Aus der Erinnerung entsteht nämlich für die Menschen Erfahrung; denn viele Erinnerungen an denselben Gegenstand bewirken das Vermögen einer Erfahrung, und es scheint die Erfahrung der Wissenschaft und Kunst fast ähnlich zu sein. Wissenschaft aber und Kunst gehen für die Menschen aus der Erfahrung hervor; […].“ 4 Aufgrund dieses philosophiegeschichtlichen Denkzusammenhangs können wir feststellen, dass das hermeneutische „Vor“ bei Gadamer nichts anderes als die ontologische Grundlage des menschlichen Verstehens in seiner Denkformel „Verstehen des Verstandenen“ ist, ähnlich wie Aristoteles die Grundstruktur der menschlichen Erfahrung als Erkenntnis des Erkannten, also die Erinnerung an das Erfahrene bezeichnet hat. Deshalb darf man nicht aus den Augen verlieren, dass das „Vor“ in Gadamers Hermeneutik den unentrinnbaren Bezug der menschlichen Erfahrung auf ihre Andersheit bereits impliziert. 4 Aristoteles, Metaphysik, in: Aristoteles Philosophische Schriften, Bd. 5, übers. v. Hermann Bonitz, Darmstadt 1995, Kap. I, I. Buch, 980b – 981a. 166 1 – 1. Gadamers Kritik am neuzeitlichen Ideal des Objektivismus und des Subjektivismus Aus der hermeneutischen Sicht liegt das Verstehen bzw. die Verständigung im interdependenten Sinngewebe von Vertrautheit und Fremdheit. Von der miteinander verschränkten und aufeinander einwirkenden Polarität kommt das Verstehen, die Verständigung überhaupt, zustande. Im Hinblick auf diese interdependente Polarität rehabilitiert Gadamer die „Vorurteile“ als die Grundmodi des menschlichen Verstehens: Die Vorurteile werden von nun an in der Hermeneutik zur allgemeinen Vorstruktur des menschlichen Weltzugangs. So bilden die Vorurteile, Gadamers Ansicht zufolge, einen wichtigen Bestandteil der menschlichen Erfahrung, d. h. eine Grundstruktur in der Binnenperspektive des Verstehens. Aus diesem Grund bezieht sich Gadamers Überlegung über die Vorurteile als ontologische Grundlage der menschlichen Erfahrung keinesfalls auf die eigensinnige Befangenheit, - obwohl viele Kritiker ihre Vorwürfe unter diesem Gesichtspunkt begründet haben - sondern Gadamers Einsicht besteht grundsätzlich darin, dass das Verstehen als der Grundvollzug der menschlichen Welterfahrung von vornherein auf das Fremdverstehen angewiesen, d. h. in die Erfahrung des Fremden bereits eingebunden ist; dass die Vorurteile also sich selbst, wie wir sehen werden, auf diese Begegnung mit dem Fremden, gewissermaßen auf ihren Erprobungsprozess einlassen. Wir können sagen, dass die Vorurteile mithin die „Vorstruktur“ des hermeneutischen Verstehens, nämlich das „Vorverständnis“ sind. Von daher macht Gadamers Hermeneutik diese Vor–Struktur des Verstehens, die jedem reflexiven Urteilsakt vorausgeht, zum ontologischen Ausgangspunkt der menschlichen Erfahrung. Sie weist zwar darauf hin, dass das Verstehen bereits auf die Vorgegebenheit des ontologischen Hintergrunds bezogen ist, aber das Verstehen wäre nicht auf die als an sich seiende Entität oder Fundament zurückzuführen. In diesem Sinn wollte Gadamer m. E. vielleicht nicht von einem Vorurteil (Singular), sondern von den Vorurteilen (Plural) sprechen, die im Verstehensprozess aufs Spiel gesetzt, erprobt, korrigiert und geklärt werden müssen. Mit seiner Einsicht in die ontologische Vorstruktur des menschlichen Verstehens wehrt Gadamer sich, wie wir naturwissenschaftliche Verfahrensexaktheit noch sehen werden, Methodenbewusstsein, der Objektivität zu eingangs das versichern sich einerseits durch glaubt und das damit gegen das Ideal der auf den Fortschrittsglauben stützt, andererseits gegen das Ideal der neuzeitlichen Subjektivität, das die unhinterfragbare Letztinstanz der in sich verschlossenen Selbstgewissheit bilden soll. Mit anderen Worten: Gadamer geht zunächst von der Kritik am Subjektivismus und Objektivismus aus und legt damit auf die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung sein 167 Augenmerk. Doch diese kritische Überwindung zielt bei ihm weder auf das Ideal des Fortschritts noch auf die Aufstellung der zweifellosen Instanz ab, auf die alle Komponenten reduzierbar wären, sondern sie übt selbst eine reflexive Kritik, die durch einen inneren Prozess hindurch Sinnmöglichkeiten immer wieder neu eröffnet. Dennoch zielt sie nicht auf die Ersetzung des gesamten neuzeitlichen Denkens durch ein destruktives Hinterfragen oder durch andere metaphysische Grundlagen – Gadamer selbst hat sich auf das humanitäre Erbe, insbesondere die Romantik, bezogen – ab. Gadamers Hermeneutik hingegen betont die Geschichtlichkeit unserer Erfahrung, nämlich die tradierte Situiertheit im menschlichen Verstehen. Deshalb will sie auf keinen Fall ein letztbegründendes Element als den Maßstab des Fortschritts oder die Substanz der subjektiven Selbstgewissheit herausarbeiten. Anders als ein solches neuzeitliches Ideal betont Gadamers Hermeneutik, dass das Verstehen überhaupt in der Angewiesenheit auf die Fremdheit bzw. die Andersheit geschieht, d. h. sich im Prozess des Aufeinander-Bezogenseins vollzieht. Die Vorurteile, die die ontologische Grundlage des Verstehens sind, verweisen in Gadamers Hermeneutik nunmehr auf die anschließende Rolle der überlieferten Tradition im unendlichen Verstehensprozess; sie haben ja die Fähigkeit, die Erweiterung des Verstehens zu ermöglichen. So wird gezeigt, dass die Vorurteile bei Gadamer auch eine berechtigte und produktive Sinnerschließungskraft in der Begegnung mit der Überlieferung haben. Wir wenden jetzt unsere Aufmerksamkeit Gadamers Objektivismus–Kritik zu, da diese Kritik m. E. den Grund für die Rehabilitierung der Vorurteile im Verstehen darstellt. Hierbei geht es Gadamer um die Wahrheitsfrage, weshalb der erste Teil seines Hauptwerkes mit der Überschrift „Freilegung der Wahrheitsfrage an der Erfahrung der Kunst“ betitelt wird. (GW. 1, S. 7) Gadamer zufolge meint Hermeneutische Wahrheit „Teilhabe“ an einer unaufhörlichen Sinnkette, die für uns nicht objektivierbar ist und nie völlig vergegenständlicht werden kann. Aus hermeneutischer Sicht befinden wir uns deshalb mit dem eigenen Verstehen–Wollen immer schon im Sinngeschehen mittendrin, über das wir keinesfalls Herr sind und das uns nicht verfügbar ist. Da wir uns bereits im Sinnfeld befinden, weist das hermeneutische Wahrheitsgeschehen über uns hinaus. Im Anschluss an diese Einsicht in den unübersteigbaren Ereignischarakter der hermeneutischen Sinnerschließung spricht Gadamer auch von der „adaequatio intellectus ad rem“ in der traditionellen Denkweise. (GW. 2, S. 47) Die Angmessenheit meint, Gadamers Ansicht zufolge, keine vollständige Korrespondenz, sondern eine Sachangemessenheit, die aus hermeneutischer Sicht im Prozess des Verstehens zur Geltung kommt. Die Naturwissenschaft im Zeitalter der Aufklärung, die das Ideal der Objektivität in den Vordergrund gestellt hat, verlangt Gadamer zufolge, einen 168 letztbegründeten Prüfstein, der sich an der exakten Methodik orientiert. Dieser Naturwissenschaft gilt deshalb das Vorurteil des nicht beweisbaren, nicht begründeten Urteils. Infolgedessen ist ihr Methodenbewusstsein auf die Aufstellung des Gesetzes nach der induktiven Verfahrensweise gerichtet, die von der mathematischen Genauigkeit abhängt. Mit Hilfe dieser methodischen Verfügbarkeit glaubt sie nunmehr das Vorurteil vollkommen ausschalten und jede bloß subjektive Einstellung aus allen Wissenschaftsbereichen ausschließen zu können. 5 Durch diese Ausschaltung des Vorurteils und die Ausschließung der subjektiven Einstellung versucht sie die vollendete Objektivität, die allerletzte Evidenz zu erreichen. Hierbei stellt das naturwissenschaftliche Ideal auch fest, dass die menschliche Erfahrung nur durch die methodische Vollständigkeit beweisbar und die beweisbare Erfahrung allein wertvoll ist. Im Hinblick auf den Appell dieses Methodenbewusstseins an die methodische Beweisbarkeit sagt Gadamer: „Alle Erfahrung ist ja nur in Geltung, solange sie sich bestätigt. Insofern beruht ihre Dignität auf ihrer prinzipiellen Wiederholbarkeit.“ (GW. 1, S. 352 – 353) Für uns lässt sich vor allem sagen, dass der Appell des Methodenbewusstseins selbst auf eine überzeitliche Logizität, Allgemeingültigkeit und die wiederholbare Kommensurabilität unter klar bestimmten Bedingungen abzielt. Indem das Methodenbewusstsein nunmehr die logische „Selbstvergewisserung“ und die objektive Allgemeingültigkeit durch die methodische Exaktheit unter klar bestimmten Bedingungen, insbesondere z. B. im Laboratorium, zu beweisen versucht, sieht es jedoch, Gadamers Ansicht zufolge, von den subjektiven Einflüssen bei der Aufstellung der eigenen Hypothesen ab. Wenn es mit der exakten Verfahrensmethodik irgendein Problem zu lösen glaubt, vergisst es die geschichtliche Herkunft des Problems völlig. Auf dieses Vergessen der geschichtlichen Herkunft seiner eigenen Problemstellungen, die man die „Geschichtsvergessenheit“ nennen könnte, stützt sich der Fortschrittsglaube dieses Methodenbewusstseins; ein Forschrittsglaube, der die Überwindung der früheren Zustände aufgrund der technischen und methodischen Vergewisserung garantieren zu können glaubt. Im Hinblick auf die Gewissheit der unendlichen Entwicklung können wir anmerken, dass ein solcher Fortschrittsglaube eine unauflösbare Selbstwidersprüchlichkeit in sich enthält, da er sich selbst ständig negieren und aufheben soll. 5 Diese Ansicht von der subjektiven Einstellung im Auslegen kommt bei E. Betti deutlich zum Ausdruck, obwohl er den kategorischen Kanon bei der Rechtsanwendung im Anschluss an Schleiermacher, insbesondere an Dilthey, zu erarbeiten versucht. Diesbezüglich sagt er folgendes: „ Eben deshalb ist das Bestreben mancher Geschichtsschreiber, sich der eigenen Subjektivität zu entkleiden, völlig unsinnig.“ E. Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre, Tübingen 1988, S. 34. 169 Davon abgesehen erarbeitet Gadamer einerseits seine eigene Konzeption von der „philosophischen Hermeneutik“ 6 aus der Überlegung zum Methodenideal und dem Fortschrittsglauben in der Naturwissenschaft heraus und übt sich im Anschluß andererseits auch in der kritischen Auseinandersetzung mit der hermeneutischen Tradition. Aus Gadamers Sicht schränkt die traditionelle Hermeneutik, die in ihrer Entwicklungslinie Schleiermacher und Dilthey bis hin zu E. Betti einschließt, mit ihrem grundsätzlichen Glauben an den Objektivismus und den Psychologismus, die jeder Auslegung Objektivität verleiht, das Verstehen auf die Methodologie ein. Mit Hilfe ihrer methodischen Durchdringung sieht die traditionelle Hermeneutik es als ihre Aufgabe an, in der Auslegung von Texten deren Sinnintentionen zu erklären. Sie fordert Regeln für die objektive Textauslegung, sie versucht methodische Verfahrensregeln aufzustellen und nach diesen aufgestellten Regeln den tradierten Textsinn zu verstehen. Anders gesagt, glaubt sie, den ursprünglichen Sinn des Textes durch das „kunstgerechte Verfahren“ zu erschließen und rekonstruieren zu können. (GW. 1, S. 178) So gesehen kann man die Behauptung wagen, dass die Auslegungskunst in der tradierten Hermeneutik wichtiger ist als das Verstehen selbst, 7 so wie Schleiermacher die Hermeneutik auch als „Kunst des Verstehens“ 8 bezeichnet hat. Seiner Ansicht zufolge hat die Hermeneutik deshalb die Aufgabe, die kunstgemäßen Auslegungsregeln für die Erhellung des Ursinnes der dunklen Stellen im Text aufzustellen. Nur wenn die Textauslegung diesen methodischen Verfahrensregeln gemäß stattfinden würde, könnte das Missverständnis 6 7 8 Gadamers opus magnum „Wahrheit und Methode“ hat, ähnlich wie andere berühmte Meisterwerke, eine eigene Geschichte in Bezug auf den Titel, weil er von Anbeginn an nicht die Frage der naturwissenschaftlichen Methoden, sondern die nach der Wahrheit oder genauer gesagt, nach dem Wahrheitsgeschehen freilegen will, d. h. er im Grunde einen kritischen Zweifel an dem wissenschaftstheoretischen Methodenbewusstsein hat. In seinem Meisterwerk will er sich deshalb von dem Methodenbewusstsein kritisch distanzieren. Stattdessen will er die Grundstruktur der Wahrheitssuche im menschlichen Verstehen zur Sprache bringen. In diesem Zusammenhang macht Ben Vedder in seinem Buch über diesen Titel den folgenden Vorschlag: „Der Titel von Gadamers Hauptwerk hätte besser auf Wahrheit oder Methode verweisen können, statt auf Wahrheit und Methode.“ Ben Vedder, Was ist Hermeneutik? – Ein Weg von der Textdeutung zur Interpretation der Wirklichkeit, Stuttgart 2000, S. 131. Zudem gibt J. Grondin uns den Hinweis, dass Gadamer ursprünglich „Verstehen und Geschehen“ als Haupttitel gewählt und unter dem gegenwärtigen Untertitel „Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“ das gesamte Manuskript erarbeitet hatte. Vgl. J. Grondin, Einführung zu Gadamer, Tübingen 2000, S. 5 – 21. Mit dem italienischen Juristen E. Betti gesagt, liegt auf der Hand, dass die Auslegung bei ihm vom Verstehen getrennt ist, sozusagen dem Verstehen gegenüber bevorzugt wird. Diesbezüglich sagt er: „Der Auslegungsprozess ist überhaupt dazu bestimmt, das epistemologische Problem des Verstehens zu lösen. Benutzen wir dabei die bekannte Unterscheidung zwischen Handlung und Erfolg, Verfahren und Ergebnis des Verfahrens, so können wir die Auslegung vorläufig als Handlung und Verfahren kennzeichnen, dessen Erfolg und zweckdienliches Ergebnis ein Verstehen ist.“ E. Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre, S. 12 – 13. Im Nachwort desselben Buches, das den Titel „Emilio Betti und das idealistische Erbe“ trägt, spricht Gadamer im Gegenteil von der „Unlösbarkeit von Verstehen und Auslegen.“ (S. 95) Sowohl bei Heidegger als auch bei Gadamer ist das Verstehen selbst das Auslegen. Diesbezüglich schreibt Heidegger in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“: „In der Auslegung wird das Verstehen nicht etwas anderes, sondern es selbst. Auslegung gründet existenzial im Verstehen, und nicht entsteht dieses durch jene.“ M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 2001, 18. Aufl., S. 148 (Hervorhebung von mir). Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, S. 75. 170 vermieden und das Verstehen gesichert werden. Da er, mehr oder weniger überheblich, seinen Akzent auf die gesicherte Auslegung legt, auf dem die bedrohliche Möglichkeit des Missverständnisses vermieden werden soll, verlangt er methodische Auslegungsregeln. Mit diesem Appell an einen methodensicheren Auslegungsweg legt er, wie wir bereits wissen, seinen Kanon für die Textauslegung vor, der im Prinzip auf dem Denkmodell der grammatischen und psychologischen Regeln beruht. Der Kanon soll bei ihm als Kriterium dienen, das dem Urteil von Richtig und Falsch bei der Auslegung zugrunde zu legen sei. Im Hinblick auf die Kanonisierung schreibt er deshalb, dass „die hermeneutischen Regeln mehr Methode sein müssen.“ 9 Für uns ist zudem bemerkenswert, dass Schleiermacher nicht „Die psychologische Auslegung“, sondern ursprünglich „Die technische Auslegung“ für den zweiten Teil seines Textes als Titel gewählt hatte. 10 Das weist darauf hin, dass Schleiermachers Hermeneutik von vornherein auf die vollkommene Rekonstruktion des Ursinnes des Textes abzielt. In Bezug auf die hermeneutische Konzeption steht auch Dilthey unter dem Einfluss der Hermeneutik Schleiermachers. Dilthey beschränkt die Hermeneutik auch auf eine Auslegungslehre. Unter Schleiermachers Einfluss sieht er die Aufgabe der Hermeneutik als „die Kunstlehre der Auslegung von Schriftdenkmalen“ 11 oder, in einem anderen Text, als „das kunstgemäße Verstehen dauernd fixierter Lebensäußerungen.“ 12 In diesem Zusammenhang verlangt er, wie Schleiermacher bereits vorgeschlagen hatte, dass die „grammatische“, „psychologische“ und „divinatorische“ Interpretationsmethodik als demonstrative Regeln beim Auslegen gelten sollen. 13 Seiner Ansicht zufolge könnte der Interpret nur mit Hilfe dieser strikten Methodik die Eingebundenheit der Einzelperson in seinen zeitgenössischen Lebenszusammenhang verfolgen und nachzeichnen. Er hält deshalb die „Selbstbiographie“ 14 der historischen Individuen für einen typischen Ausdruck eines bestimmten Zeitalters. Die Selbstbiographie ist bei ihm eine vollkommene Explikation, die die gesamten Sinnbezüge der geschichtlichen Lebenszusammenhänge umfasst. Hiermit zieht 9 Ebd., S. 84, Vgl. H. Inneichen, Philosophische Hermeneutik, Freiburg / München 1991, S. 38 – 62. Mit der Frage „Gibt es ein Kriterium der Auslegung“, hat er den Anspruch auf den Kanon, nach dem die Richtigkeit der Auslegung von der Falschheit unterschieden werden kann, erhoben. Aber wenn es im Verstehen nicht um die Absicht des Autors, sondern um die Frage geht, was die Wahrheit der uns vom Autor übermittelten Sache sei, wenn dieser Sachsinn uns übergeschichtlich, aber dennoch abständig überliefert ist, dann sollte er auf unsere Frage antworten können, wie der Prüfstein, unter dem alle Auslegungen eingeschätzt werden können, aufgestellt wird, um zu überprüfen, ob diese Regeln auch überzeitlich allgemeingültig wären. 10 Ebd., S. 167. 11 Wilhelm Dilthey, „Die Entstehung der Hermeneutik“ (1900), in: Gesammelte Schriften, Bd. V, Stuttgart 1957, S. 320. 12 Ders., Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Frankfurt a. M. 1970, S. 267. 13 Ebd., S. 279. 14 Ebd., S. 244. 171 er die Möglichkeit einer objektiven Geschichtsschreibung in Betracht, die sich auf der erkenntnistheoretischen Aufklärung der Geschichte innerhalb der Denkweise des Historismus gründet. In seiner Auseinandersetzung mit der Diltheyschen Hermeneutik-Konzeption schreibt Gadamer: „So konnte er (= Dilthey, KBL) sich das Ziel setzen, zwischen historischer Erfahrung und idealistischem Erbe der historischen Schule eine neue erkenntnistheoretisch tragfähige Grundlage aufzubauen. Das ist der Sinn seiner Absicht, Kants Kritik der reinen Vernunft durch eine Kritik der historischen Vernunft zu ergänzen.“ 15 (GW. 1, S. 223) Seiner Ansicht nach sieht Dilthey die Aufgabe der Geschichtsauslegung in der „historischen Restitution der Lebenszusammenhänge“ und darin, dass der Geschichtsschreiber gemäß den Verfahrensregeln die gesamten, geschichtlichen Lebenszusammenhänge objektiv rekonstruieren können soll. (GW. 1, S. 180) Diese aus der Methode folgende Objektivität fordert aber dennoch dazu auf, die subjektive Perspektivität bei der Geschichtsschreibung auszublenden. Bei Gadamer hingegen hört die Hermeneutik auf, eine bloß methodische Hilfsdisziplin für alle Wissenschaftsarten zu sein. Vielmehr habe die Hermeneutik mit dem Verstehen zu tun, das ein Grundphänomen der menschlichen Existenz sei, die sich ihrerseits immer schon zum gegenseitigen verstehen-können und verstehen-wollen auffordert. Da Gadamer das Verstehen als einen Grundmodus des Menschseins betrachtet, gäbe es, wie er betont, „keine eigene Methode der Geisteswissenschaft.“ (GW. 1, S. 13) Selbst die Statistik, so Gadamer, sei von der subjektiven Beobachtungsperspektive bei der Datenansammlung und der Interpretation der angesammelten Daten abhängig, so wie ein Zuschauer bei einem Schauspiel bereits im Sinngeschehen mittendrin ist, das sich im Spiel selbst vollzieht. So gesehen kann bei der Beobachtung des Gegenstandes im Laboratorium die Beobachterperspektive selbst nie gänzlich ausgeschlossen, ausgeschaltet werden. Vielmehr geht es bei Gadamer um den subjektiven Versuch eines sachgemäßen Sinnentwurfs. Neben der Kritik am Objektivitätsideal setzt Gadamer sich intensiv mit der Kritik an der neuzeitlichen Subjektivität auseinander, da die moderne Subjektivität mit einer fundamental begründeten Selbstgewissheit des denkenden Subjekts, die Möglichkeit des reflexiven Urteils suche und damit zugleich ein Wahrheitskriterium, mit dem dieses subjektive Urteil untermauert werden kann. Aus Gadamers Sicht lehnt sich das bewusstseinsphilosophische Paradigma, das als das fundamentale Prinzip der neuzeitlichen Subjektsphilosophie gilt, grundsätzlich an das Denkmodell des Aufklärungszeitalters an. Unter Berücksichtigung der philosophischen Begriffsgeschichte 16 wirft Gadamer deshalb 15 16 Ebd., S. 233, hier lautet bes. der Untertitel: „Entwürfe zur Kritik der historischen Vernunft“ In seinem Aufsatz „Begriffsgeschichte als Philosophie (1970)“ (GW 2) beschäftigt sich Gadamer insbesondere mit der Geschichtlichkeit der philosophischen Begriffsbildung. Hier besteht Gadamers Grundeinsicht darin, 172 einen zweifelnden Blick auf die Diskreditierung des Begriffs „Vorurteil“ in der Aufklärung. Ihm zufolge fordert die Aufklärung sämtliche Überzeugungen auf, einen Begründungsanspruch zu erfüllen, der sie zur beweisbaren und demonstrierbaren Kommensurabilität, gewissermaßen zu einem evidenten Geltungsgrund, zwingt. Da sich die Aufklärung von Anbeginn mit dem endlosen Zweifel an jeder Überlieferung ihren Weg bahnt, lässt sie das Vorurteil als ein grundloses Urteil außer Acht. Anders gesagt, hegt die Aufklärung einen grenzlosen Verdacht gegenüber allem Überlieferten, nämlich den Vorurteilen. Dementsprechend orientiert sich die Aufklärung mit ihrem Anspruch auf das demonstrativ Letzte an dem Glauben an die methodologische Perfektion, an einer utopischen Denkformel, da sie sich das Ziel setzt, die vollkommene Vorurteilslosigkeit zu erreichen, d. h. die Vorurteile auf allen Gebieten der menschlichen Erfahrung vollständig auszuschalten. Der Glaube an die Idee der methodologischen Perfektion im Aufklärungszeitalter verlagert deshalb seinen Schwerpunkt auf die Entkleidung und Entmachtung der mythologisierten Welt durch die Rationalität, die selbst die endlose Entlarvung und die fortschreitende Erhellung der Welt voraussetzt. Mit diesem Ideal der gewissen Erklärung der Welt und dem Fortschrittsglauben errichtet die Aufklärung „alles vor dem Richtstuhl der Vernunft“ und beurteilt die Verifikation und Falsifikation aller Sachverhalte nur nach der Autorität der Vernunft. (GW. 1, S. 277) Gadamers Überlegung über die Illusion der Idee von einer evidenten Instanz für alle Urteile im Aufklärungszeitalter, erlaubt uns nunmehr, auf den Methodengedanken bei Descartes einzugehen, der als der Ahnenvater der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie mit seinem berühmten Diktum, „ich denke, also bin ich“ gilt. Descartes versucht, wie bekannt, mit seinem methodologischen Zweifel den Weg zur Letztinstanz alles Wissens zu durchlaufen. Auf diesem Weg von dem grundsätzlichen Zweifel an allen tradierten Überzeugungen zur fundamentalen Gewissheit gewinnt er die obige Formel, die besagt, dass das denkende Ich ohne Zweifel ein unhinterfragbarer Grundstein unseres Wissens ist. Das unerschütterliche Fundament, das durch die methodische Reflexion konstruiert wird, also sich auf die sich selbst denkende Subjektivität als das unbezweifelbare Prinzip gründet, wird von nun an zum allerletzten Prüfstein für das allgemeingültige Wissen, zum einzigen Zugang zur dass selbst die philosophischen Begriffe nicht vom reinen Verstand abgeleitet sind, sondern die Begriffsbildung in der damaligen Not – hierbei könnte man Heideggers späten Begriff „Sprachnot“ in Erinnerung rufen – und den geschichtlichen Situationen gestanden haben, in denen die Begriffe geboren und verwendet wurden. So gesehen haben die philosophischen Begriffe bereits mit der geschichtlichen Vorstruktur in ihrem Bildungsprozess, die mit dem menschlichen Verstandesvermögen nicht ganz zu fassen ist, zu tun. In diesem Sinn sind die philosophischen Begriffe kein Werkzeug für die Veräußerung des instrumentellen Verstandes, sondern sie stehen in den geschichtlichen Lebenszusammenhängen zur Suche nach dem zutreffenden Wort im anstrengenden Umgang mit der bestimmten Situation. 173 allgemeingültigen Wahrheit. Aus dieser fatalen Perspektive ist die cartesianische Selbstgewissheit aus der methodischen Spaltung zwischen Subjekt und Objekt abgeleitet, da die subjektive Selbstgewissheit die prinzipielle Selbstvergegenständlichung zur Bedingung ihrer Möglichkeit macht und die Selbstobjektivierung im weiteren Schritt ebenso auf einen Selbstbesitz des Subjekts hinausläuft. Diese cartesianische Auffassung, dass das Subjekt, das die vollständige Selbsteinsicht erwirbt, nicht nur über die Welt als den rein empirischen Gegenstand, sondern auch über sich selbst Herr sein kann, ergibt sich, aus Gadamers Sicht, aus dem altgriechischen Begriff „hypokeimenon (das Zugrunde liegende)“ in Aristoteles’ Metaphysik, wovon bei Gadamer oft die Rede ist. 17 Mit Gadamers Einsicht kann man sagen, dass der neuzeitliche Begriff „Subjekt“ insbesondere mit der verführerischen Vorstellung von einem „grammatischen Subjekt“, 18 das allen Prädikaten zugrunde liegt, zu tun hat. Aufgrund dieser Vorstellung wird das Subjekt, dem die neuzeitliche Wissenschaft nachgegangen ist, zu einem fundamentalen Element, das nicht nur allen Erkenntnissen den Maßstab der Gewissheit verleiht, sondern sich selbst auch nur auf sich selbst bezieht. Aus hermeneutischer Sicht ist die Illusion des denkenden Ichs „die monologische Fiktion“, 19 da sie das Ziel verfolgt, nach dem das Subjekt sich nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch den Anderen gegenüberstellt und damit als einen Stoff, eine Materie objektiviert. Letztlich kann es sich auf sich selbst nur durch die Negation der Andersheit beziehen. Gegen diese monologische Fiktion der Subjektivität gibt Gadamer dem Verstehensvorgang zum Bewusstsein den 17 Gadamer hat die Begriffsreihe, „hypokeimenon“, „substantia“ und „subiectum“ in Bezug auf die philosophische Begriffsgeschichte vorzüglich behandelt. Mit dieser Untersuchung versucht er, auf die Frage zu antworten, woher dieser Begriff etymologisch stammt, aber auch inwiefern der Begriffsgebrauch von dem ursprünglichen Sinngehalt entfernt und in Dissonanz geraten ist. Vgl. Gadamer, „Begriffsgeschichte als Philosophie“ (1970), GW. 2 und „Subjektivität und Intersubjektivität, Subjekt und Person“ (1975), GW. 10. Bei Aristoteles war Substanz das erste Prinzip, von dem sich alle anderen Kategorien ableiten und an das sich alle übrigen Kategorien koppeln. Nun schreibt er: „Denn keines von diesen besteht an sich oder ist einer Abtrennung von dem Wesen (Substanz) fähig, sondern, sofern überhaupt, so gehört vielmehr das Gehende, das Sitzende und das Gesunde zu dem Seienden. Dieses zeigt sich aber als mehr seiend, weil sein Subjekt etwas Bestimmtes ist, nämlich das Wesen und das Einzelne, welches sich unter einer solchen Aussageweise (Kategorie) zeigt. Denn das Gute oder das Sitzende wird ohne dieses nicht ausgesagt. Es erhellt also, daß durch dieses, das Wesen (Substanz), auch ein jedes von jenem ist, so daß demnach Seiendes in erster Bedeutung (erstes Seiendes), welches nicht etwas Seiendes (in irgendeiner Beziehung), sondern schlechthin Seiendes ist, das Wesen sein dürfte.“ Aristoteles, Metaphysik, Kap. 1, VII. Buch, 1028a. 18 Vgl. J. Grondin, Einführung zu Gadamer, S. 118. 19 M. Riedel, Hören auf die Sprache, Frankfurt a. M. 1990, S. 41. Er hat überdies die Zirkularität zwischen dem „ich denke“ und dem „ich bin“ im Decarteschen Grundsatz „ich denke, also bin ich“ ins Auge gefasst. Ihm zufolge ist der Schlusssatz „also bin ich“ aus dem Hauptsatz „ich denke“ nicht folgerichtig abgeleitet. Das Ichsein ist hier keine Schlussfolgerung des denkenden Ich, sondern das Ichsein geht dem „ich denke“ voraus, d. h. das denkende Ich setzt umgekehrt das Ichsein voraus, wie er sagt, „um zu denken, muß man sein.“ In dieser Übereinstimmung mit der Hermeneutik, sieht er die Wechselseitigkeit von Sprechen und Hören, in deren Verhältnis das Ichsein und das denkende Ich gemeinsam zur Sprach kommen. Er verlagert „die akroamatische Dimension“ in der Hermeneutik, in der das Ich sich selbst erscheint und sich selbst entdeckt, auf den Knotenpunkt von dem „ich bin“ und dem „ich denke.“ In diesem Sinn sagt er: „Ja, das Ego ist sogar erste Idee, nämlich diejenige, worin sich die Zusammengehörigkeit des Denkens mit dem Sein auf dem Boden der Sprache enthüllt.“ (S. 32 – 36) 174 „Vorrang des aufeinander Bezogenseins“: „Das Verhältnis von Verstehen und Verstandenen hat vor dem Verstehen und den Verstandenen den Primat, […], der weder im einen noch im anderen Gliede der Relation seine feste Basis hat.“ (GW. 1, S. 126) Um es mit einem Wort zu sagen, ist die „Selbstvergessenheit“ aus hermeneutischer Sicht für das Phänomen „ich verstehe“ charakteristisch, anders gesagt, vergesse ich mich selbst dort, wo ich verstehe. Dieses bewusstseinsphilosophische Schema setzt sich in der Entwicklungslinie von Descartes über Kant bis Hegel durch. Gadamers Hermeneutik übt deshalb auch „eine immanente Kritik an der Geistphilosophie Hegels“, 20 obwohl sie Hegels Denkweise, einerseits die dialektisch–geschichtliche Erfahrung, andererseits die Anerkennung im Verhältnis zum Anderen, in ihre Überlegungen mit einschließt. Gadamer beschäftigt sich in seinen Überlegungen mit der ontologischen Erfahrungsgeschichte in Hegels Phänomenologie und mit dem Anerkennungsverhältnis als Bezogenheit auf den Anderen, die in den Arbeiten des frühen Hegels bis hin zur Phänomenologie auftauchen. Gleichwohl lehnt sich Gadamer gegen die Reflexivität des Selbstbewusstseins und die daraus folgende Selbsteinsicht, d. h. die Allwissenheit des Geistes bei Hegel auf. Aus Gadamers Sicht meint die Reflexivität des Selbstbewusstseins bei Hegel „die Reflexion in sich“, die durch die objektive Vergegenständlichung des Selbst hindurch zu sich selbst zurückkehrt. Das Bewusstsein von sich selbst läuft im um sich selbst drehenden Kreis herum und bezieht sich damit auf sich selbst. Diese Reflexionsbewegung bahnt sich mit sich selbst an und endet auch mit der Rückkehr zu sich selbst. Das heißt, dass die Reflexion des Selbst den in sich abgeschlossenen Weg von der unmittelbaren Selbstgewissheit über das Verhältnis zum Anderen hin bis zur Rückkehr zu sich selbst – Hegel selbst hat „die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst“ als den Untertitel von „B. Selbstbewußtsein“ in der Phänomenologie gewählt – durchführt. So gesehen ist das denkende Subjekt bei Hegel zweifelsohne die Rückbesinnung auf sich selbst durch die Selbstreflexion, in der das Subjekt sich seiner selbst bewusst wird. Diese unerschütterliche Selbstgewissheit bildet die Basis, auf der sowohl das Bewusstsein von sich selbst als auch von allem Anderen ruht. Sie ist bei Hegel, Gadamers Ansicht zufolge, ein bedingungsloser Anfang, der das absolute Ende unmittelbar in sich vereint.21 Diesbezüglich sagt Gadamer: „Das Problem des Anfangs ist, wo immer es sich stellt, in Wahrheit das 20 G. Figal, „Gadamer im Kontext. Zur Gestalt und den Perspektiven philosophischer Hermeneutik“, in: Gadamer Verstehen / Understanding Gadamer, hrsg. v. Mirko Wischke u. Michael Hofer, Darmstadt 2003, S. 149. Zur Hegelschen Philosophie in Bezug auf Gadamers Hermeneutik, vgl. G. Krüger, „Die dialektische Erfahrung des natürlichen Bewusstseins bei Hegel“, in: Hermeneutik und Dialektik, hrsg. v. R. Bubner, K. Cramer u. R. Wiehl, Tübingen 1970, S. 285ff und Claus v. Bormann, „Die Zweideutigkeit der hermeneutischen Erfahrung“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt a. M. 1971, S. 83ff. Vgl. zudem das Resümee in Abschnitt V. von dieser Arbeit. 21 Zur Voraussetzungslosigkeit und Anfangsproblematik in Hegels Logik, Vgl. R. Bubner, „Die >>Sache selbst<< in Hegels System“, S. 40 – 69. 175 Problem des Endes. Denn vom Ende her bestimmt sich der Anfang als der Anfang des Endes.“ (GW. 1, S. 476) Aus Gadamers Sicht bewegt sich die Reflexion des Hegelschen Subjekts in sich selbst als ein absolut voraussetzungsloser Anfang, vollzieht sich mit dem Wissen um sich selbst bzw. vom vollendeten Ende wie dem absoluten Anfang. Die Hegelsche Reflexivität des Subjekts ist in sich geschlossen, ähnlich wie die Hegelsche Geistesphilosophie die systematische Homogenität zur Sprache bringt. Gadamers hermeneutische Reflexion hingegen geht von keinem Nullpunkt aus, d. h. sie setzt immer schon ihre unentrinnbare Bedingtheit, die sich aus der Geschichtlichkeit ergibt, voraus. Kurzum nimmt die hermeneutische Reflexion von vornherein die Geschichtlichkeit als Voraussetzung für die menschliche Selbsterfahrung an. Von daher ist sie sich dessen bewusst, dass die letzte Wahrheit nicht gefunden werden kann und der potenzielle, stets über uns hinausreichende Sinnhorizont, nur unter bestimmten Bedingungen erschlossen werden kann. Nun sagt Gadamer: „In Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr. Lange bevor wir uns in der Rückbesinnung selber verstehen, verstehen wir uns auf selbstverständliche Weise in Familie, Gesellschaft und Staat, in denen wir leben. Der Fokus der Subjektivität ist ein Zerrspiegel. Die Selbstbesinnung des Individuums ist nur ein Flackern im geschlossenen Stromkreis des geschichtlichen Lebens. Darum sind die Vorurteile des einzelnen weit mehr als seine Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines Seins.“ (GW. 1, S. 281) Später setzt er hinzu: „Wer >Sprache< denkt, bewegt sich schon immer in einem Jenseits der Subjektivität.“ (GW. 10, S. 19, meine Hervorhebung) Der Hauptsinn von Gadamers obigen Sätzen liegt m. E. im Einwand gegen die Selbsteinsicht des Subjekts in der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie, die durch die vollständige Aneignung der unaufhebbaren Andersheit des Anderen das Widerspruchsrecht des Anderen ignoriert. Gadamer wehrt sich, wie bereits erwähnt, gegen die methodologische Gewissheit der Naturwissenschaft und gegen die neuzeitliche Subjektphilosophie. Gleichwohl schließt er das Reflexionsmoment des Selbstverständnisses im gesamten Verstehensvorgang nie vollkommen aus. Gadamer nimmt zwar von der fundamentalen Selbstgewissheit, die sich auf den Selbstbesitz des Subjekts gründet, kritischen Abstand, thematisiert jedoch in der hermeneutischen Reflexion das Verhalten zu sich selbst im Anderen. Wenn ich Gadamer richtig verstehe, kann ich die Behauptung wagen, dass die hermeneutische Reflexion die reflexive Besinnung auf sich selbst im Verlauf des Verhaltensprozesses zum Anderen garantiert, ohne jedoch zu der vorherigen Selbigkeit zurückzukehren. So zeigt sich das Selbstverständnis in der hermeneutischen Reflexion als ein Bewusstsein, das immer seinen Anderen ernst nimmt und ihn als Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit bestehen lässt. 176 Hierbei handelt es sich nunmehr um eine Selbstbezogenheit im Verhalten zum Anderen, die zu sich selbst Distanz hält und sich damit zugleich in der Erfahrung des Anderen wandelt. In diesem Sinn spricht Gadamer nicht von der vollständigen Abschaffung der Subjektivität, sondern von der „Abdämpfung der Subjektivität.“ 22 (GW. 2, S. 485) So gesehen liegt es auf der Hand, dass das „Sich–Verstehen“ im hermeneutischen Bewusstsein keinesfalls die unhintergehbare Selbstheit, sozusagen die letztbegründete, deshalb fundamental selbstgewisse Individualität ist, die sich stets auf sich selbst bezieht. Vielmehr wird dagegen gezeigt, dass dieses hermeneutische Sich–Verstehen das Bewusstsein dessen ist, dass es sich seiner unvermeidbaren Angewiesenheit auf die Andersheit des Anderen und damit seiner geschichtlichen Bedingtheit bewusst ist. Aus hermeneutischer Sicht ist das sich verstehende Bewusstsein keine neuzeitliche Subjektivität, die um ihre Selbstbezogenheit ohne irgendeine ontologische Voraussetzung weiß, sondern es konstituiert sich in der Beziehung zum Anderen. Kurzum erkennt das hermeneutische Bewusstsein auf seinem niemals endenen Weg, auf dem es sich selbst erkennt, den zwangsläufigen Anteil der Andersheit an. So verändert sich die jeweils gelungene Selbstbildung des Bewusstseins nur unter ihrer eigenen Voraussetzung. Das hermeneutische Bewusstsein, das immer schon ein Sich–Verstehen bedeutet, ist deshalb, mit Gadamers Worten, „das Weggegebensein an etwas“, d. h. es vollzieht einen inwendigen Wandel zur Selbstbesinnung hin in Abhängigkeit von den interdependenten Sinnbezügen. 23 Von dieser bisherigen Überlegung aus wird ersichtlich, dass Gadamer den „Seinsvorrang des Zugehörigseins zur Geschichte“ im hermeneutischen Verstehen gegenüber der bewusstseinsphilosophischen Subjektivität bevorzugt. Um diese Grundstruktur der hermeneutischen Erfahrung zur Sprache zu bringen, möchte ich nun kurz Gadamers „Spielbegriff“ nennen. Aus Gadamers Sicht führt uns der Spielvorgang stets über die subjektive Dimension hinaus hin zur überindividuellen, da das Spiel als solches schon eine Wir–Dimension ist. Wer spielen will, der muss mit dem Anderen zusammenspielen. Jedes Spiel hat zudem seine eigene Spielart und Spielregel; es bildet damit sein eigenes Spielfeld. In der Spielbewegung ist die reine Subjektivität deshalb sekundär, ganz im Gegenteil, wird der Spieler „angesprochen.“ Das Spiel fordert unsere Spielbereitschaft, miteinander zu spielen, versetzt uns selbst in eine Spielbewegung. In diesem tiefen Versunkensein in den Spielvorgang kommt ein übersubjektiver Horizont zur Geltung, in den wir eingebunden sind. Das Spiel erlaubt uns keine vollkommene 22 Vgl. Michael Hofer, „Die „Abdämpfung der Subjektivität“ – Drei Beispiele aus der amerikanischen bzw. französischen Gadamer–Rezeption“, in: Zeitschrift für Philosophische Forschung, Bd. 54, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 2000, S. 593 – 611. 23 Hans–Georg Gadamer, „Behandlung und Gespräch“, in: Über die Verborgenheit der Gesundheit, S. 168. 177 Rückbesinnung auf eine fundamentale Selbstgewissheit, auf die isolierte Ichheit, sondern es fordert uns auf, uns seinem Gesetz, seiner Spielart zu unterwerfen und die Regeln ernst zu nehmen. Da die holistisch miteinander vernetzten Sinngefüge in der hermeneutischen Erfahrung über das isolierte Ego hinweg stets auf eine übersubjektive Struktur verweisen, die die Teilnahme an dem Sinngeschehen in ihren Bann zieht, sagt Gadamer: „Nicht, was wir tun, nicht was wir tun sollten, sondern was über unser Wollen und Tun hinaus mit uns geschieht, steht in Frage.“ (GW. 2, S. 438) Im Gefolge der kritischen Auseinandersetzung mit der Diskreditierung des Vorurteils im naturwissenschaftlichen Methodenbewusstsein und mit dessen Anspruch auf die vorurteilsfreie Selbstgewissheit im Aufklärungszeitalter, versucht Gadamer durch den Rekurs auf die wahrheitstragende Funktion der Kunsterfahrung, die den Ausgangspunkt von Gadamers Hauptwerk bildet, die „Wahrheitsfrage“ in der humanistischen Tradition, insbesondere innerhalb der Denklinie der deutschen Romantik, „freizulegen.“ Indem seine Überlegung auf die Wiedergewinnung der Wahrheitsfrage in der Kunsterfahrung abzielt, lässt er sich auf den Diskurs mit der Kantischen, insbesondere der Schillerschen Ästhetik, 24 ein. Aus Gadamers Sicht gewinnt die Ästhetik durch das „ästhetische Bewusstsein“, das sich auf den ästhetischen „Geschmack“ gründet und dabei die Trennung von „dem Naturmenschen“ und dem „künstlichen Menschen“ 25 voraussetzt, ihre Autonomie und Souveränität. Hierbei sondert sie die Schönheit von den übrigen Welten ab, da erst das ästhetische Bewusstsein Anlass für das ästhetische Urteil gibt und „die ästhetische Unterscheidung“ vollzieht. (GW. 1, S. 91) Mit Schillers ästhetischem Bewusstsein betrachtet, zielt die Ästhetik auf die Perfektionierung des menschlichen Gestaltens bzw. die bewusste Umgestaltung zum allgemein gebildeten Individuum durch die „ästhetische Erziehung“ ab. Doch dieser Weg zur ästhetischen Perfektion führt letzten Endes, Gadamers Ansicht zufolge, einerseits zur Subjektivierung in der Genieästhetik – deshalb geht es bei ihr im Grunde um das rein ästhetische, subjektive Erlebnis -, andererseits zur ästhetischen Unterscheidung, die mit dem ästhetischen Urteilen die ästhetische Qualität einschätzt, d. h. die Trennung von Schönheit und Hässlichkeit vornimmt. Die ästhetische Unterscheidung unterscheidet auf der Basis des ästhetischen Werturteils nicht nur die Schönheit von der Hässlichkeit, sondern 24 Gadamer zufolge ist Kant grundsätzlich für diese Unterscheidung verantwortlich, weil er mit dem reinen Geschmacksurteil die Schönheit vom intellektuellen und moralischen Werturteil abzusondern, die Welt des Schönen nur der Welt des schönen Scheins zuzuordnen versuchte. Zu Gadamers intensiver Beschäftigung mit Kants Urteilskraft, vgl., H.–G. Gadamer, „Zur Fragwürdigkeit des ästhetischen Bewußtseins“, in: Theorie der Kunst, hrsg. v. D. Henrich u. Wolfgang Iser, Frankfurt a. M. 1992, 4. Aufl., S. 59 – 69. 25 Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Stuttgart 1997, S. 71, vgl. dazu, Konrad Paul Liessmann, „Die Sollbruchstelle. Die Destruktion des ästhetischen Bewusstseins und die Stellung der Kunst in Hans–Georg Gadamers „Wahrheit und Methode“, in: Gadamer Verstehen, S. 211ff. 178 trennt von der Schönheit auch deren Wahrheitsanspruch ab. Mit anderen Worten: Das ästhetische Bewusstsein, das durch sein ästhetisches Werturteil eine ästhetische Unterscheidung ausübt, schließt damit zugleich den ethischen, kognitiven und politischen Wahrheitsbereich von sich selbst aus, um aufgrund dieser Unterscheidung seine eigene Souveränität zu gewinnen. Angesichts dessen gibt Schiller im folgenden Satz zu: „Die Schönheit gibt schlechterdings kein einzelnes Resultat weder für den Verstand noch für den Willen, sie führt keinen einzelnen, weder intellektuellen noch moralischen Zweck aus, sie findet keine einzige Wahrheit […].“ 26 Somit ist die Kunstschönheit in den Bereich der bloß erscheinenden Welt verbannt, zu einem bloßen Gegenstand, der von der gesellschaftlichen Lebenswurzel völlig losgelösten Kunstsammlung, herabgesetzt. Sofern die Ästhetik das bewusstseinsphilosophische Erbe, das Ideal von der methodischen Trennbarkeit und das fundamentale Werturteil der Schönheit verfolgt, übersieht sie vor allen Dingen den Anknüpfungspunkt des Künstlers an den geschichtlich tradierten Hintergrund bzw. die Tatsache, dass selbst ein genialer Künstler außerhalb seines subjektiven Triebes dem gesellschaftlichen Bedürfnis und der geschichtlichen Weltsicht untersteht. Wenn wir den Akzent auf Gadamers Kritik am ästhetischen Urteil legen, wird deutlich, dass die ästhetische Erfahrung „eher eine Anti–Ästhetik als eine Ästhetik“ 27 ist. Von der Genieästhetik, die sich an das ästhetische Bewusstsein anlehnt, weit entfernt, sieht Gadamer in der Kunsterfahrung ein Wahrheitsmoment. Die Kunsterfahrung wird von Gadamer als ein dynamischer Prozess verstanden, der uns zu einer jeweils nicht wiederholbaren, unersetzbaren Erfahrung einer überempirischen Normativität hinführt. Hierbei geht es um das Phänomen, dass man sich selbst durch die wahrheitstragfähige Funktion des retrospektiven Rückblicks auf das Erfahrene verstehen kann. Auf dem Weg zum Phänomen des Selbstverstehens nimmt das Kunstwerk, mit Gadamers Worten, „die anspruchsvolle Sprache“ an, die die Fähigkeit hat, das gemeinsame Sinnfeld zu erschließen, da es uns immer schon anredet, uns anstößt. (GW. 1, S. 57) Durch diese stets motivierende Anregung lässt uns das Kunstwerk über die individuelle Isoliertheit hinweg bei sich selbst „verweilen.“ Zum „Verweilen beim Kunstwerk“ kann man sagen, dass es da das unaussprechbare „Mehr“ im Vergleich zu einer erklärenden Aussage gibt. Dieses Mehr, das wir seit Aristoteles kartharsis nennen, lässt sich aus Gadamers Sicht keinesfalls auf eine Instanz, also einen richterischen Urteilsmaßstab reduzieren, sondern wird nur dann sichtbar, 26 Friedrich Schiller, Ebd., S. 85 – 86. Bzg. seines Ideals von einem Schönheitsstaat gegenüber einem Moralstaat, setzt er überdies fort: „Der ethische Staat kann sie (= Gesellschaft, KBL) bloß (moralisch) notwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; der ästhetische Staat allein kann sie wirklich machen, weil er den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuum vollzieht.“ (S. 126) 27 J. Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt 2001, 2. Aufl., S. 156. 179 wenn wir uns auf das Sinngeschehen der Kunsterfahrung, auf die Selbstdarstellung des Kunstwerkes einlassen. Das Kunstwerk wird bei Gadamer „als die Vollendung der symbolischen Repräsentation des Lebens verstanden, zu der ein jedes Erlebnis gleichsam schon unterwegs ist.“ (GW. 1, S. 76) Denn die Fähigkeit, uns in ein spielerisches Gespräch mit dem Kunstwerk einzulassen, das uns ein gemeinsames Sinngewebe als kulturellgeschichtliche Erfahrung ermöglicht, lässt uns selbst entwerfen und uns innerhalb der Sinnbewegung der wechselseitigen Beziehung immer wieder neu konstituieren. Die geschichtliche Selbstbildung in der Kunsterfahrung, die Gadamer von Hegel und von der humanistischen Tradition der Romantik übernimmt, bildet einen Sinnhorizont, der es möglich macht, sich selbst anders zu verstehen, d. h. eine der vielen „Selbstbeschreibungen“, „self– description“ im gesamten Beschreibungssystem zu leisten. 28 In Gadamers philosophischer Hermeneutik bezeichnet die Selbstbildung eine offene Selbstumwandlung in der ontogenetischen Erfahrungsgeschichte. Die das Selbst verwandelnde Bildung trägt dazu bei, dass wir eine neue Vertrautheit mit uns selbst finden und dass wir uns selbst in die neue, vernetzte und auch anders gebildete Sinnkette einordnen. Indem Gadamer diesen wahrheitstragfähigen Grundcharakter der Kunsterfahrung erkennt und in ihm den geschichtlichen Ausdruck des Wahrheitsanspruchs des existenziell begrenzten Menschseins sieht, bezeichnet er die Wahrheitssuche des menschlichen Daseins als „den Spiegel der Kunst.“ (GW. 1, S. 103) Im Anschluss an seine Einsicht in den Wahrheitsanspruch des Kunstwerks, der aus der ständigen Auseinandersetzung mit dem Horizont der Vergangenheit gewonnen wird und die Erfahrung unserer existenziellen Kontinuität, in der wir immer schon zur Wahrheit stehen, ermöglicht, sagt Gadamer: „Das Pantheon der Kunst ist nicht eine zeitlose Gegenwärtigkeit, die sich dem reinen ästhetischen Bewußtsein darstellt, sondern die Tat eines geschichtlich sich sammelnden und versammelnden Geistes. Alles Sichverstehen vollzieht sich aber an etwas anderem, das da verstanden wird, und schließt die Einheit und Selbigkeit dieses anderen ein.“ (GW. 1, S. 102) 28 Zu Gadamers Hermeneutik in Bezug auf „Bildung“ in der romantischen Tradition, Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: New Jersey 1980, S. 357 – 365, hier bes. S. 362, Der Spiegel der Natur, übers. v. Michael Gebauer, S. 387 – 395. Ihm zufolge ist selbst die Naturwissenschaft eine unter den menschlichen Beschreibungssystemen. 180 1 – 2. Die unentrinnbare Angewiesenheit des menschlichen Verstehens auf das hermeneutische „Vor“ Vor dem Hintergrund der obigen Überlegungen über das Methodenbewusstsein und das subjektive Urteil bzw. der hermeneutisch anstrengenden Beschäftigung mit dem Wahrheitsanspruch in der Kunsterfahrung, hebt Gadamer das „Vorurteil“ hervor, das als eine Vorstruktur des Verstehens nach Kant eine „Bedingung der Möglichkeit“ des Verstehens ist. Aus hermeneutischer Sicht deutet das Vorurteil auf die ursprüngliche Zugehörigkeit des menschlichen Daseins zur Geschichte, d. h. zur Welt selbst, hin. Dieser Gedanke steht zwar unter dem Einfluss von Heidegger, insbesondere dem seines Hauptwerkes „Sein und Zeit“, allerdings wäre die Vorlesung vom SS 1923 über „Ontologie: Hermeneutik der Faktizität“ für Gadamers Denkentwicklung noch wichtiger gewesen als „Sein und Zeit“ – dennoch distanziert sich Gadamer von Heideggers Denken. Gadamer entwickelt keine weiteren Seinsfragen, um die Heidegger sich so sehr bemühte. Gadamers philosophische Hermeneutik bezieht sich zudem auf die überlieferte Tradition, während Heideggers Hermeneutik ihren Blick auf die Zukünftigkeit als die Seinsweise des Daseins richtet. 29 Bevor ich auf das Vorurteil in Gadamers Hermeneutik eingehe, möchte ich zunächst Heideggers Hermeneutik, die wir als die hermeneutische Philosophie bezeichnen können, skizzieren. In ihr geht es insbesondere um zwei Punkte: Einerseits um die Seinsart des Daseins in der Welt, mit Heideggers Worten um das „In–der–Welt–Sein“, andererseits die Struktur des Vorverständnisses im menschlichen Verstehen überhaupt. Die Hermeneutik war bei Heidegger „Phänomenologie des Daseins“, 30 nämlich die ontologische Explikation des Daseins im Verhältnis zum Sein. Die Hermeneutik beinhaltet die Möglichkeit, dass das Sein, um das es beim Dasein immer geht, sich selbst ausspricht und auslegt. Diesbezüglich schreibt Heidegger: „Die Hermeneutik hat die Aufgabe, das je eigene Dasein in seinem Seinscharakter diesem Dasein selbst zugänglich zu machen, mitzuteilen, […]. In der Hermeneutik bildet sich für das Dasein eine Möglichkeit aus, für sich selbst verstehend zu werden und zu sein.“ 31 29 Vgl. zu Heideggers Hermeneutik als Daseinsanalytik, G. Figal, „Selbstverstehen in instabiler Freiheit. Die hermeneutische Position Martin Heideggers“, in: Hermeneutische Positionen, hrsg. v. Hendrik Birus, Göttingen 1982, S. 89 ff., und ders., „Gadamer im Kontext“, in: Gadamer verstehen, S. 141ff. Zum Einfluß von Heidegger auf Gadamer und zu deren gedanklichen Verschiedenheit, vgl. J. Grondin, Von Heidegger zu Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik, Darmstadt 2001, S. 81 – 92 und ders., Der Sinn für Hermeneutik, Darmstadt 1994, S. 71 – 88. Besonders nach der sog. „Kehre“ wollte Heidegger selbst die Verwendung des Begriffs „Hermeneutik“ vermeiden. Deswegen hat er im Briefwechsel mit Otto Pöggeler seinen Standpunkt zur Hermeneutik mit diesem berühmten Diktum festgestellt: „Die ,hermeneutische Philosophie’ ist die Sache von Gadamer.“ Otto Pöggeler, Heidegger und die hermeneutische Philosophie, Freiburg / München 1983, S. 395. 30 Heidegger, Sein und Zeit, S. 37. 31 Ders., Ontologie. Hermeneutik der Faktizität, in: GA. 63, Frankfurt a. M. 1988, S. 15. 181 Heideggers Hermeneutik zufolge ist das Sein nicht die zeitlose Ewigkeit, sondern hat seine eigene Zeitlichkeit, da es sich selbst aussprechend auslegt. Damit wird deutlich, dass sich das Sein selbst immer schon in der Zeit der Jeweiligkeit darstellt. Anders gesagt, ist das Sein immer „da“. In diesem Sinn hat das Sein den Charakter des „Da“ innerhalb seiner Zeitlichkeit, ist das „Da–Sein“ als ein jeweiliges Da des Seins, das immer zum Sein stehende Seiende. Für das Dasein wird die Zeitlichkeit daher zur unhintergehbaren Bedingung seiner Seinsmöglichkeit, da es sich selbst in dieser Temporalität auf seine Zukünftigkeit hin entwirft. Mit seiner Einsicht in die Temporalität des Seins selbst, erhebt Heidegger gegen die überlieferte Ontologietradition den Vorwurf, diese habe das Sein nur als das „vorhandene“ aufgefasst. An deren Stelle will er nun seine „Fundamentalontologie“ setzen, die durch die radikale Ausübung der „existenzialen Analytik des Daseins“ die Ontologie des Seins alles Seienden erneut vorlegt und sie auf der Destruktion der traditionellen Ontologiegeschichte aufbaut. 32 Die Hermeneutik wird bei ihm damit zur „Existentialhermeneutik“, die sich hauptsächlich mit der Daseinsanalytik beschäftigt. Unter diesem Gesichtspunkt ist Hermeneutik bei ihm „Destruktion.“ 33 So gesehen weist das Dasein aus Heideggers Sicht eine zeitliche Bedingtheit auf, die er „Geworfenheit“ als die Seinsweise des Daseins nennt. Damit bahnt sich das Verstehen des Daseins als solches an. Das Verstehen innerhalb seiner Bedingtheit richtet sich permanent auf das Selbstverständnis und die Auslegung des Daseins, in deren Verlauf das Dasein der Welt begegnet. Mit anderen Worten: Das sich verstehende und sich auslegende Dasein trifft mit seiner Intentionalität die Welt und bildet durch seine Zuneigung zur Welt, die bereits das Dasein mit einschließt, die Vertrautheit mit der Welt aus. Im Hinblick auf diese Seinsweise des Daseins in der Welt spricht Heidegger, wie bereits erwähnt, vom In–der–Welt–Sein. Aus Heideggers Sicht weist das In–der–Welt– Sein darauf hin, dass das Dasein in der gewissen Zeitlichkeit, in die wir hineingeraten sind, in die Welt hineingeworfen ist. Infolgedessen lässt sich mit Heidegger sagen, dass das Dasein bereits zu dieser Welt gehörig und mit dieser Welt vertraut ist. Bei ihm ist die Welt immer schon der bedingte Spielraum des Daseins, sozusagen seine Lebenswelt, in der das Dasein zum Anderen steht und sein eigenes Verhältnis zum Anderen bildet. Darüber hinaus gilt es zunächst, unseren Blick auf die „Vor–Struktur“ des Verstehens in Heideggers Hermeneutik zu richten. Die Vorstruktur des Verstehens, die den Zugang zum Sein begrenzt, ja bestimmt, wird bei Heidegger unter den drei folgenden Kategorien zusammengefasst: „Vorhabe“, „Vorsicht“ und „Vorgriff.“ 34 Heidegger zufolge kann der 32 Ders., Sein und Zeit, S. 13. Ders., Hermeneutik der Faktizität, S. 105. 34 Ders., Sein und Zeit, S. 150. 33 182 Mensch, sofern er sich selbst versteht und auslegt, diesem „Vorverständnis“ niemals entkommen und entziehen, sondern vielmehr wächst er in das geschichtlich vorgegebene Vorverständnis hinein und heraus. Da die Vorstruktur die „Weltverfallenheit“ des menschlichen Daseins als des sich selbst Verstehenden bzw. die „Geworfenheit“ des menschlichen Daseins in die Welt meint, kann das Dasein diese Struktur nicht objektiv betrachten, sondern befindet sich immer schon mitten in diesem ontologischen Horizont drin. Vor dem Hintergrund dieses Vorverständnisses bildet das Verstehen einen Sinnhorizont. Aus diesem Grund können wir in Bezug auf Heideggers fundamentalontologische Daseinsanalytik bemerken, dass das Vorverständnis das Verstehen zu einem bestimmten Horizont hinführt, d. h., dass das geschichtlich Vorgegebene für uns einen Sinnhorizont eröffnet und uns damit zum Seinssinn hinleitet. Demgemäß sagt Heidegger: „Sinn ist das durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff strukturierte Woraufhin des Entwurfs, aus dem her etwas als etwas verständlich wird.“ 35 Insofern bestimmt die Vorstruktur als die Geworfenheit des Daseins die Sinnrichtung mit und macht die unentrinnbare Bedingtheit des menschlichen Verstehens sichtbar. Hierbei ist die klare Trennung zwischen Subjekt und Objekt bereits aufgehoben. Vielmehr beginnt das Verstehen über die Dinge und über sich selbst immer mit der vorgegebenen Sinndimension, der von vornherein keine objektivierbare Trennlinie innewohnt und der deshalb eine holistische Potenzialität zukommt. Heidegger drückt das so aus: „Alle Auslegung bewegt sich ferner in der gekennzeichneten Vor–Struktur.“ 36 Aus den bisherigen Skizzierungen können wir den hermeneutischen Grund dafür entnehmen, warum Gadamer das Vorurteil im menschlichen Verstehen hervorhebt. Die hermeneutische Akzentuierung der Struktur des Vorverständnisses ist im Grunde der Versuch, wie bereits erwähnt, die methodische Spaltung zwischen Subjekt und Objekt im modernen Zeitalter kritisch zu reflektieren und mehr oder weniger zu überwinden. So liegt Gadamers Einsicht in die Vorstruktur des Verstehens auch ganz in der Linie von Heideggers Idee. Heideggers Argumentation entsprechend wird das Vorurteil bei Gadamer deshalb als die Vorstruktur zum Weltzugang überhaupt verstanden. Gleichwohl blickt Gadamer über Heideggers Fundamentalontologie der radikalen Daseinsanalytik hinaus. Mit dieser Distanzierung zu Heideggers Ontologie gewinnt er seine eigene Produktivität, seinen eigenen Gedankengang seiner philosophischen Hermeneutik, sofern er noch stärker auf den reflexiven Erprobungsprozess der Vorurteilhaftigkeit in der gemeinsamen Verständigung über den Sachverhalt und über uns selbst im Gespräch eingeht. 35 36 Ebd., S. 151. Ebd., S. 152. 183 Aus hermeneutischer Sicht kennzeichnet das Verstehen den ontologisch–existenziellen Grundcharakter des Menschseins. Sofern der Mensch verstehen kann und will, versteht er immer schon etwas und sich selbst. Im Verstehen, d. h. dem Verstehen-Können und –Wollen erkennt der Mensch seine „ursprüngliche Vollzugsform.“ (GW. 1, S. 264) Sobald der Mensch etwas verstehen will, muss er sich auf dieses Etwas einlassen und sich selbst auslegen. Mit anderen Worten: Wenn man versteht, versteht man zugleich sich selbst und legt sich selbst aus. Aus hermeneutischer Sicht sind das Selbstverständnis und die Selbstauslegung, die beide die existenzielle Seinsweise des menschlichen Daseins prägen, jedoch immer auf die Erfahrung der motivierenden Fremdheit angewiesen, da das Verstehen, sofern es vom Verstehen–Wollen des Menschseins ausgeht, seinen eigenen Motivationshintergrund mit einschließt. Das hermeneutische Verstehen ist zudem intentional auf ein „Woraufhin“ gerichtet. Anders formuliert, ist das Verstehen, dem eine Intentionalität, eine tendenzielle Zuneigung innewohnt, von Anbeginn an in seinen motivierenden Anreizen verwurzelt. Aus diesem Einbezogensein in das Fremde vermehrt und verändert sich das Verstehen. Damit wird deutlich, dass die Verankerung des Verstehens im Fremden aus hermeneutischer Sicht seine Geschichtlichkeit, als die ontologische Grundlage der menschlichen Erfahrung ist. Aus Gadamers Sicht ist das Menschsein deshalb das „Geschichtlichsein“, da es sich bereits mitten in der Geschichte befindet, sofern es nicht nur etwas, sondern auch sich selbst verstehen und auslegen will und kann. Bei Gadamer geht es nunmehr um die Geschichte, noch präziser, die Geschichtlichkeit, in der wir immer schon stehen und stehen müssen, da sie die das Subjekt übersteigende Quelle aller Sinngehalte ist. Indem die Einbezogenheit in die Geschichte, so Gadamer, das „Darinstehen in einem Überlieferungsgeschehen“, die Basis unserer existenziellen Seinsweise bildet, bezieht uns das Verstehen, sobald wir verstehen wollen, ins Verstehensgeschehen mit ein oder wie Gadamer sagt: „Wer versteht, ist schon immer einbezogen in ein Geschehen, durch das sich Sinnvolles geltend macht.“ (GW. 1, S. 314 u. S. 494) So gesehen ist das Verstehen die Folge unseres motivierten Verstehen–Wollens, das dem Einbezogensein in die geschichtliche Sinnquelle, in die geschichtlich bedingte Situiertheit der menschlichen Existenz, entstammt. Das Verstehen–Können und –Wollen des Menschen ist hier der Grundstein der hermeneutischen Erfahrung, auf dem sich die reflexive Prüfung der erarbeiteten Sinngefüge gründet. Aus diesem Grund wird der hermeneutische Anspruch an den angemessenen Entwurf, an die Hoffnung auf eine kompromissvolle Verständigung, 37 erhoben. Im Verlauf unserer freiwilligen Hineinversetzung bewegt sich das Verstehen 37 Vgl. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, S. 315ff., deutl. S. 343ff. Gegen die wissenschaftstheoretische Methodenidee gilt ihm die Hermeneutik hier als „the hope of agreement.“ 184 zwischen dem beschränkten und dem sich erschließenden Sinnfeld, das von unserem Verstehen–Wollen in Gang gesetzt wird und sich als eine interpretationsbedürftige Sinnwelt darstellt. Dieses Sinnfeld ist nicht objektivierbar, sondern markiert einen uns mit einschließenden Sinnhorizont, der von uns nicht auslotbar ist, dem wir unentrinnbar von vornherein angehören. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, jemals eine abgeschlossene Gewissheit zu erlangen, ein allgemeingültiges Wissen. Aufgrund dieser hermeneutischen Anerkennung der prinzipiellen Unabschließbarkeit des Verstehensvorgangs, befindet sich das Verstehen immer auch in der möglichen Gefahr des Missverständnisses. Aber diese Möglichkeit des Missverständnisses bedeutet aus der hermeneutischen Perspektive keinesfalls einen bloßen Irrtum, sondern eröffnet stets einen neuen Sinnhorizont. Denn jedes Verstehen in der Hermeneutik ist ein unendlicher Versuch, auf die Frage nach dem schon Verstandenen zu antworten. Jedes Verstehen sieht es mithin als seine wesentliche Aufgabe an, alles bereits Verstandene zu überprüfen und es damit in einen neuen Sinnhorizont zu integrieren. In diesem reflexiven Integrationsvorgang, in dem sich eine Selbstumwandlung in seinem Inneren abspielt, gelangt dem Verstehenden nicht nur das Missverständnis, sein Irrtum zu Bewusstsein, sondern vielmehr wird er sich auch seiner eigenen Stellung zur Sache bewusst. Der Verstehensvorgang ist deshalb ein interaktives Wechselspiel zwischen dem schon Verstandenen und dem zu Verstehenden, dem Verstehen–Können und dem Missverstehen– Können. Die Geschichte beinhaltet also in Gadamers Hermeneutik die unübersehbaren Potenzen jeder möglichen Sinnerschließung, da sie die Seinsweise der menschlichen Existenz modifiziert und stets überragt, „der tragende Grund des Geschehens, in dem das Gegenwärtige wurzelt“, ist. (GW. 1, S. 303) Nun kann man mit Gadamer sagen, dass die Geschichtlichkeit die ontologische Basis für die menschliche Erfahrung, nämlich die menschlichen Handlungen, ist. So bildet sie von vornherein den präreflexiven und vorwissenschaftlichen Sinnhorizont, aus dem sich der potenzielle Spielraum überhaupt erst ergibt. Angesichts dessen bezieht sie sich auf sämtliche Bereiche menschlicher Handlungen, nämlich auf den geschichtlich-kulturellen Hintergrund, vor dem die lernprozessuale Sozialisierung stattfindet. Aus diesem Grund stammt das hermeneutische Bewusstsein aus der geschichtlich bedingten Situiertheit unserer Handlungen. Die Geschichtlichkeit bedingt daher das Bewusstsein, also die Tatsache, dass wir im Grunde in die vorwissenschaftliche Lebenswelt als sinnhaltige Grundlage der menschlichen Erfahrung hineingeworfen, hineingewachsen sind. Die gegenwärtige Sinndimension ist bereits durch die Vergangenheit mitbestimmt und unsere eigene geschichtliche Zugehörigkeit ist es, die uns schließlich zu 185 einem neuen Sinnhorizont führen wird. Über diese Geschichtlichkeit der Erfahrung sagt Gadamer emphatisch: „Wohl aber scheint es mir kein Zweifel, daß sich der große Vergangenheitshorizont, aus dem heraus unsere Kultur und unsere Gegenwart leben, bei allem als wirksam erweist, was wir in die Zukunft hinein wollen, hoffen oder fürchten. Die Geschichte ist mit da und ist selbst nur da im Lichte dieser unserer Zukünftigkeit.“ (GW. 1, S. 224, meine Hervorhebung) Hier geht das hermeneutische Verstehensproblem m. E. wieder auf die alltäglichen Lebensbezüge zurück, die der wissenschaftlichen Reflexion voraus gehen und von sämtlichen geschichtlich tradierten Überlieferungen vorgeformt sind. Im Hinblick auf die Einbettung des Verstehens in die alltägliche Lebenswelt, betont Gadamer die Zugehörigkeit zu tradierten Sinngefügen, die bei der Erschließung des gegenwärtigen Sinnhorizontes, ihre Wirksamkeit entfalten. Indem Gadamer seinen Akzent auf die Zugehörigkeit setzt, geht sein hermeneutisches Verstehen von der Anerkennung unseres Angewiesenseins auf die überlieferte Situiertheit aus, die vor allen Reflexionsakten liegt. Daraus leitet Gadamer nunmehr seinen Begriff des „Vorurteils“ ab, das nicht als ein Vorurteil, sondern als die Vorurteile bezeichnet wird. Denn die Vorstruktur des Verstehens bezieht sich nicht auf die heillose Befangenheit, der wir blind verhaftet sind, sondern sie bildet den gemeinsamen Boden, auf dem alle Sinnhorizonte als Möglichkeiten der menschlichen Erfahrung entstehen. In Anknüpfung an diese vielfältigen Möglichkeiten, können und müssen wir als Verstehende auch unseren eigenen Sinnhorizont finden und uns erarbeiten. Hermeneutisch gesehen, können wir uns einer nackten Tatsache gegenüber nicht vorurteilsfrei verhalten, sondern konfrontieren uns mit einer Sache immer schon aus dem Blickwinkel unserer Vorurteile heraus. Es gibt also keinen neutralen Standpunkt des Beobachters. Vielmehr sind wir gezwungen, mit der Vorurteilhaftigkeit unserer Sichtweise umzugehen. Hierbei kann es uns natürlich auch passieren, dass man eine Sache missversteht und sich irrt, wie bereits erwähnt wurde. Doch von diesem Missverständnis, von diesem Irrtum ausgehend, haben wir die Möglichkeit, das, was uns fehlt, noch zu lernen. Gefährlich wird es nur, wenn wir unsere vorurteilhafte Beschränktheit vergessen und uns auf sie versteifen, da uns eine solche Vergessenheit geradezu zu einer dogmatischen Verblendung führen würde. Somit liegt auf der Hand, dass die Vorurteile, die den bereits bestehenden Sinnbezügen entstammen, einen vorausgehenden Horizont, der sich als Ausgangspunkt der Verstehensprozesse weiter entfaltet, bilden. Die Struktur des Vorverständnisses in Gadamers Hermeneutik zeigt sich zudem auch als ein Vor–Urteil in dem Sinn, dass sie der ontologische Ausgangspunkt für alles Verstehen ist und den reflexiven Urteilen vorausgeht: Das Vorurteil geht bei Gadamer dem Urteil voraus. 186 In diesem Zusammenhang wird der frühe Hegel für unsere Diskussion wieder interessant, da sich der junge Hegel mit der zeitgenössischen Reflexionsphilosophie insbesondere in seiner Denkentwicklung auseinandergesetzt hat. Dort übte Hegel unter dem Einfluss der Romantik, insbesondere Hölderlins, 38 Kritik an der urteilenden Reflexion, da diese Reflexion seiner Ansicht nach das ursprüngliche Sein beiseite schiebt, das von vornherein allen Urteilen zugrunde liegt. Indem sie von der Trennung zwischen Subjekt und Objekt ausgeht, muss das Sein bei Hegel zuallererst von sich selbst unterschieden sein, damit es zum Gegenstand für das Urteil werden kann. Das bedeutet, dass das Sein sich im Grunde selbst teilen, über sich selbst aussagen muss. Erst dann ist das Sein für das Urteil bereit. Damit muss das Urteil zugleich zum Sein als solches zurückkehren, da das Sein ein dem Urteil vorausgehendes Ursprüngliches ist und das Urteil erst aus dieser Urquelle heraus erwächst. In diesem Sinn ist das Urteil grundsätzlich „Ur–Teilung“. Von daher kann man sagen, dass Hegel in seiner frühen Zeit die wesentliche Zirkelbewegung zwischen Sein und Urteil durchaus bedacht hat, obwohl er sie später zunehmend mit dem abgeschlossenen System zu vollenden glaubte. Sofern sie allen reflexiven Urteilen vorausgehen und zugrunde liegen, entsprechen die Vorurteile bei Gadamer sowohl dem ursprünglichen Sinnfeld als auch dem Sein bei Hegel. Jedoch sind sie für Gadamer auf keinen Fall der Ursinn, zu dem das reflexive Urteil kausal zurückkehren muss. Vielmehr stellen sie eine bestimmte Auswahl aller potenziellen Horizonte dar, da wir im Verstehensprozess nicht alle möglichen Vorurteile einsetzen können, sondern jeweils nur eines wählen. Nun kann man sagen, dass diese Auswahl unseren eigenen Horizont bildet. Aus Gadamers Sicht gewinnen wir mit der Bildung unseres eigenen Horizontes, der von den versteckten Sinnquellen der gesamten Lebensbezüge aus erschlossen ist, unseren Bezugspunkt zur Welt. Indem die Vorurteile in der Hermeneutik die heimlichen Motivationszusammenhänge darstellen, von denen wir uns nicht distanzieren können, leiten sie die Fragedimension, in der unser Verstehensprozess eingebettet ist, an. Denn das hermeneutische Verstehen setzt mit dem Fragen ein, ein Fragen, das durch die Zugehörigkeit zum kulturell Geschichtlichen ermöglicht wird. Insofern ist das Verstehen die Suche nach einer Antwort auf die Frage. Die Vorurteile im hermeneutischen Verstehen setzen sich selbst von vornherein einem Erprobungsprozess aus. Auf diesem Weg gewinnt das hermeneutische Verstehen das Bewusstsein von seiner ontologischen Vorstruktur und macht sich seine Vorurteile bewusst. Die Vorurteile sind, Gadamers Ansicht zufolge, kein reines Vorurteil mehr, an dem der Verstehen–Wollende versteinert festgehalten wird, sondern sie weisen als die ontologisch– 38 Zum Einfluss von Hölderlins Vereinigungsphilosophie auf Hegels Denkumwandlung, vgl. Kap. II. Das Prinzip der Anerkennung in Hegels früher Zeit vom I. Teil in dieser Arbeit. 187 bedingte Vorstruktur des Verstehens mehrhorizontale Schichten auf. Aus hermeneutischer Sicht gilt es zu sehen, dass die ontologische Vorstruktur nicht nur im Textverstehen, sondern noch wesentlicher im alltäglichen Sinnvollzug der sozialen Lebensbezüge eine Rolle spielt. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit hier dem komplizierten Strukturzusammenhang der Vorurteile im hermeneutischen Verstehen zuwenden, könnte man es in folgender Hinsicht als mehrdimensional bezeichnen: Hinsichtlich des Textverstehens handelt es sich zunächst um die geschichtliche Vorstruktur des Textes, die sich auf dessen geschichtliches Faktum bezieht und damit um das Vorverständnis des Autors, welches sich aus seiner geschichtlichen Bedingtheit ergibt. Es handelt sich jedoch auch um die Vorurteile des Lesers und dessen jeweiliges Vorverständnis, das durch den durchschrittenen Horizont hindurchgeführt worden ist. In Bezug auf die alltäglichen Dialogsituationen zwischen den Menschen werden wir außerdem die lebensgeschichtliche Bedingtheit der Perspektive des Sprechers und seinen daraus bestimmten Gegenwartshorizont bzw. die geschichtliche Vorstruktur des Hörers und den davon abhängigen Gegenwartshorizont mit berücksichtigen. Auf diese mehrhorizontalen Schichten der Vorurteile bezieht sich im Grunde das hermeneutische Verstehen. In Gadamers Hermeneutik wird deshalb zwar gezeigt, dass die ontologische Vorstruktur des Verstehens auf ein Gefangensein des menschlichen Verstehens in der situierten Bedingtheit verweist, stellt für Gadamer jedoch zugleich auch die einzige Möglichkeit zur Sinnerschließung in der Welt dar, d. h. dafür, „daß wir etwas erfahren, daß uns das, was uns begegnet, etwas sagt.“ (GW. 1, S. 224) Da die Vorurteile, wie bereits gesagt, die Möglichkeiten der menschlichen Erfahrungen, nämlich die Vorstruktur zum Weltzugang und die Situationseingebundenheit im hermeneutischen Sinnvollzug zur Geltung bringen oder anders formuliert in jeder Konfrontation der Verstehen–Wollenden mit der Sache den Sinnhorizont des Verstehen– Könnens mitbestimmen, fügt sich das hermeneutische Verstehen mit dieser Struktur des Vorverständnisses in die gesamte Sinnbewegung ein: Im ersten Fall als wechselseitige Bewegung zwischen Textsinn und Standpunkt des Lesers, im zweiten Fall zwischen Sprecher und Hörer. Somit wird deutlich, dass die Vorurteile in der Hermeneutik von vornherein den Anknüpfungspunkt bilden, der uns über die Erfahrung der Distanz hinaus das wechselseitige Verstehen erst möglich macht. Aus diesem Grund rehabilitiert Gadamer die Vorurteilsstruktur als die ontologische Grundlage der hermeneutischen Erfahrung zwar unter dem Gesichtspunkt, dass die Vorurteile im Verstehensprozess nicht ausgeblendet oder ausgeschaltet werden dürfen, sondern sie als ein Moment auf dem endlosen Weg zum hermeneutischen Sinnvollzug immer schon eine herausragende Rolle spielen. Solange wir verstehen wollen, können wir uns keinen 188 vorurteilsfrei neutralen Gesichtspunkt verschaffen, da wir bereits mit unserem eigenen Blickwinkel in die Konfrontation mit einem bestimmten Sachverhalt eingebunden sind. Vielmehr müssen wir in angemessener Weise unser Vorverständnis auf dem Weg zum Verstehen über die Sache korrigieren und so letztlich zum Verstehen über uns selbst kommen. Bezüglich des Ins–Spiel–Setzens des hermeneutischen ‚Vor’ sagt Gadamer: „In Wahrheit wird das eigene Vorurteil dadurch recht eigentlich ins Spiel gebracht, daß es selber auf dem Spiele steht. Nur indem es sich ausspielt, vermag es den Wahrheitsanspruch des anderen überhaupt zu erfahren und ermöglicht ihm, daß er sich auch ausspielen kann.“ (GW. 1, S. 304) Aus hermeneutischer Sicht ist es zweifelos eine Tatsache, dass die eigenen Vorurteile im Erprobungsprozess denen des Anderen begegnen. Das Sich-Hineinversetzen ins Verstehensfeld bringt zugleich auch die Begegnung mit den verschiedenen Sinnentwürfen mit sich, die sich dem jeweils anderen aussetzen und damit zugleich zur kritischen Auseinandersetzung mit den jeweils anderen Vorurteilen führen. Im Textverstehen geht der Leser z. B. immer von seiner eigenen Sinnerwartung aus, begegnet auf der Basis seines eigenen Sinnhorizontes dem für ihn fremden Textsinn. Bei diesem Sichaussetzen der eigenen Vertrautheit gegenüber dem fremden Sinnhorizont wird die eigene Vormeinung überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Der reflexive Prozess der Selbstüberprüfung und –entlarvung der Vorurteile auf der endlosen Wahrheitssuche skizziert von nun an aus hermeneutischer Sicht keinen entwicklungslogischen Fortschritt, sondern den Prozess des „Scheiterns des Verstehens.“ 39 (GW. 2, S. 57) Dennoch, auf der unendlichen Suche, die das logische Scheitern durchläuft, wird die Voreingenommenheit im Textverstehen auf den Textsinn treffen und sich damit dem Textsinn anzunähern versuchen. Um zu verstehen, müssen die Vorurteile sich selbst in den miteinander konfrontierenden Erprobungsprozess einlassen. Nur durch dieses Ins–Spiel–Setzen können sie mit dem Textsinn Schritt halten. Denn „die Sache, um die es jeweils geht, - der Text, den man verstehen möchte – ist der alleinige Maßstab, den man gelten läßt“, solange wir mit unserer Sinnerwartung das zu Verstehende verstehen und wir uns selbst in den Verstehensprozess hineinbetten, in dem jeder Sinnhorizont von dem eigenen Vorverständnis abgeleitet wird und die mögliche Sinnhorizonterschließung nur mit dem impliziten Sinnhorizont zusammengefügt werden kann. (GW. 1, S. 109) Das Vorverständnis ins Spiel zu setzen bedeutet daher im hermeneutischen Verstehensprozess, 39 Zu einer Logik des Scheiterns im zirkulären Verstehensgang vgl. Hans–Georg Flickinger, „Die heimliche Logik des Verstehens – Vom Denken und vom Schreiben“, in: Prisma Nr. 46, Kassel 1992, S. 3-5 und damit auch Jean Grondin, „Die Hermeneutik als die Konsequenz des kritischen Rationalismus“, in: philosophia naturalis (32), hrsg. v. Bernulf Kanitscheider, Lorenz Krüger u. a., Frankfurt a. M. 1995, S. 183 – 191. Hier geht es um K. Poppers Einsicht in die Endlichkeit der menschlichen Erkenntnis, nämlich „trial and error“ im unendlichen Versuch, etwas zu erkennen. 189 sich den möglichen Weg zum Textsinn als solchen, d. h. zur Sachangemessenheit zu erschließen, die eigene Vertrautheit durch die Erfahrung der Fremdheit zu bereichern und zu erweitern. „Das hermeneutisch geschulte Bewußtsein“ stützt sich auf die Erkenntnis, dass das Verstehen immer schon die mitkonstitutive Rolle des Fremden anerkennt, dass das Verstehen deshalb permanent etwas von diesem fremden Sinn in die eigene Vertrautheit überträgt. Hinsichtlich seiner Einsicht in die Grundstruktur der menschlichen Erfahrung, nämlich das Angewiesensein auf die Andersheit im menschlichen Verständnis, sagt Gadamer: „Wer einen Text verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen. Daher muß ein hermeneutisch geschultes Bewußtsein für die Andersheit des Textes von vornherein empfänglich sein.“ (GW. 1, S. 273) Angesichts dessen ist bei Gadamer nicht entscheidend, ob das Vorurteil im hermeneutischen Verstehen wahr oder falsch, legitim oder illegitim ist, sondern wie es im Verstehensprozess des fremden Sinns als Anstoß zum Verstehen agiert und wie es sich selbst als das Einbezogensein des Verstehens in die Erfahrung der Fremdheit bewusst macht. Das Vorurteil als Sinnantizipationshorizont ist immer schon auf jeder Stufe des wahrheitssuchenden Verstehensprozesses beteiligt. In der Konfrontation mit dem wahrheitsfähigen Sinngehalt, den die Welt uns liefert, wird das Verstehen auf eine bestimmte Sinnrichtung hin ausgerichtet. Das Vorurteil ist daher in der Hermeneutik ein Entwurf von Sinnmöglichkeiten und erschließt den potenziellen Sinnhorizont. Aus Gadamers Sicht wird das Vorurteil deshalb als die ontologische Bedingung des Verstehens, d. h. die unabdingbare Angewiesenheit auf die Fremdheit im Sinnverstehen verstanden. Um etwas zu verstehen, muss der Verstehende sein eigenes Vorurteil zunächst in den gesamten Sinnhorizont einbringen, in dem das eigene Vorurteil mit dem Sinngehalt konfrontiert und dessen Sachangemessenheit überprüft wird. Hermeneutisch gesehen meint das Vorurteil, wie bereits erwähnt, die geschichtliche Position, von der aus unser Verstehen überhaupt erst möglich wird. Daher wird verständlich, dass das Vorurteil eine Voraussetzung für die Sinnerschließung des zu Verstehenden ist. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob es wahre oder falsche, legitime oder illegitime Vorurteile im Verstehensprozess gibt. Gibt es überhaupt eine Trennlinie, die die wahren von den falschen Vorurteilen, die legitimen von den illegitimen Vorurteilen unterscheiden kann? 40 Wir haben bereits gesehen, dass es in der philosophischen Hermeneutik keine Letztinstanz mehr gibt, von der aus die Sachverhalte auf jeden Fall beurteilt werden können. Diesbezüglich hatte Gadamer seine Kritik an der Bewusstseinsphilosophie im Aufklärungszeitalter und am Methodenbewusstsein in der 40 Vgl. J. Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Frankfurt a. M. 1982, S. 303, u. „Zur Gadamers >Wahrheit und Methode<“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, S. 48. 190 Naturwissenschaft zum Ausdruck gebracht. Zudem ist das Vorurteil in Gadamers Hermeneutik eine ontologische Grundlage, die vor allen reflexiven Urteilsakten bereits besteht. Es verweist daher auf den vorreflexiven, vorwissenschaftlichen Sinnhorizont, dem wir unentrinnbar ausgesetzt sind, auf die alltäglichen Lebensbezüge. Wenn wir nun die ontologische Vorstruktur des Verstehens innerhalb des geschichtlichen Verstehensfeldes gänzlich abschaffen könnten und daran anschließend die wahren von den falschen Vorurteilen, die legitimen von den illegitimen Vorurteilen ganz selbstverständlich unterscheiden könnten, wäre es m. E. überflüssig, uns die philosophische Frage zu stellen, was wahr ist, wie es letztendlich wahr, gut oder schön ist. Denn die philosophische Grundfrage wäre damit bereits vor allen sinnstiftenden Fragestellungen beantwortet worden, da das Problem bereits vor allen reflexiven Urteilen gelöst worden wäre. Noch zugespitzter formuliert, wäre die Antwort auf die Frage, was wir verstehen können und verstanden haben, vor allen Erfahrungen immer schon gegeben, wenn wir diese Trennung vornehmen könnten. 41 Habermas scheint, indem er mit der obigen Fragestellung die kritische Auseinandersetzung mit Gadamer sucht, die Legitimationsfrage und die Gerechtigkeitsfrage dahinter verstecken zu wollen. Aus hermeneutischer Sicht wäre dem die Frage entgegenzusetzen, wie eine Fragedimension ohne die vorausgehende Fragesituation überhaupt möglich sein kann. Wenn man sich selbst eine Frage stellt, stößt diese eine motivierte Sinnrichtung an. Das bedeutet: Jede überzeugende Frage ist bereits motiviert. Hermeneutisch gesehen, gewinnt jede Frage zweifelsohne ihre Sinnrichtung aus ihrer inneren Motivation heraus. Aus diesem Grund versucht das hermeneutische Verstehen zunächst die Frage, also die Fragerichtung zu verstehen und auf die innere Motivation, die die Sinnrichtung steuert, zu hören. Indem Habermas sich selbst der Geschichtlichkeit der Normenbildung verweigert, indem er nach der Legitimität in der Gesellschaftstheorie fragt, gerät er in die Begründungsproblematik, mit der er sich später noch beschäftigen wird. 42 Aus Gadamers Sicht geht seine Begründungsproblematik jedoch auf die „objektive Substanzialität“ bzw. die „transzendentale Subjektivität“ zurück. Mit anderen Worten: Die Begründungsfrage könnte nach Habermas nur durch einen transzendentalen Grundsatz, der jenseits unserer lebensweltlichen Praktiken liegt, beantwortet werden, ganz so, als ob dieser vom Himmel fallen würde. In der Hermeneutik dagegen ist die sinnweisende Fragestellung ohne die ontologische Vorstruktur, ohne die bewusste Anerkennung der Standortgebundenheit der 41 42 Vgl. J. Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, S. 156ff. Uns ist bereits bekannt, dass sich Habermas später von dem Anspruch auf die Letztbegründung zu distanzieren versuchte. Diesbezüglich vgl. Jürgen Habermas, Erläuterung zur Diskursethik, Frankfurt a. M. 1991,S. 119ff., vgl. auch Kap. II – 1. Aristoteles’ phronesis in Bezug auf den Platonischen Dialog vom III. Teil dieser Arbeit 191 Fragesituation, unmöglich. Das hermeneutische Verstehen kann daher ohne den Zwang zum Beweis oder zur Begründung den Prozess der Sinnkonstitution von sich selbst ableiten und ausarbeiten. Im Hinblick auf die Begründungsfrage sagt Gadamer deshalb: „Wer verstehen will, braucht das, was er versteht, nicht zu bejahen.“ (GW. 2, S. 273) Darüber hinaus gipfelt Habermas’ Kritik an der Vorurteilhaftigkeit in Gadamers philosophischer Hermeneutik in dem Vorwurf, diese ersetze ein Vorurteil durch ein anderes und verabsolutiere somit das Vorurteil. Daran anschließend bezeichnet Habermas die Vorstruktur des Verstehens als „die Sedimentierung von Vorurteilen“. 43 Aus den bisherigen Überlegungen schlußfolgernd, liegt es für uns jedoch auf der Hand, dass Gadamer in seiner Hermeneutik keinesfalls das Vorurteil sedimentieren oder verabsolutieren will, sondern seine Einsicht liegt, wie wir gesehen haben, gerade darin, dass das hermeneutische Verstehen von dem Vorurteil als einer notwendigen Kompetenz für das Sinnverstehen ausgeht, seine bedingte Vorstruktur anerkennt und auf dieser Basis die Vorurteile ins Spiel bringt. Aufgrund dieser Einsicht spricht Gadamer deshalb davon, dass es „[i]n seinem Begriff liegt, daß es (= das Vorurteil, KBL) positiv und negativ gewertet werden kann.“ (GW. 1, S. 275) So gesehen muss das Vorurteil bei Gadamer erprobt und zu Bewusstsein gebracht werden, weshalb das Bewusstmachen der Vorurteile auch eine hermeneutische Aufgabe ist. Nun geht es uns als den Verstehenden um die Einbettung des eigenen Vorurteils ins Sinnfeld, niemals aber um die Ausblendung des eigenen Vorurteils oder gar die Entkoppelung von dieser vorurteilhaften Vorstruktur. Im Anschluss an die Einsicht in die Vorurteilsstruktur im hermeneutischen Verstehen spricht Gadamer von der „Tradition“, d. h. einer kulturellen, geschichtlichen Tradiertheit, die für uns einen wesentlichen, gemeinsamen Hintergrund der sozial erzeugten Sinngewebe bildet. Die Tradition entwickelt sich kontinuierlich über die begrenzte Zeitlichkeit hinweg und umschließt auch das sinnverleihende Moment. Die Tradition, die den uns überlieferten Sinnhorizont prägt, hat daher aus Gadamers Sicht doppelseitige Bezugspunkte: Sie lässt uns auf der einen Seite stets die Frage forumulieren, aus deren Perspektive sie uns anleitet und motiviert. So verleiht sie uns die Motivation, verstehen zu wollen. Auf der anderen Seite bildet sie die ontologische Rahmenbedingung, innerhalb der wir verstehen wollen und können. Als geschichtlicher Ausgangspunkt der menschlichen Erfahrung bildet sie die innere Voraussetzung für alle weiteren potenziellen Fragehorizonte. Aus hermeneutischer Sicht meint die Tradition, die tradierte Überlieferung, deshalb die sozial-kulturelle Erfahrung, die kein äußeres Drittes für die Erfüllung des Geltungsanspruchs und keine Begründung braucht, sondern sich aus dem inneren Prozess heraus konstituiert. In der Konsequenz kann man sagen, 43 J. Habermas, Zu Gadamers >Wahrheit und Methode<, S. 49. 192 dass die Tradition für das hermeneutische Verstehen die sozial erzeugten und überlieferten Sinnhorizonte, in denen die jeweilige Sinnwelt erschlossen werden kann, bildet. Das hermeneutische Verstehen bezieht sich mithin insbesondere auf den traditionell vorstrukturierten Hintergrund eines immer schon vorhandenen Bezugssystems von Sprache und Handlung, das sich für die Möglichkeiten verschiedener Lebensformen offen hält. Insofern ist die Tradition für Gadamer nicht mehr die beharrliche, versteinerte Substanz, sondern erprobt sich in der andauernden Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Denn die Zukunft kann aus hermeneutischer Sicht nur aus der Vergegenwärtigung des Herkömmlichen entworfen werden. Am Beispiel der Tradiertheit in der Kunsterfahrung merkt Gadamer folgendes an: „Die Tradition, […] ist nicht etwa ein Hemmnis für freie Gestaltung, sondern hat sich mit dem Werk selbst derart verschmolzen, daß die Auseinandersetzung mit diesem Vorbild nicht minder als die mit dem Werk selbst die schöpferische Nachstellung jedes Künstlers aufruft. […] die Werke, mit denen sie (= die reproduktiven Künste, KBL) es zu tun haben, zu solcher Nachgestaltung ausdrücklich freilassen und damit die Identität und Kontinuität nach seiner Zukunft hin sichtbar geöffnet halten.“ (GW. 1, S. 124) Diese Einsicht Gadamers in die tradierte Überlieferung im hermeneutischen Verstehen beschränkt sich nicht auf das Verstehensphänomen des überlieferten Kunstwerkes, sondern bezieht sich auf alle Sinnfelder in der alltäglichen Lebenswelt. Mit anderen Worten: Die tradierte Kontextabhängigkeit des menschlichen Verstehens gilt nicht nur in der Kunsterfahrung, sondern auch in den alltäglichen Lebensordnungen. Dementsprechend stehen nicht nur ein Theaterstück, eine musikalische Komposition usw., sondern auch die gesamten Lebensbezüge, z. B. die moralische Sitte, die Normativität usw., in diesen überlieferten Sinnzusammenhängen. Innerhalb der in dieser ganzen Bewegung wurzelnden Sinnkette wird der herkömmliche Sinnhorizont mit dem Gegenwartshorizont konfrontiert und erschließt damit zugleich in der sich verwirklichenden Auseinandersetzung die künftige Sinnmöglichkeit. Daher bedeutet Tradition „nicht bloß Konservierung, sondern Übertragung“, die die Tragfähigkeit des überlieferten Traditionssinnes immer anhand der konkreten Situation überprüft. So ist letztere keinesfalls die nachträgliche Imitation des überlieferten Sinns, sondern vielmehr kommt in ihr der tradierte Sinn zur Sprache. (GW. 8, S. 139) Hieran knüpft Gadamer auch die Frage nach dem „Klassischen“ an. Seine Fragestellung hat ihren Grund nicht nur in seinem Einwand gegen das Verständnis des Klassischen im Historismus, sondern ermöglicht die grundsätzliche Klärung der konstitutiven Funktion der Tradition in der hermeneutischen Erfahrung. Aus Gadamers Sicht ist das 193 Klassische zunächst ein Epochenbegriff, 44 wie z. B. die Klassik, der Klassizismus. Zunächst wendet Gadamer sein Interesse insbesondere den wahrheitserschließenden Schriften zu, die er selbst als „eminente“ Texte bezeichnet. Diese klassischen Texte haben uns, Gadamers Ansicht zufolge, über die zeitliche Grenze hinaus ihren Sinn dauerhaft überliefert und verliehen, da sie die Wahrheitsfrage stellen oder mit Gadamers Worten, „daher gewiß >zeitlos< [sind], aber diese Zeitlosigkeit eine Weise geschichtlichen Seins [ist].“ (GW. 1, S. 295) Das Klassische ist daher nicht lediglich obsolet geworden, sondern fordert uns stets von neuem auf, die kontinuierliche Wirkung ausgestalteter Vorbilder nachzuahmen und zu verfolgen. Aus diesem Grund fordert die Klassik uns dazu auf, sie in den Sinnzusammenhängen der Gegenwart zu erkennen. Über den einseitigen Epochenbegriff hinaus, gewinnt das Klassische durch unsere Anerkennung seinen bedeutungsvollen Inhalt, der ihm durch die geschichtlichen Bildungsprozesse hindurch verliehen wird. So gesehen modifiziert das Klassische sich selbst im geschichtlichen Prozess immer weiter, geleitet uns mit seinem fordernden Anspruch zu einer handlungsorientierenden Sinnrichtung für das Alltagsleben und wird damit auch von unserem Sinnhorizont aus immer neu verstanden. 45 An dieser Stelle spricht Gadamer von der „Autorität der Tradition“, gegen die Habermas seinen Vorwurf richtet. Die Autorität der Tradition ist, Habermas zufolge, nur dadurch möglich, dass die Vorurteilsstruktur in Gadamers Hermeneutik, wie bereits erwähnt, sedimentiert und verabsolutiert wird. Aber Habermas’ Kritik geht nur auf einen Punkt von Gadamers Überlegung ein. Er richtet seinen Blick lediglich auf die kommunikative Störung, die gewaltsame Kommunikationsverzerrung in der Gesellschaft und sucht den Grund für diese gesellschaftliche Gewalt in den tradierten Sinndimensionen. In der Folge hat er die Tradition, die tradierte Situiertheit des hermeneutischen Verstehens, als eine ideologisierte Position verstanden, der unser Verstehen unvermeidlich verhaftet ist. An dieser Stelle rückt Habermas seine reflexive Kritik an den traditionellen Überlieferungen in den Vordergrund. 46 Mit diesem 44 Zum Problem des Epochenwandels und der Epochenmarkierung unter der Fragestellung nach der Geschichte, vgl. Hans Blumenberg, „Epochenschwelle und Rezeption“, in: Philosophische Rundschau (6), hrsg. v. H.–G. Gadamer u. Helmut Kuhn, Tübingen 1958, S. 94 – 120. Seiner Ansicht zufolge liegt Geschichte als Ereignis immer in der „Schicht der Probleme“, mit der der Geschichtsschreiber und seine Überlegungen zur Geschichte zu tun haben. Indem Geschichte bei ihm „Problemgeschichte“ sei, handelt es sich bei der Geschichtsschreibung und –interpretation um die sachgemäße „Zuordnung der uns vorliegenden Aussagen zu den je akuten Problemen.“ 45 Vgl. J. Grondin, Hermeneutische Wahrheit. Zum Wahrheitsbegriff Hans–Georg Gadamers, 2. Aufl., Weinheim 1994, S. 180ff. 46 Zur Bodenlosigkeit des kritischen Bewusstseins bei Habermas, vgl. R. Bubner, „Was ist kritische Theorie?“, in: Philosophische Rundschau (16), hrsg. v. H.–G. Gadamer u. Helmut Kuhn, Tübingen 1969, S. 213ff., und ders., „>>Philosophie ist ihre Zeit, in Gedanken erfaßt<<“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, S. 210ff. 194 kritischen Verdacht 47 an allem Traditionellen begründet er auch seinen Anspruch auf einen transzendental begründeten Grundsatz. 48 Die Autorität der Tradition bei Gadamer hingegen setzt von vornherein auf deren Anerkennungsbedürftigkeit, sie muss im wechselseitigen Zusammenspiel mit unserem konkreten Gegenwartshorizont anerkannt werden, da Autorität ohne Anerkennung einen gewaltsamen Zwang bedeutet. In den Überlegungen zu Hegels Anerkennungstheorie im I. Teil haben wir bereits gesehen, dass die Anerkennung selbstverständlich gegenseitig ist: Wer dem Anderen Autorität abverlangt, muss zuallererst von dem Anderen anerkannt werden und muss umgekehrt ebenfalls den Anderen anerkennen. Wenn er seine Autorität durchsetzen will, muss er seine Autorität der wechselseitigen Anerkennung unterwerfen. Indem die Autorität selbst an das wechselseitige Anerkennungsverhältnis gebunden ist, kann die Gegenwart die unangemessenen, aus der traditionellen Überlieferung überkommenen Gesetze, verweigern und zugleich die dem Sachverhalt angemessenen Sinngefüge der Tradition übernehmen. So gesehen liegt das hermeneutische Verstehen bei Gadamer grundsätzlich im Gespräch mit dem Geschichtlichen, den überlieferten Traditionen, mit deren Perspektive wir uns im III. Teil beschäftigen werden. (GW. 1, S. 284 – 286) Somit kann man sagen, dass die Hermeneutik „die Philosophie der begrenzten Vernunft“ ist, 49 da Gadamers philosophische Hermeneutik das wechselseitige Verhältnis zwischen dem Verstehenden und dem zu Verstehenden als ein interpretationsbedürftiges versteht. Das hermeneutische Verstehen befindet sich in dieser interaktiven Polarität und vollzieht sich damit selbst. Auf dem unendlichen Weg zum Sinnvollzug spielt die Tradition als Gesprächspartner immer schon eine Rolle. Hinsichtlich dieses Anerkennungsverhältnisses im Verstehensvorgang sagt Gadamer: „Verstehen und Missverstehen spielt zwischen Ich und Du. Schon die Formulierung >Ich und Du< bezeugt aber eine ungeheure Verfremdung. So etwas gibt es ja gar nicht. Es gibt weder >das< Ich 47 Zur Hermeneutik der Verdächte, vgl. Paul Ricoeur, Die Interpretation, übers. v. Eva Moldenhauer, Frankfurt a. M. 1974, bes. S. 45ff. Hier hat er sich in der Marxistischen und Freudschen Gedankenreihe mit der psychoanalytischen Interpretation der gesellschaftlichen Pathologie beschäftigt. 48 Vgl. v. Bormann, „Die Zweideutigkeit der hermeneutischen Erfahrung“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, S. 96. Hier hat er Gadamers Gegenposition gegen den Anspruch auf die universale Geschichtsauffassung mit folgendem Satz zugegeben: „Insofern scheint mir Gadamers Position stärker als die seiner Kritiker zu sein, die das Transzendieren der geschichtlichen Bedingungen der Praxis fordern und aus der >>Erfahrung der Reflexion<< oder der Vorwegnahme des Endes der Geschichte in der Auferstehung Jesu heraus eine neue – ihrer Herkunft in kritischer Reflexion gegenüberstehende – Praxis behaupten.“ Zur Universalgeschichte, die den Gadamer–Kritikern zugeordnet wird, vgl. Wohlfahrt Pannenberg, „Hermeneutik und Universalgeschichte“, in: Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften, S. 283ff. In seinem Aufsatz versuchte er als Theologe den Anspruch auf die Universalgeschichte zu erheben, die die hinter dem Textsinn versteckt bleibende Sache erhellen können müsse und die im Grunde das Problem der Bibelexegese auslöse. 49 G. Figal, Der Sinn des Verstehens, Stuttgart 1996, S. 11 – 12 und vgl. zudem auch Reinhart Koselleck, Hans– Georg Gadamer, Historik, Sprache und Hermeneutik. Eine Rede und eine Antwort, 2. Aufl. Heidelberg 2000, S. 23. Gegen die utopische Idee der Emanzipation sagt Koselleck hier: „Es wäre ein Irrtum zu glauben, daß die Emanzipation, die immer generationsbedingt ist, jemals eine endgültige und allgemeine sein könne.“ 195 noch >das< Du, es gibt ein Du–Sagen eines Ich und es gibt ein Ich–Sagen gegenüber einem Du; aber das sind Situationen, denen immer schon Verständigung vorhergeht. Zu jemandem Du–Sagen – wir wissen es alle – setzt ein tiefes Einverständnis voraus. Da trägt schon etwas, was dauerhaft ist.“ (GW. 2, S. 223) 50 Unser Verstehen vollzieht sich im Gespräch mit der geschichtlichen Überlieferung und als Du–Erfahrung in der zwischenmenschlichen Beziehung. Im Sich-Einlassen auf das Gespräch erschließt die Tradition die möglichen Sinndimensionen, erweckt immer wieder von neuem unseren Impuls, verstehen zu wollen und zu können, sozusagen als zentrale Bedingung des Verstehens. So sind wir immer schon auf die Stimmen der Tradition angewiesen. Hermeneutisch gesehen, ist die Tradition mithin nichts anderes als „das Unvordenkliche in jedem Verstehen“ 51 und zwar in der Hinsicht, dass die Tradition die Sinnrichtung kanalisiert und den von uns nie gänzlich erklärbaren Sinnhorizont bildet. Die Autorität der Tradition ist bei Gadamer ein Eingeständnis, das besagt, dass wir uns bereits im Gemeinsamen befinden und uns selbst im ständigen Umgang mit unserer Herkunft weiter bilden. 50 Zur hermeneutischen Selbsterkenntnis im Dialogverhältnis, vgl. Kap. I – 3. Dialog als Urphänomen des Denkens: Woran orientiert sich die dialogische Gesprächsführung? im III. Teil dieser Arbeit. 51 J. Grondin, Einführung zu Gadamer, S. 153. 196 I – 2. Die Wirkungsgeschichte als das Prinzip des Verstehens: Die überlieferte Tradition und die Rekonstruktion in Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Das Verstehen in der Hermeneutik vollzieht sich durch den wechselseitigen Wirkungszusammenhang zwischen Vertrautheit und Fremdheit, Eigenheit und Andersheit. Der Sinn im hermeneutischen Verstehen entsteht aus der ineinander übergehenden Bewegung des uns Vertrauten und des uns Fremden. In diesem gegenseitig wirkenden Prozess werden die Vorurteile, wie bereits erwähnt, als geschichtlich bedingte Kontextualität unseres Verstehens bezeichnet. Insofern müssen wir unseren Verstehensvorgang mit dem vorurteilhaft Vertrauten beginnen, da diese Vorurteilsstruktur als ontologische Grundlage der menschlichen Erfahrung uns einerseits von der tradierten Überlieferung her gegeben ist und andererseits von uns selbst, d. h. von dem Verstehenden, Interpreten selbst geprägt wird. Anders gesagt bedeutet die Vorurteilsstruktur im Grunde, dass unser Verstehen die geschichtlich bedingte Voraussetzung impliziert. Ebenso weist die Erwartung an die Sinnerfüllung, die von uns selbst erarbeitet wird, die Struktur des Vorverständnisses auf. Mit Blick auf die Vorstruktur des Verstehens ist das Textverstehen beispielsweise auf den vorhandenen Textsinn angewiesen, d. h. der angebotene Textsinn bildet die Rahmenbedingung für das Verstehen, innerhalb dessen das Verstehen des Textes stattfindet. So gesehen stellt der Text uns Fragen, spricht uns an. Mit anderen Worten: Das „Angesprochenwerden“, das vom Text ausgeht, motiviert unser Verstehen, gewissermaßen unsere Fragestellung. Und umgekehrt hängt das Textverstehen von unseren Fragen ab, das auf den Text reagiert. Denn die Fragestellung steht in der Erwartung einer potenziellen Sinnganzheit, die der Text enthalten soll. Es heißt also, auf die Antwort, die vom Text selbst gegeben werden muss, zu warten. Welchen Textsinn wir herausfinden, welche Antwort wir auf unsere Frage bekommen, hängt von der in unserer Frage enthaltenen Sinnrichtung ab. Somit ist die Vorurteilsstruktur im hermeneutischen Verstehen ein vorreflexives Moment des Verstehensprozesses, das von der geschichtlich überlieferten Tradition vorgeformt ist. Somit haben wir gesehen, dass Gadamer die Vorurteile als die Geschichtlichkeit der hermeneutischen Erfahrung, insbesondere als tradierte Bedingtheit unseres Standpunktes, verstanden hat. An dieser Stelle fordert uns die philosophische Hermeneutik52 auf, uns die Zugehörigkeit des Verstehens zur Geschichte, nämlich die Standortgebundenheit unserer Erfahrung mit den tradierten Inhalten zu Bewusstsein zu bringen. Diese Geschichtlichkeit der 52 Zum Unterschied zwischen der hermeneutischen Philosophie und der philosophischen Hermeneutik, vgl. Gunter Scholtz, „Was ist und seit wann gibt es >>hermeneutische Philosophie<<?“, in: Dilthey–Jahrbuch, Bd. 8, hrsg. v. Frithjof Rodi, Göttingen 1993, S. 93 – 119. 197 hermeneutischen Erfahrung wird von Gadamer als „Wirkungsgeschichte“ bezeichnet. Gadamers Ansicht zufolge ist die Wirkungsgeschichte im hermeneutischen Verstehensprozess der Inbegriff aller Möglichkeiten der Sinnerschließung und zwar dergestalt, dass das geschichtlich Überlieferte nicht nur das zu Verstehende, das Fremde als der zu uns distanzierte Gegenstand des Verstehens ist, sondern auch die Gesamtheit der Sinnhorizonte ausbildet, innerhalb derer der potenzielle Sinn stets aufs Neue erschlossen wird und damit zugleich den uns vertrauten umfasst. Deshalb kann man sagen, dass es sich bei Gadamer um ein „Prinzip“ 53 des Verstehens handelt. Der Begriff „Wirkungsgeschichte“ ist bei Gadamer mit der Traditionslinie des philosophischen und literaturwissenschaftlichen Begriffsgebrauchs verknüpft. Gadamers Einblick in die Wirkungsgeschichte beinhaltet dabei nicht nur die traditionelle Überlegung zur Rezeptionsgeschichte der Textinterpretation in der Philosophie, vor allem im Historismus und in der Literaturwissenschaft, sondern er orientiert sich im Grunde auch an der existenziellen Seinsweise des menschlichen Daseins, das sich in seiner Geschichtlichkeit versteht und auslegt. Gadamers Grundeinsicht, die unter dem Einfluss von Heideggers Denken steht, besteht darin, dass wir unsere Seinsmöglichkeiten alle von deren Geschichtlichkeit her bestimmt sehen, anders gesagt, dass wir in der Geschichte stehen und leben und uns selbst und die Sache nur in Bezug auf die Geschichte verstehen. Aus diesem Grund wehrt sich Gadamer gegen die traditionellen Auffassungen der Rezeptionsgeschichte, da diese trotz der Anerkennung der geschichtlichen Kontextabhängigkeit der Interpretationen auf die restaurative Rekonstruktion des ursprünglichen Sinnes des Originalwerkes abzielen. 54 Die Wirkungsgeschichte in Gadamers philosophischer Hermeneutik ist nicht die Rückbesinnung auf den ursprünglichen Sinn des Werkes, sondern schließt vielmehr den Sinnentwurfshorizont, der die Sinnpotenzialität in jedem bestimmten Horizont immer wieder aufs neue eröffnet, mit ein. Gadamers Überlegung, dass der Verstehende als geschichtliches Wesen der unentrinnbaren Einwirkung der geschichtlichen Überlieferung ausgeliefert ist, liefert uns den Hinweis, dass unser gegenwärtiger Sinnhorizont mit dem bewussten Verstehen über den vergangenen Sinnhorizont und den zweckorientierenden, entwerfenden Zukunftshorizont zusammenfallen. Damit wird deutlich, dass das hermeneutische Verstehen seinen eigenen Sinnraum im Wirkungszusammenhang zwischen den betroffenen Polen der sich selbst erschließenden Vergangenheit und der sich selbst entwerfenden Zukunft, vom uns Vertrauten 53 Hier dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Gadamer damit nicht von einem deduktiven Prinzip sprechen will, sondern er denkt, wenn ich ihn richtig verstehe, an ein ontologisches Prinzip, das wir für die Erfahrung unvermeidbar annehmen müssen und können. 54 Vgl. Karl Robert Mandelkow, „Probleme der Wirkungsgeschichte“, in: Jahrbuch für Internationale Germanistik, Bd. II/ 1, hrsg. v. Hans–Gert Roloff, Frankfurt a. M. 1970, S. 71 – 84. 198 und uns Fremden, aufspürt. Somit kann man sagen, dass Gadamers Einsicht in die Geschichtlichkeit der hermeneutischen Erfahrung von ihrem Ansatz her aus Heideggers Grundgedanke der existenziellen Zeitlichkeit als menschlicher Seinsweise – in Heideggers Grundformel, dass das menschliche Dasein „da in seiner Jeweiligkeit“55 sei – beeinflusst ist. Aber Heidegger legt mit dieser Formel, der des zeitlichen „Da–Sein[s]“, seinen Schwerpunkt auf die fundamentalontologische Daseinsanalytik. Das Verstehen als die grundsätzliche Seinsweise des menschlichen Daseins wird bei Heidegger von der bewussten Endlichkeit her gedacht. Somit beruht diese bewusste Endlichkeit in Heideggers Fundamentalontologie auf der Gewissheit des Todes. Bei Heidegger bezieht das Verstehen seine Möglichkeiten aus der bewussten Gewissheit vom „Sein zum Tode“ immer aufs neue. Gadamer hingegen distanziert sich von Heideggers „radikaler Daseinsanalytik“, die man mit Bezug auf den frühen Heidegger als „Existenzhermeneutik“ bezeichnen kann. Seinem eigenen Denkansatz zur Hermeneutik gemäß führt Gadamer die philosophische Hermeneutik nicht auf Heideggers Denkweise zurück, sondern entwickelt seine Hermeneutik mit der Frage nach der traditionellen Konzeption der Hermeneutik in der philosophischen Denkgeschichte weiter. Von dieser intensiven Beschäftigung aus entdeckt er die hermeneutische Idee der Textinterpretation in der Verstehensstruktur des lebensweltlichen Erfahrungsraums wieder. Somit sieht Gadamer über Heideggers Gedanken vom „Sein zum Tode“ hinaus die Einbezogenheit des Verstehenden in die sinnverwobenen Sinngefüge der alltäglichen Lebenswelt, die einerseits immer durch den Verstehenden ihren Sinn gewinnen und dem Verstehenden ihren Sinn stets aufs neue verleihen. Gadamer spricht deshalb vom „Sein zum Text“, eine Formulierung, die ursprünglich von Odo Marquard stammt. 56 Somit kann die Behauptung gewagt werden, dass Gadamers Hermeneutik eine „Hermeneutik des Faktischen“ sei, da sie ihren Blick nicht nur auf die Textinterpretation, sondern auch auf die lebendige Gegenwärtigkeit der alltäglichen Lebenswelt richtet, während sich Heideggers Hermeneutik ständig an der Suche nach dem „Faktum der Hermeneutik“ orientiert.57 An dieser Stelle sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass Gadamer zunächst von dem Einwand gegen die neuzeitliche Subjektivität ausgegangen war. Damit hatte er dem lebendigen Sein den Vorrang gegenüber den reflexiven Urteilen verliehen. Die Geschichtlichkeit setzte er allen reflexiven Urteilsakten voraus, so dass er von hier aus 55 M. Heidegger, Hermeneutik der Faktizität, S. 48. Vgl. Odo Marquard, „Frage nach der Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort ist“, in: ders., Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 2000, S. 117 – 146, hier bes. S. 130 und in einem Gespräch mit J. Grondin, Hans– Georg Gadamer, „Dialogischer Rückblick auf das Gesammelte Werk und dessen Wirkungsgeschichte“ (1996), in: Gadamer Lesebuch, hrsg. v. J. Grondin, Tübingen 1997, S. 282. 57 G. Figal, „Gadamer im Kontext“, S. 148. 56 199 schließlich die Verstehensstruktur als einen Grundmodus der menschlichen Seinsweise nicht auf die fundamentalontologische Daseinsanalytik zurückführte, - wie Heidegger das „Sein zum Tode“ aufgefasst hatte -, sondern auf die alltägliche Lebendigkeit des lebendigen Seins. Aus diesen Überlegungen folgt, dass die Geschichte, die überlieferte Tradition, bei Gadamer ein dem Urteilen vorausgehendes Allumfassendes ist, auf dessen Basis wir es später mit dem Reflexionsakt zu tun bekommen. Die Wirkungsgeschichte selbst überragt deshalb das subjektive Bewusstsein und die von der Reflexion ermöglichte Gewissheit. Kurzum wird gezeigt, dass sie den gesamten Verstehensvorgang leitet. Nun bildet die Geschichtlichkeit des hermeneutischen Verstehens den interaktiven Ort, an dem sich alle Verstehenshorizonte begegnen, vermitteln und einander annähern, da wir uns selbst als Verstehende in diesen geschichtlichen Überlieferungen befinden und darin leben. Dementsprechend formuliert Gadamer seine Einsicht in die Geschichtlichkeit der hermeneutischen Erfahrung, die immer schon im Wirkungszusammenhang mit der tradierten Überlieferung steht, wie folgt: „Das Verstehen ist selber nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, sondern als Einrücken in ein Überlieferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig vermitteln. Das ist es, was in der hermeneutischen Theorie zur Geltung kommen muß, die viel zu sehr von der Idee eines Verfahrens, einer Methode, beherrscht ist.“ (GW. 1, S. 295) Wer versteht, ist aus hermeneutischer Sicht bereits in die Überlieferung involviert, in der über die zeitliche Grenze hinaus Sinn immer wieder neu gestiftet und gestaltet wird. Dieses Eingerücktsein des Verstehenden ins Sinngeschehen prägt von nun an den geschichtlich– kulturellen Hintergrund, an dem wir, ob wir wollen oder nicht, immer schon beteiligt sind. Infolgedessen ermöglicht erst die ontologische Teilnahmestruktur, Gadamers Ansicht zufolge, das Verstehen des Anderen und die soziale Verständigung über den Anderen und uns selbst. Betrachtet man die Grundphänomene des hermeneutischen Verstehens aus dem Blickwinkel der kulturellen Erfahrung, so ist die Kultur, der alle symbolisierten Werke der Menschheit, also Kunstwerke, Kulte, Institutionen usw. zugeordnet werden, ein Ausdruck des menschlichen Grundbedürfnisses, die inneren Schichten ins Äußere und die innere Stimme ins äußerliche Symbolsystem zu übertragen. Wenn die Kultur selbst aus diesem ursprünglichen Bedürfnis des Menschseins nach Lebensäußerung entstanden ist, können wir uns vermutlich auf der grundsätzlichen, deshalb gemeinsamen kulturellen Basis über die anderen (doppelseitig das andere und den anderen) und über uns selbst verständigen. So gesehen führt die Kultur als der gemeinsame Boden für den Verstehensvorgang uns in ein interaktives Netzwerk, nämlich in die Beziehung, die von uns selbst aus entwickelt wird und uns zueinander verhalten und miteinander verständigen lässt. Wenn das Verstehen überdies in 200 dem Geflecht zwischen dem Verstehenden und dem zu Verstehenden, dem uns vertrauten und dem uns fremden Kulturkreis, nicht nur den Spielraum der Verstehensmöglichkeit der fremden Kultur, sondern auch den der Verstehensmöglichkeit der eigenen Kultur etabliert,58 ist für das hermeneutische Verstehen, mit Gadamers Worten, „das Ineinanderspiel der Bewegung der Überlieferung und der Bewegung des Interpreten“ charakteristisch. (GW. 1, S. 298) Denn die Grundstruktur des Mitspiels hat hier zwischen der Vertrautheit und der Fremdheit, der Eigenheit und der Andersheit bereits eine Brücke geschlagen. Im von der unentrinnbaren Betroffenheit vorgegebenen Wechselspielraum der eigenen und fremden Geschichtlichkeit setzt das hermeneutische Verstehen seinen eigenen Prozess in Gang, in dessen Verlauf es sich selbst verändert und modifiziert. Damit könnte man sagen, dass Gadamers Hermeneutik „eine Hermeneutik wirkungsgeschichtlichen Geschehens“59 sei. Aus Gadamers Sicht sieht jeder Verstehensvorgang deshalb seinen Sinnvollzug stets nur aus der Perspektive seiner eigenen Eingebundenheit ins geschichtliche Sinngeschehen, in dessen Zeitperspektive das Vergangene nur für den gegenwärtigen Standpunkt vergangen ist, d. h. die Vergangenheit aus der Perspektive der Gegenwart als das Vergangene gilt. Deshalb gibt es keine elementar reine Vergangenheit, sondern die Vergangenheit kann das Vergangene nur in der Hinsicht sein, dass dasjenige, was vorübergegangen ist, in den Gegenwartshorizont einrückt und von diesem aus bestimmt wird. Und umgekehrt muss man sehen, dass es keine Gegenwart gibt, die nicht unter dem Wirkungszusammenhang der Vergangenheit steht. Die Gegenwart entfaltet ihren Horizont nur in Bezug auf die Vergangenheit, d. h. dass in dieser Horizontbildung der Vergangenheitsbezug eine konstitutive Rolle spielt. Indem das Verstehen, wie bereits erwähnt, ins miteinander verwobene Sinnnetzwerk von Gegenwart und Vergangenheit, von Vertrautheit und Fremdheit, eingezeichnet ist, ist die tradierte Überlieferung, so Gadamer, „Sprache, d. h. sie spricht von sich aus so wie ein Du.“ (GW. 1, S. 364) Hiermit nimmt die sprachliche Überlieferung ihren Platz als unser permanenter Gesprächspartner ein, der von uns nicht verobjektiviert werden kann, obwohl er uns im 58 Zum Problem des Verstehens und der Erfahrung der fremden Kulturen aus der ethnologischen Perspektive: Selbst wenn die fremden Kulturen nicht unmittelbar ineinander übersetzbar sind, so sind sie doch verstehbar, zumindest vergleichbar. Denn das gegenwärtige Betroffensein erhebt nicht nur den Anspruch auf das Verstehen, sondern eröffnet auch den nötigen Raum für den Verstehensakt. Das Verstehen zwischen den Kulturen steht in dieser ontologischen Rahmenbedingung der Verstehbarkeit. Vgl. Wolfdietrich SchmiedKowarzik, „Das Verstehen fremder Kulturen – zu einem Grundbegriff der Ethnologie als Kulturwissenschaft“, in: Kultur – Philosophische Spurensuche, hrsg. v. Gerhard Schweppenhäuser, u. Jörg H. Gleiter, Weimar 2000, S. 62 – 80. Ihm zufolge soll die Anerkennung der subjektiven Autorität der fremden Kultur zuallererst jedem Versuch zum Verstehen des Fremden vorausgesetzt werden. Deswegen geht es „der Ethnologie gerade nicht um ein Verfügbarmachen fremder Völker durch ein objektivierendes, instrumentelles Wissen von ihnen, sondern um ein Verstehen ihrer kulturellen Lebens– und Sinnzusammenhänge aus ihrer je eigenen Perspektive heraus.“ (S. 63) 59 G. Figal, Der Sinn des Verstehens, S. 22. 201 Dialog gegenübersteht, also Abstand zu uns hat. So gesehen besteht das Verstehen aus dem Dialog, in dem der Verstehende und das zu Verstehende von vornherein voneinander Distanz halten und dennoch nie gänzlich voneinander entfernt sind: Das hermeneutische Verstehen befindet sich immer schon in einem dialogischen Zwischenraum, in dem beide Beteiligte keinesfalls ein und dasselbe sind. Diesbezüglich sagt Gadamer: „Sie (= die Aufgabe der Hermeneutik, KBL) spielt zwischen Fremdheit und Vertrautheit, die die Überlieferung für uns hat, zwischen der historisch gemeinten, abständigen Gegenständlichkeit und der Zugehörigkeit zu einer Tradition. In diesem Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneutik.“ (GW. 1, S. 300) Hier sieht Gadamer, dass der interaktive Zwischenraum, in dem sich alle Beteiligten zueinander verhalten und miteinander spielen, nicht in die „destruktive Abgründigkeit“ geraten ist, wie Heidegger die Ontologietradition radikal zu zerstören versuchte, sondern durch die ontogenetische Erfahrungsgeschichte, die mit Hegels Dialektik eng verbunden oder genauer gesagt, für die „die negative Bestimmtheit“ in der Erfahrungsgeschichte des Bewusstseins bei Hegel charakteristisch ist, die basale Gemeinsamkeit etabliert. 60 Demzufolge müssen wir darauf achten, dass der miteinander verschränkte Spielraum, Gadamers Ansicht zufolge, nicht nur die Voraussetzung für die hermeneutische Erfahrung, sondern auch ein offener Ort des Dialogs ist, an dem die Gemeinsamkeit gewonnen werden kann und an dem das menschliche Zusammenleben überhaupt möglich ist. Das Sinngeschehen in den geschichtlich tradierten Wirkungszusammenhängen hat den umfassenden Sinnhorizont, in dem die Traditionslinien den diachronisch diskontinuierlichen Bruch ertragen, der zugleich den kontinuierlichen Bezugspunkt bildet. Auf diese Art und Weise der Kontinuität taucht das Neue diskontinuierlich auf. Das Überlieferungsgeschehen ist deshalb ein Sprung des Bedingten ins unendlich Übergreifende, den das Bewusstsein von unserer endlichen Bedingtheit, nämlich unserer Unentrinnbarkeit, aus der über uns selbst hinausragenden Überlieferung vollzieht. In Gadamers Hermeneutik ist dieses Bewusstsein das „wirkungsgeschichtliche Bewußtsein“, das eine doppelte Bedeutung hat: Es ist einerseits das Bewusstsein von der geschichtlichen Bedingtheit, die von den kontinuierlichen Überlieferungen geprägt ist. Andererseits ist es aber auch das Bewusstsein davon, dass es mit diesem bedingten Bewusstsein zu tun hat. Es ist sich seiner Verankerung in der Tradition bewusst und als solches das retrospektiv innewerdende Bewusstsein von diesem verankerten Bewusstsein. Mit anderen Worten: Das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein ist das Bewusstsein von der eigenen Begrenztheit, d. h. den subjektsphilosophischen Reflexionsakt 60 Zur Differenz zwischen Heideggers und Gadamers Ontologie, vgl. R. Wiehl, „Heidegger, Gadamer und die Möglichkeit einer Ontologie heute“, in: ders., Metaphysik und Erfahrung, Frankfurt a. M. 1996, S. 127 – 154. 202 umfassend und damit auch das Bewusstsein, das in dem prozessualen Verstehensvorgang diese bedingte Verankerung bewusst zu machen und zu erklären versucht. Aus diesem Grund wird in der philosophischen Hermeneutik gezeigt, dass das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, mit Gadamers Worten, „das im Gang der Geschichte erwirkte und durch die Geschichte bestimmte Bewußtsein“ und „ein Bewußtsein dieses Erwirkt– und Bestimmtseins selber“ sei. (GW. 2. S. 444) Insofern weiß das Bewusstsein der allgemeinen hermeneutischen Situation von vornherein, dass wir immer schon in die sinntragende Lebenswelt hineingeworfen und hineingewachsen sind und die Lebenswelt auch von unseren Sinnentwürfen konstitutiv zu erschließen ist. Es ist das Bewusstsein vom existenziellen Einbezogensein des menschlichen Daseins in die lebendige Sinnwelt und von der engen Bezogenheit dieser Sinnwelt auf unsere produktiv sinnstiftenden Entwürfe, da die menschliche Verstehenspraxis selbst, Gadamers Ansicht zufolge, immer schon in der Hinund Herbewegung zwischen der passiven Bedingtheit und dem aktiven Entwurf steht. Sofern die Denkreflexion überdies nach der vollständigen Aneignung des Anderen, des Gegenstandes sucht, ist jeder Reflexionsakt selbst auch eine Zerstörung der Züge jeder Einzigartigkeit, d. h. eine Vernichtung aller vorreflexiven und vorwissenschaftlichen Erfahrungen zwischen den Menschen, da die subjektive Reflexion im neuzeitlichen Denkmodell die sich um ihre eigene Achse drehende Bewegung des denkenden Ego durchlaufen und auf diesem Weg alle von ihm sich Unterscheidenden vollständig in sich aufnehmen muss. Von daher kann man sagen, dass der reflexionsphilosophische Gedankengang der vollständigen Ausschließung des Eigenrechts der unaufhebbaren Andersheit dem unendlichen Erfahrungsraum entstammt. Die hermeneutische Verstehenspraxis geht demgegenüber bei Gadamer den offenen Weg von den Differenzen über die Anerkennung des Differenten zur sachgemäßen Gemeinsamkeit. Hier meint Gemeinsamkeit weder die vollendete Abgeschlossenheit noch die verschlossene Absolutheit, sondern zeigt sich im gemeinsam etablierten Einverständnis, in dem die Andersheit nicht vollständig angeeignet wird. Sie ist nicht nur die Übereinstimmung mit dem Anderen, der immer noch die Eigenheit in seiner Andersheit behält, sondern sie ist ebenso sehr ein prinzipiell unabschließbares Unterwegssein zu sich selbst, in Hegels Worten, das Selbst im „Anderssein.“ Der Verstehensprozess, der zum Einverständnis im vorliegenden Sachverhalt gelangen soll, richtet sich deshalb bereits auf das „Sich–Verstehen“ in den geschichtlichen Lebensbezügen, sozusagen das Wiederfinden des Eigenen im Anderen und die Wiedererinnerung der verhüllten Andersheit im Eigenen. Nun wird deutlich, dass das „Sich– Verstehen“ des hermeneutischen Bewusstseins immer schon auf der Anerkennung der nie 203 völlig auflösbaren Fremdheit beruht. Aus Gadamers Sicht auf die Struktur des hermeneutischen Selbstverständnisses, fungiert das Bewusstsein nicht als Endpunkt, sondern als ein „Moment des Vollzugs des Verstehens“ im gesamten Verstehensprozess, da es selbst nur „Bewußtsein der hermeneutischen Situation“ ist, die immer schon unter dem Einfluss der unauflösbaren Fremdheit steht und sich damit auf die nicht abschließbare Auseinandersetzung mit der Fremdheit einlässt. (GW. 1, S. 306 u. S. 307) Da das hermeneutische Bewusstsein von vornherein auf eine bestimmte Situation, die sich stetig ändert, bezogen ist, vollzieht es sich nicht mit der monologischen Verschlossenheit, die der logisch beweisbaren Schlussfolgerung nachgeht, sondern von vornherein mit dem Einverständnis, das durch die Anerkennung seiner eigenen Endlichkeit erschlossen wird. Insofern bleibt die überlieferte Geschichte als ein über die zeitlich–räumlichen Grenzen hinausweisender Sinnhorizont, der mögliche Sinngefüge stets in sich birgt, dem hermeneutischen Bewusstsein gegenüber unendlich wirksam. Das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein befindet sich daher in der oszillierenden Hin– und Herbewegung, in der sich der Vollzug des Sinnes realisiert. Aus hermeneutischer Sicht bedarf das Bewusstsein keineswegs der absoluten Ablösung von seiner Oszilliertheit in der unendlichen Suche nach dem Sinnvollzug. Und umgekehrt muss das hermeneutische Bewusstsein sich zuallererst auf die oszillierende Sinnbewegung einlassen, damit es sich den Sinngehalt, den die Welt ihr verliehen hat, erarbeiten kann. In Gadamers Hermeneutik wird deshalb gezeigt, dass das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein „mehr Sein als Bewußtsein“ ist. (GW. 2, S. 496) In dieser Wortwendung liegt Gadamers Betonung, wie wir bereits sahen, auf dem Seinsvorrang der ontologischen Erfahrung vor dem reflexiv urteilenden Bewusstsein. Im Anschluss an Gadamers Einblick in den Seinsvorrang vor dem reflexiven Urteil innerhalb des gesamten Sinnbewegungsrahmens, möchte ich zunächst auf das „Geschehen“ im hermeneutischen Verstehen, noch präziser gesagt, auf das Sinngeschehen, den Ereignischarakter der hermeneutischen Wahrheit eingehen. Das Sinngeschehen im hermeneutischen Verstehen erscheint als ein Ereignis im Laufe der Erfahrungsgeschichte, das insbesondere in der Spielstruktur und im Dialog sichtbar gemacht werden kann. Dass der Sinn geschieht, bedeutet aus hermeneutischer Sicht, dass sich dieses Geschehen grundsätzlich im unaufhörlichen Spannungsverhältnis von Vertrautheit und Fremdheit befindet, dass das, was sich hier und jetzt ereignet, über eine Beteiligungsstruktur an diesem Spannungsverhältnis verfügt, da die Fremdheit im Spannungsfeld des Verstehensvorgangs in die Vertrautheit einbricht und auf sie einwirkt. Gadamers Einsicht in den Ereignischarakter des menschlichen Verstehens besteht somit darin, dass sich der Sinn aus der ontologischen Begegnung mit demjenigen, was da draußen steht und was da ist, bildet, d. h. dass der Sinn aus der 204 horizontalen Betroffenheit unter den vertikalen Wirkungseinflüssen des Überlieferten zustande kommt. Mit dieser Einsicht will Gadamer nicht nur das naive Subjektivitätsideal entschärfen, ja entmachten, sondern in Anlehnung an Platon stellt er auch die „Teilhabe“– Struktur in der menschlichen Erfahrung in den Vordergrund. Denn das Verstehen findet, Gadamers Ansicht zufolge, in der Teilhabe am Wahrheitsgeschehen, nämlich am Überlieferungsgeschehen zwischen dem tradierten Sinn und dem Interpreten statt. Da der Ereignischarakter bei Gadamer überdies auf das synchrone Sinngeschehen unter den diachronen Einwirkungen, d. h. auf ein Zusammenspiel hinweist, erschließt sich das Geschehen im synchronen Sinnfeld den Sinn immer wieder neu und anders. Mit anderen Worten: Das Sinngeschehen stellt seinen Horizont im Spiel von Sinnverborgenheit und Sinnerschließung immer wieder neu her, wie ein Blitz in tief dunkler Nacht, der „mit einem Schlag“ das Ganze offenbart, um plötzlich alles wieder in tiefe Dunkelheit zurückfallen zu lassen. 61 (GW. 8, S. 277) Am Fallbeispiel der Erfahrung der Kunst gibt Gadamer das folgende zu verstehen: „Alle Begegnung mit der Sprache der Kunst ist Begegnung mit einem unabgeschlossenen Geschehen und selbst ein Teil dieses Geschehens.“ (GW. 1, S. 105) Die Kunsterfahrung und der Dialog, den wir später betrachten werden, führen uns, Gadamers Ansicht zufolge, zur Erschütterung der naiven Illusion und der banalen Befangenheit, da die Tradition in der hermeneutischen Erfahrung ins Gespräch einbricht. Die Kunsterfahrung und der Dialog bilden deshalb den Wendepunkt zur „Sache selbst“. Aus der Perspektive der Kunsterfahrung betrachtet, hat das Bild als Kunstwerk eine doppelte Seinsweise: Einerseits ist es das Bild von einer Sache, nämlich das Abbild vom Urbild, d. h. hier muss das Bild auf die abgebildete Sache, das Modell verweisen. Damit hat das Bild einen Bezugspunkt zum Wirklichen. Andererseits ist das Bild immer auch für den Zuschauer bestimmt, da es durch die Betrachtung des Zuschauers seine eigene „Seinsvalenz“ gewinnt und der Zuschauer im Moment des Betrachtens, d. h. seiner 61 Im Anschluss an die berühmte Metapher von Aristoteles „Flucht des Heers“ im Schlachtfeld erkennt Gadamer den Grundcharakter der menschlichen Erfahrung. Die menschliche Erfahrung ist, wie er sagt, „das Zustandekommen der Erfahrung als Geschehen“, wie das Heer im Schlachtfeld flieht und plötzlich zum Stillstand kommt. Hier ist die Erfahrung undurchsichtig und unvorhersehbar, ähnlich wie das fliehende Heer während der Flucht kein einheitliches Kommando bekommt. Doch so wie die fliehenden Heere mit einem Haltmachen unter den vielen Fliehenden oder mit dem plötzlichen Befehl des Kommandos völlig zum Stillstand kommen, wird die menschliche Erfahrung, Gadamers Ansicht zufolge, ohne ein fundamental begründetes Prinzip durch ein punktuelles Geschehen erworben. Somit wird deutlich, dass der Stillstand selbst das Prinzip der Erfahrung ist, das nicht voraus bestimmt ist, uns aber denoch im Nu zum umsichtigen Verständnis führt. (GW 1, S. 357 – 358) Aristoteles schreibt: „Oder wohl auf beide Arten zugleich, wie dies bei dem Heer der Fall ist; denn für dieses liegt das Gute sowohl in der Ordnung als auch im Feldherrn, und mehr noch in diesem. Nicht er ist nämlich durch die Ordnung, sondern die Ordnung durch ihn. […] In solcher Art nämlich ist die Natur eines jeden von ihnen Prinzip; ich meine, alle müssen zur Aussonderung kommen. Ebenso verhält es sich mit anderen Dingen, die alle gemeinsam verbunden zum Ganzen beitragen.“ Aristoteles, Metaphysik, Kap. 10, XII. Buch, 1075a. 205 Einbeziehung ins Bild, zudem sich selbst begegnet. Das bedeutet: Der Maler befindet sich im gesamten Schaffensprozess in Beziehung zu seinem Gegenstand, kehrt also mit jedem Pinselstrich immer zum Gegenstand retrospektiv zurück. Damit reflektiert er im gesamten Schaffensprozess kontinuierlich den Kontrast zwischen Darstellendem und dem Dargestellten. Beim Betrachten kann der Zuschauer auch diesen zurückkehrenden Pinselstrich, den wir hier als den unermüdlichen Versuch des Malers zur reflexiven Annäherung an die Sache selbst bezeichnen können, nachvollziehen. Durch die funktionelle Vermittlung des Bildes nähert er sich dem jeweils vorgegebenen Sachverhalt und damit zugleich sich selbst an. 62 So gesehen bildet das Sinngeschehen einen „dreieinheitlichen“ Sinnhorizont, in dem das Darstellende geradezu dem Dargestellten angehört und der Zuschauer durch die Vermittlung des Darstellenden ins Dargestellte eingebunden wird. Im Hinblick auf diesen dreieinheitlichen Sinnhorizont spricht Gadamer von der „Verwandlung ins Gebilde“, da das Kunstwerk nicht nur über die unmittelbare Korrespondenz hinweg „in die Welt hineingehört“, d. h. sich selbst verändert, sondern auch den Zuschauer in seinen Bann schlägt. (GW. 1, S. 116 u. S. 121) Gadamers Ansicht zufolge vollzieht sich das hermeneutische Verstehen im „Verweilen“ bei dem Sinngeschehen: Der einheitliche Sinnhorizont der Bestandteile, die sich ihrerseits voneinander differenzieren und daher sich immer zu sich selbst zu verhalten versuchen, ergibt sich im Augenblick der selbstvergessenen Faszination oder, mit Gadamers Worten, mit dem „Dabeisein“, ja der „Anwesenheit“ des Zuschauers. (GW. 1, S. 129) In dem Augenblick, der in das Sinngeschehen verwoben ist, vergisst der Zuschauer gleichermaßen sich selbst und sein Zeitbewusstsein. Die Plötzlichkeit des Sinngeschehens im hermeneutischen Verstehensprozess kann als „Gleichzeitigkeit“, die bei Gadamer als zeitliches ZugleichBestehen verstanden wird, bezeichnet werden. Da das Sinngeschehen nicht mit der simultanen Restitution, sondern mit der gleichzeitigen Teilhabe zustande kommt, ist die Teilhabe des Verstehenden am Sinngeschehen, Gadamers Ansicht zufolge, weder die „Selbsteinfühlung“ in 62 An dieser Stelle möchte ich auf den nicht–sprachlichen Gegenstand der Hermeneutik nicht weiter eingehen. Aber wenn wir der Frage, warum Gadamers GW 8 als „Kunst als Aussage“ betitelt wird, unsere Aufmerksamkeit zuwenden, dürfen wir uns andeutungsweise mit dem Verstehen des nicht–sprachlichen Gegenstandes, ja der musikalischen Interpretation und dem anschauenden Verstehen des Bildes beschäftigen. Beim selbstvergessenen Zuhören eines musikalisches Meisterwerkes und auch beim selbstvergessenen Betrachten eines gemalten Bildes ist der Versuch zur interpretierenden Wortfindung in manchmal überflüssig, weil uns das Wunder aller Bewunderungen beherrscht. Gleichwohl können wir, der hermeneutischen Sicht zufolge, die Musik und das Bild als eine Antwort auf die Frage verstehen, wenn wir das uns ansprechende Wort der Kunst heraushören können. Hier geht es deshalb um das Zuhören der innerlichen und auch vielfältigen Stimmen. Damit übersetzt sich der nicht–sprachliche Gegenstand in einen sprachlich erschließenden Sinnhorizont. So gesehen liegt auf der Hand, dass das Bild bzw. die Musik auch ein Interpretationsgegenstand ist, sofern sie immer interpretationsbedürftig sind und auch interpretiert werden müssen. In diesem Sinn wird der nicht–sprachliche Interpretationsgegenstand sprachlich übersetzt. Zur Bildinterpretation unter Gadamers hermeneutischem Gesichtspunkt, vgl. G. Boehm, „Zu einer Hermeneutik des Bildes“, in: Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften, S. 444 – 471 und ders., „Die Wiederkehr der Bilder“, in: ders., Was ist Bild?, 2. Aufl., München 1995, S. 11 – 38. 206 den Autorenhorizont noch das „Sichhineinversetzen“ in die innere Seele des Autors, 63 sondern das „Sich–Versetzen“ der Vertrautheit in die Fremdheit und der Fremdheit in die Vertrautheit. Hier meint das Sich-Versetzen weder die vollkommene Aneignung der Fremdheit noch die Selbstübertragung in den Fremdhorizont ohne den eigenen vertrauten Horizont, sondern einen ineinander übergehenden Weg zu dem Fremden aus der eigenen Position und zu sich selbst aus der Entdeckung der Fremdheit. Die Teilhabe am Sinngeschehen skizziert bei Gadamer deshalb eine dialektische Bewegung, in der sich das Eigene mit der Bewahrung seiner Eigenheit in die Fremdheit versetzt und das Fremde ohne Zerstörung der Züge seiner Fremdheit in die Eigenheit versetzt. Infolgedessen stellen wir fest, dass die Teilhabe am Sinngeschehen den wechselseitig wirkenden Übergang zum Anderen und zu sich selbst bewirkt. Aus diesem Grund sagt Gadamer: „Versetzt man sich z. B. in die Lage eines anderen Menschen, dann wird man ihn verstehen, d. h. sich der Andersheit, ja der unauflöslichen Individualität des Anderen gerade dadurch bewußt werden, daß man sich in seine Lage versetzt.“ (GW. 1, S. 310) Daran anschließend müssen wir unser Augenmerk auf die Frage richten, was die Sache selbst bei Gadamer ist, da sich das Verstehen an der Sachangemessenheit misst, d. h. der Maßstab des angemessenen oder unangemessenen Verstehens im Verstehensprozess der Sache selbst zukommt. Die Sache selbst meint bei Gadamer nicht die schon vorgegebene oder immer bei sich selbst bleibende Substanz, die sich jenseits unserer Erfahrung befindet, sondern die sich bewegende Sache, die sich uns darstellt und sich unter den geschichtlichen Zusammenhängen wandelt. Dass das Verstehen im Zusammenspiel seiner Bestandteile auf die Sache selbst kommt, dass es in diesem Bildungsprozess die Wahrnehmung einer sachgemäßen Wahrheit sucht, könnte man als Telos ohne Endzweck, mit Gadamers Worten, als „eine unbewußte Teleologie“ in der hermeneutischen Erfahrung bezeichnen oder die „zweckfreie Vernünftigkeit im menschlichen Spiel.“ (GW. 2, S. 129 u. GW. 8, S. 114) So geschieht das sachgemäße Verstehen im konstruktiven Wechselverhältnis zur eigenen Dynamik der Sache selbst. Damit wird die Sache selbst, die „Tatsache“, die, Gadamer zufolge, ursprünglich der Begriff der Hermeneutik und daher selbst interpretationsbedürftig war, zum Gegenstand des Verstehens. (GW. 4, S. 47) Anders gesagt, erschließt die Bewegung der Sache selbst um ihrer selbst willen den Spielraum der Möglichkeit der hermeneutischen Erfahrung, so dass die hermeneutische Erfahrung im Wirkungszusammenhang zur Wahrheit der Sache selbst steht. In Anknüpfung an Hegels Denkweise spricht Gadamer deshalb vom 63 Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt, S. 263 – 264. 207 „Tun der Sache selbst“, d. h. die Sache selbst ist in Gadamers Augen nur für uns an sich, 64 sozusagen von uns als an sich gesetzte. (GW. 1, S. 468) Damit meint er keinen „subjektlosen Subjektivismus“. Mit anderen Worten: Gadamers philosophische Hermeneutik geht nicht von der Geschichte, nämlich der Sachbewegung, wie einige Gadamer–Kritiker den Vorwurf erhoben haben, als einem substanziellen Übersubjekt des Verstehensprozesses aus, das schließlich die subjektive Seite des Verstehensvorgangs aufhebt. 65 Vielmehr meint das Tun der Sache selbst gleichermaßen die prozessuale Selbstenthüllung der Wahrheit wie die subjektive Teilnahme des Verstehenden an diesem Vorgang, da das hermeneutische Verstehen bereits den mitwirkenden Anteil des verstehenden Subjekts anerkennt. Um es am Text zu verdeutlichen: Wenn ein Text an sich zu eindeutig und mit unserer Vorstellung identisch wäre, dann wäre er kein interpretationsbedürftiger Gegenstand, d. h. wir hätten keinen Anlass, diesen Text zu betrachten. Wenn ein Text im anderen Fall seinen Sinngehalt völlig verdeckt und sich unter keinen Umständen selbst darstellt, dann wäre ein Verstehen grundsätzlich ausgeschlossen. Auch dieser Text wäre dann kein Gegenstand der Interpretation. Das Verstehen des Textes, der den Sinn der Sache trägt, ist deshalb nur in einem Zwischenraum möglich, in dem wir uns gegenüber dessen sachlichem Wahrheitsanspruch auf Distanz befinden, der Text also seine Sachwahrheit, seinen Sinn zur Sprache bringt. Dementsprechend zeigt sich die Sache in Gadamers Hermeneutik von vornherein als „die Streitsache“, 66 mit der der ganze Verhandlungsprozess zu tun hat. Dass das Verstehen sich auf die Sache selbst bezieht, bedeutet hier, dass der Verstehende sich auf einen Verstehensprozess einlässt, von dem er einen sachlichen Wahrheitsanspruch, eine Sinnganzheit erwartet. Die subjektive Voreingenommenheit wird im gesamten Prozessverlauf auf jeder Stufe überprüft und korrigiert, da der sachgemäße Sinn sich nicht aus dem äußeren Dritten, sondern aus der Bewegung der Streitsache, noch präziser, aus der dialogischen Teilhabe der Betroffenen an der Sachwahrheit ergibt. Das sachgemäße Verstehen verdankt sich daher nicht nur der Ausarbeitung des angemessenen Sinnentwurfs mit jedem Schritt des 64 Zur Sache selbst in Gadamers Hermeneutik im Anschluss an Hegels Philosophie, vgl. R. Bubner, „Die >>Sache selbst<< in Hegels System“, S. 48 – 60 und Michael Theunissen, „Philosophische Hermeneutik als Phänomenologie der Traditionsaneignung“, in: >>Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache<<. Hommage an Hans–Georg Gadamer, Frankfurt a. M. 2001, S. 61 – 88. 65 Manfred Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 33. Es ist offenkundig, dass Gadamer mit seinem Begriff „Spiel“, „Dialog“, d. h. seiner Einsicht in die Teilhabewahrheit im hermeneutischen Verstehen das neuzeitliche Ideal der Subjektivität durchbricht. Aber wenn er von der Teilhabewahrheit im hermeneutischen Verstehen spricht, verweigert er nicht den Anteil der subjektiven Teilnahme, wenn ich hier mit M. Frank sagen würde, der Individualität im Verstehensvorgang, obwohl Gadamer mehr noch seinen Akzent auf den Charakter des hermeneutischen Sinngeschehens, das uns übertrifft, legt. Wer z. B. tanzt, der muss den musikalischen Rhythmus verfolgen, mit ihm harmonisch Schritt halten. Er darf diesen Rhythmus weder willkürlich wechseln, noch verlieren, sondern er muss sprachlos in ihm beim Tanz verweilen. Gleichwohl sagen wir nichts anderes, als dass der Tänzer tanzt. 66 Gadamers Interview mit J. Grondin, in: Gadamer Lesebuch, S. 285. 208 Verstehensvorgangs, sondern zielt im Grunde auch auf eine Übereinstimmung im Zusammentreffen mit der Wahrheit ab, sozusagen auf die prozessuale Enthüllung der Wahrheit, die aus der Selbstbewegung der Sache selbst erwächst. Um diese Offenbarung des Sinns in der fließenden Bewegung der Sache finden zu können, um den „Ball fangen“ 67 zu können, muss das hermeneutische Bewusstsein immer wach sein. Seine Wachsamkeit, die von der Sache selbst stets angestoßen wird, ist der ununterbrochene Versuch, mit allen Kräften in die Sache einzudringen und aus dem unbewussten Zustand zu erwachen. Wie Gadamer in Bezug auf „Theorie“, „theoria“ erwähnt, ist für diese Wachheit das „Anblicken“ und charakteristisch. 68 „Im–Anblicken–Verweilen“ des hermeneutischen Bewusstseins Von daher müssen wir schließlich darauf achten, dass uns die Wachsamkeit des hermeneutischen Bewusstseins zum Versunkensein in der Sache und damit zugleich zur Wiedererweckung des inneren Selbst führt. Die Annäherung an die Sachangemessenheit, die Teilhabe am Wahrheitsgeschehen veranlasst uns in der philosophischen Hermeneutik dazu, einen Blick auf die prozessuale Bewegtheit der reflexiven Revision des Verstandenen zu werfen. Mit dieser Revision des Verstandenen, die Gadamer „hermeneutische Reflexion“ 69 nennt, geht das sachgemäße Verstehen, d. h. die dialogische Verständigung mit der alltäglichen Verstehenspraxis einher. In deren Verlauf bezieht sich die Reflexion auf das Verstandene und auf den Verstehenden selbst. Die aufgeworfene Frage, die voreingenommene Sinnmotivation durch die fragende Hinwendung auf sich selbst, wird immer wieder erneut in Frage gestellt. Um die Bedeutung dieses Sachverhalts zu klären, will ich zunächst auf Habermas’ Tendenz zur Aufwertung des emanzipatorischen Reflexionsvermögens eingehen, bevor ich meine Aufmerksamkeit Gadamers hermeneutischer Reflexion zuwende. Habermas hat, wie bekannt, aus einer ideologiekritischen Perspektive einen schweren Vorwurf gegen Gadamers Hermeneutik erhoben. Im Hinblick auf die Überbewertung der kritischen Reflexion, die die illusionär gesteuerten Gesellschaftssituationen und die durch die Herrschaftsverhältnisse manipulierende Ideologisierung als durchsichtig entlarven müsste, hat Habermas den Schwerpunkt seiner kritischen Auseinandersetzung mit Gadamer auf dessen angebliche Unterschätzung der emanzipatorischen Reflexionskraft verlagert. So schreibt er: „Gadamer verkennt die Kraft der Reflexion, die sich im Verstehen entfaltet. Sie ist hier nicht 67 Es ist bekannt, dass Gadamer sein opus magnum „Wahrheit und Methode“ mit Rilkes Gedicht beginnt. Zur Interpretation dieses Gedichtes in Bezug auf den gesamten Kontext von Wahrheit und Methode, insbesondere den Sinngeschehenscharakter, vgl. J. Grondin, Einführung zu Gadamer, S. 22 – 30. 68 Hans–Georg Gadamer, Hermeneutische Entwürfe, Tübingen 2000, S. 7. 69 Im Unterschied zu Hegels Begriff, „Reflexion“ haben wir Gadamers Denkansatz zur hermeneutischen Reflexion, die das wechselseitige Spielverhältnis impliziert, betrachtet. Vgl. Kap. V. Resümee vom I. Teil. 209 länger vom Schein einer Absolutheit, die durch Selbstbegründung eingelöst werden müßte, geblendet und macht sich nicht vom Boden des Kontingenten, auf dem sie sich vorfindet, los. Aber indem sie die Genesis der Überlieferung, aus der die Reflexion hervorgeht und auf die sie sich zurückbeugt, durchschaut, wird die Dogmatik der Lebenspraxis erschüttert.“ 70 Mit diesem Einwand will Habermas auch demonstrieren, dass Gadamers Hermeneutik die ideologische Instrumentalisierung der Sprache durch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse übersieht, einen Schritt weiter noch, dass er die Beiträge der Sprache zur Legitimation der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse ignoriert. Deswegen ist die Sprache aus Habermas’ ideologiekritische Sicht „auch ein Medium von Herrschaft und sozialer Macht“ und „auch ideologisch.“ 71 Unter diesem Habermasschen Gesichtspunkt gesehen, blendet die Hermeneutik die Notwendigkeit der Emanzipation von allen ideologischen Barrieren aus, die durch die Einsetzung der kritischen Reflexionskraft erreichbar wäre und kann damit auch die Kommunikationsstörung, die von den herrschenden Gewaltverhältnissen manipuliert wird, nicht erklären. Nach diesem Einwand kommt Habermas’ eigener Anspruch auf die psychoanalytische Hermeneutik: Die ideologisch gesteuerte Gesellschaft ist durch die kritische Reflexion über die vorgegebenen Rahmenbedingungen der Praxis zu erklären. Durch diesen Reflexionsakt soll die emanzipatorische Entlastung vom Unterdruck der gesellschaftlichen Gewalt ermöglicht werden. Aus dieser Perspektive setzt Habermas die „Tiefenhermeneutik“ 72 gegen die philosophische Hermeneutik. Die Tiefenhermeneutik, die ihr exemplarisches gesellschaftlichen Paradigma in Überzeugungen der als Psychoanalyse bloß findet, scheinbaren muss deshalb Konsensus, alle alle Alltagskommunikationen als eine Pseudokommunikation entlarven können. Nur in der konkreten Praxis einer „Metahermeneutik“ 73 können, aus Habermas’ Sicht, die gewaltsam verzerrten Kommunikationssituationen geheilt werden. Damit wäre der Übergang zur zwangsfreien Kommunikation erfüllt. So gesehen richtet sich Habermas’ Intention, die immer noch unter der subjektphilosophischen Denkentwicklungslinie stehen zu bleiben scheint, von vornherein auf die Notwendigkeit des grenzlosen Einsatzes des reflexiven Verdachts auf alle lebensweltlichen Überzeugungen und alle tradierten Verständigungen. Wenn man jedoch mit dem uneingeschränkten Misstrauen gegenüber allem beginnt, dann stellt sich die Frage, wie trotz dieses ursprünglichen Verdachts die Verständigung oder sogar der Konsens zum Ziel der Kommunikation gewählt werden könnte. Um einerseits die gewaltfreie Kommunikation und 70 J. Habermas, „Zu Gadamers >Wahrheit und Methode<“, S. 48 und „Zur Logik der Sozialwissenschaften“, S. 303 (Hervorhebung von mir). 71 Ebd., S. 52ff. und ebd., S. 307ff. 72 Ders., „Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik“, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, S. 147. 73 Ebd., S. 149. 210 andererseits die kommunikative Gemeinsamkeit zu erreichen, soll sich die kritische Reflexion letztendlich auf einen neutralen Richterstuhl, der von allem vorurteilhaft Geschichtlichen entkoppelt sein soll, setzen. Wenn man mit seinem Reflexionsvermögen über alles kritisch negierend hinweggehen will, dann stellt sich die Frage, ob der Reflexionsakt nicht zur abstrakten Leerstelle und zum homogenen Monolog wird, wo er vollendet ist. Daran anschließend gesteht M. Frank Habermas’ Reflexionsideal gegenüber, dass Gadamer, wenn er die Begrenztheit der subjektiven Reflexionskraft einsieht, „recht gegenüber dem Rückfall der kritischen Theorie in einen Idealismus der Reflexion“ 74 hat. An dieser Stelle sollten wir noch der Habermasschen Sprachauffassung unsere Aufmerksamkeit „ideologisch“ sei. schenken, 75 da er so deutlich betont, dass selbst die Sprache Wenn die Ideologiekritik bei Habermas im Vordergrund steht, wird die Sprache m. E. unfreiwillig zum Instrument der Ideologiekritik herabgesetzt: Habermas hat die Sprache noch immer als nützliches Werkzeug für seine Ideologiekritik angesehen. Denn wenn die Ideologiekritik ohne die Sprache nicht ausgeübt werden kann, ist die Sprache hier nichts anderes als ein Instrument zur Aufklärung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und zum Aufbau der zwangsfreien Kommunikationsgesellschaft. Der Instrumentalisierung der Sprache zum Trotz, hat Habermas jedoch die Notwendigkeit der Funktion der Sprache bei der Ausübung seiner Ideologiekritik eingesehen. Im Anschluss an seine Auffassung von der positiven Funktion der Sprache, hat er das rationale Argument von dem ideologisch manipulierenden Argument, ja der Pseudokommunikation im Kommunikationsvorgang unterschieden. Seiner Ansicht nach stützt diese Unterscheidung zwischen dem uns verführenden Argument und dem guten, rationalen Argument, zwischen der Pseudokommunikation und der zwangfreien Kommunikation sich, wie wir gesehen haben, auf die kritische Reflexionskraft. Darin liegt auch die unbemerkte Gefahr, dass die Sprache als Werkzeug in diesem reflexiven Denken mißbraucht wird. Das Argument hingegen muss aus 74 75 M. Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 40 – 41. Sprache hat in der späten Habermasschen Kommunikationstheorie noch einen entscheidenden Wert. Aber wenn er seine Kommunikationshandlungstheorie unter dem Einfluss des transzendentalen Pragmatismus etabliert, geht es auch um die Begründung des Universalgrundsatzes, weil sich die ideale Sprachgemeinschaft bei ihm nur mit dem Einverständnis mit diesem Grundsatzes konkretisieren kann. Trotz seinem lehrreichen Beitrag können wir ihm m. E. die Frage stellen, ob dieser Universalgrundsatz die Voraussetzung für die Kommunikation oder das Ziel der Kommunikation ist. Wenn er zunächst die Voraussetzung wäre, dann sollte sich die Voraussetzung ohne den Begründungsversuch aus der Kommunikationssituation ergeben. Denn die Voraussetzung ist überdies jedem logischen Begründungsversuch vorausgegangen. Wenn er im anderen Falle das Ziel wäre, könnte das Ziel auch ohne die transzendentale Begründung durch die lebendigen Kommunikationsvorgänge erreichbar sein. Denn wenn die Verständigung das Ziel aller Kommunikationsbeteiligten ist, kann sich die kommunikative Verständigung nur mit der anerkannten Annahme der anderen Perspektive und der gegenseitigen Verflechtung vollziehen. Somit ist die Verständigung auch aus der Kommunikationssituation abgeleitet, weil die Situation als solche die Verständigung miteinander verlangt, so lange wir mit dem Anderen kommunizieren und dem Anderen sprachlich etwas mitteilen wollen. Zum Habermas’ U–Satz, vgl. den Exkurs zur Ethos–Ethik in dieser Arbeit. 211 hermeneutischer Sicht vor allen Reflexionsakten zunächst sprachlich mitteilbar sein und den Hörer überzeugen können, wenn es ein gutes Argument ist. So geht die Sprache dieser reflexiven Unterscheidung voraus. Die Möglichkeit dieser Unterscheidung liegt daher noch wesentlicher in der sich mit dem Sachverhalt mitbewegenden Sprache, die wir mit dem wachsamen Bewusstsein verfolgen und nachvollziehen müssen. Von daher können wir sagen, dass die Idee der rationalen Kommunikationsgesellschaft ohne die anstrengende Berücksichtigung der erschließenden Kraft der Sprache, ohne den unendlichen Versuch zum Suchen nach dem zutreffenden Wort mithin nur zu utopisch wäre. Darüber hinaus legt Gadamers Erwiderung auf Habermas’ Intention die These nahe, dass die Reflexion trotz ihrer Macht sämtliche geschichtlich–kulturellen Überzeugungen nicht transparent machen kann, sondern nur im Rahmen ihrer bestimmten Begrenztheit die entstellende Voreingenommenheit überprüfen kann. Selbst die Psychotherapie, die Habermas als einen paradigmatischen Fall der ideologiekritischen Hermeneutik betrachtet hat, bzw. das Verhältnis vom Arzt zum Patienten, orientiert sich, wenn sie auf die Heilung abzielt, an der geheilten Wiedergewinnung der alltäglichen Normalität durch die Beseitigung des pathologischen Zustandes, d. h. an der Wiederherstellung des normalen und gesunden Zustandes dank der Mithilfe des Arztes. Die Rolle des Arztes, des Psychotherapeuten im dialogischen Behandlungsprozess darf nicht in einem äußerlichen Behandlungsverhältnis stehen bleiben, sondern das Verhältnis von Arzt und Patient muss so beschaffen sein, dass der Patient „seine natürliche Fähigkeit wiedergewinnen [kann], mit anderen zu kommunizieren.“ (GW. 2, S. 115) Arzt und Patient müssen mit der Vorstellung vom sozialen Miteinander ins therapeutische Gespräch gehen und sich auf der Basis der sozialen Gemeinsamkeit des Willens zum Verstehen treffen. Aus hermeneutischer Sicht zielt die Therapie mithin nicht auf den Fortschritt zum höheren Zustand durch die sich negierende und sich überwindende Reflexionsbewegung ab, – hier müsste der Arzt für seine Behandlung im Voraus den Maßstab ansetzen –, sondern die dialogische Heilkunst muss eine Grundverständigung über das alltägliche Zusammenleben herbeiführen und deshalb alle Beteiligten in diesem Dialog zum Sich–Verstehen führen. Davon abgesehen bedarf das soziale Zusammenleben aus Gadamers Sicht statt des psychoanalytischen Behandlungsmodells der basalen Gemeinsamkeit, die auf einem gemeinsamen geschichtlich– kulturellen Hintergrund basiert, weswegen Habermas den erkenntnistheoretischen Reflexionsakt des einzelnen Subjekts im Modell der Psychotherapie auf die gesamten gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge übertragen will. 212 Um ein Grundverständnis im gesellschaftlichen Handlungsraum zu erzielen, ja das zwischenmenschliche Zusammenleben überhaupt möglich zu machen, muss die Reflexion, Gadamers Ansicht zufolge, auch den wechselseitigen Übergang von der geschlossenen zur sich neu öffnenden Bildungsdimension, d. h. den unendlichen Weg der „immanenten Kritik“, von der bei Gadamer im Anschluss an Hegel die Rede ist, endlos durchschreiten. Die hermeneutische Reflexion hat daher immer schon die kritische Aufgabe, sich durch den Prozess der Prüfung hindurch der Sachangemessenheit anzunähern. Gadamers Einsicht in die kritische Aufgabe der Hermeneutik ist grundsätzlich auch mit der traditionellen Überlieferungslinie der Hermeneutik verbunden, da nicht nur Schleiermacher die Hermeneutik als Kritik sieht, sondern auch Dilthey die kritische Aufgabe der Hermeneutik betont. So sagt Dilthey: „Mit der Auslegung der auf uns gekommenen Reste ist innerlich und notwendig die Kritik derselben verbunden.“ 76 Gadamer hatte, wie wir sahen, seine kritische Verstehenspraxis einerseits in Bezug auf das „ästhetische Bewusstsein“ angewandt, sozusagen die kritische Demaskierung der Selbsteinsicht des Subjektes und des „absoluten Geistes“, andererseits in Bezug auf das Methodenbewusstsein in der Naturwissenschaft. In ihrer Verstehenspraxis erfährt die hermeneutische Reflexion nicht nur einen Prozess des Scheiterns der vorweggenommenen Sinnentwürfe und der Kristallisierung des vorgegebenen Sinns, sondern sie selbst führt zum Verstehen des eigenen Selbst, das die Distanz zu sich selbst beinhaltet. Denn die hermeneutische Reflexion bettet sich nicht nur in den Prozess der Prüfung von Pro und Kontra, also in die Fragestellung, ob das Urteil in diesem Fall angemessen sei oder nicht, sondern sie richtet sich auch auf die Verständigung über das Andere und den Anderen sowie über sich selbst; eine Verständigung, die stets im Prozess des Sinnvollzugs geschieht. Den Selbstaufbau des kritischen Reflexionsfeldes des hermeneutischen Verstehens betreffend, sagt Gadamer: „Die hermeneutische Reflexion schließt vielmehr ein, daß in allem Verstehen von etwas Anderem oder eines Anderen Selbstkritik vor sich geht.“ (GW. 2, S. 116) Die Verstehenspraxis der hermeneutischen Reflexion entwickelt sich selbst mithin im Zwischenraum von Vertrautheit und Fremdheit, in dem keiner von beiden Priorität hat. Da sich das unauflösliche Spannungsverhältnis in derselben Dimension bewegt, handelt es sich immer um das Verstehen des Fremden aus dem Blick der eigenen Vertrautheit, ohne die Fremdheit aufzuheben. So gesehen führt die Reflexivität der hermeneutischen Erfahrung eine doppelte Verwandlung herbei: Einerseits die der Einsicht in die Sache selbst, andererseits die Selbstverwandlung des Verstehenden. Gadamers Ansicht zufolge ist dieser reflexive Blick auf das Verstandene keine irgendwann 76 Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt, S. 267 – 268. 213 endende Erfahrung, sondern eine unendliche Sinnerschließung des „anders VerstehenKönnens“. Nun könnte man sagen, dass die Unabschließbarkeit des menschlichen Verstehens ein universales Bekenntnis der hermeneutischen Erfahrung ist, mit Gadamers Worten, „daß man anders versteht, wenn man überhaupt versteht.“ (GW. 1, S. 302) Denn die hermeneutische Erfahrung geht von der Anerkennung der menschlichen Endlichkeit und der unaufhebbaren Differenz zwischen dem Eigenen und dem Anderen aus. Sein Hauptwerk hat Gadamer daher mit dem Satz abgeschlossen: „Wir sind als Verstehende in ein Wahrheitsgeschehen einbezogen und kommen gleichsam zu spät, wenn wir wissen wollen, was wir glauben sollen.“ (GW. 1, S. 494) Infolgedessen stellen wir fest, dass die hermeneutische Reflexion es permanent mit einer nie völlig gelösten Aufgabe zu tun hat und deshalb keinesfalls zu einem Abschluss kommt, da sie den geschichtlich–kulturellen Hintergrund als die existenzielle Grundlage des menschlichen Daseins nicht restlos mit der Macht der subjektiven Reflexion auflösen kann. Sofern die Geschichte selbst, zu der sie von vornherein gehört, zu keinem Abschluss kommt, stellt sich ihre Aufgabe als eine unendliche dar. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, ob Gadamers Hermeneutik von dem häufig geäußerten Relativismusvorwurf betroffen ist, wenn das hermeneutische Bewusstsein immer der Geschichtlichkeit seiner Erfahrung innewohnt, der Geschichte als seiner ontologischen Grundlage für seine Erfahrung also niemals entrinnt. Wir hatten gesehen, dass sich Gadamers Hermeneutik durch die Einwände gegen das naturwissenschaftliche Methodenbewusstsein und gegen die subjektive Selbstgewissheit in der Bewusstseinsphilosophie von jedem Absolutismus oder Dogmatismus kritisch distanziert. Aus dieser Perspektive betrachtet Gadamer nicht nur das objektivierende Erkenntnismodell, d. h. den Methodenanspruch im Historismus, sondern auch das Problem des historischen Bewusstseins. Wie jeder andere Philosoph auch, will Gadamer seine eigene Philosophie auf keinen Fall dem Vorwurf des Relativismus aussetzen, sondern er versucht diesen, im Verlauf seines kritischen Argumentationsgangs, kritisch zu überwinden. In Anknüpfung an Gadamers Denken könnte man m. E. sagen, dass das hermeneutische Bewusstsein immer in einem Beziehungsgefüge steht und die Relativität unseres Wissens, sozusagen das eng verbundene Wechselverhältnis von Selbstbezug und Fremdbezug bewusst macht, da das Verstehen aus dem miteinander verschränkten Sinnhorizont genährt wird und von diesem Horizont aus seinen Standpunkt bildet. So gesehen geht Gadamers Hermeneutik von der unverzichtbaren Annahme der Möglichkeit des Wahrheitswissens in diesem Beziehungsgeflecht aus. Daher befindet sie sich weder im Beweiszwang unter der Ägide des übergeschichtlich 214 allgemeingültigen Wahrheitskriteriums, noch in einem absoluten Skeptizismus, der die Möglichkeit des Wahrheitswissens grundsätzlich aufgibt. Sie lehrt uns vielmehr, dass unser Verstehen auf dem offenen Weg von der Vormeinung über deren Korrektur hin zum Umdenken in einem Zwischenraum des Sinnverkehrs steht, in dem sich das Wahrheitsgeschehen abspielt. Denn die Wahrheit stellt sich nur im Vollzug des Verstehensvorganges, d. h. der Erhellung, der Überprüfung, der Korrektur und der Neuschaffung des Sinnes her. Dennoch folgt Gadamers Hermeneutik keineswegs dem Grundsatz des Relativismus, wonach alles nur relative Wahrheit sei, sondern sie weist darauf hin, dass das Verstehen in der reflexiven Prüfung des schon Verstandenen unter dessen bedingter Situiertheit stattfindet und dass es deshalb kein Verstehen ohne diesen nie endenden Revisionsprozess gibt. Davon abgesehen entlarvt Gadamers Hermeneutik, wie er selbst oft betont hat, 77 die verdeckte Voraussetzung der Absolutheit im Relativismus, welche sich hinter diesem verbirgt. Gadamer hält an der Selbstwidersprüchlichkeit jeder Widerlegung des Relativismus insofern fest, als man den Grundsatz des Relativismus, alles sei relativ, nur behaupten könne, wenn man nur das ahistorisch allgemeingültige Wahrheitskriterium voraussetzt. Denn die Vorstellung der Universalrelativität setzt sich selbst dem Geltungszwang zur absoluten Satzallgemeingültigkeit aus, wie der Absolutismus seinen Geltungsanspruch auf das endgültige Wahrheitswissen erfüllen soll. Anders formuliert, besteht die Selbstwidersprüchlichkeit offensichtlich darin, dass der Relativismus von vornherein über den eingeschränkten geschichtlichen Standpunkt hinaus mit dem Ideal des Absolutismus argumentieren muss, da er andernfalls auf seinen ursprünglichen Grundsatz verzichten müsste. So sagt Gadamer: „Die Geschichtlichkeit ist nicht länger eine Grenzbestimmung der Vernunft und ihres Anspruchs, die Wahrheit zu erfassen, sondern stellt vielmehr eine positive Bedingung für die Erkenntnis der Wahrheit dar. Dadurch verliert die Argumentation des historischen Relativismus jedes wirkliche Fundament. Ein Kriterium für absolute Wahrheit verlangen enthüllt sich als ein abstrakt–metaphysisches Idol und verliert jede methodologische Bedeutung. Die Geschichtlichkeit hört auf, das Gespenst des historischen Relativismus heraufzurufen, […].“ (GW. 2, S. 103) Darüber hinaus ist das Verstehen, wie bereits erwähnt, letztendlich das Sich–Verstehen in dem Verstehen über die Anderen oder, mit Gadamers Worten, ein „Sichversetzen in etwas.“ (GW. 1, S. 183–184) Das hermeneutische Verstehen bildet sich selbst also in der unabgeschlossenen Bewegung zwischen der aufklärenden Selbsterinnerung an das Vergangene und der vorweggenommenen 77 Vgl. Gadamers Interview mit J. Grondin, in: Gadamer Lesebuch, S. 282 – 285 und Hans–Georg Gadamer, Die Lektion des Jahrhunderts, S. 44 – 58. 215 Selbstentwürfe auf das Zukünftige immer wieder neu aus. Aufgrund seiner Einsicht in den Grundcharakter des menschlichen Verstehens formuliert Gadamer daher: „Was als wahr gelten muß, zielt auf das Glaubhafte ab.“ 78 Insofern verlangt das hermeneutische Bewusstsein nicht die Beweisbarkeit, sondern stellt sich stattdessen die Frage nach der glaubwürdigen Überzeugung, da es um seine Situationsbedingtheit weiß. Da das hermeneutische Bewusstsein das gewisse Wissen um seine Situation ist, bleibt das Bewusstsein immer für den motivierenden Anstoß des Fremden und für die Möglichkeit der besseren Einsicht in die Wahrheit des Anderen offen. 78 Gadamers Interview mit J. Grondin, S. 284. 216 I – 3. Das distanzierende Verstehen und die Sinnrekonstruktion An dieser Stelle müssen wir uns die bisherigen Überlegungen in Erinnerung rufen: Für das menschliche Verstehen war gleichfalls die Geschichtlichkeit des hermeneutischen Bewusstseins wie die ontologische Vorstruktur der hermeneutischen Erfahrung charakteristisch. Aus hermeneutischer Sicht hat das Verstehen bereits einen eigenen Standpunkt, der einerseits im Laufe der Geschichte gebildet wird und andererseits durch das Ins–Spiel–Setzen gewonnen wird. Das Verstehen bildet daher durch seine Eingebundenheit in den geschichtlich–kulturellen Kontext seinen Standpunkt aus. Das menschliche Verstehen ist von vornherein in die geschichtlich–kulturellen Konventionen einbezogen und mit diesem Einbezogensein auf seine ontologische Grundlage zurück geworfen. So gesehen sieht die Hermeneutik es von Anbeginn an als ihre Aufgabe an, die mitkonstitutive Rolle des Anderen in der menschlichen Erfahrung zur Sprache zu bringen. Das Verstehen erwächst aus der ineinander übergehenden Polarität von Vertrautheit und Fremdheit, von Eigenheit und Andersheit, also aus der zwischenmenschlichen Sozialbeziehung. Mit anderen Worten: Das hermeneutische Verstehen als eine Grundstruktur der menschlichen Binnenperspektive ist grundsätzlich das Verstehen des Anderen, d. h. die gemeinsame Verständigung mit dem Anderen über die Sache als die sich selbst erschließende Welt, die mit dem Sich-Einlassen der eigenen Voreingenommenheit in die Konfrontation mit dem Anderen, erreichbar ist. Wenn sich das Verstehen im Zwischenraum zwischen dem uns Vertrauten und dem uns Fremden, also zwischen Eigenheit und Andersheit vollzieht, d. h. das Finden des Eigenen in der Begegnung mit dem Gegenüberstehenden in der alltäglichen Lebenswelt geschieht, dann müssen wir zu dem zu Verstehenden eine Distanz schaffen, sofern wir überhaupt verstehen wollen und müssen. Denn die Distanz zu sich selbst drückt sich allein in dieser Distanziertheit aus. Nur so wird das Fremde zum relativ Fremden, das Andere zum relativ Anderen in der Beziehung zum Eigenen. Am Phänomen des Sehens, insbesondere an dem des „>ästhetischen< Sehens“ in der Kunsterfahrung, lässt sich das veranschaulichen. Wir können nur aus einem bestimmten Abstand das sehen, was vor uns steht und wir nehmen deshalb im Sehen etwas Bestimmtes wahr, das zwar auf positive Weise artikuliert wird, aber zugleich auf negative Weise abstrahiert, vom anderen absieht. (GW. 1, S. 96) Da die Gefahr des Übersehens und des Wegsehens dem Sehen unvermeidbar innewohnt, müssen wir deshalb dem vor uns stehenden Gegenstand gegenüber immer eine angemessene Distanz halten, damit wir ihn richtig sehen können. Das Sehen verlangt dabei, dass unser Standpunkt nicht nur zum Gegenstand Distanz 217 hält, sondern sich mit dieser Distanznahme auch auf den Spielraum einlässt, der sich aus den voneinander distanzierten Polen ergibt. Wenn die Frage, ob dieses Sehen, dieses Wahrnehmen richtig ist, ins Zentrum gestellt wird, geht es beim Sehen darum, auf welche Weise wir die angemessene Distanz gewinnen können. Und damit geht es auch um das „Verweilen“ bei dem distanzierten Gegenpol, etwa im Fall der Erfahrung des Kunstwerks, in der die Interdependenz von Pol und Gegenpol konstitutiv ist. Im Hinblick auf die Distanz im Fall des ästhetischen Sehens sagt Gadamer: „Der Aufnehmende ist in eine absolute Distanz verwiesen, die ihm jede praktische, zweckvolle Anteilnahme verwehrt. Diese Distanz ist eine im eigentlichen Sinne ästhetische Distanz. Sie bedeutet den zum Sehen nötigen Abstand, der die eigentliche und allseitige Teilhabe an dem, was sich vor einem darstellt, ermöglicht.“ (GW. 1, S. 133) Gadamers Einsicht in die Distanz beim „ästhetischen Sehen“ ist paradigmatisch, sofern die Erfahrung der Distanz nicht nur für den Bereich der ästhetischen Erfahrung gilt, sondern auch als ein universales Phänomen des hermeneutischen Verstehens – vom Textverstehen bis hin zur Verständigung in der zwischenmenschlichen Sozialbeziehung – gelten kann, da die Distanznahme die Erfahrung der Fremdheit im Verstehensvorgang und die der Andersheit im gesellschaftlichen Verständigungsprozess ermöglicht. Das bedeutet: Es gibt kein Verstehen und keine Verständigung ohne die Distanz zum Anderen und zu sich selbst. So kann man sagen, dass unser hermeneutisch anstrengender Versuch, die dunkle Stelle in einem Text zu verstehen, auf die angemessene Distanznahme, die allein den eigenen Sinnhorizont zu bilden vermag, angewiesen ist. Denn wenn die dunkle Textstelle als Verstehensgegenstand vom Interpretationshorizont des Verstehenden zu weit entfernt ist, ist der Textsinn völlig verborgen. Mit anderen Worten: Wenn sie dem Interpreten absolut unzugänglich wäre, gäbe es hier keine Möglichkeit, sich mit uns auf ein Gespräch einzulassen. Und umgekehrt ist unsere Anstrengung, zu verstehen, auch in dem Fall zwecklos, in dem das zu Verstehende mit unserem Horizont übereinstimmt. Indem das hermeneutische Sinnfeld in dem miteinander verschränkten Zwischenraum des distanzierten Sich–aufeinander-Beziehens liegt, müssen wir als Verstehende zuallererst die Fremdheit, die Andersheit akzeptieren und den motivierenden Gegenpol als Bedingung für das gelingende Verstehen bejahen können. Von daher können wir nunmehr sagen, dass die Hermeneutik von vornherein das Differente anerkennt, dass die hermeneutische Gemeinschaftsbildung sich deshalb auf die Anerkennung der distanzierten Differenzen bezieht. Somit kann man sagen, dass die hermeneutische Distanznahme den Freiraum für das Verstehen öffnet, in dem sich die verschiedenen Perspektiven auf das Gespräch einlassen und sich auf einen gemeinsamen Bezugspunkt hin ausrichten. 218 Sofern das Verstehen sich mit dem Eintreten des Eigenen in die Fremderfahrung, nämlich innerhalb des wechselseitigen Bezugsrahmens der beiden Betroffenen ereignet, liegt das hermeneutische Sinnfeld immer schon in der Spannweite der Korrelation von Vertrautheit und Fremdheit. Die zwischenräumliche Spannweite, in der die Pole zueinander Distanz halten bzw. der Abstand ist nicht nur ein „nötiger Abstand“, sondern auch eine zeitliche Distanz, die man als „ontologische Distanz“ bezeichnen kann. Im Hinblick auf den nötigen Abstand geht ein Interpret zunächst von dem zu Verstehenden als einem Gegenstand der Interpretation aus. Um das Interpretandum zu verstehen, muss er auch zu diesem eine gewisse Distanz gewinnen. Innerhalb des Spielraums der Distanzierung zu sich selbst, kann der Interpret mithin sein Interpretandum finden. Mit anderen Worten: So lange wir etwas verstehen und verstehen müssen, muss das Verstehen das zu Verstehende zu seinem Gegenstand haben. Um das zu Verstehende zu vergegenständlichen, muss das Verstehen sich damit auch von ihm distanzieren, da es nur durch die Distanz zu sich selbst das zu Verstehende als seinen Gegenstand finden kann. Darüber hinaus können wir mit Gadamers Begriff „Zeitenabstand“, nämlich dem geschichtlichen Abstand, die konstitutive Sinnkreation durch die Distanzierung erarbeiten, die zwischen dem zu verstehenden Sachverhalt und dem Interpreten, nämlich zwischen dem Vergangenen und dem Gegenwärtigen besteht. Die tradierte Geschichte, die sich mit dem geschichtlichen Abstand bewegt, ist uns über die geschichtliche Grenze hinaus immer schon gegenwärtig. Gleichwohl verändert sie sich durch die Begegnung mit unserem Horizont immer wieder aufs neue. Anders formuliert: Sobald wir sie verständlich machen, ist sie in einen anderen Sinnhorizont übersetzt, d. h. sie lässt sich in unseren Horizont übertragen. Aufgrund der unaufhebbaren zeitlichen Distanz ist das Verstehen aus der hermeneutischen Sicht bereits ein Andersverstehen, d. h. ein Hervorbringen eines neuen Sinnhorizontes. Wenn man davon ausgehen kann, dass der Abstand die Basis für die Interpretationsfähigkeit bildet, dann kann man mit Gadamer sagen: „Der Dialog, den wir mit der Vergangenheit führen, konfrontiert uns mit einer Situation, die von der unseren grundlegend verschieden ist, sie ist uns >>fremd<<, - sagen wir - , und erfordert daher ein Interpretationsverfahren.“ 79 So gesehen eröffnet die Erfahrung des Abstandes zwischen dem geschichtlich Überlieferten und unserem Horizont aus Gadamers Sicht den möglichen Sinnhorizont, vor dem die Fremdheit zu erfahren ist und wo das Geschichtliche als das eigene Fremde zu betrachten ist. Das Fremde, das durch das hermeneutische Bewusstsein von der Geschichtlichkeit unserer Erfahrung entdeckt wird, bestimmt das geschichtliche Sinngeschehen mit, da das Verstehen, wie wir gesehen haben, sich von vornherein durch die Teilnahme an diesem Sinngeschehen vollzieht. 79 Hans–Georg Gadamer, Das Problem des historischen Bewußtseins, übers. v. Tobias Nikolaus Klass, Tübingen 2001, S. 9. 219 Selbst wenn wir uns an die eigene Erfahrung zu erinnern versuchen, führt die Erinnerungsstruktur aufgrund der zeitlichen Distanz dazu, dass der erinnerte Inhalt ein gegenüber der eigenen Erfahrung fremder wird. Die Erinnerung ist deshalb keine Widerspiegelung derselben Geschichte, - wir können auch keinesfalls ein und dasselbe wiederherstellen -, sondern sie wird im Verhältnis zu den gegenwärtigen Umständen ständig modifiziert. 80 Die Erinnerung bedeutet aus dieser Perspektive betrachtet, eine Übertragung des eigenen Fremden ins gegenwärtige Eigene. Etwas verständlich machen bedeutet aus hermeneutischer Sicht, das Fremde ins Eigene zu übersetzen, 81 die Differenz zwischen dem Eigenen und dem Fremden in diesem Übersetzungsvorgang auszuhalten. Die Distanz, die nicht nur von uns ausgeht, sondern auch im vertikalen Horizont der Geschichte verankert ist, lässt nunmehr das Andersverstehen, den neuen Sinnhorizont zu. Angesichts dieses Sachverhaltes sagt Gadamer, „daß das nachkommende Verstehen der ursprünglichen Produktion gegenüber eine prinzipielle Überlegenheit besitzt und deshalb als ein Besserverstehen formuliert werden kann, beruht nicht so sehr auf der nachkommenden Bewußtmachung, […] sondern beschreibt im Gegenteil eine unaufhebbare Differenz zwischen dem Interpreten und dem Urheber, die durch den geschichtlichen Abstand gegeben ist.“ (GW. 1, S. 301, meine Hervorhebung) Mit der Formulierung „eine unaufhebbare Differenz“ will Gadamer m. E. weniger eine abgründige Differenz, als die ontologische Distanz aufzeigen, die auch auf eine zeitlich-räumliche Trennung verweist, aber dennoch über die markierte Grenze hinaus die Unterschiedenen zusammenführen, d. h. eine Brücke zwischen dem Eigenen und dem Fremden schlagen kann. Die Differenz bedeutet bei Gadamer daher eine unaufhebbare und zwar in dem Sinn, dass sich das Fremde im gesamten Verlauf des Verstehensvorgangs als ein Unerschöpfbares zeigt und dass das Verstehen trotz der Übertragung des Fremden ins Eigene immer die auffällige Fremdheit entdeckt. Hinsichtlich des ununterbrochenen Bezugs zwischen den Differenten bezieht sich Gadamers Hermeneutik nicht auf einen unüberbrückbaren Abgrund, der im Grunde einen grenzenlosen Zweifel am Verstehen–Können und –Wollen in sich verbirgt, sondern stützt sich auf die Verstehbarkeit des wahrheitstragfähigen Sachsinnes in der 80 Vgl. Paul Ricoeur, Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen, übers. v. Andris Breitling u. Hendrik Richard Lessar, Göttingen 1998, S. 131ff. Hier hat er die psychologischen Phänomene vom Vergessen und Erinnern ins Auge gefasst. Besonders sagt er: „In dieser Hinsicht erweist sich dieses Vergessen auf der abgeleiteten Ebene des In–Erinnerung–Rufens und des Wiedererinnerns als wohltätig. Man kann sich nicht an alles erinnern. Ein lückenloses Gedächtnis wäre eine unerträgliche Last für das wache Bewußtsein.“ (S. 140) Damit sieht er die kritische Kraft in diesen Vergessensphänomenen und unvollständigen Erinnerungen. 81 Zum Übersetzungsverhältnis der Polarität von dem Eigenen und dem Fremden, vgl. G. Figal, Der Sinn des Verstehens, S. 101 – 111. 220 wechselseitigen Distanznahme. 82 Denn der wahrheitstragfähige Sachsinn befördert sich aus dem distanzierten Aufeinanderbezogensein, aus der Anerkennung der unauflösbaren Fremdheit stets in einen neuen Sinnhorizont, vor dem sich die hermeneutische Kreativität abspielt. Wenn jemand einen Text liest, offenbart sich der Sinn des Textes stets auf eine neue Weise, auch wenn wir denselben Text immer wieder lesen. Die Veränderung des Sinns wird durch den Leseakt selbst hervorgerufen, in dessen Verlauf der Leser mit seiner eigenen Antizipation den möglichen Textsinn hervorhebt und erhellt. Somit begleitet die Betonung des Textsinns auch die Sinnverstellung und Sinnverdrängung. Angesichts dessen gilt Gadamer das Verstehen als das „Immer–Anders–Verstehen“, nämlich als das ständige Anderswerden im Prozess. (GW. 2, S. 8) Außerdem steht dasjenige, was zeitlich prozessual zu entfalten ist, im ständigen Übergang zum Anderssein, in dessen Verlauf das Wechselverhältnis zu seinem Anderen im Prinzip ungebrochen ist. Im Anschluss an Gadamers Einsicht ins Andersverstehen wird auch deutlich, dass die Distanz nicht von uns geschaffen wird, sondern dem Verstehensprozess selbst entstammt. Der Weg zum Andersverstehen in Gadamers Hermeneutik orientiert sich, wie bereits gesagt, nicht an der vermeintlichen Restauration eines Ursinns, sondern zielt auf die ontologische Begegnung des Fremdsinns mit unserem Sinnhorizont, auf die schöpferische Interpretation in unserem Sinnhorizont ab. Dementsprechend wird das Verstehen, wie wir bereits mit der Vorstruktur des Verstehens besagt haben, von dem Angesprochenwerden initiiert. Das Angesprochenwerden gibt uns den Anlass zum Verstehen; es erhebt einen Wahrheitsanspruch im bestimmten Sinnfeld. Dass das Verstehen stets ein Angesprochenwerden voraussetzt, bedeutet, dass es zunächst vom Fremden motiviert wird, dass das Fremde dem Eigenen auffällt, das Eigene herausfordert. Aus hermeneutischer Sicht gibt es deshalb kein Verstehen ohne die Herausforderung des Anderen. Es bahnt sich mit dieser Herausforderung an und vollzieht sich mit der Begegnung zwischen dem tradierten Fremdsinn und unserem Standpunkt. Die Begegnung als Sinnvollzug verweist darauf, dass der überlieferte Fremdsinn in seiner eigenen Interpretationsgeschichte immer neu verstanden wird, seinen Sinngehalt vermehrt und verändert. Insofern sieht Gadamers Hermeneutik ein, dass die ontologische Differenz keine Barriere für das Verstehen, sondern als eine Basis für das Verstehen gilt. Aus 82 Dementsprechend sagt Schleiermacher: „Denn in jedem Falle ist immer eine gewisse Differenz des Denkens vorhanden zwischen dem Sprechenden und Hörenden, aber keine unauflösliche. Selbst im gewöhnlichen Leben, wenn ich bei vollkommener Gleichheit und Durchsichtigkeit der Sprache die Rede eines anderen höre und mir die Aufgabe stelle, sie zu verstehen, setze ich eine Differenz zwischen ihm und mir. Aber in jedem Verstehenwollen eines anderen liegt schon die Voraussetzung, daß die Differenz auflösbar ist.“ Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, S. 178. 221 diesem Grund fordert sie uns auf, die Erfahrung des Fremden als Motivation des Verstehens aufzunehmen. Da das hermeneutische Verstehen sich mit der Erfahrung des Fremden bewegt, kann man sagen, dass die Hermeneutik die unterschiedlichen Vielen mit dem selbigen Einen83 zusammendenken will. So nimmt sie mithin das Fremde als das eigene Fremde in sich auf. Der Zeitenabstand hat bei Gadamer überdies die hermeneutische Funktion der Filterung in der Hinsicht, dass er zwischen uns und der differenten Sache vermittelt, d. h. den Wahrheitsanspruch des wahrheitstragfähigen Sachsinnes erhebt, dass er, wie bereits erwähnt, den potenziellen Sinnhorizont in Bezug auf die Sachwahrheit erneut und andersartig eröffnet. Der Zeitenabstand legt damit mehr oder weniger auch unsere Vorentwürfe auf den Prüfstein, auf dem das wahre Vorurteil vom falschen unterschieden werden kann. Hier spielt der Zeitenabstand seine Rolle als Scheidelinie, aber er begründet sie weder auf einer Kontrollinstanz, noch beansprucht er einen letztbegründeten Richterstuhl. Aus Gadamers Perspektive soll die Scheidelinie aus dem unendlichen Versuch unserer dialogischen Wahrheitssuche selbst hervortreten, mit Gadamers Worten, muss „diese Scheidung vielmehr im Verstehen aber geschehen.“ (GW. 1, S. 301) Aus der Perspektive des hermeneutischen Verstehensproblems betrachtet, dem wir im Interpretationsverlauf so häufig begegnen, stellen wir die meisten Fragen nach der dunklen Stelle im Text, die sich im Allgemeinen aus der geschichtlichen Distanz, der Differenz der kulturellen Erfahrungen, ergibt. Anders gesagt, führt uns die dunkle Stelle im Text zu der Interpretationsfrage, d. h. zu der Interpretationsbedürftigkeit, wohingegen der allzu deutliche Textsinn unser Interesse nicht weckt. Die dunkle Stelle bildet den Anlass, sie als ein uns Fremdes zu erfahren und sie fordert uns auf, indem sie uns gegenüber bereits eine auffällige Fremdheit an den Tag legt. Mit anderen Worten: So lange das hermeneutische Verstehen einen Gegenstand findet, der der Interpretation bedarf, befindet es sich in Kontakt, indem es immer auf die Fremdheit, die von vornherein dem Verstehensvorgang vorausgeht, angewiesen ist. Die dunkle Textstelle, die unser Interpretationsinteresse weckt, veranlasst unsere Voreingenommenheit, sich in den überprüfenden Erprobungsprozess hinüber zu begeben. In diesem selbstkorrigierenden Lernprozess fragen wir uns nicht nur nach dem wahren Sinn der dunklen Textstelle, sondern vielmehr nach den eigenen Sinnvorentwürfen: Wir erarbeiten den Textsinn vor dem Hintergrund sämtlicher Sinnzusammenhänge und stellen noch mehr die kritischen Fragen 83 Sowohl die Hermeneutik als auch die dialogische Dialektik müssen Vieles in Einem sagen, das Eine ins Mannigfaltige übersetzen, solange sie die ursprüngliche Distanz umfaßt, ihren Gegenstand aus dieser Distanz herauszufinden versucht. Zu dieser Aufgabe der Hermeneutik, die aus dem Ursprung der philosophischen Tradition, d. h. aus dem Erbe des Denkens von Parmenides und Heraklit entstammt, vgl. M. Riedel, Hören auf die Sprache, S. 96ff. und ders., „Gadamers dialektische Hermeneutik und der „Schritt zurück“ zum Ethos der Dialektik. Die Werkausgabe zum Zeitpunkt seines 90. Geburtstages“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, Jg. 15, Heft 3, hrsg. v. Josef Simon, Stuttgart 1990, S. 43 – 49. 222 nach den eigenen Vorurteilen in den Vordergrund. Im Hinblick auf die hermeneutische Funktion des Zeitenabstandes sagt Gadamer: „Der Zeitenabstand, der die Filterung leistet, hat nicht eine abgeschlossene Größe, sondern ist in einer ständigen Bewegung und Ausweitung begriffen.“ (GW. 1, S. 303) Für uns ist entscheidend, dass die hermeneutische Funktion der Filterung in Gadamers philosophischer Hermeneutik eine sinnkonstruktive Kreativität impliziert. Hinsichtlich der hermeneutischen Sinnkreation kann man sagen, dass Gadamers Hermeneutik auch das „Besserverstehen“ nicht außer Acht lässt. Wenn jedoch bei Gadamer vom „Besserverstehen“ oder von der hermeneutischen Produktivität die Rede ist, orientiert sich die hermeneutische Produktivität nicht mehr am abgeschlossenen Punkt der Allwissenheit, mit dem alles differente Viele beendet werden soll, - um das Bessere zu beweisen, müssen wir unabdingbar den transzendenten Endzweck vorlegen können - sondern sie kommt im Gegenteil aus der Erwartung auf die Sinnerfüllung, die von der wahrheitstragfähigen Sache her erschlossen wird. In der zirkulären Sinnbewegung von der Eigenheit und der Fremdheit legt die hermeneutische Produktivität damit in Gadamers Augen ihren Schwerpunkt auf das Sich–Verstehen im Textsinn ebenso wie im Dialog, was nur durch die Selbsteinstellung im prozessualen Verstehensvorgang erreichbar ist. Aus Gadamers Perspektive ist die hermeneutische Produktivität nicht die abbildende Reproduktion des Urbildes: Die reproduktive Restitution ist, Gadamers Ansicht zufolge, kein Anteil des menschlichen Verstehens, so lange das Verstehen sich mit der ursprünglichen Differenz mitbewegt. Vielmehr liegt Gadamers Einsicht in die hermeneutische Kreativität darin, dass das Verstehen unter den Umständen der Begegnung des Vergangenheitshorizontes mit dem Gegenwartshorizont immer anders und stets erneut erzählt wird. Das beste Beispiel für diese hermeneutische Produktivität können wir m. E. in Gadamers Gedanken finden. So schreibt Gadamer in seinem Hauptwerk: „Oft vermag der Zeitenabstand die eigentlich kritische Frage der Hermeneutik lösbar zu machen, nämlich die wahrer Vorurteile, unter denen wir verstehen, von den falschen, unter denen wir mißverstehen, zu scheiden.“ (GW. 1, S. 304) Das in der Textstelle vorkommende Wort „Oft“ entspricht, wie Gadamer selbst sagte, dem „Nichts anderes als“ im ursprünglichen Text. Anhand dieser Textänderung zeigt sich, dass dem Verfasser selbst das Problem, das im alten Text enthalten war, bewusst geworden war, dass er die Selbstrevision auf sich selbst, die Selbstkritik im Überblick auf sich selbst, die hermeneutische Besinnung auf sich selbst leisten konnte und somit die andere und deshalb 223 neue Dimension finden konnte. 84 Diese selbstkritische Textmodifikation gibt uns auch einen Hinweis darauf, dass die Distanz der Geschichte, der Kulturen, der selbstbiographischen Erfahrungsgeschichte, z. B. der Erinnerung, der zwischenmenschlichen Beziehung usw. grundsätzlich die hermeneutische Forderung nach der unendlichen Anstrengung um die Wahrheit und nach der Bereitschaft zur überprüfenden Revision auf sich selbst erhebt. Aus diesem Grund kann man sagen, dass das Distanzhalten im hermeneutischen Sinn nicht nur das grundsätzliche Moment der Textinterpretation, sondern auch die Voraussetzung für die gemeinsame Verständigung und die Gemeinschaftsbildung in der zwischenmenschlichen Beziehung ist. Aus hermeneutischer Sicht lag es auf der Hand, dass das Verstehen die uns begegnende Überlieferung verständlich machen will. Mit dieser Begegnung hat das Überlieferte als ein tradiertes Fremdes an dem gesamten Verstehensvorgang seinen eigenen Anteil. Nun gilt es zu berücksichtigen, dass das hermeneutische Verstehen mithin nicht nur mit dem Hören auf den Wahrheitsanspruch des Überlieferten, sondern auch im Gespräch mit diesem sachorientierten Überlieferten zu Tage kommt. So hat das hermeneutische Verstehen seinen Grundcharakter in der „Du–Erfahrung“, die Gadamer später nicht nur als die Grundstruktur der hermeneutischen Erfahrung im Dialogverhältnis bezeichnete, sondern auch in seinem Hauptwerk emphatisch als das „Moment der Hermeneutik“ bezeichnet. Das hermeneutische Verstehen behält damit die personalen Züge bei, so dass es das Fremde, das Andere als seinen Gesprächspartner in diesem dialogischen Verstehensvorgang annimmt. Kurzum findet das Verstehen immer schon im zwischenmenschlichen Bezug statt. In Gadamers Augen bewegt sich das menschliche Verstehen von vornherein mit dem Aufeinander-Bezugnehmen weiter und zielt auf das Aneinander-Anschließen durch die Begegnung mit dem Anderen, d. h. dem Du ab. Nun wird gezeigt, dass Gadamers Hermeneutik von Anfang an „mit dem Problem des Anderen befasst“ 85 ist, sich mit der Frage nach dem Verstehen des Anderen beschäftigt. Die Anerkennung der unaufhebbaren Andersheit des Anderen bestimmt in Gadamers Augen das Verstehen mit, anders gesagt, das Verstehen setzt die unvermeidbare Distanz des Eigenen zum Anderen voraus. Die hermeneutische Erfahrung schließt mithin die gegenläufigen Bestrebungen, d. h. die interaktive Verflechtung mit ein, in deren Verlauf die Beteiligten aufeinander eingehen und zueinander halten. Der hermeneutische Spielraum, in dem sich die verschiedenen Meinungen zeigen und es mit der Anerkennung dieser Meinungsverschiedenheit zur gelungenen oder misslungenen Verständigung kommen kann, 84 Vgl. Gadamer, „Zwischen Phänomenologie und Dialektik. Versuch einer Selbstkritik (1985)“, in: GW. 2, dazu auch J. Grondin, Einführung zu Gadamer, S. 140 – 144 und ders., Hermeneutische Wahrheit, S. 149 – 158. 85 Emil Angehrn, Interpretation und Dekonstruktion. Untersuchung zur Hermeneutik, Weilerswist 2003, S. 114. 224 erschließt sich deshalb nur aus dem Bewusstsein, das, mit Gadamers Worten, „um die Andersheit des Anderen, um die Vergangenheit in ihrer Andersheit so gut, wie das Verstehen des Du dasselbe als Person weiß.“ (GW. 1, S. 366) Damit kommt die hermeneutische Grundstruktur der Du–Erfahrung nunmehr zur „Bewegung des Anerkennens“ im Dialogverhältnis. Wir haben gesehen, dass das Anerkennungsverhältnis bei Hegel auch mit der Entdeckung des Anderen, mit der Voraussetzung der Andersheit des Anderen in der prozessualen Erfahrungsgeschichte des Bewusstseins beginnt, dass das Bewusstsein in dieser Anerkennungsbewegung das Selbst im Anderen findet und den Anderen anerkennt, obwohl das Bewusstsein bei Hegel von vornherein durch die Anerkennungsbewegung, durch die Reflexion hindurch, auf die vollkommene Rückkehr zur fundamentalen Selbstgewissheit abzielt. Dennoch ist die Anerkennungsbewegung in der zwischenmenschlichen Beziehung in Gadamers Dialoghermeneutik nicht mehr der vollständige Rückzug auf die egozentrische Selbstheit als das allem zugrunde liegende Fundament, sondern begründet sich auf der ständigen Du– Erfahrung, der unaufhebbaren Andersheit des Anderen, die Gadamer, wie wir schon sahen, durch die Entschärfung der neuzeitlichen Auffassung von der Subjektivität erreicht und die bei ihm den beständigen Bestandteil des Verstehensvorganges, das Moment der unendlichen Sinnerschließung bildet. Die Anerkennung im Dialogverhältnis ist damit nicht nur die ontologische Voraussetzung für die Verständigung unter den Menschen, sondern bildet sich auch selbst durch den gesamten Dialogvorgang hindurch weiter stabil aus. Mit seiner Einsicht in die Unaufhebbarkeit der Andersheit des Anderen im Reflexionsakt sagt Gadamer: „Es ist wie im Verhältnis zwischen Ich und Du. Wer sich aus der Wechselseitigkeit einer solchen Beziehung herausreflektiert, der verändert diese Beziehung und zerstört ihre sittliche Verbindlichkeit. Genau so zerstört, wer sich aus dem Lebensverhältnis zur Überlieferung herausreflektiert, den wahren Sinn dieser Überlieferung.“ (GW. 1, S. 366) Im gesamten Verlauf der Anerkennungsbewegung ist der Andere deshalb in Gadamers Hermeneutik nicht mehr ins Selbige, wie die Reflexionsphilosophie es sieht, hineinverschlungen, sondern er verstärkt sein Eigenrecht. Da Gadamers Dialoghermeneutik ihren Sinnvollzug nicht am Anschlusspunkt der prozessualen Bewegtheit, sondern in der unendlichen Bewegung selbst sieht, subsumiert die Anerkennungsbewegung in der hermeneutischen Erfahrung die Andersheit des Anderen selbst nach dem Bewegungsvollzug keinesfalls unter die Selbstheit, sondern sie akzeptiert im Gegenteil die unauflösbare Distanz des Eigenen zum Anderen. Die Anerkennung bringt es im hermeneutischen Sinn zum Bewusstsein, dass die Distanz zum Anderen stets den 225 Handlungsraum der gegenseitigen Verständigung eröffnet, so dass der Andere das Eigene zum Vorschein bringt und zur Bedingung für die gemeinsame Wir–Dimension wird. Aus dieser hermeneutischen Sicht betrachtet, muss auch der Andere, um anders zu sein, daher zum Eigenen permanent Distanz halten. Denn der Andere fällt dem Eigenen nur durch seine differente Andersheit auf. Dass der Andere als Anderer anerkannt wird, bedeutet, die distanzierte Spannung stets zu halten. Innerhalb dieses Spannungsverhältnisses kann sich die Anerkennung des Anderen nur dann als sinnvoll erweisen, wenn das Eigene in der Distanznahme nicht nur seinem Anderen gegenübersteht, d. h. seine Eigenheit mit dem Anderen zusammen bildet, sondern der Andere sich damit vor den Anderen seiner selbst stellen kann. Aus diesem hermeneutischen Zusammenhang kann man erkennen, dass der Andere im Anerkennungsprozess unersetzbar ist. Die hermeneutische Erfahrung will, so Gadamer, mithin „im Verstehen die Andersheit des Anderen nicht aufheben, sondern bewahren.“ (GW. 2, S. 5) Im Dialogverhältnis lässt sie uns deshalb zur wechselseitig aufeinander wirkenden Sinnkonstruktion, in die das Eigene mit seiner Eigenheit und der Andere mit seiner Andersheit hineingezogen ist, gelangen. Mit dem Eintritt in den aufeinander wirkenden Dialoghorizont versetze ich mich selbst, ohne mir die Andersheit anzueignen, in die Andersheit des Anderen und der Andere gewinnt damit auch seine Andersheit, ohne sein Eigenrecht zu verlieren. Denn wenn wir uns in die Verhandlungssituation einbetten, zeigen wir dem Handlungspartner unser Interesse an der Sache und unser Handlungspartner tut dasselbe. Ohne das eigene Interesse aufzugeben, suchen wir in diesem Verhandlungsdialog einen möglichen Kompromiss. In diesem ontologischen Distanzschaffen zwischen der unverzichtbaren Eigenheit und der unreduzierbaren Andersheit liegt die hermeneutische Erfahrung, genauer gesagt, das miteinander zu führende Gespräch. Gadamer zufolge ist das hermeneutische Verstehen mithin „die Anerkennung des ständigen Andersseins“, die Begleitung des Sinnvollzugs des Anderen. (GW. 1, S. 499) Indem Gadamer die Selbstvergewisserung durch die Selbsterschütterung in der Begegnung mit dem Anderen und die Aufbewahrung der Andersheit des Anderen im Dialog sieht, sagt er: „[…] wenn man schon von Sichversetzen sprechen will, so versetzen wir uns in die Perspektive, unter der der andere seine Meinung gewonnen hat. Das heißt aber nichts anderes, als daß wir das sachliche Recht dessen, was der andere sagt, gelten lassen. […] So geschieht es schon im Gespräch.“ (GW. 1, S. 297) Das Gespräch in der hermeneutischen Erfahrung verstärkt nunmehr nicht nur das Eigenrecht des Anderen als Gesprächspartner, sondern erweitert auch die Möglichkeit der Schaffung eines gemeinsam gebildeten Sinnhorizontes, ohne die Differenz in einer differenzlosen Identität aufzulösen. 226 Die Erfahrung der Distanz im vorangegangenen Dialogprozess führt uns zu dem Bewusstsein, dass das Andere und der Andere die Grenze meines Eigenen sind. Dieses Selbstwissen um die eigene Begrenztheit lässt mich, Gadamers Ansicht zufolge, auf das Gespräch mit dem Anderen einlassen und damit auch über meine Grenze hinaus den Blickwinkel auf die überindividuelle Sinndimension richten. Hierbei nimmt der Andere immer schon am Gespräch teil und geht auch in der durch das Gespräch gestifteten Verständigung immer mit. Dementsprechend hebt Gadamers Hermeneutik die privilegierte Funktion des Anderen im dialogischen Verstehen hervor. Denn wir müssen beim Verhältnis zum Anderen bleiben und wir können nur von diesem privilegierten Anderen aus die Motivation zur Selbstvergewisserung, d. h. zur sich selbst modifizierenden Erhebung, zur Überschreitung über die eigene Grenze, gelangen, wenn wir verstehen wollen. Wo das Verstehen geschieht, da ist es aus hermeneutischer Sicht mithin das Verstehen des Anderen. Der Andere gibt stets den Anstoß zum Verstehen, wie die Begierdeerfüllung bei Hegel, sofern sich die Begierde nur in Beziehung auf das Andere ergibt und durch das Andere zum Genuss gelangt. Ihren Vermittlungscharakter hat sie in der Bewegung des Anerkennens. Der Andere in Gadamers Hermeneutik ist nicht so sehr ein bloßer Gegenpol, der in die abgeschlossene Letztinstanz hineingeschlungen ist, als, mit Gadamers Worten, „eine primäre Grenzsetzung unserer Eigenliebe und unserer Egozentrik“ im Inganghalten des Gesprächs. (GW. 8, S. 346) Wenn der differente Andere nunmehr als die eigene Grenze erfahrbar ist, versucht die Hermeneutik das Gespräch ständig in Gang zu halten, in dem sich das Verhältnis zwischen Ich und Du über die egozentrische Individualität hinweg, dem überindividuellen Sinngewebe zuwendet und damit die betroffenen Parteien in die Wir–Dimension versetzt. Mit der Überlegung über die ausgezeichnete Fähigkeit des Dialogs, zum Anderen Distanz zu halten, über die eigene Begrenztheit hinaus den Blick auf die sozialen Sinngewebe zu werfen, sagt Gadamer: „Gerade zwischen Mensch und Mensch gibt es ein Sich–Öffnen und eine Vertrautheit, […] sondern als eine Steigerung, Ausweitung, Ergänzung meines eigenen Eigenseins, ja als die Brechung meines Eigensinns, durch die ich Wirkliches anerkennen lerne.“ (GW. 4, S. 46) So gesehen ist das Gespräch in der hermeneutischen Erfahrung ein wirklicher Ort, an dem die voneinander Verschiedenen miteinander spielen und sich die menschliche Bereitschaft zum Sich-Einlassen auf das gemeinschaftliche Zusammenspiel zeigt. Das Gespräch in Gadamers Hermeneutik führt uns zum „Über–sich–hinaus–Sein“ hin, zum „mit dem Anderen denken und auf sich zurückkommen als auf einen anderen.“ (GW. 2, S. 369) Dieses Gesprächsverhältnis ist in der Hermeneutik „ein moralisches Phänomen“, anders gesagt, die Hermeneutik hat an diesem Ort, an dem das Gespräch zwischen den Menschen 227 stattfindet, an dem sich das Eigene im unabschließbaren Distanzgewinnen zum Anderen befindet, an dem sich alle Beteiligten in diesem Verhältnis einander näher kommen, eine ethische Haltung. (GW. 1, S. 364) Da das Gespräch, Gadamers Ansicht zufolge, die unauflösbare Distanz zum Anderen anerkennt, die von der Andersheit aus eröffnete Sinnrichtung impliziert und deshalb für das Andere offen bleibt, kommt es nie zu einem Ende: Das Gespräch in der hermeneutischen Erfahrung findet keinen Abschluss. Insofern hat es die lebendige Prozessualität zu seinem Grundcharakter. Konsequent wird im hermeneutischen Zusammenhang daran festgehalten, dass die menschliche Verstehenspraxis ohne jeden Zweifel die Lebenspraxis in der alltäglichen Lebenswelt ist. Denn die Hermeneutik versucht die Gemeinsamkeit aus dem lebendigen Gespräch mit dem Anderen abzuleiten und die ethische Konnotation durch ihre dialogische Offenheit für die unaufhebbare Andersheit zu finden. 228 I – 4. Das Bewusstsein der Endlichkeit und die hermeneutische Offenheit Bisher haben wir gesehen, dass Gadamers Hermeneutik von Anfang an ihren Schwerpunkt auf das Verstehen des Anderen legt. Das Verstehen geht davon aus, vom Anderen befragt zu werden und sich im Verhältnis zum Anderen zu vollziehen. Das Verstehen ist daher vom Anderen her motiviert und kommt durch die Selbsterfahrung in der Distanz zum Anderen zustande. Trotz dieser unauflöslichen Distanz sind die Anderen vom hermeneutischen Gesichtspunkt aus nicht verschlossen, sondern stellen sich selbst für immer vor uns dar, d. h. sie erschließen sich im Verhältnis zu uns einen Zugang zu sich selbst. Diese Anderen sind meine Gesprächspartner im gesamten Verstehensprozess und bewahren ihren Standpunkt permanent im wechselseitig aufeinander wirkenden Verstehenszusammenhang. Seiner Ansicht nach steht die hermeneutische Erfahrung unter der Einwirkung der gegenseitig miteinander verflochtenen Beziehung, anders gesagt, ist sie immer schon im unentrinnbaren Verhältnis des Ich zum Du als seinem Anderen enthalten. Die privilegierten Anderen, die nicht nur den überlieferten Text, sozusagen den schriftlich fixierten Sinn, sondern auch den Gesprächspartner, den anderen Kulturkreis usw. umschließen, bilden auf der einen Seite zwar den Hauptbestandteil im Verstehensvollzug, in dem menschlichen Versuch zur sozialen Verständigung, lassen aber andererseits ihre nie vollständig durchdrungene Andersheit hinter sich: Als ein Pol im gesamten Verstehensprozess spielen sie die wesentliche Rolle. Auch wenn das Verstehen durch diesen gesamten Prozess hindurch, in dem sich das Eigene und die Anderen eng zueinander verhalten, zum Sinnvollzug kommt, darf das hermeneutische Bewusstsein nie aus den Augen verlieren, dass die Anderen noch in der Distanz zum Eigenen verbleiben, dass sie noch immer keine Aussage unter ihren gesprochenen Worten getroffen haben. Aus hermeneutischer Sicht wohnen die Anderen sich selbst inne, d. h. sie haben stets das Moment des zu Verstehenden in sich und geben uns immer den Anstoß zum Verstehen. In diesem unaufhebbaren Spannungsverhältnis begegnet der Verstehende dem Anderen als seinem Kommunikationspartner. Aus Gadamers Sicht werden die Anderen deshalb geradezu zu einem Du, das mit uns und von uns verstanden werden kann, sie sprechen „von sich aus so wie ein Du“ (GW. 1, S. 364), während Schleiermacher in seiner „allgemeinen Hermeneutik“ auf den vollkommenen Sinnvollzug abgezielt hat, der durch die divinatorische Methode mit der idealen Erhellung der Absicht des Urhebers erreichbar sei. 86 Und auch Dilthey glaubte mit der psychologischen Methode die Sinnganzheit vollständig erfassen zu können 86 und er versuchte diese Möglichkeit vom vorbildlichen Paradigma der Vgl. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, S. 169ff. 229 Selbstbiographie abzuleiten. 87 Gegen Schleiermachers und Diltheys Ideal der Vollkommenheit des Verstehens wehrt sich Gadamer nunmehr mit folgender Aussage: „Die Idee einer allein richtigen Darstellung hat angesichts der Endlichkeit unseres geschichtlichen Daseins, wie es scheint, überhaupt etwas Widersinniges.“ (GW. 1, S. 125) An dieser Stelle nimmt Gadamer den Gesprächspartner des Verstehenden nicht als den Autor, sondern er bezieht beispielsweise den überlieferten Text auf den Kommunikationspartner als den Anderen. Er verschiebt den Akzent einerseits auf die geschichtliche Bedingtheit in der hermeneutischen Erfahrung, wie wir oben sahen, andererseits auf die existenzielle Endlichkeit des menschlichen Daseins. Man kann sagen, dass das Verstehen bereits durch das Zueinander-Verhalten zustande kommt, dass es im Zwischenraum der ineinander eingebundenen Pole stattfindet. Das Zugehörigsein des Eigenen und des Anderen zum geschichtlichen Gemeinsamen kann m. E. hier auf zwei Weisen betrachtet werden: Wir stehen einerseits unter der kontinuierlichen Linie der geschichtlichen Überlieferung, d. h. unter den vergangenen Sinnzusammenhängen. Unser gegenwärtiger Gesichtspunkt ist andererseits diskontinuierlich auf unseren jetzigen Zeitpunkt beschränkt. Unser Gegenwartshorizont ist deshalb nicht allmächtig, allwissend, sondern endlich, aber auch besonders. So steht die Gegenwart immer schon zum künftigen Horizont. Anders formuliert vollzieht sich die hermeneutische Wahrheit, laut Gadamer, nur durch die Teilhabe am gesamten Sinngeschehen. Indem sie nur durch unsere Teilnahme an der Sinnganzheit geschieht und sie auch von dem unobjektivierbaren Sinnnetzwerk ausgeht, können wir als die Beteiligten an diesem Sinngeschehen aus dieser Sinnganzheit nur einen abgesonderten Teil entnehmen, nur einen bestimmten Fall unter der kontinuierlichen Sinnverkettung erarbeiten. Das menschliche Verstehen muss deshalb ständig nach der sachgemäßen Wahrheit suchen und es steht auch zum Wahrheitsgeschehen, sofern wir verstehen wollen und können. Aus Gadamers Perspektive kann man sagen, dass das menschliche Verstehen die ständige Wahrheitssuche ist, da das zu Verstehende in diesem wahrheitssuchenden Prozess unabschließbar übrig bleibt. Wir, als die geschichtlich Bedingten und die existenziellen Endlichen, müssen uns für die künftigen Sinnmöglichkeiten, die immer sich selbst zur Sprache bringenden Sinndimensionen, offen halten. Infolgedessen lassen wir uns nunmehr zum Bewusstsein der Endlichkeit und zur hermeneutischen Offenheit, die man „die hermeneutische Tugend“ nennen kann, führen. Das hermeneutisch geschulte Bewusstsein ist bei Gadamer, wie bereits erwähnt, das Bewusstsein davon, dass es um die geschichtliche Begrenztheit der menschlichen Erfahrung 87 Vgl. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt, S. 198ff. 230 und die existenzielle Zeitknappheit des menschlichen Daseins weiß. Die Hermeneutik lehrt uns, dass unsere Erfahrung von vornherein den geschichtlichen Überlieferungen und der von der Geschichte überlieferten Sprachlichkeit zugehört, dass unsere Erfahrung damit auch auf den Lebenszeitraum begrenzt ist, in dem wir uns als die existenziellen Endlichen befinden. Demzufolge führt uns das Bewusstsein von der Zugehörigkeit unserer Erfahrung zur Geschichtlichkeit und zur geschichtlich überlieferten Sprachlichkeit auf den unabschließbaren Weg der leidenden Erfahrungen, den Hegel als den „Verzweiflungsweg“ bezeichnet hat und auf das unendliche Gespräch mit den Anderen. Das „Eingerücktsein“ in die sprachlichen Überlieferungen und in das Gespräch mit dem überlieferten Geschichtlichen wird deshalb bei Gadamer, wie bereits mit Kant angedeutet wurde, eine ontologische „Bedingung der Möglichkeit“ der hermeneutischen Erfahrung. Somit wird nun deutlich, dass das hermeneutische Bewusstsein seine bedingte Zugehörigkeit, nämlich seine Angewiesenheit auf den Anderen, erkennt. Nun gibt ein solches Bewusstsein uns den grundsätzlichen Hinweis darauf, dass die Standpunktseingebundenheit unserer Erfahrung in die vorgegebenen Situationen, das Einbezogensein in das aufeinander wirkende Sinnfeld, ein Leitfaden für die menschliche Erfahrung ist. So gesehen, sind wir keinesfalls Herr über die Geschichte, sondern die Geschichte umschließt uns und geleitet uns auf dem unumgänglichen Weg zur Wahrheitssuche. Diese geschichtliche Bedingtheit der menschlichen Erfahrung bedenkend, beginnt Gadamer den III. Teil seines Hauptwerkes mit dem folgenden Satz: „Wir sagen zwar, daß wir ein Gespräch >führen<, aber je eigentlicher ein Gespräch ist, desto weniger liegt die Führung desselben in dem Willen des einen oder anderen Gesprächspartners. So ist das eigentliche Gespräch niemals das, was wir führen wollten. Vielmehr ist es im allgemeinen richtiger zu sagen, daß wir in ein Gespräch geraten, wenn nicht gar, daß wir uns in ein Gespräch verwickeln.“ (GW. 1, S. 387) Das Gespräch gestaltet sich ebenso wie das Spiel mit den tradierten Kunstwerken und mit den sprachlich überlieferten Texten als ein freier Spielraum der Beteiligten, deren verschiedene Perspektiven ihn zusammen ausfüllen, in dem sie spielen und in dem sie ihre je eigene Besonderheit gewinnen und damit zugleich einander näher kommen. Im Gespräch, das sich durch den wechselseitigen Austausch der verschiedenen Meinungen vollzieht, spricht Einer mit dem Anderen über seine Überzeugung, versucht dem Anderen seine Überzeugungen effektiv zu vermitteln. Und umgekehrt hört er auch, indem der Andere ebenso verfährt, auf den Anderen. Dieser dialogische Austausch ist, wie die zitierten Sätze gezeigt haben, von dem Einen und dem Anderen unabhängig. Aus Gadamers Sicht wird deutlich, dass die gesamten Vorgänge des dialogischen Austausches von selbst ablaufen. Hinsichtlich seiner souveränen Dynamik erscheint das Gespräch als eine 231 übersubjektive Dimension - wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass das Sprechen selbst schon eine Wir–Dimension ist -, ähnlich wie ein Schachspiel nicht erst durch einen Schachzug ausgetragen wird, sondern sich durch den gesamten Vorgang von Zug und Gegenzug jede besondere Spielart nach ihren Spielregeln entfaltet. An dieser Stelle ist das Gespräch, mit Gadamers Worten, „die eigentliche Spur unserer Endlichkeit“, es ist „immer schon über uns hinweg.“ (GW. 2, S. 150) Wir als die bedingten Endlichen befinden uns bereits auf der ständigen Suche nach der wahrheitstragfähigen Sache, nach dem angemessenen Wort: Um den Anderen richtig zu erreichen und dem Anderen überzeugend zu vermitteln, versuchen wir das Wort stets in der bereits vorhandenen Gesprächslage zu finden. Wir können den Anderen zwar mit dem gesuchten Wort erreichen, aber es liegt auch auf der Hand, dass dieses gesuchte Wort vom Anderen oft missverstanden wird. Um zu einer Übereinstimmung mit dem Anderen zu gelangen, müssen wir uns unabdingbar in den unendlichen Gang zur gemeinsamen Wahrheitssuche begeben. Im Anschluss an die unendliche Wahrheitssuchstruktur der hermeneutischen Erfahrung im Gesprächsverhältnis verweigert Gadamers philosophische Hermeneutik die vollständige Korrespondenz von Denken und Welt, von Denken und Sprache, d. h. die absolute Vollendung der prozessualen Wahrheitssuche. Vielmehr stellt sie die nie abgeschlossene Unendlichkeit der menschlichen Erfahrung in den Vordergrund, die stets unter der Diskrepanz der wahrheitstragfähigen Sache leidet und mit dem Leiden auch die eigene Erfahrung macht. Diese strukturelle Unabschließbarkeit der hermeneutischen Erfahrung fördert das Gesprächsverhältnis zu Tage, da sich unsere Sprache in der Kommunikationssituation nicht nur miteinander austauscht, sondern auch voneinander distanziert, d. h. die je eigene Besonderheit der Gesprächspartner verstärkt. Aus hermeneutischer Sicht ist die absolute Wahrheit, die vollendete Angemessenheit nur Gott zugehörig, da Gott allein in einem Moment mit einem Wort alle erzeugt. Wir als die Bedingten müssen im Gegenteil, Gadamers Ansicht zufolge, das Eine in die Vielen bringen, die Mannigfaltigen aufrollen und versuchen, uns dadurch verständlich zu machen. Denn wir vermögen nur innerhalb unseres hermeneutischen Versuchs einander näher zu kommen und uns der sachlichen Wahrheit anzunähern. Aus diesem Grund sagt Gadamer im Zusammenhang mit Platons Einsicht: „Keiner der Götter philosophiert.“ (GW. 1, S. 490) Mit Gadamer kann man sagen, dass das Philosophieren der Anteil des Menschen sei. Insofern richtet sich die menschliche Erfahrung bzw. das Gespräch auf die unendliche Wahrheitsuche, das Einverständnis, so lange sie auf dem unabschließbaren Weg über die Endlichkeit, die Partikularität geht. Hierin liegt bei Gadamer das Besserverstehenkönnen. Die hermeneutische Universalität bei Gadamer ist im Grunde die 232 Anerkennung der universal beschränkten Endlichkeit der menschlichen Erfahrung, da die menschliche Erfahrung aus hermeneutischer Sicht die unvorhersehbare Wahrheitsdimension hinter sich lässt. Daran anschließend kann Gadamers philosophische Hermeneutik, wie der Gadamer-Experte J. Grondin es tut, auch als „Endlichkeitshermeneutik“ 88 bezeichnet werden. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass das hermeneutische Bewusstsein das Bewusstsein der Endlichkeit ist, sofern es ein menschliches Bewusstsein und der Mensch auf seine existenzielle Zeitknappheit begrenzt ist. 89 Das Bewusstsein der existenziellen Endlichkeit zeigt sich hier auf zweierlei Weisen: Einerseits als die räumliche Bedingtheit des menschlichen Daseins und andererseits als die zeitliche Begrenztheit der menschlichen Existenz. In Gadamers Hermeneutik weiß dieses Bewusstsein, dass die menschliche Erfahrung aus dem begrenzten Umgang mit den Anderen, den überlieferten Texten, dem Gesprächspartner und den anderen Kulturen besteht, dass sie, sofern der Mensch zum Tode ist, deshalb das existenzielle Endliche ist und unter der Bedingung der Zeitlichkeit lebt. Um es mit einem Wort zu beschreiben, ist die hermeneutische Erfahrung, wie Gadamer sagt, „die Erfahrung der menschlichen Endlichkeit.“ (GW. 1, S. 363) Das Bewusstsein der Endlichkeit führt uns zum Umgang mit den Anderen, in dessen Verlauf wir nicht nur die einstimmige Verständigung über die Sache und den Anderen, sondern auch die soziale Verständigung über uns selbst, gewinnen. Auf diesem ineinander übergehenden Weg der hermeneutischen Erfahrung findet ein Endlicher den Anderen, er begegnet dem Anderen, der gleich begrenzt ist. Nach dem Finden des Anderen, erfährt der eine, dass der gegenüberstehende Andere angesichts der gemeinsamen Handlungssituation ein und dasselbe Recht hat, indem er sich mit dem Anderen identisch auf seine Endlichkeit, seine Begrenztheit besinnt. Damit führt die Anerkennung der eigenen Endlichkeit zugleich zu dem Bewusstsein, dass weder der eine noch der andere den Sinnhorizont, sozusagen das Gespräch, führt, sondern der Sinnganzheitshorizont, das Gespräch, als offener Spielraum unserer Erfahrung, dem der eine und der andere zugehören, das gesamte Verfahren ausführt. Die Erkenntnis der zeitlich– räumlichen Begrenztheit der menschlichen Existenz lässt uns deshalb zu dem Schluß kommen, 88 Vgl. J. Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, S. 159ff., bes. S. 161 und M. Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 20. 89 Zum menschlichen Zeitbewusstsein mit Bezug auf die Musik, vgl. Odo Marquard, „Musik in der Philosophie“, in: ders., Individuum und Gewaltenteilung, Stuttgart 2004, S. 138 – 144, bes. S. 143 – 144. Hier wollte er, wenn ich ihn richtig verstehe, ebenso die Endlichkeit des menschlichen Daseins wie den musikalischen Rhythmus im Leben zur Sprache bringen. Ihm zufolge hat das Leben selbst zwar eine zeitliche Grenze, aber es hat innerhalb dieser Grenze auch die Fähigkeit, zu musizieren, sich zu erfüllen, wie eine Musik ihre rhythmische Harmonie mit dem widersprüchlichen Kontrast und der unwiederholbaren Improvisation ausführt. So sagt er: „Je musikalischer ein philosophischer Text ist, desto menschlicher – endlichkeitsfreundlicher – ist er. Je menschlicher ein philosophischer Text ist, desto mehr wird er dem Gesichtspunkt der unendlichen Kostbarkeit der endlichen Zeit gerecht; und er ist umso menschlicher, je mehr er – als Nichtmusik – Musik ist. Oder kurz gesagt: Je endlicher für die Menschen ihre Zeit ist, desto musikpflichtiger wird ihre Philosophie.“ 233 die potenzielle Wahrheitstragfähigkeit des eigenen Gesprächspartners wechselseitig anzuerkennen. Diese anerkannte Konfrontation mit dem Anderen fördert die gegenseitige Verstrickung zu Tage und bringt damit zugleich den möglichen Kompromiss zustande. Insofern kann die menschliche Erfahrung im Bewusstsein der Endlichkeit dem Irrweg der dogmatischen Abgeschlossenheit, der allgemein-endgültigen Allwissenheit, ausweichen. Aus dieser hermeneutischen Sichtweise können wir schlußfolgern, dass das Bewusstsein der Endlichkeit die Möglichkeit der menschlichen Erfahrung nicht mehr ausschließt, sondern stets den gesamten möglichen Sinnganzheitshorizont offen legt. So lange wir uns selbst unserer Endlichkeit bewusst sind, erkennen wir, dass das zu Verstehende immer noch übrig geblieben ist. Dennoch stehen wir bereits zum unerreichbaren Unendlichen, das in der auffälligen Distanz zu uns erscheint. Aus Gadamers Sicht führt uns die Unerschöpfbarkeit der sachlichen Wahrheit nicht nur zum Bekenntnis der menschlichen Endlichkeit hin, sondern erschließt uns als Basis der menschlichen Erfahrung auch den Sinnhorizont, dem wir zugehörig sind, immer wieder aufs Neue. Das Bewusstsein der Endlichkeit, das um die Unerreichbarkeit der letzten Wahrheitsdimension weiß, - um es mit dem von Gadamer oft zitierten Ausspruch Sokrates’ zu sagen: „Wissen um Nichtwissen“, - wird keine Barriere, sondern immer ein motivierender Grund für die weitere Erfahrung sein. Es bietet sich uns die Möglichkeit, uns auf den offenen Weg der Erfahrung zu begeben und einen Sprung in das Gespräch mit dem Anderen zu wagen. In der philosophischen Hermeneutik hat das Wissen um die endliche Bedingtheit unserer Erfahrung und die endlose Unabschließbarkeit der Wahrheitsdimension die basale Funktion, uns den immer neu zu verstehenden und auszulegenden Sinnhorizont zu erschließen. Das Bewusstsein um die Endlichkeit und der daraus folgenden Unmöglichkeit, die letzte Wahrheit zu finden, führt zu einer offenen Fragestellung. Das Wissen um die prinzipielle Unvorhersehbarkeit aller menschlichen Erfahrung bildet einen Leitfaden für die Fragen. Der Fragestellung liegt damit auch das Verhalten zum Anderen zugrunde, das das miteinander geführte Gespräch bestimmt und eine Antwort erwartet. Das Gespräch, in dem die Frage gestellt und die Antwort erwartet wird, führt uns vor Augen, dass die Andersheit des Anderen nicht bloß das Andere des fragenden Eigenen, sondern die ontologische Voraussetzung für den endlosen Weg zur Erfahrung der sich selbst offenbar machenden Wahrheitssache, zur Selbstvergewisserung ist. Beim Eintritt ins Gespräch erfahren wir, dass das Andere nicht mehr ein auf das Eigene reduzierbares, sondern von vornherein mein eigener Gesprächspartner ist, der auf die Frage antwortet und von dem ich eine Antwort erwarten kann. Hermeneutisch gesehen, bewahrt die unaufhebbare Andersheit des Anderen im dialogischen Verhältnis unserer Erfahrung nicht nur seine Besonderheit, sondern bildet sich 234 als Antworthorizont aus und wird damit zugleich zum Fragehorizont. Meine Frage ist hier das vom Anderen Befragte und erhofft damit zugleich die Antwort des Anderen. Der Fragehorizont ist eine Sinnerwartung auf die angemessene Antwort und stellt damit zugleich den vom Anderen erfragten Sinnhorizont dar. In diesem Verhältnis von Frage und Antwort, das das beantwortete Fragen und das befragte Antworten wechselseitig herbeiführt, erschließt die Fragestellung zugleich den möglichen Antworthorizont und den neuen Fragehorizont. Kurzum verweist die Fragestellung, hermeneutisch gesehen, auf den bestimmten Umfang unserer Erfahrung, d. h. auf eine bestimmte Sinnrichtung und eröffnet auch die mögliche Antwort, den offenen Spielraum, in dem das potenzielle Einverständnis gefunden werden muss. Die variable Sinnerschließung des Fragehorizonts im gesamten Verstehensvorgang betreffend, sagt Gadamer, „[…] ist die Vollzugsweise der Dialektik das Fragen und Antworten, oder besser, der Durchgang alles Wissens durch die Frage. Fragen heißt ins Offene stellen. Die Offenheit des Gefragten besteht in dem Nichtfestgelegtsein der Antwort.“ (GW. 1, S. 369) So gesehen zieht das Fragen nicht nur die Erschließung der möglichen Antwort, sondern auch das Andersverstehen und deshalb den neuen Sinnhorizont in Betracht, nämlich dass der tradierte Fremdsinn sich selbst nicht unbedingt ausschließlich durch die gesamte Rezeptionsgeschichte hindurch aufrecht erhält, sondern in der Begegnung mit jeder neuen Epoche sich immer wieder neu formiert. Wer beispielsweise eine Geschichte erzählt, der stellt die Geschichte mit seiner je eigenen Hervorhebung, Überspitzung und Verdrängung dar. So lange man verstehen will, taucht das Andersverstehen, das neue Verstehen, immer dann auf, wenn ein anderer Erzähler dieselbe Geschichte darbietet und auch dann, wenn derselbe Erzähler dieselbe Geschichte erzählt, da seine Erzählung immer schon nicht nur vom eigenen Interesse abhängt, sondern auch von den narrativen Umständen. Hier wird die Geschichte immer wieder anders und immer wieder neu verstanden, obwohl sie als eine geschichtliche Tatsache immer gleich geblieben ist. Eine eigene Frage zu stellen bedeutet daher, beide Fragehorizonte mit einzubeziehen: Die vom Anderen formulierte Frage und die unter der gegenwärtigen Fragesituation gestellte Frage. Sie führen nicht nur zur Nachfrage nach dem Vorhergegangenen, sondern erschließen auch die Andersartigkeit des Verstehens, die sich immer für das mögliche Neue offen hält. In diesem offenen Spielraum gestaltet sich das Verstehen immer wieder neu. Noch deutlicher gesagt, muss es anders sein und sich ständig neu zur Sprache bringen, so lange es existiert. In diesem ständigen Anderswerden liegt das neue Verständnis, das unter Umständen besser ist. Die hermeneutische Offenheit ist überdies in Gadamers Hermeneutik eines der höchsten Prinzipien der dialogischen Verstehenspraxis. Mit dem Bekenntnis der eigenen 235 Endlichkeit verlangt die Offenheit, Gadamers Ansicht zufolge, die Anerkennung des Anderen, ohne sich dessen Andersheit anzueignen. Aufgrund ihres eigenen Anspruchs an die Offenheit bleibt die hermeneutische Erfahrung stets für das Andere offen: Sie fordert uns zum einen auf, für die eigene Sinnerwartung auf die gegebene Antwort offen zu sein und zum anderen für eine mögliche Antwort offen zu sein. Diesem offenen Erwartungshorizont entsprechend legt die hermeneutische Offenheit auch einen bestimmten Sinnhorizont offen, d. h. sie setzt sich dem offenen Sinnfeld aus. Indem die hermeneutische Erfahrung ihre Endlichkeit und ihre geschichtliche Begrenztheit anerkennt, begibt sie sich unweigerlich in das Verhältnis zum Anderen hinein, sie macht damit die Erfahrung, dass das Andere einen unvorhersehbaren Sinngehalt bereits hält. An dieser Stelle lernt sie, für diese potenzielle Andersartigkeit offen zu sein und mit dieser Offenheit die Sinnerschließung geschehen zu lassen. So eröffnet die Fragestellung im dialogischen Verhältnis der hermeneutischen Erfahrung, Gadamer zufolge, eine bestimmte Sinnrichtung. Die Offenheit ist in zweierlei Hinsicht die Bedingung für die stets existierende Andersheit: Einerseits für das mögliche Andersverstehen bei der Textinterpretation, andererseits für den anderen Gesprächspartner im Dialog. In der dialogischen Verstehenspraxis wehrt sich daher die Frage gegen den Weg in die Sinnentleertheit, in die Sachlage ohne Ausweg. Die Offenheit im Fragen entlarvt auch die falsche Sinnentstellung, die durch das versteifte Festhalten am Vergangenen und Verstandeshorizont gestaltet wird, die sich aus der eigensinnigen Vormeinung bzw. aus der fixierten Voreingenommenheit ergibt. Aus diesem Grund hält sich die Frage in Gadamers Hermeneutik immer für den sinnvollen Aufschluss des anderen, daher neuen, möglichen Sinnhorizont offen. „Jede echte Frage“, so Gadamer, „verlangt diese Offenheit.“ (GW. 1, S. 369) Die hermeneutische Offenheit der Frage in der Gesprächssituation hat die konstitutive Fähigkeit, dass der eine seine dogmatische Eigensinnigkeit aufgibt und sich auf das Gespräch mit dem Anderen einlässt und dass der Andere seinen Sinnhorizont offen hält. Von diesem Punkt aus, fordert Gadamers Hermeneutik die Bereitschaft, sich für das Andere offen zu halten, sich also in die offen bleibende Zukünftigkeit hineinzuversetzen und immer weiter nach der unerschöpfbaren Wahrheit zu suchen. Diese Bereitschaft, für das Andere offen zu bleiben, stellt in Gadamers Hermeneutik das höchste Anerkennungsprinzip dar. Die Offenheit für das Andere bedeutet, auf den Anderen hören zu können und damit durch den selbstüberprüfenden Lernprozess auch das eigene Möglichsein aufzurollen. 90 Mit seiner Einsicht in die hermeneutische Offenheit sagt Gadamer: „[…] diese Offenheit ist am 90 Zum Sinnhorizont der hermeneutischen Selbsterkenntnis in der Logik von Frage und Antwort, vgl. Kap. I – 2 Hören auf das Ungesagte, das wir im Gesprächsverhältnis ständig aussagen wollen, vom III. Teil in dieser Arbeit. 236 Ende nicht nur für den einen da, von dem man sich etwas sagen lassen will. Vielmehr, wer sich überhaupt etwas sagen lässt, ist auf eine grundsätzliche Weise offen.“ (GW. 1, S. 367) In Bezug auf diese hermeneutische Offenheit können wir uns auch die Frage stellen, ob die Offenheit in Gadamers Hermeneutik lediglich eine moralische Forderung ist oder ob sie die ethische Grundlage für das menschliche Zusammenleben mit einschließt. Die Offenheit stützt sich, wie wir sahen, auf die wesentliche Anerkennung, dass einer im unabschließbaren Gesprächsprozess nicht nur auf den Anderen hören muss, sondern auch das Recht des Verstehenshorizontes des Anderen gelten lassen muss, da stets die Möglichkeit besteht, dass der Andere das Richtigere zur Sprache bringt und den angemessenen Sinnhorizont aufzeigt. Mit dieser Anerkennung des Sinnhorizontes des Gesprächspartners ermöglicht die Offenheit auch, Gadamer zufolge, dass einer seinen Verstehenshorizont ins reflexive Selbstverständnis im gemeinsamen „Ins–Gespräch–halten“ hineinführen kann, da das Verstehen im Grunde vom Bekenntnis der existenziellen Endlichkeit des menschlichen Daseins und von der Unerschöpfbarkeit der letzten Wahrheit ausgeht. Anders gesagt, muss man seinen möglichen Irrtum, nämlich sein eigenes Missverstehen–Können akzeptieren und deshalb für den Anderen immer offen sein, sich für das endlose Gespräch offen halten, wenn man seine Endlichkeit, seine geschichtliche Bedingtheit einsieht und sich dessen bewusst ist, dass der Sinnhorizont aus der unabschließbaren Sachwahrheit, aus der unauflöslichen Andersheit des Anderen her immer weiter und anders erschlossen wird. Um den Anderen richtig zu erreichen, um den Sachverhalt angemessen zu verstehen, müssen wir uns deshalb auf den offenen Spielraum des miteinander geführten Gesprächs einlassen, das angemessene Wort zu finden versuchen und den endlosen Weg vom basalen Stützpunkt aus über das Hören der verschiedenen Meinungen bis hin zur Gemeinsamkeitsbildung gehen. Gadamers Ansicht zufolge ist die hermeneutische Offenheit nicht nur eine Moralforderung ohne Inhalt, sondern vielmehr bildet sie selbst, die als hermeneutische Tugend verstanden werden soll, die ethische Grundlage für die „Bewegung des Anerkennens“ im Dialogverhältnis. „So kommt es am Ende darauf an“, wie Gadamer sagt, „daß überall Dialog gelingt, und das ist Austausch mit Worten, die gewiß noch von anderen Momenten begleitet werden, aber im gegenseitigen Austausch immer wieder Worte finden lassen, durch die man sich verständigen kann.“ 91 Aus diesem Grund kann man festhalten, dass die Gemeinschaftlichkeit, die der basalen Anerkennung der Menschen zugrunde liegt, ihre eigene Basis dort findet, wo wir im Dialogverhältnis den Anderen erreichen und uns selbst gelten lassen. Die gemeinschaftliche Solidarität als die einzige Grundlage 91 für das zwischenmenschliche Zusammenleben findet in Gadamers Gadamer, Hermeneutische Entwürfe, S. 53. 237 Dialoghermeneutik nur dort statt, wo das Gespräch zwischen den Menschen in Gang gesetzt wird und wo der Mensch sich mit dem Bekenntnis seiner eigenen begrenzten Endlichkeit ins Gespräch einbringt und die Angemessenheit sucht. Mit Gadamers Einsicht in den Aufbau des sozialen Zusammenlebens durch das Dialogverfahren können wir sagen, dass der Dialog, dem die Offenheit innewohnt, stets das verständigende Mitgehen mit dem Anderen leitet. 238 II. Die Zirkelbewegung und die Erwartung der Sinnganzheit Im vorigen Kapitel haben wir der ontologischen Grundlage der menschlichen Erfahrung in Gadamers Hermeneutik unsere Aufmerksamkeit geschenkt. Da waren für das hermeneutische Verstehen einerseits die Geschichtlichkeit, die das hermeneutische Bewusstsein in seine vorstrukturierte Standpunkteingebundenheit einbindet und andererseits die Offenheit, die aus diesem Bewusstsein der geschichtlichen Endlichkeit folgt, charakteristisch. Aus seiner geschichtlichen Erfahrung vollzieht sich das menschliche Verstehen im Zwischenraum von beiden betroffenen Polen, d. h. das Sinnverstehen geschieht immer im Rahmen des Wechselverhältnisses der beteiligten Komponenten. Von dieser Grundpolarität im hermeneutischen Verstehen ausgehend, die den Sinnereignischarakter ermöglicht, muss der grundlegende Anspruch auf gegenseitige Anerkennung in der zwischenmenschlichen Beziehung mit dem endlosen Zirkel zwischen dem Eigenen und dem Anderen sowie mit dem ganzen Sinnraum wieder gestartet werden, in dem sich die wechselseitige Bewegung entfaltet und die gegenseitige Verständigung als Telos dieser Bewegung gesucht wird. Aus dieser Perspektive heraus werden wir nun der Wechselseitigkeit des Anerkennungsverhältnisses und dem gesamten Sinnraum, der von der Wechselseitigkeit selbst gefordert und etabliert werden muss, unsere Aufmerksamkeit zuwenden. II – 1. Wagnischarakter im Verstehen: Die Hin– und Herbewegung zwischen dem Eigenen und dem Anderen Dem hermeneutischen Verstehen ist eine Zirkelstruktur im dynamischen Erfahrungsprozess eigen, durch den das Unbekannte, das zu Verstehende entdeckt und erfahren werden kann. Aus hermeneutischer Sicht zeigt sich die Zirkelstruktur als die allgemeine Grundstruktur der menschlichen Verstehenspraxis, da sich nicht nur die Textinterpretation, sondern auch das Verstehen als solches im zirkulären Verhältnis bewegt: Die Hermeneutik stellt deshalb fest, dass sich die menschliche Verstehenspraxis in der zirkulären Interaktionsbeziehung zwischen den Beteiligten vollzieht. Auf dieser Ebene kann ein reflexiver Überprüfungsprozess durchgeführt und der eigene Sinnhorizont gewonnen werden. So betrachtet, wird die Zirkelstruktur zur unentrinnbaren Rahmenbedingung, die die Verstehenspraxis überhaupt erst möglich macht. Wenn wir uns nun dem Zirkelphänomen in der menschlichen Verstehenspraxis näher zuwenden, werden wir sehen, dass der jeweilige Sinnentwurf, der 239 jedem Verstehensvorgang zugrunde liegt und auf den der Verstehensprozess bezogen ist, durch den Zirkel selbst ermöglicht wird, indem im freien Spielraum sämtliche Möglichkeiten von den interaktiv beteiligten Perspektiven selbst hergestellt werden. Der hermeneutische Zirkel, der als „die hermeneutische Regel“ in der romantischen Hermeneutik bezeichnet wurde, wurde Gadamers Ansicht zufolge, bereits in der antiken Rhetorik als die Hin– und Herbewegung zwischen dem Ganzen und dem Teil im jeweiligen Verstehensakt erklärt. (GW. 1, S. 179) Dies besagt: Man muss das Ganze vorher verstehen, wenn man das Teil verstehen will. Und umgekehrt muss man das Teil vorher verstehen, wenn man das Ganze verstehen will. Da das ‚Vorher’ hier nicht nur die logische und zeitliche Vorweggenommenheit im Verstehensvorgang, sondern auch das ontologische Primat des menschlichen Verstehensaktes impliziert, ist der hermeneutische Zirkel aus hermeneutischer Sicht endlos und unauflösbar. Dennoch ist auch klar, dass die zirkuläre Unendlichkeit selbst eine Produktivität in dem Sinn aufweist, dass sich das Verstehen im Zwischenraum des wechselseitig ineinander Übergehens, sozusagen im interpersonalen Spannungsfeld zwischen den Dialogteilnehmern, jeweils neu bildet. Schleiermacher machte schon den unendlichen Zirkelcharakter des menschlichen Verstehensaktes bewusst, obwohl er die Unauflösbarkeit der Zirkelbewegung im Verstehensprozess mit dem Postulat des wissenschaftlichen Wissens, eines so genannten objektivierbaren Wissens, überwinden wollte. Er sagt: „Auch innerhalb einer einzelnen Schrift kann das Einzelne nur aus dem Ganzen verstanden werden, und es muss deshalb eine kursorische Lesung, um einen Überblick des Ganzen zu erhalten, der genaueren Auslegung vorangehen.“ 92 Demzufolge durchläuft die menschliche Verstehenspraxis im Textverstehen den zirkulären Erfahrungsprozess vom Vorabentwurf einer Sinnganzheit über die Erprobung der Antizipationsdimension zur anvisierten Übereinstimmung. In der interaktiven Zirkelbewegung bringen wir also unsere Vorannahme in die gesamte Sinnbewegung ein und suchen nach einer Übereinstimmung, die in jeder vorläufigen Phase der hermeneutischen Erfahrung erwartet wird. Bevor ich in Gadamers intersubjektive Anerkennungsstruktur der Zirkelbewegung der menschlichen Erfahrungen einführe, möchte ich zunächst kurz Heideggers Auffassung von der Zirkelstruktur als existenzieller Seinsweise des Daseins skizzieren. Bei Heidegger ist die hermeneutische Zirkularität nicht circulus vitiosus, formallogisch betrachtet der mangelhafte Zirkel, sondern sie gewinnt einen „ontologisch positiven Sinn.“ (GW. 1, S. 271) Gadamer 92 Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, S. 97. Sein Postulat des vollkommen wissenschaftlichen Wissens würde auffallen, wenn wir hier andere Textstellen einführten. Diesbezüglich sagt er: „Überall ist das vollkommene Wissen in diesem scheinbaren Kreisen, daß jedes Besondere nur aus dem Allgemeinen, dessen Teil es ist, verstanden werden kann und umgekehrt. Und jedes Wissen ist nur wissenschaftlich, wenn es so gebildet ist.“ Ebd. S. 95. 240 zufolge hat Heidegger in seiner Existenzialhermeneutik die Zirkelbewegung im Verstehen erstmals als die Grundstruktur des Sich–Verstehens und des Sich–Auslegens des menschlichen Daseins aufgefasst. Wenn wir hier im Hinblick auf die Zirkelstruktur z. B. die Begründungsproblematik in der formalen Beweisführung der Logik ins Auge fassen, dann hat die Begründung in der logischen Denkform selbst einen logischen Mangel, d. h. den schlechten Zirkel zwischen Begründendem und dem Begründeten. Das bedeutet: Um zu begründen, wird hier das Begründende, wie Hegel bereits sah, vom Begründeten als das Begründende bewiesen. In diesem Fall ist das Begründete selbst das Begründende gegenüber seinem Begründenden. Mit anderen Worten: Im schlechten Zirkel wird das Begründende vom Begründeten begründet. Und umgekehrt kann das Begründete ohne das Begründende auf keinen Fall zuvor begründet werden, da das Begründete als das zu Begründende nur vom Begründenden begründet werden kann. Damit gilt die logische Zirkelform, formallogisch betrachtet, als Fehler, als Mangel, der deshalb logisch überwunden werden muss. Aber bei Heidegger ist die hermeneutische Zirkularität kein logischer Fehlschluss, sondern die unentrinnbare ontologische Struktur des Verstehens. In der Hermeneutik geht es deshalb nicht darum, wie der Zirkel im logischen Beweisgang vermieden werden kann, sondern es handelt sich darum, wie wir als Verstehende mit der Zirkelstruktur als „Struktur des Sinnes“ 93 in der richtigen, produktiven Weise umgehen können. Diese unaufhebbare Zirkelstruktur des Verstehens betreffend sagt Heidegger: „Das Entscheidende ist nicht, aus dem Zirkel heraus-, sondern in ihn nach der rechten Weise hineinzukommen. Dieser Zirkel des Verstehens ist nicht ein Kreis, in dem sich eine beliebige Erkenntnisart bewegt, sondern er ist der Ausdruck der existenzialen Vor– Struktur des Daseins selbst.“ 94 Heideggers Ansicht zufolge hat das menschliche Dasein überhaupt „eine ontologische Zirkelstruktur,“ 95 da es sich mit der vorstrukturierten Geworfenheit auf seine Zukünftigkeit entwirft und es sich im Rückzug zu seinem Geworfensein auslegt: Das Dasein ist existenziell in diese Zirkelbewegung von Geworfenheit und Entworfenheit eingebettet, so lange wie es sich um seine Seinsmöglichkeit sorgt. Die Zirkelstruktur im Verstehen gilt Heidegger mithin nicht als circulus vitiosus, sondern als die einzige Zugangsmöglichkeit zur Welt, sofern das Dasein im Grunde das In–der–Welt–Sein ist. In Gadamers Hermeneutik steht die Zirkelstruktur des Verstehens zunächst näher an der hermeneutischen Tradition, gewissermaßen näher an Schleiermachers Auffassung von der Zirkularität in der Textinterpretation, während die Zirkelformel bei Heidegger die 93 Heidegger, Sein und Zeit, S. 153. Ebd. 95 Ebd. 94 241 Konsequenz der ontologischen Analytik des existenziellen Daseins ist. Heidegger richtet seinen Blick grundsätzlich auf die existenzielle Sorgestruktur des menschlichen Daseins. Aus seiner Sicht betrachtet, liegt das Dasein als das Selbstverständnis im Zirkel zwischen der Verborgenheit und der Entworfenheit. Bei Heidegger wird dieser Zirkel deshalb als die Seinsstruktur des menschlichen Daseins, das sich selbst versteht und sich selbst auslegt, bezeichnet: Das Dasein lässt sich selbst mit dem voreingenommenen Selbstentwurf auf seine Seinsmöglichkeit ein und setzt hier die Verständlichkeit seines Selbstentwurfs voraus. Gleichzeitig führt das Selbstverständnis des Daseins auf die Selbstauslegung zurück. Die Selbstverständlichkeit bestätigt sich deshalb durch das zum Geworfensein zurückkehrende Auslegen, d. h. sie bildet sich selbst nur in diesem Auslegen. Gadamer nimmt zwar Heideggers Grundeinsicht in die ontologische Zirkelstruktur der Seinsweise des menschlichen Daseins auf, aber geht zunächst von der allgemeinen Zirkelbewegung im Textverstehen aus und rückt dabei auch die universale Zirkelbewegung in der dialogischen Verstehensweise, sozusagen den unendlichen Austausch von der Rede und der Gegenrede, ins Zentrum. Anders gesagt, steht Gadamer unter dem Einfluss der Heideggerschen Grundidee, dass die ontologische Zirkelstruktur des menschlichen Daseins die unaufhebbare Grundstruktur des Verstehens sei und wir ihr deshalb nie entrinnen können. Gadamers Einsicht beharrt jedoch darauf, dass das zirkuläre Hin und Her im hermeneutischen Verstehen ein dialogisches Sinnfeld etabliert, in dem der freie Verhaltensspielraum von den Beteiligten am Gespräch durch den Rollentausch zwischen dem Sprechen und dem Hören offen gelassen wird. Man kann sagen, dass die Zirkularität im Verstehensvorgang in Gadamers Dialoghermeneutik im Prinzip der Grundmodus der menschlichen Erfahrung, sozusagen die zwischenräumliche Wechselseitigkeit ist: Wenn seine Hermeneutik ihre Aufgabe im Verstehen des Anderen sieht und wenn dieses Verstehen sein Grundelement im dialogischen Verstehensmodell findet, lässt sich die Zirkelbewegung selbst über die Zirkulation im Textverstehen hinaus auf das praktische Gesprächsverhältnis übertragen, in dem sich die vernetzte Sinnganzheit des lebensweltlichen Verständigungsversuches bewegt. Innerhalb dieser zirkulären Hin- und Herbewegung bezieht sich das Verstehen einerseits auf die je eigene Antizipation von Sinn und andererseits auf den Ansprechpartner: In diesem oszillierenden Bezugsfeld treten seine inneren Tiefenschichten hervor. Von daher ermöglicht das gesamte Sinnnetzwerk nunmehr nicht nur die angemessene Distanzhaltung zum Anderen, sondern es bildet auch das jeweilige Einverständnis zwischen den Beteiligten aus. Die hermeneutische Zirkularität in Gadamers Hermeneutik hat m. E. deshalb nicht nur mit dem „Wagnischarakter“ des menschlichen Verstehens zu tun, sondern sie zeigt sich auch als das gesamte Sinnfeld von „Verbindlichkeit 242 und Freiheit,“ 96 von teilnehmendem Bezugspunkt und freier Eigenartigkeit in jedem Verstehensvorgang. An dieser Stelle fasst Gadamer den Horizont der Sinnganzheit als einen leitmotivischen Wegweiser für die wechselseitige Zirkelbewegung in der menschlichen Erfahrung ins Auge. Auf dem Weg von der vorstrukturierten Sinnerwartung zur Entdeckung eines neuen Sinns, also auf dem Weg der Erprobung dieser Sinnvorentwürfe mit dem ständigen Blick auf eine jeweilige Sinnganzheit, d. h. auf den vorläufigen Sinnvollzug, erarbeitet das Verstehen einen Sinnhorizont, den es permanent erweitert. Das bedeutet: Die menschliche Verstehenspraxis richtet sich ständig in der hin- und herbewegenden Zirkulation auf das zu Verstehende, aber sie kehrt mit dem Verstandenen zugleich auch zum eigenen Sinnhorizont zurück. In diesem Kreislauf verändert und erweitert sich ihr Sinnhorizont. Im Hinblick auf die innere Selbstbildung einer Sinnganzheit in der hermeneutischen Zirkelbewegung sagt Gadamer: „So läuft die Bewegung des Verstehens stets vom Ganzen zum Teil und zurück zum Ganzen. Die Aufgabe ist, in konzentrischen Kreisen die Einheit des verstandenen Sinnes zu erweitern. Einstimmung aller Einzelheiten zum Ganzen ist das jeweilige Kriterium für die Richtigkeit des Verstehens.“ (GW. 1, S. 296, meine Hervorhebung) Mit diesen Sätzen sieht Gadamer in der hermeneutischen Aufgabe nicht nur die Erweiterung zu einem Horizont von Sinnganzheit, sondern es wird auch deutlich, dass Gadamer aus der sich wechselseitig bedingenden Zirkulation das Wahrheitskriterium für das Verstehen herauszufinden versucht. Seiner Ansicht nach soll sich die endlose Wahrheitssuche einerseits an dem vorübergehenden Sinnvollzug, andererseits an den vorläufig von uns gestalteten Sinnentwürfen abarbeiten. Gleichzeitig wird mit Gadamers Hermeneutik deutlich, dass auf ein allgemeingültiges, von den jeweiligen Perspektiven unabhängiges Wahrheitskriterium als solches verzichtet werden muss. Wir können uns hier Gadamers kritische Auseinandersetzung mit dem Objektivismus und dem Fortschrittsglauben in Erinnerung rufen. In dieser Kritik Gadamers wurde der Maßstab für ein Urteil, das auf jeden Fall ewig wiederholbar und allgemeingültig sein sollte, infrage gestellt. Im Verstehensprozess verzichtet Gadamer auf dieses Wahrheitskriterium. 97 Aber er sieht das „jeweilige“ Kriterium auf unserer unendlichen Wahrheitssuche darin, dass es auf jeder vorläufigen Stufe zu einer Übereinstimmung zwischen den am Verstehensprozess Beteiligten kommt. Gadamers Ansicht zufolge verweist dieses Kriterium in der hermeneutischen Zirkelbewegung darauf, dass es sich selbst im Hin 96 Zur hermeneutischen Zirkelstruktur als einem freien Spielraum der Interpretationen. Vgl. G. Figal, Für eine Philosophie von Freiheit und Streit. Politik – Ästhetik – Metaphysik, Stuttgart/Weimar 1994, S. 7 – 19, hier bes. S. 11. 97 Zum Problem des Wahrheitskriteriums vom Gesichtspunkt der hermeneutischen Wahrheit aus betrachtet. Vgl. J. Grondin, Hermeneutische Wahrheit?, S. 176 – 180. 243 und Her des dialogischen Verstehensvorgangs befindet. Darüber hinaus machen die geltenden und gestaltenden Regeln ihren Anspruch im prozessualen Verfahren, d. h. in ihrer Anwendung auf die alltägliche Lebenswelt, geltend. Die Wahrheits– und die Welterfahrung kommen weder durch das vorbestimmte Wahrheitskriterium für das Urteil, noch durch die vorgegebenen Handlungskategorien zustande, sondern werden aus der geschichtlichen Verstehenspraxis gewonnen, in deren Licht die konventionellen Sitten und die gesellschaftlichen Spielregeln ständig auf die lebensweltlichen Lebenszusammenhänge als dem lebendigen Sinnraum angewendet und zugleich mit dieser Anwendung immer neu wirksam werden. Indem die sich stets entwickelnde Wahrheitssuche im lebendigen Sinnraum für die Konzeption der hermeneutischen Wahrheit charakteristisch ist, bleibt „die Wahrheitsmöglichkeit“, mit Gadamers Worten, immer „in der Schwebe – solches In–die– Schwebe–bringen ist das eigene und ursprüngliche Wesen des Fragens.“ (GW. 1, S. 380) Im Anschluss an Gadamers Einsicht in diesen wechselseitigen Dialograhmen können wir nunmehr das intersubjektive Anerkennungsverhältnis im endlosen Zirkel zwischen Ich und Du in unsere Diskussion mit einbeziehen. Die hermeneutische Zirkelbewegung als solche zeigt sich als Ausbildung eines Sinnhorizontes im Dialogverhältnis von Frage und Antwort. Dieses Hin und Her der dialogischen Frage–Antwort–Beziehung impliziert geradezu die wechselseitige Zirkelbewegung der zwischenmenschlichen Anerkennung, in deren Beziehung jeder die Distanz zu seinem Anderen erfährt und den Anderen als seinen Gesprächspartner annimmt. Anders formuliert, entsteht die wechselseitige Anerkennungsbeziehung aus der intersubjektiven Zirkelstruktur, also aus der dialogischen Verkehrsform. In der dialogischen Zirkelbewegung der wechselseitigen Anerkennung gelangt jeder Beteiligte zunächst und unmittelbar zu der Erkenntnis der Differenz zu seinem Anderen. Somit erfährt er auch, dass sein Anderer immer als Auslöser für seine eigene Reaktion in dieser gegenseitig verflochtenen Handlungsbeziehung agiert. Im Hinblick auf die Erfahrung der Distanz voneinander und auf die anerkennende Annahme des Anderen als Anderer ist der Andere nicht mehr ein aufzuhebender Bestandteil in der zirkulären Anerkennungsbewegung, sondern er besitzt einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert in der möglichen Erfahrung der intersubjektiven Anerkennung. So gesehen führt die Erfahrung des Anderen zum Eingeständnis der eigenen Grenzen aller Beteiligten, da sich das Bewusstsein vom Anderen im miteinander verschränkten Zirkel einerseits auf die unaufhebbare Andersheit des Anderen, nämlich auf die unauflösliche Distanz stützt, und andererseits jedem Beteiligten dadurch die Selbstbesinnung auf seine Eigenheit ermöglicht. Die Zirkelbewegung der intersubjektiven Anerkennung bewegt sich in dieser endlosen Wechselseitigkeit zwischen der unaufhebbaren 244 Distanz und der einverständlichen Anerkennung des mitspielenden Anderen. So gesehen macht die intersubjektive Zirkelbewegung den ganzen Sinnraum des wechselseitigen Anerkennungsverhältnisses aus. Der Spielraum im Hin und Her des dialogischen Austauschs bietet die Möglichkeit, sich auf den Fremdsinn zu beziehen und sich zum Anderen zu verhalten. Auf diesem Bezugspunkt bauen wir auch die Hoffnung auf die potenzielle Übereinstimmung in dem Im– Gespräch–halten auf. Indem unsere Verstehenspraxis in der ständigen Zirkulation in Bezug auf den wahrheitstragfähigen Sachsinn nicht nur auf den Anderen angewiesen ist, sondern auch ihren eigenen Sinnhorizont ständig neu erschließt, gewinnt sie auch den nötigen Freiraum, sich auf den oszillierenden Prozess von Gegensätzlichkeit und gegenseitiger Verflechtung einzulassen und zu einer möglichen Gemeinsamkeit auf der endlosen Wahrheitssuche, die durch die interaktive Beziehung zustande kommt, zu gelangen. Hier wird deutlich, dass das hermeneutische Verstehen in diesem Bewusstsein des gegenseitigen Angewiesenseins einem einheitlichen Sinnganzheitshorizont näher kommt. Dementsprechend kann Gadamers Einsicht in die hermeneutische Zirkelbewegung durchaus als die „>>holistischere<< Auffassung des Verstehens“ 98 bezeichnet werden. In Gadamers Hermeneutik bildet der vorgreifende Sinnentwurf der Sinnganzheit jedoch keinesfalls das abgeschlossene Ende, sondern diese Sinnganzheit tritt der jeweiligen Verstehenslage entsprechend immer wieder neu in Erscheinung. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Ganzheit in Gadamers Hermeneutik ein offenes Ganzes ist. Es liegt für Gadamer auf der Hand, „daß das Verständnis des Textes von der vorgreifenden Bewegung des Vorverständnisses dauerhaft bestimmt bleibt. Der Zirkel von Ganzem und Teil wird im vollendeten Verstehen nicht zur Auflösung gebracht, sondern im Gegenteil am eigentlichsten vollzogen.“ (GW. 1, S. 298) So gesehen sind wir immer schon in die zirkuläre Sinnbewegung der wechselseitigen Wirkung eingebettet und finden zugleich durch unsere Selbsteinstellung zu dieser Hin und Herbewegung das vorläufige Sinnganze. Aus hermeneutischer Sicht befindet sich der Sachverhalt selbst nur in unserem begrenzten Blickwinkel: Unsere Perspektive ist von vornherein auf einen bestimmten Standpunkt beschränkt, sofern unser Sehen in eine bestimmte Blickrichtung mit dem Sachverhalt konfrontiert ist. Durch diese Teilnahme an der zirkulären Gesamtsinnbewegung vollzieht sich das Verstehen, Gadamers Ansicht zufolge, „am eigentlichsten.“ Hierin hat der hermeneutische Sinnvollzug, der sich in der ständigen Zirkelbewegung als dem freien Verhaltensspielraum von Eigenem und Anderem auftut, seine jeweilige Eigenheit. 98 Ders., Einführung zu Gadamer, S. 131. 245 Die bisherigen Überlegungen hier zusammengefasst, findet unsere Verstehenspraxis in einer notwendigen Zirkelbewegung statt. Anders formuliert, bewegt sie sich im gesamten Sinnnetzwerk, an das die Beteiligten dialogisch und intersubjektiv gebunden sind. Das intersubjektive Zirkelverhältnis prägt den dialogischen Zwischenraum, in dem wir die Distanz zum Anderen erkennen und zu der Verbindlichkeit, die auf dieser Erkenntnis beruht, gelangen. Demzufolge bewahrt die menschliche Verstehenspraxis beständig das zirkuläre Wechselverhältnis auf ihrem ganzen Weg von der Einstellung des Erwartungshorizontes über die Explikation des Verstandenen zur Überprüfung vom Verstandenen im sich bildenden Verstehensprozess, so lange wie sie sich ihren Weg mit dem vorgreifenden Sinnerwartungshorizont bahnt. Die zirkuläre Hin- und Herbewegung ist daher, wie Gadamer sagt, „ein ontologisches Strukturmoment des Verstehens.“ (GW. 1, S. 298 – 299) Davon abgesehen tritt unsere Verstehenspraxis deshalb ins Gespräch mit dem Anderen ein, weil sie vom Sinnerwartungshorizont, sozusagen von der Hoffnung auf das Einverständnis, die bei Gadamer begrifflich als „Vorgriff der Vollkommenheit“ bezeichnet wurde, ausgeht. In diesem Ins–Gespräch–eintreten zeigt sich die Konfrontation des Sinnerwartungshorizontes mit dem wahrheitstragfähigen Sinngehalt auch als ein zirkulärer Horizont einer Sinnganzheit. Um zu einer Übereinstimmung im endlosen Zirkel zu gelangen, muss sie das Vertrauen zur vollkommenen Wahrheit des Fremdsinnes, sozusagen zum auffordernden Wahrheitsanspruch des Anderen, vorweg nehmen. Denn der Andere hat seinen Anteil an diesem Sinnfeld des zu Verstehenden und spielt eine mitkonstitutive Rolle. Nur in dieser wechselseitig aufeinander wirkenden Zirkelbewegung kann unsere Verstehenspraxis das Missverständnis, sozusagen die dogmatische Naivität, dauerhaft überwinden und vermeiden. So gesehen, konstruiert die hermeneutische Zirkelbewegung selbst im gesamten Bildungsprozess einen zirkulären Sinnganzheitshorizont, in dem die Beteiligten aufeinander treffen, sich zueinander verhalten und miteinander eine Übereinstimmung in der Sache suchen. 246 II – 2. Der Sinnhorizont der Erwartung auf den Sinnvollzug Gadamer hat der hermeneutischen Zirkularität zunächst seinen eigenen Begriff , nämlich den „Vorgriff der Vollkommenheit“ gegeben. Damit versucht er den Sinnhorizont der Wahrheitserwartung im Gefüge der hermeneutischen Zirkelbewegung sichtbar zu machen. Aus der hermeneutischen Zirkelbewegung betrachtet, umschließt die Vollkommenheit begrifflich die Vollständigkeit einer Sinnganzheit, gewissermaßen den Möglichkeitshorizont der vollkommenen Wahrheit, den der, der verstehen will, als das Telos des Verstehens beständig anstrebt. Wenn die Vollkommenheit als Beziehung zwischen dem Ganzen und seinem Teil betrachtet wird, soll sie das Teil nicht übrig lassen, sondern so in sich aufnehmen, dass es im Rahmen eines Sinngefüges integriert ist. Wenn Gadamer von der „Vollkommenheit“, d. h. vom Sinnvollzug im Verstehen spricht, steht seine Einsicht zunächst unter folgender Perspektive: Der Wahrheitssuchende besinnt sich auf die Unerreichbarkeit eines vollendeten Letzten, wird sich also seiner Endlichkeit bewusst. Trotz dieser Erfahrung hält er jedoch an der inneren Tendenz zur Vervollkommnung, d. h. am unendlichen Streben, das dem vollständigen Unendlichen, nämlich der vollkommenen Wahrheit näher kommen will, fest. Der Entwurf einer Vollkommenheit des Sinns hat damit eine steuernde Funktion im interaktiven Verstehensvorgang, da er die Sinnrichtung bestimmt, d. h. der Verstehenspraxis eine ursprüngliche Motivation verleiht. In der Erwartung einer vollkommenen Übereinstimmung spielt der Entwurf deshalb auch die Rolle eines motivierenden Anfangspunktes. Daran anschließend hat die vorgreifende Sinnerwartung an die Sinnerfüllung hier mit dem hermeneutischen Bewusstsein von der Endlichkeit zu tun. Bei dem Vorgriff auf die Vollkommenheit handelt es sich jedoch um keine so genannte transzendentale Kontrollinstanz, nach der ein vorher bestimmtes Ziel gesetzt wird, sondern sie bezieht sich in Gadamers Hermeneutik auf den Erwartungshorizont des Wahrheitssuchenden, nämlich seine Teilnahme am Wahrheitsgeschehen. Dem Wahrheitssuchenden steht stets die vollkommene Sinnganzheit, der Vorgriff auf die Wahrheit, gegenüber. Mit diesem Vertrauen in das Wahrheitsgeschehen begeben wir uns mitten in die hermeneutische Anstrengung hinein, verstehen zu wollen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die erwünschte Wahrheit, die prinzipiell unerreichbar, aber ständig im Auge behalten werden soll, „das Sein zur Wahrheit“ als die nötige Voraussetzung für die Verstehenspraxis ist. 99 Nun hoffe ich im Folgenden, dass wir einige Antworten auf die Frage finden können, welche Rolle der Vorgriff der Vollkommenheit bei Gadamer in Bezug auf die hermeneutische Wahrheitsfrage spielt, da 99 Ders., Hermeneutische Wahrheit?, S. 139ff. 247 die Rede von der Vollkommenheit die „regulative Idee“ für das richtige Verstehen oder die Idee von der Vollendung der Wissenschaften in sich zu verbergen scheint. Dies widerspräche jedoch der These, die hermeneutische Wahrheitsfrage sei von vornherein von der Kritik am Ideal der Wissenschaftlichkeit, der fundamentalen Subjektivität, ausgegangen. Wohin also führt der vorgreifende Erwartungshorizont, der von jedem Beteiligten im dialogischen Wechselspiel aufgestellt wird? Zunächst will ich auf den Wahrheitsbegriff in Gadamers Hermeneutik zurückkommen, bei dem vor allem darauf zu achten ist, dass seine Freilegung der Wahrheitsfrage einen musterhaften Modus der Normenbildung als Handlungswegweiser in der geschichtlichen Auseinandersetzung mit den überlieferten Konventionen umfasst. Die hermeneutische Wahrheit ist, wie wir bereits sahen, eine geschichtliche. Aus hermeneutischer Sicht verändert sich der Wahrheitsbegriff selbst unter den geschichtlichen Bedingungen, in deren Verlauf wir als beständige Wahrheitssuchende unsere Erfahrungen machen und uns selbst bilden. Aus dieser hermeneutischen Einsicht in die Geschichtsabhängigkeit der menschlichen Erfahrungen heraus betrachtet, ist der Wahrheitsanspruch der geschichtlichen Überlieferung und des Anderen für jede sinnvolle Verstehenspraxis unentbehrlich. Indem die Wahrheit als solche nunmehr auf die Geschichtlichkeit als ihre Bedingung verwiesen ist, ist sie nicht mehr ein ewig Selbiges, die vordefinitive Allgemeingültigkeit oder der demonstrative Anspruch auf den vorbestimmten Endzweck, sondern sie hält mit dem geschichtlichen Wandel Schritt. Die beständige Annäherung an den Sinnvollzug, an das Wahrheitsgeschehen, erhebt deshalb nicht mehr das Postulat auf einen letzten Konsens, da dieser selbst eine endgültige Korrespondenz voraussetzen würde und damit auch auf der Grundlage des regulativen Prinzips die systematische Einheit der vielfältigen Erkenntnisformen aufzubauen versuchen würde. Mit Apel gesagt, hat die „regulative Idee“, die er im Anschluss an Kant und Peirce unter seiner Konzeption der „transzendentalen Hermeneutik“ in den Vordergrund rückt, in der idealen Sprachgemeinschaft ihre normative Kraft. Und sie setzt sich zu ihrem Ziel, dass das bessere, richtigere Verstehen, nämlich das „kreative“ Verstehen geleitet, garantiert und die Wahrheit transparent vor Augen geführt werden soll. Die regulative Idee fungiert in ihrer transzendentalen Hermeneutik deshalb als ein Grundelement der zweckmäßigen Verständigung. Bei ihr kommt es grundsätzlich darauf an, einen normativen Prüfstein für die Richtigkeit bereitzustellen. 100 Die hermeneutische Erfahrung hingegen ist aus Gadamers Sicht 100 Apel hat mit seinem kritischen Vorwurf gegen Gadamer versucht, die hermeneutische Verstehenspraxis am Leitfaden der regulativen Idee, die eine völlige Übereinstimmung mit der idealen Sprachgemeinschaft bilden muss, zu gewährleisten. Hierbei bewegt sich das Ideal des Fortschritts der Verstehenspraxis zum letzten Zweck, den man fast eine ideale Utopie nennen könnte, in seiner Konzeption mit. Später hat er allerdings selbst seine frühere Konzeption leicht verändert und dabei betont, dass die regulative Idee für eine normative 248 von den geschichtlichen Kontexten abhängig. Aufgrund ihrer interaktiven Kontextabhängigkeit hört die menschliche Verstehenspraxis auf, die letztbegründete Bedingung für eine endgültige Wahrheit zu garantieren und eine solche vorher bestimmte Teleologie zu verfolgen. Aus hermeneutischer Sicht bringt die Wahrheit sich vielmehr selbst unter den sich ständig verändernden Situationen zur Sprache. Sie wird damit zu einem geschichtlichen Produkt, da der hermeneutische Wahrheitsbegriff seine geschichtliche Vermitteltheit und das produktive Wahrheitsmoment des Andersverstehens im endlosen Verlauf der menschlichen Geschichte anerkennt. Eine solche hermeneutische Wahrheitsauffassung ist geradezu mit der Anerkennung der unabschließbaren Erschließung der Sinnpotenzen im offenen Verstehensprozess verknüpft. Die Offenheit für künftige Sinnmöglichkeiten und die notwendige Erwartung eines Wahrheitsgeschehens orientieren sich nicht mehr an einem bestimmten Vorgegebenen, auf das sich alle Verstehensvorgänge reduzieren, sondern sie finden und arbeiten durch die jeweilige Konfrontation mit dem geschichtlich Vorgegebenen das vorläufige Wahrheitsmoment heraus, das die orientierende Handlungsnormenbildung diachron in der interaktiven Auseinandersetzungen und synchron im intersubjektiven Anerkennungsverhältnis gewährleistet. Gadamers Einsicht in den Vorgriff der Vollkommenheit hat entscheidend zu dieser hermeneutischen Wahrheitskonzeption beigetragen. In der hermeneutischen Anstrengung der Suche nach der Wahrheit, dem Sinnganzen, zeigt sich der Wahrheitsbezug im gesamten Verstehensvorgang als jeweils gleichbleibend: Einerseits die Verlässlichkeit auf den gemeinten Sinn, nämlich das Vertrauen auf den Wahrheitsanspruch des Anderen, andererseits der eigene Erwartungshorizont des Verstehenden. Diese beiden Komponenten schließen bereits auch die Voraussetzung für den Sinnvollzugs mit ein, der sich selbst ins Spiel bringt. Hier können wir uns diese Struktur anhand einer alltäglichen Gesprächssituation verdeutlichen. Damit ich die Schilderung eines Anderen, meines Gesprächspartners, verstehen und ein Gespräch mit ihm führen kann, muss ich von vornherein darauf vertrauen, dass er der Sache nach die Wahrheit sagt und übermittelt. Damit erkenne ich an, dass er zumindest in diesem bestimmten Fall der Sache näher gestanden hat, wenn ich an dieser Geschichte selbst nicht beteiligt bin. Mit dieser Erwartung an die Verlässlichkeit des Anderen kann ich nun meinen Entwurf eines Sinnhorizontes entwickeln. Mit anderen Worten: Ich muss mit meinem Blick nun einen Wahrheitshorizont entwerfen, der mir für jede Phase des Verstehens das Hermeneutik ein „nötiges und notwendiges Postulat“ sei, deshalb keinesfalls auf eine „Utopie der völligen Transparenz“ abziele. Vgl. Apel, Transformation der Philosophie I, S. 52 – 76 und ders., „Regulative Ideen oder Wahrheits–Geschehen? – Zu Gadamers Versuch, die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit gültigen Verstehens zu beantworten“, in: ders., Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendental– pragmatischen Ansatzes, Frankfurt a. M. 2002, S. 571 – 588. 249 Leitmotiv gibt. Ohne die vorausgesetzte Verlässlichkeit hinsichtlich meines Gesprächspartners kann die gesuchte Verständigung im Gespräch nicht zustande kommen. Denn ein Verdacht gegenüber dem Gesprächspartner führt notwendig zum Abbruch des Gesprächs, zur Gesprächsverweigerung. Ganz anders ist es, wenn wir seinem Wahrheitsanspruch vertrauen. Unter dieser Voraussetzung können wir das Gespräch nicht verweigern, weil wir in eine bestimmte Gesprächssituation eingebettet sind. Denn die Gesprächssituation selbst zwingt uns bereits zum Sprechen und Hören. Andernfalls wäre die Beurteilung, ob die Darbietung meines Gesprächspartners richtig oder falsch ist, unmöglich, wenn ich an der Erzählung von der erfahrenen Geschichte meines Gesprächspartners weder teilnehmen, noch die Sachwahrheit herausfinden wollte, die sich nur im Prozess des Gesprächs herstellt und offen gelegt werden kann. Die mögliche Einschätzung der Richtigkeit des Verstehens kann, hermeneutisch betrachtet, nur in dem vielschichtigen Gesprächsprozess, der selbst die Geschichte der eigenen Erfahrung bildet, gefunden werden. So gesehen muss ich meinem Gesprächspartner die Verlässlichkeit zubilligen und meinen vorausgesetzten Sinnvorentwurf aufs Spiel setzen, so lange ich verstehen will, was mein Gesprächspartner gesagt hat und sagen will. Denn die Bereitschaft, sich auf den Anderen einzulassen, sich ins Gespräch mit dem Anderen hineinzuversetzen und dabei zu bleiben, ist die einzige Möglichkeit für die menschliche Verstehenspraxis. Mit dieser offenen Bereitschaft müssen wir deshalb, Gadamer zufolge, auf die Wahrheit warten und uns immer für das sich offenbar machende Wahrheitsgeschehen offen halten. Seiner Ansicht nach sind wir immer schon im freien Spielraum, wenn wir die Wahrheit suchen und mit der Sachwahrheit umgehen. Auf diese Wahrheitserwartung, unsere Wahrheitssuche, bezieht sich der Vorgriff der Vollkommenheit in Gadamers Hermeneutik. Der Vorgriff der Vollkommenheit als der erwünschte Wahrheitshorizont ist in Gadamers Augen eine leitmotivische Sinnrichtung im Zugang zur Welt, unter der die Verstehenspraxis stattfindet und sich ihren Weg bahnt. „Der Vorgriff der Vollkommenheit“, wie Gadamer sagt, „der all unser Verstehen leitet, erweist sich mithin selber als ein jeweils inhaltlich bestimmter. Es wird nicht nur eine immanente Sinneinheit vorausgesetzt, die dem Lesenden die Führung gibt, sondern das Verständnis des Lesers wird auch ständig von transzendenten Sinnerwartungen geleitet, die aus dem Verhältnis zur Wahrheit des Gemeinten entspringen.“ (GW. 1, S. 299, meine Hervorhebung) Hier müssen wir besonders darauf achten, dass Gadamer in dieser Passage nicht von „transzendental“, wie im Falle O. Apels, sondern von „transzendent“ spricht. Hier liegt Gadamers Intention m. E. nicht in der exakten Erstellung transzendentaler Begriffe, sozusagen der apriorischen Kategorien, die Kant als die „Bedingungen der Möglichkeit“ der 250 Erfahrung gelten, 101 sondern er weist mit dem eigenen Begriffsgebrauch „transzendent“ auf den leitenden und motivierenden Horizont einer Sinnerwartung hin, der immer über uns hinausgeht und uns zum anstrengenden Umgang mit dem wahrheitstragfähigen Sachverhalt veranlasst. Diese transzendente Sinnerwartung ist bei Gadamer im Prinzip der Horizont der Frage nach der Wahrheit, die jedem Verstehensprozess vorausgehend gestellt werden muss und deshalb dem Verstehensvorgang eine bestimmte, normenähnliche Sinnrichtung verleiht. Sofern die Sinnerwartung an die vollkommene Wahrheit, die Sinnganzheit, hier mit dem anleitenden Fragehorizont zu tun hat, steuert die Wahrheitserwartung im dialogischen Wechselverhältnis unsere Verstehenspraxis und gründet deren Sinnvollzug in der beständigen Bewusstmachung unserer Erwartungshorizonte. Indem der vollkommene Sinnvollzugshorizont zudem ein erwünschter Wahrheitsraum ist, zu dem wir, so lange wir verstehen, eine Teilhabebeziehung haben, stellt Gadamer zunächst weniger die Sinnerwartungshorizont, Vollkommenheit in den als die Vordergrund, hermeneutische der im Vorstruktur, gesamten Verlauf den des Verstehensprozesses die bestimmte Sinnrichtung leitet. In der wechselseitigen Interaktion der menschlichen Erfahrungen entwirft sich die vorgreifende Sinnerwartung auf eine noch unbekannte Wahrheit und verweist zugleich auf eine in ihr gelegene vorstrukturierte Vorwegnahme. Denn der Erwartungshorizont impliziert nicht nur die vorausgegangene Aneignung des erwünschten Sinnvollzugs, sondern erschließt stets auch eine gewisse Sicht auf den möglichen Wahrheitshorizont, auf den hin der Verstehende sich immer schon richtet. In dieser interaktiven Wechselwirkung zwischen dem Rückgriff auf die eigene Voreingenommenheit und dem Warten auf den erwünschten Sinnhorizont hat der Vorgriff aus 101 Zur philosophischen Begriffsgeschichte „transzendental“. Vgl. N. Hinske u. a., Art. Transzendental; Transzendentalphilosophie, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, hrsg. v. Joachim Ritter u. Karlfried Gründer, Basel/Stuttgart 1998, S.1358 – 1436. Vgl. damit auch Ruth Sonderegger, „Gadamers Wahrheitsbegriffe“, in: Gadamer verstehen, Understanding Gadamer, S. 248 – 267. Er hat in diesem Aufsatz gegen Gadamers Auffassung von der hermeneutischen Wahrheit einen radikal kritischen Einwand erhoben, den er mit den Worten „Traditionalismus“, „Klassizismus“ und „transzendentale[n] Trivialitäten“ beschrieb. Doch Gadamer versuchte nie, wie wir bereits sahen, transzendentale Wahrheitskriterien zu erstellen, sondern den sinnvollen Vorgriffshorizont der Wahrheit in der gegenwärtigen Verstehenspraxis, die immer mit dem vergangenen Sinnhorizont verbunden ist, hervorzuheben. Aus dieser Sicht ist sein Einwand gegen Gadamers Wahrheitsbegriff fraglich, weil er selbst nicht unterscheidet, ob er mit seinem Begriffsgebrauch der „Transzendentalität“ das Transzendentale als die Bedingung der hermeneutischen Erfahrung verwendet oder das Transzendente als einen leitenden Endzweck des menschlichen Denkens gemeint hat. Wenn er dasjenige meint, trifft dies m. E. auf Gadamers Grundeinsicht nicht zu. Selbst wenn sich Gadamer im Vorwort zur 2 Auflage(1965) für sein Hauptwerk die transzendentale Frage, die die Affinität mit der Kantischen Frage zu haben scheint, stellt, „wie das Verstehen möglich ist“, kommt es bei ihm nicht darauf an, die methodischen Maßstäbe für das transzendentale Urteil der Wahrheit erneut aufzustellen, sondern darauf, das Verstehensgeschehen, an dem wir bereits teilgenommen haben, „phänomenologisch“ darzustellen. Das Verstehen kommt, Gadamer zufolge, durch den transzendental begründeten methodischen Eingriff in das objektiviert zu Verstehende nicht vor, sondern es ereignet sich mit der Teilhabe am Wahrheitsgeschehen. Zur phänomenologischen Darstellungsvariante, vgl. Michael Theunissen, „Philosophische Hermeneutik als Phänomenologie der Traditionsaneignung“, in: >>Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache<<, S. 65ff. 251 hermeneutischer Sicht die leitende Funktion, den Verstehenden ins intersubjektive Geschehen hineinzustellen und seinen Standpunkt in der wechselseitigen Verschränktheit geltend zu machen. So gesehen verweist der Vorgriff der Vollkommenheit die Beteiligten an der dialogischen Verstehenspraxis auf den Anknüpfungspunkt in der vorausgesetzten Erwartung des gemeinsamen Situationsverstehens und zugleich auch auf die Verständigung, die immer nur im Verhältnis zum Anderen zustande kommt. Somit wird deutlich, dass die hermeneutische Wahrheit keinen monadologischen Monolog, sondern bereits die dialogische Struktur der Sinnerschließung aufweist, da er bei jeder möglichen Sinnenthüllung die Angewiesenheit auf den mitkonstitutiven Anderen zur Sprache bringt, die sich wiederum von Beginn an auf die Verlässlichkeit und die Wahrheitserwartung des Anderen stützt. In Gadamers philosophischer Hermeneutik ist der Vorgriff der Vollkommenheit damit auch die „kontrollierte“ Vollzugsform, die aus der Antizipation auf den begrenzten Spielraum der wechselseitig einwirkenden Verstehensmodi heraustritt und den gemeinschaftlichen Normenanspruch erhebt. (GW. 1, S. 312) Sobald wir uns auf den interaktiven Spielraum einstellen, wird der vorgreifende Erwartungshorizont mit einem unerwarteten Sinnhorizont konfrontiert. Die Konfrontation mit dem Unerwarteten bewirkt nicht nur, dass die eigene Erwartung im Nachhinein korrigiert und überprüft wird, sondern auch, dass der beschränkte Sinnhorizont auf neue Perspektiven und Ansprüche hin ausgedehnt wird. Auf diesem ständig sich verändernden Weg orientiert sich die Sinnerwartung an dem zukünftigen Sinnvollzug. Aus hermeneutischer Sicht beinhaltet die kontrollierende Überprüfung dieses Erwartungshorizontes deshalb offenkundig die dialogische Verhaltensweise zwischen Sprecher und Hörer und damit auch die sittliche Funktion, die gesellschaftlichen Spielregeln auf der Basis des gemeinsamen Situationsverstehens der Beteiligten am Gespräch aufzustellen. 102 Die Vorstellung, dass der Sprecher allein versteht, was er sagt und dem Hörer als dem Interpret daher diese Sachwahrheit nicht zukommt, da der Sprecher allein den Sinn der Sachwahrheit aussagen kann, ist im Grunde irreführend. 103 Aus hermeneutischer Sicht 102 Vgl. Hans Robert Jauß, Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt a. M. 1970, S. 144 – 207. Hier handelt es sich bei ihm insbesondere um die entscheidende Macht des Erwartungshorizontes in der literarischen Rezeptionsgeschichte, den normativen Konflikt bewusst zu machen und Normen in einer Gesellschaft aufzustellen. Diesem Konzept entsprechend schreibt er: „So kann ein literarisches Werk die Erwartungen seiner Leser durch eine ungewohnte ästhetische Form durchbrechen und sie zugleich vor Fragen stellen, deren Lösung ihnen die religiös oder staatlich sanktionierte Moral schuldig blieb.“ Damit hat er auch die emanzipatorische und gesellschaftsbildende Funktion der Literatur auf der Ebene der gesellschaftlichen Lebenspraxis betont. 103 Diesbezüglich könnte man m. E. sagen, dass die Hermeneutik, die die psychoanalytischen Methoden musterhaft bevorzugt, die eingreifende Reduktion auf den Sprecher als den Urheber des Wahrheitssinnes im Prinzip konzipiert hat. Denn die Hermeneutik wollte einerseits den Autor als einzigen Ursprecher, der allein die Wahrheit tragen kann, gelten lassen und daher durch den psychologischen Rückgriff auf die Absichten des Urhebers die letzte Wahrheit vorlegen. Andererseits wollte sie mit dem psychotherapeutischen Modell durch die erklärende Reduktion auf das „tief“ zugrunde liegende Unbewusste des Patienten von der psychischen 252 hingegen wird der Sprecher selbst zum Hörer seiner selbst, sobald er sich selbst die Frage stellt, was er gesagt hat und sagen will. Nachdem der Sprecher gesprochen hat, ist er auch der Interpret seiner selbst, damit er sein gesagtes Wort verständlich machen kann. Er kann nur aus der Perspektive des interpretatorischen Hörers auf die Frage antworten, was er gesagt hat und sagen will. Somit wird deutlich, dass die Verstehenspraxis als solche im Grunde das Dialogverhältnis zu ihrem Grundcharakter hat. Von daher schafft sie ihren eigenen Kontrollbereich. Denn alle aktiv Beteiligten an einem Dialogvorgang legen ihren erwarteten Sinnhorizont, noch konkreter gesagt, ihre Stellungnahmen und Absichten vor, - selbst ein passiver Zuhörer hört das gesprochene Wort aus seiner eigenen Perspektive - erkennen sich selbst im Verstehensverfahren gegenseitig wieder und korrigieren sich dadurch gegenseitig. In diesem endlosen, deshalb offenen Prozess der Antizipation der eigenen Erwartungen, der gegenseitigen Konfrontation und der Selbstüberprüfung, wirft der Erwartungshorizont seinen Blick stets auf den Sinnvollzugshorizont und baut damit die handlungswegweisende Gemeinsamkeit der Verständigung über uns selbst auf. Der dialogische Kontrollbereich umfasst somit in Gadamers Hermeneutik einen normativen Wahrheitsraum, in dem alle gewissen Überzeugungen manifest werden, umstritten diskutiert werden können und alle Beteiligten dem sinnvollen Einverständnis und den leitenden Handlungsnormen näher kommen können. Die bisherigen Überlegungen zusammengefasst, liegt es auf der Hand, dass die hermeneutische Zirkularität zunächst weder ein circulus vitiosus, das als ein logischer Mangel aufzuheben wäre, noch ein sinnloser Kreislauf, sozusagen ein richtungsloses Herumtreiben, ist, sondern sie mit ihrem Erwartungshorizont bereits eine bestimmte Sinnrichtung hat. Der Erwartungshorizont verleiht dem Verstehenden nicht nur ein orientierendes Leitmotiv auf eine vollkommene Sinnganzheit gerichtet, sondern verschafft zugleich auch den intersubjektiven Spielraum, in dem jeder Wahrheitsanspruch durch den kommunikativen Prozess der Pro- und Kontra–Aussage und der übereinstimmenden Zusage, also durch die Zerstörung befreien. Für uns liegt auf der Hand, dass die Psychotherapie bzw. die Psychoanalyse komplizierten Interpretationsdimensionen aufweist, insofern jede therapeutische Behandlung auf die Diagnose und die Heilung des psychosomatischen Unbewussten abzielt. Die Komplexität des psychotherapeutischen Interpretationsverfahrens liegt zunächst in der situierten Differenz zwischen der Erzählung des Patienten im Wachzustand und seiner Bildgestaltung im Schlafzustand. Hierin ist der Verstehensakt des Patienten mit Bezug auf das verborgene Unbewusste bereits präsupponiert, weil nicht nur der Erzählungsversuch dem Therapeuten gegenüber, sondern auch die entstellte Bildgestaltung eine verstandene Freilegung des verdeckten Ursinns bedeutet. Um zu therapieren, soll der Therapeut nicht nur die Sinnentstellung im Traumzustand, sondern auch die Sinnüberhellung in der geäußerten Erzählung in seiner eigenen Verstehensweise erklären und durch den Erhellungsweg der vielfältig entstellten Sinnschichten hindurch dem unbewussten Ursinn näher kommen. Darüber hinaus wird deutlich, dass der unbewusste Ursinn, der hier zum therapeutischen Gegenstand gemacht wird, ohne das sagende Verstehen des Patienten im Prinzip an das therapeutische Selbstverständnis nicht herankommen kann. 253 reflexive Selbstüberprüfung der eigenen Überzeugungen, kontrolliert wird und damit neue Sichtweisen auf den zukünftigen Sinnhorizont eröffnet. Der Erwartungshorizont hat letztendlich in der alltäglichen Lebenspraxis eine Funktion der gesellschaftlichen Handlungsnormenbildung, die durch die Selbsteinbindung der Betroffenen in die Gesprächssituation möglich wird und die unter den Beteiligten eine Gemeinschaftlichkeit etabliert. Im Anschluss an Gadamers Einsicht in den Vorgriff der Vollkommenheit im dialogischen Verstehensverfahren, müssen wir schließlich feststellen, dass sich der Erwartungshorizont vor dem geschichtlich gemeinsamen Hintergrund des intersubjektiven Situationsverstehens aller Beteiligten bildet und deshalb den normativen Anspruch auf eine spezifische ethische Haltung im gesellschaftlichen Handlungsraum geltend macht. 254 II – 3. Die Horizontverschmelzung als die wahrhafte Verständigung In dem anstrengenden Lernprozess des hermeneutischen Sinnvollzugs, d. h. der Bildung von Gemeinschaftlichkeit, zeigt jeder Beteiligte in der dialogischen Verständigungspraxis sein aktives Engagement. Jeder erkennt das mitwirkende Verhältnis zum Anderen im vernetzten Sinngewebe der dynamischen Wechselbewegung. In diesem Verlauf eröffnet sich der Horizont einer Sinnganzheit, die aus einem intersubjektiven ‚Zwischen’ hervorbricht. Dabei ist eine Verschmelzung von Horizonten zu betrachten, die jedem Verstehensvorgang eigen ist; eine Horizontverschmelzung, die nicht nur die Bildung von Gemeinschaftlichkeit in der wechselseitigen Interaktion meint, sondern zu einer eigentlichen Selbsterkenntnis aller Dialogteilnehmer führt, so wie sich das sokratische Vorbild im platonischen Dialog entwickelt. 104 Angesichts dessen stellt sie, mit Gadamers Worten, „die Vollzugsform des Gesprächs“ dar. (GW. 1, S. 392) Insbesondere im Hinblick auf die zwischenmenschliche Gemeinschaftlichkeit will ich zunächst die Dynamik der Horizontverschmelzung und damit das dialogische Verstehensmodell im Anerkennungsverhältnis vorstellen, das die hermeneutische Grundpolarität als interaktive Beziehung der Beteiligten in den Vordergrund stellt. Ich tue dies mit der Frage, wie es möglich ist, zwischen den distanzierten Horizonten der Dialogteilnehmer eine Brücke zu schlagen. Inwiefern verfügt das Gespräch als eine Verständigungspraxis in der Horizontverschmelzung über einen hermeneutischen Grundzug und stellt so den gesamten Sinnraum her? Im Anschluss an diese Fragen will ich zunächst auf Gadamers Grundauffassung des Begriffs „Horizont“ eingehen. Aus hermeneutischer Sicht bedeutet einen Horizont erwerben, dass man ein entscheidendes Leitmotiv für seinen je eigenen Zugang zur Sinnwelt hat. Der „Horizont“, den Gadamer unter dem Einfluss von Husserls Theorie der Intentionalität und von Heideggers Einsicht in das „In–der–Welt–Sein“ übernimmt, meint das Gewinnen eines 104 Mit dieser kritischen Fragestellung haben einige Autoren wie z. B. M. Frank und H. R. Jauß den verschmolzenen Sinnhorizont des hermeneutischen Bewusstseins bei Gadamer verdammt. M. Franks hegte das Verdachtsmoment, dass Gadamers Begriff der „Horizontverschmelzung“ mit ihrer eigenen „höheren Einheit“ zu Ende gegangen sei und diesem einheitlichen Sinnhorizont alle „individuellen Eigenschaften und Partikularitäten“ entzogen wären. Aus diesem Grund hat er die hermeneutische Offenheit in Gadamers Hermeneutik nicht weiter beachtet. Darüber hinaus meinte H. R. Jauß, dass der verschmolzene Sinnhorizont bei Gadamer in den „substanzialistischen Rückfall“ auf den vergangenen Sinnhorizont geraten sei, weil er m. E. Gadamers Einsicht in den Charakter des hermeneutischen Wahrheitsgeschehens, das nur mit der Begegnung mit dem gegenwärtigen Sinnhorizont, sozusagen mit unserer Standpunkteingebundenheit vorkommt, übersehen hat. Bei Gadamer orientiert sich die Verschmelzung der Horizonte im Anschluss an das hermeneutische Bewusstsein, wie wir schon sahen und sehen werden, weder am verschlossenen Monolog, noch an der eschatologischen Einigkeit, sondern hat die Vorläufigkeit zu ihrer Charakteristik, hält sich deshalb immer für die Potenzialität des anderen Sinnhorizontes offen. Vgl. M. Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 20 – 34 und H. R. Jauß, Literatur als Provokation, S. 186 u. S. 235. 255 bestimmten Blickwinkels, der als ein vorgeformter Sinnbezug schon vor unserer Einsicht in den Verstehensvorgang existiert. Einen Horizont gewinnen bedeutet letzten Endes, die jeweilige Begrenztheit vom momentanen Standpunkt aus anzuerkennen und zugleich die Erschließung des über die Eigensinnigkeit hinausragenden Sinnfeldes zu ermöglichen. Beim Gewinnen eines Horizontes, in dem der eigene Schatten eine bestimmte Sphäre hinter sich lässt, zeichnet man die Begrenzungslinie seines Sehens ein, in deren Umfeld dennoch das zu Verstehende erscheint. Innerhalb dieser begrenzten Sichtweise und –weite betrachtet man den betreffenden Sachverhalt, der immer auch auf sich zurückgeworfen ist. Jede bestimmte Perspektive stellt mithin eine Grenzlinie dar und eröffnet damit auch die Möglichkeit, seinen Blick auf die Außenseite der eigenen Grenze zu richten. Der Horizont ist deshalb in Gadamers Hermeneutik ein den Blickwinkel begrenzender, aber dennoch richtungsweisender Standpunkt. Die Horizontgewinnung leitet damit nicht nur die Selbsteinstellung in Verbindung zu den lebensweltlichen Bezügen, sozusagen zu einem intersubjektiven Sinnraum, sondern sie bildet auch die mediale Mitte zwischen dem inneren Kreis des Sehens und seiner Außenseite, da sie das eigene Sinnfeld sichtbar macht und damit zugleich das entscheidende Bewusstsein von der Unaufhebbarkeit der Andersheit des Anderen zu Tage fördert. Darüber hinaus führt uns die Horizontgewinnung einerseits zu der diachronen Vermittlung zwischen den zeitlich distanzierten Horizonten, andererseits zu der synchronen Vermittlung zwischen den Kulturen, zwischen den verschiedenen Lebensformen, nämlich zwischen Ich und Du in einem Kulturkreis. Die eigene Horizontgewinnung bedeutet deshalb bei Gadamer „Nicht– auf–das–Nächste Eingeschränktsein, sondern über es Hinaussehenkönnen.“ (GW. 1, S. 307) Das bedeutet: Der Horizont verweist hier im Grunde auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Perspektive, unter der allein man mit der Sinnwelt richtig umgehen kann. Hierbei ermöglicht der Horizont die Wahrnehmung des ausgegrenzten, des anderen Horizontes, dessen Richtung nicht nur den jetzigen Standpunkt, sondern auch die entworfene Sinnwelt, die auf diesem Standpunkt beruht, verändert. So lange wir dem leitmotivischen Wahrheitsbezug näher zu kommen versuchen, müssen wir zuallererst unseren eigenen Horizont haben und bilden, da dieser gebildete Horizont die Grundlage für die Begegnung mit der Sinnwelt bildet, die ein Vorverständnis mit einschließt. Erst mit diesem Sich-HineinBegeben in das interaktive Wechselverhältnis begegnen wir dem Anderen. In dieser Begegnung werden wir selbst zu ihm getrieben, der zwar nie gänzlich transparent vor unseren Augen erscheint, aber von der stets zu verstehenden Sinnwelt stets aufs neue erschlossen wird. Innerhalb der bestimmten Rahmenbedingungen der intersubjektiven Interaktivität zwischen dem Selbstbezug und dem Bezug zum Anderen, bildet sich unser Sinnhorizont aus. 256 Gleichzeitig verschiebt er sich in der konstitutiven Auseinandersetzung mit dem Anderen aufgrund eines Horizontwandels, dem jede Verstehenspraxis unterliegt. Die Horizontbildung führt uns nicht nur auf das Spielfeld der Verstehensmöglichkeiten, sondern leitet den Horizontwandel auch aus der Entdeckung des Anderen ab. In der permanenten Veränderung der Sinnhorizonte gewinnt sie die Perspektive auf eine Sinnganzheit, in deren Licht sich der eigene Horizont erweitert und der Andere zuallererst wahrgenommen wird. Aus Gadamers Sicht ist der Horizont deshalb keinesfalls in sich verschlossen, sondern die Horizonte sind bereits miteinander verbunden, stehen immer schon in einem Wechselverhältnis zueinander. Über diese gegenseitige Interaktion im Bilden der Horizonte sagt Gadamer: „Der Horizont der Gegenwart bildet sich also gar nicht ohne die Vergangenheit. Es gibt so wenig einen Gegenwartshorizont für sich, wie es historische Horizonte gibt, die man zu gewinnen hätte. Vielmehr ist Verstehen immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender Horizonte.“ (GW. 1, S. 311) So besteht die Horizontbildung als solche geradezu aus der konstitutiven Begegnung mit dem gegenüberstehenden Anderen. Von dieser mitkonstitutiven Rolle des Anderen aus betrachtet, sind die Horizonte von vornherein füreinander offen. Durch das Offenhalten für den Anderen, sozusagen im interaktiven Verhältnis, verschiebt sich der Sinnhorizont auf den sich selbst darbietenden und erweiternden Wandel, in dessen Hin- und Herbewegung ein neuer Sinnhorizont entsteht. Die Horizontbildung in jedem Verstehensvorgang hat deshalb im Grunde die Fähigkeit, zwischen den distanzierten Horizonten eine Brücke zu schlagen, da sie hier nicht nur eine Vorbedingung für die Entdeckung des Anderen darstellt, sondern auch die Begegnung zwischen den Beteiligten anleitet. Somit kann man die Horizonterweiterung in dieser oszillierenden Bewegung auch in der Hinsicht verstehen, dass die Erweiterung der Horizonte das jeweilige Auftreten des neuen Sinnhorizontes in einer vorläufigen Übereinstimmung erfährt, aber auch modifiziert und eröffnet. Sie verweist deshalb, so könnte man sagen, auf die Selbstverwandlung als eine vorübergehende Assimilation mit dem Anderen. Mit diesem Ereignis bereichert und vermehrt sich die Sinnwelt, da der sich ausbildende Horizont in einem endlosen Wandel die Entdeckung des Bewusstseins der Eigenheit und des Bewusstseins von der Andersheit des Anderen erfährt und so die Blickrichtung auf den Anderen lenkt. Die interdependente Dynamik des gesamten Sinnhorizontes, der sich immer mit uns mitbewegt und der es, mit Gadamers Worten, ist, „in das wir hineinwandern und das mit uns mitwandert“, wird in der Hermeneutik als „Horizontverschmelzung“ (GW. 1, S. 309) bezeichnet. Die Verschmelzung der Horizonte im hermeneutischen Sinn verweist zunächst auf das auf gegenseitigem Einverständnis beruhende Zusammenkommen der Beteiligten im 257 Sinnraum des Dialogs. Hierbei prägt der assimilierte Sinnhorizont den holistisch miteinander verknüpften Sinnganzheitsraum, der als ontologische Grundlage der sozialen Verständigungspraxis im intersubjektiven Handlungsspielraum eine funktionelle und normative Rolle spielt. Diese Vermitteltheit des Sinnhorizontes ermöglicht daher das Zustandekommen der gemeinsamen Verständigung, d. h. die Gemeinsamkeitsbildung im Zusammenspiel der Differenzen bzw. die Ich und Du vermittelnde Wir–Dimension, die sich in dem variablen Zwischenspielraum konstituiert. Selbst wenn die Horizontverschmelzung im hermeneutischen Sinn als der Horizont des Sinnvollzugs verstanden wird, der uns prinzipiell im gesamten Verstehensvorgang eine bestimmte Orientierung verleiht, geht es hier nicht um die Vermittlung der rekonstruierten Wiedergabe des Originalsinnes, sondern im Grunde um die Integration in eine Gemeinsamkeit, in die die verschiedenen Perspektiven einfliessen und anerkannt werden. Aber die Verschmelzung der Horizonte impliziert überdies ein unauflösliches Spannungsverhältnis, das von der unvorhersehbaren Sachwahrheit im unendlichen Selbstentfaltungsprozess der Wahrheitssuche ausgelöst wird, da diese einen je vorläufigen Wendepunkt zur Erschließung des neuen Sinnhorizontes darstellt. Gadamer zufolge ist die interaktive Bewegung des Austauschs gerade die dialektische Dynamik des wechselseitigen Austauschs im Gesprächsvorgang. Die Horizontverschmelzung selbst bzw. die Schaffung des gemeinsamen Sinnraums der Verständigung in der Gesprächssituation muss sich deshalb, mit Gadamers Worten, auf „die eigentliche Leistung der Sprache“ stützen. (GW. 1, S. 383) Somit besteht Gadamers Einsicht darin, dass die Sprache sowohl über die schöpferische Kraft verfügt, den gesamten Sinnraum der intersubjektiven Anerkennungsbewegung sichtbar zu machen, als auch die konstitutive Fähigkeit hat, zwischen den verschiedenen Sichtweisen zu vermitteln, sie einander näher zu bringen. An dieser Stelle können wir der Sprachlichkeit und dem damit verbundenen Dialogverhältnis in der menschlichen Verstehenspraxis unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Wenn ich hier zunächst die Bedeutung, die Gadamer der Sprache für das Verstehen beimißt und die wir hauptsächlich im III. Teil behandeln werden, andeute, wäre vorweg festzuhalten, dass die Sprache in Gadamers Dialoghermeneutik die erhellende Macht hat, die in sich verborgene Sinnwelt zu offenbaren. Das bedeutet: Sie bildet mit ihrer eigenen Produktivität und mit ihrer prozessualen Geschichtlichkeit auch den Bezugspunkt, an dem die Welt immer schon mit Hilfe der Sprache erscheint, an dem wir dem Wahrheitsbezug zur Welt, der bereits sprachlich vermittelt ist, näher zu kommen versuchen. Die zu verstehende Sinnwelt ist deshalb von vornherein ein sprachlich überliefertes und zu erschließendes Sinnfeld, das die hermeneutische Anstrengung der unaufhörlichen Wahrheitssuche motiviert und mit der 258 angemessenen Weltzuwendung dieser Wahrheitssuche zur Sprache kommt. Hier hat das menschliche Weltverstehen die Sprache zur Grundlage für den Zugang zur Sinnwelt und die Sprache ermöglicht deshalb in ihrem Grundverhältnis zum wahrheitstragfähigen Sachbezug dessen primäre Erschließung. Mit Gadamers Worten ist die Sprache „das universale Medium, in dem sich das Verstehen selber vollzieht.“ (GW. 1, S. 392) Denn die Sprache übt eine mediale Funktion aus, so dass die Sinnwelt sich selbst mitteilt und uns zukommt, sozusagen den gemeinsamen Hintergrund für das Zusammenleben im dialogischen Wechselverhältnis bildet. Wenn Gadamer hier das „universale Medium“ als eine Vollzugsebene der menschlichen Verstehenspraxis bezeichnet, so handelt es sich weder um ein allgemeingültiges Prinzip, aus dem alle Sätze abgeleitet werden und auf dem sie deduktiv beurteilt werden, noch um einen begründeten Universalgrundsatz, an dem sich alle Handlungen von vornherein orientieren sollen, sondern um das Universale, das die Bestandteile für das Verstehen und die Beteiligten an dem Verständigungsvorgang miteinander verbindet. Kurz gesagt, meint das hermeneutische Universale hier die dialogische, deshalb gesellschaftliche Verbindlichkeit, auf deren Basis die Beteiligten ihre Worte formulieren und verständlich machen können, die Verschiedenheit sichtbar gemacht und miteinander verschmolzen werden kann. Im Hinblick auf diese dialogische Wechselseitigkeit haben die Textverstehenspraxis und die gemeinschaftliche Verständigung mithin denselben Grundcharakter der „sprachlichen Vermitteltheit.“ Im Anschluss an die sprachliche Vermittlung fasst Gadamer zunächst die soziale Verständigung im wechselseitigen Dialogverhältnis, die im Grunde die Anerkennungsbewegung untermauert, ins Auge. Dieses verständliche Ja–Sagen im Dialog geht hier von der unmittelbaren Annahme des Anderen als Gesprächspartner aus und muss damit auch durch die dialogische Anerkennungsbewegung festgelegt werden. In Bezug auf die gemeinsame Sprachbildung im Dialog sagt Gadamer deshalb, dass „[…] das hermeneutische Gespräch sich wie das wirkliche Gespräch eine gemeinsame Sprache erarbeiten muß und daß diese Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache […] mit dem Vollzug des Verstehens und der Verständigung selbst zusammenfällt. Auch zwischen den Partnern dieses >Gesprächs< findet wie zwischen zwei Personen eine Kommunikation statt, die mehr ist als bloße Anpassung.“ (GW. 1, S. 391) Was will Gadamer in den obigen Sätzen mit der „gemeinsamen Sprache“, einschließlich des „hermeneutischen Gesprächs“ sagen? Was bedeutet in diesem Zusammenhang die gemeinsame Sprache oder eine gemeinsame Sprachbildung im dialogischen Wechselverhältnis? Es ist klar, dass Gadamer mit diesem Ausdruck keinesfalls eine einheitliche Sprache, wie z. B. eine künstliche Sprache meinte, die 259 sich auf die homogene Äquivalenz zwischen Sprache und Welt richtet. Demgegenüber meint die gemeinsame Sprache in Gadamers hermeneutischer Sprachauffassung ebenso wie die Horizontverschmelzung m. E. eine der wechselseitig komplementären Komponenten des hermeneutischen Gesprächs: Einerseits die sprachliche Gemeinsamkeit als die Grundbedingung für die intersubjektive Verstehenspraxis, denn wir müssen die sprachliche Gemeinsamkeit als eine minimale Grundbasis voraussetzen und einen Hintergrund des gemeinsamen Situationsverstehens, der mit der sprachlichen Gemeinsamkeit zusammenfällt, haben, damit wir uns mit unseren Anderen verständigen können. Die gemeinsame Sprache soll andererseits durch das Gespräch „erarbeitet“ werden. Die Verständigung in einem auf die Sache bezogenen Sinnraum des Gesprächs ist hier auch ein Telos, das auf dem Weg von der in der Frage formulierten Vorerwartung durch den wechselseitigen Austausch der jeweiligen Überzeugungen aller Gesprächsteilnehmer schließlich zur Gemeinschaftlichkeit gelangt. Anders gesagt, ist dasjenige, das den gesamten Sinnraum im Dialogprozess stiftet, der Zweck, der vom Dialog selbst erzeugt und durch den Dialog erreichbar wird. In diesem Verlauf zur Verständigung, an deren Sinnnetzwerk alle Gesprächsbeteiligten immer schon partizipieren und in dessen Spielraum sie nicht nur ihre Meinungsverschiedenheit zum Ausdruck bringen, sondern vielmehr eine auf Verständigung gerichtete wechselseitige Begründung und Auslegung geben, erkennt der Dialog im Grunde den Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit an und bewahrt deshalb das symmetrische Wechselverhältnis. Daran anschließend hat die intersubjektive Anerkennungsbewegung, in deren Prozess jeder Beteiligte den Anderen als seinen Partner annimmt und damit sich selbst zugleich erkennt, ihren herausragenden Sinnraum im wechselseitigen Dialogverlauf zur Gemeinsamkeitsbildung. Die Anerkennung unter den Menschen bahnt sich, wie bereits erwähnt, nicht nur mit der sprachlichen Gemeinsamkeit an, sondern auch mit der gemeinsamen Basis der kulturell–geschichtlichen Erfahrung. Von daher kann sie ihren Vollzug im Dialogverhältnis finden. Denn die Gewissheit aller Beteiligten, die immer noch der Legitimation bedürfen, sich selbst geltend zu machen, ist im offenen Prozess des Dialogverhältnisses austauschbar. In diesem Zusammenhang bewegt sich die Bewegung der Anerkennung unter der notwendigen Grundvoraussetzung, wonach die Beteiligten bereits eine minimale Gemeinsamkeit haben, damit sie ihre Beziehung weiter führen, die wechselseitige Anerkennung erlangen und ein gemeinsames, solidarisches Zusammenleben führen können. Das bedeutet: Die soziale Beziehung unter den Menschen beruht auf der Grundlage der sprachlichen Gemeinsamkeit und der vertrauten Gewohnheiten, die durch die kulturell– geschichtlichen Erfahrungen geprägt werden. Insofern ermöglicht die wechselseitige 260 Anerkennung bzw. die darauf gestützte Gemeinschaftlichkeit das menschliche Zusammenleben. Aus hermeneutischer Sicht findet das Anerkennungsverhältnis deshalb dort seinen wirklichen und vitalen Ort, wo das Gespräch zwischen den Beteiligten sich wirklich vollzieht, wo diese bereits den Gegenüberstehenden anerkennen und zugleich die Bereitschaft haben, die Gemeinsamkeit durch den Eintritt ins Gespräch wiederherzustellen. So gesehen durchläuft die wechselseitige Anerkennung im hermeneutischen Dialogverhältnis einen inneren Übergangsprozess in der Verständigungspraxis. Auf diesem Weg der kommunikativen Selbstbildung durch die Entdeckung der Andersheit wird die gemeinsame Verständigung über den Anderen und über sich selbst, also auch über die gewohnheitsmäßige, aber noch nicht bewusste Spielregel, in Gang gesetzt. Diese dialogische Verständigungspraxis hat m. E. bereits eine enge Verwandtschaft mit der gesellschaftlichen Handlungsnormenbildung in einer bestimmten Handlungssituation. Dies gilt für die Gesprächssituation gleichermaßen wie für das Spiel. Aus hermeneutischer Sicht ist im Auge zu behalten, dass sich die wechselseitige Anerkennungsbewegung innerhalb des innerlich verständigenden Dialogparadigmas, d. h. auf der Grundlage der Symmetrie des intersubjektiven Gesprächsverkehrs, ständig mitbewegt. Hierin findet das intersubjektive Anerkennungsverhältnis seinen lebendigen Sinnraum, verleiht damit den geschichtlich tradierten Gesellschaftsnormen einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert und arbeitet anschließend einen Orientierung bietenden Handlungswegweiser aus der geschichtlichen Normbildung heraus aus, der der gegenwärtigen Handlungssituation immer angemessen ist. Von den bisherigen Überlegungen ausgehend, können wir einige vorläufige Antworten auf folgende Fragen finden: Warum hebt Gadamer das Primat des Gesprächs im menschlichen Verstehen hervor? Inwiefern spielt das Gesprächsverhältnis im Lernprozess der Sozialisierung eine entscheidende Rolle? Wo findet das wechselseitige Anerkennungsverhältnis, das sich aus der Grundstruktur der hermeneutischen Erfahrung ergibt, seinen lebendigen Sinnraum? Aus welchem Grund erfordert der Dialog selbst auch den Sinnraum der wechselseitigen Anerkennung? Darüber hinaus hoffe ich, dass wir im folgenden anhand einiger Punkte sehen können, dass die menschliche Verstehenspraxis in Gadamers Hermeneutik von vornherein das Dialogparadigma umfaßt. Zunächst taucht sie nur vor dem geschichtlich–kulturellen Hintergrund der wechselseitig einwirkenden Erfahrungen auf; sie ist letztlich von den geschichtlich überlieferten Kontexten abhängig. Mithilfe dieses kontextabhängigen Wandels ihres eigenen Standpunktes und der sprachlich erschlossenen Zugänglichkeit zur Sinnwelt, bildet sie auch den produktiven, nämlich neuen Sinnbezug aus. Im Hinblick auf die dialogische Wechselseitigkeit gilt Gadamer die Verstehenspraxis als das 261 „hermeneutische Gespräch.“ (GW. 1, S. 391) Zudem sind die Horizontverschmelzung sowie die Verständigung in den alltäglichen Lebensbezügen bei Gadamer bereits „eine Verwandlung ins Gemeinsame.“ (GW. 1, S. 384) Das bedeutet hier, sich selbst in die überindividuelle Gemeinsamkeit, sozusagen in die Wir–Dimension zu verwandeln und zu versetzen, so dass sich alle Beteiligten am dialogischen Verstehen auf einen lebendigen Sinnraum einlassen, in dem sich der Sinnvollzug ereignet, in dem jeder den Anderen als unaufhebbaren Anderen anerkennt und sich selbst erkennt, in dem er den gemeinsamen Sinnvollzug im Gespräch erfährt. Die menschliche Verstehenspraxis in diesem Dialogverhältnis bewegt sich schließlich auf der Grundlage einer gemeinsamen Sprachlichkeit hin und her, die die möglichen Sinnhorizonte erschließt und offen hält und das erschlossene Sinnfeld angemessen zur Sprache bringt. Aus Gadamers Sicht ist die Sprache deshalb weder ein instrumentelles Mittel, noch ein Epiphänomen, das nachträglich und zweitrangig abgeleitet ist, sondern sie stellt bei jedem Sprechen die Sache selbst vor und gibt dem Sachverhalt eine bestimmte Sinnrichtung. Daher ist die Sprache kein beherrschbares Werkzeug, sondern unsere Welterfahrung selbst wird nur mit und durch die Sprache erschlossen. Aus hermeneutischer Sicht vollzieht sich der intersubjektive Anerkennungsprozess über die Banalität unserer legitimationsbedürftigen Vormeinungen hinaus zu einer gemeinschaftlichen Verständigung über uns selbst nur durch das SichEinlassen auf das Gespräch, in dem sich der wahrheitstragfähige und normative Sinnraum herstellt und die Überzeugungen aller Sprecher ohne äußerliche Einschränkungen und Hemmungen wechselseitig aufeinander bezogen werden. 262 Dritter Teil: Vom Verstehen des Textes zur Verständigung im Dialog „Was wir nämlich denkend an Wahrem auffinden, von dem vor allem finden wir, daß wir es einsehen, und dies wiederum hinterlegen wir dann in der Erinnerung. Aber dort ist die abgründigere Tiefe unserer Erinnerung, wo wir auch das zum ersten Mal finden, wenn wir denken, und das innerste Wort gezeugt wird, das keiner Sprache angehört, wie Wissen von Wissen und Schau von der Schau und Einsicht, die im Denken erscheint, von der Einsicht, die schon in der Erinnerung war, aber verborgen war.“ 1 Nach dem so genannten „linguistic turn“, der besonders seit dem späten Wittgenstein in Erscheinung getreten ist, steht die Sprachproblematik, nämlich die Frage nach der umfassenden Beziehung zwischen Denken und Sprechen, im Zentrum unseres philosophischen Diskussionsrahmens. Demnach können wir sagen, dass die Sprache kein Instrument zur nachträglichen Bezeichnung des vorgestellten Denkinhaltes oder zur bildhaften Wiedergabe des Gedankens ist, sondern in engem Zusammenhang mit dem jeweiligen Denken steht. Damit wird deutlich, dass die Sprache einen entscheidenden Einfluss auf das jeweilige Denken seiner Zeitepoche hat und dass das gebildete Denken sich auch stets seine Sprache sucht. Mit dieser philosophiegeschichtlichen Wende der Sprache Schritt haltend, wählt Gadamer den Satz „Ontologische Wendung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache“ als Titel für den letzten Teil von Wahrheit und Methode. Hierbei geht es, wie wir sehen, um die „ontologische Wendung der Hermeneutik“, nämlich um die hermeneutische „Sprachontologie“, die im Prinzip auf den Ereignischarakter der Sprache bei jedem Denken verweist. Gadamer will damit zum Ausdruck bringen, dass die Sprache eine kreative oder zumindest mitkonstruktive Funktion im Denkprozess übernimmt. Die hermeneutische Sprachontologie meint weder die substantielle Metaphysik der Sprache noch die exakte Widerspiegelung der Dingwelt oder des Denkinhaltes durch die Sprache, sondern die menschliche Seinsweise im dialogischen Umgang mit den Anderen (Welt und dem Anderen). 1 Aurelius Augustinus, De trinitate, übers. v. Johann Kreuzer, Hamburg 2001, XV. Buch, 21. 40. 263 Hinter seiner ontologischen Sprachauffassung, dass die Welt vermittels der Sprache zu uns kommt und dass das Denken sprachlich verfasst ist, steht deshalb Gadamers Grundeinsicht, dass wir immer schon im dialogischen Wechselverhältnis zum Anderen sind, solange wir bereits unseren Anderen begegnen. Wenn seit der Sprachwende klar ist, dass das Denken nicht souverän zu seinem Schluss kommt, sondern das Denken sich selbst vermittels der Sprache zeigt, ist die Sprache dessen entscheidender Erscheinungsort, was gilt, so lange das Sein von selbst zu Wort kommt. Für die Sprache ist damit keine monologische Verschlossenheit, sondern von vornherein die dialogische Gerichtetheit charakteristisch. Die Sprache befindet sich nicht im kausalen Referenzverhältnis zwischen dem Zeigen und dem Bezeichneten, sondern ist bereits auf die Welt und auf den Anderen gerichtet und umgekehrt kommt dieser Andere gleichzeitig auch zu seiner Sprache. Im Anschluss an Gadamers Einsicht können wir deshalb sagen, dass die Sprache eine zirkuläre Bewegtheit aufweist. Aus diesem Grund ist die Sprache bei Gadamer im wesentlichen das Gespräch. Nun kann man sagen, dass Gadamers Denkansatz zur hermeneutischen Sprachontologie in III. Teil von Wahrheit und Methode darin besteht, dass das, was ist, immer schon sich selbst mit und in der Sprache erscheint und die menschliche Seinsweise deshalb das unaufhörliche Suchen nach dem Wort, das uns im endlosen Umgang mit der Welt fehlt, ist, da das Denken von Beginn an zum Sein steht. Wenn das Denken von vornherein zum Sein, das von selbst zum Wort kommt, steht, soll das Denken auch unabdingbar in der Sprache sein und zur Sprache kommen. Insofern kann derjenige, der an das Sein denkt, sich selbst auf das Gesprächsverhältnis einlassen und zur Sprache bringen. Hinter seiner Aussage „Ontologische Wendung“ steht die Einsicht, dass wir im Prinzip von dem, was ist, sprechen können. Somit stellen wir fest, dass dieses prinzipielle Können die hermeneutische Universalität der Sprache ist. Es liegt auf der Hand, dass das Menschsein von vornherein mit seiner existentiellen Zeitknappheit eingeschränkt, nämlich endlich ist. Wir als Endliche sind uns, wie Gadamers Hermeneutik gelehrt hat, darüber im Klaren, dass wir uns unter dem Einfluß des geschichtlichen, kulturellen und sprachlichen Hintergrunds befinden und unseren Anderen vor diesem Hintergrund begegnen. Mit dieser geschichtlich bedingten existentiellen Ausgangslage des Menschseins betrachtet, ist das prinzipielle Können in Gadamers Dialoghermeneutik praktisch, da das hermeneutische Mangelbewusstsein, das Suchen nach dem, was zu sagen und was zu tun ist, ständig motiviert. An dieser Stelle will ich kurz auf Gadamers kompositorische Konstellation in seinem Hauptwerk eingehen. Um sich Gadamers Hauptanliegen zu nähern, empfiehlt sich die Frage, welchen Stellenwert der abschließende Teil in Wahrheit und Methode hat und ob das Werk 264 selbst heterogen oder homogen ist. Bevor wir unsere Aufmerksamkeit dem Kompositionsproblem zuwenden, muss für uns klar sein, dass die menschliche Erfahrung aus hermeneutischer Sicht immer schon auf den unaufhebbaren Anderen in seiner Andersheit angewiesen ist, dass das Verstehbare, ja das Erfahrbare sich aus dem dialogischen Zwischen des Eigenen und des Anderen ergibt und dass dasjenige, was wir erfahren, sich immer aus dem dialogischen Verfahrensprozess, in dessen Verlauf die Sprache die entscheidende Rolle spielt, ergibt. Davon abgesehen ist bekannt, dass Gadamer in Wahrheit und Methode die drei verschiedenen Bestandteile, nämlich Kunst, Geschichte und Sprache als die Voraussetzungen für die hermeneutische Wahrheitserfahrung bezeichnet. Es stellt sich die Frage, ob diese drei Elemente der hermeneutischen Erfahrung bei Gadamer die „vertauschbaren Größen“ sind. 2 Diese verkannte Frage ist in der Tat nicht grundlos, da Gadamers Hauptwerk aus der Untersuchung dieser drei Arbeitsfelder entsteht. Dennoch wird deutlich, dass das Werk im Grunde dann seinen einheitlichen Sinnhorizont, 3 der den konsequenten Übergang von der präparierenden Kunsterfahrung über die Geschichtlichkeit der ontologischen Erfahrung zur universalen Sprachlichkeit der Hermeneutik bildet, entfaltet, wenn wir uns dem werkinneren Übergangsmoment, d. h. Gadamers Kritik an der kongenialen Reproduktivität in Schleiermachers Hermeneutik und seine Betonung auf Hegels dialektischem Integrationsmoment vom II. Teil bzw. Gadamers Blickwinkel auf die Dialektik von Frage und Antwort vom III. Teil, zuwenden. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass sowohl die Kunsterfahrung als auch die hermeneutische Erfahrung unter der geschichtlich bedingten Situation vermittels der Sprache zustande kommt. So kann die Sprache bei Gadamer als unser ausgezeichnetes, universales Erfahrungsfeld, in dem das Wahre, das Gute und das Schöne als das verschwisterte Eine erfahrbar sind, bezeichnet werden. Aus Gadamers Sicht ist die Sprache auch deshalb universal, weil sie, als die menschliche Erfahrung selbst, von vornherein „Sprachliche Spiele“, nämlich Dialog ist, in dessen Licht wir als Dialogbeteiligte das Eine in seiner Vielfältigkeit ohne Ende zu suchen trachten und das richtige Wort herauszufinden versuchen. (GW. 1, S. 493) Wenn wir zudem unseren Blick auf die werkinnere Sinnorientierung an der universalen Dialogperspektive richten, könnte man sagen, dass Gadamers Hauptwerk an sich ein kohärenter Philosophietext ist. Im Anschluss an Gadamers Auffassung, dass die Dingwelt sprachlich verfasst ist und dass die menschliche Erfahrung als der sich selbst verstehende Umgang mit der Welt 2 Vgl. Walter Schulz, „Anmerkungen zur Hermeneutik Gadamers“, in: Hermeneutik und Dialektik, S. 305 – 316, hier, S. 311. 3 Zum Kompositionsproblem von Gadamers Wahrheit und Methode, vgl. Jean Grondin, Der Sinn für Hermeneutik, Darmstadt 1994, S. 1 – 23. 265 sprachlich vermittelt ist, wird deutlich, dass Gadamers Dialoghermeneutik ohne Ethik nicht verstehbar ist. 4 Denn Gadamers Denken kehrt nicht nur immer wieder zur Wurzel des philosophischen Anliegens der Ethik zurück, sondern auch die hermeneutische Erfahrung, die als die ontologische Struktur der menschlichen Seinsweise bezeichnet werden kann, bewegt sich bereits auf die Anerkennung des begegneten Anderen zu. Aus hermeneutischer Sicht ist die anerkannte Annahme des Anderen als Gesprächspartner kein Ergebnis unseres reflexiven und nachreflexiven Verhältnisses zum Anderen, sondern ein präreflexives Ereignis, das die bedingungslose Bedingung für das gemeinsame Suchen im Gespräch mit dem Anderen bestimmt. Da das Sich-Einlassen auf das Gespräch als die menschliche Seinsweise nunmehr die unmittelbare Begegnung mit dem Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit ist, verlangt das Gespräch als eine hermeneutisch anstrengende Verstehensgemeinschaft von jedem Betroffenen eine ethische Verhaltenweise. Dementsprechend stellen wir fest, dass diese Betroffenheit als unentrinnbare Grundstruktur geradezu auf die situierte Begrenztheit der menschlichen Erfahrung verweist. Daran anschließend liegt es auf der Hand, dass Gadamers Einsicht in den Situationscharakter der hermeneutischen Erfahrung an Aristoteles’ Analyse der Phronesis anknüpft. Bei beiden Philosophen geht es hier um das praktische Situationswissen. Denn das Ethische ist im Gespräch oder im Handeln als einer anerkannten Begegnung mit dem unmittelbaren Gegenüber immer schon von der gewissen Bewusstmachung der jeweiligen Situation abhängig. Da die betreffende Situation nicht mehr zum Stillstand kommt, sondern sich flexibel und variabel in ihrer geschichtlichen und zeitlichen Kontinuität weiter bewegt, müssen wir als Betroffene immer wieder die Frage stellen, was gut für das Leben ist und die Antwort auf die Frage permanent suchen. Diese Aspekte berücksichtigend, möchte ich nun die Universalität der hermeneutischen Sprachlichkeit aus der dialogischen Perspektive einleiten. Hierbei geht es um das ethische Fundament, das sich mit den gesamten Dialogvorgängen mitbewegt. Um das ethische Element in Gadamers Dialoghermeneutik herauszuarbeiten, will ich von der Universalität der hermeneutischen Sprachlichkeit, die wir als das Gespräch, das, so Hölderlin, wir sind, verstehen müssen, ausgehen. Somit werden wir sehen, dass die dialogische Sprachvermittlung, die sich als die spekulative Wechselbeziehung darstellt, den ursprünglichen Hörverstehenshorizont erschließt. Von da aus wird sich der Dialog als das philosophische Urphänomen zeigen. Damit wird auch gezeigt, dass der Dialog nicht nur die Anerkennung des Anderen voraussetzt, sondern auch die Anerkennungsbewegung vollzieht, da der Dialog einerseits durch die Zustimmung des Anderen voran kommt und andererseits 4 Vgl. Günter Figal, „Ethik und Hermeneutik“, in: Hermeneutik als Ethik, hrsg. Hans–Martin Schönherr–Mann, München 2004, S. 117 – 133. 266 die grundsätzliche Unaufhebbarkeit der Andersheit bestätigt. Aus diesem Grund möchte ich mich zunächst Gadamers Rekurs auf Aristoteles’ Phronesis in seinen frühen Arbeiten und in Wahrheit und Methode zuwenden. Ich hoffe, dass wir auf diesem Weg die Frage beantworten können, von welcher Bedeutung die universale Sprachlichkeit in Gadamers Kontext ist, auf welche Weise das dynamische Anerkennungsverhältnis im Dialog vorkommt oder ob der Dialog selbst die Bewegung des Anerkennens ist und schließlich ob der Dialog ohne das praktisch-ethische Fundament denkbar ist. 267 I. Die dialogische Verständigung als die Gemeinsamkeitsbildung durch die sprachliche Vermittlung I – 1. Die Universalität der Sprache, in der wir sind In der philosophischen Hermeneutik bezieht sich die Universalität der Sprachlichkeit des menschlichen Verstehens, mit Gadamers berühmtem Satz gesagt, „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache“ (GW. 1, S. 478), auf das hermeneutische Bewusstsein, das unter der geschichtlichen Bedingtheit steht und sich mit dem uns Betreffenden unter der Bedingung dieser Begrenztheit auseinandersetzt. Somit kann man sagen, dass Gadamers Grundeinsicht in die Sprachlichkeit des hermeneutischen Verstehens zu dem tendiert, was im Verstehensprozess immer schon sprachlich geschehen ist. Die hermeneutische Wendung zur Sprache, wie Gadamer in Anlehnung an Platons „Flucht in die Logoi“ gesagt hat, verweist auf die sprachliche Erschlossenheit der menschlichen Welterfahrung. Wir können im Prinzip alles sprachlich formulieren; wir können uns darum bemühen, die Sprache mit unserem Partner gemeinsam zu finden. Dieses universale Können, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist bei Gadamer die menschliche Fähigkeit, dasjenige, was ist, in eine sprachliche Formulierung zu überführen. Gleichwohl liegt Gadamers Sprachauffassung gerade nicht darin, dass alle Dingwelt sprachlich, sagbar ist, dass die Sprache das Denken an sich vollendet erschöpft, sondern sie weist darauf hin, dass sich die menschliche Welterfahrung in der eingeborenen Sprache bildet, d. h. dass das Verstehen von vornherein der Sprache zugehörig und die Welt vermittels der Sprache zugänglich ist. Aus hermeneutischer Sicht ist die Sprache deshalb nicht mehr das Objekt der Besitzergreifung, mit dessen Beherrschung wir unseren Gesprächspartner argumentativ niederschlagen können und ihn zum Irrtum verführen können 5 , sondern sie ist 5 Habermas hat sich in seinem Aufsatz „Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik“, wie wir bereits gesehen haben, mit der Kritik an Gadamers Hermeneutik beschäftigt: Es geht hier um Gadamers Akzentuierung der konstitutiven Rolle der Rhetorik in der Gesprächsführung. Gegen Gadamers dialogische Perspektive hat Habermas insbesondere die Gefahr der sophistischen Verführung der Sachwahrheit durch die Überredungskunst, wie seit Aristoteles’ Kritik bekannt war, und die ‚ideologische’ Propaganda im gesellschaftlichen Machtverhältnis, betont. Dessen Ansicht nach stellt er die unverzichtbare Rolle der „Reflexivität“ und der „Objektivität“ für die rationale Begründung im kommunikativen Handeln ins Zentrum. Wenn Habermas deshalb den Anspruch auf die „Metasprache“ erhebt, tendiert seine Intention zu dem Verdacht gegen den lebendigen Sprachaustausch in der Lebenswelt. Aus Gadamers Sicht ist die Rhetorik hingegen nicht bloße Überredungskunst, die mit einer vorbestimmten Zielsetzung des argumentativen Niederschlags des Gesprächspartners anfängt, sondern sie dient im andauernden Gesprächsprozess dem Bilden der Überzeugungskraft, weil sie uns zum Wahren und zum Guten führt. Die Rhetorik im Gesprächsaustausch ist nicht mehr eine sophistische Redekunst, die das Wahre, das Gute tarnt und uns damit in die Irre führt, sondern sie leistet immer die konstitutive Funktion im Dialog, uns das Moment der reflexiven Selbstüberprüfung der eigenen Gewissheit zu verleihen. Um sich über das Wahre und das Gute gemeinsam verständigen zu können, bedarf die Gesprächsführung der Rhetorik. Denn ein guter Rhetoriker weiß, welches Wort in einer bestimmten Gesprächsphase angemessener als ein anderes ist, damit das, was er eigentlich sagen 268 der entscheidende Ort, an dem das Sein erscheint. Wir müssen bedenken, dass die Sprache nicht vom atomisierten Subjekt manipulierbar, beherrschbar ist. Demgegenüber bildet sie von vornherein den übersubjektiven Sinnhorizont, in dessen Licht wir uns dialogisch verständigen. Darüber hinaus darf man nicht außer Acht lassen, dass die bildhafte Wiedergabe, Gadamers Ansicht zufolge, jenseits unserer Sprache liegt, so lange wie die menschliche Welterfahrung in den geschichtlich bedingten Lebenszusammenhängen entsteht. Von hier aus führt uns das Bewusstsein unseres Mangels, dass uns die nötige Sprache fehlt, zur Sprachsuche hin. So schlägt die Sprache den offenen Weg ihrer Selbsterweiterung und –entfaltung ein. An dieser Stelle möchte ich auf die Sprachlichkeit des menschlichen Verstehens, die Gadamer als „Sprachverfasstheit“ bezeichnet, anders formuliert, auf die konstitutive und einführende Funktion der Sprache in unserem sorgfältigen Umgang mit der Welt, eingehen. Hier geht es insbesondere darum, dass die Sprache in der philosophischen Hermeneutik in einer ununterbrochenen Wechselbeziehung zu ihrer Grundstruktur steht, d. h. dass die Sinnangebote, welche die Welt uns gibt, im sprachlich erschlossenen Zwischen gebildet werden. Die Erscheinung der Sachwahrheit bewegt sich stets mit der Sprache mit. Die Wahrheit, die die menschliche Erfahrung von vornherein anstrebt, ist deshalb, so wie Gadamer der Platonischen „Lichtmetapher“ im Endteil von Wahrheit und Methode seine Aufmerksamkeit zuwendet, in der Sprache „einleuchtend“. Sprache selbst ist immer ‚wahr– scheinend’, weil die Wahrheit in ihrer sprachlichen Verlautung mitklingt. In diesem Sinn bildet die Sprache einen ausgezeichneten Ort der Selbsterscheinung der Wahrheit. Beide gehören einem einheitlichen Sinnganzheitshorizont an, in dem die unüberbrückbare Kluft überwunden ist. Diese einheitliche Zusammengehörigkeit bildet deshalb die ontologische Grundlage unserer sprachlichen Welterfahrung, der wir bereits zugeordnet sind. Insofern liegt Gadamers Anliegen zur Sprachverfasstheit der Welt darin, dass die Sprache nicht mehr das zweitrangige Abbild, sondern das einleuchtende Aufgehen der Wahrheit ist, ähnlich wie der schöne Schein im Kunstwerk das Lebensganze, das sich selbst unendlich und unaufhörlich entfaltet, umfaßt und dementsprechend seinen Wahrheitsbezug etabliert. Die Sprache als der Erscheinungsort der Sachwahrheit ist nunmehr die Wechselbeziehung als solche, in deren Hin und Her sich die menschliche Wahrheitserfahrung ereignet. Die ineinander übergehende will, den Hörer überzeugen kann. In diesem Zusammenhang zeigt die Rhetorik, nämlich „echte Rhetorik“, wie Gadamer gesagt hat, „zwar auch nicht die Sache auf, wie der Redner sie sieht, sondern gibt sie den Hörern als etwas aus, was sie nicht ist, aber geleitet von einer sachlichen Absicht: die Andern auf dem Wege dieses Täuschens von etwas zu überzeugen und zu etwas überreden, woran dem Redner liegt. Er redet also nicht, um sich oder seine Kunst zu zeigen, sondern um seine Hörer zu etwas zu bestimmen, das er zu vertreten imstande wäre, das er aber vor Vielen nicht einfach wie es ist zeigen kann, weil die Vielen nicht der Eine sind, den man allein in sachliche Verständigung zwingen kann.“ (GW. 5, „Platos dialektische Ethik (1931)“, S. 37) Insbesondere zum Stellenwert der Rhetorik in Gadamers Hermeneutik, vgl. Jean Grondin, „Unterwegs zur Rhetorik“, in: Hermeneutische Wege, S. 207 ff. 269 Wechselbeziehung ist „aufgrund der Selbstbedeutung des Scheins möglich, weil die Beziehung auf Wahrheit nur aus der Beziehung des Scheins auf sich selbst sichtbar wird.“ 6 Sie hat deshalb ihre unendliche Bewegtheit, auf deren Grundlage die Sprache den Mitvollzug leistet, so lange die Wahrheitserfahrung keine unmittelbare Konfrontation mit dem nackten Objekt, sondern die Einsiedlung in die Welt und die Auslegung der Welt vermittels der Sprache ist. Aus Gadamers Sicht hat die Sprache diese dialogische Bezüglichkeit zu ihrem Grundcharakter, da sie von vornherein auf ihre Sache gerichtet ist. Die Sprache selbst hat mit dem unaufhörlichen Versuch der Transformierung des unendlichen Ganzen zur sichtbaren Gestaltung zu tun. In diesem Sinn stiftet die Sprache, die den dialogischen Bezugspunkt innehat, den gesellschaftlich erzeugten Sinnhorizont, in dem nicht nur die Welt auf jede Weise erschlossen wird, sondern wir uns auch miteinander verständigen. Aus der Perspektive der dialogischen Gerichtetheit der Sprache, nämlich der zirkulären Wechselbeziehung der Sprache auf die Anderen, müssen wir bedenken, welche Bedeutung die Universalität der Sprache bei Gadamer hat, wie das Denken durch die Sprache vermittelt wird, wenn das Denken nur durch die Sprache zum Ausdruck kommen kann und wo die Sprache ihre Vollzugsform hat, wenn sie von vornherein die Wechselseitigkeit zu ihrer Grundstruktur hat. Mit seiner Einsicht in die Sprachverfasstheit der Welt geht Gadamer davon aus, dass die Welt an sich sprachlich ist. Gadamers Ansicht über die Sprachlichkeit des hermeneutischen Verstehens im dritten Teil von Wahrheit und Methode geht, wie bekannt, von der Kritik an der instrumentellen und nominalistischen Sprachauffassung in der abendländischen Denktradition aus, die er als die „Sprachvergessenheit des abendländischen Denkens“ bezeichnet. (GW. 1, S. 422) Gadamers Ansicht zufolge war die Idee, dass die Sprache dem Denken oder der Vorstellungserkenntnis der Dinge adäquat entspricht, eine grundsätzliche Hauptströmung der abendländischen Denktradition von Platons Kratylos 7 bis zur analytischen Sprachphilosophie. Selbst in Platons 6 G. Figal u. H.–G. Flickinger, „Die Aufhebung des schönen Scheins – Schöne und nicht mehr schöne Kunst im Anschluß an Hegel und Adorno“, in: Hegel – Studien (Bd. 14), Bonn 1979, S. 212. Der Aufsatz gibt uns den Hinweis, dass der Begriff „Schein“ seinen Stellenwert in Hegels Logik deshalb hat, weil der Schein auf dem Übergang von der Seinslogik zur Wesenslogik einen systematischen Bezugspunkt bildet und in dieser Verknüpfungsfunktion einen Anteil am begrifflichen Wissen hat. Da das begriffliche Wissen hier durch die Vermittlung des Scheins zum Ausdruck kommt, bezieht sich der Schein auf die Wahrheit, die mit der Begriffsergreifung vollendet wird. Es geht hier um die Beziehung im logischen Verlauf zum Begriff, mit der sich die wesentliche Ganzheit verbindet. Uns sagen die Autoren deshalb weiter: „Der schöne Schein ist autonomer Schein, insofern Wahrheitsbezüge kraft seiner Selbstbeziehung zustande kommen. Die Selbstbeziehungsstruktur ist zugleich Bedingung seiner, des schönen Scheins, Zugehörigkeit zur Sphäre der Vernunft.“ (S. 213) 7 Zunächst müssen wir beachten, dass Gadamer sich des öfteren als Platoniker darstellt, dass Gadamers gesamter Gedankengang hauptsächlich Platons dialogische Idee im Auge behält. Davon abgesehen behandelt Platons Dialog Kratylos, den wir beinahe als Platons einzige Sprachphilosophie verstehen können, zwei ursprüngliche Sprachkonzeptionen: Die eine ist der Konventionalismus, dessen Auffassung zufolge alle Wörter, nämlich alle 270 Dialog Kratylos, der die sprachphilosophischen Probleme ins Zentrum stellte, wurde die Sprache aus Gadamers Sicht instrumentell verstanden, da Platon mit Sokrates sagen wollte, dass sie erst nach dem Denken kommen würde. Mit anderen Worten: Platon wollte in diesem Dialog zum Ausdruck bringen, dass man die Erkenntnis der Dinge ohne die Sprache gewinnen kann. 8 Unfreiwillig hat er hier vorausgesetzt, dass das Wort nur das Zeichen der Dinge, nämlich dasjenige, das dem Ding gegenüber steht, sein muss. Von hier aus ist die Sprache in ihr prekäres Referenzverhältnis zum Vorstellungsinhalt geraten und sie hat der unerreichbaren Reduktion auf das Erkenntnisobjekt die Erfüllung ihres Gültigkeitsanspruchs zu verdanken. Diese Sicht auf die Sprache lässt im Grunde außer Acht, dass das Wort im ganzen Erkenntnisprozess immer schon mitwirkt. Darüber hinaus steht die analytische Sprachphilosophie zweifelsohne auch unter dieser Traditionslinie, da sie sich von vornherein auf dem Anspruch gründet, dass es möglich sein muß, bei dem Gedanken an Sprache, zu wissen, was damit gemeint ist. Hinter diesem fatalen Anspruch der analytischen Sprachphilosophie versteckt sich ein gewisser Glaube, nämlich der, dass die Sprache objektivierbar ist. Somit ist die Sprache ihr Untersuchungsgegenstand, womit sie die Sprache zugleich zum „Ding“ macht. Hier setzt der Anspruch auf Objektivierbarkeit noch immer die unauflösbare Scheidelinie zwischen der Sprache und dem Denken bzw. dem Ding voraus. So gesehen ist die analytische Sprachphilosophie auch auf die instrumentelle Sprachauffassung festgelegt, da sie die Sprache zum wissenschaftlichen Objekt im Anschluss an das Denkmodell der erkenntnistheoretischen Objektivität macht. Wenn die Sprachphilosophie diese Grundidee des naturwissenschaftlichen Bewusstseins zu ihrem Vorbild hat, dann können wir uns fragen, was Sprache, die über die Sprache als das Objekt spricht, ist. Kann man die Sprache überhaupt zum Forschungsobjekt machen, wenn über die Sprache als wissenschaftlicher Gegenstand wiederum nur über die Sprache kommuniziert werden kann? An dieser Stelle wird deutlich, dass die analytische Sprachphilosophie die 8 begrifflichen Kategorien, ihre Bedeutung unter den geschichtlichen Verwendungsumständen der Sprachgemeinschaft erwerben. Die andere ist der Naturalismus, der alle Wörter nur als die genauen Abbilder in der unmittelbaren Konfrontation mit demjenigen, was vor uns steht, ansieht. Das Thema dieses Dialogs wird von Anfang an genannt, wenn ich zitiere: „[…], jegliches Ding habe seine von Natur ihm zukommende richtige Benennung, und nicht das sei ein Name, wie einige unter sich ausgemacht haben etwas zu nennen, indem sie es mit einem Teil ihrer besonderen Sprache anrufen; sondern es gebe eine natürliche Richtigkeit der Wörter, […].“ Im Diskussionsrahmen geht es deshalb darum, wie die sophistische Verführungsgefahr durch das Argumentationsverfahren vermeidbar ist, wie wir die richtige Erkenntnis der Dinge erreichen können, wenn die Wörter nicht ganz die natürliche Ähnlichkeit mit dem Wesen der Dinge enthalten. Platon, Kratylos, in: Platons Werke, Bd. 3, übers. von F. Schleiermacher, Darmstadt 1974, 383a – b. Diesbezüglich sagt uns Sokrates im Kratylos: „[…] Denn es gibt ja keine. Sondern offenbar muß etwas anderes aufgesucht werden als Worte, was uns ohne Worte offenbaren kann, welche von diesen beiden die richtigsten sind, indem es uns nämlich das Wesen der Dinge zeigt.“ Und er sagt weiter: „Es ist also doch möglich, wie es scheint, Kratylos, die Dinge kennenzulernen ohne Hilfe der Worte, wenn sich dies so verhält.“ Ebd. 438d – e. 271 Tatsache übersieht, dass die Sprache im wesentlichen nicht objektivierbar ist, da sie ihren Sinnraum aus sich selbst heraus schafft. Aus Gadamers Sicht gibt es eine Ausnahme in der Sprachvergessenheit der abendländischen Denktradition, nämlich die Trinitätslehre von Augustinus, die Inkarnationslehre im christlichen Denken, mit der wir uns in Bezug auf die spekulative Dimension der Sprache beschäftigen müssen. Aus hermeneutischer Sicht zeigt sich die traditionelle Sprachvergessenheit auf zwei Weisen: Einerseits als die objektive Erkenntnis der Dinge, andererseits als die unhinterfragbare Souveränität des Denkens gegenüber der Sprache. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit zunächst dem sogenannten vorstellungserkenntnistheoretischen Glauben an die Objektivität zuwenden, muss der Erwerb der richtigen Erkenntnis durch die unmittelbare Konfrontation mit dem nackten Objekt ohne die Vermittlung der Sprache möglich sein. Hier besteht die Erkenntnis in der adäquaten Korrespondenz mit der Dingwelt innerhalb der exakten Verstandeskategorien, die vom Erkenntnissubjekt verwandt werden. Von den Erkenntnisobjekten gewinnt das Subjekt die verschiedenen Wahrnehmungsinhalte. Daran anschließend separiert das Erkenntnissubjekt auch die Informationen und ordnet die unterschiedlichen Informationen zugleich in den Zusammenhang ein. Auf diese Weise wird die klassifizierte Information, die von der Dingwelt unmittelbar gegeben zu sein scheint, unter den allgemeinen Begriff subsumiert. Da die Vorgänge der Erkenntnis der Dinge hier auf dem Kausalverhältnis beruhen, tendiert die Subsumtion der einzelnen Information unter den allgemeinen Begriff, mithin zu der Feststellung des unhintergehbaren Grundes, aus dem jede Erkenntnis objektiv logisch abgeleitet werden kann. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass das ideale Streben nach dem Erwerb der objektiven Erkenntnis zunächst die bildhafte Wiedergabe des Dings durch das Wort vorausgesetzt 9 und anschließend die Sprache, die hier z. B. als Verstandeskategorie gilt, nur als ein Instrument für die Übermittlung der wahrgenommenen 9 Informationen herabgesetzt hat. Hinter diesem Ideal der M. E. gäbe es diese nominalistische Sprachkonzeption, die auf der Voraussetzung der ontologischen Angleichung der Dinge mit dem Begriff den Sprachsinn vereinfachen und verkürzen will. Ihr ideales Ziel richtet sich darauf, die sinnlose Sprache durch die Reduktion auf die Substanz zu eliminieren und mit der logischen Genauigkeit des Sprachgebrauchs, die die mathematische Genauigkeit zum Vorbild hat, den wahren Urteilssatz vom falschen zu unterscheiden. Indem die nominalistische Sprachauffassung den Sprachsinn an der substanziellen Dingwelt zu messen trachtet, beschränkt sie die vielfältigen Potenzen des Sprachsinns auf das verkürzte Bedeutungsfeld. Aber die Argumentation der nominalistischen Sprachkonzeption muss diesen Fall, wie G. Frege uns zu verstehen gibt, erklären können, nämlich dass sich ein Namensträger als verschiedene Namen erweist, d. h. dass ein Begriffsumfang demjenigen, der durch das Wort bezeichnet wird, nicht entspricht. In diesem Sinne sagt Frege uns: „Es liegt nun nahe, mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung, Schriftzeichen) außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gegebenseins enthalten ist. […] Es würde die Bedeutung von „Abendstern“ und „Morgenstern“ dieselbe sein, aber nicht der Sinn.“ Gottlob Frege, „Über Sinn und Bedeutung“, in: Funktion, Begriff, Bedeutung, hrsg. v. Günther Patzig, 3. Aufl., Göttingen 1969, S. 41. 272 Instrumentalisierung der Sprache ist auch die substanzielle Metaphysik versteckt. Denn wenn das Wort nur das Zeichen von etwas wäre, hätte das Wort das nachträgliche Bezeichnungsverhältnis zum Erkenntnisobjekt. Damit steht das Ding als Kriterium für die objektive Erkenntnis dem Wort gegenüber. Gadamer hingegen weist darauf hin, dass die Erkenntnis der Dinge immer schon durch die Sprache zustande kommt, so lange die menschliche Erfahrung innerhalb des sprachlich verschafften Sinnraums mit der Welt umgeht und sich somit innerhalb sämtlicher Lebensbezüge befindet. Gadamers Ansicht zufolge lässt die Überschätzung der Autorität des Denkens, insbesondere in der neuzeitlichen Subjektsphilosophie, auch die kreative Kraft und die mitkonstitutive Fähigkeit der Sprache im dynamischen Prozess der Denkbildung außer Acht. In diesem instrumentellen Sprachverständnis ist die Sprache nur ein nutzbares Werkzeug für die Verlautung des Denkens, d. h. das Denken ist eine souveräne Substanz, die sich ohne die Sprache entäußern kann. Hier wird die Sprache dem prekären Bestandteil der Denkbildung zugeordnet, sofern das Wort die Übereinstimmung mit dem Denkinhalt nicht ständig auf Recht erhält. Da das Wort ein Instrument zur Verlautung des Denkinhaltes im primären Verhältnis des Denkens mit der Dingwelt ist, wird die Sprache in der instrumentellen Sprachauffassung mithin als ein beherrschbarer Gegenstand verstanden, mit dessen Besitz das Denken seinen inneren Inhalt im logischen Beweisverfahren evident wiederherstellen kann. Wenn aber das Denken die Wahrheit nicht bereits enthält, sondern sie ständig sucht, nämlich permanent anstrebt, muss sich das Denken in den dialektischen Prozess der ununterbrochenen Bemühung um die Offenlegung der Wahrheit begeben. Auf diesem dynamischen Weg setzt das Denken seine eigene Bewegung aus der Selbstüberwältigung und der Selbstfeststellung fort, damit es zur Sprache kommt. 10 Somit stellt Gadamers Hermeneutik die strukturelle Verwandtschaft des Denkens mit der Sprache in den Vordergrund, da das Denken sich selbst in der Sprache vollzieht und auch bildet. Diese unaufhörliche Denkbewegung zum Erwachen der Wahrheit zeigt, dass das Denken mit seinem vorübergehenden Bruch zur Sprache kommt 10 Im gegenwärtigen Diskussionsrahmen wird deutlich, dass das denkende Subjekt die unauflösbare Zirkelstruktur der Selbstreflexion hat, weil das reflexive Selbstbewusstsein immer zwischen dem Selbstbezug und dem Fremdbezug, nämlich zwischen dem Bewusstsein von sich selbst und dem Bewusstsein von etwas steht. In Bezug auf die Unendlichkeit der reflexiven Denkbewegung zwischen dem Gegenstandsbewusstsein und dem Selbstbewusstsein sagt M. Frank, wenn ich hier die Sätze in Gänze zitiere: „Sie (= die philosophische Tradition) ist offensichtlich unhaltbar. Denn wäre Bewußtsein durch Selbstbezug ausgezeichnet – so, daß dasjenige, von dem Bewußtsein besteht, erst mit dem Gewahren in den Blick käme -, so wäre das erste Bewußtsein (in der Stellung des Gegenstandes) auf ein zweites Bewußtsein (in der Stellung eines Subjektes) verwiesen: auf ein Bewußtsein, das, selbst unbewußt, abermals auf ein Bewußtsein verwiesen wäre, für welches das gleiche Erfordernis gälte, das also, um zu sein, was es ist, auf ein viertes Bewußtsein angewiesen wäre, und so ad infinitum. Nun besteht aber Bewußtsein, also kommt das Reflexionsmodell als Erklärung des Phänomens nicht in Betracht.“ Manfred Frank, „Subjekt, Person, Individuum“, in: Die Frage nach dem Subjekt, hrsg. ders., Gérard Raulet, Willem van Reijen, u. a., Frankfurt a. M. 1988, S. 11. 273 und umgekehrt die gesagte Sprache den Anlass zum weiteren Denken gibt. Die Sprache ist daher dem Denken weder reflexiv nachgegangen, noch ahmt sie die formallogische Folge des Denkens nach, sondern das Denken selbst ist ein anstrengender Versuch, die treffende Sprache zu finden. Dementsprechend müssen wir darauf achten, dass die Sprache die Spur des Denkens ist und das Denken immer schon mit der Selbstübertragung in die Sprache Schritt hält. Daraus folgt aus hermeneutischer Sicht, dass der Sprachgebrauch in der bestimmten Situation dasjenige, was das Denken in seiner eigenen Situation sagen will, ist, wenn auch die Aussage das Denken nicht ganz erhellen kann. Auf diesem offenen Weg hat das Denken vermittels der Sprache die unendliche Bewegtheit der Herauslösung aus den erstarrten Dogmatismen. Mit dieser Kritik an der Sprachvergessenheit in der abendländischen Denktradition wird Gadamers Anspruch auf die hermeneutische Universalität 11 der Sprachlichkeit gekoppelt, die sich mit dem umstrittenen Satz, „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache“, in Wahrheit und Methode zeigt. In Gadamers Hermeneutik hat Sprache nunmehr keinen derivativen Seinswert, sondern sie selbst ist, wie Heidegger gesagt hat, „das Haus des Seins“. 12 Denn die Sprache ist die hervorragende Stätte der Selbsterscheinung des Seins. Aber dies besagt bei Gadamer nicht, dass die Sprache ohne Grenze das Sein an sich erschöpft. Mit anderen Worten: Gadamers obiger Satz meint nicht die „Gleichsetzung von Sein und Sprache“, 13 sondern er weist darauf hin, dass das verstandene Sein zur Sprache kommt. 14 Insofern zielt die hermeneutische Ereignisontologie der Sprache, die wir als Gadamers Universalität der Sprachlichkeit bezeichnen können, nicht auf die vollendete Erhellung des Seinssinns durch die Sprache ab, sondern sie ist mit unseren tätigen Verstehensvorgängen verbunden. Dementsprechend legt Gadamer uns seine spätere Erklärung vor: „Wenn ich den 11 Hendrik Birus, „Einleitung“, in: Hermeneutische Positionen – Schleiermacher – Dilthey – Heidegger – Gadamer, hrsg. ders., Göttingen 1982, S. 11 – 12. Dort sagt er: „Als universalisierter und dazu noch möglichst vom Makel des Subjektiven gereinigter Begriff verliert >Verstehen< nahezu jegliche Bestimmtheit und verschwimmt mit dem der >hermeneutischen Erfahrung<; die Differenz zwischen den Gegenständen des Verstehens (historischen Berichten, philosophischen Texten, Dichtungen etc.) wird in einem totalen Universum des Sinns eingeebnet – nicht von ungefähr wird von Gadamer ein Aufgehen der Ästhetik in der Hermeneutik gefordert; und schließlich schwindet auch die Differenz zwischen Verstehenden und Verstandenem: die Tradition sagt mir immer, wer ich bin – und nichts anderes.“ (meine Hervorhebung) Aber wir dürfen nicht übersehen, dass die hermeneutische Universalität, wie häufig betont, keinesfalls auf die totale Identifizierung durch die Aufhebung der Verschiedenheit der Differenten verweist, sondern es hier um die hermeneutische Situation geht, in der wir den Anderen begegnen und sie verstehen wollen. Die Universalität der hermeneutischen Situation enthält deshalb immer die ununterbrochene Begegnung mit dem Anderen in seiner Andersheit, weil die unaufhebbare Andersheit den Möglichkeitshorizont des Verstehens permanent eröffnet. 12 M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, S. 166. 13 Gianni Vattimo, „Weltverstehen – Weltverändern“, in: >>Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache<<, hier S. 54. In diesem Aufsatz hat er sich, wie der Titel andeutet, insbesondere mit der auffälligen Wendung der hermeneutischen Ontologie in Wahrheit und Methode, in der er von „eine[r] grundlegende[n] Revolution der Ontologie“ (S. 53) gesprochen hat, beschäftigt. 14 Zur satzanalytischen Interpretation, vgl. Jean Grondin, Von Heidegger zu Gadamer, S. 100 – 105. 274 Satz schrieb: >>Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache<<, so lag darin, daß das, was ist, nie ganz verstanden werden kann. Es liegt darin, sofern alles, was eine Sprache führt, immer noch über das hinausweist, was zur Aussage gelangt. Es bleibt, als das, was verstanden werden soll, das, was zur Sprache kommt – aber freilich wird es immer als etwas genommen, wahr–genommen. Das ist die hermeneutische Dimension, in der Sein >sich zeigt<.“ (GW. 2, S. 334) Gadamers Grundeinsicht besteht daher darin, dass das verstandene Sein, mit dem wir in einer bestimmten Situation umgehen und zu dem wir allein durch die Sprache Zugang haben, sprachlich ausgedrückt werden kann. Nur dasjenige, was zu sagen ist, ist bei Gadamer das verstandene Sein, das sich durch die Teilnahme unseres Verstehens „zeigt“. Die hermeneutische Universalität der Sprache setzt nicht die absolute Abgeschlossenheit der Verstehensvorgänge durch die bildhafte Wiedergabe des Seinssinns voraus, sondern sie akzentuiert insbesondere die potenzielle Fähigkeit der Sprache, unsere dogmatische Befangenheit zu erschüttern und die Sinnwelt immer wieder neu zu konstruieren. Denn die Sprache bietet uns die Sinnwelt an und der sprachlich erschlossene Sinnraum erweitert sich damit zum unabschließbaren Erwartungshorizont der vollkommenen Übereinstimmung mit dem Sachverhalt. Darüber hinaus müssen wir dem Sinnfeld des zu Verstehenden, nämlich dem Verstehen–Können im obigen Satz, unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Dass das, was ist, in der Sprache verstanden werden kann, verweist nicht nur darauf, dass das verstandene Sein zur Sprache kommt, sondern auch darauf, dass sich die Potenzen des Verstehen–Könnens mit der Verlautung des Seinssinns mitbewegen. Die hermeneutische Verständlichkeit von demjenigen, was ist, vollzieht sich deshalb im Mitvollzug der Sprache. In diesem Sinn ist das sprachliche Verstehen des Seins bei Gadamer am Können, wie Heideggers Formel („sich auf etwas verstehen“) den Hinweis gibt, gebunden. Außerdem ist dieses Können das praktische Bewusstsein vom Können, da das Können hier nicht nur die theoretische Verständlichkeit, sondern auch die praktische Fähigkeit mit einschließt, die Gadamer in Anknüpfung an das altgriechische Begriffsfeld der „poiesis“, nämlich „Herstellen–Können“, das das Sinnfeld vom „Machen–Können“ als dem technischen Wissen und dem „Dichten–Können“ als der Kunst umfasst, im Auge behält. Indem das Können aus hermeneutischer Sicht die umfassende Möglichkeit der menschlichen Tätigkeit enthält, führt das Bewusstsein vom Können uns nicht nur zur Erfahrung des Gegenstandes hin, sondern lässt uns auch das dialogische Handlungsfeld betreten, das die kommunikative Wir–Dimension, die jedem Betroffenen die reflexive Unterscheidung des Könnens vom Nicht–Können erlaubt, ist. Auf dem dialogischen Handlungsfeld behält das praktische Bewusstsein vom Können das zu Verstehende in Bezug 275 auf das Verstandene stets im Sinn. Das dialogische Verstehen, das sich auf das praktische Bewusstsein vom Können stützt, führt zudem den eigenen Denkbildungsprozess in der sprachlichen Wiederbelebung des Verstandenen durch, da wir die Welt sprachlich artikulieren, den Anderen erreichen und uns selbst verständigen. Nun ist das Sein im Grunde bei Gadamer dasjenige, was dialogisch zu verstehen ist. Dass das Sein im dialogischen Verstehensfeld auszusagen ist, bedeutet bei Gadamer die „Sprachverfasstheit“ der Welt. Diese Sprachauffassung weist darauf hin, dass sich die Welt sprachlich artikuliert. Dadurch, dass sich die Welt durch die Sprache darstellt und dass die menschliche Erfahrung auf die sprachliche Artikulation der Welt angewiesen ist, ist die Sprache der „Kern der Hermeneutik“. 15 Das „Zur–Sprache–kommen“ des Sachsinns in der Welt (GW. 1, S. 384) ist nunmehr bei Gadamer die Übertragung des Sachsinns auf das Wort, nämlich das Sprachgeschehen im umsichtigen Umgang mit der Welt. Außerdem skizziert diese Übertragung der Sache ins Wort aus hermeneutischer Sicht die unendlich wiederholbare Selbstmanifestation, in der sich die Welt für uns weiter verändert. Da die Veränderung zum Wort, nämlich zum Gemeinsamen immer schon auf die Sache und auf uns gerichtet ist, wie das Kunstwerk in der Kunsterfahrung bei Gadamer für das Dargestellte und für uns steht, ist ihr selbst der „Zuwachs an Sein“ zugehörig. (GW. 1, S. 145) In der Sprache ist dasjenige, was die Welt uns verleiht, deshalb nachvollziehbar, da die Sprache selbst den wesentlichen Bezugspunkt auf die Welt etabliert, d. h. die Welt in der Sprache immer „anwesend“ ist: „Die Welt ist nur da im >>da<< der Sprache.“16 Die Sprache ist mithin ein ontologischer Fundus,17 in dem die Welt für uns erschlossen ist. Die Sache in der Welt und die Sprache befinden sich in einer unauflösbaren Wechselbeziehung, da die Sprache von vornherein auf die Sache gerichtet ist und die Sache sich durch die sprachliche Erhellung darstellt. In diesem Sinn ist 15 Emil Angehrn, Interpretation und Dekonstruktion, S. 27. Jean Grondin, Einführung zu Gadamer, S. 229. 17 Es wird, wie bereits bekannt, deutlich, dass Gadamer seine ontologische Auffassung in Anknüpfung an Heideggers Fundamentalontologie weiter erarbeitet. Bei der Aufnahme der Heideggerschen hermeneutischen Perspektive, dass Heidegger den Seinssinn in der Interpretation der Seinsgeschichte offen zu legen trachtet, in seine philosophische Hermeneutik versteht Gadamer Heideggers Fundamentalontologie als einen konsequenten Denkweg von der „Kehre“ zu Heideggers frühen Ontologie. Die Ontologie als Wissenschaft des Seins der Seienden, die deshalb bei Aristoteles als „Erste Philosophie“ verstanden wurde, zielt im ursprünglichen Sinn auf die wissenschaftliche Analyse des Seins bzw. der Seienden ab. Insofern ist sie auf der Theorie der Gegenständlichkeit, die wir die Präsenzontologie nennen können, fixiert. Von hier aus hat Heidegger bereits in seiner Studienzeit gelernt, dass sich die Ontologiekonzeption seit Aristoteles zeitlich und unterschiedlich entwickelt hat, dass die traditionelle Ontologie nur das „Vorhandensein“ ohne das „Zuhandensein“, nämlich das bestimmte Gegenwärtigsein ohne seine Zukünftigkeit behandelt. Aus Heideggers Sicht gibt uns die geschichtliche Umwandlung der Ontologiekonzeption den entscheidenden Hinweis, dass das Sein selber zeitlich sei und dass die traditionelle Ontologie ihre eigene Betrachtungsposition, auf der die unhintergehbare Substanz sich der ontologischen Objektivität versichert, außer Acht gelassen habe. Heidegger wollte die Substanzmetaphysik in die ontologische Analyse der lebensweltlichen Praxis, die wir in seinem Buch „Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles“ finden können, in seiner frühen Hermeneutik umsetzen. Martin Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, Stuttgart 2002. 16 276 die Sprache bei Gadamer das „Da“ der Welt, in dessen Modus sich die Welt im Nu offenbart. Mit anderen Worten: Das „Da“ als der Modus der ontologischen Manifestation der Welt ist hier das sprachliche Vorkommnis, mit dem wir die Sache verständlich machen. Insofern nimmt das hermeneutische Verstehen desjenigen, was die Welt uns jeweils zeigt, seine Vollzugsform als Sprache an. So stiftet Sprache ihren eigenen Sinnraum, in dem wir die Welt erfahren. Dass die Sache dasjenige, was zu verstehen ist, innerhalb des sprachlich modifizierten Sinnraums zeigt, bedeutet in Gadamers Hermeneutik die Sprachzugehörigkeit der menschlichen Welterfahrung. Die Sprache hält den Sachverhalt in ihrer Gerichtetheit zusammen und stiftet das gesamte Sinnnetzwerk, in dem sich die menschliche Welterfahrung auf einer gleichzeitigen Punktualität befindet. Wenn wir die wechselseitige Gerichtetheit der Sprache hier weiter bedenken, schließt die Sprache auf dem offenen Weg zur unabschließbaren Erfahrung der Wahrheit die kundgebende Beziehung mit ein, da sich der Sachverhalt durch die Sprache ausdrücken lässt. Hier zeigt sich, dass das ineinander übergehende Wechselverhältnis von der Sache und der Sprache im ununterbrochenen Verlauf der menschlichen Welterfahrung nunmehr die hermeneutische Struktur der gemeinsamen Selbstauslegung bilden. Deswegen steht die sprachliche Gerichtetheit im Grunde nicht mehr unter dem einseitigen Präsenzverhältnis des Objektes. In der gemeinsamen Wahrheitssuche der menschlichen Erfahrung befindet sich die Sprache auch im Dialogverhältnis. Denn die Sprache ist immer schon auf den Anderen gerichtet und kann aufgrund dieser dialogischen Gerichtetheit den Anderen erreichen. So gesehen ist die ganze Welt, die sich stets durch die Sprache ausdrückt, wie Gadamer sagt, „nie die Welt eines ersten Tages, sondern immer schon uns überkommen. Überall da, wo etwas erfahren, wo Unvertrautheit aufgehoben wird, wo Einleuchten, Einsehen, Aneignung erfolgt, vollzieht sich der hermeneutische Prozeß der Einbringung in das Wort und in das gemeinsame Bewußtsein.“ (GW. 2, S. 498) Gleichwohl setzt die Sprachzugehörigkeit der menschlichen Welterfahrung aus hermeneutischer Sicht auch die Unterscheidung zwischen dem Sprecher und der Welt an sich voraus. Aber der Unterschied ist hier keine gegensätzliche Spaltung zwischen Subjekt und Objekt, auf dessen Scheidelinie die beweisbare Gegenstandsobjektivität garantiert wird, sondern die uneinholbare Distanz, in deren Zwischenraum sich die menschliche Welterfahrung permanent bewegt. Da vernimmt die menschliche Welterfahrung die Sprache der Sachen in der Welt aus dem Blickwinkel ihrer geschichtlichen Situation. Unser Umgang mit der Welt ist deshalb das Sich-Einlassen auf die Welt durch die Transformierung der Sachen zum verstehbaren Wort. In diesem endlosen Umgang erweitert sich das gesuchte Wort ständig zum Gemeinsamen, auf 277 dessen Ebene es verwendbar und konkretisierbar ist. So enthält die menschliche Erfahrung als ein unendlicher und unvermeidbarer Versuch zur gemeinsamen Sprachsuche den Sozialisierungsprozess, der sich vor dem kulturellen und geschichtlichen Hintergrund entwickelt. Aus hermeneutischer Sicht ist die menschliche Welterfahrung, die in der Sprache mitschwingt, auf ihre bestimmte Perspektive angewiesen. Eine solche Welterfahrung ist keine Entzifferung desjenigen, was die Welt an sich zu sein scheint, sondern bewegt sich vor ihrem eigenen Sinnhorizont, der in einer bestimmten Situation existiert. So prägt sie die Weltanschauung, durch die wir die Welt entdecken können. Aber wir gelangen nicht alle zu der selben Anschauung, sondern zu vielfältigen Weltanschauungen, da wir verschiedene Bildungsgeschichten haben. Die Verschiedenheit der menschlichen Weltansichten zeigt hier die Begrenztheit unserer Welterfahrung auf. Diese Verschiedenheit, die man hier als Meinungsverschiedenheit bezeichnen kann, führt uns zum Dialogfeld hin, in dem sich die verschiedenen Weltanschauungen gegenseitig begegnen und einander annähern. Dementsprechend sagt Gadamer: „Als sprachlich verfaßte ist eine jede solche Welt von sich aus für jede mögliche Einsicht und damit für jede Erweiterung ihres eigenen Weltbildes offen und entsprechend für andere zugänglich.“ (GW. 1, S. 451) Wenn auch die vollständige Erfassung des An-Sich immer schon jenseits unserer Grenze liegt, müssen wir die Welt an sich und die Vielfältigkeit der menschlichen Weltanschauungen in eins mitzudenken trachten, weil unsere Welterfahrung von vornherein auf das Aufgehen der Wahrheit wartet und sich in diesem Sinn an der Wahrheit orientiert. Aber dennoch lässt ein fanatischer Glaube an die totale Kundgebung vom An-Sich uns entweder zur „theologischen“ Überwelt gelangen oder vom „luziferischen“ Wahnsinn verführen. (GW. 1, S. 421 und S. 450) Denn wenn die Welt nur an sich ist, nämlich das An-Sich der Welt nur in sich versteckt ist, soll sich das An-Sich unentbehrlich dem „Göttlichen“ zuordnen. Im anderen Fall wäre der Glaube, dass das AnSich der Welt von uns vollständig erklärbar und beherrschbar ist, „luziferisch“, weil der Mensch hier vergöttlicht würde und die ganze Welt schließlich unserer mächtigen Herrschaft verfallen würde. Angesichts dessen müssen wir beachten, dass sich die hermeneutische Sprachverfasstheit der Welt von vornherein im dialogischen Übersetzungsverhältnis der eigenen Wortfindung befindet, so lange die menschliche Welterfahrung, durch die die verschiedenen Weltanschauungen gebildet werden, ihre Wahrheit unaufhörlich herauszuarbeiten trachtet. Auf Grund der bisherigen Überlegungen über den ‚Universalitätsanspruch’ der hermeneutischen Sprachlichkeit müssen wir zunächst Gadamers Berücksichtigung der 278 Augustinischen Inkarnationslehre in seiner Sprachauffassung beachten, bevor wir die „spekulative Struktur der Sprache“, die in Gadamers Hermeneutik die dialogische Mitte meint, behandeln. (GW. 1, S. 479) Augustinus’ Inkarnationslehre ist bei Gadamer deshalb entscheidend, weil sie das spekulative Verhältnis der Sprache zum Denken deklamiert. Es geht hier einerseits um die „Wesensgleichheit“ von Denken und Sprache, wie die Anwesenheit von Gottes Vater bei Gottes Sohn. Es geht andererseits um den dialogischen Sinnhorizont der Denkbildung, wie das Gespräch von Moses mit Gott im Alten Testament zeigt. Die Inkarnationslehre als das christliche Denkerbe der Trinitätstheologie lehrt uns, dass die Inkarnation Christi keine Herabwürdigung der heiligen Gottheit, sondern die wesensgemäße Fleischwerdung Gottes sei. Demzufolge weiß Gottes Sohn von sich selbst als dem aus seinem Vater Hervorgekommenen, bei dem Gott sich gleichzeitig und vollkommen offenbart. Die verklärte Offenbarung des Gottesvaters durch seinen Sohn wird uns deshalb als die Vergegenwärtigung der wesentlichen, heilsamen Gottheit präsentiert. So ist für das Christentum die Inkarnation kein Abfall, kein Verlust der Gottheit, sondern ist im Grunde die göttliche Dreieinigkeit. Im Anschluss an die Analogie zur theologischen Inkarnationslehre muss auch gesagt werden, dass die Offenbarung Gottesvaters bei der jeweiligen Gesprächsführung mit Gott in Gang gesetzt wird. 18 Für Gadamer verweist das Gespräch mit Gott im alten Testament daher auf den dialogischen Sprachcharakter der Gottesoffenbarung. Aus diesem Denkmodell leitet er den Ereignischarakter der Sprache im dialogischen Verstehen ab. Denn er findet die wesentliche Einheit zwischen dem inneren Verborgenen und seinem äußeren Verkörperten im Inkarnationsvorgang, nämlich die sprachliche Selbstmanifestation des Denkens im Dialogvorgang. Gadamers Sprachauffassung zufolge ist die Sprache mithin die Vernehmung und Verlautbarung des inneren Denkens. Indem die Sprache die unmittelbare Präsentation des Denkens ist, vollzieht sich das innere Denken in der ständigen Übertragung auf die sprachliche Vielfältigkeit. So gesehen hält der dialogische Austausch zwischen Rede und Gegenrede aus hermeneutischer Sicht mit dem Denkbildungsprozess selbst Schritt. 18 Vgl. Jean Grondin, Von Heidegger zu Gadamer, S. 71 ff. Hier hat er hauptsächlich den hermeneutischen Wahrheitsvollzug in der menschlichen Erfahrung behandelt. Wenn die Wahrheit unserer Erfahrung im hermeneutischen Sinn nicht durch eine von uns unabhängige Objektivität garantiert wird, sondern sich auf dasjenige, was mich schon immer betrifft und mich befragt, bezieht, geht es in der Wahrheitserfahrung nun um die Angemessenheit. Mit diesem Verständnis der Wahrheitserfahrung hat er sich mit Heideggers Augustin– Vorlesung vom Sommersemester 1921 in Anknüpfung an Augustinus’ Bekenntnisse/confessiones, in denen Augustinus ein Selbstgespräch vor Gott geführt hat, beschäftigt. Wenn die hermeneutische Wahrheit mit dieser unentrinnbaren Wahrheitsfrage, die mich betrifft, rettet, und um die wir uns deshalb ständig sorgen sollen, zu tun hat, dann enthält die Wahrheitserfahrung die Gesprächsform der von sich selbst gestellten Frage und der zu suchenden Antwort. Denn die Wahrheitserfahrung als die permanente Selbstfrage ist hier ein Selbstgespräch sowohl vor der Wahrheit als auch vor Gott, das stets die unverzichtbare Frage nach dem Wesen des Menschen in sich enthält. 279 Nach dieser hermeneutischen Einsicht in die ontologische Einheit von Denken und Sprache richtet Gadamer nun seine Aufmerksamkeit auf Augustinus’ Verbum–Lehre. 19 Gadamers Grundanliegen in Wahrheit und Methode liegt hier in der Umsetzung der offenbarungstheologischen Trinitätslehre von Augustinus in den sprachphilosophischen Bereich. Seine Aufnahme der augustinischen Verbum–Lehre in die hermeneutische Sprachauffassung stützt sich deshalb auf die Prämisse, dass Augustinus seine theologische Inkarnationslehre mit der Sprachtheorie unter der Fragestellung nach der adäquaten Kohärenz von Wortzeichen und Wortsinn verknüpft. Aber für Gadamer geht es hier nicht um die totale Präsenz der ontogenetischen Gottesschöpfung im „wahren“ Wort, sondern um den faktischen Ereignischarakter, nämlich dasjenige, was zur Sprache kommt und sich im Wort verwirklicht. In diesem sprachphilosophischen Zusammenhang verweist das innere Wort (verbum interius), wie die augustinische Verbum–Lehre zeigt, auf das Denken, was „sich sagt“, und damit auch auf die unaufhebbare Endlichkeit unserer Sprache. Das innere Wort, wie Gadamer sagt, „indem es das Denken ausdrückt, bildet also gleichsam die Endlichkeit unseres diskursiven Verstandes ab. Weil unser Verstand das, was er weiß, nicht in Einem denkenden Blick umfaßt, muß er jeweils das, was er denkt, erst aus sich herausführen und wie in einer inneren Selbstaussprache vor sich selber hinstellen. In diesem Sinne ist alles Denken ein Sichsagen.“ (GW. 1, S. 426) Insofern liegt auf der Hand, dass unser Denken weder die reine Kognitivität, die durch die exakte Evidenz des logischen Beweissatzes der Gegenstandserkenntnis zustande kommt, noch das bedeutungsidentische Reduktionsverhältnis, das sich zwischen dem Wortzeichen und demjenigen, was bezeichnet wird, abspielt, sondern einen akzidentellen und dialektisch prozessualen Zug aufweist. Denn das Denken als das innere Wort erreicht seinen Vollzug durch die wörtliche Erfüllung dessen, was die vertrauten Wahrnehmungsdaten, die in diesem Zusammenhang gebildet werden, ausführen. Der augustinische Gedanke vom Verbum, nämlich vom wesensgleichen Verhältnis des Wortzeichens zum inneren Denken, ist in Gadamers hermeneutischem Kontext 20 zudem deshalb entscheidend, weil Augustinus zuerst gegen die metaphysisch–idealistische Denktradition, die den Primat der ratio in Verbindung mit der Welt in den Vordergrund rückt, den Logos als das Verbum verstanden hat. Gegen diese traditionelle Gewissheit der vorschriftlichen Zuordnung des Weltganzen durch die ratio betont die augustinische Verbum– Lehre, dass das Denken selbst der aufhellenden Kraft des Wortes bedarf, so lange das, was 19 Vgl. Johann Kreuzer, „Was verstehen wir, wenn wir verstehen? – Augustinus über Orakel, innere Wörter und die Zierde der Verstehensgemeinschaft“, in: Philosophisches Jahrbuch, 111Jg., hrsg. v. Thomas Buchheim u. a., München 2004, S. 274 ff. 20 Zum Stellenwert der Augustinischen Verbum–Lehre in der hermeneutischen Traditionslinie, vgl. Jean Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, 50 ff. 280 verstanden worden ist, auch zu sagen ist. Konsequent kann gesagt werden, dass das Denken, wie Augustinus es als verbum interius bezeichnet hat, im wesentlichen Sinn das lautlose Wort ist und deshalb die Modifikation zur sinnlichen Verlautung des Wortes für seine Entäußerung ertragen muss. Aber das bedeutet dennoch nicht, dass das Denken in seiner Transformation zur sinnlichen Verlautung die vollkommene Relation zu seiner Sache gewinnt. Auch hier zeigt sich, dass ein solch modifiziertes Wort weder ein eindeutiges Merkmal für den Sachverhalt, noch eine direkte Kopie dessen ist, was zu bezeichnen ist. Aus diesem Grund nimmt Augustinus’ Verbum–Lehre, aus Gadamers Sicht, die Unterscheidung zwischen dem „inneren Wort“ und dem „äußeren Wort“ vor, die von vornherein das stoische Denkerbe war. Diese augustinische Unterscheidung weist darauf hin, dass das innere Wort im Prinzip das von seiner Sache gebildete, aber auch das ins äußere Wort übergehende Denken ist. So gesehen, findet das Denken seine Vollzugsform nicht im bereits geformten Wort, sondern der Denkvollzug liegt in dem unendlichen Versuch zum dialektischen Nachvollzug, in dessen Prozess sich das lautlose Wort des Denkens in das verlautete Wort übersetzt. Hinsichtlich dieser prozessualen Endlosigkeit der hermeneutischen Wortsuche ist die ständige Übersetzung des inneren Wortes ins äußere Wort aus hermeneutischer Sicht immer unvollkommen. So kommt das Denken nicht ganz zu seiner Vollendung, sondern es selbst bahnt sich den unaufhörlichen Weg der ständigen Wortsuche in der anstrengenden Bemühung um das künftig Sagbare. In dieser Anlehnung von Gadamers hermeneutischer Sprachauffassung an die augustinische Unterscheidung des inneren Wortes von dem äußeren Wort werden wir Augustinus’ Grundeinsicht in das „göttliche“ Wort (verbum dei) unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Die augustinische Lehre hat die Fleischwerdung des Wortes, die uns aus dem Prolog des Johannes-Evangeliums bekannt ist, aus dem Blickwinkel der trinitarischen Inkarnation Christi hervorgehoben. Hier wird das göttliche Wort in der ontogenetischen Schöpfungsgeschichte als die wesensgleiche Verkörperung der Gottheit verstanden. Diese schöpferische Verkörperung Gottes in seinem Wort geschah jedoch nur einmal in einem vollkommenen Wort, in dem die Gottheit dreieinheitlich in eins zusammengebracht wurde. In diesem absolut einmaligen Ereignis ist der göttliche Logos das vollkommene Wahrheitsgeschehen, in dem die unauflösbare Distanz zwischen dem inneren Wort und dem äußeren Wort bzw. der Unterschied zwischen dem Wortzeichen und demjenigen, was bezeichnet wird, nicht vorkommt. Dennoch soll sich das göttliche Wort als Gottesbotschaft, das in einer bestimmten geschichtlichen Situation in der Heiligen Schrift auftaucht, hier von dem Wort, das schon immer „bei Gott“ war, unterscheiden. In dieser grundsätzlichen 281 Unterscheidung erarbeitet das Wort, das in sich verborgen ist, von sich selbst das Modifikationsmoment zum sinnlich hörbaren Wort, um zu uns zu kommen, so wie das innere Wort, um sich selbst zu sagen, der sinnlichen Verlautung des äußeren Wortes bedarf. Denn das Moment der Selbstmanifestation des göttlichen Wortes stammt, der hermeneutischen Sprachauffassung zufolge, aus der wesentlichen Gerichtetheit des Wortes selbst, die die schöpferische Kraft des Wortes in sich einschließt. Dementsprechend wird bei Gadamer deutlich, dass die Heilige Schrift nicht nur die Fleischwerdung des göttlichen Wortes durch den verklärten Mund Christi ist, sondern auch die Predigt als Applikation des göttlichen Wortes, die Gadamer als theologische Anwendungsleistung in Anknüpfung an das juristische Anwendungsproblem in seinem Hauptwerk gesehen hat und die konkrete Verkündung der Gottheit ist. Da ein solch offenbartes Wort, wie uns das Geheimnis der Gottesoffenbarung gezeigt hat, die schöpferische Kraft der Gerichtetheit des Wortes zu seinem Grundcharakter hat, kann man sagen, dass Gott sich in diesem Wort jeweils verkörpert und vergegenwärtigt. Dennoch stehen wir ständig vor der Aufgabe der Auslegung, da das uns verkündete Wort im wesentlichen Sinn von dem Wort, das im Anfang „bei Gott“ war, distanziert ist. Aus diesem Grund können wir annehmen, dass das Wort im Prinzip mit dem Denken „wesensgleich“ ist. In Bezug auf seinen Sachverhalt steht das Denken als das innere Wort nicht zeitlich vor dem bereits geformten Wort, sondern geht nur logisch dem verlauteten Wort vorweg. Denn das Denken spricht sich nicht nur durch die hörbare Verlautung des Wortes aus, sondern bildet sich selbst auch in seinem sprachlichen Bezug auf die Sache. Das Wort ist, wie Gadamer sagt, das „geistige Hervorgehen, das sich im Vorgang des Denkens, des Sichsagens, vollzieht.“ (GW. 1, S. 427) In diesem Sinn leistet das Wort mit seiner wesentlichen Gerichtetheit die kreative Bezeichnungsfunktion, das Denken zu präsentieren. Trotz des potenziellen Sinnganzheitshorizontes der vollkommenen Selbstdarstellung des Denkens in der hörbaren Verlautung des Wortes ist das „menschliche“ Wort jedoch stets unvollkommen, da es uns bereits unter der geschichtlichen Begrenztheit prozessual zukommt, während das „göttliche“ Wort ohne das zeitliche Akzidens das Universum mit einem Wort erschafft. Kein menschliches Wort kann den gesamten Sachverhalt oder das zu Sagende im Nu vollkommen aussagen. Gleichwohl gibt die Unvollkommenheit des menschlichen Wortes uns den wichtigen Hinweis, dass das Denken in sein verlautbares Wort hinein wächst, so lange es seine Wahrheit prozessual sucht. Somit wird deutlich, dass das Wort zufällig und vieldeutig ist, so lange wie es immer schon etwas Sagbares in seinem Sachverhalt hinter sich lässt. Wenn das Denken ohne die Sprache nicht ausgedrückt werden kann oder wenn das Denken in seinem dialektischen Entfaltungsverlauf zur Wahrheit auf die Sprache angewiesen ist, muss 282 aus Gadamers Sicht gesagt werden, dass die Sprache, indem wir Schellings Gedanken nachspüren, „etwas unvordenkliches“ ist. Dass das menschliche Wort zufällig und vieldeutig ist, heißt im hermeneutischen Sinn, dass das Wort für uns kein defizitäres, sondern ein ständig Sagbares ist. Denn die Vieldeutigkeit des menschlichen Wortes verweist auf den Sinnüberschuss im Prozess des Transfers des lautlosen Wortes zum vernehmbaren Wort, nämlich im Transzendieren des verborgenen Denkens zum übersubjektiven Sinnhorizont. Sofern wir den Sachverhalt durch die Sprache verstehen müssen und den Anderen mit der Sprache erreichen wollen, müssen wir zunächst unseren Horizont in der bestimmten Situation gewinnen. Solch gebildete Darstellungs– und Auslegungsweisen verleihen uns die Sinnpotenzen und erlauben uns auch die Akzentuierung, Überhellung und Entstellung des wörtlichen Sinnes. Da die Vieldeutigkeit unseres Wortes den möglichen Sinnraum der Sprache erweitert, ist die Annahme der Zufälligkeit und der Vielfältigkeit unseres Wortes für uns nicht viel gefährlicher als die dogmatische Befangenheit. Denn wenn ein erstarrter Dogmatiker glaubte, dass es nur eine einzige Wahrheit in der Welt gäbe und er allein ihren absoluten Maßstab hätte, würde er, wie die Geschichte von dem Kalifen gezeigt hat, in dem Fall, dass die anderen dasselbe sagen, es für überflüssig oder in dem Fall, dass die anderen etwas anderes sagen, es für falsch und schädlich halten. Im Gegensatz zu dieser dogmatischen Banalität führt uns die Vielfältigkeit und Vieldeutigkeit des Wortes zum dialogischen Übersetzungsverhältnis, in dem das Wort in der geschichtlichen Situation verwendet und damit ins andere, aber dennoch gemeinsame Sinnbild verwandelt wird. Angesichts dessen ist das Wort im dialogischen Übersetzungsverhältnis auf jeden Fall virtuell und flexibel, da nicht aus den Augen verloren werden darf, dass das Wort seinen Sinnvollzug nicht in der Summe der Buchstaben findet und der Satz auch seinen Sinn nicht in der syntaktischen Analyse bildet. Darüber hinaus hat Gadamers Sprachhermeneutik nicht außer Acht gelassen, dass unser Anspruch auf die kontextuell angemessene Wortbildung im dialogischen Übersetzungsverhältnis nicht nur die Unerreichbarkeit der vollendeten Aussage bereits voraussetzt, sondern auch das Sagbare des Denkens in der wesentlichen Gerichtetheit des Wortes beständig vor Augen hat. In diesem dialogischen Übersetzungsverhältnis, dem die sinnkonstitutive Funktion der Sprache in Gadamers Sprachhermeneutik zugrunde liegt, hat die Sprache den „spekulativen“ Horizont: Sprache, wie Gadamer gesagt hat, ist „etwas Spekulatives“. (GW. 1, S. 472) Im etymologischen Sinn bedeutet hier Spekulation, wie bekannt, speculum, nämlich der Spiegel. Aber wir können die Spekulation im weiteren Sinn auch als die theoretische Betrachtung einer bestimmten Erkenntnisform, aus hermeneutischer Sicht als eine andauernde 283 Teilhabe am Anblick der Sachbewegung bezeichnen. Wenn Gadamer in Wahrheit und Methode den Begriff „Spekulation“ gebraucht, liegt seinem Sprachgebrauch nicht nur eine traditionelle Auffassung zugrunde. Vielmehr macht er insbesondere auch hier Anleihen bei Hegel. 21 An dieser Stelle müssen wir deshalb nun eine kurze Antwort auf die Frage geben, was bei Hegel „Spekulation“ oder „spekulativ“ bedeutet. Mit seinem eigenen Anspruch, dass das spekulative Denken für die Philosophie notwendig ist, damit die Philosophie ihre Wahrheit in der einheitlichen Ganzheit erwerben kann, hat Hegel bereits in der Phänomenologie des Geistes bemerkt, „daß die Natur des Urteils oder Satzes überhaupt, die den Unterschied des Subjekts und Prädikats in sich schließt, durch den spekulativen Satz zerstört wird und der identische Satz, zu dem der erstere wird, den Gegenstoß zu jenem Verhältnisse enthält.“ (PhdG. S. 59, meine Hervorhebung) Wenn der Urteilssatz, Hegels Ansicht zufolge, sein gegenüberstehendes Objekt zum Denken, gewissermaßen zum Satzausdruck ohne die anderen Elemente, hinführen können muss und wenn er damit seinen Gültigkeitsanspruch erhebt, dann wird der Urteilssatz selbst zu einem Denkprodukt, das sprachlich und reflexiv niedergeschlagen wurde. Beim sprachlichen und reflexiven Niederschlag geht es hier auch um die totale Entsprechung mit seinem Denkinhalt, die sich der Objektivität versichert. Da der Urteilssatz hier der sprachlichen Bezeichnung seines realen Inhaltes zugeordnet wird, soll er zunächst die Bedingungen des Gültigkeitsanspruches erfüllen. Damit soll jede Sprache im Grunde eine bedeutungsidentische Referenz sein. Aus Hegels Sicht hat der Urteilssatz damit seinen Stellenwert als einen absoluten Wahrheitssatz verloren, der von seiner direkten Merkzeichenfunktion garantiert wurde. Mit diesem Verlust ist der Urteilssatz nur in ein Moment der gesamten Erkenntnisverläufe, nämlich in einen gewissen Punkt des selbstreflexiven Denkprozesses geraten. Gegen diesen formellen Urteilssatz kann das Denken sich selbst, Hegel zufolge, im „spekulativen“ Satz, wieder in Erinnerung rufen, ja widerspiegeln und seinen eigenen Inhalt erfahren. Denn das Denken in seiner spekulativen Satzform wendet sich seinem inneren Inhalt zu und beginnt bereits die Selbstnegation seiner Gefesseltheit an die Getrenntheit. Durch diese negative Zuwendung zu seiner Innerlichkeit fasst das Denken das gegenseitig abhängige Verhältnis von Subjekt und Prädikat in seiner Satzform auf. In diesem Sinn kann gesagt werden, dass die Spekulation „die Weise der Selbsterfahrung des Denkens“ 22 ist. Das spekulative Denken ist deshalb bei Hegel ein wahres 21 Wie bereits angedeutet, wurde die Aufnahme der Hegelschen Philosophie in Gadamers Hermeneutik von zahlreichen Gadamer–Kritikern verkannt. Vgl. etwa M. Frank, Das individuelle Allgemeine, S. 20 ff. u. S. 80 ff. 22 Vgl. Josef Simon, „Die Kategorien im „gewöhnlichen“ und im „spekulativen“ Satz – Bemerkungen zu Hegels Wissenschaftsbegriff“, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, Bd. III, hrsg. v. Erich Heintel, Wien/Stuttgart 284 Subjekt, das die wechselseitige Beziehung zwischen Satzsubjekt und Prädikat, präziser gesagt, den unmittelbaren Übergang vom Satzsubjekt zum Prädikat, – hiermit wird das Prädikat in Verbindung mit der Kopula 23 zum Allgemeinen -, und den reflexiven Übergang vom Prädikat zum Satzsubjekt, - hier hat das Satzsubjekt zwar seine Allgemeinheit wieder gewonnen, aber seine Wirklichkeit verloren -, erkennt. Nur durch die selbstreflexive Negationsbewegung des spekulativen Denkens kann sich das Satzsubjekt als eine wirkliche Allgemeinheit, im Hegelschen Sinne als der „Begriff“, auf dessen Ebene das Wesen des ganzen Satzinhalts zur Sprache kommt, zeigen. Bei der vollkommenen Ausführung des spekulativen Satzes ist die Dialektik bei Hegel zunächst als Spekulation bestimmt. Angesichts der absoluten Affirmativität der Spekulation gelangt dialektische Philosophie bei ihm auch zur Metaphysik. Davon abgesehen wird klar, dass Hegels subjektphilosophischer Denkzug durch die reflexiv angeeignete Zurückführung auf das denkende Ich zur absoluten Selbstvermittlung des Subjekts tendiert. Damit erweckt Hegels reflexionsphilosophischer Denkzug auch zugleich den Anschein, dass die metaphysische Denkaffirmation im spekulativen Satz, wie angedeutet, die homogene Vermittlung des Subjektes mit der Substanz, der Wirklichkeit mit dem Geist, ausführlich erarbeitet. Mit anderen Worten: Das wahre Subjekt des spekulativen Satzes ist das denkende Ich, das sich in der dialektischen Bewegung zum Unendlichen durchsetzt. So verstanden prägt der spekulative Satz deshalb nicht mehr die gewöhnliche Satzverbindung des Subjektes mit dem Prädikat in der umgangssprachlichen Satzform, sondern er schließt den dem Paradigma des selbstreflexiven Selbstbewusstseins gemäßen Modus der Selbstdarstellung, in der das Subjekt sich selbst auslegt, ein. Dementsprechend meint das Prädikat in diesem Satz nicht mehr die Eigenschaften des Subjekts, die von jedem Blickpunkt aus je verschieden beigefügt werden können, sondern es meint die einheitliche Wesentlichkeit, die das Subjekt in der Satzform zum Ausdruck bringen soll. So hat der spekulative Satz das 1970, S. 9 – 37, hier S. 15 und ders., „Ethik und Ästhetik des Zeichens“, in: Orientierung in Zeichen – Zeichen und Interpretation III, hrsg. v. ders., Frankfurt a. M. 1997, S. 267 – 291. Zur Spekulativität des Anfangs der Hegelschen Logik, vgl. Hans Friedrich Fulda, „Über den spekulativen Anfang“, in: Subjektivität und Metaphysik – Festschrift für Wolfgang Cramer, hrsg. v. Dieter Henrich, Hans Wagner, Frankfurt a. M. 1966, S. 109 – 127. 23 Die Kopula leistet drei verschiedene Funktionen im Urteilssatz: Die Kopula „ist“ bedeutet erstens die definitive Identifikation im logischen Satz, wie die Funktion des Zeichens „Gleich“ in der Mathematik. Sie spielt zweitens eine Rolle als Hilfszeitwort. Hierbei ist sie deshalb keine Eigenschaft mehr. Aber in ihrem Gebrauch, insbesondere in der Philosophiegeschichte, wird die Kopula drittens häufig als die ontologische Eigenschaft, nämlich das Sein verstanden. Daraus folgt ein ontologisches Problem in der Philosophiegeschichte. Wenn das Sein als die Kopula die Eigenschaft im Urteilssatz wäre, zeigt sich das Sein einerseits als eine Bestimmung, nämlich die Qualität im Satz. Im Urteilssatz verweist das Sein kategorisch auf die Positivität gegenüber der Negativität bzw. dem „Nicht“. Andererseits wird ‚Sein’ in der Substanzontologie außerdem auch auf das substanzielle Eine verlegt, das allen Seienden, ja allen Eigenschaften vorweg geht. Vgl. Josef Simon, „Verführt die Sprache das Denken? – Zur Metakritik gängiger sprachkritischer Ansätze“, in: Philosophisches Jahrbuch, 83. Jg., hrsg. v. Hermann Kriegs u. a., Freiburg/München 1976, S. 102 ff. Seine Frage in diesem Aufsatz richtet sich insbesondere darauf, inwiefern die Sprache auf die Gedankenbildung Einfluss nimmt. 285 Spannungsverhältnis zwischen seinem Denkinhalt und seiner Ausdrucksform noch nicht verloren, bevor das Denken zu sich selbst vollendet zurückkehrt. Die Spannung ist bei Hegel vom denkenden Ich, das die zirkuläre Bewegtheit zwischen dem Inhalt und seiner Form vollständig durchführt, negativ aufgehoben. Mit Hegels subjektphilosophischem Denkansatz betrachtet, kommt die dialektische Bewegung der negativen Vermittlung schließlich der subjektiven Selbstgewissheit des denkenden Ich zu. Außerhalb der selbstbezüglichen Gewissheit des Subjektes bleibt nichts übrig. Demgegenüber wird die negative Aufhebung der Vermittlung zur Affirmation in Hegels spekulativer Philosophie von Gadamer als die erneute Unterwerfung der Sprache unter die Herrschaft des Denkens verstanden. Denn die Sprachvermitteltheit hält bei Gadamer das unaufhebbare Wechselverhältnis ewig fest, indem die Vermittlung nie zu einem Ende kommt. Beim Versuch der aktuellen Aufnahme der Hegelschen Denkspekulation will Gadamer nicht Hegels homogenes Systemdenken verteidigen, sondern er erhebt Einspruch gegen die Geschlossenheit der totalen Vermittlung. Vor dem Hintergrund der systematischen Homogenität ist die Geschichte mit der Wahrheit, das Subjekt mit der Substanz bzw. die Wirklichkeit mit dem Geist in eins vollendet zusammengebracht. Gegen diese totale Vermittlung im Modell der Hegelschen Spekulation hat Gadamer die existenzielle Endlichkeit der menschlichen Erfahrung als den Wesenszug des verstehenden Subjekts immer vor Augen. Aus hermeneutischer Sicht befinden wir uns immer in der Situation, dass die Überlieferung und unsere Selbstbestimmtheit nicht restlos reflexiv erklärbar sind. Wenn wir uns hier daran erinnern, dass die Welt nicht mehr dasjenige ist, was alphabetisch zu entziffern und abzulesen ist, sondern unser Umgang mit der Welt des sprachlich erschlossenen Horizontbildens bedarf und auf die daran angeschlossene Wortbildung angewiesen ist, verweist der spekulative Horizont der hermeneutischen Sprachlichkeit im Grunde zwar auf die wesensgemäße Wiederherstellung des Sachsinns in der Welt, der sich in der Sprache darstellt und vollzieht. Aber die sprachliche Wiederherstellung der Sachlichkeit vor dem spekulativen Horizont schließt bei Gadamer keinesfalls das substanzontologische Kausalverhältnis ein, in dem das Urbild als die allerletzte Instanz immer die logische und ontologische Priorität hat und sich als das so genannte letztbegründete Wirkende zeigt. Hinsichtlich des spekulativen Horizontes der Sprache sagt Gadamer in Wahrheit und Methode: „Was verstanden werden kann, ist Sprache. Das will sagen: es ist so, daß es sich von sich aus dem Verstehen darstellt. Auch von dieser Seite bestätigt sich die spekulative Struktur der Sprache. Zur–Sprache–kommen heißt nicht, ein zweites Dasein bekommen. Als was sich etwas darstellt, gehört vielmehr zu seinem eigenen Sein. Es handelt 286 sich also bei all solchem, das Sprache ist, um eine spekulative Einheit, eine Unterscheidung in sich, zu sein und sich darzustellen, eine Unterscheidung, die doch auch gerade keine Unterscheidung sein soll.“ (GW. 1, S. 479, meine Hervorhebung) Dies könnten wir zunächst mit dem Spiegelverhältnis, wie der ursprüngliche Wortsinn der Spekulation andeutet, zu erklären versuchen. Im Spiegelverhältnis reflektiert das Spiegelbild das Gespiegelte vor unseren Augen wieder. Hierbei führt das Spiegelbild die Augen des Betrachters wieder zum Gespiegelten hin. Aber bei diesem Erklärungsversuch zum Spiegelverhältnis geht es, wenn ich Gadamers Einsicht in die Spekulation der Sprache richtig verstehe, weder um die kopierte Wiedergabe des Gespiegelten durch das Spiegelbild, noch um die Reduktion des Spiegelbildes auf das Gespiegelte, sondern um die Repräsentationsfunktion des Spiegelbildes, das Gespiegelte in Erscheinung zu bringen. Wenn hier außerdem deutlich wird, dass das Urbild, nämlich das Gespiegelte im substanzontologischen Modell des Kausalverhältnisses, als der Grund für die logische und ontologische Beziehung für das Abbild bestimmt ist, dann ist das Abbild zu etwas zweitrangigem, das jedoch stets vom Urbild abgeleitet wurde, geworden. Um die Seinsvalenz zu erwerben, soll sich das Abbild nun auf das Urbild als seinen hypostasierten Bezugsgrund reduzieren. Gegen die Feststellung der logischen und ontologischen Priorität des Urbildes, nämlich des Gespiegelten im substanzontologischen Modell, weist die „spekulative Einheit“, wie Gadamer sagt, auf die dialogische Vermitteltheit der Sprache hin, die uns zur Verbindung mit der Welt und mit uns selbst bringt. Denn die Sprache, der aus hermeneutischer Sicht die wechselseitige Gerichtetheit auf ihre Sache zugrunde liegt, erschafft ständig ihre Mitte, die keine vollkommene Wiedergabe durch die unhintergehbare Reduktion auf das Urbild ist, sondern das Ungesagte in der Vielfältigkeit des Wortes mithörbar macht. Im Anschluss an die spekulative Einheit rückt Gadamer zunächst die Seinsvalenz der Sprache als eines Darstellenden, die er mit der neuplatonischen Emanationslehre untermauert, in den Vordergrund. Gadamers Konzept der Seinsvalenz, der Beziehung zwischen dem Sein und dem Seienden, akzentuiert nicht den ontologischen Vorrang des Seins als ein einziges Prinzip, sondern die permanente Selbstmanifestation des Seins in den Seienden. Hierin liegt Gadamers Einsicht in die „ontologische Distanz“ 24 zwischen dem Sein und den Seienden. Das 24 Vor allem müssen wir m. E. feststellen, dass die Distanz, die wir bereits gesehen haben, in Gadamers Hermeneutik das angemessene Zwischen ist, in dem das Verstehen immer stattfindet. Darüber hinaus schließt der Begriff „Distanz“ in Bezug auf Gadamers Ontologie auch den Begriffsumfang „Differenz“ im weiteren Sinne von Identität und Differenz ein. Somit kann man sagen, dass Gadamers Ontologie im Grunde gegen die metaphysische Denktradition, die der Identität den logischen Vorrang zu verleihen trachtete, einen kritischen Einwand erhebt. Gleichwohl darf hier nicht außer Acht gelassen werden, dass Gadamers Einsicht in die ontologische Distanz anders als die postmoderne Denkströmung der Differenz ist, für die Derrida als Hauptvertreter gilt. Denn wenn das Derridasche Differenzdenken von der emphatischen Prämisse, dass die 287 bedeutet nicht, dass viele Seiende sich mit einem Sein indifferent identifizieren sollen, sondern dass die Vielheit der Seienden ihren eigenen Seinswert in einem unabschließbaren Affinitätsverhältnis mit dem Sein hat, da sich der Seinssinn in der ununterbrochenen Übertragung auf die Vielheit der Seienden freilegt. 25 So gesehen ist Gadamers Einsicht in den spekulativen Horizont der hermeneutischen Sprachlichkeit gerade mit seiner Erarbeitung der Ontologie des Kunstwerks in der Kunsterfahrung verbunden, die den Ausgangspunkt von Wahrheit und Methode gebildet hat. In diesem Sinn sagt Gadamer: „Es kann sich als das, was es ist, auch anders darstellen. Aber wenn es sich so darstellt, ist dies kein beiläufiger Vorgang mehr, sondern gehört zu seinem eigenen Sein. Jede solche Darstellung ist ein Seinsvorgang und macht den Seinsrang des Dargestellten mit aus. Durch die Darstellung erfährt es gleichsam einen Zuwachs an Sein.“ (GW. 1, S. 145) Mit dieser Aussage Gadamers wird deutlich, dass die Sprache wie ein Bild 26 ihren Seinswert aus demjenigen, was als das Sein in seiner jeweiligen Darstellung „zur Sprache kommt“, gewinnt. Das „zur–Sprache– kommen“ des Seins bezieht sich mithin nicht mehr auf die indifferente Identität, die durch die Zurückführung auf ein ewig gleich Bleibendes zustande kommt, sondern auf die unendliche Sinngestaltung in jedem Ereignis. Vor allem dürfen wir hier nicht außer Acht lassen, dass das sprachliche Sinngeschehen in Gadamers Hermeneutik auf der Anerkennung der unaufhebbaren Distanz zwischen dem Sein und den Seienden, 27 hier nämlich der Differenten nicht mehr das Identische sein sollen, ausgeht, dann erweckt dies den Anschein, dass es keine Beziehung zwischen dem Sein und den Seienden gäbe. Hier sollen die Differenten deshalb nur different sein. Demgegenüber hält Gadamer zwar die unerschöpfbare Differenz zwischen dem Sein und den Seienden vor Augen, aber es geht bei ihm auch um die Selbsterscheinung desjenigen, was es ist, in den Seienden. Die ontologische Distanz bezeichnet daher die wesentliche Beziehung zwischen dem Sein und den Seienden. Vgl. Heinz Kimmerle, Jacques Derrida – zur Einführung, 6. Aufl. Hamburg 2004, insbesondere S. 17 ff. u. S. 77 ff. 25 Der Seinsvalenz des Bildes widmet Gottfried Boehm seine genauere Betrachtung. Hier geht es insbesondere um die kreative Macht des Darstellenden in seiner unendlichen Gestaltungsmöglichkeit: „Bilder funktionieren nicht wie starre Spiegel, die eine stets vorauszusetzende Realität wiederholen, sie sind keine Doubles. Das plane Abbild ist der banalste, wenn auch der verbreitetste Ausdruck einer ganz leeren Bildlichkeit. Von wirklichen Bildern erwarten wir dagegen nicht nur eine Bestätigung dessen, was wir schon wissen, sondern einen Mehrwert, einen >>Seinszuwachs<<(Gadamer).“ G. Boehm, „Die Bilderfrage“, in: Was ist ein Bild, hrsg. v. ders., 2. Aufl. München 1995, S. 332. 26 Wir müssen beachten, dass Gadamer später „Kunst als Aussage“ zum Titel von seinem GW. 8 gewählt hat. Hierin liegt m. E. ein doppelter Sinn: Kunst ist einerseits sprachlich ausdrückbar. Andererseits hat die Sprache in ihrer Seinsweise eine ontologische Verwandtschaft mit dem Kunstwerk. Mit dieser Aussage will Gadamer deshalb nicht davon sprechen, dass Kunst an sich immer sprachlich ist und dass Sprache direkt die bedeutungsidentische Bezeichnungsfunktion hat. Wir erleben de facto in manchen Fällen das unerwartete Wunder bei der Begegnung mit dem eminenten Kunstwerk. Ein solch unfassbares Wunder führt uns des öfteren zum sprachlosen Schweigen. Wenn aber auch das Kunstwerk die nicht–sprachliche Dimension, nämlich die übersprachliche Ausdrucksform enthält, ist das Kunstwerk sprachlich besonders ansprechend, sofern es im Grunde für uns „da“ ist. Davon abgesehen bedarf unsere Kunsterfahrung selbst auch der sprachlichen Interpretationsweise, weil die Kunsterfahrung die hermeneutischen Verstehensvorgänge enthält. Zur sprachlichen Sagbarkeit der Bilder, vgl. G. Boehm, „Zu einer Hermeneutik des Bildes“, S. 444 – 471. Auch dazu, ders., „Die Wiederkehr der Bilder“, S. 11 – 38. 27 Manfred Riedel gibt uns einen Hinweis darauf, dass das Sein in Gadamers Hermeneutik stets den transzendenten Horizont der Offenlegung der Sinnpotenzen prägt. Demzufolge sagt er: „Die so gefasste Notwendigkeit ist für Gadamer die Macht des Überkommenen, die dem Anfang des Denkens vorausliegt. 288 Vieldeutigkeit der Sprache, basiert. Die Sprache besteht immer aus der „prinzipiellen Unausgefülltheit der Zwischenräume“. herausragende Verwandlungskraft 28 zur Mit anderen Worten: Die Sprache hat die Gemeinsamkeitsbildung im unendlichen Darstellungsprozess. Aber die Kraft und die Funktion der Sprache liegt dennoch, Gadamers Ansicht zufolge, nicht in der zum Ende gekommenen Indifferenz, sondern in ihrer Vielheit, in deren Bewegtheit die Sprache ihre Sinnräume erweitert und vermehrt. Gadamers ontologische Überlegung zur Sprache vor deren spekulativem Horizont tendiert einen Schritt weiter zum grundsätzlichen Wechselverhältnis von Einheit und Vielheit, das seit Parmenides und Heraklit als die metaphysische Aufgabe der Philosophie gilt. 29 Da es eine allzu belastende Aufgabe wäre, hier die verschiedenen Positionen der Philosophiegeschichte zu behandeln, genügt es für unseren Zusammenhang m. E., zu beachten, wie die Vielheit der Sprache ihre Mitvollzugsfunktion in der Einheit der Sache leistet. Von diesem Ansatz ausgehend muss zunächst gesagt werden, dass die Vielheit aufgrund der unentbehrlichen Distanz zwischen dem Sein und den Seienden, die sich im Grunde aus der Selbstunterscheidung des Seins ergibt, als Einheit bezeichnet werden kann, da die menschliche Erfahrung, die durch die Sprache zum Ausdruck kommt, das wechselseitige Übersetzungsverhältnis, nämlich die Übertragung der Einheit auf die Vielheit und umgekehrt der Vielheit auf die Einheit, zu ihrer Grundstruktur hat. Wenn das Wissen unabdingbar an der Sachwahrheit orientiert ist, entwickelt es sich in doppelter, aber nicht nachträglicher Weise: Zum einen als die dihairetische Differenzierung, zum anderen als die Wiedervereinigung der Verschiedenen. Die beiden Bestandteile des Wissens, die Differenzierung und die Wiedervereinigung, gehören damit auch der sprachlichen Begriffsbildung an. Die Begriffsbildung als die Vollzugsform des Wissens um die Sachwahrheit, zielt nicht auf die direkte Subsumtion der differenten Vielheit unter die Einheit ab, sondern sie steht in der philosophischen Hermeneutik immer zwischen der Differenzierung und der Wiedervereinigung. So bewegt sich die Einheit der dialogischen Wahrheitssuche in der vielfältigen Erweiterung der sprachlichen Begriffsbildung. Aus diesem Grund können wir in Betracht ziehen, dass der spekulative Sinn des Wortes in Gadamers Hermeneutik mit den Vielen der Sprache, die sich im dialogischen Indem sie vom Ende her jede unmittelbare >>Wiederholung<< als unmöglich ausschließt, beschränkt sie das Denken auf das Mögliche, das ihm noch offen bleibt.“ M. Riedel, Hören auf die Sprache, S. 365 ff., hier S. 371. 28 G. Boehm, „Zu einer Hermeneutik des Bildes“, S. 462. 29 Vgl. Karen Gloy, „Vermittlungsmodell von Einheit und Vielheit – das Substanzontologische, das selbstreferentielle bewußtseinstheoretische und das relationale wissenschaftstheoretische Modell“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Jg. 39, Bd. II, Berlin 1991, S. 782 – 794, und dazu, M. Riedel, Ebd., S. 96 ff. 289 Übersetzungsverhältnis zueinander verhalten, zu tun hat. Im dialogischen Übersetzungsverhältnis ist der zu sagende Seinssinn im Prinzip verlautbar, weil die Sprache die Offenbarungsmacht in ihrer Vieldeutigkeit hat.30 Selbst das gesagte Wort ist deshalb nicht an die exakte Bestimmung der Aussage gebunden, sondern der Sinn des Wortes geht immer aufgrund der vielen Sinnpotenzen über das Gesagte hinaus, sofern das Wort auf seine Sache gerichtet ist. Um seine immanenten Sinnpotenzen freizulegen, muss das Wort sich selbst ins Übersetzungsverhältnis, das den gebundenen Kontext bildet und damit den Wortsinn anders und neu erweitert, einstellen. So befindet sich das gesagte Wort permanent in seinem spekulativen Sinnhorizont der Vieldeutigkeit. Wenn wir hier die Übersetzung des anderen Wortes auf das eigene Wort beachten, wird deutlich, dass das Übersetzungsverhältnis eine bestimmte Haltung verlangt, da dieses die Einschätzung und die Wertschätzung unter den begrenzten Umständen begleitet. Demzufolge bezieht sich eine angemessene Textübersetzung beispielsweise auf die Entscheidung bei der Wahl zwischen vielen Varianten eines Wortes, die nicht nur im lexikalischen Sinn einen Sinn bilden, sondern sich auch um den weiteren Sinn im gesamten Kontext bemüht: Die Übersetzung macht deutlich, dass ein gesagtes Wort oft eine Mehrdeutigkeit aufweist und dass der Übersetzer dieses Wort von Fall zu Fall in einen neuen Wortsinn, den der verstandene Sinnkontext ihm verleiht, übertragen muss, wenn das Wörterbuch kein angemessenes Wort anbietet und wenn es selbst im Kreis von Muttersprachlern kein geeignetes Wort gibt. So bedarf der Vorgang der Übersetzung des gesagten Wortes auf das eigene Wort der anstrengenden Bemühung um das betroffene Wort: Er verlangt unsere kluge Überlegtheit, nämlich eine überlegte Einschätzung. Hierbei kann ein Übersetzer sich vermutlich das Ziel der vollkommenen Übersetzung setzen, damit er die gesamten Vorgänge der Übersetzung durchführt. Gleichwohl ist eine vollkommene Übersetzung für uns ein Grenzfall, da der Unterschied zwischen dem Übersetzten und der Übersetzung nicht mehr auffällt. Anhand der bisherigen Überlegungen können wir sagen, dass die Gerichtetheit der Sprache auf ihr Sein sich vor dem spekulativen Horizont des Übersetzungsverhältnisses bewegt, da unser Versuch zur sprachlichen Formulierung des Seinsinns selbst das unaufhörliche Suchen nach dem geeigneten Wort ist. Im Verlauf der 30 Vgl. Walter Benjamin, „Die Aufgabe des Übersetzers“, in: Gesammelte Schriften, Bd. 1, hrsg. v. Tilman Rexroth, Frankfurt a. M. 1972, S. 9 – 21. Der Übersetzer begegnet der Fremdheit und soll damit die Fremdheit in seine Eigenheit übersetzen. Er muss die Vertrautheit mit der Fremdheit bilden und damit die Fremdheit zugleich erhalten. So scheint die Übersetzungssituation selbst widersprüchlich zu sein, weil die Übersetzung bereits einerseits die Aneignung der Fremdheit und andererseits die Bewahrung der Fremdheit verlangt. Eine solche Übersetzungssituation erweckt deshalb den Anschein, dass die Übersetzung im Prinzip nicht möglich ist. Von der Überlegung über den selbstwidersprüchlichen Anspruch des Übersetzers setzt W. Benjamin die Übersetzbarkeit voraus, die, in seinen Worten, auf der „reinen Sprache“ (S. 13) basiert. Dementsprechend liegt die Aufgabe des Übersetzers im Hören auf diese „reine Sprache“. Trotz der Verschiedenheit der systematischen Ausdrucksformen kann der Übersetzer diese Sprache hören, weil Sprache im Grunde sprechen will. 290 dialogischen Übersetzung ist diese ständige Suche ab einem bestimmten Moment abzubrechen und das gesuchte Wort festzulegen. So gesehen ist das Moment des Abbruchs nicht nur die Wahlentscheidung für das bestimmte Wort im unendlichen Verlauf der Suche, sondern auch die Sinnvermehrung des Wortes. Wenn sich die Wortsuche im kontextabhängigen Übersetzungsverhältnis, in dessen Licht das gesuchte Wort freigelegt wird, ohne Ende weiter entfaltet, stiftet der Dialog in Gadamers Hermeneutik nunmehr einen ausgezeichneten Erscheinungsort des spekulativen Horizontes der Sprache, da die Sprache ihre Sinnräume hier eröffnet und damit ihren Vollzug erreicht. Der Dialog, der selbst das Wortsuchen und das Wortfinden ist, ist immer schon das Zusammensuchen seiner Wahrheit. Und er vollzieht im wechselseitigen Austausch auch den prozessualen Stufenweg zum Wissen um die Wahrheit. Da sich der Dialog bereits an seinem Ausgangspunkt das Ziel, das wir als Verständigung bezeichnen können, setzt, ist er in der philosophischen Hermeneutik kein verwirrendes Umhertreiben, sondern er ist immer am Wissen um die Wahrheit orientiert, da das Wissen um die Wahrheit, das als gemeinsame Übereinstimmung in einer Sprachgemeinschaft bezeichnet werden kann, durch die gesamten Dialogvorgänge hindurch auftauchen kann. Darüber hinaus beschränkt sich Gadamers Einsicht ins Aufgehen der Wahrheit im Dialog, die die Platonischen Dialoge zum Vorbild hat, nicht auf die theoretische Philosophie, sondern breitet sich auf den praktischen Bereich aus. Denn der Dialog geht von vornherein nicht nur von der Anerkennung der Andersheit aus, sondern zielt auch auf die Verständigung über den Anderen und über sich selbst anhand des Leitfadens der mitkonstitutiven Funktion des Anderen. Nun finden wir die gemeinsam gesuchte Wahrheit in der Verständigung. Dementsprechend kann gesagt werden, dass das Wissen um die Wahrheit im Dialog bzw. die menschliche Erfahrung überhaupt im wesentlichen auf die Andersheit des Anderen angewiesen ist, so lange die Wahrheitssuche nicht mehr die monologische Schlussfolgerung der Beweislogik verfolgt, sondern sich in der Teilnahme am dialogischen Zwischen der gemeinsamen Wortsuche vollzieht. So verstanden liegt es auf der Hand, dass der Dialog von vornherein das dialektische Zusammendenken, über das keiner von uns verfügt, ist. Der Dialog hütet uns deshalb vor der Gefahr einer dogmatischen Sinnverführung und versichert sich der gemeinsamen Sachwahrheit, weil er in seiner Interdependenz ständig auf die Anderen gerichtet ist. Von den bisherigen Überlegungen aus gelangen wir m. E. zu dem Punkt, an dem wir die zu Anfang gestellte Frage beantworten können. Wir haben gesehen, dass Gadamers Anliegen zur Universalität der Sprache in der menschlichen Welterfahrung nicht darin liegt, dass alles Sprache sei oder dass Sprache alles sei, wie Gianni Vattimo betont hat, dass das 291 Sein „dazu tendiert, sich in die Sprache aufzulösen, oder zumindest dort an ein Ende zu kommen“. 31 Demgegenüber kann man sagen, dass sich der Universalitätsanspruch der Sprache bei Gadamer nicht nur auf das hermeneutisch geschulte Bewusstsein, dass unsere Welterfahrung immer schon in der bestimmten Situation stattfindet und sich durch die Sprache konstruiert, sondern auch auf die mitkonstitutive Funktion der Sprache, das, was zu sagen ist, offenbar zu machen, nämlich die Sinnpotenzen kundzugeben, bezieht. Insofern hat die Sprache in der philosophischen Hermeneutik auch ihre Endlichkeit, wie die menschliche Erfahrung, die wir zuvor behandelt haben, ihre Grundstruktur zur Anerkennung der existenziellen Endlichkeit des Menschen hat. Denn die Sprache lässt, wie wir später sehen werden, immer das zu Sagende hinter dem Gesagten, so lange wir mit der Sachwahrheit durch die Sprache umgehen können und so lange die Wahrheit nicht substanziell vorgegeben ist, sondern sie die dialogische Teilhabestruktur hat. Wenn die Sprache die Offenbarungsmacht des Sachsinns hat und die Wahrheit in der dialogischen Umgangsform erscheint, prägt der Dialog, an dem wir immer schon Anteil haben, für uns den übersubjektiven Horizont, in dem der Logos als ein subjektiver Wahrheitsträger seine Rolle spielt. 31 Gianni Vattimo, Das Ende der Moderne, Stuttgart 1998, S. 141. 292 I – 2. Hören auf das Ungesagte, das wir im Gesprächsverhältnis ständig aussagen wollen Die philosophische Hermeneutik gab, wie wir schon gesehen haben, uns den wichtigen Hinweis, dass die menschliche Erfahrung immer schon auf die geschichtliche Sprachbildung angewiesen ist. Gadamer zufolge ist die Sprache, an die das hermeneutische Verstehen im Grunde angeknüpft ist, „die Konkretion des wirkungsgeschichtlichen Bewußtseins“. (GW. 1, S. 393) Der hermeneutische Universalitätsanspruch der Sprache ist deshalb in Gadamers philosophischer Hermeneutik nicht nur die Grundlage für die Erfüllung des Wahrheitsanspruchs unseres Denkens, sondern beinhaltet auch unsere sprachliche Grenzerfahrung. Denn wenn sich das Denken nicht ohne die Vermittlung der Sprache zeigt und sich nur im inneren Verkehr mit der Sprache darstellt, soll sich das Denken unabdingbar in das sprachliche Viele übersetzen. Insofern ist das Denken das ‚Eingerücktsein in die Wirkungsgeschichte’, was wir oben als die Grundstruktur der menschlichen Erfahrung bezeichnet haben. (GW. 1, S. 295) Kurzum sind wir schon in ein gewohntes Sprach– und Handlungssystem, das die Familie, die kleine Gruppe, die Gesellschaft bis zum Kulturkreis umfasst, hineingeworfen. Deswegen steht nicht nur das Denken, sondern auch die Sprache unter der situierten Bedingtheit, die den vorstrukturierten und mitkonstruktiven Einfluss auf die jeweilige Denk– und Sprachbildung ausübt. Mit dieser Einsicht in die hermeneutische Überlieferungsgeschichte des Denkens und damit auch der Sprache akzentuiert Gadamer später die „Grenze der Sprache (1985)“, die er insbesondere in GW. 8 thematisiert hat. Dort zeigt Gadamers Betonung der Grenze der Sprache nicht nur die geschichtliche Bedingtheit unserer Denkbildung, sondern auch die universelle Grenzerfahrung unserer Sprache. Wenn wir die Einsicht Gadamers ernst nehmen, müssen wir auch sagen, dass die philosophische Hermeneutik „Metaphysik der Endlichkeit“ 32 sei. Statt einer idealistischen Verblendung des formalistischen Methodikanspruchs, fordert uns das hermeneutische Denken der Endlichkeit dazu auf, über die Angewiesenheit auf die Andersheit in der faktischen Lebensweise des Menschen grundsätzlich Rechenschaft abzulegen. Da Gadamers Hermeneutik von der Anerkennung des Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit ausgeht, muss vor allem gesagt werden, dass die Sprache, selbst das Denken, von vornherein des Dialogs bedarf. Für uns scheint die hermeneutische Perspektive des ineinander übergehenden Wechselverhältnisses zwischen dem Denken und der Sprache dennoch fast widersprüchlich zu sein, da Gadamer später die Grenze der Sprache als die Grundauffassung der hermeneutischen Sprachlichkeit annimmt, während er in seinem Hauptwerk die universale 32 J. Grondin, Einführung zu Gadamer, S. 237 ff. und ders., Hermeneutische Wahrheit?, S. 195 ff. 293 Formulierbarkeit der Sprache des Denkens ins Zentrum gestellt hat. Aber wir haben bereits gesehen, dass Gadamers Universalitätsanspruch der hermeneutischen Sprachlichkeit von Anfang an auf die prinzipielle Aussagbarkeit unseres Denkens verweist, d. h. unsere Sprachfähigkeit, das innere Denken zu symbolisieren und zu transformieren. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Gadamers späte Einsicht in die Grenze der Sprache eine konsequente Denkerweiterung ist, die vom Grundanliegen zur hermeneutischen Sprachauffassung in Wahrheit und Methode abgeleitet ist, dass das hermeneutische Endlichkeitsdenken, das dialogische Zwischen von Denken und Sprache in den Vordergrund rückt. Denn das Denken ist hier einerseits nicht mehr ein Subsumieren unter das vorherbestimmte Allgemeine, sondern dasjenige, was ständig gesagt werden muss und was es sagen will. Denn die Sprache konstruiert andererseits in dem Sinn das nie ganz einholbare Sinnnetzwerk des zu Sagenden, indem das Denken immer weiter und anders sagbar ist, wenn wir überhaupt etwas verstehen wollen und dieses Verstandene aussagen müssen. Das dynamische Zwischen der denkenden Aussagbarkeit und der von der kontextuellen Spracherweiterung abhängigen Denkbildung befindet sich nunmehr im ununterbrochenen Übergang zur gemeinsamen Wortfindung, in dessen Zwischenspiel die Differenz zwischen Denken und Sprache überprüfend erprobt und kritisch reflektiert werden kann. Im Anschluss an das Wechselverhältnis zwischen der Denkbildung und der Spracherweiterung zieht das Endlichkeitsdenken auch die Erfahrung von der eigenen Endlichkeit des Menschen in Betracht. Diese Erfahrung der menschlichen Endlichkeit ermöglicht die Begegnung mit dem anderen Endlichen, die die Grundbedingung für die dialogische Verbindlichkeit ist. Wenn Gadamer später davon spricht, dass die Sprache in der Endlichkeit verwurzelt ist, liegt Gadamers Sprachauffassung weder jenseits unserer sprachlichen Sinnpotenzen, noch diesseits des sprachlich geformten Denkens, sondern sie besteht immer im Gesprächsverhältnis, in dessen Licht die Andersheit ohne die vollständige Aneignung zu Worte kommt. Im Anschluss an das hermeneutische Endlichkeitsdenken gehen wir zunächst davon aus, dass das Mangelbewusstsein davon, dass uns das Wort fehlt, uns zu der unendlichen Suche nach dem treffenden Wort im Gesprächsverhältnis veranlasst. Mit dieser hermeneutischen Einsicht in die dialogische Wortsuche müssen wir zweitens feststellen, dass unsere Bereitschaft zum dialogischen Verstehen immer schon die Anerkennung dessen, was anders ist, voraussetzt, dass das dialogische Verstehen deshalb nicht mit der perfekten Äußerung des monologischen Beweisaussagesatzes zustande kommt, sondern sich mit dem Gespräch, in dem die wechselseitige Anerkennung gelingt, vollzieht. Darüber hinaus muss schließlich gezeigt werden, dass das Hörverstehen im Gespräch das innere Wort vernehmbar 294 macht, weil das Hören von vornherein unsere Dialogfähigkeit zu Verfügung stellt und in Gang setzt. Dass wir uns im Dialog den Anderen nie ganz aneignen können, bedeutet bei Gadamer, dass das innere Wort (verbum interius), 33 das er in Anknüpfung an Augustinus’ Verbum– Lehre eingeführt hat, immer schon über die verschieden formulierten Sprachausdrücke hinausgegangen ist, weil das innere Wort im wechselseitig aufeinander bezogenen Gesprächsverhältnis geradezu dasjenige, was ständig zu sagen ist, übrig lässt. So gesehen zeigt sich das innere Wort innerhalb des dialogischen Erfahrungsrahmens als das wesentliche Merkmal der menschlichen Grenzerfahrung der Sprache. Daran anschließend versichert sich Gadamers Ansatz zum inneren Wort zugleich der unaufhebbaren Bewahrung der Andersheit des Anderen. Dementsprechend stellt Gadamers Grundsatz der Grenze der Sprache sich so dar: „Oberster Grundsatz der philosophischen Hermeneutik ist, wie ich sie mir denke (und deshalb ist sie eine hermeneutische Philosophie), daß wir nie das ganz sagen können, was wir sagen möchten. Immer sind wir etwas dahinter zurückgeblieben, haben das nicht ganz sagen können, was wir eigentlich wollten.“ (GW. 10, S. 274) Nun lautet Gadamers Grundthese von der Erfahrung der Endlichkeit der Sprache, dass wir nie vollkommen sagen können, was wir sagen wollen, d. h. dass das Gesagte das Ungesagte immer schon hinter sich lässt. Vor allem kann gesagt werden, dass diese These der Grenze der Sprache in jedem Fall den dialogischen Anspruch begleitet: Wir müssen das Ungesagte ständig zu vernehmen versuchen, wenn wir das, was im Grunde zu sagen ist, verstehen wollen, weil wir nicht alles im Nu sagen können, was wir sagen wollen. So gesehen liegt Gadamers späte Einsicht darin, dass das Gespräch zuallererst die nötige Basis ist, damit wir den Anderen erreichen und insbesondere uns selbst verständigen können. Im hermeneutischen Gesprächsverhältnis verursacht die prinzipielle Unsagbarkeit des inneren Wortes keine zweifelhafte Resignation unseres unverzichtbaren Versuchs zur verständlichen Übertragung des Denkens in die sprachliche Ausdrucksform, sondern sie schließt bereits in ihrem eigenen Sinn das zu Sagende, nämlich das ständig anders Sagbare, ein, das sich selbst in die geschichtliche und dialogische Sprachbildung einordnen lässt. Somit wird deutlich, dass sich das innere Wort im unendlichen Übergang zum Wort befindet, weil das Denken selbst die permanente Wortsuche ist. 33 Vgl. Hans–Georg Gadamer, „Die Logik des verbum interius – Hans–Georg Gadamer im Gespräch mit Gudrun Kühne–Bertram und Frithjof Rodi, in: Dilthey – Jahrbuch, Bd. 11, hrsg. v. Frithjof Rodi, Göttingen 1998, S. 19 – 30, insbesondere S. 25, wo Gadamer sagt: „gerade auch der noch nicht vernehmbare Sinn ist Logos.“ Vgl. dazu Jean Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, S. 9 – 11. Im Vorwort zu seinem Buch, das eigentlich den Titel „Vorwörtliches“ trägt, weist er darauf hin, dass der wesentliche Ansatzpunkt der Verfassung in Gadamers Antwort auf seine Frage liegt. Seinem Bericht zufolge hat Gadamer im Interview auf Grondins Frage nach dem hermeneutischen Universalitätsanspruch geantwortet, dass die hermeneutische Universalität im „inneren Wort“ sei. 295 Indem die philosophische Hermeneutik es nunmehr als ihre Hauptaufgabe ansieht, das innere Wort aussprechbar zu machen, d. h. unser inneres Denken zum sprachlichen Sinnhorizont zu führen, weckt das hermeneutische Endlichkeitsdenken das beständig wachsame Mangelbewusstsein, dass uns das treffende Wort fehlt, dass wir das angemessene Wort für dasjenige, was zu sagen ist, gemeinsam suchen und finden müssen. Denn das Bewusstsein, dass das Ungesagte, nämlich dasjenige, was zu sagen ist, immer schon über das Gesagte hinausragt, verlangt die unbedingte Bereitschaft, uns selbst in das dialogische Spiel zu begeben. Da unsere Bereitschaft zum Finden des nötigen Wortes die unbedingte Annahme des Gesagten verweigert, setzt die Bereitschaft zum Einlassen auf das Gespräch hier das unendliche „Suchen nach dem richtigen Wort“ voraus. (GW. 8, S. 360f) Insofern zeigt sich das wachsame Mangelbewusstsein, das das praktische Bewusstsein des Könnens, das auf dem Bekenntnis der existenziellen Endlichkeit des Menschseins basiert, als die anstrengende Bemühung des dialogischen Verstehens um die gemeinsame Sinnfreilegung, zu der das Wort uns stets den Anlass gibt. Ein solches Bewusstsein ist, so Gadamer, daher „eine unbegrenzte Offenheit für Weiterbildung, die in der Sprache liegt. Keine Sprache ist das Regelsystem, […]. Jede Sprache ist ständig auf dem Wege, sich zu verändern.“ (GW. 8, S. 357) So gesehen kann man sagen, dass das Mangelbewusstsein, das unser gemeinsames Suchen nach dem treffenden Wort stets motiviert, die dialogische Offenheit der philosophischen Hermeneutik meint. Daran anschließend hat die dialogische Offenheit aus hermeneutischer Sicht eine doppelte Bedeutung: Die Offenheit meint einerseits die Sinnoffenlegung im unaufhörlichen Versuch der Sprachformulierung des inneren Denkens. Andererseits ist sie das ständige Offenhalten für die Andersheit, auch wenn der dialogische Verstehensvorgang zu seinem Ziel gekommen ist. Aus diesem Grund können wir sagen, dass unser Streben nach dem Wort endlos im Gang ist. An dieser Stelle kommt es darauf an, dass der Sinnumfang der Sprache bei Gadamer eine eigene Dynamik zwischen dem inneren und dem äußeren Wort aufweist. Die dynamische Selbstbildung der Sprache bildet den ununterbrochenen Übergangsprozess vom geformten Wort zum zu Sagenden. Kurzum transformiert die Sprache sich selbst. Gadamer zufolge stellt sich die innere Dynamik der Sprache nunmehr in drei Dimensionen dar (GW. 8, S. 350 ff.): Die „vorsprachliche“, die „sprachliche“ und die „übersprachliche“. Hier weist die vorsprachliche Dimension zunächst auf die zu sagende Sagbarkeit hin, da sie die sinnlichen Wahrnehmungen, Leiden, Gefühle, den Willen zum Bestimmten, das innere Denken usw. mit einschließt. Da sie sich bereits auf diesen sprachlichen Sinnhorizont, nämlich auf das, was der Sprecher sagen will, richtet, strebt der Horizont unseres Sagenwollens mithin ständig nach der 296 sprachlichen Formulierung, d. h. nach der grundsätzlichen Sagbarkeit. Angesichts dessen bezieht sich die sprachliche Dimension im Verlauf der menschlichen Erfahrung auf diesen vorsprachlichen Sinnhorizont, da sich der vorsprachliche Sinnhorizont immer schon auf dem Weg zum sprachlichen Horizont befindet, da das sprachliche Verstehen bereits auf den vorsprachlichen Sinnhorizont angewiesen ist. Daraus folgt, dass sich die vorsprachliche Dimension in gewisser Hinsicht als die übersprachliche zeigt, wenn beide an das zu Sagende gekoppelt sind. Bezüglich des sprachlichen Sinnhorizontes geht jedoch die vorsprachliche Dimension als die Materie zum Sagbaren von ihrem Wert aus, während das Übersprachliche von vornherein immer über eine geformte Sprachdimension hinausgeht. Gleichwohl ist die übersprachliche Dimension für uns nicht das überirdisch Unsagbare, noch das Jenseits des Sagbaren, so lange wir sprachfähig sind. Wenn auch das Übersprachliche nicht vollkommen zur Sprache kommt, so liegt es auf der Hand, dass wir es sagen wollen und daher das treffende Wort dafür suchen. Das Vorsprachliche und das Übersprachliche schlagen sich daher endlos in unserem wechselseitigen Austausch in der Sprache nieder. In diesem Sinn liegt unsere Sprache immer zwischen dem vorsprachlichen und dem übersprachlichen Sinnhorizont. Wenn wir dies im Sinn behaltend auf unsere geschichtliche Sprachbildung anwenden, werden wir diese lebendige Dynamik der Sprache bestätigt finden. Vom Gesichtspunkt der philosophischen Hermeneutik aus betrachtet, stellt die Begriffsgeschichte unsere dynamische Wortsuche ausführlich dar. Die Bewegung der Wortsuche und der Begriffsfeststellung ist dabei auch wechselseitig zirkulär. Die zirkuläre Bewegtheit der geschichtlichen Begriffsbildung, mit der Gadamer sich in seinen Aufsätzen, „Begriffsgeschichte als Philosophie (1970)“ (GW. 2, S. 77 ff.) und „Vom Wort zum Begriff (1995)“ 34 beschäftigt, hat auch den altmetaphysischen Grundsatz vor Augen: omnis determinatio est negatio. Da jeder bestimmte Begriffsumfang seine Bedeutungsgrenze markiert, ist die Begriffsdefinition notwendigerweise negativ. Die Negativität ist die Leitkraft der geschichtlichen Begriffsdefinition, die nicht nur den bestimmten Begriffsumfang sprengt, sondern auch die flexiblen Varianten an die begrenzten Haltepunkte fesselt. 35 Sofern die 34 Hans–Georg Gadamer, „Vom Wort zum Begriff – Die Aufgabe der Hermeneutik als Philosophie“, in: Gadamer Lesebuch, S. 100 ff. 35 Vor allem können wir hier darauf aufmerksam machen, dass Hegel in seiner Logik die Bewegung der wechselseitigen Beziehung zwischen den Begriffen ins Auge gefasst hat. Hegels Ansicht zufolge muss der Begriff den Prozess der Selbstentfaltung und –bildung auf jeder Stufe erledigen. Auf diese Hegelsche Konzeption der prozessualen Begriffsbildung wirft J. Simon mit seiner zeichentheoretischen Perspektive seinen Blick. Nun will J. Simon Hegels Begriffsbewegung in den Zeichenversionen, in deren Übergang der Begriff sich selbst zeitlich entfaltet und modifiziert, verstehen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist ein Zeichen, ohne die Interpretation zu verstehen, unmittelbar, aber ein Zeichen soll bei seiner Erklärung oder bei seiner Mitteilung unentbehrlich in die anderen Zeichen übergehen. Hier ist das Zeichen vermittelt. Der Begriff als das Zeichen skizziert deshalb den spürbaren Weg zwischen der Unmittelbarkeit und der Vermitteltheit. Dementsprechend drückt J. Simon aus: „Der >>wahre Begriff<< ist, aus dieser Sicht, das entweder 297 definitive Bedeutungsgrenze jedes philosophischen Begriffs mit der geschichtlichen Sprachbildung Schritt hält, kann man sagen, dass die Begriffsbestimmung nicht mehr dogmatisch geschieht, sondern sie sich mit der geschichtlichen Situation des Sprachgebrauchs mitbewegt: Sie befindet sich in dem uneingeschränkten Sinnnetzwerk, das sich zwischen der umgangssprachlichen Sprachgemeinschaft und den philosophischen Begriffsgebrauchsräumen hin und herbewegt, verbreitet und verengt. Unter dem Motto „Nicht nur vom Wort zum Begriff, sondern ebenso vom Begriff zurück zum Wort“ rückt Gadamer das geschichtlich dynamische Wechselverhältnis zwischen der Wortbildung und der Begriffsbildung in den Vordergrund: „Ohne Begriff zum Sprechen zu bringen, ohne eine gemeinsame Sprache können wir nicht die Worte finden, die den Anderen erreichen. Der Weg geht >>vom Wort zum Begriff<< - aber wir müssen vom Begriff zum Wort gelangen, wenn wir den Anderen erreichen wollen. Nur so gewinnen wir ein vernünftiges Verständnis füreinander.“ 36 Von der umgangssprachlichen Sprachgemeinschaft ausgehend, die der Muttersprachkreis prägt, können wir uns um die Bildung des nötigen Begriffs bemühen. Im Anschluss an die lebendige Flexibilität der umgangssprachlichen Sprachbildung hat die Begriffsbildung ihre geschichtliche Verwendungssituation, in der der gebildete Begriff bereits mit dem umgangssprachlichen Sprachgebrauch verknüpft ist. In diesem wechselseitigen Übersetzungsverhältnis gelangt der gesuchte Begriff zur gemeinsamen Sprache. Mit dieser Umsetzung gewinnt er auch seinen eigenen Sinnhorizont, in dem er begrenzt verwendbar ist. Wenn sich die Sprachbildung damit auch in der ständig uneinholbaren Dissonanz zwischen der ursprünglichen Bedeutungsintension und dem gesuchten Wort bzw. dem bestimmten Begriff befindet, so zeigt sich doch auch, dass diese Situation der Sprachbildung, die ambivalent zu sein scheint, in der philosophischen Hermeneutik hauptsächlich das unverzichtbare Moment zu unserem Akt der Wortsuche motiviert. So bildet der ununterbrochene Übergang zwischen der Begriffsbildung und der Begriffsverwendung das Gesprächsverhältnis. In diesem Gesprächsverhältnis, wie Gadamer sagt, „sonst nirgends, hat Philosophie ihren wahren, ihren nur ihr eigenen Prüfstein.“ (GW. 2, S. 91) Dieser Dialogperspektive entsprechend, überträgt die philosophische Hermeneutik den unmittelbare oder zu neuer Unmittelbarkeit hin vermittelte Verstehen der Zeichen als das gelingende Verstehen, in dem das, was eine Person (von ihrem >>Standpunkt<< aus) sagt, einer anderen (von ihrem anderen >>Standpunkt<< aus) >>etwas<< bedeutet, ohne dass zur gleichen Zeit noch einmal >>reflektiert<< würde, ob das auch für beide >>dasselbe<< sei. […] Die Zeit ist die reine Form der Veränderung des >>Standpunktes<< oder der >>Bewegung des Begriffs<< in Zeichenversionen; sie ist das reine Übergehen des einen in den anderen Standpunkt. So ist der Begriff der Begriff eines Individuums als eines Sohnes >>seiner<< Zeit, die sich für kein anderes Individuum als >>dieselbe<< darstellen muß wie für es selbst. Auch die Beschreibung der Zeit wäre immer nur wieder die Darstellung seines Begriffs von ihr und ihr Geist insofern sein eigener Geist.“ vgl. Josef Simon, „Von Zeichen zu Zeichen“, in: Fremde Vernunft – Zeichen und Interpretation IV, hrsg. v. ders. und Werner Stegmaier, Frankfurt a. M. 1998, S. 44 – 45. 36 Hans–Georg Gadamer, „Vom Wort zum Begriff“, S. 100 und S. 110. 298 philosophischen bzw. theoretischen Begriffsgebrauchsraum auf die praktischen Handlungsräume, auf deren Ebene sich der Handelnde durch die Sprache erklären muss und damit den Anderen durch die Sprache verstehen kann. Ein Wort oder ein Satz erwirbt deshalb seinen Sinn nur im dialogischen Kontext, der den Sozialisierungsprozess leistet. An dieser Stelle wird deutlich, dass jeder Begriff bzw. jedes Wort kein bloß gesprochenes oder geschriebenes Zeichen ist, sondern uns die sich kundgebenden Sinnangebote im geschichtlichen Verwendungskontext vermittelt. Dementsprechend ist jeder Satz aus hermeneutischer Sicht nicht mehr der ‚apodiktische’ Urteilssatz, der sich des unhintergehbaren Grundes der Wahrheitserkenntnis durch die beweislogische Erklärung zu versichern trachtet. Wenn wir uns hier kurz auf die Aristotelische „Apodiktik“ beziehen, so bedarf Aristoteles’ „Apodiktik“ als der Satz des theoretischen Wissens (episteme) im Grunde keiner Zustimmung des Anderen, d. h. sie sorgt sich nicht um die Zusage des Anderen, während die Sokratische Gesprächsführung immer die Zustimmung des Gesprächspartners ins Zentrum stellt und damit ihren Weg durch die mitkonstitutive Beteiligung des Anderen, nämlich durch das Zusammengehen mit dem Anderen, bestätigt haben will. Aus hermeneutischer Sicht ist das Verstehen des gesagten Aussagesatzes weder von der methodisch separierten Trennlinie, die zwischen dem Erkenntnissubjekt und seinem Objekt verläuft, noch von der widerspruchslosen Evidenz der ewig wiederholbaren Beweislogik abhängig, sondern bewegt sich stets vor dem Sinnentwurfhorizont, auf den wir uns mit unserem Motivationshintergrund einlassen. Jede Aussage verlangt deshalb über die grammatikalische und semantische Bedeutung hinaus den Sinnvollzug, der immer schon hinter dem Gesagten verborgen ist, aber sich als dasjenige, was sagen will, offenbart. Aus dieser Perspektive hat Heidegger auch von der ‚apophantischen’ Aussage im Unterschied zum hermeneutischen „Als“, das in der ‚vorprädikativen’ Wurzel des fundamentalen Bezugs des ursprünglichen Verstehens auf die Welt besteht, gesprochen. Aus Heideggers Sicht verführt uns die apophantische Aussage wie der beweislogische Urteilssatz zu der irrtümlichen Annahme, dass jeder Satz das bezeichnete Ding exakt wiedergibt. Nun erinnern wir uns hier an Heideggers berühmtes Beispiel vom Hammer. Der Aussagesinn, „der Hammer ist schwer“, 37 beruht immer auf den lebensweltlichen Aussageumständen. Wenn jemand eine solche Aussage z. B. einer wissenschaftlichen Sprachgemeinschaft vorgelegt hätte, könnten wir meinen, dass er mit diesem Aussagesatz die physische Schwerkraft zu erklären trachtete. Wenn ein Handwerker, der Tag für Tag mit diesem Werkzeug arbeitet, dies gesagt hätte, könnte mit der Aussage bereits das Leiden, Gefühl, Trieb, Streben usw. seines 37 M. Heidegger, Sein und Zeit, S. 157. 299 gesamten Lebenszusammenhanges gemeint sein. Der Aussagesatz ist mithin nicht auf die theoretische Erklärung, der das Schwere als eine Eigenschaft anhaftet, beschränkt, sondern erweitert die permanente Sinnmodifikation, die sich über die bezeichnete Satzbedeutung hinaus ergibt, in jedem Handlungszusammenhang. Wenn wir die Aussage sprachlich angemessen verstehen wollen, müssen wir deshalb unseren Blick immer über das Satzzeichen hinaus auf das Ungesagte, das stets hinter dem Gesagten steht, richten. Davon abgesehen ist der theoretische Aussagesatz, dem das Prädikat immer beigefügt ist, seitens des Handwerkers überflüssig, noch deutlicher formuliert, geradezu lästig. Denn der Handwerker soll vor einer solchen prädikativen Erklärung bereits mit seinem Werkzeug umgehen können und sich in diesem alltäglichen Umgang als geschickt erweisen. Aus hermeneutischer Sicht kann man daher sagen, dass jede Aussage in Bezug auf die lebensweltliche Handlungsfähigkeit, nämlich auf das praktische Können, das auch das Leiden mit der praktischen Unfähigkeit einschließt, zu tun hat, da die Aussage, „der zu schwere Hammer“, von vornherein im Handlungszusammenhang, in dessen Verlauf sich jeder Betroffene um seine Selbstverständigung kümmert, verwurzelt ist. Insofern bildet das Verstehen der Aussage die sprachlich erschlossene Lebensweise des Menschen. Um den lebensweltlichen Umgang mit der Welt richtig zu führen und die Aussage sprachlich angemessen zu verstehen, müssen wir uns stets um das passende Wort für eine entsprechende Situation bemühen. So gesehen wird klar, dass das hermeneutische Verstehen in den gesamten Lebensbezügen immer schon dem Sprachlichen zugehörig ist. Die hermeneutische Zugehörigkeit, wie das Wort selbst uns andeutet, meint hier den „Hörhorizont“ des Verstehens, da der sorgfältige Versuch des Verstehens der Aussage nicht nur der ununterbrochenen Wortsuche, sondern auch der Vernehmung des Sagenwollens angehört. Außerdem ist das Hören im Gesprächsverhältnis bereits dem Anderen als dem Gesprächspartner zugehörig. Da das Hören hier im Grunde das Zuhören dem Anderen gegenüber ist, ist das Hören immer schon auf den Anderen gerichtet, d. h. das Hören bleibt stets für den Anderen offen. Vor diesem dialogischen Hörhorizont kommt daher die echte Anerkennung der ontologischen Unaufhebbarkeit des Anderen zustande. In diesem Zusammenhang geht es bei Gadamer um das „Auf–ein–ander–Hören–können“. (GW. 1, S. 367) Gadamers Ansicht zufolge eröffnet das praktische Hören–können in der kommunikativen Handlungssituation nicht nur den möglichen Weg zum Verstehen der gesprochenen Aussage, sondern schließt auch das Hören des Ungesagten ein, nämlich das Sagenwollen mit dem ganzen Ohr, mit dessen Licht das dialogische Gemeinsame, das sich über die gesuchte Sachlichkeit verständigt, erreichbar ist. 300 Der hermeneutische Hörhorizont setzt nunmehr die prinzipielle Verstehbarkeit in den dialogischen Handlungsräumen in Gang. Denn das Hören auf einen Ton im Dialog ermöglicht nicht nur das unverzichtbare Suchen nach dem richtigen Wort, sondern auch die gemeinsame Verständigung über den Anderen und über sich selbst. Das Hören ist hier seitens des unendlichen Versuchs der Sprachformulierung der eigenen Denkbildung das Hören auf die innere Stimme und auch seitens der dialogischen Gemeinsamkeitsbildung das Hören darauf, was der Andere sagen will. 38 Der hermeneutische Hörhorizont in den gesamten Dialogvorgängen ist deshalb, wenn ich hier M. Riedel zitiere, „spekulativ, weil sich so die Sprache selbst >>spiegelt<< und als das, was sie ist, zum Vorschein kommt. Sie bringt das Spekulative zur Sprache: die Zwiefalt des Sagens und Sichsagenlassens, das Sprechen, das nicht zugleich, sondern zuvor ein Hören ist, das Zuvorgehörthaben auf das Gesagte. Und er ist geschichtlich, weil sich das Spekulative über das Gespräch mit der Überlieferung als der Spiegelung des Einen im Vielen des Zusagenden entfaltet.“ 39 Demzufolge hat das Hören das zeitliche Primat im dialogischen Verstehen, 40 weil das Hören immer schon die Verstehenspotenzen des zu Sagenden eröffnet und jeder Dialogteilnehmer damit auch die bestimmte Orientierungsspur des Gesagten heraushört. Angesichts dessen leitet der spekulative Hörhorizont im ganzen Dialogvorgang den mitwirkenden Erwartungshorizont an, den wir selbst entwerfen, damit wir die Sinnangebote, die wir gesagt haben und sagen wollen, 38 Zum hermeneutischen Hörverstehen des inneren Denkens in Bezug auf die ästhetische Erfahrung, vgl. Jean Grondin, Von Heidegger zu Gadamer, S. 126 ff. Damit auch zu den Phänomenen des Zuhörens auf die innere Stimme der Andersheit im hermeneutischen Verstehen, vgl. James Risser, Hermeneutics and the Voice of the Other – Re–reading Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, New York 1997, insbesondere S. 159 ff. Gegen Derridas Kritik am „Phonozentrismus“ hat M. Riedel den spekulativen Hörhorizont im Dialogvorgang zu verteidigen versucht. Dementsprechend sagt M. Riedel: „Das Hören begleitet und umgibt aber nicht nur unser Sprechen, es ist mit ihm zugleich. Was kein Sich–Sprechen–Hören meint, wie es Derrida von Husserls Phänomenologie des sprachlichen >>Ausdruck<< (der Phone) her versteht. Es meint vielmehr, dass das Sprechen von sich aus ein Hören sei – auf die von uns gesprochene Sprache und darauf, wie sie selber spricht.“ Manfred Riedel, Hören auf die Sprache, S. 9 – 10. Hierbei handelt es sich somit um das Hören darauf, was die Sprache selbst sagen will. Auch zu Derridas „Phonozentrismus“, der geradezu auf dem abendländischen „Logozentrismus“ beruht, vgl. Heinz Kimmerle, Jacques Derrida, S. 34 ff. 39 Manfred Riedel, Ebd., S. 173 – 174. 40 Wenn wir uns hier fragen, wie wir die Sprache erlernen, können wir m. E. das zeitliche Primat des Hörens im Spracherwerb feststellen. Das wesentliche Phänomen des Spracherwerbs zeigt uns die unendliche Dynamik zwischen der „Nachahmung“ und dem „Austausch“. Dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass die Nachahmung im Laufe des Spracherwerbs dem Austausch immer vorausgeht, dass die Nachahmung mit unserem Wahrnehmungsvermögen des Hörens im Lernen der Sprache verbunden ist. In diesem Sinne könnte fast gesagt werden, dass das Sprechen–Können vom Hören–Können abhängt. Selbst wenn der innere Denkvorgang, der stumm zu sein scheint, zur Sprache kommt, ist das Verstehen dieser sprachlichen Ausdrucksform primär an das Hören auf die innere Stimme des Denkens gekoppelt. Demgegenüber können wir im allgemeinen Sinn feststellen, dass die Philosophiegeschichte seit Aristoteles das Sehen als einen primären Vorgang unter den verschiedenen Wahrnehmungsvermögen des Menschen angesehen hat. Daran anschließend hat Aristoteles zu Beginn seiner Metaphysik gesagt: „Alle Menschen streben von Natur nach Wissen. Dies beweist die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen; denn auch ohne den Nutzen werden sie an sich geliebt und vor allen anderen die Wahrnehmungen mittels der Augen. Nicht nämlich nur zum Zweck des Handelns, sondern auch, wenn wir nicht zu handeln beabsichtigen, ziehen wir das Sehen so gut wie allen anderen vor.“ Aristoteles, Metaphysik, 980 a. 301 sprachlich angemessen heraushören. Da das ursprüngliche Hörphänomen, wie wir oben gesehen haben, die Angewiesenheit auf die Andersheit im Gesprächsverhältnis andeutet, bildet das Hören des Anderen im Grunde das menschliche Zusammenleben. Das Hörverstehen des inneren Sagenwollens im Dialog bringt nicht nur die unentbehrliche Bereitschaft zum dialogischen Verstehen mit sich, in dessen Verlauf die verschiedenen Meinungen zum Tragen kommen, sondern befestigt auch permanent die konstitutive Funktion des Sprechens, die Sinngehalte, die das Wort gibt, im dialogischen Umgang mit dem Anderen offenbar zu machen und anschließend die Gemeinsamkeit aufzubauen. In diesem Sinn sagt Gadamer: „Wer auf den anderen hört, hört immer auf jemanden, der seinen eigenen Horizont hat. Das ist zwischen Ich und Du dieselbe Sache wie zwischen den Völkern oder zwischen den Kulturkreisen und Religionsgemeinschaften. Überall stehen wir vor dem gleichen Problem: Wir müssen lernen, daß im Hören auf den anderen der eigentliche Weg sich öffnet, auf dem sich Solidarität bildet.“ (GW. 8, S. 347) Dadurch, dass das ursprüngliche Hörphänomen von vornherein auf dasjenige, worauf es gerichtet ist, gewissermaßen auf die offene Zugehörigkeit zum Anderen, hinweist, skizziert das Hören im dialogischen Wechselverhältnis die innere Denkspur, die das Sprechen aufweist. In der dialogischen Verstehensstruktur ermöglicht das Hören nicht nur die Verständigung über den Anderen, sondern es ist auch ein Hören auf sich selbst. Das Hören prägt im Grunde das Modell der hermeneutischen Selbsterkenntnis, da das Hören auf das innere Denken im gesamten Dialogvorgang nicht nur dasjenige, was der Andere sagen will, sichtbar macht, sondern auch immer mit dem Hören auf das eigene Innere gekoppelt ist. So verstanden liegt der dialogische Hörverstehenshorizont im stets ineinander übergehenden Dazwischen von der Anerkennung der Andersheit des Anderen und der vom Heraushören der Differenz erschlossenen Bildung des Sinnzusammenhangs. Hiermit wird klar, dass die ewige Suche des dialogischen Hörverstehens nach der gemeinsamen Mitte zwischen der Anerkennung und der Aneignung von sich selbst der reflexive Vorgang des Hörens ist. Denn wenn das Sprechen überhaupt ein sich auslegendes Zeigen, d. h. dasjenige, was wir im sorgfältigen Sprachgebrauch sagen wollen, ist, ist das Hören des Sprechens unmittelbar das Hören darauf, was wir nie ganz verloren haben, was wir nicht vergessen dürfen. So hört das Hören im dialogischen Austausch zwischen dem Reden und dem Gegenreden die Differenzen und gleichzeitig sich selbst heraus. Damit wird deutlich, dass der dialogische Hörverstehenshorizont in der philosophischen Hermeneutik den aufschlußreichen Weg zum internen Vollzug der Selbsterkenntnis in der zirkulären Bewegung zwischen der sprachlichen 302 Grenzerfahrung und der anstrengenden Verfolgung der hinterlassenen Spur der Sprachsuche geht. 303 I – 3. Dialog als Urphänomen des Denkens: Woran orientiert sich die dialogische Gesprächsführung? Der Dialog als die dynamische Bewegung von Sprechen und Hören geht von der wechselseitigen Anerkennung der Andersheit aus und zielt damit auch auf die gemeinschaftliche Verständigung ab. Aus hermeneutischer Sicht ist der Dialog im Grunde mit den gesamten Lebensbezügen des Menschen verbunden und sorgt damit für eine zwischenmenschliche Verbindlichkeit, die auf der notwendigen Bereitschaft zum dialogischen Verstehen basiert. So kommt die wechselseitige Anerkennungsbeziehung als Grundbedingung für die Gesprächsführung zu ihrem Stellenwert. Von diesem Ausgangpunkt eines inwendigen Wechselverhältnisses aus vollzieht sich im Dialog zudem die permanente Anerkennungsbewegung. Dialog ist die Bewegung des Anerkennens, da jeder Dialog nicht nur die wechselseitige Annahme des Anderen als Gesprächspartner voraussetzt, sondern in den jeweiligen Vorgängen auch an die anerkennende Billigung des Gesprächspartners appelliert. Aus diesem Grund spricht Gadamer davon, dass das Gespräch die „Vollzugsform“ der Sprache sei. Die Sprache kommt durch das dialogische Zusammenspiel von Sprechen und Hören zustande, nämlich von Fragen und Antworten. Aus Gadamers Sicht steuert die dialogische Anerkennungsbeziehung nicht nur den zwischenmenschlichen Umgang, sondern strukturiert auch das umsichtige Gespräch mit dem Text und der Welt, sofern die menschliche Erfahrung in ihrer wesentlichen Kontur auf die Andersheit angewiesen ist. Daher kann man sagen, dass die Gesprächsführung unser unverzichtbarer Versuch zum intersubjektiven Antworten auf den Appell und den Anspruch durch die Anderen darstellt. Aus diesem dialogischen Sinnzusammenhang heraus, in dem wir uns bereits befinden, wird außerdem klar, dass die dialektische Bewegung des Anerkennens der Andersheit immer schon den reflexiven Rückblick auf sich selbst innerhalb des interdependenten Rahmens der gegenseitigen Wechseleinwirkung begleitet. Zu diesem verflochtenen Sinnnetzwerk der prozessualen Selbstausbildung kommt der Dialog der Selbsterkenntnis hinzu. Von den bisherigen Überlegungen ausgehend, können wir sagen, dass Sprache in Gadamers Dialoghermeneutik weder definitiv noch vorbestimmt ist, sondern sich immer wieder sich anredend und sich sprechend darstellt, d. h. dass Sprache ständig auf ihre Sachlichkeit im konventionell überlieferten Kommunikationskreis gerichtet ist und dass das Hören, das mit dem Sprechen zusammen das Grundelement des Gesprächs bildet, im ganzen Dialogverlauf auch nicht das in sich verschlossene Vorbeihören, sondern immer offen auf den Anderen gerichtet ist, nämlich auf das Hören der unaufhebbaren Andersheit. Diese 304 dialogische Replikstruktur des ewigen Rollentauschs von Sprechen und Hören wird durch das dialektische Zusammenspiel von Frage und Antwort in Gadamers Wahrheit und Methode wiederhergestellt. Angesichts dessen dürfen wir hier Gadamers kompositorisches Anliegen des Abschnittes „Der hermeneutische Vorrang der Frage“ in seinem Hauptwerk nicht außer Acht lassen, weil er mit diesem Abschnitt zwischen den beiden Teilen, nämlich zwischen der Geschichtlichkeit und der Sprachlichkeit eine Brücke schlagen wollte: In Gadamers Wahrheit und Methode hat die Dialektik von Frage und Antwort eine kompositorische Schlüsselstellung. Sie bildet den Übergang vom II. Teil „Ausweitung der Wahrheitsfrage auf das Verstehen in den Geisteswissenschaften“ zum III. Teil „Ontologische Wendung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache“, anders formuliert, von der Analyse der Geschichtlichkeit der menschlichen Erfahrung zum sprachlichen Sinngeschehen im Gesprächsverhältnis. Somit stellen wir fest, dass das hermeneutische Verstehen des geschichtlich überlieferten Textes in Gadamers Hermeneutik das Gesprächsverhältnis, in dem der Interpret von seinem Interpretandum befragt wird, damit zugleich seine Frage stellt und die Antwort auf seine Frage im Text herauszufinden versucht, auf die Grundlage der traditionellen Überlieferung stellt. Aus Gadamers Perspektive besteht das Lesen eines Textes deshalb von vornherein immer in einem Frage–Antwort–Verhältnis, so lange wie das Lesen das Heraushören einer bestimmten Antwort, die immer vom gelesenen Text aus geht, ist und so lange wie jeder Lesevorgang als Suche auf eine Antwort immer wieder zu der gestellten Frage zurückkehrt und damit zugleich den Ausgangspunkt für eine neue Fragestellung bildet. In diesem hervorragenden Abschnitt bezieht sich Gadamer mit Platons Dialogdenken auf Collingwoods Einsicht ins logische Schema von Frage und Antwort. Hier liegt Gadamers Anliegen zum Rekurs auf Collingwood 41 insbesondere darin, dass „die Vollzugsweise der Dialektik“, wie Gadamer gesagt hat, „das Fragen und Antworten, oder besser, der Durchgang alles Wissens durch die Frage“ sei. (GW. 1, S. 369) Seiner Konzeption der Dialoghermeneutik entsprechend, versucht Gadamer einerseits Hegels monologische Dialektik wieder zurück ins lebendige Dialogfeld zu bringen und andererseits die dialektische Aussagestruktur in Platons Dialog wiederherzustellen. 42 Kurzum tendiert Gadamers Intention 41 Vgl. Robert Schnepf, „Der hermeneutische Vorrang der Frage – Die Logik der Fragen und das Problem der Ontologie“, in: Gadamer verstehen, S. 302 ff. 42 Vgl. Rüdiger Bubner, „Dialog und Dialektik oder Plato und Hegel“, in: Zur Sache der Dialektik, S. 128 ff. Dort scheint Hegels Dialektik ein moderner Versuch zu sein, den methodischen Weg zum richtigen Umgang mit der Aussage im geschichtlichen Begriffsbildungslauf herauszufinden. Wenn auch Hegel, Bubner zufolge, seine Dialektikkonzeption von Platons Dialogdenken ausgehend erarbeitet, ist Platons Dialog für ihn deshalb einer äußeren Reflexion zugehörig, weil Platons Dialog den endgültigen Sachbezug aus den Augen verliert. Hiermit markiert Hegels Idee der eigenen Methodik nunmehr die entscheidende Scheidelinie von Platons Dialog, die in der gedanklichen Differenz zwischen der Vollständigkeit und der Unvollständigkeit liegt. In Bezug auf seine überlegte Einschätzung von Hegels Methodenidee der Dialektik bemerkt Bubner: „Das eigene 305 hier zum dialektischen Dialog, nämlich zur „Dialogik“, die stets von der Sprache ausgeht. Demzufolge hat Gadamers Aufnahme der Einsicht Collingwoods in seine Dialoghermeneutik damit zu tun, dass jede Aussage in dem logischen Schema von Frage und Antwort besteht. Diesbezüglich sagt Collingwood: „Was man gewöhnlich meint, wenn man eine Aussage >>wahr<< nennt, ist meiner Auffassung nach folgendes: a) Die Aussage gehört zu einem Frage–Antwort–Komplex, der als Ganzes im eigentlichen Sinne des Wortes >>wahr<< ist; b) innerhalb dieses Komplexes ist sie eine Antwort auf eine bestimmte Frage; c) die Frage ist dabei das, was wir gewöhnlich eine annehmbare oder gescheite Frage nennen, sie ist keine dumme Frage, d. h. in meiner Terminologie, >>sie erhebt sich<<; d) die Aussage ist die >>richtige<< Antwort auf diese Frage.“ 43 Konsequenterweise zeigt sich in Gadamers Dialoghermeneutik, dass jeder Aussagesatz eine gesuchte Antwort auf die bestimmte Frage ist. Nun müssen wir im Dialogverlauf davon ausgehen können, dass Aussage, Geste, Miene usw. bereits eine Antwort auf unsere Frage sind. Um die jeweils gegebene Antwort zu verstehen, müssen wir deshalb die Frage im Vorhinein bereits verstanden haben, weil jede Antwortform, nämlich Aussage, Geste, Miene usw. auf den Fragehorizont als Motivationshintergrund angewiesen ist. So gesehen liegt auf der Hand, dass wir keinesfalls den Dialog verweigern können, nachdem wir uns auf den Dialogvorgang eingelassen haben. Denn selbst die Verweigerung im Dialog ist bereits eine Antwort. Trotz dieser Aufnahme der Einsicht Collingwoods von Seiten Gadamers, gibt es aber einen Unterschied zwischen den beiden Philosophen. Gadamer distanziert sich, wie wir bereits gesehen haben, kritisch von jedweden metaphysischen Gedankengängen, während Collingwood durch das logische Schema von Frage und Antwort einen gangbaren Weg zum metaphysischen Denken, der vor allem in der Denktraditionslinie des britischen Neohegelianismus steht, zu skizzieren trachtet. Außerdem orientiert sich Gadamers Betonung auf dem Fragehorizont nicht an der logischen Analyse des möglich wahren Aussagesatzes, sondern er rückt das Verstehen des Fragesinns in den Vordergrund, weil die Frage immer schon nicht nur der Antwort zeitlich vorausgeht, sondern auch die mögliche Antwortrichtung anzeigt. Für unseren Zusammenhang geht es deshalb nicht darum, ob ein Aussagesatz eine „wahre“ Antwort ist, sondern vor allem darum, die Frageintention, die sämtliche Aussagen in den gesamten Dialogvorgängen ermöglicht, verständlich zu machen, weil die Angemessenheit einer Antwort bereits vom Verstehen des Fragesinns abhängig ist. Methodenverständnis versperrt Hegel den Zugang zur Struktur eines Gedankengangs im Medium lebendiger Rede.“ (S. 132) 43 R. G. Collingwood, Denken – Eine Autobiographie, übers. v. Hans–Joachim Finkeldei, Einl. v. Hans–Georg Gadamer, Stuttgart 1955, S. 39. 306 Aus diesem Grund werden wir im folgenden insbesondere auf drei Punkte achten müssen: Gadamers Dialoghermeneutik akzentuiert erstens das Primat der Frage im ineinander übergehenden Gesprächsverhältnis. Demzufolge leitet der Fragehorizont nicht nur die ständige Sinnstoßrichtung des Gesprächs, sondern übt auch den Vorgang des reflexiven Wiedererinnerns aus, auf dem das Moment der Selbsterkenntnis basiert. In der Anknüpfung an das Frage–Antwort–Verhältnis wendet Gadamer zweitens Platons Dialogdenken seine Aufmerksamkeit zu. Hier zeigt sich, dass Platons sokratischer Dialog dem Gesprächspartner durch die Verwirrung der Selbstgewissheit Anlass zum eigenen Denken gibt. Der Dialog als dynamische Bewegung von Frage und Antwort gelangt in Gadamers Hermeneutik schließlich zu der dialektischen Selbsterkenntnis in der Anerkennung der Andersheit. Gadamers Dialoghermeneutik zufolge spiegelt der Dialogvorgang keine totale Zurückführung auf die substanzielle Subjektivität wieder, sondern begleitet einen reflexiven Rückzug auf sich selbst, der die Andersheit des Anderen, ohne Appell an die gewisse Substanz, stets mitkonstruiert. Wenn wir an dieser Stelle der Formulierung der Gadamerschen Dialoghermeneutik entnehmen können, dass jede Aussage im Grunde eine Art der Antwort ist, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass alle Ausdrucksformen das Modell der Aussage in sich enthalten. Die Aussage als ein jeweils möglicher Antwortversuch darf deshalb nicht verkürzt verstanden werden. Aus Gadamers Sicht ist nicht nur ein geschriebener Text, sondern auch das lebendige Sprechen und das Handeln eine Aussage als Antwort auf eine bestimmte Frage. Da das dialogische Verstehen nunmehr auf dasjenige, was geschrieben, gemeint und getan wird, bezogen ist, besteht das Verstehen aus hermeneutischer Sicht im Verstehen solcher Äußerungen. Um diese Äußerungen zu verstehen, müssen wir aber zuerst ihren Motivationshintergrund verstehen, weil jede Aussage ihre Motivationsgeschichte beinhaltet. Hinsichtlich dessen bemerkt Bultmann: „Ein Verstehen, eine Interpretation, ist – das ergibt sich – stets an einer bestimmten Fragestellung, an einem bestimmten Woraufhin, orientiert.“ 44 Insofern setzt das Verstehen der geschriebenen, gemeinten oder gemachten Aussage im hermeneutischen Gesprächsverhältnis vor allem das Verstehen der Frage, die jede Aussage motiviert, voraus. Denn nur wenn die Frageintention des Fragenden deutlich wird, kann entschieden werden, ob eine vorgegebene Aussage als die angemessene Antwort auf die Frage annehmbar ist oder nicht. Aus Gadamers Sicht stiftet die Bereitschaft zum Fragen den Erwartungshorizont 44 des möglichen Sinngehaltes. Das Verstehen der Frage im Rudolf Bultmann, „Das Problem der Hermeneutik“, in: Seminar: Philosophische Hermeneutik, 2. Aufl., hrsg. v. Hans–Georg Gadamer u. Gottfried Boehm, Frankfurt a. M. 1979, S. 242. An anderer Stelle hat er zudem gesagt: „Echtes Verstehen wäre also das Hören auf die im zu interpretierenden Werk gestellte Frage, auf den im Werk begegnenden Anspruch, […].“ (S. 252) Zu Bultmanns Einfluss auf Gadamer in seiner Studienzeit, vgl., Jean Grondin, „Gadamer und Bultmann“, in: Gadamer verstehen, S. 186 ff. 307 Gesprächsverhältnis öffnet mithin den Weg zum dialogischen Verstehen. Somit kann man sagen, dass das dialogische Verstehen, wie Gadamer sagt, „des Aufbrechens der Sache durch die Frage [bedarf]“, d. h. dass es die ununterbrochene Antwortsuche in der Sinnorientierung der Frage ist. (GW. 1, S. 369) Da jede gesuchte Antwort auf einen bestimmten Fragesinn angewiesen ist, steht die Antwort nicht vorher fest, sondern bewegt sich mit der sinnkonstruktiven Modifikation des Fragehorizontes mit. Auch wenn Gadamers Begriff „Vorrang der Frage“ an dieser Stelle als Betonung der Priorität des Frageverstehens in der gegenseitig aufeinander wirkenden Gesprächssituation verstanden werden kann, will Gadamer mit seiner Hervorhebung nicht dem Privileg des Fragenden, hinter dem wir den subjektphilosophischen Zug entlarven können, im Gesprächsverhältnis entsprechen, sondern den Schwerpunkt auf die allgemeine Fragesituation, die das dialogische Verstehen stets leitet, legen. Im hermeneutischen Gesprächsverhältnis werden wir nicht nur vom zu Verstehenden befragt, sondern wir müssen auch die Frage innerhalb des von uns gestifteten Fragehorizontes finden, bevor eine Aussage als erwünschte Antwort angenommen werden kann. In Gadamers Dialoghermeneutik ist das Verstehen der Frage gegenüber der Beantwortung deshalb „das Offenlegen und Offenhalten von Möglichkeiten“. (GW. 1, S. 304) Mit anderen Worten: Das Fragen, das Fragenkönnen im dialogischen Wechselverhältnis führt uns nicht nur einen möglichen Antworthorizont vor Augen, sondern erschließt uns auch das Verstehen der Frage, das als ein entscheidender Sinnträger im gesamten Dialogverlauf mitschwingt. (GW. 1, S. 381) Darüber hinaus schließt das Primat der Frage die praktische Haltung gegenüber dem Anderen in dem Sinn mit ein, dass das dialogische Verstehen im ununterbrochenen Austausch zwischen Frage und Antwort die ontologische Angewiesenheit auf die Andersheit voraussetzt. Insofern ist das Fragenkönnen von vornherein auch das Verstehen der Frage, das mit dem Hören auf dasjenige, was zu sagen ist und was der Andere sagen will, zustande kommt. Denn das dialogische Verstehen bewegt sich aus hermeneutischer Sicht mit der unaufhörlichen Übernahme der Frage in die eigene Frage mit, nämlich einerseits mit dem Versuch zur Herausarbeitung der Frage hinter der vorgegebenen Aussage, andererseits mit der unendlichen Suche nach einer Antwort innerhalb des von uns gestellten Fragehorizontes. Gadamers Formulierung, dass die Frageintention vor dem Antwortverständnis verstanden werden muss, stellt deshalb die mindeste Voraussetzung für die angemessene Beantwortung in der hermeneutischen Gesprächssituation dar, da der Fragehorizont immer schon eine bestimmte Sinnrichtung anstößt und sowohl der mögliche Antworthorizont als auch die Offenheit des Fragenkönnens variabel sind. 308 Der Fragehorizont skizziert nunmehr die sinnkonstitutive Dynamik des gesamten Gesprächsverlaufes, da er den Sinnkontext, der uns fehlt, bildet und den Sachverhalt, der hinter der zu verstehenden Aussage liegt, anzeigt. Eine sinnvolle Fragestellung markiert deshalb nicht nur den begrenzten Sinnraum des potenziellen Antworthorizontes, sondern sie macht auch den positiven oder negativen Sinn einer zu verstehenden Aussage, nämlich den Motivationszusammenhang, sichtbar, zu dem sich die Aussage verhält, wogegen sie Einwände hat oder woran sie sich orientiert usw. Selbst die einfachste Seinsfrage, nämlich „was ist“, ist bereits mit dem immanenten Sinngebilde, das in der kontextabhängigen Fragesituation zur Sprache kommt, verknüpft, sofern jede Frage von vornherein die Erwartung an eine Antwort beinhaltet. Da jede Fragestellung immer schon „die bestimmte Umgrenzung durch den Fragehorizont“ einschließt, setzt die Erwartung an eine angemessene Antwort den wechselseitigen Spielraum des Gesprächs in Gang. (GW. 1, S. 369) Die Erfüllung der Erwartung, die in der Dialogsituation als Ziel gesetzt wird, entscheidet sich schließlich in Abhängigkeit von der voran gegangenen Frageintention. Insofern wird deutlich, dass die dialogische Bewegung der Fragestellung das ständige Hervorbrechen einer Aussage im jeweiligen Gesprächslauf provoziert und damit dem Antwortenden zugleich die Möglichkeit der reflexiven Überprüfung seiner eigenen Aussage eröffnet. Denn die Frage ermöglicht mit ihrer wesentlichen Offenheit nicht nur den möglichen Antworthorizont, sondern eröffnet auch die Möglichkeit des permanenten Nachfragens. So gesehen stammt die hermeneutische Offenheit des dynamischen Fragehorizontes im gesamten Dialoglauf, wie bereits erwähnt, aus dem intensiven Blickwinkel von Gadamers Dialoghermeneutik auf die existenzielle Endlichkeit des Menschen, in deren Licht die Ganzheit der praktischen Lebensbezüge von vornherein zustande kommt. Angesichts dessen muss vor allem gesagt werden, dass der Vorrang der Frage vor der gemachten Aussage von nun an die praktische Haltung für die unaufhebbare Andersheit und das unvorhersehbare Ergebnis im Gespräch in den Vordergrund stellt. Die Frage, die wir uns selbst stellen, zielt daher nicht auf die Erarbeitung eines Maßstabes für das Antworten-Können 45 ab, sondern lässt die „Fragwürdigkeit“, um die es bei der menschlichen Existenz geht, hinter sich. 45 Wenn man hier bemerkt, dass nur eine ‚sinnvolle’ Frage den Umriss des möglichen Antworthorizonts skizziert, wird man sich insbesondere fragen müssen, ob eine Frage, auf die es keine treffende Antwort gäbe, keine Frage ist oder wie eine sinnvolle Frage sich von einer unsinnigen unterscheiden könnte. Diesbezüglich könnte man vermutlich das Unterscheidungskriterium durch die Reduktion der Frage auf das Problem der richtigen Beantwortung herzustellen versuchen. Aber manche wesentlichen Fragen, z. B. die Frage nach der Freiheit, nach dem Gottessein oder nach der Räumlichkeit und der Zeitlichkeit usw., befinden sich hingegen immer im unauflösbaren Antwortsuchgang. Zur Analytik der Frage nach der sinnvollen Fragestellung, vgl., Thomas Schwarz Wentzer, „Das Diskrimen der Frage“, in: Hermeneutische Wege, S. 219 ff. 309 Dass mit dem Verstehen der Frage in Gadamers Dialoghermeneutik schließlich gemeint ist, sich selbst zu fragen, beinhaltet die nie endgültig auflösbare Nachfragbarkeit. Die Nachfrage, nämlich die Rückfrage nach der gemeinten Vorstellung, hat ihren eigenen Sinngehalt in der unabschließbaren Bewegung des dialogischen Verstehens. Denn die Nachfrage schließt von vornherein die Reaktion auf die gegebenen Antwortvorschläge mit ein. Aus diesem Grund übt sie sich auch in der Bejahung und der Verneinung, im Zweifel am vorgelegten Aussagesatz oder in der Versicherung des Aussagesatzes usw. So kommt es im Dialogverlauf öfter zu einer Nachfrage als zu einer bestimmten Antwort. Dementsprechend stiftet der Fragehorizont ein offenes und symmetrisches Verhältnis zwischen der Affirmation und der Negation, weil jede Frage eine Ja–Nein–Stellungnahme innerhalb des potenziellen Antworthorizontes verlangt und in diesem Sinne ein unabgeschlossenes Behauptungsmoment gewinnt, während jeder beweislogische Aussagesatz, der den von sich selbst betonten Wahrheitsanspruch im Auge behält, im Grunde die Affirmation bevorzugt. Wenn das Behauptungsmoment im dem gegebenen Antwortsatz vorausgehenden Fragehorizont nicht bereits bestände, wäre es unmöglich, dass wir im Dialogverlauf einen gegebenen Aussagesatz als eine sinnrichtende Behauptung annehmen. Darüber hinaus leitet die ununterbrochene Bewegung von Fragen und Nachfragen den reflexiven Vorgang an, an dem alle Dialogteilnehmer teilnehmen. Das Hervorbrechen der Nachfrage im Dialoglauf zwingt den Antwortenden zur kritischen Überprüfung seiner Aussage und zum retrospektiven Versuch der Mitteilung seiner Verstehensweise, ja seiner Meinung. Die immer offen bleibende Nachfragbarkeit, die sich mit dem Geben der Antwort mit bewegt, führt auch den Fragenden auf die gestellte Frage reflexiv zurück. Mit dem Hören der Antwort ruft sich der Fragende seine ursprüngliche Frage in Erinnerung und reagiert damit auf die gegebene Antwort auf seine Frage. Indem sich der Fragehorizont von vornherein immer auf das Fragwürdige bezieht, er stets kritisch die erworbene Geltung hinterfragt und indem die kritische Nachfrage nach dem Vorgegebenen nicht nur Zweifel weckt, sondern auch die Gewinnung eines anderen und neuen Sinnhorizontes anstrebt, etabliert der Fragehorizont im dialogischen Verstehensvorgang das selbstkritische Reflexionsfeld. 46 46 Zum reflexiven Dialogakt am Leitfaden des Fragehorizontes, vgl. Josef Simon, „ Von Zeichen zu Zeichen“, S. 38. Hier bemerkt er: „Ich vermittelt mich mit mir und den anderen, >>für<< die ich mein Verstehen äußere, weil mir an ihrem Verstehen gelegen ist, in einem Akt, und es muß sich jeweils zeigen, ob sie mich verstehen und ich darin auch mit mir selbst vermittelt bin. Es erscheint als gelungen, wenn sie meinen Versuch der Darstellung dessen, was ich mir vorstelle, von sich aus unmittelbar (d. h. ohne weitere Frage nach >>Bedeutungen<< der Zeichen dieser Darstellung) und insofern >>leicht<< zu verstehen scheinen. Erst ihre Rückfrage nach >>der<< Bedeutung, die eine Differenz im Verstehen zur Sprache bringt, bringt mich (wieder) zur >>Reflexion<< meiner Vorstellung >>auf mich<<.“ 310 An dieser Stelle fassen wir die bisherigen Überlegungen des Fragephänomens im Dialogverhältnis zusammen. Die Frage eröffnet mit ihrer Sinnrichtungskraft zunächst den Erwartungshorizont auf die angemessene Antwort. Zweitens befindet sie sich immer in einer unabschließbaren Dynamik, weil jede Frage befragt und immer wieder hinterfragt wird. Im Anschluss an die dialogische Selbstverständlichkeit erreicht der Fragehorizont schließlich seinen Vollzug im reflexiven Rückzug auf sich selbst. Darüber hinaus ist die Logik von Frage und Antwort, wie Gadamer in Anlehnung an Platons Dialog sagt, nunmehr die Dialektik (=dialegesthai), die aus dem ursprünglichen Begriffssinne auf den „richtigen Umgang mit der Rede im Gespräch“ 47 verweist und die deshalb ihre Vollzugsform im lebendigen Dialog findet. Somit ist der dialektische Dialog, nämlich die Dialogik bei Gadamer, „die Kunst des Fragens und des Suchens der Wahrheit“, weil sie immer schon mit ihrem Sachverhalt zu tun hat, d. h. die Sachangemessenheit, die von vornherein durch die Dialogsituation bedingt ist, verlangt. 48 Um einen gelungenen Dialog vom misslungenen zu unterscheiden, benötigt der Dialog keinen äußeren Dritten, sondern stellt von seinem eigenen Verfahrensgang her den nötigen Maßstab auf. Somit wird deutlich, dass der einzige Kontrollbereich des Dialogs die gemeinsam gesuchte Verständigung, die vom Gespräch selbst erzwungen wird, ist. Wenn die gemeinsam gesuchte Verständigung der nötige Maßstab für den gelungenen Dialog ist, kommt die Wahrheit, die im Verlauf des Gesprächs ständig mitspielt, Gadamers Dialoghermeneutik zufolge, mit der sachgemäßen Übereinstimmung des Gesprächspartners zum Vorschein, weil der Logos sich selbst in diesem Miteinanderreden durchsetzt. Hierbei skizziert die Durchsetzung des Logos im gesamten Dialogverlauf den schrittweisen Prozess der gemeinsamen Wahrheitssuche. Da uns der Dialog als dia–logos einen ausgezeichneten Ort der Selbstdarstellung des Logos verleiht, basiert das Aufgehen der Wahrheit im Dialog auf der gemeinsamen Verständigung über die Dialogsache. Deshalb kann man sagen, dass der Dialog einen potenziellen Sinnhorizont für die Selbsterscheinung der Wahrheit stiftet. Beim Rückgriff auf Platons Dialog besteht Gadamers Hauptanliegen darin, dass das Aufgehen der Wahrheit die dialogische Teilhabestruktur am Logos aufweist. Die Teilhabestruktur als die Grundstruktur der menschlichen Erfahrung, wie wir bereits gesehen haben, ist im Grunde der Ursprung unseres praktischen Tuns, nämlich das primäre Teilnehmen am Dialog für die unentbehrliche Wahrheitssuche, weil sich der Logos selbst 47 48 Rüdiger Bubner, „Dialog und Dialektik oder Platon und Hegel“, S. 124. Zu Gadamers Versuch der Ausarbeitung der Gemeinsamkeit zwischen dem Dialog und der Dialektik, vgl., Petra Plieger, Sprache im Gespräch – Studien zum hermeneutischen Sprachverständnis bei Hans–Georg Gadamer, Wien 2000, S. 62 ff. 311 immer auf dem dialogischen Übergangsweg zur Wahrheit befindet. 49 Indem der Dialog im herkömmlichen Sinn das denkende Teilhaben am Logos selbst, nämlich das Durchschreiten des Logos, ist, bildet das Sich-Einlassen auf das Gespräch bei Gadamer unseren unverzichtbaren Erwartungshorizont an das Wahrheitsgeschehen im Wechselverhältnis. Das motiviert unser Bestreben, der Mitteilung des Logos unseres Gesprächspartners durch das dialogische Mitdenken zuzuhören. Kurzum ist die Teilnahme am Dialog im Grunde das Verweilen bei dem Logos. Da der Dialog selbst einen entscheidenden Sinnraum der Selbstmitteilung des Logos darstellt und wir in dieser Hinsicht mit dem Logos verbunden sind, verlangt die dialogische Übung als ununterbrochene Wahrheitssuche auch eine ethische Haltung. Um die Wahrheit, die sich am Leitfaden des Logos orientiert, zu finden, müssen wir als Dialogteilnehmer unbedingt den Anderen als unseren mitkonstruktiven Gesprächspartner annehmen, damit die Andersheit des Anderen anerkannt und daran anschließend die Bedingtheit unserer eigenen Perspektive offenkundig wird. Denn einer von uns besitzt nicht allein den Logos, sondern der Logos befindet sich immer im zwischenmenschlichen Dialog. Wenn sich der Dialog mit dem Logos mitbewegt, kann man sagen, dass der Dialog selbst den dialogischen Handlungsraum, in dem die gemeinsame Wahrheitssuche stattfindet, errichtet und die ethische Grundlage enthält. Somit wird deutlich, dass sich das Gespräch als Überprüfer sämtlicher Aussagen erweist. Denn das Gespräch ist, wie bereits erwähnt, ein kritisches Erprobungsfeld, auf dem die verschiedenen Meinungen ausgetragen und überprüft werden. Die kritische Selbstüberprüfung des Gesprächs wird nicht durch die subjektive Absicht kanalisiert, sondern sie verfolgt die dynamische Bewegung der gemeinsamen Gesprächssache im geschichtlichen Verlauf vom gegenseitigen Widerspruch zur Verständigung über den Anderen und über sich selbst, da die gesamten Gesprächsvorgänge die Struktur des unendlichen Suchens nach dem treffenden Wort aufweisen und sich ein solch gesuchtes Wort bereits in die virtuellen Lebensbezüge der Gesprächssituation einlagert. So lässt sich jede Aussage als Darstellung einer Meinungsverschiedenheit im Gespräch durch das aufeinander Hören auf einen anderen Sinnhorizont übertragen. In diesem dialogischen Übertragungsverhältnis konfrontiert sie sich mit der zweifelnden Nachfrage und der Widerrede. Die Konfrontation mit der Widerrede des Gesprächspartners zwingt deshalb jeden Gesprächsteilnehmer zum selbstkritischen Reflexionsrückzug auf den Sachverhalt des Gesprächs und damit zum wiederholten Versuch 49 Zu Gadamers Anknüpfung an Platons Dialogdenken in den traditionellen Forschungslinien, von Schleiermacher über Natorp und Hartmann bis Stenzel, vgl. Mirko Wischke, Die Schwäche der Schrift – Zur philosophischen Hermeneutik Hans–Georg Gadamers, Köln 2001, S. 119 ff. Von Platons Kritik an der Schrift im 7. Brief ausgehend, versucht er hier insbesondere auf diese Frage zu antworten, warum der Logos selber seine Grenze betrifft, womit der Fluchtpunkt in die Logoi (die lebendige Rede) angesprochen wird. 312 des Herausfindens des verfehlten Wortes, der sich der lebendigen Bewegung der sachlichen Gesprächssituation Schritt für Schritt annähern wird. Somit kann man sagen, dass sich die gesamten Gesprächsvorgänge selbst als kritische Überprüfungswege erweisen, die die Unaufhebbarkeit der Andersheit ständig im Auge behalten. Nun hat der Dialog damit seinen Stellenwert als basaler Sinnganzheitshorizont, vor dem sich der Logos durchsetzt, vor dem sich die gemeinsame Wahrheitssuche erfüllt. In Gadamers Dialoghermeneutik zeigt sich der Dialog deshalb als „das ursprüngliche Urphänomen der Philosophie“, nämlich des Philosophierens, 50 weil das Gesprächsverfahren uns immer zur eigenen Denkbildung führt. Wenn wir an dieser Stelle auf die Philosophiegeschichte blicken, stellen wir fest, dass die diskursiven Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Positionen in der gesamten Philosophiegeschichte diese Kraft des Dialogs, das Denken immer weiter anzuregen und zu erzeugen, skizzieren. Die Philosophie wiederholt im Laufe ihrer Denkentwicklung immer wieder die Frage nach der Idee der Wahrheit, die stets als normative Bestimmung in der Geschichte fungierte. Insofern bildet das geschichtlich überlieferte Denkerbe hier nicht nur die elementare Basis für die gegenwärtigen Philosophie, sondern auch der Versuch zur umfassenden Darstellung der philosophiegeschichtlichen Denkentfaltung, selbst der Umgang mit einem Philosophietext, führt uns zu der nie endenen Suche nach der Antwort auf die anfängliche Frage der Philosophie. Mit der Erkenntnis, dass sich die Philosophiegeschichte im dialogischen Wechselverhältnis, das in jeder anderen Geschichtslage vertikal und horizontal zustande kommt, darstellt, anders formuliert, dass die Philosophie in der Dialogform die entscheidende Kraft, sich selbst endlos weiter zu korrigieren und zu variieren, findet, legt Gadamer nunmehr sein Augenmerk auf Platons sokratische Dialoge, die der Geburtsort der Philosophie sind. Gadamers Ansicht zufolge zielt Platons Dialog darauf ab, nicht nur den zeitgenössischen Dialogteilnehmer, sondern auch den Leser in die lebendige Denkbewegung im Dialog mit einzubeziehen, damit jeder Teilnehmer die Dialogbewegung verfolgen und sein eigenes Denken ausbilden kann. Im Anschluss an den philosophiegeschichtlichen Rückgriff auf Platons Dialoge, ist es Gadamers Hauptanliegen, den Dialog als die anfängliche „Urgestalt“ der Philosophie zu bezeichnen, nämlich des menschlichen Denkens überhaupt, uns also den grundsätzlichen Spielraum bietet, in dem wir nicht nur nach der philosophisch gesuchten Antwort, sondern auch nach einer vielschichtigen Denkweise im umgangssprachlichen Austausch suchen, in dem die wesentliche Meinungsverschiedenheit zur Sprache kommt. Dementsprechend heißt es bei Gadamer: „Das hermeneutische Urmodell 50 Vgl. Ebd. S. 124 ff. 313 ist das Gespräch, und dieses steht unter der Leitidee der Erzielung von Verständigung. Das braucht natürlich nicht immer zu Einverständnis zu führen. Es kann auch verständnisvoller Austausch von Gründen und Gegengründen sein. Aber auch dann noch ist ein tragendes Einverständnis dabei vorausgesetzt. Denn das Resultat der Verständigung ist insofern positiv, als sich dadurch die Überbrückung von Gegensätzen, Vermittlung und Kompromiß anbahnen können.“ 51 Wir sollten vor allem im Auge behalten, dass Platons sokratischer Dialog von der Frage nach der Sachwahrheit ausgeht und die Spur der geschichtlichen Suche nach der Wahrheit hinter sich lässt. Indem der Dialog bei Gadamer die Vollzugsform der Sprache ist und die Sprache, wie bereits erwähnt, der ausgezeichnete Ort des Erscheinens der Sachwahrheit ist, 52 ist die Wahrheit, zu der das dialogische Verstehen stets steht, nicht diejenige, die vollkommen aufgehoben und einverständlich festgestellt werden kann, sondern dasjenige, was im dialogischen Wechselverhältnis ständig wieder zu fragen und zu sagen ist. Ähnlich wie Platons Dialog, ist die Wahrheit der Dialogsache bei Gadamer das gesetzte Ziel, das jeder Dialogteilnehmer anstrebt. In diesem Zusammenhang betont er die mitkonstruktive Funktion des Gesprächspartners im gemeinsamen Akt der Wahrheitssuche: „Die erste Bedingung für die Kunst des Gesprächs ist, sich jeweils des Mitgehens des Partners zu versichern. […] Ein Gespräch führen heißt, sich unter die Führung der Sache stellen, auf die die Gesprächspartner gerichtet sind. Ein Gespräch führen verlangt, den anderen nicht niederzuargumentieren, sondern im Gegenteil das sachliche Gewicht der anderen Meinung wirklich zu erwägen.“ (GW. 1, S. 373) Somit kann man sagen, dass die Wahrheit nicht mehr etwas unhinterfragbares, sondern das gemeinsam zu Suchende ist, das den kontextabhängigen Anspruch auf Übereinstimmung mit dem Gesprächspartner im gesamten Dialogvorgang erhebt. Ein solcher hermeneutischer Wahrheitsbegriff, der im Dialogverlauf immer mitspielt, hat mit Platons Erkenntnis der Wahrheit, nämlich „a–letheia“, 53 die sich stets auf die Sokratische Frage richtet, zu tun. Dabei stellen wir fest, dass das Wort „lethe“ im griechischen Wahrheitsbegriff „aletheia“ vorkommt. Somit kann man sagen, dass die a–letheia, wie das 51 Hans–Georg Gadamer, „Emilio Betti und das idealistische Erbe“, S. 97 (meine Hervorhebung). Hier sagt er weiter: „Das habe ich am Modell des Dialogs zu tun versucht, und wie ich meine, im Rückgang auf ursprüngliche Phänomene menschlich–gesellschaftlicher Existenz auszuweisen gesucht.“ 52 Vgl. Reiner Wiehl, „Dialog und philosophische Reflexion“, in: Neue Hefte für Philosophie – Dialog als Methode, (Heft 2/3), Göttingen 1972, S. 41 – 94. Vor allem im Ausgangspunkt sagt er: „Der Dialog erscheint also teils als der ausgezeichnete Ort, an dem „Wahrheit sich ereignet“ oder ereignen kann, teils als ausgezeichneter Grund möglicher Wahrheitsbestimmung, teils schließlich als ein hoher Wert, als eine Wahrheit an sich.“ (S. 41 – 42) 53 Zu Heideggers Wahrheitsfrage in der hermeneutischen Traditionslinie in Bezug auf den griechischen Wahrheitsbegriff aletheia, vgl. Ad Verbrugge, „Aletheia und die Frage nach der Wahrheit“, in: Gadamer verstehen, S. 324 – 337 u. Hans Ruin, „Einheit in der Differenz – Differenz in der Einheit – Heraklit und die Wahrheit der Hermeneutik“, in: Hermeneutische Wege, S. 87 – 106. 314 Wort bereits andeutet, dasjenige, was nicht vollkommen erhellt ist, was jedoch auch nicht ganz vergessen ist, meint. Somit können wir diesen Wahrheitsbegriff aletheia, den Heidegger mit Unverborgenheit übersetzt hat, auch als dasjenige verstehen, was wir uns ständig in Erinnerung rufen müssen, weil sie halb anwesend und halb vergessen, ja verloren ist. Die aletheia, die der Dialog als seine Aufgabe ansieht, ist weder Dialogsubjekt, noch Dialogobjekt, sondern drückt sich immer in der Bewegung der Dialogsache, die bereits in der Dialogsituation enthalten ist, aus. So verstanden ist die aletheia, nach deren Bedeutung Heidegger fragt, geradezu dasjenige, was keine Verborgenheit zulässt bzw. was mit Heideggers Worten immer schon entborgen ist. Infolge dieser Einsicht Heideggers in den ursprünglichen Sinn der Wahrheit wird die aletheia in Gadamers Dialoghermeneutik als Dialogsache verstanden, nach der wir im Dialog suchen und streben sollen, weil sie nur für uns vergessen ist. Die Dialogsache, nach der die Frage im Dialog wieder neu gestellt wird, leitet außerdem die gesamten Dialogvorgänge, weil sie den orientierenden Wegweiser in den jeweiligen Dialogsituationen darstellt. Indem Platons Dialog, Gadamers Ansicht zufolge, die Wahrheit nicht als ein unhintergehbares Vorbestimmtes, sondern als ein „Einleuchtendes“, mit deren Licht nicht nur jeder Dialogteilnehmer, sondern auch der Leser die Frage stellen und die Antwort suchen kann, beschreibt, bildet die Frage nach dem wesentlichen Sinn der Wahrheit, die die Philosophie von vornherein gestellt hat, den Ausgangspunkt des Dialogs. Insofern bewegt sich die philosophische Wahrheitsfrage als die zu erfüllende Aufgabe nicht nur mit der Dialogform ständig mit, sondern vollzieht sich auch im dialogischen Suchprozeß. So gesehen nimmt der Dialog die ursprüngliche Grundstruktur des Philosophierens in den Blick, dass jede Wahrheitsfrage in der bestimmten Dialogsituation wieder nachgefragt werden kann und die jeweils gemeinsam gesuchte Antwort auf die gestellte Frage zustande kommen muss. Aus Gadamers Sicht beginnt die Philosophie daher mit dieser Platonischen Dialogform, d. h. sie findet ihre kontinuierliche Triebkraft in diesem dialogischen Austausch zwischen dem Reden und dem Gegenreden, zwischen dem wiederholten Nachfragen und dem unendlichen Suchen nach der Antwort. Nun kann und muss ein solcher philosophischer Anfang immer dann wiederholt werden, sobald wir die Frage zu stellen und die gemeinsame Antwort zu finden versuchen. Den dialogischen Grundcharakter der philosophischen Wahrheitssuche bereffend, bemerkte Gadamer schon in seiner früheren Habilitationsschrift „Platos dialektische Ethik (1931)“: „Denn daß dies Vervielfachen des Einen eine positive Möglichkeit des Logos ist, das lehrt die Tatsache der Verständigung durch den Logos. Es gibt eine in der Sachaufweisung fortschreitende Rede, die ständig etwas als ein anderes anspricht, dem in ihr gelegenen 315 Widerspruch des Einen und Vielen zum Trotz.“ (GW. 5, S. 16) Demzufolge kann hier im Prinzip gezeigt werden, dass jede philosophische Frage, z. B. die Frage nach dem Anfang, die nach dem Grund oder die nach dem Sein des Seienden, im dialogischen Wechselverhältnis neu gestellt werden kann und dass die gesuchte Antwort mit einer jeweils anders gestellten Frage wiederum neu und anders abzuwägen ist. Kurzum entwickelt sich das philosophische Problem im geschichtlich bedingten Dialoggang stets anders und neu. Insofern ist der philosophische Anfang überall da, wo der Dialog im Gang ist, d. h. wo die Frage nach dem Anfang gestellt wird. Aus diesem Grund wird der Dialog, in dem der Logos ständig mitschwingt, von Gadamer als ein dauerhafter Motor der Philosophie betrachtet, weil das bereits Gesuchte mit der zweifelnden Fragestellung immer wieder neu gesucht werden muss und die vorher marginalisierten Varianten durch die Nachfrage wieder in unsere dialogischen Gedanken integriert werden müssen. Somit ist der Dialog, Gadamers Ansicht zufolge, tätig in seiner bedingten Lage; das Aufgehen der Wahrheit ist die Tätigkeit des Dialogs. Denn der Dialog bildet nicht nur das Sinnnetzwerk, in dem wir der Sachwahrheit begegnen, sondern auch den Handlungsraum, in dem wir uns verständlich machen und uns mit dem Anderen verständigen. Im Anschluss an Gadamers Einsicht ins hermeneutische Wahrheitsgeschehen im andauernden Dialogvorgang müssen wir hier die Frage stellen, wie sich das dialogische Denken entwickelt und wie das Denken seiner Selbsterkenntnis zugute kommt. Wir haben bereits gesehen, dass sich Gadamer nicht nur von der naturwissenschaftlichen Idee der Objektivität, sondern auch von der philosophischen Konzeption der Subjektivität in der Neuzeit kritisch distanziert hat. Somit liegt auf der Hand, dass das hermeneutische Selbstverstehen nicht als die substanzielle Entität, sondern als dasjenige, was sich selbst in der zirkulären Bewegtheit zwischen dem Selbstbezug und dem Fremdbezug entdeckt, verstanden wurde. Das „Sich–Verstehen“, auf das jeder Verstehensakt von vornherein abzielt, war die Selbsterkenntnis in Bezug auf den Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit, wie Hegels berühmte Formel „die Selbsterkenntnis im Anderssein“ zum Ausdruck bringt. Von da aus darf man nicht außer Acht lassen, dass Gadamer mit seinem nachdenklichen Anliegen zum wirkungsgeschichtlichen Bewusstsein keinesfalls die mitspielende Individualität im Verstehensakt zur Seite geschoben, sondern seinen Einwand lediglich gegen die Substanzialität in der Rückkehr zur subjektiven Selbstgewissheit gerichtet hat, d. h. die versteinerte Auffassung vom Subjekt im modernen Denken abzumildern gedachte. Aus dieser Perspektive ist daher festzuhalten, dass der Verstehensakteur, der sich selbst versteht, permanent unter dem Einfluss der unerschöpflichen Andersheit seines Anderen steht. 316 Bevor wir den authentischen Orientierungscharakter des Denkens an der reflexiven Selbsterkenntnis im Dialogvorgang behandeln, müssen wir einen kurzen Blick auf Platons Anamnesis–Lehre, 54 die einen entscheidenden Einfluss auf Gadamers Konzeption der reflexiven Selbstentdeckung im dialogischen Wechselverhältnis hat, werfen. Denn Gadamer stellt in Anlehnung an Platon die Grundstruktur der Wiedererkenntnis der dialogischen Selbsterkenntnis ins Zentrum. Dennoch will ich hier den Diskussionsrahmen auf Gadamers Denkverbindung zu Platons Anamnesis–Lehre beschränken, weil Platons Erkenntnis der Wiedererinnerung, die er insbesondere im Dialog Menon konzipiert hat, im gedanklichen Zusammenhang mit der eigenen Erkenntnislehre seiner Ideenlehre steht. Die aletheia ist nichts unterirdisches, nichts, was völlig in den Bereich der Vergessenheit gefallen wäre, sondern sie zeigt sich in unserer unaufhörlichen Erinnerung daran, was vergessen ist. Im sich ununterbrochen wiederholenden Dialogfeld der gemeinsamen Wahrheitssuche skizziert die Wiedererinnerung deshalb die unendliche Zirkulationsbewegung zwischen dem Erinnern und dem Vergessen des Erinnerten. Wenn sich das Denken mit dem zeitlichen Voranschreiten des Dialogs entfaltet und sich dabei auf das Wissen um sich selbst bezieht, hat das Denken, Gadamers Ansicht zufolge, einen vorreflexiven Horizont, der durch den prozessualen Dialogvorgang in den reflexiven Bezugspunkt ständig wieder und anders einbezogen werden muss. Dementsprechend ist ein solch präreflexiver Sinnhorizont im Dialog deshalb nicht nur der Reflexionsgegenstand des Denkens, sondern auch dasjenige, was das Denken im gesamten Dialog bewusst machen und sich ständig in Erinnerung rufen muss. Im Anschluss an diese irreduzible Rekonstruktion des Denkens im dialogischen Phänomen der Wiedererinnerung kann nunmehr gesagt werden, „daß das philosophische Erkennen ein Moment des in ihm Erkannten wird. Unter dieser Voraussetzung vertieft sich das Wiedererkennen im Dialog zu der unvollendbaren, sich unterbrechenden und wieder erneut anhebenden Kontinuität eines nie endenden Gesprächs.“ 55 Nun werden wir sagen können, dass das Vergessen in diesem Zusammenhang nicht ein verhängnisvolles Geratensein in die abgründige Annulliertheit, sondern nur den momentanen Verlust des bereits Bekannten meint und dass das Erinnern hiermit auch nicht auf unser intellektuelles Vermögen zur vollkommenen Fassbarkeit verweist, sondern den Sinnhorizont der Wiederbelebung des Gedächtnisverlustes bildet. Dieser Ansicht zufolge hat die Wieder–erinnerung – indem das Wieder hier die Vergegenwärtigung der jeweiligen Sinnerneuerung unter jedem Umstand 54 Zu Gadamers Verhältnis zu Platons Anamnesis–Lehre, vgl. Charles Scott, „Überlieferungen jenseits von Bildern und gestohlenen Erinnerungen“, S. 3 – 33 und Nicholas Davey, „Mnemosyne und die Frage nach dem Erinnern in Gadamers Ästhetik“, in: Hermeneutische Wege, S. 35 – 62. 55 Mirko Wischke, Die Schwäche der Schrift, S. 178. 317 beinhaltet, ist das Wieder von vornherein das zeitlich prozessuale Geschehen – den Charakter der unendlichen Suche danach, was sich hinter dem gesagten Wort im Dialog befindet. Im Dialogvorgang kommt die Wiedererinnerung zwischen dem Erinnern und dem Vergessen des Erinnerten durch das in der bestimmten Situation konstruierte Sinnbild zustande, das sich durch das Sprechen und das Denken vollzieht. So führt der Erinnerungsvorgang seinen geschichtlichen Prozess im Dialogverlauf durch. In diesem Prozess stellt sich die Wiederbelebung des Gedächtnisverlustes im komplexen Kreuzweg zwischen der Aussage und dem Gedanken dar. Wenn der Dialogteilnehmer diesen Erinnerungsvorgang im Dialog ernst nimmt, ist der prozessuale Vorgang, der von vornherein zum Denkvollzug tendiert, für ihn spürbar und das Sinngebilde des bereits Erkannten kann zum Vorschein kommen. In seinem Dialog hat Platon uns zudem gelehrt, dass der Lernprozess zum Wissen um die Ideen, die für uns in Vergessenheit geraten sind, aber an der Präexistenz unserer Seele teilnehmen, sich auf dem Weg der Wiedererinnerung an die bekannten Erkenntnisinhalte durch den Gesprächspartners im Dialog befindet. Angesichts dessen ist das Lernen im Dialog als das Erkennen des Vergessenen keine einseitige Vermittlung von Erkenntnisfakten, sondern der unumgängliche Verlauf der bewussten Rückführung auf dasjenige, was vorher war, uns aber momentan fehlt, durch das dialogische Verfahren, durch das der Erzieher Beihilfe leistet. 56 Dieser Vorgang der Wiedererinnerung im dialogischen Lernprozess führt uns über das Vergessensein (lethe) hinaus zu den ursprünglichen Präexistenzen, nämlich zu den Ideen hin und motiviert hiermit zugleich unsere Gedankengänge. Daran anschließend bezieht sich die Wiedererinnerung, die mit der theoretischen Anschauung die Erkenntnis von den Ideen zu erwerben trachtet, im Zusammenhang mit Platons Erkenntnistheorie auf die Ideen als einen wesentlichen Erkenntnisurgrund, während das dialogische Verfahren zum Selbstwissen für Platon auf der grundsätzlichen Ebene der Wiedererinnerung ausgeführt wird. Gegen Platons Auffassung, in der die Wiedererinnerung in seiner Erkenntnismetaphysik mit der vollkommenen Rückkehr zur urbildlich unwandelbaren Ideenwelt zu Ende kommt, stellt Gadamer den geschichtlich uns stets überlieferten Sprach– und Kulturhintergrund dar, der hier als die wesentliche Grundlage der Wiedererinnerung verstanden wird. Aus Gadamers Sicht ist die Wiedererinnerung als ein Reflexionsvorgang im dialogischen Verfahren keine vollständige Rückführung auf die ewige Ideenwelt, sondern das Sich-Einlassen auf die Überlieferungsereignisse und die sich–verstehende Bewusstmachung vor dem geschichtlich überlieferten und deshalb gemeinsamen Hintergrund. Es wird deutlich, dass die dialogische 56 Zur pädagogischen Leistung des Dialogs, Hans–Georg Flickinger, „Gesellschaft, Pädagogik, Umwelt“, in: Kritik und Praxis . Zur Problematik menschlicher Emanzipation – Wolfdietrich Schmied–Kowarzik zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Heinz Eidam, Frank Hermenau u. Dirk Stederoth, Kassel 1998, S. 282 – 293. 318 Bewegung der reflexiven Wiedererinnerung an das Vergessene aus hermeneutischer Sicht immer schon auf dem überlieferten Sprach– und Kulturhintergrund basiert und stets auf die überindividuelle Wir–Dimension abzielt. Dementsprechend sagt Gadamer: „Gedächtnis ist der schwarze, ansteigende Strahl, es ist nicht die breite Flut des geistigen Besitzes, die sich angesammelt hat. Und in der Tat ist es nicht angesammeltes Wissen, sondern dieser aus dem Dunkel des Unbewußten kommende Strahl, in dem sich das Ich bildet. Ich, das sich selbst anredet, >>klimmt<< an ihm zutage, das heißt, das Gedächtnis, das innere Wissen von sich selbst, steigt nicht einfach an wie die aus der ersten anderen Lebensquelle breit strömende Flut der Sinne, sondern das Ich arbeitet sich mühsam, Schritt vor Schritt, in die Helle des seiner selbst bewußten Ich empor. Am Ende wird es sich selbst zum Du. Das ist der Anfang des Selbstbewußtseins.“ (GW. 9, S. 418) In diesen Sätzen Gadamers geht es uns vor allem um das „Du“. Dieses Du, zu dem der Reflexionsvorgang schrittweise näher kommt, verweist einerseits, wie wir von den reflexionsphilosophischen Denkzügen gelehrt wurden, auf das vergegenständlichte Ich. Andererseits ist für uns vorstellbar, dass Gadamers Einsicht in das allgemeine Ich, dass wir alle unmittelbar „Ich“ seien, hinter diesem Du verborgen bleibt. Nun müssen wir darauf achten, dass die Bewusstmachung des Ich, die wir als einen unaufhörlichen Denkvollzug verstehen können, das Finden des Ich sowie des Du im kollektiven WirBewusstsein, nämlich die Selbstentdeckung in der dialogischen Wir–Dimension, ist. Auch wenn die Wiedererinnerung im dialogischen Verfahren selbstreflexive Züge hat, führt der dialogische Reflexionsvorgang in Gadamers Dialoghermeneutik keine vollkommene Widerspiegelung des Selbst durch, die in der selbsteinsichtigen Rückkehr zu sich selbst kommt, sondern bewegt sich immer vor dem vorreflexiven Hintergrund, der reflexiv nie restlos erklärbar ist und steht von vornherein einer Gemeinsamkeitsbildung gegenüber, in der wir solidarisch zusammenbleiben. Mit Gadamer betrachtet gab es bereits die präreflexiven „Vorgestalten“ (GW. 6, S. 116 – 128) 57 , die die notwendige Bedingung für die dialogische Reflexionsbewegung bilden. Beim Umschwung auf das Dialogfeld ist die Wiedererinnerung nicht mehr zum subjektiven Reflexionsvollzug gekommen, sondern lässt die übersubjektiven Transzendenzen erscheinen, die den beständigen Anstoß zum schrittweisen Reflexionsübergang in der dialogischen Verbindlichkeit geben und das gemeinsame Miteinandersein ermöglichen. Insofern ist der Reflexionsvorgang in der geschichtlichen 57 Hier wendet Gadamer über die subjektphilosophische Reflexivität im Idealismus hinaus seine Aufmerksamkeit den Seelenteilen im griechischen Denken zu. Aus Gadamers Sicht hat die Seele drei elementare Teile, „die Einheit der Seele“, „die Seele als Selbstbewegung“ und „die Bewegung des Geistes“, die die Vorstruktur des Reflexionsvorganges ausmacht. Die reflexive Selbstbezüglichkeit, die wir das sich zu den Teilen der Seele Verhaltensein nennen können, wird nunmehr das Bewusstmachen unter den sich auseinander entzweiten Teilen der Seele. Das reflexive Bewusstmachen wird mithin in der zirkulären Bewegung zwischen diesen nie ganz einholbaren Seelenteilen deutlich. 319 Dialogsituation mit der sich schrittweise modifizierenden Unterscheidung, die immer schon mit der vorreflexiven Wir–Dimension, 58 die nicht auf die reflexive Selbsteinsicht reduziert werden kann, verbunden. Da der Reflexionsvorgang die Wiedererinnerung an das Vergessensein und an sich selbst im dialogischen Verwandlungsweg zum menschlichen Zusammensein ist, geht er immer schon von der vorreflexiven Grundlage, wie z. B. Gewohnheiten, Bräuchen, Institutionen, Zugehörigkeit zum sprachlichen und kulturellen Kreis usw., aus. Deshalb verdankt er seinen Vollzug als reflexiver Rückzug auf sich selbst dem selbstvergessenen Dialog, weil das Sich-Einlassen auf den Dialog von vornherein das Moment der Erschütterung der bewussten Selbstgewissheit in der Begegnung mit dem Anderen in seiner Andersheit ist, d. h. die ununterbrochene Selbstumsetzung auf die vorreflexive Solidaritätsgrundlage. Die reflexive Selbstbezüglichkeit betont nunmehr keinen Vorrang des reflexiv isolierten Selbstbewusstseins vor der präreflexiven Wir–Dimension, sondern liegt stets zwischen der reflexiven Selbstausbildung und der vorreflexiven Wir– Dimension. Sofern das Denken im dialogischen Reflexionsvorgang, in dem wir uns selbst bewusst und verständlich machen, zu sich selbst kommt, sofern sich das Denken nicht im monologisch verschlossenen Kreis der Reflexionsbewegung des Subjekts dreht, sondern die innere Reziprozität zwischen dem Fragen und dem Suchen der Antwort, zwischen der Bejahung und der Verneinung aufweist, können wir feststellen, dass das Denken selbst dialogisch und der Denkvollzug selbst das Sprechen ist. In diesem Sinn spricht Gadamer in Anknüpfung an Platon davon, dass das Denken „das innere Gespräch der Seele mit sich selbst“ 59 sei. In Gadamers Augen hält das Denken keinesfalls am apriorischen Kategorienverhältnis fest, sondern führt den selbstkritischen Reflexionsvorgang im Dialogverhältnis durch. So bildet sich das Denken selbst auf dem reflexiven Dialogfeld der unendlichen Selbstüberprüfung aus. Insofern müssen wir bedenken, dass das Denken immer schon zur eigenen Denkbildung im wechselseitigen Dialogverhältnis steht. Einen solchen musterhaften Dialogweg zur eigenen Denkbildung finden wir in der sokratischen Gesprächsführung, die die mäeutische Methode 58 Vgl. Hans Bernhard Schmid, „Wir–Identität: reflexiv und vorreflexiv“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Bd. 53, Berlin 2005, S. 365 – 376. Seine These lautet: „Reflexive Identifikation mit dem Kollektiv ist keine hinreichende, notwendige Bedingung für Wir–Identität.“ (S. 367, S. 368) Unter dieser These hat er die Reflexivität der kollektiven Identitätsbewusstseinsbildung behandelt. Die reflexive Identifizierung des Kollektivbewusstseins steht nicht unter einer monologischen, einseitigen Wirkung, sondern immer in der intentionalen Reziprozität, nämlich in der dialogischen Wechselbeziehung, die nie ganz abgeschlossen werden kann. 59 Platon, Der Sophist, in: Platons Werke, Bd. 6, übers. v. F. Schleiermacher, Darmstadt 1970, 263 e. 320 als seine Haltung im Dialog anlegt. 60 Durch die sokratische Gesprächsführung erfahren wir, dass der authentische Gesprächsaustausch das Denken des Gesprächspartners weder instrumentalisiert, noch niederschlägt, sondern freilegt, nämlich zur Sprache bringt. Indem die sokratische Gesprächsführung nicht auf die einseitige Kundgebung abzielt, sondern den internen Übergang über die Verwirrung der unmittelbaren Gewissheiten hinaus zum eigenen Denken durchsetzt, hat Sokrates im Dialog immer noch seinen Platz als therapeutischer Erzieher, der seine Schüler zum Philosophieren bringt, ihnen Denkanstöße gibt. Im Anschluss an die praktische Leistung der sokratischen Gesprächsführung zum Philosophieren kann man sagen, dass die eigene Denkbildung als der selbstkritische Reflexionsvorgang im Dialogverlauf immer auf das Denken des Anderen, nämlich auf die Andersheit des Anderen, angewiesen ist. Denn das Denken soll sich selbst im Dialog aussagen und die Aussage des Denkens soll auch durch die gegenseitige Konfrontation mit der Nachfrage, der Verneinung, nämlich der Reaktion des Gesprächspartners, immer wieder zu Wort kommen. Um das eigene Denken weiter zu bilden und die gebildeten Gedanken mitzuteilen, müssen wir ständig im Dialog bleiben. Im Dialog erfahren wir, dass der Dialog einerseits die Grenze unseres eigenen Denkens markiert und andererseits die Überschreitung jeder Grenze durch den unendlichen Gedankengang zur Wahrheitssuche motiviert. Hinsichtlich der dialog– dialektischen Denkbewegung, ganz hegelianisch, bemerkt Gadamer: „Das Ganze heißt im Gespräch sein.“ (GW. 8, S. 349) Dennoch liegt bei Gadamer auf der Hand, dass das Ganze keine totale Vermitteltheit als das in sich Verschlossene bedeutet. Demgegenüber weist das Ganze in Gadamers Dialoghermeneutik formell auf den umfassenden Sinnraum des Gesprächs und inhaltlich auf den gewobenen Sinnhorizont der ununterbrochenen Weiterbildung des Denkens im Gespräch hin. Der Dialog ist deshalb der ontologische Sinnganzheitshorizont, in dem wir uns stets befinden. Das bedeutet: Der Dialog ist die existentielle Seinsweise des Menschen; die Ganzheit als die ontologische Grundlage für das menschliche Miteinandersein ist an die beständige Offenheit für die Andersheit gekoppelt. Denn das Gespräch stiftet nicht nur das komplexe Sinnnetzwerk der Selbstaussage alles möglich Denkbaren, sondern lässt uns auch unserer existenzielle Endlichkeit bewusst werden. Das Gespräch ist nicht abgeschlossen, sondern lebendig. An dieser Stelle fällt auf, dass das einzige Ergebnis des sokratischen Gesprächs immer das Wissen um Nichtwissen war. Wenn sich das sokratische Gespräch die eigene Denkbildung zum Ziel gesetzt hat, wenn das eigene Denken damit auf das Wissen um sich selbst verweist, 60 Vgl. Leonard Nelson, „Die sokratische Methode“, S. 21–72 u. Dieter Birnbacher, „Philosophie als sokratische Praxis – Sokrates, Nelson, Wittgenstein“, in: Das sokratische Gespräch, hrsg. Dieter Birnbacher und Dieter Krohn, Stuttgart 2002, S. 140 – 165. 321 besteht die dialogische Selbsterkenntnis nicht mehr in der Vollendung eines transzendentalen Ichs, das alles in die regulativen Kategorien einordnet, sondern ist zuallererst das Wissen um die eigene Grenze. Denn das dialogische Selbstwissen ist kein unteilbares Bewusstsein um sich selbst, sondern impliziert das ständige Bewusstmachen davon, dass es von vornherein auf seine Andersheit angewiesen ist. Dementsprechend nimmt das dialogische Selbstwissen, das gemeinsam gesucht wird, auch die offene Haltung für die Unaufhebbarkeit der Andersheit des Anderen in Anspruch. Von dieser Überlegung zum Ergebnis des sokratischen Gesprächs ausgehend, bemerkt Gadamer schon in seiner Frühschrift: „Am Ende des Gesprächs steht somit die ironische Ratlosigkeit. Sie ist scheinbar das einzige Resultat des Verständigungsversuchs und in der Tat die erste Homologie. Diese Homologie des Nichtwissens ist aber die erste Voraussetzung für die Gewinnung eines echten Wissens. […] die Gemeinsamkeit des Nichtwissens und die Gemeinsamkeit des Wissenmüssens, d. h. die Einsicht in die Notwendigkeit, einen echten, begründbaren Anspruch auf Wissen erheben zu können.“ (GW. 5, S. 44) Für uns geht es hier zunächst um den echten Dialog. Denn das Nichtwissen im echten Dialog verweist uns nicht auf die irrtümliche Verführung, sondern etabliert die Grundlage für unsere Gemeinsamkeitsbildung, in deren Verlauf die unersetzbare Andersheit nicht aufgehoben, sondern stets bewahrt wird. Darüber hinaus verursacht das gemeinsame Wissen um das Nichtwissen im echten Dialog nicht die ohnmächtige Resignation, sondern garantiert das ununterbrochene Weitersuchen nach der verstehbaren Wahrheit, weil sich dieses Nichtwissen nicht nur auf das hermeneutische Bewusstsein um die Endlichkeit bezieht, sondern auch darauf verweist, dass das selbstbezügliche Wissen die Abhängigkeit vom Anderen zu seiner Grundstruktur hat. Aus diesem Grund ist die anerkannte Bewahrung der Andersheit und die angeeignete Selbstverständigung in Gadamers Dialoghermeneutik nicht widersprüchlich, sondern bildet einen unentbehrlichen Bestandteil der zirkulären Weiterbildung des Denkens. Hierbei handelt es sich deshalb nicht um die endgültige Auflösung der Selbstwidersprüchlichkeit zwischen der Aneignung und der Anerkennung, sondern um die Angemessenheit im dialogischen Umgang mit der unangeeigneten Andersheit. Denn die dialogische Selbsterkenntnis als das Bewusstsein um die eigene Endlichkeit tendiert von vornherein zur Gemeinsamkeit im unendlichen Verständigungsversuch. Dass Gadamer insbesondere die sokratische Weisheit in Platons Dialog in den Vordergrund rückt, zeigt seine Einsicht in die hermeneutische Distanz. Aus hermeneutischer Sicht schafft die Distanz im Dialog den möglichen Verständigungsraum, ja die potenzielle Rahmenbedingung für die dialogische Verständigung über den Anderen und über sich selbst. So ermöglicht sie die Annahme des unaufhebbaren Anderen in der Bewahrung seiner 322 Andersheit. Da die dialogische Verständigung auf keinen Fall auf die vollständige Übereinstimmung mit der unersetzbaren Individualität abzielt, sondern den ununterbrochenen Übergangsweg von der Verständigung über den Anderen zur reflexiven Selbsterkenntnis darstellt, befindet sich der echte Dialog als unser unendlicher Verständigungsversuch immer in angemessener Distanz. In Gadamers Augen ist eine vollständige Übereinstimmung mit dem Gesprächspartner aufgrund der Unaufhebbarkeit seiner Individualität von vornherein widersprüchlich. Wenn es für Gadamer die Möglichkeit eines solchen Einverständnisses gäbe, dann wäre das dialogische Einverständnis nicht von einem subjektiven Dialogteilnehmer, sondern nur von der Dialogsache, über die jeder Teilnehmer seine individuelle Meinung zum Ausdruck bringt, abhängig. Aus diesem Grund kann man sagen, dass der Dialog im Grunde ein ausgezeichneter Ort ist, in dem die verschiedenen Meinungen aufeinander übertragen werden können. Nun zwingt uns der Verständigungsversuch im Dialog, zum Hören der verschiedenen Meinungen des Dialogpartners. Außerdem führt uns der Dialogvorgang zu dem Wissen, dass der potenzielle Sinnraum der dialogischen Verständigung ständig in der Distanz zum Anderen liegt. Die Andersheit im Dialog ist weder ein Hindernis auf dem Weg zur dialogischen Verständigung, noch etwas, das es zu überwinden gilt, um die Erfüllung des Dialogziels zu vollenden, sondern vielmehr ein unentbehrliches Element, das im Dialogvorgang immer bestehen bleibt. Denn die Anerkennung der Andersheit ist nicht nur die Voraussetzung für den Dialog, sondern zeigt auch das ursprüngliche Dialogphänomen des unendlichen Verständigungsversuchs, in dessen Verlauf die reflexive Selbsterkenntnis sich permanent mitbewegt. Auf dieser notwendigen Distanz zwischen dem reflexiven Selbstbezug und der bewussten Anerkennung der Andersheit basiert die dialogische Bewegung. Daran anschließend wird gezeigt, dass der Andere in seiner Andersheit auch die mitkonstruktive Rolle zum reflexiven Rückzug auf sich selbst im Dialog spielt. Gadamers Formulierung, dass die dialogische Verständigung immer im Kontext der Angewiesenheit auf die Verständigung über den Anderen steht, d. h. über das Verstehen des Anderen hinaus zur Selbstverständigung gelangt, betont auch das wesentliche Recht auf Widerrede des Anderen im dialogischen Verlauf der reflexiven Selbsterkenntnis. Aus hermeneutischer Sicht zeigt sich, dass der dialogische Reflexionsvorgang auf die Begegnung mit dem Anderen bezogen, nämlich mit der Verneinung des Anderen verbunden ist, weil der Einspruch des Anderen gegen die eigene Perspektive im Dialog die reflexive Innwendung motiviert, weil die Widerstandsleistung des Anderen im Dialog den eigenen Standpunkt in Erinnerung ruft. Die Widerrede im Gespräch lässt einen deshalb nicht nur die unaufhebbare Individualität des Anderen erfahren, sondern lässt ihn vielmehr zu seinem internen 323 Reflexionsvorgang kommen. 61 Insofern verfügt die hermeneutische Selbsterkenntnis, die sich immer im Gespräch, sozusagen in der Konfrontation mit dem anderen Standpunkt vollzieht, über eine reflexive Rückzugsstruktur, auch wenn sie, wie bereits erwähnt, über keine selbsteinsichtige Vollkommenheit der reflexiven Rückführung auf die subjektive Entität verfügt. Die hermeneutische Selbsterkenntnis kommt dadurch zustande, dass der Andere als Gesprächspartner seine unersetzbare Andersheit freilegt, nämlich seine verschiedenen Meinungen zum Ausdruck bringt. Dementsprechend stellen wir fest, dass die reflexive Selbsterkenntnis, Gadamers Dialoghermeneutik zufolge, einen Anstoß impliziert, der von der Andersheit des Anderen kommt. Sofern die hermeneutische Selbsterkenntnis ihren Reflexionsvorgang im Dialog ausführt, anders formuliert, das „denkende Ich“ immer schon im dialogischen Wechselverhältnis mit dem Anderen steht, hält der Reflexionsvorgang uns den vom Anderen motivierten Anspruch auf das Selbstwissen, den wir permanent suchen, vor Augen. Da die selbstkritisch erweckte Selbsterkenntnis im Dialog immer von der Andersheit des Anderen abgeleitet ist und zudem nicht zum in sich verschlossenen Selbst kommt, sondern sich in der ständigen Weiterbildung befindet, benötigt sie, um sich selbst weiter auszubilden, die unaufhebbare Andersheit des Anderen. Nun kann man sagen, dass die wiedererweckte Selbsterkenntnis für Gadamer bereits in der Sphäre des Wir bzw. im dialogischen Zusammenleben liegt, weil die Reflexion im Gespräch, hermeneutisch gesehen, als ein „selbstvergessenes“ Mitwissen, das nicht von der einseitigen Subjektleistung, nämlich von der unmittelbaren Selbstbeziehung, sondern vor allem vom ununterbrochenen Verhältnis zum Anderen, z. B. der familiären Intimbeziehung, dem Freundeskreis oder der gesellschaftlichen Verbundenheit usw. ausgeht, bezeichnet werden kann. Kurzum skizziert der hermeneutische Reflexionsvorgang im Dialog keinesfalls den isolierten Kreislauf des verschlossenen Selbst, sondern die Gemeinsamkeitsbildung, in deren Verlauf wir uns selbst verständigen. So ist die selbstkritisch wiedererweckte Selbsterkenntnis 61 in Gadamers Dialoghermeneutik das gemeinsam erworbene Vgl. Rüdiger Bubner, Dialektik als Topik, Frankfurt a. M. 1990, S. 10 ff. Mit der These, „daß der Vollzug einer Reflexion im gekennzeichneten Sinn und die Bereitschaft zum Eintritt in einen Dialog strukturell ein und dasselbe sind“ betont er, wenn ich hier verkürzt darstelle, dass der Dialog selbst ein Reflexionsakt sei. (S. 15) Denn für ihn bedeutet die Reflexion im Prinzip keinen unmittelbaren Bezug zum Sachgehalt. Der Reflexionsakt wie der reale Dialogverlauf beziehen sich deshalb auf die Einstellung aller Beteiligten, die sich dem realen Sachbezug auf verschiedene Weise anzunähern versuchen. Aus diesem Grund ist die Widerrede des Gesprächspartners, nämlich der andere Gesichtspunkt mitkonstitutiv, weil die Konfrontation mit dem Anderen, sowohl das Moment der Reflexion als der Motor des Gesprächsvorgangs, keine Behinderung der weiteren Denkbildung ist, sondern immer schon die Möglichkeit eröffnet, die geprägten Positionen in die anderen wieder mit einzubeziehen. In diesem Sinne fügt er weiter hinzu: „Hinter dem Erheben der Gegenrede des Dialogpartners ebenso wie hinter dem Eingehen auf alternative Gesichtpunkte im eigenen Nachdenken steht die grundsätzliche Möglichkeit, dass solche Alternativen überhaupt existieren. […] Konkurrierende Positionen reduzierten sich auf verbale Variationen des einen, einzig gültigen Zugangs zur Sache.“ (S. 19) 324 Zusammendenken mit dem Anderen. Dementsprechend kommt Gadamers Anliegen zur hermeneutischen Selbsterkenntnis im Dialogfeld, das sich im Grunde gegen das subjektsphilosophische Ideal über die Substanzialität der subjektiven Reflexionsbewegung wendet, insbesondere mit den folgenden Sätzen zum Ausdruck: „Verstehen und Missverstehen spielt zwischen Ich und Du. Schon die Formulierung >Ich und Du< bezeugt aber eine ungeheure Verfremdung. So etwas gibt es ja gar nicht. Es gibt weder >das< Ich noch >das< Du, es gibt ein Du–Sagen eines Ich und es gibt ein Ich–Sagen gegenüber einem Du; aber das sind Situationen, denen immer schon Verständigung vorhergeht. Zu jemandem Du–Sagen – wir wissen es alle – setzt ein tiefes Einverständnis voraus. Da trägt schon etwas, was dauerhaft ist.“ (GW. 2, S. 223, meine Hervorhebung) Wenn unsere Selbsterkenntnis ihren Reflexionsvorgang, nach Gadamers Konzeption, tatsächlich im Dialog vollzieht und sich deshalb immer schon im unentrinnbaren Zusammensein mit dem Anderen befindet, dann ist das Ich nur ein sich mitbewegender Bezugspunkt der selbstkritischen Reflexionsbewegungen ohne die substanziellen Züge, die im Prinzip von der irrtümlichen Vorstellung des grammatischen Personalpronomens „ich“ abgeleitet zu sein scheinen. Im Anschluss an diesen Einwand Gadamers gegen die moderne Subjektivität können wir auch der dialogphilosophischen Idee von Martin Buber unsere Aufmerksamkeit zuwenden; wenn ich hier zitiere: „Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich–Du und das Ich des Grundworts Ich–Es. Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins von beiden. […] Ich sein und Ich sprechen sind eins.“ 62 In diesem Zusammenhang müssen wir darauf achten, dass das Ich im wesentlichen kein Subjekt des Dialogs ist. Wenn „ich“ im Dialog den reflexiven Rückzug auf sich selbst bildet, so besagt dies vom dialogphilosophischen Standpunkt aus nur die Wiedererinnerung an den präreflexiven Bekannten, die im Grunde den entscheidenden Fundus der zwischenmenschlichen Lebensbezüge gestaltet. Im Dialog ist „ich“ ohne seine substanziellen Züge deshalb nur der Sagende und zugleich der Hörende, der sich selbst erst in seiner prozessualen Selbstausbildung herausschält. Sofern der Reflexionsvorgang im Grunde dialogisch ist, sofern die Selbsterkenntnis von vornherein auf die Unaufhebbarkeit der Andersheit bezogen ist, muss hier gezeigt werden, dass der Dialog selbst praktisch ist. Denn die dialogische Selbsterkenntnis geht von der Annahme der Andersheit, ja vom Sich-Einlassen auf das Gespräch aus und die Begegnung mit dem Anderen stiftet damit zugleich den dialogischen Handlungsraum, in dem wir den 62 Martin Buber, Ich und Du, Stuttgart 1995, S. 4. Vorher sagt er auch folgendes: „Wenn Du gesprochen wird, ist das Ich des Wortpaars Ich–Du mitgesprochen. Wenn Es gesprochen wird, ist das Ich des Wortpaars Ich–Es mitgesprochen. Das Grundwort Ich–Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Das Grundwort Ich–Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.“ (S. 3) Daran anschließend würde es vermutlich lauten, dass „Ich“ im Dialog vor seiner Isoliertheit immer schon gemeinsam ist. 325 Anderen zu erreichen und zu vernehmen versuchen. In dieser dialogischen Begegnung mit dem Anderen, die von vornherein die Bereitschaft zum Verstehen des Anderen umfaßt, besteht auch die unbedingte Anerkennung der Andersheit, die die grundsätzliche Voraussetzung für den ununterbrochenen Dialogverlauf prägt. Der Dialog skizziert daher die zwischenmenschliche Anerkennungsbewegung und in diesem oszillierenden Zwischen entfaltet er sich selbst gleichzeitig endlos. Da „Im Gespräch sein“ nunmehr die zwischenmenschlichen Lebensbezüge meint, bezeichnet das Urphänomen des Dialogs sich im wesentlichen Sinne als das Ethische. Insofern impliziert der Dialog von Anfang an ethische Implikationen, die den praktischen Anspruch auf die Einhaltung aller Betroffenen erheben. Darüber hinaus legte Gadamer, wie bereits gezeigt, sein Augenmerk bereits während seiner frühen Schaffenszeit auf die ethische Grundlage im Dialog, mit der wir uns als nächstes beschäftigen werden, da es hier insbesondere um Aristoteles’ Phronesis mit Rückgriff auf Platons Dialog gehen wird. In Gadamers Augen kommt Aristoteles’ Phronesis grundsätzlich in Platons Dialog zustande, sofern sowohl die Phronesis als auch der Logos nicht vorgegeben sind, sondern gemeinsam gesucht werden sollen. Somit wird die sokratische Urfrage in Platons Dialog, nämlich was gut sei für das menschliche Leben, ständig wiederholt, ja lebendig hinterfragt. Die Frage nach dem Guten, die uns seit Sokrates permanent gestellt wird, kann so beschrieben werden, dass sie sich mit der menschlichen Denkgeschichte ununterbrochen mitbewegt und dass die jeweils gesuchte Antwort auf die Frage keine unhinterfragbare Endgültigkeit darstellt, sondern sie den offen gebliebenen Erwartungshorizont, nämlich die stets sich wiederholende Nachfrage unter den bestimmten Situationen begleitet. Der Grund für diese Unabschließbarkeit folgt von vornherein aus der menschlichen Existenzlage, die bereits in der unauflösbaren Spannung zwischen dem ständigen Bedürfnis nach dem Guten, nämlich dem guten Leben, und der existenziellen Zeitknappheit des eigenen Lebens steht. Innerhalb dieses Spannungsverhältnisses erwartet die menschliche Handlung in der Tat von ihrem Willen aus das Gute und kommt ihrem Verwirklichungshorizont in jedem Augenblick diesem Ziel näher. Insofern ist für sie die Prozessualität, die vom vorgegebenen Zeitverlauf abhängt, charakteristisch. Aus diesem Grund zwingt das Bewusstsein um die existenzielle Endlichkeit, was Gadamers Dialoghermeneutik emphatisch betont, uns zur ständig wiederholenden Fragestellung nach dem Guten, auf die wir die Antwort zusammen suchen müssen. 326 II. Die dialogische Ethik im Gesprächsverhältnis II – 1. Aristoteles’ phronesis in Bezug auf den Platonischen Dialog Aufgrund der bisherigen Überlegungen zu Gadamers Gedankengang von der hermeneutischen Sprachlichkeit zum ursprünglichen Urphänomen des Dialogs, können wir uns davon überzeugen, dass das dialogische Verstehen praktisch und ethisch ist. Aus hermeneutischer Sicht ist das menschliche Verstehen deshalb praktisch, weil dies immer in der Begegnung mit der Andersheit des Anderen stattfindet und dieses Bezogensein auf die Andersheit den Betroffenen zum umsichtigen Umgang mit dem Anderen zwingt. Sofern das Verstehen in seine Andersheit, die uns im geschichtlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen begegnet, mit einbezogen ist, kann das Verstehen nur durch praktische Umsicht und Überlegung gelingen, in deren Spielraum der thematisierte Sachverhalt gemeinsam behandelt wird. Hieraus eröffnet sich die hermeneutische Situation, die unentbehrlich des gemeinsamen Gesprächs bedarf. Im Anschluss an seine Einsicht, dass die menschliche Erfahrung überhaupt im umsichtigen Umgang mit dem Anderen, mit dem geschichtlich Überlieferten und mit der Welt gemacht wird, rückt Gadamers Dialoghermeneutik die kreative und konstruktive Macht der Sprache ins Zentrum, wenn davon die Rede ist, dass die Welt sprachlich verfasst und dass das Gespräch die Vollzugsform der Sprache sei. Denn der Wortsinn, den die Welt uns gegeben hat, ist von vornherein nicht nur auf seine Sache, sondern auch auf den Anderen gerichtet, um ihn zu erreichen. Mit anderen Worten: Die Sprache in der Gesprächsbeziehung teilt dem Anderen ihren immer schon gemeinsamen Sachverhalt mit. Auf jeden Fall bewegt das Miteinandersprechen sich deshalb nicht im einseitigen Verhältnis zwischen Sender und Adressaten, wie z. B. eine Übermittlung von Informationen, sondern ein echtes Gespräch verlangt die mitwirkende Teilnahme und die gemeinsame Suche des Anderen in seiner unaufhebbaren Andersheit. So schließt das souveräne Eintreten ins Gespräch bereits die bewusste Akzeptanz gewisser Spielregeln und die Annahme des Anderen in seiner Andersheit als Gesprächspartner ein. Da der ständige Versuch, den Anderen ernst zu nehmen und seine unaufhebbare Andersheit zu vernehmen, dem Gespräch als Sprechen zu und mit dem Anderen zugrunde liegt, stellt sich das Gespräch als eine ethische Verhaltensweise zwischen den Dialogteilnehmern dar. Wenn die Ethik zudem nicht das wissenschaftliche Wissen, das die Neugier befriedigt, sondern die Lebensorientierung, d. h. die zwischenmenschliche Haltung in der alltäglichen Lebenswelt zum Thema macht, gründet das dialogische Verstehen in Gadamers Hermeneutik auf einem ethischen Fundament. Denn die erste Bedingung für das 327 Gelingen des Gesprächs ist die Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit. Das Gespräch in seinem Verlauf macht also die ihm eigenen ethischen Konnotationen, die sich aus dem dialogischen Wechselverhältnis ergeben, spürbar. Damit liegt auf der Hand, dass die Bereitschaft zum Zuhören eine der Grundvoraussetzungen für den Gesprächsverlauf ist. Das Zuhören in unserem Zusammenhang ist gleichbedeutend mit dem unabschließbaren Offensein für die Andersheit des Anderen. Es erweist sich, dass das Zuhören im Gespräch immer schon das Hören auf den Anderen ist und ein sich offen haltendes Bezogensein auf die Andersheit einschließt. Das Hören auf den Anderen meint deshalb, der Andersheit des Anderen zuzuhören, also die Bemühung, diese Andersheit ernst zu nehmen. Insofern ist das Zuhören immer schon auf die Andersheit des Anderen, die im Sprechen mitklingt, ausgerichtet. Eine solche hermeneutische Zugehörigkeit weist, Gadamers Ansicht zufolge, aber nicht darauf hin, dass ich mich im Gespräch dem Gesichtspunkt des Anderen bedingungslos unterwerfe, sondern darauf, dass ich mich aus meiner eigenen Perspektive auf die Sache, um die es geht, in den Standpunkt des Anderen als meinen Gesprächspartner hineinversetze. Wenn Gadamer in seiner Hermeneutik betont, dass das dialogische Verstehen im wesentlichen Sinn auf die Andersheit des Anderen angewiesen ist, dass das Ungesagte, das wir im Grunde sagen wollten, in der sinnerschließenden Leistung des Zuhörens vernehmbar ist, liegt sein Grundanliegen darin, zu zeigen, dass das solidarische Aufeinanderbezogensein als grundsätzliche Seinsmöglichkeit des Menschseins in dem Versuch, auf den Anderen zu hören, immer schon wirksam ist. Ein Gespräch enthält daher die ethische Orientierung, die die zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmt, bereits in sich. Indem das Gespräch den gemeinsamen Sinnhorizont impliziert, in den der Mensch mit dem Anderen permanent eingebunden ist, wird seine ethische Grundlage nicht, wie Habermas meint, durch einen moralischen „Universalgrundsatz“ begründet und erklärt, sondern in ihm selbst ausgebildet. 63 Dementsprechend schreibt M. Riedel: „Was hinter dem einzigartigen 63 An dieser Stelle müssen wir uns zunächst Aristoteles’ metaphorische Aussage „Ein Stein im Brett“ in Erinnerung rufen. Diese Aussage schließt in seinem Denkzusammenhang auch an den Satz an, dass der Mensch von Natur aus ein zoon politikon sei, d. h. dass der Mensch von vornherein in seine Gesellschaft eingeboren ist. Dementsprechend können wir bemerken, dass der Mensch bereits seine institutionalisierten Sitten vor der deduktiven Ableitung des obersten Prinzips kennt. Aristoteles betont deshalb emphatisch, dass der Mensch, der ohne die gesellschaftlichen Ordnungen, ja die gemeinschaftlichen Gestalten ist, „entweder weniger als Mensch und so das Tier oder mehr als der Mensch und so der Gott“ ist. Vor diesem Hintergrund betrachtet ist der isolierte Mensch kein Mensch mehr. Aristoteles, Politik, in: Aristoteles Philosophische Schriften, Bd. 4, übers. v. Eugen Rolfes, Darmstadt 1995, 1253 a 1 – 8. Dazu auch, Joachim Ritter, Metaphysik und Politik, Frankfurt a. M. 2003, S. 91. So verstanden liegt die Möglichkeit des Ethischen nicht in der idealen Konstruktion des Handlungsprinzips, sondern immer schon im menschlichen Leben, weil der Mensch in das bestehende Ethos, das die ethische Handlung anleitet, einbezogen ist. Darüber hinaus distanziert sich Habermas selber kritisch von seinem frühen Anspruch auf die Letztbegründung der Legitimität der Rechte, die an Apels Strategie angeknüpft waren. Trotz dieser selbstkritischen Überlegung ist immer noch fraglich, wie die noch rationalere Begründung ohne die Letztbegründungsnot überhaupt möglich ist und ob sein 328 Selbstbezug der Phronesis aufscheint, ist die akroamatische Dimension des Logos, des Hörenkönnens auf das rechte Wort als ein Vermögen der ethischen Tugend, worauf die Phronesis angewiesen bleibt.“ 64 Darüber hinaus führt das dialogische Verstehen, das sich aus der unabschließbaren Bewegung zwischen dem wechselseitigen Sprechen und Hören bildet, aus hermeneutischer Sicht zu einem inneren Reflexionsvorgang, der von der unaufhebbaren Andersheit des je Anderen motiviert ist. Dieser hermeneutische Rückzug auf sich selbst im Gesprächverhältnis ist jedoch weder eine bloß sich wiederholende Rückkehr zum Vergangenen oder zum Vorhandenen, noch die Rückführung auf ein isoliertes Ich, das in der neuzeitlichen Subjektphilosophie das Chaos vollkommen scheint ordnen zu können, sondern im Grunde die Erfahrung, in der ich meiner selbst bewusst werde und zugleich die offene Fortsetzung, die von der Erfahrung der Andersheit endlos in Gang gesetzt wird. So findet sich das Menschsein in der sich veränderten Gesprächssituation selbst und sein ethisches Handeln immer wieder neu. Nun dürfen wir nicht vergessen, dass Gadamer sich in seinem gesamten Gedankengang und seiner Theorieentwicklung mit der Ethikfrage beschäftigt hat. 65 Aus Gadamers Sicht muss klar gemacht werden, dass die Hermeneutik keine theoretische Wissenschaft ist, die die methodische Erläuterung der technischen Auslegungskünste zu ihrem Schwerpunkt hat. Sie bestimmt sich selbst vielmehr über eine „Kunstlehre“ der Textauslegung als praktische Philosophie. Aufgrund dieser Einsicht wählte Gadamer als Titel seines Aufsatzes ohne eine weitere Bestimmung „Hermeneutik als praktische Philosophie“. Hier schreibt er: „Hermeneutik ist Philosophie, und als Philosophie praktische Philosophie.“ 66 Gadamer versucht deshalb, die Wurzeln seines Denkansatzes in der dialogischen Ethik konsequent weiter herauszuarbeiten und das hermeneutische Verstehen als die ontologische Grundstruktur der menschlichen Erfahrung mit den ethisch–moralischen Ansprüchen der praktischen Lebenswelt, vor allem im Rahmen der Analyse der Phronesis in Aristoteles’ Praktischer Philosophie, zu verbinden. Diesbezüglich wurde bereits oben gezeigt, dass das menschliche Verstehen aus hermeneutischer Sicht immer schon dialogisch und ethisch ist, weil es im Verstehen des Anderen in seiner Andersheit gründet, in diesem Sinn die Universalgrundsatz für die legitime Kommunikationshandlung hier nicht ein unhintergehbares Letztes als das oberste Prinzip ist. J. Habermas, Erläuterung zur Diskursethik, S. 116 – 118 u. S. 130 ff. 64 M. Riedel, Hören auf die Sprache, S. 162. 65 Hier können wir feststellen, dass die vorwurfsreiche Unterschätzung, dass Gadamer nach der Debatte mit Apel und Habermas über die ideologiekritischen Reflexionspotenzen die ethische Grundlage in seiner Perspektive vom dialogischen Verstehen wieder findet, nicht Gadamers Dialoghermeneutik trifft. Diese Behauptung kommt m. E. deshalb zustande, weil sie Gadamers gesamten Gedankengang außer Acht lässt. Diesbezüglich beispielsweise, vgl. Richard J. Bernstein, Beyond objectivism and relativism – science, hermeneutics and praxis, Uni. of Pennsylvania Press: Philadelphia 1983, etwa S. 182 ff. 66 H. – G. Gadamer, „Hermeneutik als praktische Philosophie“, S. 143. 329 Anerkennung des Anderen als Gesprächspartner voraussetzt und im Gespräch mit dem Anderen nicht nur den Gesprächspartner, sondern gerade auch sich selbst versteht. Hinter diesem Anliegen Gadamers, die Hermeneutik in Aristoteles’ Phronesis einzubetten, verbirgt sich auch die kritische Erkenntnis der Grenze des modernen Wissenschaftsbegriffs, der zufolge die kalkulierte Überlegtheit als ein Musterbild des wissenschaftlichen Wissens, die rigorose Markierung des Begriffsumfangs, die im lebendigen Sprachgebrauch stattfindet, weder die zwischenmenschliche Bezugnahme in der praktischen Lebenswelt, noch die unvorhersehbaren Folgen der menschlichen Praxis in den variablen, flexiblen Lebenszusammenhängen berücksichtigt. Diese hermeneutische Wendung zur praktischen Philosophie lässt sich besonders anhand von Gadamers beiden Arbeiten aus den frühen dreißiger Jahren belegen, die unter Heideggers Einfluss stehen 67 – nicht nur Ontologie: Faktizität der Hermeneutik, sondern auch Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles. Sie verweisen auf die Ethikfrage in Platons sokratischen Dialogen und deren Verbindung mit Aristoteles’ Phronesis. In seiner Habilitationsschrift „Platos dialektische Ethik“ (GW. 5, 1931) stellt sich Gadamer die Aufgabe, Platons Dialogphilosophie mit der Dialektik weiterzudenken und, wie er sagt, „die Einheit von Dialog und Dialektik“ ins Auge zu fassen. (GW. 5, S. 14) Die Antwort auf die Frage, worauf sich Gadamers damaliges Anliegen, die Einheit des Dialogs mit der Dialektik zu denken, beziehe, wird gegeben, wenn wir unsere Aufmerksamkeit Gadamers Fragestellung im Vorwort zu seiner Habilitationsschrift zuwenden. Hier fragt Gadamer sich selbst, „in welchem Sinne platonische Dialektik das Problem der Ethik stellt und überhaupt stellen kann. […] ob und wie platonische Dialektik >Ethik< ist, wird gefragt.“ Auf diese Frage antwortet Gadamer mit der These, dass „die Theorie der Dialektik bei Plato die Theorie der sachlichen Möglichkeit des Dialogs“ ist. (GW. 5, S. 158) Gadamers Bezugnahme auf die Aristotelische Phronesis liegt, wie die These bereits enthält, die Einsicht zugrunde, dass sich die Phronesis durch die sokratische Ethikfrage, nämlich durch das Fragen nach dem Guten in Platons Dialog, konkretisieren und verwirklichen könne und ihre Vollzugsform in diesem dialogischen Vorgang bestehen könne, den die Frage nach dem Guten anleitet. Hierbei zeigt 67 In seiner phänomenologischen Interpretation, die von Anfang an für die Berufung nach Marburg ungefähr im Jahr 1922 verfasst wurde, hat Heidegger Phronesis als eine umsichtige Einsicht, mit der sich das menschliche Dasein immer um das Gute sorgt, verstanden. Für ihn ist die menschliche Handlungsweise deshalb die Sorgestruktur, nämlich die jeweilig bestimmte Sorge für das Gute. Aufgrund dieser Sorgestruktur gewinnt das menschliche Dasein in seiner faktischen Lebenswelt die bestimmte Neigung zur Welt, sobald es der Welt begegnet. Mit dieser Einsicht in die lebendige Handlungsstruktur der Lebendigen schreibt er weiter folgendes: „Die aletheia praktike ist nichts anderes als der jeweils unverhüllte volle Augenblick des faktischen Leben im Wie der entscheidenden Umgangsbereitschaft mit ihm selbst, und das innerhalb eines faktischen Besorgensbezugs zur gerade begegnenden Welt.“ M. Heidegger, Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles, S. 55. 330 sich vor allen Dingen, dass Gadamer mit dieser gedanklichen Verbindung zwischen dem Dialog und der Dialektik die ontologische Debatte zwischen Platon und Aristoteles über „das Verhältnis des Seins zum Guten“, die durch Aristoteles Kritik an Platons Ideenlehre ausgelöst wurde, überwinden wollte. 68 Hinter dieser Aristotelischen Platonkritik steht deshalb das ontologische Problem, dass das Sein des Seienden als das Eine, das Erste, von dem aus alles Seiende abgeleitet werden kann, in seiner Vielfältigkeit nur gezeigt werden kann, wenn dieses von allem Seienden abgelöste Sein benannt werden kann. Kurzum geht es vor allem um das Verhältnis des Einen zu dem Vielen, in dessen Licht wir den philosophiegeschichtlich andauernden Streit aufspüren können. Um Gadamers obige Problemlage zu präzisieren, möchte ich hier kurz und skizzenhaft in Aristoteles’ Platonkritik einführen. Hierbei will ich nicht die zahlreichen Aspekte Aristoteles’, die in seinen Texten verstreut sind, behandeln, sondern mich insbesondere auf Aristoteles’ Argumentation im I. Buch von Die Nikomachische Ethik beschränken, in dem seine Kritik an Platons Idee des Guten abgehandelt wird. 69 Dort stellt Aristoteles m. E. die Hauptlinie seiner Argumentation mit folgendem Satz dar: „Auch wenn ein Gutes existiert, das eines ist und allgemein ausgesagt wird, oder das abgetrennt und an und für sich besteht, so ist es doch klar, daß dieses Gute für den Menschen weder zu verwirklichen noch zu erwerben ist.“ 70 In Aristoteles Augen scheint Platons Idee des Guten, die im Prinzip von allen verschiedenen Erscheinungsformen des Guten abgelöst ist und unter die die Verschiedenheit aller verschiedenen Erscheinungsformen des Guten subsumiert wird, den Realitätsbezug, nämlich die realen Lebensbezüge, verloren zu haben. Denn das Gute stellt sich, so Aristoteles, in jeder zwischenmenschlichen Handlungssituation verschieden und in jedem Fall anders dar. Da Aristoteles hiermit sein Augenmerk zunächst auf den praktischen Bereich im lebensweltlichen Handlungsraum, nämlich vor allem auf die Frage nach dem menschlichen Handlungssinn wirft, bedeutet für ihn Platons Idee des Guten als Seinsprinzip, dass damit alle anderen Erscheinungsformen des Guten überflüssig sind. Denn Platons Konzeption der Unterordnung aller Variationen des Guten unter eine einzige Idee des höchsten menschlichen Guten besteht von vornherein aus der unerträglichen Abtrennung des Guten an sich von den konkreten einzelnen Variationen des Guten, die den Handlungsvollzug mit einschließen, der von den verschiedenen Erscheinungsformen des Guten angestrebt wird. In diesem 68 Vgl. M. Riedel, Hören auf die Sprache, S. 96 ff., hier S. 107. Auch ders., „Zwischen Plato und Aristoteles – Heideggers doppelte Exposition der Seinsfrage und der Ansatz von Gadamers hermeneutischer Gesprächsdialektik“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, Jg. 11, hrsg. v. J. Simon, Stuttgart 1986, S. 1 ff. 69 Vgl. Helmut Flashar, „Die Platonkritik (I. 4)“, in: Aristoteles Die Nikomachische Ethik, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, S. 63 ff. 70 Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, I. Buch, 1096 b 32 – 35. 331 Zusammenhang schreibt Aristoteles einige Sätze zuvor noch schärfer: „Ein Gutes also, das gemeinsam wäre und als eine einzige Idee aufgefaßt werden könnte, existiert nicht.“ 71 Darüber hinaus bezieht sich Aristoteles’ argumentativer Einwand gegen Platons Idee des Guten auch auf dessen Lehre von den Kategorien. Hier handelt es sich um das Verhältnis der ersten Kategorie zu den anderen Kategorien, nämlich um den ontologischen Zusammenhang des absoluten Guten, das um seiner selbst willen angestrebt wird, mit den relativen Varianten des Guten, die nur als ein einzelnes Mittel zur Zweckerfüllung ihren Platz fänden. Denn wenn das höchste menschliche Gute überhaupt wirklich und real wäre, sollten alle anderen auf dieses Gute bezogen sein. Ohne den Wirklichkeitsbezug gäbe es, wie Aristoteles gesagt hat, ein solches höchstes Gutes nicht mehr. Mit Aristoteles lässt sich also sagen, dass das Gute in Platons Ideenlehre nur ein formaler Allgemeinbegriff sein kann, der grundsätzlich der theoretischen Wissenschaft angenähert werden kann und bei ihm nur in der Ersten Philosophie behandelt und bewiesen wird, wenn dieses Gute als eine ethische Kategorie den nötigen Bezugspunkt zu den realen Handlungsräumen nicht impliziert und lediglich das Gute als eine von vielen verschiedenen Kategorien darstellt. Im letzten Fall ist das Gute keine Arche mehr, von der her alle anderen abgeleitet werden. Aristoteles’ Ansicht zufolge liegt der Grund hierfür darin, dass nur die allen zugrunde liegende Substanz das erste und höchste Seinsprinzip ist, auf das sich alle anderen Kategorien beziehen: Das Gute als eine bestimmte Kategorie wäre nur dasjenige, was jedem Satz prädikativ beigefügt werden kann. Betrachtet man Aristoteles’ kritische Argumentation gegen Platons Ideenlehre insgesamt, wird uns gezeigt, dass wir, um das Gute selbst beim Wort zu nehmen, die angemessene Antwort auf zwei Fragen zu suchen haben, nämlich was das Gute ist und wie darüber gesprochen werden kann. An dieser Stelle können wir feststellen, dass Gadamers in seiner Habilitationsschrift gestellte Frage innerhalb eines in der Philosophiegeschichte dauerhaft umstrittenen Diskussionsrahmens steht. Und wenn wir Gadamers gesamten Gedankengang von seinen sorgfältigen Abhandlungen in den dreißiger Jahren über Wahrheit und Methode zu den späten Aufsätzen ins Auge fassen, stellen wir auch fest, dass Gadamers Sprachontologie, die sich selbst als den spekulativen Sinnganzheitshorizont der Sprache bezeichnet, in der die Sprache das Eine im Vielen-Sagenden unaufhörlich sucht, mit der genannten philosophischen Problemlage zu tun hat. Wenn Gadamer Aristoteles’ Praktischer Philosophie, insbesondere der Phronesis, seine Aufmerksamkeit zuwendet, geht es ihm, abgesehen von der oben behandelten Platonkritik, um die von Aristoteles selbst vorgenommene Unterscheidung zwischen 71 Ebd., 1096 b 23 – 25. 332 theoretischer und praktischer Philosophie. Denn diese Aristotelische Trennung der theoretischen von der praktischen Philosophie beinhaltet einen entscheidenden Bezug auf Sokrates’ Weisheit des Nichtwissens, wonach es im Grunde einen nicht auflösbaren Widerspruch zwischen dem Wissen und der Wirklichkeit gibt. Im Anschluss an Aristoteles Einsicht arbeitet Gadamers Dialoghermeneutik noch mit einem weiteren Gegensatz, dem zwischen phronesis, episteme und techne. Wenn Aristoteles auch in seiner Ethik Platons Idee des Guten im Prinzip abgelehnt hat, gesteht er de facto doch ein, dass man auch von einem Guten, das mit den verschiedenen Varianten des Guten übereinstimmt, - obgleich dies eine Gute, wie wir sahen, nur mit dem theoretischen Wissen (episteme) auszudrücken ist -, reden können muss, damit man die verschiedenen Erscheinungsformen des Guten in die bestimmten Handlungssituationen einordnen und herausarbeiten kann. Davon abgesehen ist es für unseren Zusammenhang entscheidend, darauf zu achten, dass das theoretische Wissen, das vom Urteilssatz abhängig ist, keinen praktischen Bezug hat, weil es nicht dialogisch, sondern monologisch ist. Infolgedessen bedarf z. B. die Aristotelische Apodiktik, die in den Schlussfolgerungsverfahren des theoretischen Wissens begründet ist, im Prinzip keiner Zustimmung des Anderen. Sie sorgt sich nicht um die Zustimmung des Gesprächspartners, so lange das beweislogische Verfahren nur um sich selbst kreist, während sich die Sokratische Gesprächsführung immer um die Zustimmung des Gesprächspartners sorgt, sie sich damit zugleich in ihrem prozessualen Gang der aktiven Beteiligung des Anderen vergewissern und mit dem Anderen zusammengehen will. Denn der Dialog selbst will das Eine und damit zugleich das Viele im Wechselverhältnis zum Anderen zusammenschauen und –denken. Aus dieser Perspektive führt Gadamer von nun an drei verschiedene Wissensweisen des Menschen ein: Im Gegensatz zum praktischen Wissen (phronesis), das theoretische (episteme) und das technische Wissen (techne). Dem theoretischen und dem technischen Wissen gemeinsam ist eine übergeordnete Herrschaftsstruktur, da beide die Subsumtion des Einzelnen unter das Allgemeine betreiben. Deshalb sind beide lehrbares und lernbares Wissen. Uns wird vor allem gezeigt, dass für das theoretische Wissen, das die Mathematik zu seinem Muster hat, die Genauigkeit, die ohne eine kontextuelle Abhängigkeit von der konkreten Situation unveränderliche Wiederholbarkeit und deshalb die absolute Vollkommenheit der Erkenntnis ermöglicht, charakteristisch ist und dass das technische Wissen eine Kenntnis der Verfügbarkeit des nützlichen Herstellens ist und damit in dem zweifelsfreien Wissen um die Anwendbarkeit der allgemein gesetzten Regeln in jedem konkreten Fall gründet. 333 Im Vergleich zum theoretischen und technischen Wissen ist die Phronesis hingegen als das Wissen darum, was der Mensch in der jeweils bedingten Handlungssituation zu tun hat, unlehrbar und unlernbar, weil ein solches praktisches Wissen die Besinnung auf das Gute, mit anderen Worten, die freiwillige Wahlentscheidung für das Beste 72 unter sich ständig verändernden Handlungssituationen bedeutet. Da unser praktisches Wissen weder die fix objektivierbare Dingwelt, die das technische Wissen zu seinem Gegenstand hat, noch das theoretisch beweisbare Unveränderliche, an das das wissenschaftliche Wahrheitswissen kontinuierlich gefesselt ist, sondern immer schon die geschichtlich begrenzte Lebenssituation der Lebendigen als seine potenzielle Verwirklichungsbedingung hat, steht dieses Wissen von vornherein nicht unter der kausalen Kette geplanter Zielverfolgung. Man könnte sagen, dass die Zielsetzung des menschlichen Handelns, die von Anfang an den Handelnden motiviert, von unserem Willen geplant ist. Es liegt auf der Hand, dass das menschliche Leben, das immer schon sein praktisches Wissen in die praktische Lebenswelt übersetzt, vom ständigen Wechsel der jeweiligen Lebensabschnitte und Erfahrungen abhängig ist und sich nicht in einer aneinander geketteten Folge gewiss geplanter Ziele erschöpft. Vielmehr fordert die menschliche Handlungssituation uns häufig auf, mit unserem praktischen Wissen auf das Unerwartete angemessen zu reagieren und dafür nicht nur den besten Handlungszweck, sondern auch das beste Handlungsmittel zum Handlungsvollzug auszuwählen. Aus diesem Grund wird in Gadamers Dialoghermeneutik auch deutlich, dass das praktische Wissen nicht nur das kluge Vorwissen (prudentia), sondern auch vor allem das eigenartige Wissen sei. Nun sagt Gadamer in seinem frühen Aufsatz „Praktisches Wissen“: „[…] Selbstwissen muß ein eigenes Werk haben, wenn es Wissen sein soll. […] Alles Wissen ist Wissen von etwas, als einem Anderen seiner selbst. Wissen seiner selbst aber soll nicht nur Wissen von anderen Wissenschaften, sondern auch von ihm selbst sein, und Wissen nicht nur dessen, was man weiß, sondern auch, was man nicht weiß.“ (GW. 5, S. 235) Im Anschluss an die zitierten Sätze können wir hier feststellen, dass Gadamer von Anbeginn an das praktische Wissen als das „Selbstwissen“, nämlich das Wissen um sich selbst verstanden hat. Damit wird deutlich, dass das Wissen um sich selbst das sokratische Wissen des Nichtwissens ist, in dem 72 Uns ist bereits bekannt, dass Gadamer selber Aristoteles VI. Buch von Nikomachische Ethik, in dem hauptsächlich die Phronesis behandelt wurde, übersetzt hat. Hier hat er uns auch den annehmbaren Vorschlag unterbreitet, dass der altgriechische Begriff arete nicht bloß als die Tugend, sondern als die „Bestheit“ verstanden werden könne. Denn die Griechen dachten, dass alle sachlichen oder lebendigen Naturwesen von Natur aus in ihrer eigenen Seinsweise ihre eigene Bestheit innehaben und um ihrer selbst willen den besten Zustand erstreben. Das Messer hat z. B. seine eigene Bestheit. Vor diesem Hintergrund betrachtet, fällt auf, dass das lateinische Wort virtus, das von dem Begriff der „Tugend“ herkommt, im wesentlichen auf die Männlichkeit, gewissermaßen die männliche Stärke, verweist. Als Tapferkeit im Krieg gilt deshalb insbesondere ein tugendhaftes Tun. Gegen diese Einseitigkeit könnte man zur Zeit vermutlich auch den Vorwurf erheben, dass sich dieses nur auf die männliche Tugend bezieht. Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, hrsg. und übers. von H. – G. Gadamer, Frankfurt a. M. 1998, S. 3. 334 das hermeneutische Bewusstsein, das bei Gadamer als das Bewusstsein von der eigenen Grenze bezeichnet wird, verwurzelt ist. 73 In Gadamers Augen kulminiert das praktische Wissen nicht in der Spitze der hergestellten Fertigkeit und der technischen Geschicklichkeit, sondern dieses Wissen befindet sich, wie das Denken die zirkuläre Bewegung von Wort (onoma) und Begriff (logos) aufweist, immer in der ununterbrochen wechselseitig aufeinander wirkenden Harmonie von logos (Rede) und ergon (Tat). Insofern ist das praktische Wissen „ein suchendes Wissen“ 74 , das nur im Handlungsvollzug erwerbbare Wissen. Dabei ist zunächst unwichtig, ob dies Handeln gelungen oder nicht gelungen ist. In der Tat können wir uns hier davon überzeugen, dass keiner von uns eine Handlungsfolge vorhersehen, vorhersagen oder gar beherrschen kann, weil die menschliche Handlung das Verhältnis des Menschen zum Menschen zu ihrer Grundlage hat. Das praktische Wissen Klugheitsüberlegung, als die Handlungswegweiser uns bestimmte hat nicht Informationen nur mit über der eine rationalen bestimmte Handlungssituation gibt, sondern auch mit der „praktische[n] Vernünftigkeit“ 75 zu tun, worunter Gadamer einerseits die kluge Entscheidung für das beste Mittel zum guten Zweck, andererseits das Festhalten des Sinns für das Rechte und das Gute im konkreten Fall versteht. Insofern ist die Praxis, die permanent vom praktischen Wissen begleitet wird und damit die sorgfältige Anwendung der gewonnenen Handlungsprinzipien auf den konkreten Fall leistet, das lebendige Handeln der Lebendigen, kurzum das menschliche Leben selbst, das sich in der ethisch institutionalisierten Gemeinschaft zu vollziehen strebt und immer schon eine Beziehung auf den „letzten Zweck“ als dem „Gut–Leben“ 76 in der eigenen Lebensweise hat. Deshalb sagt Aristoteles in dem von Gadamer übersetzten Text: „Aus dem Gesagten ist also klar, daß es unmöglich ist, im eigentlichen Sinn tugendhaft zu sein ohne Vernünftigkeit, und daß es ebenso unmöglich ist, vernünftig zu sein, wenn Ethos, das heißt die sittliche Tugend fehlt.“ 77 Damit wird deutlich, dass das praktische Wissen als handlungsleitende Orientierungsinstanz seine Handlungsprinzipien nicht aus einer zugrunde liegenden Transzendenz, sondern vom Ethos (z. B. Gewohnheit, Bräuche, Institutionen usw.) ableitet, so lange es auf die Verwirklichung und die Konkretisierung seines eigenen Zwecks, nämlich des guten Lebens gerichtet ist. Da die Praxis, die vom praktischen Wissen angeleitet wird, immer 73 Vgl. Otto Pöggeler, „Die ethisch–politische Dimension der hermeneutischen Philosophie, in: Probleme der Ethik, hrsg. v. Gerd–Günther Grau, München 1971, S. 45 ff. Bescheiden schrieb er in diesem Aufsatz, dass Gadamer „die Aristotelische Analyse des sittlichen Wissens oder der praktischen Klugheit als Modell einer Analyse des hermeneutischen Bewusstseins“ betrachtet hat. (S. 50) 74 Mirko Wischke, Die Schwäche der Schrift, S. 192. 75 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, S. 19. 76 Manfred Riedel, „Über einige Aporien in der praktischen Philosophie des Aristoteles“, in: Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. I, hrsg. v. ders., Freiburg 1972, S. 87. 77 Aristoteles, Ebd. S. 57. 335 schon die Tugend als den Sinn ihres Handelns annimmt, ist sie das „beständige Am–Werk– Sein“ 78 im in die ethischen Institutionen eingebundenen Leben des Menschseins. Anders gesagt, ist sie im Grunde die unaufhörliche Suche nach dem Guten, die von der praktischen Vernunft geleitet wird. Vor allem dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass das praktische Wissen ein sich selbst ausbildendes Wissen ist, das aus dem Spannungsverhältnis zwischen dem im gelungenen Handlungszweck gewonnenen Wissen und dem auf das auszufüllende Handlungsziel bezogenen Wissen erwächst. An dieser Stelle ist nun daran zu erinnern, dass das praktische Wissen in Gadamers philosophischer Hermeneutik das dialogische Verstehen ist, weil das hermeneutische Wissen ebenso wie das praktische Wissen die unaufhörliche Suche nach dem Wahrsein (aletheia), Gutsein (agathon) und auch Schönsein (kalon) zu seiner Grundstruktur hat. So verstanden zeigt sich, dass das Gespräch, insbesondere Platons Dialog als dessen hervorragendes Muster, das von der sokratischen Frage geleitet wird, was gut für das menschliche Leben sei, das sich selbst verwirklichende und konkretisierende Sinnnetzwerk des praktischen Wissens prägt. In Gadamers Augen wohnt zum einen das ‚Ethische’, nämlich der ethische Impuls, der uns ständig wieder nach dem Guten die Frage stellen lässt als ein gemeinsamer Ursprungssinn der menschlichen Handlung, dem Gespräch inne, in dem das praktische Wissen seinen Ort hat. Da das praktische Wissen im Gespräch die unendliche Suche nach dem Guten zu seinem Leitprinzip hat, ist das Gute des Guten in diesem Gespräch nicht nur ein transzendentaler Horizont der Sinnerwartung, der in der hierarchischen Gütertafel als „oberstes“ Prinzip gilt, 79 sondern auch das realisierbare Muster, auf das wir unseren Blick werfen und unter dessen Licht wir das Gute in dieser konkreten Situation bewusst machen und gewinnen können. Zum anderen bewegt sich das Gespräch in Gadamers Dialoghermeneutik mit dem Ethos, das weder begründungsbedürftig, noch begründungsfähig ist, sondern an das die Begründungsnot immer 78 79 M. Riedel, Ebd. S. 93. Das Gute als die angemessene Antwort auf die Frage, was gut ist, ist de facto immer von der bestimmten Fragesituation abhängig, weil die Frage selbst hier den konkreten Lebensbezug hat. Wir können dafür das folgende Beispiel anführen: Essen oder Trinken gegen Hunger oder Durst wäre ‚gut’ und Kleidung als Schutz vor Hitze und Kälte für einen Obdachlosen wäre ‚gut’. So sind die Güter in jeder Situation von der Sicherheit des Leibes, des Lebens bis zur sozialen Anerkennung, zur politischen Autonomie verschieden und umfassend. Aber diese Güter ordnen sich nicht in die vertikalen Werturteile ein, sondern sie haben immer zugleich an dem Guten teil. Vgl. Martha C. Nussbaum, „Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit. Zur Verteidigung des aristotelischen Essentialismus“, S. 208 ff. und Angelika Krebs, „Werden Menschen schwanger? – Das >>gute menschliche Leben<< und die Geschlechterdifferenz“, in: Was ist ein gutes Leben? , hrsg. v. Holmer Steinfath, Frankfurt a. M. 1998, S. 237 ff. Vor allem berichtet Nussbaum in ihrem Aufsatz über die pädagogische Funktion des Gesprächs zwischen den Entwicklungshelfern und den Dorfbewohnern in den Entwicklungsländern. Die erziehungsfähige Kraft des Gesprächs ist effektiver als die sachliche Erklärung. Denn die Gesprächsstruktur baut eine Verlässlichkeit zwischen den Menschen auf und legt die Anerkennung der allgemeinen Menschlichkeit fest. In diesem Sinne bedarf die gegenwärtige Diskussion der Menschenrechte auch des hermeneutischen Dialoghorizontes. Diesbezüglich, vgl. Hans–Georg Flickinger, „Im Namen der Freiheit – Über die Instrumentalisierbarkeit der Menschenrechte“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin 2006, S. 841 – 852. 336 gekoppelt ist. Gadamers Anknüpfung des Gesprächsphänomens an den Ethos verweist uns auf die hermeneutische Grundannahme, dass das hermeneutische Verstehen den praktischen Lebenssinn im alltäglichen Verhältnis des Menschen zum Menschen im Auge behält und in diesem Sinne ohne eine weitere adjektivische Bestimmung praktische Verständigung ist, die als ein gesellschaftstheoretischer Begriff gebraucht wird. Das dialogische Spiel des wechselseitigen Gebens und Nehmens beruht auf einem ethischen Fundament, weil es nicht nur von der Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit ausgeht, sondern auch die Bewegung des Anerkennens ausdrücklich vollzieht: Mit einem Wort, dieses dialogische Spiel ist selbst die „Bewegung des Anerkennens“. Die Frage nach dem Guten fordert nunmehr die Frage heraus, wie der Handelnde das Gute halten und um das Gute wissen kann. Denn der Mensch kann ohne das Wissen um das Gute nicht gut handeln. Bevor wir etwas tun, müssen wir zwar um das Gute wissen, weil unsere Handlung in der bestimmten Handlungssituation mit Hilfe dieses Wissens um das Gute zum Guten gelingen soll. Damit ist jedoch nicht garantiert, dass das Wissen um das Gute das menschliche Handeln zum Guten hinleitet. Das Wissen um das Gute garantiert nicht die ethische Handlung. Denn es liegt auf der Hand, dass ein professioneller Moraltheoretiker, der das sittliche Moralgesetz in- und auswendig kennt, eine ethische und gute Handlung in einer konkreten Handlungssituation nicht selbstverständlich erfüllt und ausübt. Mit anderen Worten: Um gut und ethisch zu handeln, müssen wir ständig versuchen, immer wieder um das Gute zu ringen. Dennoch ist das in einer bestimmten Situation erworbene Wissen um das Gute nicht der einzige Garant für die gute Handlung in einer sich selbst ständig verändernden Handlungssituation. Wenn wir uns nun selbst nach unserem guten Leben fragen, stehen wir vor der Aufgabe, über unser Handeln zu urteilen. Da eine solche Frage den Lebenssinn im Ganzen betrifft, ist sie für unser Leben von entscheidender Bedeutung. Dennoch liegt die Möglichkeit der Beantwortung dieser Frage immer jenseits unseres Lebens, weil die Beurteilung unseres ganzen Lebens erst am Ende des Lebens möglich ist und selbst der Endpunkt unseres Lebens noch immer einen Teil dieses Prozesses darstellt. Das Gute befindet sich also vor dem Horizont des ethischen Fragens: Das Gute, nämlich ein gutes Leben, kann nie endgültig festgestellt werden, sondern wir müssen das Gute endlos suchen. Da die Frage nach dem Guten nach dem eigenen Lebenssinn fragt, ist sie auch entscheidend dafür, auf welches Leben wir hoffen können, welches Leben wir leben wollen oder sollen. Demzufolge ist die Frage nach dem Guten in meinem Leben, in der familiären Intimbeziehung, im Freundeskreis und in dem gesellschaftlichen Rahmen, in den ich schon immer hineingeworfen und hineingewachsen bin, eingeschrieben. Die Hoffnung auf das mögliche gute Leben als die 337 Wahlmöglichkeit unter bestimmten Rahmenbedingungen bezieht sich deshalb auf die ernsthafte Sorge um sich selbst und damit zugleich um die Anderen in der gesamten Lebensgeschichte. So gesehen, wird deutlich, dass die Frage nach dem Guten ein zukunftsgerichteter Sinnhorizont für alle Menschen ist. Uns ist bereits bekannt, dass Aristoteles seine Ethik mit diesem Satz beginnt: „Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluß scheint irgendein Gut zu erstreben. Darum hat man mit Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt.“ 80 So gesehen ist die Tatsache selbstverständlich, dass der Mensch von Natur aus um seiner selbst willen das Gute anstrebt. Gleichwohl wählen wir auch eine Lebensform in einer konkreten Situation und verleihen dieser gewählten Lebensform von vornherein einen eigenen Lebenssinn. Vor diesem Hintergrund betrachtet zwingt uns die Wahl einer Lebensform, den Grund dafür zu benennen, noch verschärfter, zu rechtfertigen, warum man diese Lebensform wählen soll und auch welche Lebensform unter den verschiedenen Formen sinnvoll und gut sein kann. Denn wir entscheiden uns für eine bestimmte Lebensform im unendlichen Kreislauf zwischen einem genusssüchtigen Leben und einem moralischen, sittlichen Leben. Unsere Suche nach dem guten Leben spielt sich in der dialogischen Bewegung zwischen Frage und Antwort ab, die im Grunde vom ethischen Fragehorizont immer wieder und anders erschlossen werden. Das Sich-Einlassen auf das Gespräch, das durch den ethischen Fragehorizont, noch genauer, durch das eigene Bedürfnis nach dem Guten, nach dem das menschliche Leben strebt, bestimmt ist, lässt uns nicht nur die Begegnung mit dem Du erfahren, das der Andere meiner selbst ist, sondern führt uns zu der selbstüberprüfenden Frage nach dem eigenen Lebenssinn und fordert eine offene Haltung des Anerkennens eines möglichen anderen guten Lebens. Da das Ergebnis eines solchen Gespräches genauso wenig wie die Handlungsfolge vorhersagbar oder vorhersehbar ist, d. h. da das Gespräch, das an unserem Handlungswissen der Phronesis orientiert ist, keine endgültige Antwort gibt, steht das gemeinsame Suchen nach dem Guten immer im dialogischen „Zwischen“, einer potenziellen Polarität. Insofern tendiert die zwischenmenschliche Suche nach dem Guten in der dialogischen Dynamik zwischen dem Geben und dem Nehmen zum Finden des „Mitte– Halten–Könnens“, nämlich des „mittleren Zustandes“, das im Prinzip deshalb endlos gesucht werden soll, weil die Mitte selbst, mit der ständigen Veränderung der Handlungssituation Schritt haltend, immer neu und anders zu bestimmen ist. 81 Sofern der Mensch um seiner selbst willen das Gute anstrebt, kann er freilich im praktischen Verwirklichungs- und Konkretisierungsverlauf seines Willens zum Guten in der 80 81 Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, übers. v. Olaf Gigon, I. Buch, I. Kap. 1094 a 1 – 1094 a 4. Vgl. Gernot Böhme, Ethik im Kontext, Frankfurt a. M. 1997, S. 143 – 147, hier S. 145. 338 konkreten Handlungssituation auch Fehler machen, weil jede Handlung unerwartete Folgen, die er nicht absehen konnte oder wollte, haben kann. Der Handelnde hat daher keine andere Wahl, als das unbehagliche Handlungsresultat zu ertragen. Er kann diesem unfreiwilligen Handlungsakt nicht entrinnen, weil das Ergebnis immer schon geschehen ist, noch bevor er es hatte ahnen können. Aus diesem Grund fordert die menschliche Handlung uns auf, Verantwortungsbewusstsein für Fehler und Schuld zu zeigen, d. h. auch für die Konsequenzen, die sich aus den Handlungen ergeben und die der Mensch niemals mit Absicht tut, verantwortlich zu sein. Wir werden dazu aufgefordert, uns im Handlungsverlauf darüber Rechenschaft abzulegen, dass wir auf dem Handlungsfeld Fehler machen können. Daran zeigt sich, dass das praktische Wissen, das die unabschließbare Suche der menschlichen Praxis nach dem Guten anleitet, die Selbstverantwortung des Handelnden als ethische Kategorie umfaßt. Um autonom und vernünftig handeln zu können, muss man sich um seiner selbst willen ein Handlungsziel setzen und das Handlungsmittel zur Zielerfüllung freiwillig wählen, dafür jedoch zugleich auch die Verantwortung übernehmen. Die Praxis des Dialogs beinhaltet diese ethische Kategorie, weil der ethische Fragehorizont, nämlich das Fragen nach dem Guten als treibender Motor der Gesprächsführung fungiert. Die Frage nach dem Guten, die die Dialogvorgänge leitet, hat für den Fragenden im Erwartungshorizont hinsichtlich einer angemessenen Antwort ihren Stellenwert und sie wird für den Befragten zur ethischen Pflicht der Beantwortung. Mit anderen Worten: Der Befragte hat das Recht, die Antwort auf seine Art und Weise zu geben, damit zugleich aber auch die Pflicht, die Frage zu beantworten. Der ethische Fragehorizont im ununterbrochenen Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen bildet den Erwartungshorizont aus. Ich muss auf die unerwartete Herausforderung des Anderen angemessen reagieren können, d. h. der Fragehorizont ist der Horizont, innerhalb dessen ich das Antworten des Anderen erhoffe. Der Fragehorizont begründet deshalb die ethische Verantwortung, einerseits die Antwort auf die Frage zu geben und andererseits sich selbst fragen zu lassen und zu fragen. Somit könnte man sagen, dass diese ethische Kategorie in der Praxis des Dialogs keine zwanghafte Pflicht, sondern ein Anspruch ist, der ständig von jedem Dialogteilnehmer selbst erhoben wird. Nachdem wir uns auf das Gespräch eingelassen haben, müssen wir dem Anderen zuhören, d. h. die Aussage des Anderen ernst nehmen und zugleich auf die unvorhersehbare Herausforderung des Anderen mit der permanenten Anerkennung seiner Andersheit angemessen zu reagieren trachten. Somit ist die menschliche Handlungsfreiheit von vornherein begrenzt. 339 Das Wissen darum, dass Du nur ein Anderer meiner selbst bist, d. h. dass der Andere mein Gesprächspartner ist, dem ich mitzuteilen und den ich zu erreichen versuchen muss, bildet, wie wir bereits in der vorherigen Überlegung zum ursprünglichen Dialogphänomen gesehen haben, den zugrundeliegenden Ausgangspunkt des Gesprächs. Dass man den Anderen als seinen Gesprächspartner annimmt, nämlich das unmittelbare Gegenüber grenzenlos anerkennt, ist die einzige „Bedingung der Möglichkeit“ des Gesprächs. Darüber hinaus stellt das Gespräch als ein unendliches Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen, zwischen Frage und Antwort, in seinem Vollzug die Bewegung des Anerkennens dar. Denn das Sprechen und das Hören als die Grundelemente des Gesprächsverlaufs bewegen sich im Grunde entlang der Anerkennung des Rechts des Anderen, gegen meine Argumente Einwände erheben zu können. Vor allem zeigt das Hörphänomen im Gesprächsverhältnis, die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen. Bereit zu sein, sich etwas sagen lassen, bildet zwar die Basis für das eigene Recht, das, was ich sagen will, auf jeden Fall zu Wort kommen zu lassen, verpflichtet aber zugleich jeden Dialogteilnehmer zur ethischen Verantwortung des Zuhörens. Da das Gespräch in seiner ursprünglichen Gestalt keine monologische Selbstbeantwortung der eigenen Frage ist, sondern die gemeinsame Übernahme der Verantwortung für das Fragen fordert, besteht der Gesprächsverlauf darin, den Gesprächspartner sprechen zu lassen, nämlich dessen Recht im Gespräch zu stärken. Vor diesem Hintergrund betrachtet verleiht das Gespräch keinem von uns das Privileg, den Anderen zu derselben Einsicht zu zwingen und ihn argumentativ niederzukämpfen. Vielmehr erkennt das Gespräch das Widerstandsrecht des Anderen an, meine Perspektive zu verweigern. Diese Anerkennung des Widerstandleistens des Anderen führt uns nicht nur zum Anspruch auf das Zuhören, sondern gibt uns auch, wie bereits erwähnt, den entscheidenden Impuls zum reflexiven Rückzug auf uns selbst, nämlich auf unseren ursprünglichen Fragehorizont. An dieser Stelle wird uns in Gadamers Dialoghermeneutik gezeigt, dass die Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit die erste Voraussetzung für das zwischenmenschliche Zusammenleben ist, nämlich die Anerkennung, dass der Andere im Gespräch auch das Recht hat, seine Andersheit zu Wort zu bringen. Zweitens folgt aus der ethischen Grundlage der weiteren Gesprächsführung, dass das Gespräch letztlich das Verwirklichungsfeld ist, auf dem sich die Bewegung des Anerkennens vollständig entfalten kann. So gesehen ist das Gespräch, in dem sich der Anspruch auf Anerkennung des Anderen erfüllt, ohne die ethische Konnotation nicht denkbar, weil die Anerkennung im Gesprächsverlauf von vornherein die ethische Verantwortung für das Sprechen–lassen und für das Zuhören bzw. für das Fragestellen und Antwortgeben voraussetzt. 340 Aus Gadamers Sicht ist zudem klar, dass sich das „Ethische“ seit Sokrates in dem harmonischen Zusammenspiel der Phronesis und des Ethos niederschlägt. Sofern der Mensch von Natur aus das Ethische, nämlich das Gute anstrebt, macht er sich auch seine Angewiesenheit auf den Anderen und auf den geschichtlichen und kulturellen Hintergrund bewusst. Er ist sich dessen bewusst, dass er allein kein Mensch sein kann. Aus diesem Grund lernt er auch, dass er, um ethisch zu sein, notwendig der Ergänzung durch den Anderen bedarf. Das dialogische Anerkennungsverhältnis, in dessen Verlauf wir die Antwort auf die Frage nach dem Guten suchen, konstruiert nicht nur das Sinnnetzwerk des menschlichen Zusammenseins, sondern bildet auch die ethische Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Das ethische Prinzip, das den Gesprächsverlauf immer beeinflußt, ist deshalb dasjenige, „Sich–betreffen–Lassen von dem, was den anderen betrifft“. 82 Insofern stützt sich das Gespräch, das von der Frage nach dem Guten geleitet wird und die gemeinsame Bereitschaft zur Suche nach dem wechselseitigen Anerkennungsbezug umfaßt, immer schon auf die ethische Grundvorstellung, die uns eigen ist. Mit seiner Erkenntnis der dialogischen Suche nach dem Guten in Platons Dialektik verlagert Gadamers Rekurs auf Aristoteles Phronesis den Schwerpunkt auf den Begriff der „Freundschaft“ im VIII. Buch von Die Nikomachische Ethik. Gadamer knüpft an Aristoteles an, wenn in seinem Aufsatz „Freundschaft und Selbsterkenntnis (GW. 7, 1985)“ von der Freundschaft die Rede ist. Denn die Freundschaft offenbart seiner Ansicht nach die vereinigende Kraft des Gesprächs. Sofern sich das Fragen nach dem Guten auf den Erwartungshorizont der Antwort bzw. auf die Verantwortung für das Antwortgeben bezieht, ist die Suche nach dem Guten, wie wir schon sahen, unentbehrlich für das gemeinsame Suchen, d. h. die unruhige Fragestellung bedarf der Teilnahme des Anderen. Mit einem Wort: Die Suche nach dem Guten führt uns unmittelbar zu der Begegnung mit dem Nächsten. Eine Freundschaft zu schließen, nämlich den Anderen als einen Freund zu finden, heißt hier das ursprüngliche Einbezogensein in die übersubjektive Wir–Dimension, nämlich „eine reale Einbettung in das Gefüge der miteinander lebenden Menschen.“ (GW. 7, S. 405) Im Anschluss an die gemeinsame Lebensweise zwischen Freunden geht es auch um das vertrauenswürdige Ratschlaggeben, das sich im Prinzip innerhalb der Gesprächsform abspielt. Diese menschliche Verhaltensweise der Freundschaft zeigt uns, dass wir im Gesprächsverhältnis die Frage des Anderen und die Verantwortung für das Antwortgeben ernst nehmen. Diese Ernsthaftigkeit, die das dialogische Suchen bereits in sich enthält, richtet nun den gemeinsamen Blick auf das zu findende Gute. So wird gezeigt, dass das Gespräch, 82 So hat Gernot Böhme in seinem Buch Solidarität definiert, ebd. S. 142. 341 das sich ständig auf dem Feld des Ethischen vollzieht, die wesentliche Grundstruktur desjenigen prägt, was der Mensch von Natur aus mit sich selbst und mit dem Anderen erfährt. Somit kann man auch sagen, dass die Gesprächsführung, die von Anfang an die gemeinsame Suche nach dem Guten betreibt, die individuelle und auch gesellschaftliche Gemeinsamkeit bildet, auf der das menschliche Zusammenleben basiert. Nun sagt Aristoteles: „Vollkommen ist die Freundschaft der Tugendhaften und an Tugend Ähnlichen. Diese wünschen einander gleichmäßig das Gute, sofern sie gut sind, und sie sind gut an sich selbst. […] Ihre Freundschaft dauert, solange sie tugendhaft sind.“ 83 Kurzum, die ethische Verbindlichkeit, die sich mit und durch das Gespräch vollzieht, entspricht der Freundschaftsbeziehung. An dieser Stelle erstreckt sich der dialogische Fragehorizont des Ethischen, Gadamers Ansicht zufolge, über das Fragen nach dem einzelnen guten Leben hinaus auf die gesellschaftliche Frage, was gut für die Gemeinschaft und auch für den Staat sei, auf die Politik. Das Gespräch über das Wissen um das Gute hat zwar bereits auf die unentbehrliche Harmonie der Phronesis mit dem Ethos hingewiesen, der gesellschaftliche und interkulturelle Handlungsraum aber, in dem die herkömmlich erworbenen Moralvorstellungen miteinander konfrontiert werden, erzeugt das Bedürfnis nach Dialog, das aus der menschlichen Frage nach dem Guten immer wieder neu erwächst. Denn der Konflikt erhebt von vornherein den Anspruch auf den Dialog. Hier hat die ethische Praxis des Dialogs als praktische Philosophie in Gadamers Dialoghermeneutik mit dem gesellschaftstheoretischen Bereich, mehr noch, mit der Politik zu tun. Gadamer hat daher Aristoteles’ Ethik als Übergang zur Politik verstanden: „In ihr (Ethik oder praktische Philosophie, KBL) ist nicht nur die Besinnung und die Ordnung des Lebens des einzelnen in der Gesellschaft eingeschlossen, sondern gerade auch die Ordnung der gesellschaftlichen Einrichtungen selber, die das Zusammenleben der Menschen im gesellschaftlichen Gefüge regeln. Die praktische Philosophie umfaßt also neben der Ethik auch die sogenannte Politik und meint beides, wenn sie >praktische Philosophie< heißt.“ (GW. 7, S. 382) 84 Wenn wir uns hier an Gadamers Aussage „Hermeneutik als Praktische Philosophie“ erinnern, können wir feststellen, dass die Dialoghermeneutik nicht nur eine Ethik, die sich auf den einzelnen Handelnden bezieht, sondern auch die Politik, die das öffentliche Gemeinschaftsleben unter den Menschen bestimmt, umfaßt. Unter diesem Aspekt 83 84 Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, VIII. Buch, Kap. 4, 1156 b 7 – 12. Aristoteles selbst hat in seiner Ethik den notwendigen Übergang von der Ethik zu Politik angekündigt. Es ist bekannt, dass Hegel seine Rechtsphilosophie an Aristoteles’ Aspekt angeknüpft hat. Unter dem Einfluss beider Philosophen hat Joachim Ritter festgestellt: „Die praktische Philosophie ist als >Ethik< Politik.“ Zu Aristoteles’ Selbstankündigung, vgl. Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, X. Buch, Kap. 10, insbesondere 1181 b 13 – 24 und auch zudem, Joachim Ritter, Metaphysik und Politik, S. 110. 342 betrachtet können wir auf die praktische Anwendung in der theologischen und juristischen Hermeneutik näher eingehen. Wenn ich hier kurz die praktische Anwendungsfunktion der hermeneutischen Erfahrung, das Ethische zu verwirklichen und zu konkretisieren, vorweg skizziere, dann ist die grundsätzliche Anwendungsstruktur immer an das anerkennende Wechselverhältnis zwischen Ich und Du bzw. zwischen Ich und Wir gebunden. Denkt man an die moderne Idee der Freiheit, spielt das sittliche System, hegelianisch gesagt, eine entscheidende Rolle im Verwirklichungs– und Konkretisierungsprozess der individuellen Freiheit. Denn das Freiheitsprinzip kann sich nur in der Anerkennung des Du und durch die Anerkennung des Freiheitssystems realisieren. Eine demokratische Gesellschaft, der im Prinzip die faktische Freiheit aller Mitglieder zugrunde liegt, sollte die Besinnung auf die gesellschaftlichen Ordnungen und das Moralbewusstsein jedes frei handelnden Mitgliedes voraussetzen und auf die engagierte Bereitschaft dieses Mitgliedes vertrauen können, die gesellschaftlichen Normen zu befolgen. Doch die Verwirklichungsmöglichkeit der individuellen Freiheit liegt nur in der anerkannten Garantie durch die sittlichen Institutionen, nämlich im gesellschaftlichen Rechtsystem. Jedes Mitglied kann nur dann seine Freiheit verwirklichen, wenn sich das gesellschaftliche System auf diesem Freiheitsprinzip gründet. Damit wird deutlich, dass die Freiheit eine eingeschränkte Freiheit ist, die als ethische Bestimmung des hermeneutischen Geistes immer im Vordergrund steht. Somit wird deutlich, dass die praktische Anwendung als das Verwirklichungsmoment der individuellen Freiheit immer schon auf den Anderen und auf die überindividuelle Wir–Dimension angewiesen ist. 343 II – 2. Praktische Applikation als die Vollzugsform des dialogischen Verstehens Mit Gadamers früher Einsicht in Aristoteles’ Phronesis können wir uns nun seinem Denkansatz zur dialogischen Ethik zuwenden, so wie er besonders in der späten engen Bindung an die hermeneutische Problematik der praktischen Anwendung in Wahrheit und Methode entwickelt wird. Gadamers Grundauffassung der Hermeneutik, dass das menschliche Verstehen immer auf das reziproke Verhältnis zwischen Ich und Welt, Ich und Du bzw. Ich und Wir angewiesen ist, weist von vornherein darauf hin, dass sich das Verstehen nicht im bloßen Auslegungsakt, der im hermeneutischen Verfahren die perspektivische Subjektivität des Interpreten aufhebt, sondern durch die praktische Anwendungsleistung vollzieht. Dass sich das Verstehen durch das Auslegen vollzieht, bedeutet, dass das Auslegen bereits das dialogische Übersetzungsverhältnis enthält, in dessen Kreislauf sich der Sinngehalt, den der Andere uns anbietet, in unser eigenes Wort überträgt und umgekehrt, dass sich unser Standpunkt zugleich ins Sinnfeld der Andersheit des Anderen überträgt. Insofern ist das Auslegen, Gadamers Ansicht zufolge, in der praktischen Anwendungsstruktur verankert. Demzufolge kann man sagen, dass das dialogische Verstehen mit der praktischen Applikation seinen Vollzug erreicht und somit die ethische Verhaltensweise zwischen den Beteiligten in den Vordergrund stellt. Mit dieser Erkenntnis des wesentlichen Anspruchs des hermeneutischen Verstehens auf die ethische Praxis, behandelt Gadamer das hermeneutische Anwendungsproblem in seinem Hauptwerk. Dort trägt das Kapitel, zu dem die drei Abschnitte gehören, den Titel „Wiedergewinnung des hermeneutischen Grundproblems“. Hier kündigt Gadamers Aussage von der „Wiedergewinnung“ an, dass die Anwendung innerhalb des Diskussionsrahmens der traditionellen Hermeneutik als ein mehr oder weniger prekäres Element des Verstehensaktes galt. Aus diesem Grund stellt Gadamer das Anwenden, 85 das von der traditionellen Hermeneutik zur Nebensächlichkeit geworden war, als einen Grundbestandteil des hermeneutischen Verstehens wieder in den Vordergrund. Damit fasst Gadamers Dialoghermeneutik den ethisch–politischen Themenbereich ins Auge, der philosophiegeschichtlich der praktischen Philosophie angehört. Die hermeneutische Anwendung als lebendige Handlung zur Verwirklichung und Konkretisierung des 85 In der überlieferten Linie der traditionellen Hermeneutik hatten die zwei Kompetenzen, das Verstehen (subtilitas intelligendi) und das Auslegen (subtilitas explicandi), bereits ihren Stellenwert. Erst in der pietistischen Hermeneutik wurde die dritte Kompetenz, das Anwenden (subtilitas applicandi), von J. J. Rambach hinzugefügt. Aber eine unter den drei Kompetenzen, nämlich die Anwendung, ist bei Gadamer nicht die Methode zur objektiven Auslegungskunst, in deren Licht der Interpret über den Textsinn verfügen kann, sondern erweist vielmehr den hermeneutischen Freigeist, dass die Sachwahrheit unter der bedingten Situation verstehbar ist. Vgl. GW. 1, S. 312. 344 Lebensvollzugs hat im Grunde mit dem praktischen Wissen um die situationsbedingte Kontextgebundenheit zu tun. In Gadamers Dialoghermeneutik ist das Verstehen das Anwenden, weil sich sowohl das Verstehen als auch das Anwenden in demselben dialogischen Übersetzungsverhältnis bewegt. Die Vollzugsform des dialogischen Verstehens liegt in der praktischen Anwendung des Handlungsgesetzes auf den konkreten Fall oder des zu verstehenden Textsinnes auf den bestimmten Kontext. Das Verstehen ist, wie Gadamer sagt, deshalb „immer schon Anwenden“. (GW. 1, S. 314, meine Hervorhebung) Da die hermeneutische Anwendung die Konkretisierung des überlieferten Sinngehaltes, nämlich die ethische Integration der gewohnten Institutionen in den gegenwärtigen Handlungssinn anvisiert, ist die mögliche Anwendungsleistung, durch die das Verstehen ermöglicht werden soll, auf die betroffene Situation beschränkt. Das Anwendungsmoment, das von seinem situativen Zusammenhang abhängt, findet also immer einen neuen Rahmen. Demzufolge hat die Situationsbedingtheit der praktischen Anwendung, die Gadamer als die Vollzugsweise des Verstehens bezeichnet, eine Verwandtschaft mit Aristoteles’ Gedanken der Phronesis in dessen praktischer Philosophie, so wie er in Gadamers frühem Denkansatz zur Ethik verwurzelt war. Das praktische Wissen ist, wie oben erwähnt, immer auf die jeweilig veränderten Handlungssituationen bezogen, so wie die hermeneutische Anwendung immer an einen bestimmten Kontext gebunden ist. Im Anschluss an seinen Rekurs auf Aristoteles’ Ethik hebt Gadamer die praktische Anwendungsleistung im hermeneutischen Verstehensverfahren vor allem gegenüber der Position des intellektuellen Moralbewusstseins hervor, die die „Kognitivität“ und auch die „Formalität“ der Handlungsnormen 86 in den Vordergrund stellt. Ein solcher ethischer Intellektualismus des aufklärungszeitlichen Freigeistes instrumentalisiert auch die menschliche Vernunft, weil alle Handlungsgesetze hierbei vom menschlichen Intellekt ohne Rücksicht auf dessen Gebrauchsgrenzen abgeleitet werden zu können scheinen. Dort soll dann dasjenige, was gut oder normativ in der menschlichen Handlungsweise ist, immer am kognitiv gewonnenen und formal begründeten Maßstab gemessen werden, das vom menschlichen Intellekt bestimmt wird. Aus Gadamers Sicht hingegen ist das praktische Wissen, das die menschliche Handlung unter der Perspektive der entscheidenden Fragestellung nach dem Guten für sein gesamtes Leben anleitet, im Grunde das Anwendungswissen, das nur in Bezug auf die bestimmte Handlungssituation erworben werden kann. Denn wenn das Gesetz des Handelns die menschliche Handlung zum Ethischen, 86 Zur Normengeschichtlichkeit gegen Habermas’ Universalgrundsatz, vgl. den Exkurs zur Ethos–Ethik in dieser Arbeit. 345 gewissermaßen zum Normativen, anleitet, wird sich dies in der sich permanent verändernden Handlungssituation zeigen. Und umgekehrt soll es sich in der bedingten Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Handlungskontext erschließen und konkretisieren. Nun wird in Gadamers Dialoghermeneutik emphatisch gezeigt, dass die Handlungsnormen nicht mehr das Unhintergehbare sind, das vom menschlichen Intellekt konstruiert ist, sondern sich selbst immer nachzufragen und neu anzuwenden haben. Die Kritik der philosophischen Hermeneutik am Intellektualismus normativer Handlungsprinzipien hat unter anderem mit der überzogenen Akzentuierung des kognitiven und kreativen Verständnisses in der juristischen Hermeneutik zu tun. Mit seinem epistemologischen Denkansatz zum Verstehensvollzug im Auslegen von juristischen Texten stellt E. Betti das Primat der Kognitivität des hermeneutischen Verstehens ins Zentrum. So glaubte er, dass wir das Handlungsgesetz, z. B. auf der Seite des Rechtsinterpreten das Gesetzbuch, kognitiv auswendig verstehen müssen, bevor wir die praktische Anwendung des Handlungsgesetzes auf den konkreten Fall in unserer geschichtlich eingeschränkten Handlungssituation ausüben können. 87 Dieser kognitiven Denkweise setzt Gadamer seine Gegenposition entgegen: „Applikation ist keine nachträgliche Anwendung von etwas gegebenem Allgemeinen, das zunächst in sich verstanden würde, auf einen konkreten Fall, sondern ist erst das wirkliche Verständnis des Allgemeinen selbst, das der gegebene Text für uns ist.“ (GW. 1 S. 346) So verstanden kann man sagen, dass das wirkliche Verstehen in Gadamers Dialoghermeneutik die Anwendung ist, noch emphatischer, dass das Verstehen und das Anwenden bei Gadamer immer gleichzeitig geschieht: Die Gleichzeitigkeit als der Ereignischarakter des hermeneutischen Verstehens meint keine simultane Kopie, sondern die zeitliche Jeweiligkeit des Verstehens, die das „spekulative“ Hören des Sprechens in jeder Gesprächsphase mitkonstruiert. Da sich das dialogische Verstehen immer schon in der praktischen Anwendung vollzieht, wird gezeigt, dass die geschichtliche Anwendung der Handlungsnormen ein sich selbst überprüfender und konkretisierender Verstehensprozess ist. Sowohl ein richterliches Plädoyer hinsichtlich der Tat, als auch ein interpretatorisches Verständnis des Rechtshistorikers, hat bei Gadamer nunmehr dieselbe Anwendungsstruktur der juristischen Hermeneutik. Wenn ein Rechtshistoriker ein vergangenes Rechtssystem mit Hilfe eines alten Gesetzbuches verstehen will, versetzt er sich, wie wir schon sahen, unabdingbar mit seinem eigenen Verständnis in das zu verstehende Vergangene. Auf diese Weise wird der Sinngehalt, der sich hinter dem prozessualen Verstehensweg zum sich erhellenden Verstehensvollzug bewegt, erschlossen. Dass er selbst in das verständliche 87 Vgl. Emilio Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre, S. 58 ff. 346 Wechselverhältnis zum überlieferten Textsinn eintritt, bedeutet, dass das Verstehen nicht vom Objektivitätsideal her, das den eigenen Sinnanspruch des Interpreten ohne den geschichtlichen Hintergrund des menschlichen Handlungsgesetzes auszuschließen versucht, geschieht, sondern bereits an einen bestimmten Kontext gebunden ist. Genau so darf der Richter, um das Gesetz richtig anzuwenden, nicht die „kongeniale“ Revision über die Urheberabsicht vollständig auszuführen versuchen, sondern die richterliche Gesetzanwendung selbst bildet den praktischen Anwendungszusammenhang und überprüft sich selbst anhand des bestimmten aktuellen Verwendungskontextes. So ist jeder Richterspruch als jeweilige Gesetzesanwendung immer schon in seine bestimmte Anwendungssituation eingebunden. In die bestimmte Situation eingebunden zu sein, bedeutet aus hermeneutischer Sicht, dass man eine beschränkte Sichtweise hat, die wir im allgemeinen den eigenen Standpunkt nennen. Aus hermeneutischer Sicht muss der Richter deshalb im Hinblick auf die Verurteilung notwendigerweise eine eigene Perspektive bilden. Vor diesem eigenen Horizont bleibt dem Richter nichts verborgen, sondern er bringt den Rechtssinn auf seine eigene Weise zum Ausdruck. Der Geltungsanspruch des Handlungsgesetzes hängt also nicht vom universal gesetzten Werturteil, sondern von der Anwendungssituation ab, in der das Gesetz sich selbst verwirklicht und konkretisiert. 88 Was das Gesetz rechtmäßig gelten lässt, befindet sich nicht in der dogmatischen Einseitigkeit der Textinterpretation, sondern immer im unabschließbaren Spannungsverhältnis zwischen der Gesetzestreue und der praktischen Anwendung des Gesetzes auf den konkreten Fall. Die Frage, was eine normative Handlung ist, wird uns, Gadamers Ansicht zufolge, nicht von einer abstrakten Idealkonstruktion gestellt, sondern zielt auf die existenzielle Betroffenheit ab, nämlich auf die lebensweltliche Konfrontation mit der konkreten Handlungssituation, die die menschliche Bereitschaft zum ethischen Handeln verlangt. Sofern die Handlungsnormen als handlungsorientierende Wegweiser ihren Geltungsanspruch in der Begegnung mit der eigenen Situation erfüllen, kann man sagen, dass die Normen nicht in einer idealen Deduktion festgestellt werden, sondern sich aus der geschichtlichen Überlieferungslinie entwickeln. Hier spielen die Normen als leitende Handlungsrichtlinien des menschlichen Handelns, in dessen Licht jeder Handelnde seinen Willen und seine 88 Diese Dynamik der praktischen Gesetzanwendung betreffend schreibt J. Ritter in seinem Buch: „Wo es um die Zusammenhänge des menschlichen Lebens und seiner Praxis geht, da genügt der reine Begriff nicht; was es ist und was es sein kann, muß sich an ihm selbst zeigen und in seinem Zusammenhang zur Sprache kommen. […] Die ethische Theorie muß hermeneutisch an die Vieldeutigkeit und Mehrsinnigkeit des menschlichen Daseins anknüpfen, weil nur so Begriffe gewonnen werden können, deren Gültigkeit sich auf das, was ist, bezieht, dies zugleich voraussetzt und stehen läßt. Wir besitzen vollendet ausgebaute ethische Systeme, sieht man aber von ihrer Höhe zurück auf die Wirklichkeit des Menschen, wie sie ist, dann fragt man sich, was die Begriffe des Systems mit ihr zu tun haben.“ J. Ritter, Metaphysik und Politik, S. 63 – 64. 347 Interessen bildet und konkretisiert, ihre eigene Rolle. Dass jeder Handelnde seiner betroffenen Situation entsprechend angemessen handeln kann und damit das Beste zu suchen trachtet, bedeutet aus hermeneutischer Sicht, dass jede menschliche Handlung bereits den sittlichen Kontext enthält, in dessen Kreis wir miteinander verkehren. So gesehen besteht die normative Handlung, auf die jeder Handelnde um seiner selbst willen abzielt, in der angemessenen Zielkonkretisierung unter den kontingenten Handlungsrahmenbedingungen. Und die Normen, die in den herkömmlichen Sittengesetzen, Gewohnheiten, tragenden Institutionen und Bräuchen usw. zum Ausdruck kommen, bewähren sich in einer solchen geschichtlichen Auseinandersetzung mit der kontingenten Situation. Die geschichtliche Entfaltung der Handlungsnormativität ist aber kein kontinuierlicher Fortschritt, der den Fortgang von Anfang zu Ende vollständig leitet, sondern eine unendliche Weitergabe in einer Wiederholung des authentischen Anspruchs auf das ursprünglich Ethische. Denn die menschliche Handlung ist um ihrer selbst willen zwar auf das Gute gerichtet, kann aber unter keinen Umständen den abgeschlossenen Endzweck erreichen. Um das Gute zu erreichen, sollte sich jeder Handelnde in einer bestimmten Handlungssituation, die ihm permanent unauflösbare Aufgaben bietet, dem beabsichtigten Handlungsziel stellen und dabei stets die Frage nach der Ethik im Hinterkopf haben. Hier geht es nicht um die technische Verfahrensexaktheit, sondern um das menschliche Handlungsurteil, 89 das sich auf dem Weg der inhaltlichen Konkretisierung des ethischen Anspruchs, auf das Gute gerichtet bildet. Da die von Anfang an gestellte Frage, was die normative Handlung sei, damit auf das menschliche Handlungsurteil unter den kontingenten Umständen grundsätzlich angewiesen ist, kann es keine Wertneutralität geben, 90 die in jeder Erfüllung der praktischen Anwendungsaufgabe deduktiv abgeleitet würde. In Gadamers Augen liegt der Grund für das menschliche Handlungsurteil nicht im abstrakten Resultat der Deduktion, sondern im ethischen Anspruch auf die angemessene Zielkonkretisierung unter den kontingenten Umständen, der mit dem Sich-Einlassen auf das Gespräch mit dem Anderen erhoben wird. Hier fasst der Mensch das Ethische permanent ins Auge und kann das Menschsein in seinem solidarischen Zusammenleben verwirklichen. Aufgrund der bisherigen Überlegungen liegt auf der Hand, dass sich jeder Handelnde mit seinem eigenen Willen zum Guten ein Handlungsziel setzt, das Handlungsmittel zur bestimmten Zielerfüllung auswählt und dass uns der Handlungswegweiser, der den 89 Zur hermeneutischen Anwendungsproblematik in Bezug auf Kants Urteilskraft, vgl. Manfred Riedel, „Imputation der Handlung und Applikation des Sittengesetzes – Über den Zusammenhang von Hermeneutik und praktischer Urteilskraft in Kants Lehre vom ‚Faktum der Vernunft‛ “, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, hrsg. v. J. Simon, Stuttgart 1989, S. 27 – 50. 90 Zur „Unparteilichkeit“ unter den Moralbegründungsproblemen in der kommunikativen Ethik, vgl. Ernst Tugendhat, Problem der Ethik, Stuttgart 2002, S. 87 – 108. 348 situationsgebundenen Konkretisierungsprozess zum Handlungsziel anleitet, mit der Überlieferung des Ethischen gegeben ist. Damit erfährt nicht nur jeder einzelne Handelnde das Ethische im Umgang mit seiner eigenen Handlungssituation, sondern das Ethische, nämlich die Handlungsnorm, bildet sich selbst immer in der geschichtlichen Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Moralanspruch aus. Eine solche Bildung der ethischen Orientierungen befindet sich immer schon in einer Struktur von Geschichtlichkeit, in der es Gewinn- oder Verlusterfahrungen gibt. Dass wir die richtige Handlungs- und die ethische Verhaltensweise, die die richtige ethische Einschätzung über die konkreten Handlungsbedingungen voraussetzt, erwerben können, verlangt von uns nicht die rücksichtslose Anwendung eines festgelegten Handlungsgesetzes, sondern unsere ununterbrochene Suche nach dem Guten, d. i. eine langzeitige Erfahrung und die reflexive Selbstausbildung im retrospektiven Handlungsurteil. Somit können wir sagen, dass die ethische Selbstbildung des Menschseins eine geschichtliche Kontextgebundenheit hat und immer in der zirkulären Wechselbeziehung zwischen Ich und Du und zwischen Ich und Wir besteht. Jeder einzelne Handelnde versetzt sich selbst, um das Ziel zu verwirklichen, in seinen Handlungsraum und begegnet darin dem unmittelbaren Gegenüber als seinem Partner, weil sich das lebensweltliche Sinnnetzwerk als die Rahmenbedingung für die Zielkonkretisierung erweist. Da jeder einzelne Handelnde, der auf das Gute in seinem Handeln und seiner Wahlentscheidung für das richtige Mittel abzielt, bereits im dialogischen Verhältnis zum anerkannten Anderen steht, bedarf die gemeinsame Suche nach dem zu erreichenden Handlungsziel andererseits der Anerkennung der Autorität der Überlieferten, auf der unser gemeinsamer Handlungsspielraum als die überindividuelle Wir–Dimension basiert. So gesehen kann man sagen, dass uns die ethische Selbstbildung, die sich in ihrer geschichtlichen Einbindung entfaltet, das doppelte Anerkennungsverhältnis zeigt: Einerseits die Anerkennungsbewegung zwischen Ich und Du auf der anerkannten Wir-Dimension, andererseits die Anerkennung der allgemeinen Wir-Dimension durch den handelnden Einzelnen. Wenn die Handlungsnormativität, in der das menschliche Handlungsurteil unter den sich eigenständig bildenden Handlungskontexten steht, nicht das abstrakte Ergebnis der deduktiven Reflexion der „praktischen Vernunft“ ist, sondern, Gadamers Ansicht zufolge, sich im wechselseitigen Anerkennungsverhältnis, um das unser Suchen nach dem Guten kreist, ausdrückt, bildet sich die Handlungsnormativität, die ununterbrochen gemeinsam gesucht wird, nun im reziproken Gesprächsverhältnis zwischen mir und dem Anderen. Denn sowohl das Gespräch mit dem Gesprächspartner, als auch das unaufhörliche Geben und Nehmen hat 349 eine leitende Kraft, in deren Licht sich jeder Beteiligte von den naiven Bestrebungen distanzieren kann und sich den Spielregeln unterwirft, d. h. das Gute verfolgt. Je ernsthafter wir uns daher auf den dialogischen Spielraum einlassen und den sprachlichen und tätigen Ausdrucksformen des Anderen zuhören, desto mehr machen wir nicht nur den Anderen, sondern uns auch über uns selbst verständlich. Noch deutlicher gesagt, verlangt der Eintritt in den dialogischen Spielraum von vornherein die unentbehrliche Ernsthaftigkeit aller Beteiligten. 91 Die ethische Verantwortung dafür, was man sich selbst und dem Anderen in einer solchen Gesprächsbeziehung verständlich machen muss, fordert uns auf, den Anderen immer ernst zu nehmen. Mit dieser Einsicht in die dialogische Ethik sagt Gadamer: „Wer einsichtig ist, ist also bereit, die besondere Situation des anderen recht gelten zu lassen, und daher ist er auch am meisten zur Nachsicht oder zur Verzeihung geneigt.“ (GW. 1, S. 329) Dementsprechend können wir hier zu behaupten wagen, dass Gadamers Denkansatz zur dialogischen Ethik im Prinzip eine ethisch–politische Philosophiekonzeption impliziert. Denn das Gespräch, das bereits unter der Frage nach dem Guten steht, ermöglicht nicht nur die ethische Verständigung über sich selbst und den Anderen, die in dem Bewusstsein der gemeinsamen Zugehörigkeit gründet, sondern versichert sich auch des gesellschaftlichen Zusammenlebens, in dem die menschliche Seinsmöglichkeit aktualisiert und konkretisiert wird. Dass man den Anderen in seiner authentischen Andersheit verstehen muss, ist der hermeneutische Moralanspruch, auf den das menschliche Zusammenleben angewiesen ist. Demzufolge beruht auch das dialogische Verstehen des Anderen immer schon auf der ethischen Einsicht in das gesellschaftliche Gemeinsame. Schließlich kann man sagen, dass sich die Anerkennung als ethische Bedingung für die menschliche Solidarität in dieser dialogischen Verständigung über sich selbst und über den Anderen vollzieht. 91 Vgl. Gernot Böhme, Ethik im Kontext, S. 150 ff. 350 Ein kurzer Ausblick Anhand der bisherigen Überlegungen sahen wir, dass der hermeneutische Denkansatz zum dialogischen Sinnvollzug den praktischen Vorrang der menschlichen Vernunft beweist und damit die ethische Grundlage im lebensweltlichen Umgang mit dem Anderen zum Vorschein bringt. Wenn die Ethik als Lehre vom guten Leben und von der rechten Verhaltensweise zwischen den Menschen zu sehen ist, wenn sich das sittliche Verhalten von nun an im kontextbezogenen Sozialleben, d. h. in den sozialen Rahmenbedingungen der menschlichen Lebenssituation vollzieht, bedarf die Ethik unabdingbar der Hermeneutik, die an der wesentlichen Existenzform der Menschen als Verstehende ansetzt. Dieser hermeneutische Ansatz erhebt daher gegen den ethischen Formalismus den Einwand, dass der inhaltsleere Sollsatz die beweislogische Abstraktion von der Besonderheit der lebensweltlichen Handlungssituationen unerlässlich macht. Der Ansatz weist auch die Bodenlosigkeit des Appells an die Universalgrundsatzbegründung zurück, weil der Sollsatz die Allgemeinheit notwendigerweise von jedem konkreten Besonderen absondert. Im Verhältnis zum Handlungspartner erfahren wir, dass die begründeten Handlungsmaximen häufig dem jeweils spezifischen Handlungsfall nicht entsprechen. Daran anschließend wird letztendlich gezeigt, dass der formal bewiesene Sollsatz in Bezug auf die sich unendlich verändernde Lebenssituation ohnmächtig ist. Denn er kann im Grunde die Frage nicht beantworten, wie die ethischen Ansichten in den praktischen Handlungsraum umgesetzt werden. Infolgedessen hat Gadamers Dialoghermeneutik die Auffassung in den Mittelpunkt gestellt, dass der Dialog den einheitlichen Vollzugshorizont des zwischenmenschlichen Anerkennens stiftet. Aus diesem Grund muss gezeigt werden, dass das menschliche Verstehen von der bedingungslosen Annahme der unaufhebbaren Andersheit ausgeht und im Vollzug der Anerkennung der Andersheit zustande kommt. Hierbei zieht der Dialog die praktische Verständigung nach sich, da sich jeder Beteiligte im Sich-Einlassen seiner eigenen Einstellungen bewusst ist. Die hermeneutische Dialogperspektive erlaubt uns auch, festzustellen, dass das Gespräch eine therapeutische Kraft hat. Das psychotherapeutische Ges