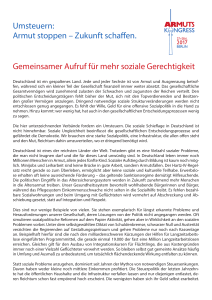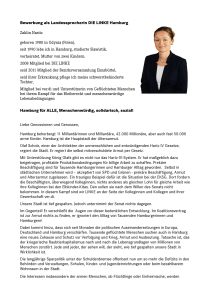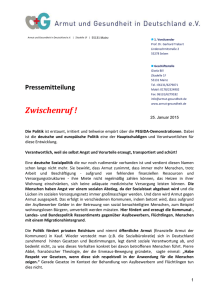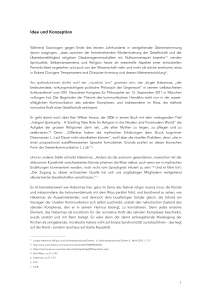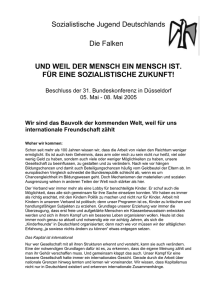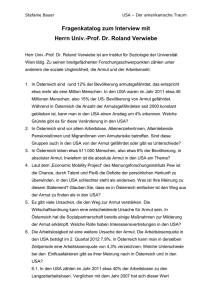Heft als pdf - Zeitschrift diskurs
Werbung

gesellschafts- und geisteswissenschaftliche interventionen Herausgeber Daniel Kuchler, M.A., M.A. State University of New York at Albany (SUNY) – Dept. of Political Science Dr. Bastian Walter, M.A. Bergische Universität Wuppertal – Fachbereich Geistes- und Kulturwissenschaften Ines Weber, M.A. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft Board of Reviewers Prof. Dr. Johanna Bödege-Wolf Universität Vechta – Institut für Sozialwissenschaften und Philosophie Prof. Dr. Karl-Heinz Breier Universität Vechta – Institut für Sozialwissenschaften und Philosophie Prof. Peter Breiner, PhD State University of New York at Albany (SUNY) – Dept. of Political Science Prof. Dr. Thomas Großbölting Westfälische Wilhelms-Universität Münster – Historisches Seminar Prof. em. Edward Keynes Penn State University; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Institut für Sozialwissenschaften Prof. Dr. Martin Kintzinger Westfälische Wilhelms-Universität Münster – Historisches Seminar Dr. Wilhelm Knelangen Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft Prof. Dr. Martin Lücke Freie Universität Berlin – Friedrich-Meinecke-Institut Prof. em. Dr. Lothar Maier Heidelberg Prof. Dr. Christian Martin Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft Prof. Dr. Renate Martinsen Universität Duisburg-Essen – Institut für Politikwissenschaft Dirk Nabers Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft Dr. Stephan Sandkötter Universität Vechta – Institut für Sozialwissenschaften und Philosophie Prof. Dr. Morton Schoolman, PhD State University of New York at Albany (SUNY) – Dept. of Political Science Dr. Daniel Siemens Universität Bielefeld – Fakultät für Geschichtswissenschaft Prof. Dr. Hans Rainer Sepp Karls-Universität Prag – Humanwissenschaftliche Fakultät Redaktion Dr. des. Anja Franke-Schwenk Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Collegium Philosophicum Ingmar Hagemann, Dipl.-Pol. Universität Duisburg-Essen, Institut für Politikwissenschaft Zusätzliche Reviewer für diese Ausgabe Jutta Schmitz, M.A. Universität Duisburg-Essen, Institut für Soziologie Robin Schroeder, M.A. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Inhalt Editorial 8 Aufsätze Meike Siegfried Gewalt als das Andere der Macht? Überlegungen im Ausgang von Hannah Arendt und Michel Foucault 10 Philipp Hölzing Öffentlichkeit und Privatheit. Rekonstruktion einer Unterscheidung am Beispiel der Theorie von Jürgen Habermas 34 Gottfried Schweiger Philosophie und Armut. Überlegungen zu ihrem Zusammenhang 66 Klaas Schüller Die Zwecke der Gesellschaft. Vier Modelle sozialer Teleologie 90 Claudia Simone Dorchain Die Rächer von Elba. Exil und Gewalt Marianne Witt 114 Die Europäische Union in den georgischen Sezessionskonflikten. Ein sicherheitspolitischer Akteur? 130 6 Inhalt Gelesen Sebastian Klauke Zur Aktualität der Klassenfrage 162 Autorenverzeichnis 166 Impressum 168 7 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Editorial Bastian Walter Liebe Leserinnen und Leser, nachdem Sie sich im letzten Themenheft von dis|kurs eingehend über die verschiedenen Facetten von Exil informieren konnten, ist diese erste Ausgabe des Jahres 2012 als offenes Themenheft konzipiert. Unserem international breitgestreuten Call-for-Paper sind zahlreiche Autorinnen und Autoren gefolgt. Die Redaktion ist daher sehr erfreut, in dieser thematisch offenen Ausgabe eine qualitativ hochwertige und disziplinäre, methodische, sowie inhaltliche Vielfalt der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung abbilden zu können. Die Beiträge reichen von der analytischen Reflektion ideenpolitischer und philosophischer Auseinandersetzungen des 20. und 21. Jahrhunderts bis hin zur Analyse spezifischer empirischer Problemstellungen. Den Anfang macht Meike Siegfried mit ihrem theoretischen Beitrag „Gewalt als das andere der Macht? Überlegungen im Ausgang von Hannah Arendt und Michel Foucault“. Basierend auf der Feststellung, dass „Macht“ eines der Schlüsselkonzepte der zeitgenössischen politischen Philosophie ist, untersucht sie die Möglichkeit, ob man klar zwischen „Gewalt“ und „Macht“ unterscheiden kann. Dabei durchleuchtet sie sowohl die Ausführungen von Hannah Arendt zu „Macht und Gewalt“ als auch Michel Foucaults Analyse zum Zusammenhang zwischen Macht, Gewalt und Herrschaft. Auch der zweite Beitrag dieses Heftes „Öffentlichkeit und Privatheit. Rekonstruktion einer Unterscheidung am Beispiel der Theorie von Jürgen Habermas“ von Philipp Hölzing widmet sich einer politiktheoretischen Fragestellung. Hölzing stellt mit Blick auf die Forschungsdebatte fest, dass sich zwar viele Wissenschaftler mit dem Öffentlichkeitskonzept von Habermas befasst haben, es aber kein einheitliches Öffentlichkeitsverständnis bei Habermas gibt, sondern insgesamt vier Unterscheidungsformen von Öffentlichkeit und Privatheit bei Habermas erkennbar sind. Diese rekonstruiert Hölzing werksgeschichtlich und bricht so mit dem derzeit gängigen Öffentlichkeitsbegriff. Darauf stellt Gottfried Schweiger in seinen innovativen Ausführungen zu „Philosophie und Armut. Überlegungen zu ihrem Zusammenhang“ fest, dass es zwar zahlreiche philosophische Einzelstudien gebe, die sich mit Armut beschäftigen, doch fehle eine ein8 Editorial hellige Meinung, was philosophische Armutsforschung überhaupt ist und was sie leisten kann. Mithilfe der Beantwortung der drei Fragen, was Armut ist, wie sie zu bewerten ist und wie sie bekämpft werden kann, bereitet Schweiger den Weg für seinen Appell, das Feld der Armutsforschung für die Philosophie fruchtbar zu machen und in philosophische Debatten einzubetten. Die „Zwecke der Gesellschaft“ stehen im Blickwinkel des nachstehenden Beitrages. Klaas Schüller diskutiert zunächst mit dem Traditionalismus, dem Totalitarismus und dem Liberalismus drei idealtypische Modelle sozialer Teleologie, um dann mit dem kritizistischen Republikanismus ein Modell vorzustellen, das die Identifikation des Individuums mit dem Gemeinwesen erleichtert und Möglichkeiten zur Reflexion bietet. Der darauffolgende Beitrag „Die Rächer von Elba – Exil und Gewalt“ von Claudia Simone Dorchain ist als nachgelagerter Artikel zum letzten Themenheft „Exil“ (2-2011) zu verstehen. In ihm beschäftigt sich die Autorin mit den jüngsten Ausführungen von Jan Phillip Reemtsma zu „Vertrauen und Gewalt“ und untersucht in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Auswirkungen und Folgen von Exilierung als Gewalterfahrung für die von dieser Betroffenen. Gleichsam sehr aktuell ist der letzte Beitrag dieses Heftes „Die Europäische Union in den georgischen Sezessionskonflikten – ein sicherheitspolitischer Akteur?“ von Marianne Witt, der das Spannungsverhältnis zwischen der zivilen und sicherheitspolitischen Rolle der Europäischen Union unter Einbeziehung von rollentheoretischen Überlegungen in den Konflikten Georgiens mit Russlands analysiert. Zuletzt möchten wir noch auf zwei Dinge hinweisen: Erstens wird die kommende Ausgabe von dis|kurs ganz im Zeichen von Theorie stehen. Im Mittelpunkt des Heftes wird die zentrale Frage „Was kann Theorie?“ diskutiert. Dabei sollen Fragen zum Verhältnis zwischen Theorie, Praxis und Methodologie genauso im Vordergrund stehen wie das Verhältnis disziplinspezifischer Theorien zueinander. Zweitens – und darüber freuen wir uns als Herausgeber sehr - wird diskurs ab dieser Ausgabe neben der gewohnten Printausgabe unter der Adresse ­http:// www.diskurs-online.de/ auch als Open-Access-Journal verfügbar sein. Hier stehen nicht nur die Artikel der Printausgabe zur Verfügung, sondern es haben – getreu unserem Selbstverständnis – alle Nutzer die Möglichkeit, sich aktiv an den aufgeworfenen Debatten zu beteiligen, beziehungsweise diese zu initiieren. Was bleibt, ist, Ihnen eine gewinnbringende Lektüre zu wünschen. 9 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Aufsätze Gewalt als das Andere der Macht? Überlegungen im Ausgang von Hannah Arendt und Michel Foucault Meike Siegfried Ruhr-Universität Bochum, Institut für Philosophie E-Mail: [email protected] Abstract Starting from the diagnosis that ‘power’ is one of the key concepts of contemporary political philosophy, this essay examines the possibility of a clear differentiation between the phenomena of power and violence. To explore this question, the essay focuses on two theoretical approaches: Hannah Arendt’s attempt to elaborate an unambiguous differentiation between power and violence in her famous essay ›On Violence‹ as well as Michel Foucault’s analysis of relations of power, violence and domination in his later writings on ‘governmentality’. The aim of this comparison is to highlight some of the most important issues that arise when dealing with the question of power in the horizon of current approaches in the field of political theory. Schlüsselwörter Arendt, Foucault, Macht, Gewalt, Herrschaft 10 Meike Siegfried ‚Macht‘ gehört ohne Zweifel zu den Schlüsselbegriffen der politischen Philoso­ phie. Ebenso breite Aufmerksamkeit erfahren Fragen der Bestimmung, Ausübung und Eingrenzung von Macht in der aktuellen Politik- und Sozialwissenschaft.1 Jedoch hat kaum ein Phänomen in der geisteswissenschaftlichen Tradition derart unterschiedliche, mitunter gerade entgegengesetzte Zuschreibungen erfahren wie die Macht. In ihrer Einleitung zu dem Sammelband ›Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart‹ heben die Herausgeber die auffälli­ ge Heterogenität der Bestimmungen hervor, welche Macht in der Theoriebildung zugesprochen bekommen hat: Oftmals werde sie mit der Einwirkung von Zwang assoziiert – Macht als Potential zur Überwindung von Widerständen oder zur Unterwerfung von Widerstrebendem –, dann wiederum werde sie verstanden als Gestalt gebendes Medium, das sämtliche Bereiche des sozialen Zusammenlebens durchwirkt und produktiv formt.2 Zudem erscheint Macht in vielen traditionellen Ansätzen als personen-, klassen- oder institutionengebundenes Vermögen; andere Konzeptionen beschreiben sie als dezentral und anonym wirkende ‚Formkraft‘, die als solche nicht als Eigenschaft oder Potential irgendeines Subjekts verstanden werden dürfe. Ein Verständnis von Macht im Sinne eines personengebundenen Handlungspotentials drückt sich exemplarisch in der bekannten Definition von Max Weber in ›Wirtschaft und Gesellschaft‹ aus: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.«3 Dagegen betont Michel Foucault im Rahmen seiner Vorlesung ›In Verteidigung der Gesellschaft‹: 1 Siehe zur Breite der Diskussion und der Vielfalt der beteiligten Disziplinen insgesamt Röttgers, Kurt: Spuren der Macht. Begriffsgeschichte und Systematik. Freiburg / München 1990 sowie Berger, Wilhelm: Macht. Wien 2009. 2 Vgl. Krause, Ralf / Rölli, Marc (Hrsg.): Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philoso­phie der Gegenwart. Bielefeld 2008, S. 7. 3 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 51976, S. 28. Siehe auch die viel zitierte Definition von S. Lukes: »Die Macht eines oder mehrerer Handelnder A in Hinblick auf ein Ziel Z manifestiert sich dann, wenn A das Ziel Z durch das Einwilligen eines oder mehrerer Handelnder B erreicht.« (Lukes, Steven: Macht und Herrschaft bei Weber, Marx, Foucault. In: Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt a.M. / New York 1983, S. 106–119, hier S. 107). 11 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 »Die Macht muss, wie ich glaube, als etwas analysiert werden, das zirku­liert, oder eher noch als etwas, das nur in einer Kette funktioniert; sie ist niemals lokalisiert hier oder da, sie ist niemals in den Händen einiger, sie ist niemals angeeignet wie ein Reichtum oder ein Gut.«4 Angesichts der eben umrissenen Theorielage konstatiert Christian Kupke, dass Macht heute einerseits ein so komplexes Thema darstelle, dass dessen Behand­ lung auf »ein äußerst breites, man könnte sagen inter- oder heterodisziplinäres Arsenal von (logischen, hermeneutischen und empirischen) Analyseinstrumen­ ten«5 zurückgreifen müsse; andererseits sei Macht »auch zu einer Art Füllsel, d.h. zu einem derart äquivoken und polyvoken Term geworden, dass er nur noch als totalisierende [...] Metapher für das Politische selbst fungieren kann«6. Als ein Kernphänomen des Politischen wird Macht in zeitgenössischen Ansätzen im Bereich der politischen Philosophie vornehmlich von Autorinnen und Autoren postuliert, die mit ihren Konzeptionen zugleich Position beziehen gegen die Dominanz einer Ausrichtung der Disziplin am Thema der Gerechtigkeit, die mit dem Erscheinen von John Rawls’ ›A Theory of Justice‹ (1971) einsetzte und sich in der anschließenden Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte entfaltete. Hier wäre etwa die seit einigen Jahren auch im deutschen Sprachraum intensiv diskutierte Hegemonietheorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe zu nennen. Mouffe beschreibt in ihrem Buch ›The Return of the Political‹ (1993) Rawls’ Theorie als eine »political philosophy without politics«7 und konstatiert, Rawls’ Liberalismus »leads to neglect of the role played by conflict, power and interest«8. Ebenso behauptet Raymond Geuss in seinem Buch ›Philosophy and Real Politics‹ (2008), in dem die kritische Abgrenzung von Rawls’ Identifizierung der politi­schen Philosophie mit einer spezifischen Herangehensweise an die Gerechtig­keitsproblematik 4 Foucault, Michel: Vorlesung vom 14. Januar 1976. In: Ders.: Analytik der Macht. Frankfurt a.M. 2005, S. 108–125, hier S. 114. 5 Kupke, Christian: Macht und/oder Gewalt. Politikphilosophische Interventionen. In: Krause, Ralf / Rölli, Marc (Hrsg.): Macht. Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart, S. 63–84, hier S. 63. 6Ebd. 7 Mouffe, Chantal: Rawls: Political Philosophy without Politics. In: Dies.: The Return of the Political. London / New York 1993, S. 41–59, hier S. 49. 8Ebd. 12 Meike Siegfried eine zentrale Rolle spielt: »To think politically is to think about agency, power, and interests, and the relations among these.«9 Vorgeworfen wird Rawls, insbesondere vonseiten der Hegemonietheorie, jedoch nicht nur, dass er Macht als Phänomen nicht eigens thematisiert habe, sondern dass sein Ansatz vielmehr ein Bild von Politik entwerfe, bei der es darum gehe, Macht als Faktor gerade auszuschalten: Während im privaten Bereich Pluralismus zugelassen wer­de, sei die soziale und politische Gemeinschaft als dauerhaft zu befriedende Sphä­re vorgestellt.10 Chantal Mouffe: »Conflicts, antagonisms, relations of power disappear and the field of politics is reduced to a rational process of negotiation among private interests under the constraints of morality.«11 Allerdings fällt auf, dass die aktuellen Ansätze einer Erneuerung machttheoreti­ schen Denkens im Feld der politischen Philosophie sich oftmals keinen ausführ­ licheren Analysen des Phänomens Macht in Abgrenzung von verwandten Phäno­ menen und Begriffen wie ‚Unterdrückung‘, ‚Herrschaft‘ oder ‚Gewalt‘ widmen.12 Nicht selten werden diese Begriffe hier synonym verwendet und ‚Macht‘, mit­unter mit deutlich neo-nietzscheanischen Anklängen, als eine Art ‚Kampfbegriff‘ gegenüber den Konzeptionen des Liberalismus, aber auch des Kommunitarismus sowie der deliberativen Demokratietheorie eingesetzt. Gut sichtbar ist dies erneut in einer Beschreibung von Chantal Mouffe, die ihr eigenes Konzept einer ‚radika­len Demokratie‘ umreißt: »The main question of democratic politics becomes [...] not how to eliminate power, but how to constitute forms of power which are compatible with democratic values. To acknowledge the existence of relations of power and the need to transform them, while renouncing the illusion that we could free 9 Geuss, Raymond: Philosophy and Real Politics. Princeton, NJ 2008, S. 25. 10Bei Geuss hingegen steht der Vorwurf im Mittelpunkt, Rawls’ ahistorischer Ansatz verschließe die Augen vor tatsächlich bestehenden Machtbeziehungen. 11 Mouffe, Chantal: On the Articulation between Liberalism and Democracy. In: Dies.: The Return of the Political, S. 102–116, hier S. 113. 12 Interessant sind hier Geuss’ Anmerkungen zur weiten Bedeutung von engl. power in der deutschen Übersetzung von ›Philosophy and Real Politics‹; vgl. Geuss, Raymond: Kritik der politischen Philosophie. Eine Streitschrift, Hamburg 2011, S. 43f. Er nutzt diese Reflexionen jedoch nicht zur Einführung klarer Unterscheidungen im Phänomenfeld von Macht und Gewalt. Zudem fällt auf, dass er sich in diesem Buch auf ganz unterschiedliche Machtkonzeptionen bezieht (so u.a. auf Weber, Nietzsche und Foucault). 13 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 ourselves completely from power – this is what is specific to the project that we have called ‘radical and plural democracy’. Such a project recognizes that the specificity of modern pluralist democracy – even the well-ordered one – does not reside in the absence of domination and of violence but in the establishment of a set of institutions through which they can be limited and contested.«13 Das Zitat zeigt: Bei diesem Bekenntnis zu ‚demokratischen Werten’ sollen Macht, Gewalt und Herrschaft zwar gerade nicht als Phänomene benannt werden, die aus dem Politischen verbannt werden sollten beziehungsweise überhaupt könnten. Doch geht es bei dieser Konzeption einer ‚radikalen Demokratie‘ klar um eine ‚Transformation‘ oder eine ‚Begrenzung‘ dieser Beziehungen, so dass ein bestimmtes Verständnis von Gewalt und Herrschaft im Sinne spezifischer Formen der Verletzung und Un­terdrückung ohne Frage ausgeschlossen werden muss. Mouffe plädiert zwar dafür, das Politische vom Moralischen zu trennen und die Rolle der Vernunft im Bereich des Politischen nicht zu überschätzen,14 doch sie spricht sich ebenso deutlich für eine »Ethik des Politischen« (ethics of the political) aus.15 Somit stellt sich un­weigerlich die Frage nach der Notwendigkeit einer deutlicheren Differenzierung zwischen ‚Macht’ und ‚Gewalt’ im Sinne von franz./engl. violence. Ziel dieses Beitrags ist es, dieser Frage in Auseinandersetzung mit zwei ausge­ wählten Autoren näher nachzugehen, in deren Konzeptionen Macht und deren Beziehung zu verwandten Phänomenen eine zentrale Rolle spielt: Die Kritik an einer unhinterfragten Identifikation von Macht und Gewalt steht im Zentrum von Hannah Arendts politischem Denken, eindringlich entfaltet vor allem in dem Essay ›Macht und Gewalt‹ – im Original ›On Violence‹ – aus dem Jahr 1970. Macht wird hier von Arendt als ‚Urphänomen‘ des Politischen überhaupt aufge­wiesen, Gewalt dagegen als dieser Sphäre nicht genuin zugehöriges Phänomen beschrieben. Bemerkenswerterweise hat auch Michel Foucault, welcher in seinen Untersuchungen ab den frühen siebziger Jahren dem Phänomen der Macht die Schlüs­selrolle 13 Mouffe, Chantal: Democracy, Power and ‘The Political’. In: Dies.: The Democratic Paradox. London / New York 2005, S. 17–35, hier S. 22. 14Vgl. etwa Mouffe, Chantal: On the Articulation between Liberalism and Democracy, S. 115. 15 Vgl. Mouffe, Chantal: On the Articulation between Liberalism and Democracy, S. 113f. 14 Meike Siegfried bei der Herausbildung sozialer Identitäten und Institutionen zugewiesen hat, eine dezidierte Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt beziehungsweise Macht und Herrschaft vorgenommen.16 Vor allem in seinen Vorlesungen und Texten zur ‚Gouvernementalität‘ seit Ende der siebziger Jahre hat er sich zudem im Rahmen seiner machtanalytischen Perspektive explizit auch dem Bereich des Politischen im herkömmlichen Sinne – dem Staat und staatlichen Institutionen, Regierungs­ formen und Verwaltungspraktiken – zugewandt.17 Im Folgenden soll eine vergleichende Diskussion beider Ansätze unter systema­ tischen Gesichtspunkten unternommen werden.18 Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sich im Zuge der Herausstellung der Gemeinsamkeiten und Differenzen beider Ansätze einige der zentralen Fragen und Probleme einer Un­ terscheidung zwischen Macht und Gewalt überhaupt aufdecken lassen. Es wird sich zugleich zeigen, dass in einer näheren Thematisierung von Arendts und Fou­ caults Konzeptionen eben diejenigen Grundmotive hervortreten, welche in der ak­ tuellen Bezugnahme auf den Machtbegriff bei der Kritik am Liberalismus John Rawls’ sowie anderer wichtiger Positionen der zeitgenössischen politischen Philo­ sophie besonders bedeutsam sind. Als leitende Perspektive der folgenden Überle­ gungen fungiert die Frage, inwiefern Gewalt als das Andere der Macht gedacht werden muss. Dies kann allerdings zweierlei bedeuten: Meint Gewalt das tatsäch­ lich Andere im Sinne eines der Macht äußerlichen, fremden Phänomens, so dass kein Übergang zwischen beiden möglich ist? Oder entpuppt sich Gewalt als ein 16Allerdings tut er dies erst in seinen späten Schriften; zieht man diese Texte nicht hinzu, wird ein Vergleich zwischen Arendt und Foucault zwangsläufig anders ausfallen; siehe exemplarisch Kupke, Christian: Macht und/oder Gewalt, S. 70ff. 17 Ohne allerdings die Offenlegung einer spezifischen ‚Kunst des Regierens‘ auf diesen Bereich des Politischen in traditioneller Hinsicht zu beschränken. 18Aufgrund der Fokussierung auf eine konkrete Fragestellung ist es trotz des unterschiedlichen Oeuvres der Werke der im Kern doch existenzialontologisch orientierten politischen Denkerin Arendt und dem am historisch Wandelbaren interessierten ‚Genealogen‘ Foucault möglich, die Konzeptionen beider in einen direkten Bezug zueinander zu setzen. Dabei müssen mit Blick auf den hier zur Verfügung stehenden Raum jedoch wichtige Differenzen unthematisiert bleiben, z.B. dass Foucault unterschiedliche Typen von Macht (Souveränitätsmacht, Disziplinarmacht usw.) unterscheidet, während bei Arendt eine solche Differenzierung ausbleibt. Auch wird bewusst ver­zichtet auf die naheliegende Möglichkeit, den Gegensatz zwischen einem handlungstheoretischen und einem systemtheoretischen Ansatz zur Kontrastierung beider Entwürfe heranzuziehen. 15 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Phänomen, in das Macht jederzeit ‚umkippen’ kann, und welches somit mögli­ cherweise nicht immer trennscharf von der Macht abzugrenzen ist? Der Grundansatz bei Arendt und Foucault: Abschied vom Modell des ›Leviathan‹ Zunächst soll die gemeinsame Grundausrichtung der ‚Machttheorien‘ von Arendt und Foucault skizziert werden. Sie lässt sich treffend mit der von Foucault aus­ gegebenen Parole betiteln, in machtanalytischer Hinsicht »dem König den Kopf ab[zu]schlagen«19. Gemeint ist die klare Absage an eine Orientierung am Modell der Souveränität beziehungsweise der juridischen Machtkonzeption, welche sowohl Foucault als auch Arendt in besonders eindringlicher Form im Entwurf des ›Leviathan‹ von Thomas Hobbes realisiert sehen.20 So kritisiert Arendt in ›Macht und Gewalt‹ scharf die – ihrer Ansicht nach im linken wie im rechten Lager gleichermaßen verbreitete – Identifizierung von Macht und Staatsgewalt, bei der die Gewalt im Sinne des Krieges nur das auf die Spitze ge­triebene Phänomen der Macht darstelle. Da dem Staat die Herrschaft zukomme, werde hier laut Arendt zugleich Macht mit Herrschaft gleichgesetzt, letztlich sei Macht so mit dem Zwang durch Befehl und Gesetz identifiziert.21 Verantwortlich macht sie für diese, ihrer Meinung nach, verhängnisvolle Ver­knüpfung von Macht und Staat, Gewalt, Befehl und Gesetz vornehmlich das Auf­kommen der modernen Idee des Nationalstaats; sie nennt jedoch als prägende Einflüsse auch die schon in der Antike begründete Identifikation von Staatsfor­men mit Herrschaftsformen so­ wie die jüdisch-christliche Tradition des Zusam­menschlusses der Idee der Gottes­ herrschaft mit dem Imperativ von Gebot und Gesetz.22 19 Gespräch mit Michel Foucault. In: Foucault, Michel: Analytik der Macht, S. 83–107, hier S. 95. 20Nach Arendt hat Hobbes dem Phänomen der Pluralität Eingang in die politische Philosophie der Neuzeit verschafft, doch nur, um es sogleich aus der Sphäre der Politik zu verbannen; vgl. exem­plarisch Arendt, Hannah: Denktagebuch 1950–1973. Erster Band. München / Zürich 2002, S. 81 und 161. 21 Vgl. Arendt, Hannah: Macht und Gewalt. München / Zürich 162005, S. 36ff. 22Vgl. Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 39f. 16 Meike Siegfried Auch Michel Foucault plädiert hinsichtlich des Grundansatzes seiner Machtanaly­ tik deutlich für die Ablösung der Orientierung am Begriffs- und Phänomenfeld von Recht, Gesetz, Souveränität und Staat. In einem Interview von 1976 heißt es: »Der Souverän, das Gesetz, die Untersagung, das alles bildete ein Repräsen­ ta­tionssystem der Macht, das anschließend von den Theorien des Rechts weiterge­geben wurde: Die politische Theorie ist von der Gestalt des Souve­ räns besessen geblieben. [...] Was wir brauchen, ist eine politische Philoso­ phie, die nicht um das Problem der Souveränität, also des Gesetzes, also der Untersagung herum aufge­baut ist; man muss dem König den Kopf abschla­ gen, und in der politischen Theo­rie hat man das noch nicht getan.«23 Indem Arendt und Foucault sich vom Modell des ›Leviathan‹ distanzieren, verab­ schieden sie konsequenterweise ein monistisches und zentralistisches Konzept von Macht und verknüpfen diese vielmehr unmittelbar mit dem Phänomen der Pluralität. Macht entpuppt sich in beiden theoretischen Ansätzen als relational, flüchtig und vom Wesen her zunächst produktiv. Das bedeutet weiterhin: Macht denken beide nicht als etwas, das immer ‚von oben nach unten‘ wirkt, ebenso we­ nig als etwas, das sich besitzen, speichern, zerteilen und vererben ließe wie ein erwerbbares (materielles) Gut. Arendts Verständnis von Macht und Gewalt Bei Arendt konkretisieren sich diese Bestimmungen in einem Begriff von Macht, welcher ganz auf den Ursprung dieses Phänomens konzentriert ist und diesen in der menschlichen Fähigkeit ausmacht, »nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln«24. Gemeinsames Handeln und sprachliche Artikulation, als Erhellung und Interpretation konkreten Handelns, sind für Arendt zentrale Phänomene einer Sphäre des Politischen, die gerade nicht identifiziert werden darf mit den Ver­ handlungen von Berufspolitikern und den berechnenden Kalkulationen von Ex­ perten. Vielmehr begreift Arendt das Handeln und Sprechen – als Urphänomene des Politischen – als Tätigkeiten, welche ihren Zweck in einem spezifischen Sinne 23Gespräch mit Michel Foucault, S. 95. 24Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 45. 17 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 in sich selbst tragen, weil es hier nicht um die Festlegung der am besten geeigne­ ten Mittel für bereits fest umrissene Zwecke geht, sondern weil Zweck- und Sinn­ haftigkeit verschiedener möglicher Weisen gemeinsamen Lebens selbst erst zur Diskussion stehen.25 ‚Gewalt‘ dagegen ist nach Arendt gerade dadurch gekennzeichnet, Werkzeuge zu gebrauchen und wie alle Prozesse des Herstellens bestimmter Endprodukte oder Endzustände in Zweck-Mittel-Kategorien fassbar zu sein. Anders als Macht, wel­ che somit nach Arendt auf der Einigung, dem Einvernehmen handelnder und spre­chender Menschen beruht und immer wieder neu entsteht und vergeht, lässt sich das Potential von Gewalt durchaus durch Anhäufung bestimmter Güter steigern, nämlich durch eine Akkumulation der Mittel, mit denen sich das gewählte Ziel am besten erreichen lässt. Arendt: »Zu den entscheidenden Unterschieden zwischen Macht und Gewalt gehört, daß Macht immer von Zahlen abhängt, während die Gewalt bis zu einem gewissen Grade von Zahlen unabhängig ist, weil sie sich auf Werkzeuge verläßt.«26 Während Arendt Macht also vom Modell einer konsensorientierten Verständigung über Formen des Gemeinschaftslebens her denkt, versteht sie Gewalt wesentlich als instrumentelles Durchsetzen von Endzwecken.27 Das bedeutet schließlich: »Macht und Gewalt sind Gegensätze: wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden.«28 Entsprechend distanziert sich Arendt kategorisch von Mo­ dellen, welche beide Phänomene als Stufen eines Kontinuums denken: 25Vom Handeln in idealtypischer Weise unterschieden werden von Arendt in ›Vita activa‹ bekanntlich ‚Arbeiten‘ und ‚Herstellen‘; ersteres ist nach Arendt eingebunden in einen biologisch bestimmten Lebenszusammenhang, letzteres meint alle Tätigkeiten, in denen es um die auf Zweckdienlichkeit der Produkte abzielende Einrichtung einer beständigen Umwelt geht. 26Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 43. 27 Sie unterscheidet zudem noch zwischen ‚Macht‘ und ‚Stärke‘ sowie ‚Autorität‘ und ‚Gewalt‘ und ‚Terror‘ (als Basis totaler Herrschaft); Stärke komme als individuelle Eigenschaft immer einem Einzelnen zu; Autorität versteht Arendt als Ausdruck fragloser Akzeptation bestehender Macht­verhältnisse. Terror zerstöre durch eine konsequente Atomisierung der Gesellschaft jegliche Basis für mögliche Machtbildungen; vgl. Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 45f. und 56f. 28Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 57. 18 Meike Siegfried »Zwischen Macht und Gewalt gibt es keine quantitativen oder qualitativen Übergänge; man kann weder die Macht aus der Gewalt noch die Gewalt aus der Macht ableiten, weder die Macht als den sanften Modus der Gewalt noch die Gewalt als die eklatanteste Manifestation der Macht verstehen.«29 Um den besonderen Ansatz bei Arendt im Kontext begrifflicher Unterschei­dungen der gegenwärtigen Debatte um das Phänomen der Macht noch präziser zu fassen, sei verwiesen auf die seit den siebziger Jahren in der politischen Theorie eta­blierte Differenzierung zwischen ‚power over‘ und ‚power to‘. Ein Konzept, wel­ches Macht konsequent als ‚power over‘ denkt, wurde mit Max Webers berühmter Definition bereits skizziert: Macht bedeutet hier, Macht über andere einzelne Per­sonen oder Gruppen auszuüben, die eigenen Intentionen gegenüber anderen durchzusetzen. Es ist offenkundig, dass Arendt Macht nicht als ‚power over‘ denkt – vielmehr lässt sich ihre Position durchaus sinnvoll als Beschreibung von Macht als ‚power to‘ verstehen: Macht als Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln einer Gruppe – als Vermögen, gemeinschaftlich Welt zu gestalten.30 Welche historischen politischen und ideengeschichtlichen Entwicklungen einer Identifizierung von Macht und Herrschaft im Sinne von Zwangsgewalt nach Arendt zugearbeitet haben, wurde bereits deutlich. Wenn sie ihren eigenen Macht­ begriff präsentiert, dann verweist sie allerdings ebenfalls auf eine bestimmte Tra­ ditionslinie politischen Denkens sowie auf konkrete politische Einrichtungen als Vorbilder: auf die athenische polis und auf die civitas der Römer, welche die Re­ volutionäre im 18. Jahrhundert inspiriert habe bei der Suche nach möglichen Ge­ staltungsformen einer neu zu konstituierenden Republik.31 29Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 58. 30Zu einer Deutung von Arendts Modell mit Bezug auf die Unterscheidung von ‚power over‘ und ‚power to‘ siehe Göhler, Gerhard: Macht. In: Göhler, Gerhard / Iser, Mattias / Kerner, Ina (Hrsg.): Politische Theorie. 25 umkämpfte Begriffe zur Einführung. Wiesbaden 2 2011, S. 224–240. Wichtig ist jedoch Folgendes: Vor dem Hintergrund der unhintergehbaren Pluralität bei Arendt erscheint es nicht überzeugend, Arendts Machtbegriff fraglos mit einem Verständnis von ‚power to‘ zu identifizieren, der die relationale Verfasstheit von Macht kategorisch ausblendet. Im übernächsten Abschnitt wird diese Problematik eigens aufgegriffen und vertieft. 31 Vgl. Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 41. 19 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Foucaults Differenzierung zwischen Macht, Gewalt und Herrschaft Wie Arendt betont nun auch Foucault in seinen späten Texten im Umfeld der Un­ tersuchungen zur Gouvernementalität, dass die Urform von Macht keine Gewalt im Sinne des Zwingens oder gar Zerstörens darstelle. Foucault: »Gewaltbeziehun­ gen wirken auf Körper und Dinge ein. Sie zwingen, beugen, brechen, zerstören. Sie schneiden alle Möglichkeiten ab.«32 Macht ist jedoch laut Foucault auch nicht wesenhaft als Ausdruck eines Konsenses zu fassen, auch wenn ein Konsens durchaus Voraussetzung dafür sein könne, dass bestimmte Machtbeziehungen zu­stande kämen.33 Machtbeziehungen im grundlegenden Sinne sind nach Foucault vielmehr beschreibbar als eine »handelnde Einwirkung auf Handeln«, Macht sei ein »auf Handeln gerichtetes Handeln«.34 In der Idee des ‚Regierens‘ im weiten Sinne der Anleitung/Führung, in ihrem historischen Ursprung beschreibbar als ‚Pastoralmacht‘ (pouvoir pastoral), findet Foucault diese Idee einer nicht gewalt­sam herrschenden Macht besonders deutlich verkörpert. Der andere, dies stellt Foucault dabei deutlich heraus, muss im Rahmen eines sol­chen Verständnisses von Macht als freies Subjekt begriffen werden. Das heißt konkret: Die Beziehung zwischen Herr und Sklave ist gerade keine Machtbezie­ hung, denn hier sei jegliche Dynamik eines gegenseitigen Aufeinander-Einwir­ kenkönnens erstarrt. Foucault: »Wo die Bedingungen des Handelns vollständig determiniert sind, kann es keine Machtbeziehung geben. [...] Macht und Freiheit schließen einander also nicht aus (wo Macht ist, kann es keine Freiheit geben). Ihr Verhältnis ist weitaus komplexer. In diesem Verhältnis ist Freiheit die Voraussetzung für Macht (als Vorbedingung, insofern Freiheit vorhanden sein muss, damit Macht ausgeübt werden kann, und auch als dauerhafte Bedingung, denn wenn die Freiheit sich der über sie ausgeübten Macht entzöge, verschwände 32Foucault, Michel: Subjekt und Macht. In: Ders.: Analytik der Macht, S. 240–263, hier S. 255. 33Vgl. Foucault, Michel: Politik und Ethik: ein Interview. In: Ders.: Analytik der Macht, S. 264–271, hier S. 269ff. 34Vgl. Foucault, Michel: Subjekt und Macht, S. 255f. 20 Meike Siegfried im selben Zuge die Macht und müsste bei reinem Zwang oder schlichter Ge­ walt Zuflucht suchen).«35 Mit dem Phänomen einer totalen Verhärtung bestimmter Machtkon­stellationen und der Blockade jeglicher Möglichkeit spontaner Veränderungen identifiziert Foucault nun explizit das Wesen von ‚Herrschaft‘: Diese kennzeichne eine »glo­ bale Machtstruktur«36, in welcher der Freiraum des Handelns minimiert sei. Insgesamt distanziert sich Foucault mit dieser Auffassung von Macht als einer ge­waltfreien Interaktionsbeziehung im Sinne des Einwirkens auf das Handeln freier Handelnder deutlich von seinem früheren, stark durch Nietzsches ‚Wille zur Macht‘ inspirierten Machtbegriff, der versuchte, Macht ganz durch das Modell von Kampf und Krieg zu fassen.37 Unter Bezugnahme auf die bereits vorgestellte Unterscheidung von ‚power over‘ und ‚power to‘ ließe sich sagen: Foucault distanziert sich nicht grundsätzlich von der Orientierung an Macht als ‚power over‘, jedoch eröffnet sein Ansatz in den späten Schriften – vor allem durch die Fokussierung auf die unterschiedlichen Dimensionen und Zusammenhänge des Sich-selbst-Regierens und Regiertwerdens – die Möglichkeit, den Blick auch auf Phänomene der Weltgestaltung und Identitätsstiftung zu lenken, die sich sinnvoll mit dem Konzept der Selbstermächtigung als ‚power to‘ beschreiben lassen. Macht als ‚zwangloser Zwang‘? Nach der Herausarbeitung der wesentlichen Akzentsetzungen bei der Differen­ zierung zwischen Macht und Gewalt bei Arendt und Foucault lässt sich folgendes 35Foucault, Michel: Subjekt und Macht, S. 257. Diese ‚Freiheit’ kann jedoch bei Foucault konse­quenterweise kein universelles Wesensmerkmal menschlicher Existenz meinen, sondern Foucault weist vielmehr nach, inwiefern das ‚freie‘ Subjekt im Kontext konkreter historisch gewachsener Regierungstechnologien gleichsam ‚geboren‘ wurde; vgl. dazu auch Richter, Mathias: Freiheit und Macht. Perspektiven kritischer Gesellschaftstheorie – der Humanismusstreit zwischen Sartre und Foucault. Bielefeld 2011, S. 420ff. und 439. 36Foucault, Michel: Subjekt und Macht, S. 263. 37Foucault schreibt noch 1976: »Auf was man sich meiner Meinung nach beziehen muß, ist nicht das große Modell der Sprache und der Zeichen, sondern das des Krieges und der Schlacht.« (Fou­cault, Michel: Wahrheit und Macht. In: Ders.: Dispositive der Macht. Berlin 1978, S. 21–54, hier S. 29) In der Vorlesung ›In Verteidigung der Gesellschaft‹ unterzieht Foucault schließlich seine eigene Perspektive einer ‚genealogischen‘ Betrachtung, indem er das historische Entstehen des Konflikt- und Kriegsmodells untersucht. 21 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Zwischenfazit ziehen, das sogleich in eine erste Problematisierung münden soll: In der Abgrenzung der Macht von der Gewalt betonen Foucault und Arendt beide einen engen Zusammenhang zwischen Macht und Freiheit (freiem Handeln). Bei beiden Denkern wird jedoch Macht offenkundig mit dem Potential zur Ergreifung bestimmter Möglichkeiten beziehungsweise – bei Foucault – als Gestaltung eines konkreten Handlungsspielraums begriffen und somit ist ein Moment der Exklusion, nämlich des Ausschlusses anderer Handlungsmöglichkeiten, dem Machtbegriff zwangs­läufig inhärent. Foucault schließt mit seiner Definition des auf ‚Handeln gerich­teten Handelns‘ zudem das Moment der unmittelbaren Einwirkung explizit ein, wenn auch als ein solches, das sich vom puren Bezwingen des anderen gerade unterscheiden soll. Es stellt sich nun jedoch die Frage, wie ein solcher Ausschluss, wie ein solches Einwirken erklärt werden kann ohne den Rückgriff auf das Phänomen des Zwan­ ges, das schließlich auch in einer subtilen Beschneidung von Möglichkeiten ge­ sehen werden kann. Lässt sich so etwas wie ein ‚zwangloser Zwang‘ aufzeigen, welcher auswählt, ausschließt, formt und wirkt, ohne als Gewalteinwirkung ver­ standen werden zu dürfen? Anders gefragt: Lässt sich aus einem Verständnis von Macht als ‚power to‘ die Frage nach dem Wirken von Macht als zwingender oder exkludierender ‚power over‘ – als nicht zu leugnender ‚Realität’ eines durch Plu­ ralität gekennzeichneten Politischen – tatsächlich vollkommen ausklammern? Be­sonders mit Blick auf Arendts Konzeption ist diese Frage von großer Bedeu­ tung, da gerade das Modell des Konsenses etlichen der aktuellen Verfechter einer machttheoretisch orientierten politischen Philosophie verdächtig erscheint, weil es ihrer Ansicht nach Macht, die sie bewusst vom Modell des Streites her denken, gerade zu eliminieren sucht. Entsprechend werfen sie dem Konsensmodell ge­nerell vor, die in ihrer Sicht ganz apolitische Idee eines solchen ‚zwanglosen Zwanges‘ – prominent artikuliert bei Jürgen Habermas – in den Mittelpunkt des politischen Denkens zu stellen.38 38Vgl. Mouffe, Chantal: Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy. In: Dies.: The Democratic Paradox, S. 36–59, hier S. 45ff. Siehe auch Laclau, Ernesto: Community and its Paradoxes: Richard Rorty’s ‘Liberal Utopia’. In: Ders.: Emancipation(s). London / New York, S. 105–124, hier S. 112 und 122. 22 Meike Siegfried Doch was sagt Arendt selbst zur konkreten Herausbildung des Einvernehmens zwischen den Handelnden, zwischen denen sich mit einem solchen Einvernehmen Macht bilden soll und wieder zerfällt, wenn die Einigung zerbricht? Wie kommt der Konsens nach Arendt überhaupt zustande und warum stellt der Extremfall der Macht, den sie als Situation des »Alle gegen Einen«39 beschreibt, nicht zugleich den Extremfall einer möglichen Gewaltbeziehung dar? Es ist offenkundig, dass im Rahmen der Arendt’schen Konzeption der Prozess einer ungehinderten Meinungsbildung für die Ausbildung eines Machtpotentials zentral sein muss. Vorausgesetzt wird die Existenz eines öffentlichen Raumes, in dem engagiert und unverstellt kommuniziert wird, und zwar in einer Weise, bei der es nicht nur um das Verfolgen von Eigeninteressen geht, sondern in der viel­ mehr die Grundideen eines gemeinsam zu realisierenden Gemeinschaftslebens reflektiert und ausgehandelt werden. Nicht vereinbar mit diesem kommunikativen Machtbegriff40 ist somit die Vorstellung der Sprache als eines wesentlich rhetori­ schen Instruments – Arendt muss Manipulation durch ein besonders öffentlich­ keitswirksames Sprechen aus der Sphäre des eigentlich Politischen ausschließen, ebenso die Anwendung reiner Zweckrationalität. Doch dies bedeutet umgekehrt nicht, dass sie diesen Raum als Bühne für eine zu sich selbst kommende über­ historische Vernunft begreift, welche Wahrheiten eröffnet, die von allen vernünf­ tig denkenden Menschen eingesehen werden müssten. In dem Essay ›Wahrheit und Politik‹ von 1967 betont Arendt die tyrannischen Züge, welche in jeder po­ litischen Konzeption stecken, die davon ausgeht, dass letzte Wahrheiten – welche im Grunde auch einsam errungen werden könnten – den Bestand des Politischen ausmachten.41 So ist ihre Konzeption der Meinungsbildung jedoch von auffälligen Spannungen durchzogen: Einerseits betont Arendt stets das Faktum der Pluralität in der Sphäre des Politischen, welches sich konkret in einer irreduziblen Meinungsvielfalt nie­ 39Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 43. Der Extremfall der Gewalt nach Arendt: »Einer gegen Alle.« 40Als einen solchen macht ihn Habermas im Horizont seines eigenen Ansatzes produktiv; vgl. Habermas, Jürgen: Hannah Arendts Begriff der Macht. In: Ders.: Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische Philosophen. Stuttgart 2006, S. 103–126. 41Vgl. Arendt, Hannah: Wahrheit und Politik. In: Hannah Arendt und Patrizia Nanz über Wahrheit und Politik. Berlin 2006, S. 7–62, hier S. 14 und 19. 23 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 derschlage. Auf der anderen Seite setzt sie große Hoffnungen auf Einbildungs­kraft und Urteilskraft als Vermögen, welche es ermöglichten, aus den unterschied­lichen Standpunkten der vielen doch eine »relativ unparteiische Gesamtsicht« ermitteln zu können.42 Sie setzt auf die Diskursivität der Meinungsbildung sowie auf die Kreativität des Erschließens neuer Standpunkte und schließt Letztbegrün­dungen aus dem Politischen aus,43 meint jedoch einen Halt zu sehen in der Bezug­nahme auf die sogenannten ‚Tatsachenwahrheiten‘, welche bezeugen sollen, dass Wirk­ lichkeit nicht vollends als Produkt widerstreitender Interpretationen verstan­den werden dürfe.44 Sie gesteht jedoch in ›Wahrheit und Politik‹ auch indirekt ein, dass diese Tatsachenwahrheiten, die bloßes Faktenwissen darstellen, gar nicht den Kern dessen ausmachen, was ‚echte‘ politische Diskussionen auszeichne.45 Tat­sächlich denkt sie diese ja, wie gesehen, als Meinungsbildungen über Fragen, wie überhaupt gemeinsam zu leben sei. Hier geht es also letztlich um gleichsam ‚abso­lute‘ Leitideen wie Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit et cetera und nicht primär um De­batten über konkrete gewesene Ereignisse, um Einschätzungen historischer Bege­benheiten.46 Es kann somit festgehalten werden, dass Arendts Modell eines Konsenses als Ur­ sprung von Macht nicht mit der Idee einer totalen Befriedung des Politischen gleichzusetzen ist, weil der Konsens nicht auf die Harmonisierung aller mit allen abzielen kann, sondern sich als Phänomen beständig neuer Gruppenbildungen er­weist. Arendts Entwurf des Politischen postuliert also nicht völlige Konfliktfrei­ heit, er tendiert jedoch dazu, die Momente der Kontingenz sowie der Exklusions­ kraft der jeweiligen Konsensbildungen nicht deutlich herauszuarbeiten, oder 42Vgl. Arendt, Hannah: Wahrheit und Politik, S. 27ff. Zur zentralen Bedeutung der Urteilskraft für Arendts Konzeption siehe Meints, Waltraud: Partei ergreifen im Interesse der Welt. Eine Studie zur politi­schen Urteilskraft im Denken Hannah Arendts. Bielefeld 2011. 43Wichtig sind hier Arendts Bestimmungen des Handelns als Tätigkeit, die vorhersagbare Prozes­se durchbricht, sowie ihr Verständnis von Freiheit als Spontaneität des (neu) Anfangenkönnens; siehe Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 35 sowie Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München / Zürich 72008, S. 215ff. 44Vgl. Arendt, Hannah: Wahrheit und Politik, S. 23f. 45Vgl. Arendt, Hannah: Wahrheit und Politik, S. 61. 46Vgl. zur ‚Selbstzweckhaftigkeit‘ dieser Ideale und den Gefahren, die entstehen, wenn man ver­sucht, sie im Sinne eindeutig bestimmbarer Endziele ‚herzustellen‘, Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 53. 24 Meike Siegfried besser: Er stellt diese Momente nicht in den Vordergrund. Lediglich an einigen Stellen wird deutlich, dass auch im Bereich der Machtausbildung mit Arendt von einer – mehr oder weniger subtilen – Zwangsausübung gesprochen werden kann (beziehungsweise in bestimmten Situationen gesprochen werden muss), welche keine Legi­timation mehr in einer letzten Wahrheit finden kann.47 Das Modell von Foucault betont hingegen gerade die unhintergehbare Vorstruk­ turiertheit einer Steuerung und Leitung konkreter Kommunikationsereignisse und Handlungen durch bereits bestehende Machtbeziehungen. Anders als Arendt sie­delt er Macht im Sinne auch der begrenzenden und ausschließenden Kraft explizit schon im Kern der Prozesse von Meinungsbildungen selbst an. Freiheit entpuppt sich hier sehr viel deutlicher als bei Arendt als Freiheit in bestimmten Horizonten, als Agieren in konkreten, bereits strukturierten Handlungsspielräumen.48 Entspre­chend bemerkt er zur Idee einer kommunikativen Vernunft im Horizont von Ha­bermas’ Diskursethik: »Die Vorstellung, dass es einen Zustand der Kommunika­tion geben kann, worin die Wahrheitsspiele ohne Hindernisse, Beschränkungen und Zwangseffekte zirkulieren können, scheint mir zur Ordnung der Utopie zu ge­hören.«49 Die Unbestimmbarkeit des Umschlagpunktes von Macht in Gewalt Nun stellt sich jedoch angesichts dieser Absage Foucaults an eine Handlungs- und Redefreiheit ohne Hindernisse und Barrieren die Frage, wie er dann überhaupt noch meint, die Umschlagpunkte von Machtbeziehungen in Gewalt- oder Herr­ schaftsverhältnisse klar bestimmen zu können. Wo verläuft die Grenze zum Zwang im Sinne der tatsächlichen gewaltsamen Beschneidung von Freiheit, wo diejenige zur Herrschaft im Sinne einer stabilen Blockade von Handlungsmög­lichkeiten?50 47Siehe folgende Bemerkung Arendts: »Ungeteilte und unkontrollierte Macht kann eine Mei­nungsuniformität erzeugen, die kaum weniger ›zwingend‹ ist als gewalttätige Unterdrückung. Aber das heißt nicht, daß Gewalt und Macht dasselbe sind.« (Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 43). 48Doch auch bei Arendt findet sich jeder Mensch in einem bereits bestehenden »Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten« wieder; vgl. Arendt, Hannah: Vita activa, S. 222ff. 49Foucault, Michel: Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit. In: Ders.: Analytik der Macht, S. 274–300, hier S. 296. 50In dem Gespräch ›Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit‹ präsentiert Fou- 25 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Tatsächlich legt Foucault an einigen Stellen nahe, dass er Gewalt vornehmlich als physischen Zwang versteht, der auf Körper einwirkt. Es wäre aber angesichts des in Foucaults Analysen sich offenbarenden Verständnisses von Subjektivität in keiner Weise überzeugend, hier von einer Aufspaltung des Sub­jekts in Körper und Seele auszugehen und Gewalt lediglich auf die Niederwerfung des Körpers zu beziehen. Vielleicht lässt sich ein Weg zu einem klareren Verständnis eines Kriteriums für den Umschlag von Macht in Gewalt oder Herrschaft bei Foucault aufzeigen, wenn man danach fragt, welche konkreten politischen Organisationsformen er vor dem Hintergrund seines eigenen Ansatzes favorisieren müsste. Nun hat Foucault selbst seinen Ansatz gerade nicht mit normativ gehaltvollen Beschreibungen idealer Re­ gierungsformen verbunden. Entsprechend gibt es hier einen Interpretationsspiel­ raum, der von der Forschung ganz unterschiedlich ausgefüllt wird. So meinen einige Foucault-Forscher, dass Foucault den im Rahmen seiner Analysen des Li­ beralismus, speziell des Neo-Liberalismus im 20. Jahrhundert, untersuchten An­ sätzen eine große Sympathie entgegenbringen müsste, da hier schließlich die Idee eines minimalen Regierens tragendes Prinzip sei.51 Tatsächlich präsentiert Fou­ cault die Leitidee einer Organisation der ‚Mächte‘, welche deren Dynamik achtet, als das Ziel, »innerhalb der Machtspiele mit dem Minimum an Herrschaft zu spie­ len«52. Doch zielt dies nicht zwangsläufig auf einen Entwurf ab, der traditionellen cault fol­gende drei Ebenen: strategische Beziehungen, Regierungstechniken und Herrschaftszustände; vgl. Foucault, Michel: Die Ethik der Sorge um sich, S. 298. Durch diese Dreiteilung wird meines Erachtens die Frage nach der Möglichkeit klarer Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen Praktiken/Zuständen jedoch nicht beantwortet. Ebenfalls skeptisch äußert sich dazu Lemke (vgl. Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität. Berlin / Hamburg 1997, S. 309f.). 51 Eine solche Deutung wird u.a. nahegelegt in Sarasin, Philipp: Wie weiter mit Michel Foucault? Hrsg. vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Hamburg 2008. Ebenso meint Kögler, Fou­cault plädiere in seinen späten Schriften zu einer ‚Ästhetik der Existenz‘ für einen »radikalen Liberalismus« (Kögler, Hans Herbert: Fröhliche Subjektivität. Historische Ethik und dreifache On­tologie beim späten Foucault. In: Erdmann, Eva / Forst, Rainer / Honneth, Axel (Hrsg.): Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung. Frankfurt a.M. 1990, S. 202–226, hier S. 222). Kri­tisch ge­genüber solchen Deutungen dagegen Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Ver­nunft, S. 296ff. 52Foucault, Michel: Die Ethik der Sorge um sich, S. 297. 26 Meike Siegfried Vorstellungen von durch Eigeninteressen motivierter Konkurrenz zwischen Sub­ jekten folgt. Bemerkenswerterweise eröffnet Foucaults eigenes politisches Engagement, das schließlich sehr intensiv und vielfältig war, wiederum die Möglichkeit, eine große Nähe viel eher zu den Denkern zu sehen, welche – wie Arendt und Habermas – dem Phänomen der Öffentlichkeit als Ort echter Debatten zutrauen, eine Unter­ scheidung zwischen Macht- und Gewaltverhältnissen begründen zu können. So zeichnet viele von Foucaults politischen Aktivitäten das Ziel aus, Menschen am Rande der Gesellschaft oder Menschen mit wenig Einfluss auf dieje­nigen Fakto­ ren, welche politische Entscheidungsprozesse wesentlich mitbestimmen, die Mög­ lichkeit zu geben, selbst ihre Stimme zu erheben und ihren Standpunkt deutlich zu machen. Zwar ist die Vorstellung einer »vollkommen transparenten Kommunika­ tion« für ihn eine nicht zu realisierende »Utopie«,53 die Bereitstellung eines Fo­ rums für einen möglichst ‚freien‘ Austausch der Meinungen scheint für Foucault aber dennoch ein geeignetes Mittel gewesen zu sein, die Dynamik der Machtbe­ ziehungen und die Möglichkeit beständiger Relationsverschiebungen aufrechtzu­ erhalten.54 Sehr viel deutlicher als Foucault hat sich jedoch Hannah Arendt der Frage nach der Vereinbarkeit einer konkreten Gestaltung politischer Systeme, also einer be­ stimmten Organisation politischer ‚Gewalten‘, mit dem flüchtigen, dynamischen Phänomen der Macht gewidmet. Die Frage nach einem Moment des ‚Umschlags‘ von Macht in Gewalt scheint sich hinsichtlich der Konzeption Arendts nicht stellen zu lassen, betont sie selbst schließlich die Unmöglichkeit eines solchen. Doch möglicherweise entpuppt sich die Arendt’sche Strenge der Differenzierung zwischen Macht und Gewalt auch im Horizont der Diskussion konkreter politi­scher Ordnungen als problematisierbar. Vor dem Hintergrund ihres eigenen Ansatzes muss sie freilich deutlich unterschei­ den zwi­schen der Sphäre des Politischen als Bereich des gemeinsamen Handelns und Sprechens und der Politik im engen Sinne, wo dieser Bereich ursprünglicher 53Vgl. ebd. 54Vgl. exemplarisch Thomas Lemkes Ausführungen zu Foucaults Engagement für die G.I.P (Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Vernunft, S. 62ff.). 27 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Macht bereits verlassen wurde: »Alle politischen Institutionen sind Manifestatio­ nen und Materialisationen von Macht«55, heißt es. Diese Behauptung ist jedoch zweideutig: Einmal benennt sie ganz klar die unhintergehbare Erstarrung der ur­ sprünglich flüchtigen Macht, die sich zwischen den Menschen bildete, zu einem in sich klar strukturierten System. Die grundsätzlichen Elemente der Gewalt in ihrer Nähe zum Herstellen – der Horizont umrissener Zwecke, das strategische Rech­ nen mit Ressourcen und Mitteln – sind aus diesem Gebilde, das organisiert und verwaltet, nicht wegzudenken. Andererseits lässt sich aus der Beschreibung der politischen Institutionen als ‚Manifestationen‘ von Macht auch Arendts Basis für die Beurteilung bestimmter politischer Systeme ableiten: Die Institutionen selbst »erstarren und verfallen« nach Arendt, und das tun sie ihrer Konzeption nach zu Recht, »sobald die lebendige Macht des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht«56. Ihr Ideal einer politischen Organisation setzt dementsprechend auf die Faktoren einer möglichst großen Bürgerbeteiligung und einer klaren Dezentralisation von Macht im traditionellen Sinne, also auf eine föderalistische Struktur. Eine Form der Regierung, bei der es vornehmlich um die Garantie negativer Freiheiten für die Bürger geht, lässt sich nach Arendt entsprechend nicht als echte ‚Bewahrung‘ kommunikativer Macht als Ursprungsmoment legitimer politischer Institutio­nen begreifen. Sie selbst hat sich in ihren Schriften bekanntlich mehrfach positiv für ein Rätemodell ausgesprochen, als Vorbild hat sie dabei vor allem die townhall meetings der Gründerzeit der Vereinigten Staaten von Amerika im Blick.57 Nun lässt sich jedoch im direkten Rückgriff auf die Diskussion des Konsensmo­ dells bei Arendt zeigen, dass eine kategorische Scheidung zwischen dem Politi­ schen mit seinem Schlüsselbe­griff der Macht und der Politik, in deren Sphäre die der Gewalt zugehörigen Phänomene zu verorten sind, nicht wenig problematisch ist.58 So hat die nähere Thematisierung von Arendts Idee des Einvernehmens 55Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 42. 56Ebd. 57Vgl. Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 25, sowie Dies.: Über die Revolution. München / Zürich 2011, S. 302ff. Siehe zu Arendts Diskussion verschiedener Typen von politischer Herrschaft Becker, Michael: Die Eigensinnigkeit des Politischen. Hannah Arendt über Macht und Herrschaft. In: Imbusch, Peter (Hrsg.): Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Konzep­tionen und Theorien. Opladen 1998, S. 167–181. 58Problematisch ist ebenfalls, dass Arendt die Debatten in der Sphäre des Politischen offenkundig von den konkreten Fragen einer Umsetzung der verhandelten Ziele isoliert. 28 Meike Siegfried Han­delnder gezeigt, dass das Moment des zumindest potentiellen Konfliktes hier nicht ausgeschlossen ist, denn der Konsens entsteht immer zwischen Angehörigen einer bestimmten Gruppe. Wenn der Konsens also gerade nicht die Übereinkunft aller Menschen einer Gemeinschaft meint, muss dann aber nicht immer schon ein fester Rahmen den Umgang der unterschiedlichen Gruppierungen untereinander regeln und dafür sorgen, dass er sich nicht kriegerisch vollzieht? So verweist Arendt selbst an etlichen Stellen auf die Einrichtung der Gewaltenteilung als Garantie für ein lebendiges, funktionierendes Zusammenspiel der Mächte im Staat sowie auf das Modell des Vertrags als Sicherung eines nicht-kriegerischen Mitund Gegen­einanders unterschiedlicher Perspektiven auf globaler Ebene.59 Da das Konsens-Modell von Arendt letztlich streng genommen immer von einer Vielzahl von ‚Mächten‘ ausgehen muss, scheint es somit sinnvoll, eine grundlegende Orga­ nisiertheit dieser ‚Mächte’ als Voraussetzung ihres Funktionierens als ‚Mächte‘ anzusetzen.60 Letztlich gesteht Arendt selbst ein, dass die von ihr so strikt voneinander ge­ trennten Phänomene Macht und Gewalt selten in Reinform aufträten; meist seien sie vielmehr auf bestimmte Art und Weise miteinander verbunden. So behauptet sie: »Auch Macht und Gewalt treten gewöhnlich [...] kombiniert auf und sind nur in extremen Fällen in ihrer reinen Gestalt anzutreffen«61. Dagegen scheint es frag­lich, ob sich bei Foucault von der Möglichkeit einer ‚Kombination‘ von Macht und Gewalt oder Macht und Herrschaft sprechen ließe, denn dies setzte ja voraus, Es scheint oft, als be­trachte sie Fragen der sozialen Gerechtigkeit als bloß administrative Angelegenheiten, welche ganz in den Bereich des technisch-bürokratischen Herstellens fielen. Es erscheint jedoch plausib­ler, diese Sphären weniger streng voneinander zu trennen, als Arendt dies tut. Siehe dazu die Ausführungen bei R. Jaeggi, die Arendts Grenzziehung zwischen dem Politischen und dem Sozia­len nicht auf streng voneinander geschiedene Gegenstandsbereiche bezieht, sondern vielmehr auf Weisen der Behandlung und Thematisierung bestimmter Fragen des gemeinsamen Lebens. Es zeige sich dann: »Lebenserhaltung und Weltgestaltung sind immer schon miteinander verknüpft«; vgl. Jaeggi, Rahel: Wie weiter mit Hannah Arendt? Hrsg. vom Hamburger Institut für Sozialfor­schung. Hamburg 2008, S. 31. Das bedeutete auch: Es gäbe bei Arendt keinen Gegenstandsbereich und keinen Tätigkeitsraum des Menschen, der prinzipiell abgeschottet wäre gegenüber Ereignissen der Machtentstehung und -entfaltung. 59Vgl. Arendt, Hannah: Wahrheit und Politik, S. 26 sowie Arendt, Hannah: Vita activa, S. 311ff. 60Siehe auch Fn. 47 in diesem Beitrag. 61 Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, S. 48. 29 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 dass es sich um prinzipiell unterschiedliche Phänomene handelt (wie bei Arendt). Tatsächlich legt sein Versuch in den späten Texten, eine Vielzahl von möglichen Beziehungen zu unterscheiden, nahe, dass es vorteilhafter wäre, Gewalt und Herr­ schaft nicht einfach als spezifische Formen einer schlichtweg überall wirkenden ‚Macht‘ – beziehungsweise als graduelle Ausprägungen dieser Macht – zu fassen. Jedoch setzte dies ein ‚Außen‘ der Macht voraus, für welches im Rahmen der Gesamt­konzeption der Foucault’schen Machtanalytik kein Platz zu sein scheint.62 Zum Schluss: Ergebnisse und Perspektiven Die nähere Beschäftigung mit Arendt und Foucault in diesem Beitrag war moti­ viert durch die Frage nach der Möglichkeit einer eindeutigen Unterscheidung zwi­ schen den Phänomenen Macht und Gewalt. Ohne eine ausführliche Auseinander­ setzung mit aktuellen machtanalytisch inspirierten Konzeptionen im Bereich der politischen Philosophie voranzustellen – deren Machtbegriffe auch keineswegs identisch sind –, konnte dennoch mit Blick auf exemplarisch ausgewählte Zitate aufzeigt werden, dass eine solch klare Differenzierung hier an entscheidenden Stellen fehlt. Wenn sich nun jedoch gezeigt hat, dass sowohl bei Arendt als auch bei Foucault die unternommenen Versuche einer Unterscheidung zwischen Machtbeziehungen und Gewalt- oder Herrschaftsbeziehungen nicht unproblema­ tisch sind, welche Perspektiven vermag dieser Vergleich dann zu eröffnen für eine kritische Auseinandersetzung mit Positionen, die Macht als wesentliches Element des Sozialen und Politischen ansetzen? Ich möchte abschließend zwei Punkte hervorheben, die sich im Zuge des ge­ leisteten Vergleichs herauskristallisiert haben und die mir für die aktuelle Diskus­ sion im Feld der politischen Theorie besonders wichtig zu sein scheinen: 1) Die Frage nach Reichweite und Selbstverständnis eines auf Konflikt und Streit setzen­ 62Die von Foucault angesetzte ‚Omnipräsenz‘ von Macht führt schließlich auch dazu, dass er das Phänomen des Widerstandes als in den Raum der Macht-Spiele selbst hineingehörend denken muss (»Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand.«); vgl. Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit. Erster Band: Der Wille zum Wissen. Frankfurt a.M. 1977, S. 116. Eine differenzierte Auseinan­dersetzung mit der Reichweite dieses Verständnisses von ‚Widerstand‘ bietet Klass, Tobias N.: Foucault und der Widerstand: Anmerkung zu einem Missverständnis. In: Hechler, Daniel / Philipps, Axel (Hrsg.): Widerstand denken. Michel Foucault und die Grenzen der Macht. Bielefeld 2008, S. 149–168. 30 Meike Siegfried den Modells des Politischen; 2) die Notwendigkeit differenzierter Analysekate­ gorien für normativ-kritische Perspektiven. Zu 1): Es ist offensichtlich, dass Verfechter eines Verständnisses des Politischen als einer durch Antagonismen konstituierten Sphäre eine ‚postfundamentalisti­ sche‘ Lesart von Hannah Arendt vertreten müssten, wollten sie sich auf ihre Überlegungen zu Macht und Gewalt beziehen.63 Nicht diejenigen Motive bei Arendt, welche Habermas für seinen Ansatz einer kommunikativen Vernunft fruchtbar gemacht hat, wären für diese Denker interessant, sondern diejenigen Stellen, an denen deutlich wird, dass im Phänomen der Macht auch bei Arendt ein verborgener Zwang aufscheint,64 den sie selbst freilich nicht Gewalt nennen möchte. Werden Macht und Gewalt so strikt geschieden, scheinen die Kategorien zu fehlen für eine differenzierte Beschreibung unterschiedlicher Formen von Einwirkung, Zwang, Begrenzung et cetera Umgekehrt müssen sich Konzeptionen, wel­che die Begrifflichkeit des Konfliktes und Dissenses in den Mittelpunkt ihrer Ansätze stellen und Macht tendenziell mit ‚Gewalt‘ und dem Kampf um ‚Herr­schaft‘ assoziieren, klar eingestehen, dass dieses Modell in der Regel nur funktio­niert, weil bestimmte Formen von Gewalt ganz selbstverständlich ausgeschlossen werden.65 Indem in Chantal Mouffes Entwurf einer ‚radikalen Demokratie‘ Anta­gonisten (Feinde) zu Agonisten (Gegnern) werden, präsentiert sie, so Dirk Jörke treffend, 63Zu einer solchen Lesart vgl. Marchart, Oliver: Ein revolutionärer Republikanismus – Hannah Arendt aus radikaldemokratischer Perspektive. In: Heil, Reinhard / Hetzel, Andreas (Hrsg.): Die unendliche Aufgabe. Kritik und Perspektiven der Demokratietheorie. Bielefeld 2006, S. 151–168. ‚Postfundamentalismus‘ meint nach Marchart »einen Prozess unabschließbarer Infragestellung metaphysischer Figuren der Fundierung und Letztbegründung« (Marchart, Oliver: Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben. Frankfurt a.M. 2010, S. 16) Anders als bei einem konsequenten Antifundamentalismus ginge es hier jedoch nicht um die Leugnung jeglicher Fundamente in der Gesellschaft, sondern um die Annahme stets umkämpfter und miteinander konkurrierender Fundamente. 64Auf das Phänomen der Exklusion wurde bereits hingewiesen, ein Moment der ‚Gewalt‘ kann auch im Ereignis der Neugründung, des kreativen neu Anfangens, gesehen werden, das Arendt so stark macht; siehe dazu auch Kupke, Christian: Macht und/oder Gewalt, S. 73f. 65Sehr aufschlussreich sind hier die Schlussbemerkungen von Chantal Mouffe zu ihrem Buch ›The Democratic Paradox‹; einerseits sucht sie Gewalt als das durch den aufklärerischen Rationa­lismus illegitimerweise Abgedrängte zu begreifen (als verdrängte Dimension des Sozialen), andererseits wird eingestanden, dass diese eine ständige Bedrohung für die Gesellschaft darstellt; vgl. Mouffe, Chantal: The Democratic Paradox, S. 129ff. 31 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 einen »weich gekochten Schmitt«66, der kompatibel ist mit einer auf Plu­ralismus setzenden Konzeption gesellschaftlicher Wirklichkeit. Einerseits kann die eigene Position, das Plädoyer für ‚Demokratie‘, im Rahmen eines solchen An­satzes auch nur eine Strategie bedeuten, eine spezifische ‚Kampfposition‘, denn sie ist ja nicht legitimierbar durch den Verweis auf universelle Werte oder das unveränderliche Wesen des Menschen. Doch selbstverständlich wird analysiert und argumentiert, statt Formen anderen ‚Zwanges‘ anzuwenden, um diese Posi­tion durchzusetzen. Im Horizont einer solchen Vermeidung der Frage nach der Gewalt als dem Anderen der Macht besteht jedoch die Gefahr, dass die Rede von der nicht zu eliminierenden ‚Macht‘ zu einer rhetorischen Geste herabsinkt und einer der Kernbegriffe der gesamten Theorie am wenigsten ausgearbeitet bleibt. Zu 2): Die Notwendigkeit möglichst differenzierter Unterscheidungen im Be­ griffsfeld ‚Macht‘/‚Gewalt‘/‚Herrschaft‘ zeigt sich nun zuletzt dort, wo im Spek­ trum politischen Denkens auf die Möglichkeit der Einnahme einer kritischen Perspektive auf gesellschaftliche und politische Zustände nicht verzichtet werden soll – auch dann, wenn sich der Theoretiker/die Theoretikerin der historischen und kulturellen Situiertheit der eigenen Position vollkommen bewusst ist.67 Erst mit dem Versuch einer Unterscheidung zwischen den genannten Phänomenen – be­gleitet von wichtigen Überlegungen zu Kritik und Aufklärung68 – ist Foucault schließlich überhaupt zu einem Autor avanciert, welcher für eine theoretische Diskussion des Phänomens des Widerstandes sowie Überlegungen zu einer Trans­ formation des traditionellen Emanzipationsideals sinnvollerweise herangezogen werden kann. Wenn in diesem Schlusswort nun insgesamt plädiert wird für die Herausarbeitung klarer Unterscheidungen zwischen den Begriffen, die im Mittel­punkt der Aus66Jörke, Dirk: Wie demokratisch sind radikale Demokratietheorien? In: Heil, Reinhard / Hetzel, Andreas (Hrsg.): Die unendliche Aufgabe, S. 253–266, hier 263. 67Dieser Anspruch ist schließlich auch bei zahlreichen Denkern vorhanden, die gemeinhin dem ‚postmodernen‘ Lager zugeordnet werden, so etwa bei Jacques Derrida und Richard Rorty. 68Siehe zu Foucaults Transformation einer traditionell aufklärerischen Perspektive Volkers, Achim: Wissen und Bildung bei Foucault. Aufklärung zwischen Wissenschaft und ethisch-ästheti­schen Bildungsprozessen. Wiesbaden 2008 sowie Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Vernunft, S. 347–366. 32 Meike Siegfried führungen standen, dann muss jedoch Folgendes hervorgehoben werden: Argumentiert werden sollte für die Erarbeitung eines ausreichend breiten Spektrums funktional einsetzbarer Analysekategorien. Die Frage, ob Gewalt das Andere der Macht ist oder lediglich eine Variante derselben, ließe sich nur dann eindeutig beantworten, wenn man beiden Phänomenen ein feststellbares Sein jen­seits ihrer Beschreibung und Bewertung im Rahmen konkreter Theorien zuge­stehen würde. Am Ende steht also keine einfache Ja- oder Nein-Antwort auf die leitende Frage des Beitrags, sondern die Andeutung einer Perspektive für Ansätze, die etwas bestimmtes – ‚kritisches‘ Denken im Horizont postmetaphysischer Kon­zeptionen – erreichen möchten. 33 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Aufsätze Öffentlichkeit und Privatheit Rekonstruktion einer Unterscheidung am Beispiel der Theorie von Jürgen Habermas Philipp Hölzing Berlin E-Mail: [email protected] Abstract Against the background of the lively debates on public deliberation in recent years, this essay tries to reconstruct the different public/private distinctions that one can find in Jürgen Habermas’ pioneering works. It claims that we can find four specific forms of distinction, which evolve from each other starting with his work on the structural transformation of the public sphere until his later work on the discourse theory of the democratic state. Only in his later work Habermas seems to have solved the problem of intermediation between lifeworld and system.With this solution he also has found a convincing normative justification for the public/private distinction. Schlüsselwörter Autonomie, Deliberative Demokratie, Habermas, Öffentlichkeit, Privatheit, Politische Theorie 34 Philipp Hölzing In seiner ebenso berühmten wie umstrittenen Man-Analyse hat Martin Heidegger konstatiert: »Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung konstituieren als Seinsweisen des Man das, was wir als die ›Öffentlichkeit‹ kennen.«1 In der Öffentlichkeit ist man für Heidegger in der Weise der Unselbständigkeit und Uneigentlichkeit, »weil sie unempfindlich ist gegen alle Unterschiede des Niveaus und der Echtheit.«2 So kommt er zu dem Urteil, »die Öffentlichkeit verdunkelt alles und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus.«3 Im Umkehrschluss müsste die Privatheit für Heidegger durch die Seinsweise der Selbständigkeit und Eigentlichkeit konstituiert sein, auch wenn sich diese Behauptung so explizit nicht bei ihm findet. Wenn in diesem Urteil nicht nur ein antidemokratischer Affekt steckt – und ganz allein darauf lässt es sich nicht reduzieren –, dann haben wir es mit einem umfassenderen theoretischen Problem zu tun: der Frage nach einer Theorie von Öffentlichkeit und Privatheit zwischen normativen Annahmen und empirischen Aussagen. Das gleiche Problem zeigt sich etwa, wenn die in der Tradition der Hegelschen Dialektik von Besonderem und Allgemeinem stehende Philosophie Adornos in ihrer Kritik des identifizierenden Denkens und dem Diktum, das Ganze, die öffentliche Meinung, sei das Unwahre, eigentümliche Parallelen zu Heideggers Unterscheidung aufweist. 4 Gegen eine solche Konzeptionalisierung von Öffentlichkeit und Privatheit hatte bereits John Dewey eingewendet, die Unterscheidung von Privatem und Öffentlichem entspreche »in keiner Beziehung der Unterscheidung von Individuum und Sozialem.«5 Er kommt dadurch zu einer normativ positiven Einschätzung der Öffentlichkeit, die einen zentralen Ort in seiner Demokratietheorie erhält. Wir können das mit diesen kurzen Bemerkungen aufgeworfene Problem zunächst so formulieren, dass wir fragen: Was meinen wir mit ‚Öffentlichkeit‘ und mit ‚Privatheit‘? Wie verhalten sie sich zueinander? Und wo verläuft die Grenze? Korres­ pondiert die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit den Unterscheidungen von Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit, Allgemeinem und Besonderem 1 Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 1993 (1927), S. 127. 2 Ebd., S. 127. 3Ebd. 4 Vgl. etwa Adorno, Theodor W.: Meinung, Wahn, Gesellschaft. In Ders.: Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt/M. 1963. 5 Dewey, John: Die Öffentlichkeit und ihre Probleme. Berlin 2001 (1927), S. 27. 35 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 oder Sozialem und Individuum? In welcher Weise man die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit konzipiert und beurteilt, hängt darüber hinaus, so scheint es, mit weiteren im Hintergrund stehenden normativen Annahmen zusammen. An die düstere Heideggersche und Adornosche Variante schließen sich heute kulturpessimistische Analysen an, für die hier exemplarisch Richard Sennetts Arbeit über die Tyrannei der Intimität und den Verfall des öffentlichen Lebens genannt sei. Sennett diagnostiziert einen Niedergang des öffentlichen Lebens seit dem 18. Jahrhundert durch einen zunehmenden Rückzug ins Private und eine Idealisierung der Kernfamilie als Schutzwall gegen die Lasten der öffentlichen Auseinandersetzung. Die damit einhergehende ausschließliche Fokussierung auf die eigene Person und die eigenen Gefühle führe zu einer Tyrannei der Intimität, die den kühlen, distanzierten und zivilisierten öffentlichen Umgang miteinander zerstöre. Sennett plädiert dadurch in gewisser Weise für eine Rückkehr zu älteren Formen des Zusammenspiels von Öffentlichkeit und Privatheit im Sinne des 18. Jahrhunderts.6 In normativer Hinsicht wurde in den letzten drei Jahrzehnten diese klassische Öffentlichkeits / Privatheits-Distinktion allerdings von feministischer Seite stark kritisiert. Selbst in der liberalen Form der Unterscheidung der beiden Sphären wurde die fortlaufende Unterdrückung der Frau durch den Mann erkannt, insofern in ihr der als natürlich aufgefasste, mit reproduktiven Aufgaben betraute und emotional geprägte private Bereich als Raum der Frau verstanden und vom öffentlichen, rationalen Bereich als Raum der Freiheit und des Mannes getrennt wurde. Eine mögliche Auflösung dieser verdeckten Herrschaftsbeziehung bestand in der Verabschiedung der Unterscheidung überhaupt, wodurch auch der private Bereich als öffentlicher, politischer Bereich und nicht als natürlich gegeben konzipiert wurde.7 Beate Rössler hat dagegen in jüngerer Zeit aus liberaler Perspektive eine Verteidigung des Wertes des Privaten und damit der Unterscheidung unternommen, indem sie die eigene Kontrolle über einen privaten Raum als substantielle Voraussetzung von Freiheit und Autonomie versteht. 6 Vgl. Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt / M. 1986. 7 Vgl. dazu klassisch Pateman, Carole: Feminist Critiques of the Public / Private Dichotomy. In: Benn, Stanley I./ Gaus, Gerald F. (Hrsg.): Public and Private in Social Life. London 1983, S. 281–303. 36 Philipp Hölzing »Substantiell besteht der Konnex zwischen Privatheit und Autonomie also deshalb, weil nur durch solche mittels der Trennlinie privat/öffentlich abgesteckten ›Räume‹ die Ausbildung, der Entwurf und die Ausübung (bestimmter) Aspekte von Autonomie möglich werden. Auf die Frage ›Autonomie in welcher Hinsicht?‹ müsste dann die Antwort lauten: Privatheit schützt Autonomie in den Hinsichten, in denen die Ausübung von Autonomie angewiesen ist auf meine Kontrolle des ›Zutritts‹ anderer zu mir, zu meiner Person, zu meinen (Überlegungen zu) Entscheidungen, zu Informationen über mich; und ebendiese (symbolischen) Räume können nicht anders abgegrenzt werden als mit Hilfe der normativen Unterscheidung zwischen dem, was als privat, und dem, was als öffentlich zu gelten hat, da die Differenz zwischen ›frei‹ und ›unfrei‹ allein für diese Abgrenzungen gerade nicht hinreicht.«8 Aus historischer Perspektive haben Philipp Ariès und George Duby eine umfangreiche Geschichte des privaten Lebens vorgelegt, während sich Peter Uwe Hohendahl et al. vor einigen Jahren noch einmal der Geschichte der Öffentlichkeit zugewandt haben.9 Einen Überblick über verschiedene Verwendungsweisen der Öffentlich / Privat-Unterscheidung in der zeitgenössischen politischen Theorie hat Jeff Weintraub vorgelegt, wobei er vier zentrale Verwendungsweisen ausmacht: liberal-ökonomische (Staat vs. Markt/Gesellschaft), republikanische (Zivilgesellschaft/Öffentlichkeit vs. Staat einerseits und Privatbereich/Markt andererseits), sozialhistorisch-anthropologische (Öffentlichkeit und Privatheit als sich wandelnde Formen von Sozialität) und feministische (Familie vs. Markt/Politik).10 Eine breite internationale Debatte über den Begriff der Öffentlichkeit löste jedoch insbesondere die englischsprachige Publikation von Jürgen Habermas‘ Struktur- 8 Vgl. Rössler, Beate: Der Wert des Privaten. Frankfurt/M. 2002, S. 139. Siehe auch den Band Seubert, Sandra/ Niesen, Peter (Hrsg.): Die Grenzen des Privaten. Baden-Baden 2010. 9 Vgl. Ariès, Philipp/ Duby, George (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens. 5 Bde. Frankfurt/M. 1993 und Hohendahl, Peter Uwe et al. (Hrsg): Öffentlichkeit. Geschichte eines kritischen Begriffs. Stuttgart 2000. 10Vgl. Weintraub, Jeff: The Theory and Politics of the Public / Private Distinction. In: Ders./ Kumar, Krishan (Hrsg.): Public and Private in Thought and Practice. Perspectives on a Grand Dichotomy. Chicago 1997, S. 1–42, hier S. 7. 37 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 wandel der Öffentlichkeit Ende der 1980er Jahre aus, die bis heute nicht abgerissen ist und zentral war für die Entwicklung deliberativer Demokratietheorien.11 Habermas schließt an die zuvor erwähnte Deweysche, demokratietheoretische Perspektive an und sagt von sich, »in meinem Modell tragen vor allem die Kommunikationsformen einer Zivilgesellschaft, die aus intakt gehaltenen Privatsphären hervorgeht, tragen die Kommunikationsflüsse einer vitalen Öffentlichkeit, die in einer liberalen Kultur eingebettet ist, die Bürde normativer Erwartung.«12 Hiermit sind schon einige zentrale Begriffe dieser Untersuchung gefallen, die es zu rekonstruieren gilt. Denn bei Habermas, der im Folgenden im Mittelpunkt stehen wird, findet sich eines der gegenwärtig differenziertesten Modelle zur Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit. Habermas ist der Theoretiker der Öffentlichkeit. Gerade deshalb scheint es interessant, Habermas‘ Philosophie zugleich auf den Stellenwert des Gegenpols der für sein Werk zentralen Öffentlichkeit abzutasten: der Privatheit, was in der theoretischen Auseinandersetzung bisher kaum geschieht.13 Hinzu kommt, dass Habermas die kritischen Momente der Heideggerschen, Adornoschen und Senettschen Öffentlichkeitsanalyse in seine Überlegungen zu Öffentlichkeit und Privatheit aufzunehmen versucht, ohne am Ende in deren häufig so einseitigen Kulturpessimismus zu verfallen. Habermas‘ erste Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit markiert dabei für diese Untersuchung den Ansatzpunkt zum Verständnis der Habermasschen Theorie im Ganzen, denn der Öffentlichkeitsbegriff wird als der zentrale Begriff bei 11Vgl. dazu den wichtigen Band von Craig Calhoun (Hrsg.): Habermas and the Public Sphere. Cambridge 1992, sowie zur deliberativen Demokratietheorie etwa Bohman, James/ Rehg, William (Hrsg.): Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics. Cambridge 1997. Einen guten Überblick über die ganze Debatte und die Literatur gibt die Website: http://publicsphere.ssrc.org/guide/. 12 Habermas, Jürgen: Ein Gespräch über Fragen der politischen Theorie. In: Ders.: Die Normalität einer Berliner Republik. Frankfurt/M. 1995, S. 135–164, S. 137. 13 Vgl. etwa Nanz, Patrizia: Öffentlichkeit. In: Brunkhorst, Hauke/ Kreide, Regina/ Lafont, Cristina (Hrsg.), Habermas Handbuch. Stuttgart 2009, S. 358–360, wo jeder Bezug zur Privatheit fehlt. 38 Philipp Hölzing Habermas aufgefasst.14 Die zentrale Frage der Untersuchung lautet im Hinblick auf die Öffentlichkeits / Privatheits-Unterscheidung bei Habermas: Warum sollte der politisch-soziale Raum in Öffentlichkeit und Privatheit aufgeteilt werden? Sie verweist auf eine normative Begründung der Unterscheidung. Die im Hinblick auf diese Frage zu prüfende These behauptet, dass Öffentlichkeit und Privatheit substanzielle Bedingungen für die grundlegende, normative Prämisse der Demokratie sind: beide verweisen auf den Autonomiebegriff, die Selbstbestimmung der Bürger. Sie sind Sphären der Realisierung von gleichursprünglichen Aspekten der Autonomie. Meine Argumentation wird versuchen, Habermas‘ normative Begründung dieser Unterscheidung werkgeschichtlich zu rekonstruieren. Dabei wird sich zeigen, so die weitere These, dass sich in Habermas‘ Werk vier verschiedene Unterscheidungsformen von Öffentlichkeit und Privatheit finden lassen, vom Strukturwandel der Öffentlichkeit über die Theorie des kommunikativen Handelns (TKH) bis zu Faktizität und Geltung (FuG), die sich in ihrer werkgeschichtlichen Entwicklung in spezifischer Weise auseinander rekonstruieren lassen und einer gewissen Entwicklungslogik folgen.15 Meine Rekonstruktion des Habermaschen Œuvres besagt, dass dieser in seiner Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit aus bürgerlichen Praktiken des 18. Jahrhundert. und deren zeitgenössischer philosophischer Reflexion eine erste normative Form der Unterscheidung gewinnt, die ich als doppelte Unterscheidung bezeichne. Diese wird in Form der idealen Kommunikationsgemeinschaft prägend für sein weiteres Denken bleiben. Sie wird jedoch abgelöst von einer zweiten Unterscheidungsform, die ich die einfache Unterscheidung nennen möchte. In dieser schließt Habermas an die kulturpessimistischen Thesen der ersten Generation der Frankfurter Schule zur Kulturindustrie an (I). In seiner Theorie des kommunikativen Handelns, so der weitere Argumentationsgang, fundiert er die mit der doppelten Unterscheidung gewonnene normative Unterscheidungsform kommunikationstheoretisch, um sie dadurch zu begründen. Dadurch, dass 14 Vgl. dazu Heming, Ralf: Öffentlichkeit, Diskurs, Gesellschaft: zum analytischen Potenzial und zur Kritik des Begriffs der Öffentlichkeit bei Jürgen Habermas. Wiesbaden 1997. 15Vgl. dagegen Nanz, Patrizia: Öffentlichkeit. In ihrer Darstellung vergleicht Nanz allein die bürgerlichen Öffentlichkeitsformen. Die Unterscheidungsform der TKH fehlt und auch der Strukturwandel der Öffentlichkeit in der frühen Studie wird nicht systematisch analysiert. 39 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 er über die Kolonisierung-der-Lebenswelt-These jedoch auch an die zweite, einfache Unterscheidungsform anschließt, taucht in dieser kommunikationstheoretisch fundierten dritten Unterscheidungsform ein Vermittlungsproblem zwischen Öffentlichkeit und Privatheit und den in der TKH als systemisch integriert verstandenen Handlungsbereichen Staat und Ökonomie auf (II). Dieses Problem löst Habermas erst in FuG in seiner Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaates, in der die Öffentlichkeit als intermediäre Struktur verstanden wird. Mit der dort entwickelten vierten Unterscheidungsform werden Öffentlichkeit und Privatheit als Sphären der Realisierung von privater und öffentlicher Autonomie begründet, die als gleichursprünglich aufgefasst werden (III). Der Fokus der Untersuchung liegt auf dieser werkgeschichtlichen Rekonstruktion. Aus ihr und den dabei zu erkennenden Neuansätzen und Transformationen ergeben sich wichtige Einsichten für eine heutige Konzeptionalisierung der Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit, da wir in Habermas‘ Versuchen zentrale Fragen und Problematiken der Unterscheidung sowie Lösungsmöglichkeiten präsentiert bekommen, so das Resümee (IV). I. Beginnen wir mit Habermas‘ Beschreibung der Entstehung der ersten Unterscheidungsform in der Aufklärung: Die öffentlichen Orte, von denen aus Habermas die bürgerlichen Schichten das Zwiegespräch mit der öffentlichen Verwaltung des Absolutismus aufnehmen sieht, sind die Kaffeehäuser und Salons. Dieser sozusagen räumliche Konstitutionsprozess bürgerlicher Öffentlichkeit beginne in England und Frankreich zum Ende des 17. Jahrhundert; in Deutschland, etwas verspätet, sind zu Beginn des 18. Jahrhundert. die Tischgesellschaften der Ort des räsonierenden Publikums.16 Es handele sich zu Beginn jedoch noch um eine rein »literarische Öffentlichkeit«. Man räsoniere über Literatur, Kunst und Musik. Diese literarische Öffentlichkeit bringe etwas hervor, das mit den Begriffen ‚public opinion‘, ‚opinion publique‘ oder ‚öffentliche Meinung‘ umschrieben werde, in Zeitungen und Zeitschriften seinen Ausdruck finde (Tatler, moralische Wochenschriften) und sich von der Öffentlichkeit der öffentlichen Verwaltung abspalte. Habermas hebt dabei drei Charakteristika dieser literarischen Öffentlichkeit hervor: 16 Vgl. Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie bürgerlicher Gesellschaft. Frankfurt / M. 1990 (1962), S. 94 ff. 40 Philipp Hölzing »Zunächst ist eine Art gesellschaftlichen Verkehrs gefordert, der nicht etwa die Gleichheit des Status voraussetzt, sondern von diesem überhaupt absieht. […] Die Diskussion in einem solchen Publikum setzt zweitens die Problematisierung von Bereichen voraus, die bislang nicht als fragwürdig galten. […] Der gleiche Vorgang, der Kultur in Warenform überführt und sie damit zu einer diskussionsfähigen Kultur überhaupt erst macht, führt drittens zur prinzipiellen Unabgeschlossenheit des Publikums. […] Alle müssen dazu gehören können.«17 Die Zeitungen und Zeitschriften gingen aus der Mitte des Publikums hervor. Das Publikum habe sich in dieser literarischen Öffentlichkeit »selbst zum Thema.«18 Die Erfahrungen, über die sich das Publikum verständige, entsprängen einer spezifischen Subjektivität, deren Sphäre die patriarchalische Kleinfamilie sei. Sie ist für Habermas der dominante Familientypus der bürgerlichen Schicht. Demgegenüber verharrten die Massen der ländlichen und städtischen Unterschichten noch weitgehend im Kontext von Großfamilie und ständestaatlichen Abhängigkeitsgefügen, die die Trennung von Öffentlichkeit und Privatsphäre nicht zuließen. Die neue Form bürgerlichen Lebens lasse sich, wie schon beim griechischen oikia oder der römischen villa, an der architektonischen Einteilung des Hauses in private und öffentliche Räume nachvollziehen. Auch im bürgerlichen Haus diene ein Salon als Empfangszimmer, das der Öffentlichkeit zugewandt und von den privaten Räumen streng separiert sei. Die bürgerliche Neuerung sei nun, dass die privaten Räume jeweils einzelnen Familienmitgliedern zugeordnet sind, hier sozusagen selbst noch einmal innerhalb des Hauses individuelle Privatsphären entstehen. Sie würden nach dem jeweiligen Geschmack der Person eingerichtet und geben dem Bedürfnis nach Einsamkeit, Intimität, Innerlichkeit, Individualität, kurz: der Ausbildung und Erfahrung der eigenen Subjektivität Raum. Die Psychologie als Erforschung dieser Innerlichkeit habe hier ihren Entstehungsort und im Briefverkehr und im psychologischen Roman würden die Ergebnisse dieser inneren Erforschung einem Publikum mitgeteilt. Habermas nennt die patriarchalische Kleinfamilie den Ort einer »psychologischen Emanzipation«,19 denn sie verstehe sich als 17 Ebd., S. 97. 18Ebd., S. 107. 19 Ebd., S. 110. 41 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 unabhängig und von allen gesellschaftlichen Bezügen losgelöst. Die Ehepartner und die Eltern und die Kinder begegneten sich in ihr als »bloße Menschen«. »Die drei Momente der Freiwilligkeit, der Liebesgemeinschaft und der Bildung schließen sich zu einem Begriff der Humanität zusammen, die der Menschheit als solcher innewohnen soll und wahrhaft ihre absolute Stellung erst ausmacht: die im Worte des rein und bloß Menschlichen noch anklingende Emanzipation eines nach eigenen Gesetzen sich vollziehenden Inneren von äußerem Zweck jeder Art.«20 Dabei stehe die bürgerliche Familie jedoch in einem Verhältnis der Abhängigkeit zum ökonomischen Geschehen des Marktes. Die zwanglose familiäre Intimität sei »das Siegel auf die Wahrheit«21 der für die Sphäre der Ökonomie propagierten scheinbaren Autonomie des Privateigentümers. Habermas betont aber, dass das vorgestellte Zusammenspiel von intimer Privatsphäre, die von den ökonomischen Zwängen befreit ist, und literarischer Öffentlichkeit, die sich von allen staatlichen und statusbedingten Zwängen ablöst, mehr ist als bürgerliche Ideologie. »Als ein in die Gestalt der wirklichen Institution mit aufgenommener objektiver Sinn, ohne dessen subjektive Geltung die Gesellschaft sich nicht hätte reproduzieren können, sind diese Ideen auch Realität.«22 Diese Verwendung des Begriffs ‚Geltung‘ verweist bereits auf die Habermassche Konzeption von Gesellschaft und Demokratie in der Theorie des kommunikativen Handelns und in Faktizität und Geltung. Aus den Strukturen dieser literarischen Öffentlichkeit gehe nun die politische Öffentlichkeit hervor. Die bürgerliche politische Öffentlichkeit, die sich die von der öffentlichen Verwaltung bisher reglementierte politische Öffentlichkeit aneigne, brauche nur auf die Strukturen der bereits konstituierten literarischen Öffentlichkeit zurückzugreifen. Dabei gingen die oben beschriebenen Ideen der literarischen Öffentlichkeit mit in das Verfahren der nun politischen Diskussionen ein. Man könnte hier auch von einer Politisierung der literarischen Öffentlichkeit sprechen, und vor allem im deutschen Reich findet diese, im Vergleich zu England und Frankreich wieder 20Ebd. 21Ebd. 22Ebd., S. 112. 42 Philipp Hölzing etwas verspätet, unter dem Eindruck der politisch-sozialen Revolutionen in Nordamerika und Frankreich statt. Zugleich hat sich diese Politisierung für Habermas aber dadurch angebahnt, dass der Warenverkehr zu einem Gegenstand von öffentlichem Interesse und von Politik geworden sei. Daher forderten die an diesem Warenverkehr beteiligten bürgerlichen Privateigentümer nun eine Teilhabe am Prozess politischer Entscheidungsfindung und das Medium dieser Forderung sei die öffentliche Meinung. Dennoch übersteigt die Idee der bürgerlichen politischen Öffentlichkeit für Habermas, durch die Anknüpfung an die in der literarischen Öffentlichkeit entwickelten Ideen, das rein materielle Interesse der Privateigentümer an der Teilhabe am politischen Entscheidungsprozess. Was von den Privateigentümern von der öffentlichen Gewalt eingefordert werde, sei die Schaffung genereller und abstrakter Gesetze. Als deren einzige legitime Quelle gelte nun die öffentliche Meinung. Für Habermas vollzieht sich das öffentliche Räsonnement der bürgerlichen Öffentlichkeit daher »im Prinzip unter Absehung von allen sozial und politisch präformierten Rängen nach allgemeinen Regeln, die, weil sie den Individuen als solchen streng äußerlich bleiben, der literarischen Entfaltung ihrer Innerlichkeit; weil sie allgemein gelten, dem Vereinzelten; weil sie objektiv sind, dem Subjektivsten, weil sie abstrakt sind, dem Konkretesten einen Spielraum sichern. Gleichzeitig beansprucht, was unter solchen Bedingungen aus dem öffentlichen Räsonnement resultiert, Vernünftigkeit; ihrer Idee nach verlangt eine aus der Kraft des besseren Arguments geborene öffentliche Meinung jene moralisch prätentiöse Rationalität, die das Rechte und das Richtige in einem zu treffen sucht.«23 Man meint hier in toto bereits das Programm der Habermaschen Diskurstheorie zu entdecken. Die Grundintuition ist also schon in der Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit anzutreffen. Aus dieser Rekonstruktion ergibt sich als erste Unterscheidungsform während dieser historischen Phase für Habermas eine doppelte Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit. Einerseits ist mit »öffentlich« der Staat gemeint und somit diesem die gesamte bürgerliche Gesellschaft als »privat« gegenüber gestellt. 23Ebd., S. 119. 43 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Andererseits zerfällt diese bürgerliche Gesellschaft selbst noch einmal in die Bereiche der »Öffentlichkeit« und der familiären »Privatsphäre« (Abb. 1).24 Abb. 1.: Die doppelte Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit (eigene Darstellung) War im 18. Jahrhundert das Thema noch Publizität als Waffe gegen die absolute Herrschaft des Fürsten, so ist für Habermas das Thema des 19. Jahrhunderts die Wahlrechtsreform zur Erweiterung der zur Teilhabe an der politischen Öffentlichkeit berechtigten Schichten. In dem Maße aber, in dem sich die Öffentlichkeit erweitere, verliere sie für die bürgerlichen Schichten die emphatische Bedeutung von Kritik, Wahrheit und Vernunft. Sie werde nun mehr als Ausdruck eines Konformitätszwangs aufgefasst, zumal als Bereich unschöner Grabenkämpfe mit dem Proletariat um die materielle Verteilung. Habermas zeigt dies exemplarisch an Äußerungen von Mill und Tocqueville. Beide forderte, den Einfluss der öffentlichen Meinung auf den Staat über eine repräsentative Regierungsform zu filtern und den auf das einzelne Individuum durch eine geschützte Privatsphäre, mit dem damit verbundenen Schutz der Grund- bzw. Freiheitsrechte, zu beschränken.25 Habermas bemerkt, dass sich in den nun folgenden hundert Jahren bis zur Mitte 24Ebd., S. 86–90. 25Vgl. Ebd., S. 209 ff. 44 Philipp Hölzing des 20. Jahrhundert das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit grundlegend wandelt: »Zwei dialektisch aufeinander verweisende Tendenzen bezeichnen einen Zerfall der Öffentlichkeit: […] Öffentlichkeit scheint in dem Maße die Kraft ihres Prinzips, kritische Publizität, zu verlieren, in dem sie sich als Sphäre ausdehnt und noch den privaten Bereich aushöhlt.«26 Die Ausweitung der Öffentlichkeit unter Verlust ihres kritischen Potenzials erfolge durch einen zunehmenden staatlichen Interventionismus. Dieser reagiere auf die oligopolitischen Tendenzen des kapitalistischen Wirtschaftsystems des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er verbinde sich dabei mit der Übernahme staatlicher Aufgaben durch private Interessenverbände, Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die ihre gesellschaftliche Macht direkt in politische umsetzen, beim Kampf um die materielle Verteilung einsetzen und die, etwa im Fall der Tarifverträge, quasi gesetzgeberische Kompetenzen gewönnen. Damit werde aber die Grenze zwischen privatwirtschaftlichem und öffentlichem Bereich sowie zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht zunehmend verwischt. Dem sich hieraus entwickelnden Sozialstaat gelinge es zwar, die selbstzerstörerischen Tendenzen der Kapitalkonzentration abzufedern, er müsse allerdings dazu in hohem Maße gestalterisch in den zuvor privaten Bereich des Warenverkehrs und Eigentums eingreifen. Gleichzeitig verliere die Öffentlichkeit, durch die Organisation als Sphäre kollektiver Interessenverbände, die staatliche Funktionen übernehmen und gesamtwirtschaftliche Verteilungsprobleme aushandeln, ihren privaten Charakter einer Sphäre von autonomen Privatleuten. Habermas schlussfolgert daher: »Das publizistische Moment des öffentlichen Interesses verbindet sich in dem Maße mit dem privatrechtlichen der vertraglichen Formulierung, in dem mit Kapitalkonzentration und Interventionismus aus dem Prozess wechselseitiger Vergesellschaftung des Staates und einer Verstaatlichung der Gesellschaft eine neue Sphäre hervorgeht. Diese kann sinnvoll weder als eine rein private noch als eine genuin öffentliche aufgefasst und eindeutig den Bereichen des privaten oder öffentlichen Rechts zugeordnet werden.«27 26Ebd., S. 223. 27Ebd., S. 238. 45 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Dieser neuen Sphäre stelle sich die private familiäre Intimsphäre als zusammengeschrumpfter Rest des ehedem privaten Gesellschaftsbereichs gegenüber. Die im Zuge der Kapitalkonzentration gebildeten Großbetriebe seien aus den Zusammenhängen des bürgerlichen Familienunternehmens herausgewachsen. Die Arbeitswelt bilde nun einen »quasi-öffentlichen Bereich.«28 Die Freizeit des Feierabends und der Wochenenden sei als Komplement der nun öffentlichen Berufssphäre das letzte Reservat der Privatheit. Zum anderen erfolge das Eindringen der Öffentlichkeit über die entstehenden Massenmedien, die den Übergang vom kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum forcierten. Dabei nehme der der verselbständigten Berufssphäre komplementäre Freizeitbereich tendenziell den Raum ein, den zuvor die literarische Öffentlichkeit konstituierte. Er bleibe aber dem ökonomischen Bereich der Tauschbeziehungen insofern verhaftet, als sich die Aneignung von Kultur vollständig in Konsum verwandele, denn die Absatzorientierung der Massenmedien (z. B. Einschaltquote), mit ihrer einseitigen Kommunikation vom Sender zum Empfänger, verweigere die Möglichkeit des Widerspruchs als wichtiges Moment literarischer Öffentlichkeit. Die Kulturindustrie – hier schließt Habermas an Adorno und Horkheimer an29 – fabriziere daher patentierte Muster, die nur noch den Schein bürgerlicher Privatheit hervorbrächten. »Die durch Massenmedien erzeugte Welt ist Öffentlichkeit nur noch dem Schein nach; aber auch die Integrität der Privatsphäre, deren sie andererseits ihre Konsumenten versichert, ist illusionär.«30 Eine solche massenmediale Öffentlichkeit übernehme Funktionen der Werbung und betreibe Public Relations für den Status quo. In ihr verbinde sich der verstaatlichte Bereich der Gesellschaft, die Parteien und Verbände, mit dem vergesellschafteten Bereich des Staates, der öffentlichen Verwaltung, ohne Vermittlung der räsonierenden Privatleute. Die Kulturindustrie als Form ökonomischer und politischer Werbung diene Zwecken der Akklamation, der Legitimationsbeschaffung oder zumindest der Duldung beim Massenpublikum. 28Ebd., S. 241. 29Vgl. Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/M. 2000 (1947), S. 128–176. 30Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit, S. 260. 46 Philipp Hölzing »Inzwischen ermöglicht sie die eigentümliche Herrschaft über die Herrschaft der nichtöffentlichen Meinung: sie dient der Manipulation des Publikums im gleichen Maße wie der Legitimation vor ihm. Kritische Publizität wird durch manipulative verdrängt.«31 Habermas spricht hier deshalb auch von einer »Refeudalisierung der Öffentlichkeit«,32 die dem Grundprinzip des demokratischen Rechtsstaates zuwider laufe: der Volkssouveränität. Im Zuge unserer Rekonstruktion gelangen wir so mit Habermas am Ende des Strukturwandels der Öffentlichkeit zu einer zweiten Unterscheidungsform, einer einfachen Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit. Der zusammengeschrumpften privaten, familiären bzw. individuellen Intimsphäre steht eine enorm ausgeweitete öffentliche Sphäre gegenüber, die sich aus öffentlicher Verwaltung, massenmedialer Öffentlichkeit, öffentlichen Organisationen und quasiöffentlicher Arbeitswelt zusammensetzt (Abb. 2). Mit diesen beiden Unterscheidungsformen, der ersten doppelten und der zweiten einfachen, haben wir den von Habermas nachgezeichneten Strukturwandel der Öffentlichkeit rekonstruiert und ihn zugleich im Hinblick auf den Gegenpol der Öffentlichkeit, der Privatheit, abzubilden versucht. Mit der herausgearbeiteten ersten Unterscheidungsform verortet Habermas, wie gezeigt (Abb.1), die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit auf zwei Ebenen. Ich habe dies die doppelte Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit genannt. Sie wird aus normativer Sicht als richtige Form der Unterscheidung ausgezeichnet, da in ihr die Öffentlichkeit der räsonierenden Privatleute im privaten, gesellschaftlichen Bereich verortet ist, und bleibt prägend für Habermas‘ weiteres Denken. In der im Anschluss an den Strukturwandel von Öffentlichkeit und Privatheit herausgearbeiteten zweiten Unterscheidungsform (Abb.2) vermischen sich nach Habermas die beiden Ebenen. Damit nähert sich die einfache Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit der von Sozialem und Individuum oder Allgemeinem und Besonderem. Es wundert nun angesichts der normativen Auszeichnung der ­ersten Unterscheidungsform nicht, dass Habermas die Transformation zur zweiten Un31 Ebd., S. 270. 32Ebd., S. 292. 47 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 terscheidungsform als Verfallsgeschichte schreibt. Diese doch etwas einseitige Aufteilung in richtige und falsche Unterscheidungsform durch Habermas ist natürlich fragwürdig, und zwar nicht nur aus historischer Perspektive, da die Errungenschaften des Sozialstaats, der Arbeiter- und Frauenbewegung ja auch durchaus in philosophischer bzw. normativer Hinsicht zu berücksichtigen sind.33 Es mutet daher etwas seltsam an, dass die Öffentlichkeit genau in dem Moment zerfallen soll, in dem sie »zu einer Instanz gesamtgesellschaftlicher und nicht bloß bürgerlicher Interessenartikulation avanciert.«34 Abb. 2: Die einfache Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit (eigene Darstellung) 33Vgl. Fraser, Nancy: Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In: Calhoun, Craig (Hrsg.): Habermas and the Public Sphere, Cambridge 1992, S. 109–142. Fraser verwirft die bürgerliche Öffentlichkeits- und Privatheitsdistinktion und argumentiert für eine postbourgeoise conception die »strong and weak publics« identifizieren kann. Kritisch dazu auch Gegner, Martin: Entmaterialisierung der Öffentlichkeit. Über die Verengung eines dialektischen Konzepts und den Gebrauch in neoliberalen Zeiten. In: Laberenz, Lennart (Hrsg.): Schöne neue Öffentlichkeit. Beiträge zu Jürgen Habermas‘ ›Strukturwandel der Öffentlichkeit‹. Hamburg 2003, S. 58–88. 34Heming, Ralf: Öffentlichkeit, Diskurs, Gesellschaft, S. 80. 48 Philipp Hölzing Wir werden sehen, wie Habermas diese Aufteilung kommunikationstheoretisch fundiert und beide Unterscheidungsformen in einer dritten Unterscheidungsform im Lebenswelt / System-Dualismus verbindet. Dadurch wird ihm eine Beschreibung gegenwärtiger Gesellschaften möglich, die ambivalente Tendenzen greifen kann und sich nicht in einer Verfallsgeschichte erschöpft. II. Die erste Frage, die sich uns hier bei der Rekonstruktion dieser dritten Unterscheidungsform stellt ist: Warum überhaupt eine kommunikationstheoretische Fundierung von Öffentlichkeit und Privatheit? Habermas‘ Antwort lautet: »Das, was uns aus der Natur heraushebt, ist nämlich der einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen können: die Sprache. Mit ihrer Struktur ist Mündigkeit für uns gesetzt. Mit dem ersten Satz ist die Intention eines allgemeinen und ungezwungenen Konsensus unmissverständlich ausgesprochen.«35 In seiner Frankfurter Antrittsvorlesung hat Habermas also bereits die Stoßrichtung seiner Philosophie angegeben, die in seinem Hauptwerk, der ›Theorie des kommunikativen Handelns‹, ihre Ausarbeitung findet. Die Sprache ist der grundlegende Ausgangspunkt. Mit diesem Ausgangspunkt werden sogleich normative Folgerungen verbunden: Mündigkeit und ungezwungener Konsensus, die an die in der Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit rekonstruierte erste Unterscheidungsform erinnern. Die Strukturen des Zusammenspiels von bürgerlicher Privatsphäre und bürgerlicher Öffentlichkeit werden aus der Struktur der Sprache selbst abgeleitet. Bevor wir darauf eingehen, erscheint mir eine weitere Frage sinnvoll: Was will die Theorie des kommunikativen Handelns? Auch hier finden wir bei Habermas eine Antwort: »Es geht zunächst um einen Begriff der kommunikativen Rationalität, der hinreichend skeptisch entwickelt wird und doch den kognitiv-instrumentellen Verkürzungen der Vernunft widersteht; sodann um ein zweistufiges Konzept der Gesellschaft, welches die Paradigmen Lebenswelt und System auf 35Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse. In: Ders.: Technik und Wissenschaft als Ideologie. Frankfurt / M. 1969, S. 146–168, hier S. 163. 49 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 eine nicht nur rhetorische Weise verknüpft; und schließlich um eine Theorie der Moderne, die den Typus der heute immer sichtbarer hervortretenden Sozialpathologien mit der Annahme erklärt, dass die kommunikativ strukturierten Lebensbereiche den Imperativen verselbständigter, formal organisierter Handlungssysteme unterworfen werden.«36 Hinter diesem ganzen Unternehmen steht der Versuch, die normativen Grundlagen einer kritischen Gesellschaftstheorie aufzuzeigen, um diese dadurch aus den Aporien zu befreien, in die sie beispielsweise durch Adornos negative Dialektik geraten war. Die gesamte Argumentation der TKH kann hier selbstverständlich nicht nachgezeichnet werden. Ich muss diese als weitgehend bekannt voraussetzen, da es mir speziell um die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit geht, die Habermas am Ende der TKH vornimmt. Habermas versucht bekanntlich in der TKH zu zeigen, dass verständigungsorientiertes bzw. kommunikatives Handeln der »Originalmodus« sozialen Handelns ist, denn »Verständigung wohnt als Telos der menschlichen Sprache inne.«37 Im Zuge der Rationalisierung der Lebenswelt und der funktionalen Differenzierung werde die soziale Integration von modernen Gesellschaften auf den rationalen Konsens einer idealen Kommunikationsgemeinschaft umgestellt. Diese ideale Kommunikationsgemeinschaft ist uns bereits in der ersten Unterscheidungsform der bürgerlichen Öffentlichkeit begegnet, an die Habermas hier anknüpft. In der TKH versucht er darüber hinaus zu zeigen, dass in den Strukturen der Sprache selbst diese sozialevolutionäre Tendenz zum kommunikativen Handeln, zum rationalen Konsens einer Kommunikationsgemeinschaft angelegt ist. Das meine ich hier mit der kommunikationstheoretischen Fundierung der ersten Unterscheidungsform von Öffentlichkeit und Privatheit. Zugleich nimmt Habermas aber mit der Unterscheidung von Lebenswelt und Sys­ tem gewisse Momente der Verfallsgeschichte der zweiten Unterscheidungsform auf. Durch die funktionale Differenzierung moderner Gesellschaften seien gesellschaftliche Teilsysteme wie Politik und Ökonomie entstanden, die sich von der Le36Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde. Frankfurt / M. 1981, S. 8. 37Die beiden berühmten Formulierungen finden sich in ebd., Bd. 1, S. 387 und S. 388. 50 Philipp Hölzing benswelt abkoppelten und auf generalisierte Kommunikationsmedien wie Macht und Geld umstellten. Innerhalb dieses Lebenswelt / System-Dualismus bei Habermas bilden nun die Öffentlichkeit und die Privatsphäre die gesellschaftlichen Komponenten der Lebenswelt. Die symbolische Reproduktion der Lebenswelt verlaufe über das Medium der Sprache durch kommunikatives Handeln. Privatsphäre und Öffentlichkeit und die Subsysteme Ökonomie und Staat seien komplementär aufeinander bezogen. In der Moderne bildeten die von produktiven Funktionen entlasteten und auf Sozialisationsaufgaben ausgerichteten Kleinfamilien den institutionellen Kern der Privatsphäre. Sie erschienen aus der Perspektive des ökonomischen Systems als Umwelt der privaten Haushalte. Das Wirtschaftssystem interagiere mit ihnen über den Tausch von Lohn gegen Arbeitsleistung und über das Angebot von Gütern und Dienstleistungen gegen Nachfrage der Konsumenten. Den institutionellen Kern der Öffentlichkeit bildeten die Kommunikationsnetze von Kulturbetrieb, Presse und Massenmedien. Sie ermöglichten die Teilnahme der Privatleute an der kulturellen Reproduktion und die Teilnahme der Staatsbürger an der über öffentliche Meinung sich vollziehenden sozialen Integration. Das administrative System interagiere mit der Öffentlichkeit über den Tausch von Steuern gegen Organisationsleistungen und von politischen Entscheidungen gegen Massenloyalität. Aus diesen Austauschbeziehungen ergäben sich auf der privaten Seite die Rollen des Beschäftigten und Konsumenten, auf der öffentlichen Seite die des Klienten und Staatsbürgers. Die Rollen des Klienten und des Beschäftigten seien organisa­ tionsabhängig und rechtsförmig konstituiert. In ihnen zeigt sich nach Habermas ein schmerzvoller Rationalisierungsvorgang, der aufgrund seiner größeren Effektivität traditionale Lebensformen zerstörte. Dagegen seien die Rollen des Konsumenten und des Staatsbürgers zwar ebenfalls auf systemische Handlungsbereiche bezogen, aber nicht organisationsabhängig definiert. Die mit ihnen einhergehenden rechtlichen Normen seien der Form nach Vertragsbeziehungen oder subjektiv öffentliche Rechte. Ihre Ausfüllung erfolge durch Handlungsorientierungen, in denen private Lebensstile und kulturelle und politische Lebensformen von Individuen zum Ausdruck kämen. »Konsumenten- und Staatsbürgerrollen verweisen deshalb auf vorgängige Bildungsprozesse, in denen sich Präferenzen, Wertorientierungen, Einstellungen usw. formiert haben. Solche Orientierungen werden in 51 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Privatsphäre und Öffentlichkeit ausgebildet; sie können nicht wie Arbeitskraft oder Steuern von privaten und öffentlichen Organisationen ›gekauft‹ bzw. ›eingezogen‹ werden. Das erklärt vielleicht, warum die bürgerlichen Ideale vornehmlich an diesen Rollen ansetzen. Die Autonomie der Kaufentscheidung unabhängiger Konsumenten und die Autonomie der Wahlentscheidung souveräner Staatsbürger sind gewiß nur Postulate der bürgerlichen Ökonomie und Staatstheorie. Noch in diesen Fiktionen bringt sich aber der Umstand zur Geltung, dass die kulturellen Nachfrage- und Legitimationsmuster eigensinnige Strukturen aufweisen.«38 Diese Betonung der kontrafaktischen Geltung erinnert an eine Bemerkung von Habermas, die uns im Rahmen der Rekonstruktion der ersten Unterscheidungsform begegnet ist. In dieser Kontinuität zeigt sich das Festhalten an der ersten Unterscheidungsform von Öffentlichkeit und Privatheit. Dennoch zeigt sich nun auch an den Rollen des Konsumenten und des Staatsbürgers für Habermas die schleichende Umstellung auf die Medien Macht und Geld, da die Subsysteme Staat und Ökonomie nur über diese Medien mit ihrer Umwelt kommunizieren könnten. Diese Umstellung sei ein Anzeichen für eine ›Kolonisierung der Lebenswelt‹, die in einer Monetarisierung und Bürokratisierung von privaten und kulturell-politischen Lebensformen ihren Ausdruck finde. Die Folge seien Orientierungs- und Legitimationskrisen. »In dem Maße wie das ökonomische System die Lebensform der privaten Haushalte und die Lebensführung von Konsumenten und Beschäftigten seinen Imperativen unterwirft, gewinnen Konsumismus und Besitzindividualismus, Leistungs- und Wettbewerbsmotive prägende Kraft. Die kommunikative Alltagspraxis wird zugunsten eines spezialistisch-utilitaristischen Lebensstils einseitig rationalisiert; und diese medieninduzierte Umstellung auf zweckrationale Handlungsorientierungen ruft die Reaktion eines von diesem Rationalitätsdruck entlastenden Hedonismus hervor. Wie die Privatsphäre vom Wirtschaftssystem, so wird die Öffentlichkeit vom Verwaltungssystem unterlaufen und ausgehöhlt. Die bürokratische Vermachtung und Austrocknung spontaner Meinungs- und Willensbildungsprozesse erweitert einerseits den Spielraum für eine planmäßige Mobilisierung von Massen- 38Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2, S. 475. 52 Philipp Hölzing loyalität und erleichtert andererseits die Abkopplung der politischen Entscheidungen von Legitimationszufuhren aus identitätsbildenden, konkreten Lebenszusammenhängen.«39 Gerade der sozialstaatliche Kompromiss führt nach Habermas – auch hier zeigen sich Kontinuitäten zur früheren Studie – zu diesem Übergreifen der Systemimperative auf die Lebenswelt. Indem der soziale und demokratische Rechtsstaat durch Verrechtlichungsprozesse versuche, die Verelendungstendenzen durch Interventionen in die materielle Reproduktion zu beheben, erzeuge er diese Störung der symbolischen Reproduktion. Die privatisierten Hoffnungen auf Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung zögen sich in die Rollen des Konsumenten und sozialstaatlichen Klienten zurück.40 Mit der Rationalisierung der Lebenswelt selbst komme es darüber hinaus zu einer Institutionalisierung von Expertenkulturen, die sich von Öffentlichkeit und Privatsphäre abtrennten und Wissenschaft, Moral und Kunst professionell bearbeiten. Laut Habermas setzen sie die lebensweltlichen Traditionen unter Reflexions­druck, hinterlassen jedoch durch ihre Abkapselung nur ein »fragmentiertes Alltagsbewußtsein«,41 dem die Tradition unglaubwürdig geworden ist, ohne von Alternativen zu wissen. Die Folge seien Sinnkrisen. Öffentlichkeit und Privatsphäre seien also zugleich bedroht von einer systemischen Verdinglichung und einer kulturellen Verarmung. »Erst damit sind die Bedingungen einer Kolonialisierung der Lebenswelt erfüllt: die Imperative der verselbständigten Subsysteme dringen, sobald sie ihres ideologischen Schleiers entkleidet sind, von außen in die Lebenswelt – wie Kolonialherren in eine Stammesgesellschaft – ein und erzwingen die Assimilation; aber die zerstreuten Perspektiven der heimischen Kultur lassen sich nicht soweit koordinieren, dass das Spiel der Metropolen und des Weltmarktes von der Peripherie her durchschaut werden könnte.«42 Wir erhalten also aus der Rekonstruktion der TKH ein dritte Unterscheidungsform, die mit einer einfachen Unterscheidung zu operieren scheint (Öffentlichkeit 39Ebd., S. 480. 40Vgl. Ebd., S. 513. 41 Ebd., S. 521. 42Ebd., S. 522. 53 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 und Privatsphäre als Komponenten der Lebenswelt) und diese kommunikationstheoretisch fundiert. Sie ist jedoch eingelassen in die Unterscheidung von Lebenswelt und System, wodurch auf dieser Ebene die an die doppelte Unterscheidung erinnernde Unterscheidung von ›privater‹ Gesellschaft und ›öffentlichem‹ Staat wieder aufgegriffen wird. Darauf verweisen zudem die von Habermas skizzierten Austauschbeziehungen von Öffentlichkeit und Privatheit und Staat und Ökonomie in der Moderne (Abb.3). Abb. 3: Öffentlichkeit und Privatheit im Lebenswelt / System-Dualismus (eigene Darstellung) In diesem Abschnitt ist deutlich geworden, warum bei Habermas von einer kommunikationstheoretischen Fundierung von Öffentlichkeit und Privatheit gesprochen werden kann: Die herausgearbeitete dritte Unterscheidungsform verortet unsere Unterscheidungspole in der Lebenswelt, als deren gesellschaftliche Komponenten. Die symbolische Reproduktion dieser Lebenswelt verläuft laut Habermas über kommunikatives Handeln, das durch illokutionäre Geltungsansprüche gekennzeichnet ist. Im Falle von Interaktionsstörungen könne in den theoretischen und praktischen Diskurs oder in ein therapeutisches Gespräch eingetreten 54 Philipp Hölzing werden. Diskurse folgten den impliziten, kontrafaktischen Annahmen der idealen Sprechsituation und der Konsensustheorie der Wahrheit. Diese dritte Unterscheidungsform zeigt, wie einerseits das Zusammenspiel von bürgerlicher Öffentlichkeit und Privatsphäre der ersten Unterscheidungsform in das Konzept der Lebenswelt eingeflossen ist. Der Lebenswelt / System-Dualismus erinnert daher an die dort herausgearbeitete Unterscheidungsebene von privatem Gesellschaftsbereich und öffentlicher Gewalt bzw. Staat; nur dass der ökonomische Verkehr der Privateigentümer, analog zur zweiten Unterscheidungsform, auf die Seite des Staates gewandert ist. Man sollte diesen Vergleich natürlich nicht zu weit treiben. Dennoch lässt sich, glaube ich, erkennen, dass in der Verortung von Öffentlichkeit und Privatheit im Lebenswelt / System-Dualismus eine Art Amalgam aus den beiden ersten Unterscheidungsformen der Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit gebildet wurde. In diesem Amalgam liegt, was nicht überrascht, die normative Begründungslast ganz bei der aus der ersten Unterscheidungsform übernommenen Konzeption von bürgerlicher Öffentlichkeit und Privatsphäre, die nun als ideale Kommunikationsgemeinschaft auftritt. Dies wird auch in der Kennzeichnung der Rollen von Konsument und Staatsbürger deutlich, während vor allem die Rolle des sozialstaatlichen Klienten von Habermas negativ beurteilt wird. Die Kennzeichnung der Rolle des Beschäftigten bleibt seltsam undeutlich. Er taucht einzig systemtheoretisch in der Austauschbeziehung von Arbeitsleistung gegen Lohn auf. Die Kolonialisierungsbewegung geht, wiederum nicht überraschend, von den an die zweite Unterscheidungsform erinnernden, allerdings hier systemtheoretisch gefassten Bereichen Staat und Ökonomie aus. Was irritiert ist, dass Lebenswelt und System einseitig vermittelt bleiben, da die Systeme nur in ihren Codes mit ihrer Umwelt kommunizieren können. Man fragt sich, wie die ideale Kommunikationsgemeinschaft noch über die Öffentlichkeit auf die systemisch integrierten Bereiche von Staat und Ökonomie einwirken soll.43 Will uns Habermas hier sagen, dies sei nicht mehr möglich? Diese nur reaktive oder abwehrende Position von Öffentlichkeit und Privatheit gegenüber den Ko43Vgl. zu diesem Problem Joas, Hans: Die unglückliche Ehe von Hermeneutik und Funktionalismus. In: Honneth, Axel/ Joas, Hans (Hrsg.): Kommunikatives Handeln. Beiträge zu Jürgen Habermas Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt / M. 1986, S. 144–176 und McCarthy, Thomas: Komplexität und Demokratie – die Versuchungen der Systemtheorie. In: Ebd., S. 177–215. 55 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 lonisierungstendenzen von Staat und Ökonomie widerspricht der Annahme der Diskursethik, wonach die soziale Integration und die Legitimität des politischen Systems in der Moderne nur noch über öffentliche Diskurse hergestellt werden kann. Diskursethik und Gesellschaftstheorie bleiben hier seltsam unverbunden, wenn nicht gar widersprüchlich.44 Mit diesen Fragen wenden wir uns der Habermasschen Demokratietheorie zu. III. Wie zuvor im Zusammenhang der TKH nicht deren gesamter Argumentationsgang rekonstruiert werden konnte, so muss das hier auch für FuG nicht geschehen. Mich interessiert hier abschließend, wie Habermas von der Idee der Gleichursprünglichkeit von privater und öffentlicher Autonomie in FuG zu einer vierten Unterscheidungsform von Öffentlichkeit und Privatheit gelangt, in der Öffentlichkeit als intermediäre Struktur begriffen wird. Diese löst das Vermittlungsproblem der dritten Unterscheidungsform. Er setzt dafür bei der Unterscheidung von subjektivem und objektivem Recht an. Die subjektiven Rechte der Neuzeit haben für Habermas in FuG ihrem historischen Entstehungszusammenhang nach einen freiheitssichernden Sinn. Ihnen sei eine vom demokratischen Gesetzgebungsprozess unabhängige Autorität verliehen worden, die innerhalb der Rechtstheorie nicht zu begründen war. In der weiteren historischen Entwicklung ordnete der Rechtspositivismus, aufgrund dieser Begründungsproblematik, die subjektiven Rechte dem objektiven Recht unter. Die Legitimität des Rechts erschöpfte sich damit in der Legalität einer politischen Herrschaft. Gegen diese beiden historischen Vorläufer bringt Habermas nun den Gedanken der Gleichursprünglichkeit ins Spiel: »Subjektive Rechte sind nicht schon ihrem Begriff nach auf atomistische und entfremdete Individuen bezogen, die sich possessiv gegeneinander versteifen. Als Elemente der Rechtsordnung setzen sie vielmehr die Zusammenarbeit von Subjekten voraus, die sich in ihren reziprok aufeinander bezogenen Rechten und Pflichten als freie und gleiche Rechtsgenossen anerkennen. Die- 44Vgl. Heming, Ralf: Öffentlichkeit, Diskurs, Gesellschaft, S. 170 ff. 56 Philipp Hölzing se gegenseitige Anerkennung ist konstitutiv für eine Rechtsordnung, aus der sich einklagbare subjektive Rechte herleiten. In diesem Sinne sind subjektive Rechte mit dem objektiven Recht gleichursprünglich.«45 Nach Habermas darf ebenso das objektive Recht nicht etatistisch missverstanden werden, es leite sich aus der intersubjektiven Anerkennung ab. Seine Legitimität liege im demokratischen Rechtsetzungsprozess, der auf dem Prinzip der Volkssouveränität beruhe. Im Anschluss an Kant erklärt Habermas, dass der Hobbessche Gesellschaftsvertrag von anderer Art ist als der Privatrechtsvertrag. Er konstituiere überhaupt erst das Recht der Menschen unter öffentlichen Zwangsgesetzen zu leben. Begründet werde er bei Kant durch den autonomen Willen des Einzelnen, der als moralische Person über die soziale Perspektive einer gesetzesprüfenden Vernunft verfüge. Die Begründung erfolge also aus Moral, nicht wie bei Hobbes aus Klugheit. Habermas folgert: »Weil die Frage nach der Legitimität der freiheitssichernden Gesetze innerhalb des positiven Rechts eine Antwort finden muss, bringt der Gesellschaftsvertrag das Rechtsprinzip zur Herrschaft, indem er die politische Willensbildung des Gesetzgebers an Bedingungen eines demokratischen Verfahrens bindet, unter denen die verfahrenskonform zustandekommenden Ergebnisse per se den übereinstimmenden Willen oder vernünftigen Konsens aller Beteiligten ausdrücken. Auf diese Weise verschränken sich im Gesellschaftsvertrag das moralisch begründete Recht der Menschen auf gleiche subjektive Freiheiten mit dem Prinzip der Volkssouveränität.«46 Damit ist die Gleichursprünglichkeit von privater und öffentlicher Autonomie angedeutet, die Habermas an die Gleichursprünglichkeit von subjektiven Rechten und Volkssouveränität anknüpft. »Die Gleichursprünglichkeit von privater und öffentlicher Autonomie zeigt sich erst, wenn wir die Denkfigur der Selbstgesetzgebung, wonach die Adressaten zugleich die Urheber ihrer Rechte sind, diskurstheoretisch ent45Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt / M. 1992, S. 117 (Letzte Hervorhebung durch Autor). 46Ebd., S. 123. 57 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 schlüsseln. Die Substanz der Menschenrechte steckt dann in den formalen Bedingungen für die rechtliche Institutionalisierung jener Art diskursiver Meinungs- und Willensbildung, in der die Souveränität des Volkes rechtliche Gestalt annimmt.«47 Für den Republikanismus sei die Gesellschaft »von Haus aus eine politische Gesellschaft – societas civilis –«48 und solle sich durch Verfahren der Meinungs- und Willensbildung selbst organisieren. Nach liberaler Auffassung solle die Trennung von Staat und Gesellschaft dagegen gerade nicht aufgehoben, sondern nur durch sporadische Wahlen überbrückt werden. Habermas‘ eigene Diskurstheorie bewege sich zwischen Republikanismus und Liberalismus, insofern sie mehr wolle als der Liberalismus, aber weniger als der Republikanismus. »Die Diskurstheorie macht das Gedeihen deliberativer Politik nicht von einer kollektiv handlungsfähigen Bürgerschaft abhängig, sondern von der Institutionalisierung entsprechender Verfahren und Kommunikationsvoraussetzungen, sowie vom Zusammenspiel der institutionalisierten Beratung mit informell gebildeten öffentlichen Meinungen. Die Prozeduralisierung von Volkssouveränität und die Rückbindung des politischen Systems an die peripheren Netzwerke der Öffentlichkeit gehen zusammen mit dem Bild einer dezentrierten Gesellschaft.«49 Die politische Öffentlichkeit als Kommunikationsnetz, das das institutionalisierte demokratische Verfahren des parlamentarischen Betriebs und die nichtinstitutionalisierten Öffentlichkeiten miteinander verbinde, solle gewährleisten, dass kommunikativ erzeugte Macht durch die Gesetzgebung in administrative Macht umgeformt werden könne. Dabei unterscheidet Habermas die Zivilgesellschaft, als lebensweltliche Grundlage autonomer Öffentlichkeiten, von der öffentlichen Administration und der Ökonomie, die über die Medien Macht und Geld systemisch integriert seien. Die Zivilgesellschaft und ihre öffentliche Meinung können nach Habermas nicht selbst herrschen, dies könne nur das politische System. Aber sie könnten dessen administrative Macht in eine bestimmte Richtung lenken. 47Ebd., S. 135 (Hervorhebung durch Autor). 48Ebd. 49Ebd., S. 362. 58 Philipp Hölzing »Dem Diskursbegriff der Demokratie entspricht das Bild einer dezentrierten Gesellschaft, die allerdings mit der politischen Öffentlichkeit eine Arena für die Wahrnehmung, Identifizierung und Behandlung gesamtgesellschaftlicher Probleme ausdifferenziert.«50 Damit verabschiedet Habermas die Idee, Souveränität sei entweder im Volk oder in verfassungsrechtlichen Kompetenzen zu finden. Vielmehr sei sie in den »subjektlosen«51 Kommunikationsformen einer diskursiven Meinungs- und Willensbildung aufgegangen. Politik und Recht könnten aber nicht als autopoetisch geschlossene Systeme begriffen werden. Das rechtstaatliche politische System sei intern in Bereiche administrativer und kommunikativer Macht differenziert. Damit bleibe es gegenüber der Lebenswelt geöffnet und auf Eingaben aus den informellen Kommunikationsnetzen der Öffentlichkeit und Privatsphäre angewiesen. Ohne Anbindung an Parlament und Öffentlichkeit, als systempaternalistische Expertokratie, gerieten die politische Verwaltung und das Recht unweigerlich in Legitimationsprobleme. Das Recht diene als Transformator zwischen Privatheit, Öffentlichkeit und den systemisch integrierten Bereichen. Das rechtsstaatlich verfasste demokratische politische System wird im Hinblick auf die Kommunikations- und Entscheidungsprozesse von Habermas auf der Achse Zentrum-Peripherie angeordnet und als durch ein System von Schleusen strukturiert vorgestellt. Das Zentrum sei polyarchisch in Verwaltung und Regierung, Gerichtswesen und demokratische Verfahren der Parteienkonkurrenz, Wahl und des parlamentarischen Betriebs gegliedert. Das Parlament ist nach Habermas am sensibelsten für die Wahrnehmung gesellschaftlicher Probleme. Die Peripherie gliedere sich in Interessenverbände, politische Vereinigungen, kulturelle Einrichtungen und public interest groups. »Nun fällt ein guter Teil der normativen Erwartungen, die mit deliberativer Politik verknüpft sind, auf die peripheren Strukturen der Meinungsbildung. Die Erwartungen richten sich an deren Fähigkeit, gesamtgesellschaftliche Probleme wahrzunehmen, zu interpretieren und auf innovative Weise in Szene zu setzen. […] Resonanzfähige und autonome Öffentlichkeiten dieser Art 50Ebd., S. 365. 51Ebd. 59 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 sind angewiesen auf eine soziale Verankerung in zivilgesellschaftlichen Assoziationen und auf eine Einbettung in liberale Muster der politischen Kultur und Sozialisation, mit einem Wort: auf das Entgegenkommen einer rationalisierten Lebenswelt.«52 Öffentlichkeit ist für Habermas nun ein ebenso elementares gesellschaftliches Phänomen wie Handlung, Aktor, Gruppe oder Kollektiv. Sie entziehe sich jedoch diesen Begriffen, lasse sich aber auch weder als Institution, Organisation oder System beschreiben. Er versteht unter Öffentlichkeit ein Netzwerk für die Kommunikation. In der Öffentlichkeit würden die Kommunikationsflüsse gefiltert und synthetisiert, so dass sie sich zu thematisch gebündelten öffentlichen Meinungen verdichteten. Öffentlichkeit reproduziere sich wie die Lebenswelt durch kommunikatives Handeln über das Medium der Umgangssprache. Im Gegensatz zu spezialisierten, lebensweltlichen Handlungsbereichen wie Schule und Familie oder Wissenschaft, Moral und Kunst verbleibe die Öffentlichkeit selbst unspezialisiert. »Die Öffentlichkeit zeichnet sich vielmehr durch eine Kommunikationsstruktur aus, die sich auf einen dritten Aspekt verständigungsorientierten Handelns bezieht: weder auf Funktionen noch auf Inhalte der alltäglichen Kommunikation, sondern auf den im kommunikativen Handeln erzeugten sozialen Raum.«53 Die private Sphäre ist für Habermas ebenso wie die Öffentlichkeit ein kommunikativ erzeugter sozialer Raum, der sich von Öffentlichkeit durch Weite und Abstraktheit unterscheidet. Die Privatsphäre sei jedoch nicht ein für alle Mal von der Öffentlichkeit abgeriegelt, sondern es entstünden historisch wechselnde Grenzziehungen. Die Zivilgesellschaft ist auf der Linie der hier rekonstruierten Argumentation die strukturelle Komponente der Lebenswelt, die die Öffentlichkeit in den privaten Lebenswelten verankert. »Die Zivilgesellschaft setzt sich aus jenen mehr oder weniger spontan entstandenen Vereinigungen, Organisationen und Bewegungen zusammen, welche die Resonanz, die die gesellschaftlichen Problemlagen in den privaten Le52Ebd., S. 434. 53Ebd., S. 436. 60 Philipp Hölzing bensbereichen finden, aufnehmen, kondensieren und lautverstärkend an die politische Öffentlichkeit weiterleiten. Den Kern der Zivilgesellschaft bildet ein Assoziationswesen, das problemlösende Diskurse zu Fragen allgemeinen Interesses im Rahmen veranstalteter Öffentlichkeiten institutionalisiert.«54 Die Bedingungen der Möglichkeit einer Zivilgesellschaft sind für Habermas einerseits grundrechtlich durch die Rechte der Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit gewahrt. Andererseits könne die Zivilgesellschaft nur autonom, spontan und pluralistisch sein, wenn die Unversehrtheit privater Lebensbereiche durch den grundrechtlichen Schutz von Privatheit gewahrt werde. Die grundrechtliche Verankerung von unversehrter Privatsphäre, pluraler Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit reicht jedoch nach Habermas alleine nicht aus, um die Öffentlichkeit vor Deformationen zu bewahren. Gleichzeitig müssten die Aktoren nicht nur Themen in der Öffentlichkeit platzieren, sondern auch selbstbezüglich die Strukturen der Öffentlichkeit reproduzieren wollen. Für Habermas ist das Zusammenspiel einer zivilgesellschaftlich basierten Öffentlichkeit mit der rechtsstaatlich institutionalisierten Meinungs- und Willensbildung des parlamentarischen Betriebs eine soziologische Übersetzung des Begriffs deliberativer Demokratie. Die deliberierende Öffentlichkeit hat jedoch nach Habermas einen begrenzten Wirkungsgrad in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Ihr Ziel könne es nicht sein, im Sinne eines geschichtsphilosophisch bestimmten gesellschaftlichen Großsubjekts die Gesellschaft im Ganzen zu steuern. Die Ausdifferenzierung von autopoetischen Subsystemen wird von Habermas als evolutionärer Fortschritt begriffen. Sie wieder rückgängig zu machen, muss ihm daher als modernitätsfeindliches Ansinnen erscheinen. So kommt er zu dem Ergebnis: »In komplexen Gesellschaften bildet die Öffentlichkeit eine intermediäre Struktur, die zwischen dem politischen System einerseits, den privaten Sektoren der Lebenswelt und funktional spezifizierten Handlungssystemen andererseits vermittelt.«55 54Ebd., S. 443. 55Ebd., S. 451 (Hervorhebung von mir). 61 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Damit haben wir die vierte Unterscheidungsform in FuG herausgearbeitet (Abb. 4). Die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit wird von Habermas jetzt an der Weite und Abstraktheit kommunikativ erzeugter sozialer Räume festgemacht. Die Öffentlichkeit fungiert als intermediäre Struktur, die auf der Achse Peripherie- Zentrum angeordnet ist. Sie vermittelt die privaten Lebensbereiche über die Zivilgesellschaft mit dem politischen System. Normativ begründet wird dieses Modell der Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaates und seine Unterscheidungsform von Öffentlichkeit und Privatheit durch die Gleichursprünglichkeit von privater Autonomie (subjektive Rechte) und öffentlicher Autonomie (Volkssouveränität). Öffentlichkeit und Privatheit sind die sozialen Sphären, innerhalb deren sich öffentliche und private Autonomie realisieren lassen. Abb. 4: Öffentlichkeit und Privatheit in der Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaates (eigene Darstellung) 62 Philipp Hölzing IV. Ziel dieser Untersuchung war es, werkgeschichtlich bei Habermas nachzuvollziehen, wie sich die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit über vier Unterscheidungsformen hin transformiert. Im Verlauf wurde gezeigt, dass sich die erste, doppelte Unterscheidungsform der bürgerlichen Öffentlichkeit und Privatheit mit der zweiten, einfachen Unterscheidungsform des sozialstaatlichen Interventionismus und der Kulturindustrie in der dritten Unterscheidungsform des Lebenswelt / System-Dualismus der TKH verbindet und kommunikationstheoretisch fundiert wird. Das dort aufgetretene Vermittlungsproblem zwischen Lebenswelt und System, so wurde weiter gezeigt, löst Habermas erst durch die vierte Unterscheidungsform in FuG, in der Öffentlichkeit als intermediäre Struktur aufgefasst wird. Auf die zu Beginn aufgeworfene normative Frage, warum der politisch-soziale Raum in Öffentlichkeit und Privatheit aufgeteilt werden sollte, gibt Habermas am Ende so eine autonomie- und demokratietheoretische Antwort: es handelt sich dabei um gleichursprüngliche soziale Sphären, in denen sich die Ausübung von privater und öffentlicher Autonomie realisieren kann. Eine lebendige Demokratie ist demnach einerseits auf intakte, rechtlich geschützte Privatsphären angewiesen, damit die Zivilgesellschaft autonom, spontan und pluralistisch agieren kann. Habermas nimmt dadurch Überlegungen von Beate Rössler vorweg, die die eigene Kontrolle über eine private Sphäre als substantielle Voraussetzung von Freiheit und Autonomie betonen, wie wir zu Beginn gesehen haben.56 Er fügt diese Überlegungen zur privaten Autonomie jedoch in eine umfassendere demokratietheoretische Perspektive ein, denn andererseits benötigt die Autonomie eine öffent­ liche Sphäre, die durch Rechte der Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit gewährleistet wird, um sich artikulieren und auf das politische System einwirken zu können. Diese öffentliche Sphäre kann als intermediäre Struktur begriffen werden, die zwischen den privaten Lebensbereichen und dem politischen System vermittelt. Damit schließt Habermas in meinen Augen an die von Jeff Weintraub herausgearbeitete republikanische Verwendungsweise der Unterscheidung an, die 56Vgl. Rössler, Beate: Der Wert des Privaten. 63 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 von ihm aber gesellschafts- und kommunikationstheoretisch fundiert wird.57 Beide Pole der Unterscheidung erscheinen durch diese gesellschafts- und kommunikationstheoretische Fundierung als gleichursprüngliche politisch-soziale Sphären, deren Abgrenzung und inhaltliche Ausfüllung sich im Sinne der feministischen Kritik wandeln können, stets zur Debatte stehen und nicht natürlich sind.58 Mit dieser so rekonstruierten Theorie von Öffentlichkeit und Privatheit kann Habermas ambivalente gesellschaftliche Tendenzen und Wandlungsprozesse analytisch erfassen und gegebenenfalls normativ begründet kritisieren, ohne in den einseitigen Kulturpessimismus von Heidegger, Adorno oder Sennett zu verfallen. Damit ist, über das werkgeschichtliche Interesse dieser Untersuchung hinaus, in meinen Augen von Habermas eine plausible theoretische Konzeptionalisierung von Öffentlichkeit und Privatheit vorgelegt worden, an die weitere theoretische Versuche und empirische Untersuchungen anknüpfen können – oder mit der sie sich zumindest kritisch auseinandersetzen müssen. 57Vgl. Weintraub, Jeff: The Theory and Politics of the Public / Private Distinction, S. 7. 58Vgl. bereits in diese Richtung argumentierend Benhabib, Seyla: Modelle des öffentlichen Raums. Hannah Arendt, die liberale Tradition und Jürgen Habermas. In: dies.: Selbst im Kontext. Frankfurt/ M. 1995, S. 96–131, die allerdings wiederum mit einer starken Verengung des Republikanismusbegriffs auf Hannah Arendt bestreitet, dass Habermas diesem zugeordnet werden kann. 64 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Aufsätze Philosophie und Armut Überlegungen zu ihrem Zusammenhang Gottfried Schweiger Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Universität Salzburg E-Mail: [email protected] Abstract In this paper I explore the philosophical debate about poverty. Although there is a significant amount of philosophical research on poverty – especially on world wide and absolute poverty – there is little reflection on what philosophical poverty research could be as a distinct research agenda and also little reflection on certain questions regarding the concept and normative evaluation of poverty. Here, I explore two important questions: What is poverty, which relates to conceptual issues and the definition of poverty. How can poverty be evaluated, which brings forward the normative substance of poverty and its special relation to morality and ethics. In the last section I conclude with further remarks on such a philosophy of poverty. Schlüsselwörter Armut, Philosophie, Begriff der Armut, Bewertung von Armut 66 Gottfried Schweiger Die philosophische Literatur zu Armut ist in den letzten Jahren beträchtlich angewachsen.1 Dabei stehen vor allem Probleme der globalen Armut, insbesondere der Armut in den sich entwickelnden Ländern und die Frage im Vordergrund, welche normativen Konsequenzen aus dieser radikalen Ungleichheit zu ziehen sind. Die philosophische Literatur zu Armut ist also zum überwiegenden Teil Literatur zu globaler Ethik und globaler Gerechtigkeit.2 Der Anstoß für meinen Beitrag hier ist somit nicht, dass es keine Reflexionen über Armut und Philosophie gibt, sondern dass diese bisher zu einseitig auf einen bestimmten Aspekt fokussiert waren, während andere wichtige Aspekte vernachlässigt wurden.3 So gibt es weitaus weniger philosophische Literatur zu Fragen der Armutsmessung, der Anwendung unterschiedlicher Armutskonzepte oder zu spezifischeren Fragen wie etwa der Vererbung von Armut oder der Energiearmut.4 Bisher wird in der philosophischen Literatur weniger beachtet, was unter Armut eigentlich zu verstehen ist und welche Implikationen mit unterschiedlichen Begriffen von Armut verbunden sind. Vernachlässigt wird außerdem das Problem der relativen Armut, also jener Formen der Armut, die nicht lebensbedrohlich sind, die – um mit Pierre Bourdieu zu sprechen – nicht die große Not darstellen, sondern die kleine.5 1 Der anonyme Gutachterprozess hat erheblich zur Verbesserung dieses Artikels beigetragen, gerade weil er ihn aus sozialwissenschaftlicher Perspektive einer konstruktiven Kritik unterzogen hat. Hierfür bedanke ich mich. 2 Der Übergang zwischen globaler Ethik und globaler Gerechtigkeit ist fließend und beide werden auch nicht immer differenziert. Vgl. etwa Boylan, Michael (Hrsg): The morality and global justice reader. Boulder, CO 2011; Fleisch, Barbara / Schaber, Peter (Hrsg): Weltarmut und Ethik. Paderborn 2007; Hahn, Henning / Broszies, Christoph (Hrsg): Globale Gerechtigkeit. Schlüsseltexte zur Debatte zwischen Partikularismus und Kosmopolitismus. Berlin 2010; Hahn, Henning: Globale Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. Frankfurt am Main / New York, NY 2009; Pogge, Thomas / Moellendorf, Darrel (Hrsg): Global Justice: Seminal Essays. St. Paul, MN 2008. 3 In anderen wissenschaftlichen Disziplinen sieht dies durchaus anders aus. 4 Die wenigen Ausnahmen, die sich finden lassen, bestätigen diese Einschätzung. Vgl. etwa: Neuhäuser, Christian: Zwei Formen der Entwürdigung: Relative und absolute Armut. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 96/4 (2010), S. 542–556; Reddy, Sanjay G / Pogge, Thomas: How Not to Count the Poor. In: Anand, Sudhir / Segal, Paul D / Stiglitz, Joseph Eugene (Hrsg): Debates on the measurement of global poverty. Oxford / New York, NY 2010, p. 42–85. 5 Diese eindrückliche Stelle erklärt nicht nur bedeutsame Unterschiede im Alltagsverständnis sondern auch in der philosophischen Reflexion: »Dieses positionsbedingte Elend, bezogen auf die Perspektive dessen, der es erfährt und dabei in den Grenzen des Mikrokosmos gefangen bleibt, erscheint zwangsläufig als ‚gänzlich relativ‘, d.h. völlig irreal, 67 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Wenn ich mich in diesem Beitrag nun dem Begriff der Armut und der normativen Bewertung von Armut zuwende, so geschieht dies vor dem Hintergrund meiner Überzeugung, dass sich im Rahmen der institutionalisierten Form der Philosophie – wie sie durch Lehrstühle, Fachbereiche, Zentren, Publikationsorgane oder Gesellschaften zum Ausdruck kommt – eine philosophische Armutsforschung bzw. eine Philosophie der Armut etablieren sollte. Ich sehe vier Argumente, die hierfür sprechen: (1) Es gibt bereits diverse philosophische Bereichsdisziplinen, die deutlich machen, dass es sich bei ihren Themen um wesentliche Bereiche des menschlichen Lebens handelt, die eine Sonderstellung verdienen. Man denke hier an die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die etwa eine Philosophie des Sports oder eine Philosophie der Biologie hervorgebracht haben.6 Durch die auch nach außen sichtbare Eigenständigkeit gegenüber anderen Bereichen kann die Forschung entsprechend fokussiert und vorangetrieben werden. (2) Die anhaltende Aktualität des Armutsproblems, verstärkt in den letzten Jahren durch die weltweiten Entwicklungen der Wirtschaftskrise, seine tatsächliche globale Verbreitung in Afrika wie in Europa, in den USA wie in Asien und seine tiefgreifende Wirkung auf die Betroffenen sind für mich weitere gute Gründe, die für eine Disziplinierung in Form einer Philosophie der Armut sprechen.7 (3) Ein weiterer Grund ist das wenn man es aus der Perspektive des Makrokosmos mit dem großen situationsbedingten Elend vergleicht; ein Bezug, der übrigens tagtäglich vorgenommen wird, um jemand zu kritisieren (‚Du kannst dich nicht beklagen‘) oder aber zu trösten (‚Es gibt Schlimmeres, weißt du‘). Doch indem man die große Not zum ausschließlichen Maß aller Formen der Not erhebt, versagt man sich, einen ganzen Teil der Leiden wahrzunehmen und zu verstehen, die für eine soziale Ordnung charakteristisch sind, die gewiß die große Not zurückgedrängt hat (allerdings weniger als zuweilen behauptet wird), im Zuge ihrer Ausdifferenzierung aber auch vermehrt soziale Räume (spezifische Felder und Sub-Felder) und damit Bedingungen geschaffen hat, die eine beispiellose Entwicklung aller Formen der kleinen Nöte begünstigt haben.« Bourdieu, Pierre: Positionen und Perspektiven. In: Bourdieu, Pierre / Balazs, Gabrielle / Beaud, Stéphane / u. a.: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz 22010), S. 17–18, hier S. 18. 6 Besonders die Philosophie der Biologie ist ein interessantes Beispiel. Diese entstand unter anderem in Abgrenzung zu einer von der Physik dominierten Wissenschaftsphilosophie mit der Begründung, dass zum einen Physik und Biologie so unterschiedlich sind und die Biologie nicht auf die Physik reduziert werden kann, zum anderen dass der Biologie – vor allem durch die Evolutionstheorie und Soziobiologie – eine besondere Bedeutung innerhalb der Wissenschaften und der Gesellschaft zukommt. Ich denke, dass sich vergleichbare Argumente für eine Philosophie der Armut vorbringen lassen. 7 Dies ist in der Philosophie unbestritten und wird in der Literatur oft als Ausgangspunkt herangezogen, wie sich etwa im Erfurter Manifest zeigt. Zu einer disziplinären Formie68 Gottfried Schweiger wissenschaftspolitische Argument, dass sich die akademische Philosophie damit als gesellschaftlich und politisch relevante Disziplin in Zeiten der knappen Mittel für Forschung und Lehre positionieren kann. (4) Schließlich das Argument, dass durch die Etablierung einer Philosophie der Armut die Zusammenarbeit und die philosophische Beteiligung an Projekten einer interdisziplinären Armutsforschung gestärkt werden könnte. Bisher spielt die Philosophie, obwohl doch Armutsforschung fast immer mit normativen Maßstäben arbeitet, in diesen Bereichen nur eine untergeordnete Rolle oder kommt in den entsprechenden Handbüchern und Überblickswerken gar nicht vor.8 Die thematische und methodische Breite und Tiefe einer solchen Philosophie der Armut würde sich auf das gesamte Spektrum begrifflicher, konzeptioneller, deskriptiver und evaluativer sowie theoretischer und praktischer Fragen der Armut und angrenzender Gebiete erstrecken. Dies würde offensichtlich den Rahmen eines einzelnen Beitrags überschreiten, weshalb ich mich hier auf die Ausbreitung der beiden vorher genannten Punkte – den Begriff der Armut und der normativen Bewertung von Armut – beschränke. Mein Anspruch hier ist also wesentlich bescheidener und dennoch mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden. Zunächst ist die philosophische Literatur, die sich explizit mit dem Begriff der Armut und dem normativen Gehalt von Armut befasst, nicht umfangreich, dafür jedoch jene, die implizit oder indirekt darauf bezogen ist, sehr wohl. Das heißt, es gibt auch für diese beiden Fragen eine Reihe unterschiedlicher theoretischer Rahmen, die herangezogen werden könnten. Des Weiteren wird man bei der Behandlung beider Fragen nicht umhin können, die disziplinären Grenzen der Philosophie zurung hat es allerdings nicht geführt: Vgl. Mack, Elke / Schramm, Michael / Klasen, Stephan / u.a. (Hrsg): Absolute poverty and global justice : empirical data, moral theories, initiatives. Farnham / Burlington, VT 2009. 8 Vgl. etwa die folgenden Werke, in denen die Philosophie stets nur indirekt präsent, jedoch kein eigener philosophischer Beitrag ist. Und dies obwohl sich diese allesamt als interdisziplinär verstehen: Abrams, Dominic / Christian, Julie / Gordon, David (Hrsg): Multidisciplinary handbook of social exclusion research. Chichester 2007; Addison, Tony / Hulme, David / Kanbur, Ravi (Hrsg): Poverty dynamics : interdisciplinary perspectives. Oxford / New York, NY 2009; Dimmel, Nikolaus / Heitzmann, Karin / Schenk, Martin (Hrsg): Handbuch Armut in Österreich. Innsbruck / Wien 2009; Huster, Ernst-Ulrich / Boeckh, Jürgen / Mogge-Grotjahn, Hildegard (Hrsg): Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung. Wiesbaden 2008; Nanak Kakwani, Nanak / Silber, Jacques (Hrsg): The Many Dimensions of Poverty. Basingstoke / New York, NY 2008. 69 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 mindest an einigen Stellen zu überschreiten und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse der Armutsforschung einzubeziehen. Dies birgt das Risiko in sich, einer dieser beiden Seiten – hier insbesondere derjenigen der Sozialwissenschaften – nicht gerecht werden zu können, da die Breite und Tiefe der Rezeption sowie auch die Kenntnis unterschiedlicher Forschungsdisziplinen notwendigerweise beschränkt bleiben muss. Im ersten Abschnitt dieses Beitrags wende ich mich dem Begriff der Armut zu, wobei ich mich auf zwei seiner Eigenschaften beschränken werde. Armut ist ein »essentially contested concept« und ein »thick concept«.9 Beide Aspekte kommen in der Analyse von Armut als relationalem Begriff, der sowohl relative als auch absolute Elemente in sich vereint, zur Geltung, die ich hierfür im zweiten Abschnitt heranziehen werde. Im dritten Abschnitt wende ich mich dann der Frage zu, wie Armut bewertet werden kann bzw. der eingeschränkten Frage, wie relative Armut aus philosophischer Perspektive bewertet werden kann. Hierfür bieten sich zwei unterschiedliche Zugangsweisen an, die ich idealtypisch unterscheiden möchte: Einerseits kann die Bewertung ausgehend von etablierten Begriffen von Armut oder von empirischen Erkenntnissen, die damit erzielt wurden, vorgenommen werden. Diesen Zugang bezeichne ich als sekundären und zwar in dem Sinne, dass hier ein Begriff von Armut bzw. entsprechende empirische Erkenntnisse der Armutsforschung primär vorhanden sind, die dann philosophisch auf ihre normative Bedeutung hin evaluiert werden. Anderseits kann diese Bewertung bereits in die Begriffsbildung selbst eingeschlossen sein; als Armut wird dann bereits nur dasjenige verstanden, was die gesetzten normativen Maßstäbe erfüllt. Diesen Zugang bezeichne ich als primären, da die normative Evaluation die Begriffsbildung und empirische Forschung explizit anleitet. Beide Formen des Zugangs lassen sich theoretisch voneinander trennen, sind in der Praxis jedoch zumeist ineinander verwoben. Aus Perspektive der Philosophie bedeutet dies, dass ihre normative Bewertung zumeist als eine Verknüpfung von rekonstruktiver und evaluativer Arbeit geschehen wird. Zum Abschluss meines Beitrags werde ich dann wieder auf einige 9 Auch ich kann hier nur einzelne Aspekte, die mit einer solchen Charakterisierung von Armut verbunden sind, ansprechen. Vgl. für die Idee eines »essentially contested concept«: Garver, Eugene: Rhetoric and Essentially Contested Arguments. In: Philosophy & Rhetoric 11/3 (1978), S. 156–172 und für jenen des »thick concept«: Williams, Bernard: Ethics and the limits of philosophy. Cambridge, MA 1985. 70 Gottfried Schweiger weiterführende Perspektiven einer philosophischen Armutsforschung oder Philosophie der Armut zurückkommen. Was ist Armut: ein »essentially contested concept« und ein »thick concept« Es gibt in der Armutsforschung keinen einheitlichen Armutsbegriff, sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen Konzepten und Methoden, um Armut zu untersuchen und zu messen. Dies trifft auch für philosophische Beiträge zu, unter denen es überhaupt nur sehr wenige Ansätze gibt, sich mit Armut auf einer rein begrifflichen Ebene auseinanderzusetzen. Zumeist werden hier sozialwissenschaftliche Begriffe und Erkenntnisse einfach übernommen, ohne deren Spezifität zu reflektieren oder zu kritisieren. Diese Methode wird mich besonders im zweiten Abschnitt interessieren. Zunächst möchte ich versuchen, auf der begrifflichen Ebene zu verbleiben und möchte dafür zwei Konzepte heranziehen, die vor allem in der Metaethik, also der philosophischen Reflexion auf ethische Begriffe, diskutiert wurden. Einerseits jenes eines »essentially contested concepts« und andererseits jenes eines »thick concepts«. Diese beiden Metakonzepte, welche im Folgenden noch näher erklärt werden, zu verwenden, hat den Vorteil, dass hierdurch grundlegende Eigenschaften des Armutsbegriffes zum Vorschein gebracht werden können, ohne sich in einer unvollständigen Aufzählung und Systematisierung von unterschiedlichen Armutsbegriffen und -konzepten zu verlieren.10 Die Idee eines »essentially contested concept« bringt nun zum Ausdruck, dass es sich bei Armut um einen Begriff handelt, der aus der Perspektive verschiedener Wertvorstellungen ausgedeutet und interpretiert werden muss und dass dies notwendigerweise zu Deutungskonflikten führt, wie sie für viele normative Konzepte – man denke an Gerechtigkeit oder Menschenwürde – typisch sind. Eugene Garver hat das Konzept so beschrieben: 10Vgl. hierfür etwa die Klassifikation von Paul Spicker, der zwölf Dimensionen von sozialwissenschaftlichen Armutsbegriffen unterschieden hat: Spicker, Paul: Definitions of poverty: twelve clusters of meaning. In: Spicker, Paul / Alvarez Leguizamón, Sonia / Gordon, David (Hrsg): Poverty : an international glossary. London / New York, NY 22007, S. 229–243. 71 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 »The term essentially contested concepts gives a name to a problematic situation that many people recognize: that in certain kinds of talk there is a variety of meanings employed for key terms in an argument, and there is a feeling that dogmatism (›My answer is right and all others are wrong‹), scepticism (›All answers are equally true (or false); everyone has a right to his own truth‹), and eclecticism (›Each meaning gives a partial view so the more meanings the better‹) are none of them the appropriate attitude towards that variety of meanings.«11 Armut scheint mir offensichtlich so ein Konzept zu sein, über dessen Grundzüge zwar teilweise Konsens hergestellt werden kann, dessen nähere Bestimmung und Applikation jedoch umstritten ist. Es lässt sich also nur bis zu einem bestimmten Punkt Einigkeit darüber erzielen, welche Bedeutung von Armut die angemessenste ist und welche Konsequenzen daraus folgen sollten. Armut kann nun nicht nur als ein derartiges »essentially contested concept« verstanden werden, sondern auch als ein »thick concept« im Sinne von Bernard Williams.12 Als »thick concepts« sind solche zu verstehen, die in sich deskriptive und evaluative Elemente vereinigen und damit Beschreibung und Bewertung zusammenfallen lassen. Um es aus moralphilosophischer Perspektive zu formulieren: »thick concepts« geben nicht nur Auskunft darüber, wie die Wirklichkeit ist, sondern auch wie sie sein sollte. Wenn jemand als arm bezeichnet wird, so beschreibt dies nicht nur die Lebenslage derjenigen Person, sondern enthält zugleich die normative Bewertung, dass diese Person nicht arm sein sollte. Diese – in der Philosophie durchaus umstrittene – Eigenschaft trifft auf Armut in besonderem Maße zu, da ihr Begriff in mehreren sich überlagernden Diskursen und Praktiken verwendet und gedeutet wird. Armut ist kein »rein« wissenschaftlicher oder philosophischer, sondern ein politischer, sozialer, rechtlicher und moralischer Begriff, der sowohl beschreiben11 Garver, Eugene: Rhetoric and Essentially Contested Arguments. In: Philosophy & Rhetoric 11/3 (1978), S. 156–172, hier S. 168. 12Für Williams sind solche »thick concepts« »world-guided« und »action-guided«, während »thin concepts« wie das Gute, das Richtige oder das Verwerfliche nur »action-guided« sind: »The way these notions [=thick concepts] are applied is determined by what the world is like (for instance, by how someone has behaved), and yet, at the same time, their application usually involves a certain valuation of the situation, of persons or of actions. Moreover, they usually (though not necessarily directly) provide reason for action«. Williams, Bernard: Ethics and the limits of philosophy. Cambridge, MA 1985, S. 129-130. 72 Gottfried Schweiger de, erklärende, rechtfertigende, handlungsanleitende oder auch disziplinierende Funktionen übernehmen kann. Dabei kann die beschreibende Funktion nicht von der evaluativen getrennt werden und stets wird dasjenige, was als Armut beschrieben wird, auch normativ bewertet.13 Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive hat David Piachaud Armut als ein solches moralisches Konzept bezeichnet, um zu erklären, warum es keine wissenschaftliche Einigkeit über den Armutsbegriff geben kann.14 Die Kombination von beschreibender und evaluativer Funktion von Armut ist auch wissenschaftsphilosophisch bzw. wissenschaftstheoretisch interessant, da sie sowohl die Armutsforschung als wissenschaftliche Tätigkeit als auch die Armutsbekämpfung beeinflusst. Die Annahme und Überzeugung – wie auch immer begründet –, dass Armut etwas moralisch Schlechtes ist, stellt oftmals den Ausgangspunkt für ihre Erforschung und ihre Bekämpfung dar – in der Philosophie wie auch in den anderen Wissenschaften. Else Øyen hat dies als einen wichtigen »Mehrwert« von Armutsforschung für die Armutsforscherin selbst dargestellt. 13Angelika Linke hat gezeigt, dass dies schon für die sprachliche Ebene gilt: »Die Analyse der Semantik von ›arm‹, von ›Armut‹ und von ›Arme‹ als Personenbezeichnung macht die sprachhistorisch begründete wie aktuell gültige Verschränktheit zweier Lesarten – ›mittellos‹ und ›bemitleidenswert‹ – deutlich, die im Übrigen nicht nur für das Deutsche, sondern auch für andere Sprachen, also etwa das Italienische, Englische, Französische, gilt. Die festgestellte emotive und deontische Bedeutungskomponente von ›arm‹ ist einerseits Ausdruck, andererseits Medium einer sozialen Norm, die zu Angerührtheit und Zuwendung zu solchen Personen gegenüber verpflichtet, die wir als ›arm‹ bezeichnen. In diesem Sinne ist ›arm‹ ein Appell-Wort, das nicht nur auf einen Daseinszustand referiert, sondern immer auch die Gefühlslagen von Adressaten anspricht und gleichzeitig auf soziale Werte verweist. Es sind solche Wörter, die in Ethikdiskursen zentral sind. « Linke, Angelika: Wer ist »arm«? Soziale Kategorisierung im Medium der Sprache. In: Renz, Ursula / Bleisch, Barbara (Hrsg): Zu wenig : Dimensionen der Armut. Zürich 2007, S. 19–41, hier S. 39. 14Piachaud, David: Problems in the Definition and Measurement of Poverty In: Journal of Social Policy 16/02 (1987), S. 147–164. Geteilt wird eine solche Einschätzung etwa auch von Josef Hörl: »Allerdings gibt es über brauchbare Definitionen und die legitimen Verwendungsweisen von ›Armut‹ oder über die Abgrenzung der ›Armenbevölkerung‹ alles andere als Übereinstimmung, was nicht zuletzt mit der Tatsache zusammenhängt, daß diese Begriffe ideologisch und moralisch höchst wertgeladen sind. Die Forschenden wissen wohl, daß ›Werturteilsfreiheit‹ gerade auf dem Gebiet der Armutsforschung unerreichbar sein wird«. Hörl, Josef: Die Wahrnehmung Sozialer Benachteiligung in Österreich – Konsens und Polarisierung. In: SWS-Rundschau 39/2 (1999), S. 171-188, hier S. 171. 73 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 »The rationale for poverty research is not only intellectual. Many poverty researchers engage in the pursuit of poverty understanding because they see it as a worthwhile undertaking beyond ordinary research. Likewise, the rationale for the funding of such research is often an explicit or implicit expectation that the research results will contribute to more efficient poverty-reducing strategies.«15 Wenn nun also Armut als ein solches »essentially contested concept« und als »thick concept« verstanden werden kann, dann hat dies auch Auswirkungen darauf, wie über Armut – in Forschung, Politik und Gesellschaft – diskutiert wird. Ebenso wird hierdurch erklärbar, dass viele dieser Fragen nicht empirisch gelöst werden können, da die zu beschreibende Wirklichkeit bereits durch die zu Grunde liegende Wertung gedeutet und interpretiert wird.16 Dies lässt sich zum Beispiel gut an der Unterscheidung von relativer und absoluter Armut deutlich machen, die auch für einen philosophischen Zugang zur Armut von Bedeutung ist. Daher möchte ich diese im nächsten Abschnitt diskutieren. Relative und absolute Armut Für Richard Hauser liegt die Unterscheidung von relativer und absoluter Armut darin, dass relative Armut das Unterschreiten eines gesellschaftlich erreichten Lebensstandards meint, während absolute Armut die Existenz selbst bedroht. 15Øyen, Else: The Paradox of Poverty Research: Why is Extreme Poverty Not in Focus? In: Mack, Elke / Schramm, Michael / Klasen, Stephan / u.a. (Hrsg): Absolute poverty and global justice : empirical data, moral theories, initiatives. Farnham / Burlington, VT 2009, S. 259–271, hier S. 259. 16 Ich muss hier die Frage unbeantwortet lassen, in welchem Verhältnis die These, dass Armut ein »essentially contested concept« und ein »thick concept« ist, zum Selbstverständnis sozialwissenschaftlicher Wissenschaft als werturteilsfrei steht. Für die Philosophie stellt sich ein anderes Problem, welches ich hier nur kurz andeuten kann, nämlich der »naturalistische Fehlschluss«. Dieser besagt, dass man nicht aus einer endlichen Menge an Fakten – oder Daten – auf ein unendliches normatives Urteil schließen kann. Ein solcher Fehlschluss liegt nahe, wenn von dem Faktum der Armut auf deren moralischen oder ethischen Gehalt geschlossen wird. 74 Gottfried Schweiger »Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Armut. Absolute Armut liegt vor, wenn Menschen das zum Überleben Notwendige an Nahrung, Wasser, Kleidung, Heizung, Obdach und Hilfen gegen leicht heilbare Krankheiten fehlt. Dann droht der frühe Tod durch Verhungern, Verdursten, Erfrieren oder durch Krankheiten. Diese Menschen erreichen nicht einmal das absolute Existenzminimum.«17 In der Unterscheidung von relativer und absoluter Armut kommen also unterschiedliche, letztlich normativ gefärbte Grundannahmen über den richtigen Maßstab von Armut zum Vorschein. Während einerseits das erreichte Wohlstandniveau als Maßstab dient, ist es andererseits ein Existenzminimum, welches anthropologisch bestimmt wird. Diese Einschätzung wurde jüngst von Christian Neuhäuser geteilt, der herausgearbeitet hat, dass Armut als dreistellige Relation zu verstehen ist, nämlich als »A hat im Verhältnis zu M zu wenig von G«.18 A ist dabei die Person, die arm ist, M ist der Maßstab demgegenüber Armut gemessen wird und G sind die Güter, Ressourcen oder Fähigkeiten, mit denen Armut gemessen wird. Während relative Armut als »A hat im Verhältnis zu der Gesellschaft, in der er oder sie lebt zu wenig von G« bedeutet, bringt absolute Armut die Bedeutung »A hat im Verhältnis zu einer jeden Gesellschaft (oder im Vergleich zu den basalen Bedürfnissen des menschlichen Lebens) zu wenig von G« zum Ausdruck. Relative und absolute Armut unterscheiden sich dahingehend also nur durch die unterschiedlichen Maßstäbe, die sie zur Anwendung bringen und nicht ihrer kategorialen Form nach. Doch birgt dieses Ergebnis erst den Anfang der Diskussion und nicht ihr Ende, denn die eigentliche Herausforderung besteht nun darin, festzulegen, welche Maßstäbe herangezogen werden sollten und können, denen gegenüber Armut zu messen ist. Aus Platzgründen kann ich mich hier nur auf das M, also den Bezugspunkt, demgegenüber Armut bestimmt wird, beziehen, obwohl die Gs, mit denen 17 Hauser, Richard: Das Maß Der Armut: Armutsgrenzen Im Sozialstaatlichen Kontext. Der Sozialstatistische Diskurs. In: Huster, Ernst-Ulrich / Boeckh, Jürgen / Mogge-Grotjahn, Hildegard (Hrsg): Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung. Wiesbaden 2008, S. 94117, hier S. 96. 18Ich werde auf die weiterreichenden normativen Schlüsse, die Neuhäuser daraus zieht, hier nicht eingehen können. Vgl. hierzu: Neuhäuser, Christian: Zwei Formen Der Entwürdigung: Relative Und Absolute Armut. 75 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Armut gemessen wird, mindestens ebenso umstritten sind. Von Neuhäuser werden die Gs als Ressourcen beschrieben, es könnten jedoch auch Fähigkeiten oder anderweitige Dinge oder Eigenschaften wie etwa Gesundheit sein. Für ein relatives Verständnis ist M nun ein bestimmter Standard von Normalität in der Bezugsgesellschaft, während absolute Konzepte – wie etwa jenes der UNO – dazu tendieren, M anthropologisch zu bestimmen.19 Neuhäuser versteht dies ähnlich und schreibt hierzu: »Bei absoluter und relativer Armut handelt es sich um zwei unterschiedliche Ausprägungen von Armut. Absolut arme Menschen haben zu wenige Ressourcen, um überhaupt eine Chance auf ein gelingendes Leben zu haben. [... Relativ arme Menschen haben im Verhältnis zu ihren Mitmenschen zu wenig Ressourcen«.20 Um die richtige Bestimmung von M – und auch G – ist es auch Amartya Sen in seiner Auseinandersetzung mit Peter Townsend gegangen. Sein wesentlicher Kritikpunkt bestand darin, auf einen absoluten Kern von Armut hinzuweisen, der nicht relativ aufgelöst werden darf, eben weil der angemessene Bezugspunkt M für ihn die anthropologische Basis ist und nicht die umgebende Gesellschaft. M auf das jeweils erreichte Wohlstandsniveau festzulegen, bedeutet für ihn eine unzulässige Bestimmung des Armutsbegriffs, da hierdurch nur Ungleichheit, aber nicht notwendigerweise Armut erfasst werden könne. Seine Kritik bezieht sich also vor allem auf den normativen Kern, der im Armutsbegriff zum Ausdruck kommen sollte und der für ihn nicht in Ungleichheit aufgehen darf. Sen schreibt hierzu: »One element of that absolutist core is obvious enough, though the modern literature on the subject often does its best to ignore it. If there is starvation and hunger, then - no matter what the relative picture looks like – there clearly is poverty. In this sense the relative picture – if relevant – has to take a back seat behind the possibly dominating absolutist consideration. […] Even when we shift our attention from hunger and look at other aspects of living 19United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action: World Summit for Social Development 6-12 March 1995, New York 1995. 20Neuhäuser, Christian: Zwei Formen Der Entwürdigung: Relative Und Absolute Armut, S. 553. 76 Gottfried Schweiger standard, the absolutist aspect of poverty does not disappear. The fact that some people have a lower standard of living than others is certainly proof of inequality, but by itself it cannot be a proof of poverty unless we know something more about the standard of living that these people do in fact enjoy. It would be absurd to call someone poor just because he had the means to buy only one Cadillac a day when others in that community could buy two of these cars each day. The absolute considerations cannot be inconsequential for conceptualising poverty.«21 Damit kommen auch unterschiedliche Bezugssysteme und Anwendungsgebiete ins Spiel. Die Frage ist dann also nicht nur, wie M (und G) zu bestimmen ist, sondern auch, welchen Einschränkungen jeweilige Ms (und Gs) in ihrer explikativen Kraft unterliegen. Kann der gewählte Bezugspunkt Armut überhaupt erfassen oder zielt er nicht vielmehr auf ein anderes Phänomen? Viele absolut arme Menschen sind nicht relativ arm, da in ihrer Bezugsgesellschaft alle unter einer großen Anzahl an Einschränkungen leiden, während viele relativ arme Menschen nicht absolut arm sind, da sie im Vergleich zu der festgelegten Bezugsgröße der anthropologischen Verfassung unter keinen Einschränkungen leiden.22 Ebenso wird durch eine solche Analyse deutlich, dass sowohl relative als auch absolute Konzepte von Armut in sich absolute Standards verwenden. Die Relativität liegt im Verhältnis von »A zu M« aber nicht in M selbst. Der jeweils festgelegte Standard ist nicht mehr relativ, sondern absolut. Er »gilt« und entwickelt dadurch erst seine explikative und letztlich auch normative Kraft. Die Festlegung, dass Armut relativ zum Wohlstandsniveau in der jeweiligen Bezugsgesellschaft zu 21Sen, Amartya: Poor, Relatively Speaking. In: Oxford Economic Papers 35/2 (1983), S. 153-169, hier S. 159. 22Dies wird etwa klar, wenn man unterschiedliche Messungen mit einander vergleicht: »It is important to note that this material deprivation indicator is still a relative rather than an absolute measure: it is only by rich country standards that the lack of a colour television or a car or a week’s holiday away from home (all counted as deprivations in the EU’s indicator) could be regarded as signs of inadequate living standards. This reflects the standing of even the poorest countries in the EU as members of the rich world: Romania and Bulgaria, for example, the two poorest EU states, rank among the top third of nations in the world on the UNDP’s Human Development Index and the World Bank classifies them as ›upper middle income‹ countries.« Fahey, Tony: Poverty and the Two Concepts of Relative Deprivation, 14, Working Paper Series (Dublin: UCD School of Applied Science, July 2010). 1.6.2011, www.ucd.ie/t4cms/wp15%20fahey.pdf. 77 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 bestimmen ist, setzt dieses Wohlstandsniveau – wenn es auch variieren und sich verändern mag – als absolute Größe bzw. als Wert. Gesellschaftliche Normalität wird damit normativ aufgeladen und Armut erhält von dort aus ihre Bedeutung. Weil die adäquate Teilhabe am Wohlstandsniveau »gut« ist, ist es »schlecht« darunter zu verbleiben. Dies wird deutlich an Townsends Konzept der relativen Deprivation. »Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty when they lack the resources to obtain the type of diet, participate in the activities and have the living conditions and amenities which are customary, or are at least widely encouraged or approved, in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are, in effect, excluded from ordinary living patterns, customs and activities.«23 Hier wird Armut als das Unterschreiten von gesellschaftlicher Normalität, also auch als fehlende Zugehörigkeit gesetzt. Diese »weitverbreiteten Lebensbedingungen« besitzen offensichtlich einen intrinsischen Wert, so dass es »gut« ist daran zu partizipieren. Selbiges gilt für absolute Konzepte natürlich auch: weil es »gut« ist das Existenzminimum zu erreichen, ist es »schlecht« es zu verfehlen. Die jeweilige Güte der gewählten Ms und Gs lässt sich jedoch gar nicht anders als über solche Wertungen bestimmen – zumindest nicht auf einer grundlegenden Ebene. Man kann versuchen dies konsenstheoretisch aufzulösen, wie es etwa der Grundansatz des Deprivationsindikators der Europäischen Union ist. Diese Lösung verschiebt allerdings das Problem nur auf eine andere Ebene. Der Grundansatz ist hierbei, zu ermitteln, was von der Bevölkerung selbst als notwendig zu einem »normalen« Leben gehörig verstanden wird. Wer diesen Standard, der sich in einer Liste von Grundgütern und Dienstleistungen ausdrückt, unfreiwillig unterschreitet, gilt als arm bzw. materiell depriviert.24 Wieso jedoch die Bevölkerung überhaupt eine 23Townsend, Peter: Poverty in the United Kingdom. A Survey of Household Resources and Standards of Living. Berkeley, CA 1979, S. 31. 24Vgl. zur Erstellung dieses Indikators: Guio, Anne-Catherine: What Can Be Learned from Deprivation Indicators in Europe. Eurostat Methodologies and Working Papers (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009). 23.6.2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-09-007/EN/KS-RA-09007-EN.PDF. 78 Gottfried Schweiger solche normative Kraft entfalten können sollte, ist fraglich. Aber eben auch nicht minder fraglich als die normative Auszeichnung eines bestimmten anthropologischen Konzepts, für das Sen votiert und das sich mittlerweile einflussreich in der Philosophie und in der Armutsforschung verbreitet hat. Sein Beispiel des Hungers – im obigen Zitat – mag noch intuitiv einleuchtend sein – die Unfreiwilligkeit der Betroffenen einmal vorausgesetzt – sehr viele andere »fundamentale« Fähigkeiten sind weitaus weniger trivial zu bestimmen.25 Unterschiedliche Konzepte von Armut betonen unterschiedliche Probleme, Prozesse und Strukturen, die gegenüber anderen in den Vordergrund gerückt werden und lassen damit auch jeweils eine andere »Wirklichkeit« hervortreten. Und es ist schließlich diese »Wirklichkeit«, die in Armutsbekämpfung, Entwicklungs- und Sozialpolitik verändert wird. Wer nach einer vorherrschenden Definition nicht arm ist, der kommt möglicherweise nicht nur in der Forschung nicht vor, dem oder der bleibt auch der Zugang zu Hilfe verwehrt. Dies ist die politische und rechtliche Konsequenz aus der Entscheidung, was als M und G in der Armutsmessung gesetzt wird.26 Hierdurch wird nochmals deutlich, was mit der Beschreibung als »essentially contested concept« und als »thick concept« gemeint ist. Es sind diese Vorentscheidungen schon auf grundlegender Ebene des Armutsbegriffes, die ihn zu einem 25Ganz offensichtlich wird dies bei Martha Nussbaums Version des capability approach und ihrer Liste von Grundfähigkeiten. Vgl. etwa die Darstellung in: Graf, Gunter: Der Fähigkeitenansatz als neue Grundlage der Armutsforschung? In: SWS-Rundschau 51/1 (2011), S. 84–102. 26Es hat somit auch handfeste Auswirkungen auf die Betroffenen, was als Armut bestimmt wird: »To devise policies to reduce poverty effectively, it is important to know at what we are aiming. The current approach to the identification of poverty and policy formulation is rather messy: on the one hand, there is acknowledgement of its multidimensionality, combined with a pick-and choose approach in advocacy with little consistency across studies; on the other hand, in practice the monetary approach mostly retains its dominance in descriptions and analysis, both nationally and internationally. Clarification of how poverty is defined is extremely important, as different definitions imply the use of different indicators for measurement: they may lead to the identification of different individuals and groups as poor and require different policies for poverty reduction«. Ruggeri Laderchi, Caterina / Saith, Ruhi / Stewart, Frances: Does It Matter That We Do Not Agree on the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches. In: McGillivray, Mark / Clarke, Matthew (Hrsg): Understanding Human Well-being. Tokyo / New York, NY 2006, S. 19–53, hier S. 19. 79 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 umstrittenen Begriff machen und die sich nicht einfach in einem wissenschaftlichen Diskurs – schon gar nicht empirisch – auflösen lassen, weil sie vielmehr mit normativen Überzeugungen gefüllt sind. Dahingehend kann auch nicht gesagt werden, dass es eine richtige Antwort auf die Frage gibt, ob Armut nun relativ oder absolut verstanden werden soll, da dies erstens eine sich ausschließende Dualität suggeriert und zweitens die Komplexität gar nicht erfasst.27 Schon von ihrer begrifflichen Grundstruktur ist Armut sowohl relativ als auch absolut. Es geht aus philosophischer Perspektive also zunächst darum, kenntlich zu machen, welche Überzeugungen in welchen Konzepten »enthalten« sind und zu versuchen, deren Gehalt zu untersuchen. Dies ist dann Teil einer rekonstruktiven Arbeit, die eine normative Evaluation von Armut beeinflusst. Wie ist Armut zu bewerten: Primäre und sekundäre Herangehensweisen Habe ich im vorherigen Abschnitt versucht, mich dem Begriff der Armut zu nähern, so widme ich mich im zweiten Teil meines Beitrags der Frage, wie Armut aus philosophischer Sicht bewertet werden kann. Dabei möchte ich sogleich eine Einschränkung vornehmen, um diese Frage überhaupt im Rahmen eines Abschnitts beantworten zu können. Ich werde versuchen, zwei unterschiedliche Zugangsweisen idealtypisch zu unterscheiden, die ich als primären und sekundären Zugang bezeichne.28 Aus der Beschreibung von Armut als »essentially contested concept« und als »thick concept« folgt bereits, dass Armut ohne eine normative Bewertung nicht sinnvoll gedacht und konzipiert werden kann. Fraglich ist somit nicht, ob es einer Bewertung bedarf, sondern vielmehr, wie diese aussehen kann. Dabei geht es mir um eine normativ-philosophische Perspektive. 27Das wird auch von Hauser so klar gestellt: »Armut kann nicht objektiv nur aufgrund statistisch erhobener Fakten festgestellt werden; denn letztlich stehen hinter jeder Interpretation des Armutsbegriffs und hinter jedem darauf beruhenden Messverfahren Wertüberzeugungen, über deren Richtigkeit im ethischen Sinn nicht allgemein gültig geurteilt werden kann. Aus diesem Grund kann jedes Ergebnis einer empirischen Armutsmessung von einer anderen Wertbasis aus angegriffen werden«. Hauser, Richard: Das Maß Der Armut: Armutsgrenzen Im Sozialstaatlichen Kontext. Der Sozialstatistische Diskurs, S. 95. 28Ich kann jedoch hier ebenso wenig eine Systematisierung unterschiedlicher Bewertungen vornehmen wie ich auch nicht deren argumentative Stärken und Schwächen hier analysieren kann. 80 Gottfried Schweiger Im Grunde sehe ich zwei Möglichkeiten, wie Armut normativ bewertet werden kann. Der erste Zugang wendet sich an bereits explizierte Begriffe und Konzepte von Armut und untersucht, welchen normativen Gehalt die darin zum Ausdruck gebrachte Wirklichkeit besitzt. Auf diese Weise können auch empirische Erkenntnisse normativ interpretiert werden. Der zweite Zugang dagegen zeichnet sich dadurch aus, dass er bereits festlegt, welche Wirklichkeit als Armut bezeichnet werden sollte, um das normative Urteil zum Ausdruck zu bringen. Während im ersten Fall also Begriffe, Konzepte oder Daten im Nachhinein bewertet werden, wird im zweiten Fall versucht, bereits die Begriffe, Konzepte und Daten selbst zu prägen. Ich möchte beide illustrieren. Die European Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) stellen eine Reihe von Daten über Armut in der Europäischen Union zur Verfügung und erheben diese unter der Anwendung unterschiedlicher Armutskonzepte.29 Das Konzept der Armutsgefährdung erfasst all jene, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des äquivalisierten Medianeinkommens beträgt. Das Konzept der schweren materiellen Deprivation erfasst wiederum all jene, die sich mindes­ tens vier von neun Grundgütern und Dienstleistungen nicht leisten können.30 Ein indirekter oder sekundärer Zugang würde nun fragen, wie diese Konzepte und diese Zahlen der Betroffenheit aus normativer Sicht zu interpretieren sind. Ist es entwürdigend armutsgefährdet zu sein? Widerspricht es einem moralischen 29Vgl. für einen Überblick zu Methoden und Daten: Atkinson, Anthony B. / Marlier, Eric (Hrsg): Income and Living Conditions in Europe. Eurostat Statistical Books. Luxembourg 2010; Brian Nolan, Brian / Whelan, Christopher T.: Poverty and Deprivation in Europe. Oxford / New York, NY 2011. 30Der Indikator der erheblichen materiellen Deprivation wurde im Zuge der Europa 2020 Strategie der EU festgelegt. Die Liste der Grundgüter und Dienstleistungen sieht so aus: 1. es bestehen Zahlungsrückstände bei Miete, Betriebskosten oder Krediten. 2. es ist finanziell nicht möglich, unerwartete Ausgaben (bis zur Höhe von 60 Prozent des nationalen äquivalisierten Medianeinkommens) zu tätigen. 3. es ist finanziell nicht möglich, einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren. 4. es ist finanziell nicht möglich, die Wohnung angemessen warm zu halten. 5. es ist finanziell nicht möglich, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische Speise zu essen. 6. ein PKW ist finanziell nicht leistbar. 7. eine Waschmaschine ist finanziell nicht leistbar. 8. ein Farbfernsehgerät ist finanziell nicht leistbar. 9. ein Telefon oder Handy ist finanziell nicht leistbar. Vgl. zu den Indikatoren der Europa 2020 Strategie: Atkinson, Anthony B. / Marlier, Eric: Living Conditions in Europe and the Europe 2020 Agenda. In: Atkinson, Anthony B. / Marlier, Eric (Hrsg): Income and Living Conditions in Europe. Eurostat Statistical Books. Luxembourg 2010, S. 21–35. 81 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Recht materiell depriviert zu sein? Ab wie vielen armutsgefährdeten Menschen ist eine Gesellschaft als sozial ungerecht zu bezeichnen? Offensichtlich versucht der sekundäre Zugang eine Interpretation von vorhandenen Begriffen, Konzepten und Daten, mit denen Armut gemessen wird und die angeben, wie viele Menschen und wie stark diese betroffen sind. Es ist also zunächst auch nicht das Ziel dieses sekundären Zugangs zu fragen, ob dasjenige, was hier gemessen wird, wirklich Armut ist oder nicht. Es findet – zumindest zunächst – keine Kritik der verwendeten Begriffe und Konzepte sowie der Methoden der Datenerhebung statt. Im Falle von EU-SILC würde sich ein sekundärer Zugang also zunächst nicht damit beschäftigen, ob die Konzepte der Armutsgefährdung und der materiellen Deprivation geeignet sind, um Armut zu messen, sondern würde »nur« fragen, wie die durch sie erfasste Wirklichkeit zu bewerten ist. Diesen Zugang habe ich in einem früheren Aufsatz gewählt, in dem ich das Konzept der materiellen Deprivation mit dem Konzept der Entwürdigung von Axel Honneth in Zusammenhang setzte. Darin habe ich gezeigt, dass das unfreiwillige Leben unter den Bedingungen der materiellen Deprivation in den meisten Fällen alle Kriterien einer moralischen Verletzung und sozialen Ungerechtigkeit im Sinne einer Theorie der Anerkennung erfüllt. »Einkommensmangel und materielle Deprivation sind nämlich genau dann entwürdigend, wenn sie durch eine der drei zuvor genannten Formen der Entwürdigung verursacht sind. Also, entweder auf einem illegitimen Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt beruht, auf einer illegitimen Unterbezahlung von Arbeit oder auf einer illegitimen Unterbezahlung einer reproduktionsnotwendigen Tätigkeit.«31 Der primäre Zugang wiederum würde vor einer solchen Bewertung ansetzen und auf die begriffliche und konzeptionelle Ebene zurückgehen. Er würde sich also vor allem auf der Ebene bewegen, die im ersten Abschnitt thematisiert wurde. Ausgehend von der Form »A ist dann und nur dann arm, wenn A im Verhältnis zu M zu wenig von G hat« würde der primäre Zugang A, M und G so definieren, dass damit die Wirklichkeit gemäß der zu Grunde liegenden normativen Theorie erfasst wird. Die Ausgangsfrage für den primären Zugang lautet also nicht, wie dasjenige, was 31Schweiger, Gottfried: Relative Armut Und Soziale Wertschätzung. In: SATS. Northern European Journal of Philosophy 13/1 (2012), S. 39-59, hier S. 49. 82 Gottfried Schweiger von der Armutsforschung als Armut bestimmt und gemessen wird, zu bewerten ist, sondern welche Wertung für die Konzeption und Messung von Armut ausschlaggebend sein sollte.32 Auch hier ist wiederum ein relativ breites Spektrum an normativen Theorien denkbar, die eine geeignete Folie abgeben können. Für Neuhäuser etwa ist der Begriff der Würde im Anschluss an Avishai Margalit entscheidend und er prägt seinen Armutsbegriff dementsprechend. Für Neuhäuser stellt sich also nicht die Frage, ob etwa der Indikator der materiellen Deprivation eine Verletzung der Menschenwürde zum Ausdruck bringt, sondern er legt in seinem primären Zugang fest, dass Armut als eine solche Verletzung der Menschenwürde konzipiert werden sollte. »Bei absoluter und relativer Armut handelt es sich um zwei unterschiedliche Ausprägungen von Armut. Absolut arme Menschen haben zu wenige Ressourcen, um überhaupt eine Chance auf ein gelingendes Leben zu haben. Dies ist entwürdigend, weil diese Menschen keine Möglichkeit haben im wörtlichen Sinne auf sich selbst zu achten. [...] Relativ arme Menschen haben im Verhältnis zu ihren Mitmenschen zu wenig Ressourcen. Dies ist entwürdigend, weil sie im sozialen Sinne nicht auf sich selbst achten können.«33 Beide Zugänge zur Armutsbewertung besitzen spezifische Vor- und Nachteile. Der Vorteil des sekundären Zugangs liegt für die philosophische Analyse zunächst und vor allem darin, dass auf vorhandene Erkenntnisse – zumeist aus den Sozialwissenschaften – zurückgegriffen werden kann, die dann interpretiert werden. Es ist dies sozusagen ein arbeitsteiliger Zugang: die Sozialwissenschaften sind dafür zuständig, Armut zu definieren, zu erforschen und zu messen, die Philosophie interpretiert und bewertet dann diese Ergebnisse vor dem Hintergrund ihrer nor32Der primäre Zugang ist damit dem der sozialwissenschaftlichen Armutsforschung sehr nahe. Hauser hat die Möglichkeiten so abgesteckt: »Die konzeptionelle Bestimmung von Armut kann auf der Basis eigener Werturteile von Sozialwissenschaftlern oder von in der sozialen Praxis stehenden Personen und Organisationen, auf Basis gesellschaftlicher Konventionen oder durch politische Entscheidungen im demokratischen Prozess erfolgen. Im Diskussionsprozess um die Frage, was unter Armut zu verstehen ist, spielen philosophisch, humanistisch oder religiös begründete ethische Wertvorstellungen eine wichtige Rolle«. Hauser, Richard: Das Maß Der Armut: Armutsgrenzen Im Sozialstaatlichen Kontext. Der Sozialstatistische Diskurs, S. 95. 33Neuhäuser, Christian: Zwei Formen Der Entwürdigung: Relative Und Absolute Armut, S. 553. 83 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 mativen Theorien. Soweit es sich um in einem wissenschaftlichen Kontext anerkannte Theorien und Daten handelt, kann auch die Stichhaltigkeit der Konzepte und Daten als gesichert angenommen werden. Der sekundäre Zugang ist also auch davon geprägt, der Philosophie einen spezifischen Bereich zuzuordnen und anzuerkennen, dass diese auf die Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung angewiesen ist.34 Der primäre Zugang wiederum bietet den entscheidenden Vorteil, dass die Begriffe und Konzepte direkt geprägt werden können. Dahingehend ist er auch »freier« in seinem Verständnis von Armut und kann gezielt spezifisch normative Schwerpunkte setzen und hervorheben. Wenn etwa – wie bei Neuhäuser – der Begriff der Würde als maßgebliche Eigenschaft für das menschliche Leben angesehen wird, kann davon ausgehend, eine eigene Begrifflichkeit von Armut gebildet werden, die in bereits vorhandenen Begriffen und Konzepten vielleicht noch unberücksichtigt oder unterbelichtet ist. Der primäre Zugang erlaubt es daher auch, vorhandene Begriffe direkt auf ihren Gehalt zu analysieren und unterschiedliche Begriffe gegeneinander zu diskutieren. Begriffe von Armut können dann kritisiert werden, weil bestimmte Dimensionen, die als notwendig zur Armut gehörend betrachtet werden, nicht berücksichtigt werden. Der primäre Zugang ist daher auch nur idealtypisch von den reichhaltigen konzeptionellen und begrifflichen Diskussionen in der sozialwissenschaftlichen Armutsforschung zu unterscheiden, in dem sein metatheoretischer bzw. philosophischer Charakter betont wird. In der Praxis wird eine solche Unterscheidung zwischen dem primären philosophischen Zugang und einem begrifflich-theoretischen, jedoch sozialwissenschaftlich geprägten Diskurs 34Eine Tradition, in der dieser Zugang ausgeprägt ist, findet sich in der Kritischen Theorie von Axel Honneth und seiner Theorie der Anerkennung. Hier werden sozialwissenschaftliche Erkenntnisse – z.B. zur Arbeitswelt – ausführlich rezipiert, jedoch nicht für sich selbst thematisiert. Sie bilden eben nur den Ausgangspunkt für eine sozialphilosophische Theorie – und Evaluation. Interessanterweise wurden Teile eben dieser philosophischer Begriffe dann von SoziologInnen selbst aufgegriffen und empirisch und theoretisch nutzbar gemacht. Der Hiatus zwischen Philosophie und Soziologie wird dadurch aber nicht aufgehoben, da aus Perspektive der Philosophie »Anerkennung« weiterhin ein normativer Begriff bleibt, aus Perspektive der Soziologie aber ein beschreibender und erklärender. Vgl. dazu etwa: Holtgrewe, Ursula / Voswinkel, Stephan / Wagner, Gabriele (Hrsg): Anerkennung und Arbeit. Konstanz 2001; Honneth, Axel: Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung. In: Honneth, Axel (Hrsg): Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus. Frankfurt am Main / New York, NY 2002, S. 141–158. 84 Gottfried Schweiger nicht immer möglich sein, wie ja auch in diesem Beitrag sowohl philosophische als auch sozialwissenschaftliche Diskussionen verarbeitet werden. Für die Aufgabe einer normativen philosophischen Bewertung von Armut wird zumeist eine Mischform aus beiden Zugängen praktiziert. Einerseits werden also vorhandene Begriffe und Daten aufgegriffen, andererseits wird versucht, diese in Richtung der jeweiligen normativen Theorie zu formen bzw. zu interpretieren. Zum Abschluss dieses Abschnittes möchte ich daher noch auf diese Form der normativen Bewertung von Armut eingehen. Auch dies lässt sich gut an einem Beispiel zeigen, nämlich an der These von Peter Schaber, laut der Armut eine Verletzung der Menschenwürde darstellt, weil arme Menschen nicht auf sich selbst achten können.35 Um zu diesem Urteil zu gelangen, diskutiert Schaber einerseits einige »Fakten«, die mit Armut verbunden sind: dass armen Menschen essentielle Güter fehlen, dass diese keine Möglichkeit haben ihre Rechte wahrzunehmen, dass arme Menschen in ihrer körperlichen Integrität verletzt werden oder dass arme Menschen eben nicht auf sich selbst achten können. Die eigentlich normative Aufgabe liegt im argumentativen Aufweis, dass das Nicht-Auf-Sich-Selbst-Achten-Können eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Der Schluss ist also folgendermaßen: p1: »A ist in seiner Würde verletzt, wenn A nicht auf sich selbst achten kann« p2: »Armut ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen nicht auf sich selbst achten können« p3: »A ist arm« S: »A ist in seiner Würde verletzt« 35»Poverty, I have argued, does not violate the dignity of human beings because poor people lack vitally important goods. Neither does it violate dignity because poor people, due to poverty, are unable to realize their rights. Poverty violates human dignity, because, and insofar as, poor people are dependent on others in a specific way. It violates dignity when it is responsible for the fact that a person’s survival and her way of survival are placed at the mercy of others. Individuals who have to live in poverty are not able to stand up to others when it comes to securing their own survival. «Schaber, Peter: Absolute Poverty. In: Kaufmann, Paulus / Kuch, Hannes / Neuhäuser, Christian / u.a. (Hrsg): Humiliation, degradation, dehumanization: human dignity violated. Dordrecht / New York, NY 2011, S. 151–158, hier S. 155–156. 85 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Um diesen Schluss S zu ziehen, ist es also nötig p1 moralphilosophisch zu begründen und zu zeigen, dass p2 ein empirisch ausweisbares Faktum ist. Dafür bieten sich zwei Möglichkeiten an: (1) Es werden sozialwissenschaftliche Daten und Studien vorgebracht, die p2 direkt untermauern oder (2) es wird gezeigt, dass p2 implizit in Erkenntnissen, Definitionen oder Konzepten der Armutsforschung enthalten ist. Schaber verwendet nun keine solchen empirischen Daten, die seine These p2, wonach arme Menschen nicht auf sich selbst achten können, direkt stützen würden, sondern zitiert nur die Definition von absoluter Armut der UNO.36 Er argumentiert also, dass p2 implizit in der von ihm gewählten und übernommenen Definition von Armut der UNO enthalten ist. Dies ist weit mehr als der sekundäre Zugang – idealtypisch – erlauben würde, aber auch etwas anderes als der primäre Zugang, der Armut – wie Neuhäuser – direkt als die Unmöglichkeit auf sich selbst achten zu können, definieren würde. Schabers – durchaus erhellende – Ausführungen zu p2 stellen somit eine rekonstruktive Arbeit dar, die ihm seine evaluative erst ermöglich. Weil er zeigt, dass in der Armutsdefinition der UNO die These enthalten ist, dass arme Menschen nicht auf sich selbst achten können, ist der Schluss erlaubt, Armut als Verletzung der Würde der Betroffenen zu verstehen und dahingehend zu kritisieren. Aus diesem Beispiel kann gelernt werden, dass eine normative Bewertung von Armut aus philosophischer Sicht auch als eine Verknüpfung von Rekonstruktion und Evaluation möglich ist und ich gehe davon aus, dass die meisten philosophischen Arbeiten diese Methode anwenden. Dabei werden implizite oder explizite normative Urteile, die in vorhandenen Begriffen und Konzepten von Armut eingelassen sind, rekonstruiert und vor dem Hintergrund normativer philosophischer Theorien interpretiert. Die Sinnhaftigkeit einer solchen normativen Bewertung ist zumindest aus der philosophischen Innenperspektive klar. Ohne diese könnten keine weiterführenden handlungsanleitenden Aussagen getroffen werden. Die Kantsche Frage »Was soll ich tun?« müsste in Bezug auf die Armut und ihre Betroffenen somit unbeantwortet bleiben. Ebenso wenig lassen sich 36»Absolute poverty is a condition characterized by severe deprivation of basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education and information. It depends not only on income but also on access to social services.« United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action: World Summit for Social Development 6-12 March 1995. New York 1995. 86 Gottfried Schweiger entsprechende sozialethische, also Institutionen, Gesellschaften oder Staaten betreffende Aussagen ableiten, wenn der normative Status von Armut ungeklärt bleibt. Warum Armut überhaupt bekämpft werden sollte, bliebe – zumindest aus moralphilosophischer Perspektive – dem Feld der Interessen, der Zwecke und der Klugheit überlassen.37 Anders formuliert: Ohne eine solche philosophisch-evaluative Arbeit können zwar politische, ökonomische oder sozialtechnische Argumente für und wider die Bekämpfung von Armut vorgebracht werden, jedoch keine – im philosophischen Sinne – stichhaltigen normativen und moralischen. Schlussbemerkung: Für eine philosophische Armutsforschung In diesem Beitrag habe ich den Versuch unternommen, einige wenige, jedoch zentrale Aspekte einer philosophischen Armutsforschung oder Philosophie der Armut zu diskutieren. Dabei standen begriffliche und vor allem normative Fragen im Vordergrund, die letztlich um den Topos kreisen, mit welchen normativen Theo­rien und Konzepten Armut begriffen werden sollte. Dass dies ein offener Prozess ist, kann alleine schon an der Geschichte der normativen Disziplinen der Philosophie abgelesen werden. Bis heute gibt es keine verbindliche und akzeptierte Fassung von Termini wie Gerechtigkeit, Menschenwürde, Gemeinwohl oder dem Guten, die im Zuge jeder Armutsdiskussion kontextualisiert werden. Sie sind allesamt »essentially contested concepts«. Dennoch sind diese nicht einfach beliebig, wie manche meinen und sehr wohl der rationalen Deliberation und der wissenschaftlichen Forschung zugänglich. Auch auf diesen Gebieten lassen sich Fortschritte erzielen und Antworten formulieren, die nicht bloß eine persönliche Meinung oder ein Interesse darstellen. Eine systematische Auflösung und Differenzierung der normativen Konzepte, die in den unterschiedlichen Armutsbegriffen einer37Kant unterschiedet für Richtigkeit des Handelns die drei Fragen (die miteinander verbunden sind), ob das Handeln zweckmäßig ist, ob es klug ist und ob es moralisch richtig ist. Es war Peter Koller, der diese Unterscheidung für den Begriff des Gemeinwohls fruchtbar gemacht hat und dieses Modell ist – wie mir scheint – auch auf die Frage der Armutsbekämpfung übertragbar. Zumeist wird hier nach den Regeln der Zweckmäßigkeit und der Klugheit argumentiert, die Frage der Moral hingegen nimmt einen weniger prominenten Platz ein. Vgl. dazu: Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, In: Weischedel, Wilhelm (Hrsg): Kant-Werkausgabe, Frankfurt am Main 1968; Koller, Peter: Das Konzept des Gemeinwohls. Versuch einer Begriffsexplikation, In: Brugger, Winfried / Kirste, Stephan / Anderheiden, Michael (Hrsg): Gemeinwohl in Deutschland, Europa und der Welt. Baden-Baden 2002, S. 41-70. 87 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 seits gefunden werden können, andererseits dort verwendet werden sollten, ist dabei sicherlich ein wesentliches Desiderat philosophischer Forschung. Eine philosophische Armutsforschung oder eine Philosophie der Armut kann auf diesem Gebiet sowohl analytisch, deskriptiv als auch evaluativ vorgehen. Schließlich sind normative Fragen das Kerngeschäft moralphilosophischer, ethischer oder sozialund rechtsphilosophischer Reflexion. 88 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Aufsätze Die Zwecke der Gesellschaft Vier Modelle sozialer Teleologie Klaas Schüller Jacobs University Bremen / Universität Bremen E-Mail: [email protected] Abstract How do societies define their goals? What status do these goals have? How do they change? Who is involved in this process? These questions are addressed in social teleologies, i. e. theories about the goals of society. In this text, three ideal-typical social teleologies – traditionalism, totalitarianism and liberalism – are outlined and discussed. Since none of these approaches provides a convincing teleological conception, a fourth approach named critical republicanism is introduced. The critical-republican teleology implies a dynamic and participatory understanding of collective goals, thereby facilitating a mutual relatedness of individual and society. Schlüsselwörter Teleologie, Traditionalismus, Totalitarismus, Liberalismus, Republikanismus, Kritizismus 90 Klaas Schüller Wenn Personen Handlungen ausführen, so tun sie dies, um bestimmte Sachverhalte zu erreichen, aufrechtzuerhalten oder zu verhindern. Handlungen sind somit auf die Realisierung von Zwecken ausgerichtet.1 Häufig beziehen sich diese Zwecke ausschließlich auf die zwecksetzende Person selbst oder ihr enges privates Umfeld. In diesem Fall haben wir es mit individuellen Zwecken zu tun. Doch inwieweit gibt es darüber hinaus auch kollektive Zwecke, die auf Sachverhalte von gesellschaftlicher Relevanz verweisen? Wie entstehen diese kollektiven Zwecke und wer ist an ihrer Festlegung beteiligt? Was beinhalten sie und auf welche Art und Weise verändern sie sich? Mit diesen Fragen beschäftigen sich soziale Teleologien, d. h. Lehren von den Zwecken der Gesellschaft. In diesem Text entwickle ich zunächst drei idealtypische Modelle sozialer Teleologie. Erstens handelt es sich dabei um den Traditionalismus, in dem kollektive Zwecke implizit durch die Ausübung überlieferter sozialer Praktiken entstehen und weitergegeben werden. Zweitens wird der Totalitarismus betrachtet, in dem eine übergeordnete Autorität umfassende kollektive Zwecke aus einem letztgültigen ideologischen System herleitet und für verbindlich erklärt. Drittens kommt der Liberalismus zur Sprache, in dem die Festlegung kollektiver Zwecke abgelehnt wird, um eine freie Wahl individueller Zwecke zu ermöglichen. In der folgenden Diskussion komme ich zu dem Ergebnis, dass keines dieser drei teleologischen Modelle überzeugen kann. Anschließend entwerfe ich daher ein viertes Modell. Dieses grenzt sich scharf vom Traditionalismus und vom Totalitarismus ab und befindet sich gleichzeitig in kritischer Distanz zur liberalen (Anti-) Teleologie, wie sie etwa in Anknüpfung an John Rawls auch in der zeitgenössischen Politischen Theorie vertreten wird. Anstatt in der prinzipiellen Verneinung kollektiver Zwecke zu verharren, werden im von mir befürworteten vierten Modell Zwecke mittlerer Reichweite angestrebt, die in einer pluralistischen Öffentlichkeit definiert und fortlaufend revidiert werden. Durch eine Verbindung von Aspekten des Republikanismus mit dem Prinzip des Kritizismus wird darauf abgezielt, die Unzulänglichkeiten des Liberalismus zu vermeiden und ein wechselseitiges Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu fördern. 1 Vgl. Hartmann, Dirk: Kulturalistische Handlungstheorie. In: Hartmann, Dirk / Janich, Peter (Hrsg.): Methodischer Kulturalismus. Zwischen Naturalismus und Postmoderne. Frankfurt am Main 1996, S. 70–114, hier S. 78 f. 91 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Traditionelle, totalitäre und liberale Teleologie Das erste Modell ist das der traditionellen Teleologie. In diesem Modell existiert kein ausformuliertes Gedankengebäude, aus dem ausdrückliche kollektive Zwecke ableitbar wären. Stattdessen entstehen die kollektiven Zwecke implizit durch die alltäglichen gesellschaftlichen Interaktionen. Sie werden »gelebt« und sind den überlieferten sozialen Praktiken eingeschrieben. Den Bezugspunkt der kollektiven Zwecke bildet die unmittelbare Lebenswelt des Gemeinwesens. Aufgrund des impliziten Charakters der kollektiven Zwecke gibt es im traditionellen Modell keine eindeutig identifizierbare zwecksetzende Instanz. Zwar nehmen gewisse Autoritätspersonen eine herausgehobene Position bei der Stützung der kollektiven Zwecke ein, aber in erster Linie werden sie durch Fortschreibung von Traditionen beiläufig vererbt und erlernt. Entsprechend verändern sich die kollektiven Zwecke vor allem durch graduelle Verschiebungen der Alltagspraxis. Bewusste Abweichungen vom Zweckkonsens sind hingegen sozial geächtet und werden gegebenenfalls sanktioniert. Das zweite Modell ist das der totalitären Teleologie. Hier steht eine herausgehobene Autorität in Gestalt einer kleinen Elite hierarchisch über der restlichen Gesellschaft. Sie allein legt fest, welche Zwecke das Gemeinwesen als Ganzes verfolgen soll. Diese Zwecke werden aus einem allgemeinen ideologischen System hergeleitet und beziehen sich auf umfassende gesellschaftliche Idealzustände. Sie verfügen über den Status sicherer Erkenntnisse und unumstößlicher Bestimmungen, von denen nicht abgewichen werden darf. Ändern können sich die kollektiven Zwecke daher nur, wenn die herausgehobene Autorität dies so anordnet. Die Mitglieder der Gesellschaft werden von dieser Autorität in einen vollständigen und einheitlichen Sinnkontext eingebunden. Obwohl die Menschen im Gesamtgefüge der Gesellschaft verschiedene Funktionen übernehmen, gelten doch für alle die selben übergeordneten kollektiven Zwecke, zu deren Erreichung jeder Einzelne ein Stück beiträgt. Damit ist letztlich das ganze Dasein darauf abgestimmt, den vorgegebenen Zwecken näherzukommen; alle Lebensbereiche sind von der Ausrichtung auf die kollektiven Zwecke durchdrungen. 92 Klaas Schüller Es lassen sich zwei Varianten der totalitären Zwecksetzung unterscheiden. In der diesseitigen Spielart strebt die Gesellschaft einen als ideal betrachteten irdischen Zustand an, der sich im Vergleich zur Vergangenheit und zur Gegenwart durch signifikante politische, wirtschaftliche oder kulturelle Vorzüge auszeichnet. In dieser Variante nimmt ein säkularer Staat die Position der zwecksetzenden Autorität ein. Er definiert den Sinnhorizont der Gesellschaft und verbreitet ihn in allen Bereichen des Gemeinwesens. In der metaphysisch-jenseitigen Variante totalitärer Zwecksetzung wird hingegen ein Zustand anvisiert, der in einer übernatürlichen Sphäre verortet wird. Die irdische Gesellschaft stellt in diesem Sinnkontext eine Art Vorstufe zu dem jenseitigen Ideal dar. In der metaphysisch-jenseitigen Modellvariante sind es institutionalisierte Religionen oder klerikale Staaten, die die Rolle der übergeordneten Autorität einnehmen und ihre Ideologie und ihre Praktiken allen gesellschaftlichen Bereichen überstülpen. Das dritte Modell ist das der liberalen Teleologie, in dem die Festlegung kollektiver Zwecke abgelehnt wird. Es existieren kein Ziele, die die Gesellschaft als solche anstrebt.2 Stattdessen ist die Definition von Zwecken völlig den einzelnen Menschen überantwortet, die als autonome und selbstbestimmt handelnde Personen begriffen werden. Diese setzen sich individuelle Zwecke, die auf ihr eigenes Leben und ihr privates Umfeld abstellen. Da im liberalen Modell jeder frei in der Wahl seiner persönlichen Zwecke ist, kann eine Vielzahl unterschiedlicher individueller Zwecksetzungen entstehen. Jegliche Akteure, die der Gesellschaft allgemeinverbindliche Zwecke vorgeben wollen, stehen hingegen unter dem Verdacht der anti-liberalen Bevormundung. Entsprechend verfügt auch der Staat nur über einen eng begrenzten Kompetenzbereich. Er schreibt seinen Bürgern keine Zwecke vor, sondern garantiert einen rudimentären rechtlichen Rahmen, in dem die Angehörigen der Gesellschaft ihre individuellen Zwecke definieren und verfolgen können. Es herrscht ein Politikverständnis, das sich vom Streben nach großen gesellschaftlichen Entwürfen distanziert. Neben der Bereitstellung des rechtlichen Rahmens begnügt sich die staatliche Politik 2 Zum anti-teleologischen Charakter des Liberalismus vgl. Rawls, John: Gerechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht metaphysisch. In: Rawls, John: Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978–1989. Frankfurt am Main 1994, S. 255–292, hier S. 288 f. 93 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 mit der Moderation partikularer Interessen und der reaktiven Bearbeitung von Einzelproblemen. Stärken und Schwächen des Traditionalismus, Totalitarismus und Liberalismus Wo liegen nun die Stärken und Schwächen dieser drei Modelle sozialer Teleologie? Kehren wir zunächst zum traditionellen Szenario zurück. Dabei ist es wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass die Frage, an welchen kollektiven Zwecken sich das Gemeinwesen orientieren soll, in diesem Modell als solche gar nicht auftaucht. Kollektive Zwecke existieren hier eher implizit und sind den alltäglichen sozialen Praktiken eingeschrieben. Sie werden beiläufig weitergegeben und sind kein Gegenstand einer bewussten Wahl oder einer allgemeinen Diskussion. Da die überlieferten Zwecke als selbstverständlich erscheinen, sind alternative Zwecksetzungen – verkörpert in abweichenden Praktiken – selten. Je nach Perspektive birgt diese Situation nun bestimmte Vor- und Nachteile. Aus dem Blickwinkel der ihr ausgesetzten Personen erscheint sie als weitgehend akzeptabel. Die Frage der Zwecksetzung wird nicht problematisiert, und daher gibt es am bestehenden Zustand augenscheinlich auch nichts auszusetzen. Im Gegenteil: Die Mitglieder wachsen in eine Gesellschaft hinein, die ihnen einen relativ verlässlichen normativen Orientierungsrahmen bietet und die »Last« der individuellen und kollektiven Zwecksuche erst gar nicht entstehen lässt. Dieser Vorzug verkehrt sich jedoch ins Gegenteil, wenn eine externe Perspektive eingenommen wird, die vom Wert der persönlichen Autonomie ausgeht. Dann erscheint eine Gesellschaft, die tradierte Zweckvorstellungen lebt und unbeirrt weitergibt, als potenzielle Einschränkung der selbstbestimmten Entwicklung der Individuen. Sobald Mitglieder der Gesellschaft tatsächlich mit den überlieferten Zwecken in Konflikt geraten, wird dies auch aus dem Blickwinkel der Beteiligten zu einem realen Problem, da wenig Raum für Abweichungen besteht. Es existiert kein anerkanntes Verfahren, mittels dem alternative Ansichten und Praktiken in die bestehende Struktur integriert werden können. Auch gibt es keinen Mechanismus, der die bewusste Modifikation der kollektiven Zwecke vorsieht; sie wandeln sich lediglich implizit und graduell. Aus diesem Grund ist eine Gesellschaft, in 94 Klaas Schüller der eine traditionelle Teleologie wirksam ist, schlecht darauf vorbereitet, sich an veränderte natürliche und kulturelle Bedingungen anzupassen. Noch stärker als im traditionellen Modell finden sich die Gesellschaftsmitglieder im totalitären Modell in einem festgefügten telelogischen Bezugssystem wieder. Hier sind die kollektiven Zwecke nicht nur in sozialen Praktiken verkörpert; sie sind in ein ausdrückliches ideologisches Gerüst eingeflochten, klar identifizierbar und aus der Sicht ihrer Verfechter wohlbegründet. Idealtypisch verstehen sich alle Individuen und gesellschaftlichen Gruppen als Teil eines Kollektivs, das auf diese umfassenden, von einer übergeordneten Autorität vorgegebenen Zwecke hinarbeitet. Der totalitäre Ansatz kann daher als Versuch gedeutet werden, den im traditionellen Modell organisch entstehenden dichten Sinnkontext bewusst herbeizuführen und zu intensivieren. Entsprechend entfällt auch im totalitären Modell die mitunter schwierige eigenständige Suche nach individuellen und kollektiven Zwecken. Zusätzlich soll die Einbindung in eine einheitliche Struktur, in der alle Beteiligten gemeinschaftlich zur Verwirklichung der gleichen Zwecke beitragen, die gesellschaftsinterne Solidarität sicherstellen und die soziale Geborgenheit stärken. Diesen gefühlten Vorteilen des totalitären Modells stehen jedoch mehrere schwerwiegende Nachteile entgegen. Ein Kernproblem stellt hierbei der dogmatische Status der kollektiven Zwecke dar. Sie bilden die obersten Ziele der Gesellschaft und sind als Teil einer offiziellen Ideologie immun gegen Kritik. Weder findet eine offene theoretische Auseinandersetzung statt, noch gibt es alternative Lebensweisen, die die kollektiven Zwecke durch ihr praktisches Beispiel in Zweifel ziehen könnten. Dieser Zustand der Homogenität kann nur aufrechterhalten werden, indem Abweichungen von vornherein unterdrückt werden. Damit wird die autonome Festlegung von Zwecken, die gegen das vorgegebene ideologische System verstoßen, unmöglich. Das Individuum wird zum Baustein eines übermächtigen Kollektivs erklärt und erfüllt Funktionen, die ihm von außen auferlegt werden. Es wird zum Objekt eines Denkens, in dem die alles überragenden kollektiven Zwecke die Mittel heiligen und in dem jede Einschränkung in der Gegenwart mit dem 95 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Verweis auf einen in der Zukunft liegenden Idealzustand gerechtfertigt werden kann.3 Die Verabsolutierung der offiziellen Zwecke und die Verhinderung des Pluralismus haben zudem Folgen, die über den individuellen Bereich weit hinausgehen. Wenn keine alternativen Denk- und Lebensweisen zugelassen werden, fehlen genau jene Mechanismen der Kritik, durch die die ideologischen und praktischen Schwachstellen des herrschenden Systems erst sichtbar würden und auf deren Grundlage Verbesserungen stattfinden könnten. Weil sie die fundamentale Fehlbarkeit menschlicher Erkenntnis nicht in Rechnung stellt, birgt die Strategie der Dogmatisierung der Zwecksetzungen das Risiko, auch gravierende Irrtümer dauerhaft fortzuschreiben.4 Noch stärker als im traditionellen Modell tritt in diesem Szenario daher das Problem der mangelnden Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft auf, das sich insbesondere bei raschen Veränderungen von Rahmenbedingungen als existenzbedrohend erweisen kann. Das Problem der geringen Flexibilität wird zusätzlich durch den hohen Grad der Durchdringung der gesamten Gesellschaft von der Verfolgung der kollektiven Zwecke verschärft. Alle gesellschaftlichen Bereiche sind darauf programmiert, einen Beitrag zur Annäherung an die absolut gesetzten Zwecke zu leisten. Da jegliche Ressourcen in eine Richtung gelenkt werden, entstehen massive institutionelle Pfadabhängigkeiten. Eine Kurskorrektur wäre äußerst kostspielig, da sie die Neuausrichtung sehr vieler Ressourcen implizieren würde. Ein Verbleiben auf dem alten Kurs wird daher nahezu unausweichlich.5 Zwei weitere Schwächen des totalitären Modells sind als Folge der Monopolstellung anzusehen, die in Bezug auf die Setzung von Zwecken vorliegt. Nur die übergeordnete Autorität ist dazu berechtigt, die kollektiven Zwecke festzulegen. Hier3 Vgl. Popper, Karl R.: Utopie und Gewalt. In: Popper, Karl R.: Vermutungen und Widerlegungen. Das Wachstum der wissenschaftlichen Erkenntnis. Teilband II: Widerlegungen. Tübingen 1997, S. 515–527, hier S. 520–523. 4 Vgl. Albert, Hans: Die Idee der kritischen Vernunft. In: Albert, Hans: Plädoyer für kritischen Rationalismus. München 1971, S. 11–29, hier S. 15–17. 5 Zum allgemeinen Gedanken der Pfadabhängigkeit siehe Pierson, Paul: Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. In: The American Political Science Review XCIV (2000), S. 251–267. 96 Klaas Schüller aus resultiert erstens ein Wissensproblem: Eine solche zentrale Instanz kann nicht über alle Informationen verfügen, die dafür notwendig wären, um umfas­sende gesellschaftliche Zwecke sicher bestimmen oder auch nur ihre Erreichung verlässlich planen und steuern zu können. Das hypothetisch dafür benötigte Wissen ist nämlich auf zahllose Träger verteilt oder schlichtweg inexistent.6 Zweitens impliziert die Monopolstellung der übergeordneten Autorität, dass die Zwecksetzung ausschließlich von »oben nach unten« verläuft. In dieser Konstellation besteht das hohe Risiko, dass sich auf Dauer eine Lücke zwischen den Zweckvorgaben der Elite und den Sichtweisen der breiten Bevölkerung auftut. Die übergeordnete Autorität kann zwar für sich in Anspruch nehmen, stellvertretend für die ganze Bevölkerung zu handeln; da aber keine direkte Artikulationsmöglichkeit von »unten nach oben« vorgesehen ist, müssen die Interessen der Bevölkerung von der Elite unterstellt und im Lichte der offiziellen Ideologie interpretiert werden. Dadurch tritt die Situation ein, dass die Interessen der Bevölkerung seitens der übergeordneten Autorität falsch eingeschätzt oder ganz ignoriert werden.7 Dies erscheint unter normativen Gesichtspunkten als fragwürdig, und es stellt die dauerhafte Stabilität einer solchen Gesellschaftsform in Frage. Einige dieser Nachteile des Totalitarismus sind im liberalen Modell aufgehoben. Hier gibt es keine staatlichen oder religiösen Autoritäten, die der Gesellschaft oder den Individuen Zwecke auferlegen. Die klassischen Bedrohungen der Freiheit sind damit ausgeschaltet, und die Mitglieder der Gesellschaft können ihre individuellen Präferenzen besser zur Geltung bringen. Eine Vielfalt von Denk- und Lebensweisen kann sich entfalten, ohne dass diese willentlich eingeschränkt oder gar mit Gewalt unterdrückt wird. Darüber hinaus ist der Dogmatismus, der im totalitären Modell zu verheerenden Folgen führt, im liberalen Szenario unbekannt. Auch fehlt die starke soziale Kontrolle, die in der traditionellen Teleologie Veränderungen erschwert. Im Optimalfall hindert niemand die Individuen daran, ihre Ziele laufend zu überdenken und sie bei Bedarf anzupassen. 6 Vgl. Hayek, Friedrich August: The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. London 1988, S. 85 ff. 7 Vgl. Albert, Hans: Aufklärung und Steuerung. Gesellschaft, Wissenschaft und Politik in der Perspektive des kritischen Rationalismus. In: Albert, Hans: Kritische Vernunft und menschliche Praxis. Stuttgart 1984, S. 180–210, hier S. 202–204. 97 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Den Hauptbezugspunkt des Modells bilden damit eindeutig die individuellen Zwecke einzelner Personen. Dies ist der Bereich, den es aus liberaler Perspektive zu schützen gilt. Es gibt hingegen keine kollektiven Zwecke, die festlegen, in welche Richtung sich die Gesellschaft insgesamt bewegen soll. Der gesellschaftliche Sinnhorizont ist gewollt leer: Wo es keine verbindlichen Traditionen und keine autoritären Institutionen gibt, die der Gesellschaft allgemeingültige kollektive Zwecke auferlegen, so die liberale Idee, verfügen die Individuen über einen ungestörten Spielraum zur Setzung ihrer eigenen Zwecke. Der Liberalismus »erkauft« sich die Freiheit zum individuellen Sinn durch den Verzicht auf kollektiven Sinn. Eine Implikation des Fehlens kollektiver Zwecke im liberalen Modell besteht jedoch darin, dass es keine Orientierungspunkte gibt, an denen sich die Gesellschaft in ihrer Gesamtentwicklung ausrichten könnte. Dies hat zur Folge, dass sich die Gesellschaft zwar verändert, dies aber ohne kollektive Steuerung tut. Die faktische Entwicklung der Gesamtgesellschaft ist nicht das Ergebnis zielgerichteter Eingriffe, sondern die unbeabsichtigte Nebenfolge der eigentlich auf individuelle Zwecke ausgerichteten Handlungen einzelner Akteure. Ob dies aus der Sicht der Betroffenen zu positiven oder zu negativen Konsequenzen führt, ist letztlich dem Zufall überlassen. Diese Situation stellt die bereits angesprochene Flexibilität – und damit auch die Problemlösungsfähigkeit – des liberalen Modells in Frage. Idealtypisch können die Gesellschaftsmitglieder ihre persönlichen Zwecke hier in der Tat schneller und ungestörter anpassen als in den anderen Modellen. Doch diese Anpassungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf den individuellen Bereich. Auf der gesellschaftlichen Ebene kann nur sehr schwer eine bewusste Anpassung stattfinden, da hierzu die institutionellen und ideellen Voraussetzungen fehlen; es existieren weder Instanzen, die zu einer gesamtgesellschaftlichen Steuerung fähig und befugt wären, noch liegen kollektive Zwecke vor, an denen sich eine solche Steuerung orientieren könnte. So kann etwa der Staat nicht eigenmächtig auf kollektive Probleme reagieren, sondern erst, sobald die Probleme mit den individuellen Zwecken der einzelnen Gesellschaftsmitglieder in Konflikt kommen. Genuin kollektive Probleme, die sich nicht auf die individuelle Ebene »herunterbrechen« lassen, 98 Klaas Schüller bleiben aus diesem Grund dauerhaft ungelöst.8 Somit sind die Einzelpersonen in der liberalen Gesellschaft zwar frei, ihre individuellen Zwecke zu setzen und diese flexibel zu ändern, aber dies reicht zur Bewältigung kollektiver Probleme nicht aus. Die isolierte Anpassung des persönlichen »Lebensstils« als Reaktion auf kollektive Probleme bleibt ein hilfloser Versuch, auf der individuellen Ebene das nachzuholen, was auf der gesellschaftlichen Ebene unterbleibt. Das Fehlen kollektiver Zwecke in einer an der liberalen Teleologie ausgerichteten Gesellschaft verändert darüber hinaus das Selbstverständnis der in ihr lebenden Menschen und ihre Beziehungen untereinander. Anders als im traditionellen und im totalitären Modell werden den Gesellschaftsmitgliedern keine verbindlichen Zwecke überliefert oder vorgegeben. Stattdessen wird von den Individuen erwartet, dass sie sich als autonom denkende und handelnde Personen eigenständig ihre persönlichen Zwecke setzen. Da keine vorgefertigten sozialen Rollen an sie herangetragen werden, werden ihnen erhebliche »biographische Eigenleistungen«9 abverlangt; die Individuen müssen ihren Platz in der Gesellschaft selbst finden. Die Folgen dieses strukturellen Individualismus sind ambivalent. Einerseits ermöglicht er den Menschen, sich von den erzwungenen Bindungen an die Gemeinschaft zu emanzipieren. Die Individuen sind frei von staatlicher und religiöser Unterdrückung, und sie werden reflektierter und selbstständiger. Auch kann die eigenständige Zwecksuche durchaus als befriedigender und seinerseits sinnvoller Prozess gesehen werden. Andererseits besteht die Gefahr, dass die freigesetzten Individuen sich ohnmächtig und isoliert fühlen, da sie sich mit einer Gesellschaft konfrontiert sehen, die ihnen keinerlei Sicherheit und soziale Geborgenheit bietet.10 Da jede Person sich ihre eigenen individuellen Zwecke setzt, ist der Bestand an geteilten Werten, Deutungsmustern und Identitäten gering, und die Menschen erleben sich nicht als Bestandteil eines integrierten Ganzen. Infolgedessen wird ein instrumentelles Verständnis sozialer Beziehungen begünstigt. Anstatt wechselseitig aufeinander bezogen zu sein, treten die »atomistischen« Subjekte11 aus8 Der Bereich der Umweltzerstörung bietet hierfür zahlreiche empirische Beispiele. 9 Honneth, Axel: Individualisierung und Gemeinschaft. In: Zahlmann, Christel (Hrsg.): Kommunitarismus in der Diskussion. Berlin 1992, S. 16–23, hier S. 19. 10Vgl. Fromm, Erich: Die Furcht vor der Freiheit. München 2010, S. 32 f. 11 Vgl. Taylor, Charles: Atomism. In: Avineri, Shlomo / De-Shalit, Avner (Hrsg.): Commu- 99 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 schließlich miteinander in Verbindung, weil es der Realisierung ihrer jeweiligen individuellen Zwecke nützt.12 Die Menschen handeln zwar im Hinblick auf ihre individuellen Zwecke sinnhaft, aber aus der gesellschaftlichen Perspektive verhalten sie sich aneinander vorbei. Jenseits von Sinndiktat und Sinnvakuum Wie wir gesehen haben, sind alle bislang diskutierten Modelle sozialer Teleologie mit Schwächen behaftet. Im traditionellen Modell ist es das Fehlen eines anerkannten Mechanismus des Zweckwandels, der zu einer mangelnden Dynamik und zu einer geringen Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft führt. Die kollektiven Zwecke ändern sich lediglich implizit durch die graduelle Verschiebung der ­sozialen Praktiken. Es bleibt zudem wenig Spielraum für den Einzelnen, sich bewusst seine eigenen vom sozialen Konsens abweichenden Zwecke zu setzen. Im totalitären Modell sind zwar explizite kollektive Zwecke vorhanden, aber ihre Definition obliegt ausschließlich einer übergeordneten Autorität. Die Verpflichtung der gesamten Gesellschaft auf die von der Autorität gesetzten Zwecke führt zu einem sehr dichten, aber ebenfalls starren und nur durch die Unterdrückung von Alternativen aufrechtzuerhaltenden Sinnkontext. Im liberalen Modell liegen hingegen überhaupt keine kollektiven Zwecke vor, und die Sinnsuche ist völlig den Einzelpersonen übertragen. Dies führt einerseits zu mehr individueller Freiheit, andererseits aber auch zu einem Mangel an wechselseitiger Bezogenheit und Gemeinschaftlichkeit. Bei aller berechtigten Skepsis gegenüber dem Kollektivismus läuft der Liberalismus damit Gefahr, von einem Extrem ins andere zu verfallen. An die Stelle des überlieferten oder des diktierten Sinns tritt ein kollektives Sinnvakuum. Doch haben wir es wirklich mit einem Nullsummenspiel zu tun, in dem ein Mehr an individueller Freiheit nur auf Kosten des kollektiven Sinns erreicht werden nitarianism and Individualism. Oxford 1992, S. 29–50. 12 Dies bedeutet, dass die Menschen auch im liberalen Modell nicht immer rein isoliert voneinander handeln. Vielmehr bilden sie in bestimmten Fällen Handlungszusammenhänge mit anderen Menschen, d. h. sie stimmen ihre Handlungen aufeinander ab. Sie tun dies jedoch nicht, um gemeinsam kollektive Zwecke zu erreichen, sondern um ihre jeweiligen individuellen Zwecke besser zu realisieren. Aus diesem Grund haben wir es im liberalen Modell lediglich mit einer egoistisch-instrumentellen Form der Kooperation zu tun. 100 Klaas Schüller kann, und ein Zuwachs an kollektivem Sinn nur durch die Preisgabe individueller Freiheit? Dies muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Im Folgenden skizziere ich ein viertes, an republikanischen Ideen orientiertes Modell sozialer Teleologie, in dem individuelle und kollektive Zwecke in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen. Es geht damit um eine Teleologie, an der die in einer Gesellschaft lebenden Menschen teilhaben können, ohne dass sie dabei ihre Individualität und ihren Spielraum zur Setzung selbstgewählter individueller Zwecke aufgeben müssen. Vom Zweckabsolutismus zu intermediären Zwecken Um uns einem vierten Modell sozialer Teleologie anzunähern, müssen wir zunächst den Begriff des kollektiven Zwecks genauer analysieren. Kollektive Zwecke zeichnen sich nach dem oben entwickelten Verständnis dadurch aus, dass sie auf Sachverhalte von gesellschaftlicher Relevanz verweisen. Damit ist jedoch lediglich der Bezugsrahmen kollektiver Zwecke angedeutet, während über ihren epistemischen Status nichts ausgesagt ist. Wie in der Darstellung des totalitären Modells gezeigt wurde, kann kollektiven Zwecken der Status sicherer Erkenntnisse zugeschrieben werden. Sie verfügen dort über den Charakter unbezweifelbarer Dogmen und »endgültige[r] Ziele«13. Diesem absolutistischen Verständnis muss man jedoch keineswegs folgen. Ebenso denkbar sind Zwecke, die über den Status vorläufig akzeptierter regulativer Ideen verfügen. Sie sind zu jeder Zeit kritisierbar und revidierbar und dienen als Orientierungspunkte des sozialen Handelns, aber sie schreiben keine allgemeinverbindlichen Ziele dauerhaft fest. Die durch den Dogmatismus verursachte Inflexibilität und Lernresistenz wird damit vermieden. Darüber hinaus können sich kollektive Zwecke im Hinblick auf ihren Zustimmungsgrad unterscheiden. Sie müssen nicht wie im traditionellen und totalitären Modell von nahezu allen Mitgliedern der Gesellschaft geteilt werden. Es ist ohne Weiteres vorstellbar – und auch empirisch immer wieder zu beobachten –, dass auch zahlenmäßig kleinere Gruppen als Träger kollektiver Zwecke auftreten und dabei eine beträchtliche gesellschaftliche Signifikanz erreichen. Eine »öffentliche Übereinstimmung«14 im Sinne eines allgemeinen Konsenses über die kollektiven 13 Popper, Karl R.: Utopie und Gewalt, S. 520. 14 Rawls, John: Gerechtigkeit als Fairneß, S. 289. 101 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Zwecke ist hierzu nicht erforderlich. Wenn nicht die gesamte Gesellschaft auf dieselben Zwecke festgelegt ist, kann sich vielmehr ein Pluralismus unterschiedlicher kollektiver Zweck-Angebote entwickeln. Abweichungen müssen in dieser Situation nicht sanktioniert oder gewaltsam unterdrückt werden, sondern können in eine bestehende Landschaft konkurrierender oder komplementärer kollektiver Zwecke integriert werden. Neben dem epistemischen Status und dem Zustimmungsgrad kann auch der Umfang kollektiver Zwecke variieren. Offensichtlich lässt sich nicht exakt bestimmen, ab wann ein Sachverhalt, auf den sich ein Zweck bezieht, weitreichend genug ist, damit er als »gesellschaftlich relevant« bezeichnet werden kann. Keinesfalls muss jedoch – wie im Totalitarismus – ein gesamtgesellschaftlicher Idealzustand postuliert werden, damit dieses Kriterium erfüllt ist. Bei kollektiven Zwecken geht es somit nicht zwangsläufig um »umfassende Lehre[n]«15 oder um eine »Konzeption des Guten«16 schlechthin. Sie können sich ebenso auf anspruchsvolle, aber eher bereichsspezifische gesellschaftliche Zustände beziehen, die vergleichsweise besser bewertet werden als die Alternativen. In diesem Fall sind die Zwecke weniger umfangreich, und sie verlieren ihren metaphysisch-absoluten Charakter, über den sie mitunter im Kontext politischer Utopien oder religiöser Systeme verfügen. Der Umfang kollektiver Zwecke wirkt sich schließlich auch auf ihr Verhältnis zu individuellen Zwecken aus. Im traditionellen und insbesondere im totalitären Modell überlagern die umfassenden kollektiven Zwecke die individuellen Zwecke und haben Vorrang vor diesen; die soziale Rolle des Einzelnen und seine individuellen Zwecke sind aus den kollektiven Zwecken ableitbar. Haben wir es jedoch mit weniger umfassenden kollektiven Zwecken zu tun, lassen diese genügend Spielraum für die selbstbestimmte Setzung individueller Zwecke. Die Individuen verfügen dann über eine – beispielsweise durch personenbezogene Grundrechte geschützte – Sphäre, die nicht zwangsweise von den kollektiven Zwecken beeinträchtigt werden darf. Anstatt in einem hierarchischen Verhältnis zueinander zu stehen, 15 Rawls, John: Der Bereich des Politischen und der Gedanke eines übergreifenden Konsenses. In: Rawls, John: Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978–1989. Frankfurt am Main 1994, S. 333–363, hier S. 344. 16 Rawls, John: Gerechtigkeit als Fairneß, S. 289. 102 Klaas Schüller ergänzen sich die kollektiven und die individuellen Zwecke in diesem Fall gegenseitig. Wie wir gesehen haben, kann der Begriff des kollektiven Zwecks in unterschiedlicher Weise interpretiert werden. Die Ausdeutung des Begriffs im traditionellen und vor allem im totalitären Modell lässt sich zusammenfassend als zu weitgehend bewerten. Kollektive Zwecke führen dort zu negativen Konsequenzen, weil sie von einem zu hohen Grad an Gewissheit, zu hoher Allgemeinverbindlichkeit und einem zu großem Umfang gekennzeichnet sind. Das alternative Verständnis des Begriffs zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass kollektive Zwecke nichtdogmatisch (sondern vorläufig akzeptiert), nicht für alle zustimmungspflichtig (sondern lediglich von signifikanten Gruppen unterstützt) und nicht allumfassend (aber dennoch gesellschaftlich relevant) sind. Sie befinden sich folglich im Hinblick auf ihren epistemischen Status, ihren Zustimmungsgrad und ihren Umfang auf einer mittleren Ebene. Aus diesem Grund sollen kollektive Zwecke dieses Typs als intermediäre Zwecke bezeichnet werden. Die Entstehung intermediärer Zwecke in der Öffentlichkeit Ein gewichtiger Nachteil der traditionellen und totalitären Teleologien besteht im jeweiligen Modus der Zwecksetzung und des Zweckwandels. Kollektive Zwecke entwickeln sich im traditionellen Modell durch soziale Praktiken und deren graduelle Verschiebung, und im totalitären Modell werden sie von einer übergeordneten Autorität festgelegt und gegebenenfalls von dieser verändert. In beiden Modellen fehlt somit ein dynamischer und flexibler Mechanismus, der die bewusste Veränderung der kollektiven Zwecke ermöglicht. Zurückzuführen ist dies auf einen Mangel an zweckbezogener Kommunikation. Während diese im traditionellen Modell aufgrund des impliziten Charakters der kollektiven Zwecke weitgehend unterbleibt, vollzieht sie sich im totalitären Modell lediglich einseitig, indem die übergeordnete Autorität der übrigen Gesellschaft die kollektiven Zwecke verkündet. In beiden Fällen fehlt demzufolge Kommunikation im Sinne einer wechselseitigen und im Hinblick auf ihre Teilnehmer und ihre Ergebnisse offenen Verständigung. Doch gerade diese eine Vielzahl von Perspektiven einbeziehende Form der Kommunikation wäre notwendig, um kollektive Zwecke immer wieder modifizieren zu können. 103 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Der Ort, an dem eine in diesem Sinne kommunikative Auseinandersetzung über die kollektiven Zwecke einer Gesellschaft stattfinden kann, ist die politische Öffentlichkeit. Diese stellt ein allgemein sichtbares Forum dar, in dem die das Gemeinwesen als solches betreffenden Belange beraten werden. Jedem Akteur steht es frei, seine gesellschaftlich relevanten Ideen in der Öffentlichkeit vorzubringen. Die anderen an der Öffentlichkeit teilhabenden Gesellschaftsmitglieder greifen diese Ideen auf, beleuchten sie unter allen erdenklichen Gesichtspunkten und analysieren sie auf ihre Tragfähigkeit. Es entsteht mithin ein öffentlicher Diskurs, in dem Vorschläge zur Fortentwicklung der Gesellschaft vorgebracht, rezipiert und diskutiert werden. Dieser Diskurs umfasst einerseits öffentliche sprachliche Äußerungen. Andererseits schließt er aber auch bestimmte nicht-sprachliche Praktiken ein. So kann eine Auseinandersetzung innerhalb eines Diskurses nicht nur in Form von (sprachlichen) Argumenten geführt werden, sondern auch mittels nicht-sprachlicher symbolischer Praktiken und mittels der öffentlich wahrnehmbaren Praktizierung voneinander abweichender Handlungs- und Lebensweisen. In einem solchen kontroversen und vielgestaltigen Diskurs manifestiert sich das Prinzip des Kritizismus, das ausgehend von der Fehlbarkeit und der inhärenten Unvollständigkeit menschlicher Erkenntnis auf die beständige Prüfung jeglicher Problemlösungsversuche setzt.17 In dem öffentlichen Diskurs kristallisieren sich vielfältige kollektive Zwecke heraus, die aufgrund der prinzipiell niemals abgeschlossenen Kritik stets über einen vorläufigen und verbesserungswürdigen Charakter verfügen. Da der öffentliche Diskurs uneingeschränkt zugänglich für unterschiedliche Perspektiven ist, herrscht ein struktureller Pluralismus, der erstens eine vergleichende Beurteilung kollektiver Zwecke ermöglicht und zweitens verhindert, dass es zu einem völligen Konsens und zur Verabsolutierung bestimmter kollektiver Zwecke kommt. Der Pluralismus sorgt gleichsam für eine wohltuende Relativierung der kollektiven Zwecke und führt ununterbrochen vor Augen, dass immer auch Alternativen möglich wären. Bei den kollektiven Zwecken, die in einer dem Kritizismus verpflichte17Zum Kritizismus vgl. Albert, Hans: Die Idee der kritischen Vernunft, S. 15–24; Albert, Hans: Traktat über rationale Praxis. Tübingen 1978, S. 7 ff.; Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft. Tübingen 51991, S. 42–44; sowie Niemann, Hans-Joachim: Die Strategie der Vernunft. Rationalität in Erkenntnis, Moral und Metaphysik. Braunschweig / Wiesbaden 1993, S. 7 ff. 104 Klaas Schüller ten Öffentlichkeit entstehen, handelt es sich demzufolge um intermediäre Zwecke im oben erläuterten Sinn. Sie bieten gesellschaftliche Orientierung, sind dabei aber flexibel genug, um laufend an veränderte Problemsituationen angepasst zu werden. Eine nach diesem Muster funktionierende Öffentlichkeit impliziert, dass es sich bei der Setzung und beim Wandel von Zwecken um einen irreduzibel gemeinschaftlichen Vorgang handelt. Der öffentliche Diskurs ist ein Prozess, in dem sich Ansichten im Lichte der von anderen Personen vorgebrachten Kritik weiterentwickeln und sich wechselseitig inspirieren. Folglich bilden sich in diesem Modell Vorstellungen über die kollektiven Zwecke erst in menschlicher Interaktion und durch die Konfrontation mit einer Vielfalt von Perspektiven heraus. Niemand kennt bereits die Ziele, die er mit Anderen erreichen will, bevor er mit diesen in einen Diskurs und in ein gemeinsames politisches Leben eingetreten ist. 18 Dies bedeutet, dass kollektive Zwecke nicht einfach aus einem vorpolitischen Raum in die Öffentlichkeit hineingetragen werden, sondern sich zu einem wesentlichen Teil erst in ihr herausbilden. Dieses konstitutive Verständnis von Öffentlichkeit als zentralem Ort der politischen Auseinandersetzung bildet das republikanische Element des vierten Modells.19 Damit die Öffentlichkeit als eigenständige Sphäre fungieren kann, in der sich kollektive Zwecke herauskristallisieren, muss sie als umfassendes Forum verstanden werden, in dem unterschiedlichste Ansichten, Argumente und Praktiken aufeinandertreffen. Alle Arten von Beiträgen können in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden, sind dabei aber auch gleichermaßen Gegenstand von Befürwortung, Abgrenzung und Kritik.20 Erst in einer solchen Situation des echten Pluralismus, der auch miteinander inkompatible Sichtweisen einschließt, kann 18 Vgl. Dewey, John: The Future of Liberalism. In: The Journal of Philosophy XXXII (1935), S. 225–230, sowie Taylor, Charles: Atomism, S. 43–49. 19Vgl. Bonacker, Thorsten: Die politische Theorie des freiheitlichen Republikanismus: Hannah Arendt. In: Brodocz, André / Schaal, Gary S. (Hrsg.): Politische Theorien der Gegenwart I. Opladen 2002, S. 183–219, hier S. 186 ff. 20Dies impliziert, dass auch weltanschaulich und religiös fundierte Beiträge im öffentlichen Diskurs auftauchen können. Da sie keinen Sonderstatus genießen, sind sie allerdings auch in gleicher Weise der Kritik ausgesetzt wie alle anderen Diskursbeiträge. Vgl. Dacey, Austin: The Secular Conscience. Why Belief Belongs in Public Life. Amherst 2008, S. 39 ff. 105 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 eine leidenschaftliche und kontroverse Auseinandersetzung über die Zwecke einer Gesellschaft geführt werden. Die Gegensätzlichkeit der Positionen sorgt für eine ständige Dynamik, trägt zu einer fortlaufenden Willensbildung der Beteiligten bei und ermöglicht ihnen, sich im Hinblick auf die Zwecke der Gesellschaft zu orientieren und zu positionieren.21 Dieses expansive Verständnis von politischer Öffentlichkeit unterscheidet sich offensichtlich grundlegend von den traditionellen und totalitären Modellen, die keine bzw. nur eine einseitig strukturierte Öffentlichkeit umfassen. Es ist jedoch ebenso vom oben diskutierten liberalen Modell abzugrenzen. Dieses beinhaltet zwar aufgrund seines freiheitlichen Charakters eine allgemein zugängliche Öffentlichkeit, doch diese hat nicht die eigenständige Konstitution kollektiver Zwecke zur Aufgabe, sondern lediglich die Aggregation und Vermittlung vorpolitisch entstandener individueller Zwecke. Anstatt eine kollektive Auseinandersetzung über die Zwecke der Gesellschaft zu beherbergen, ist die Öffentlichkeit dort angefüllt mit Partikularinteressen, die, weil sie nicht im gemeinschaftlichen Diskurs entstanden sind, inhaltlich unverbunden nebeneinander stehen.22 Ferner ist das expansive Verständnis von Öffentlichkeit abzugrenzen von liberalen Konzeptionen, die auf eine Beschneidung der politischen Sphäre hinauslaufen. Während diese darauf abzielen, fundamentalen Dissens aus einem eng gefassten »Bereich des Politischen«23 auszuklammern, geht es im hier bevorzugten vierten Modell um eine Ausweitung des politischen Diskurses im Hinblick auf die zugelassenen Themen, Argumente und – indem die Sprachfixierung liberaler Diskursmodelle überwunden wird – Praktiken. Ein solcher umfassender Diskurs ist folglich nicht darauf festgelegt, eine »vernünftige Übereinstimmung«24 der Beteiligten über 21Dieses dynamische Verständnis öffentlicher Diskurse bedeutet nicht, dass alle Themen permanent Gegenstand kontroverser Auseinandersetzungen sind. Themen, die gegenwärtig nicht als problematisch wahrgenommen werden oder unstrittig sind, brauchen nicht ständig öffentlich diskutiert zu werden. Es besteht aber jederzeit die Möglichkeit, sie in den öffentlichen Diskurs einzubringen und sie damit zu (re-)politisieren. 22Vgl. Bauman, Zygmunt: Flüchtige Moderne. Frankfurt am Main 2003, S. 47–54. 23Rawls, John: Der Bereich des Politischen und der Gedanke eines übergreifenden Konsenses. Vgl. Ackerman, Bruce: Warum Dialog? In: van den Brink, Bert / van Reijen, Willem (Hrsg.): Bürgergesellschaft, Recht und Demokratie. Frankfurt am Main 1995, S. 385– 410, hier S. 399 ff., sowie Larmore, Charles: Patterns of Moral Complexity. Cambridge 1987, S. 50 ff. 24Rawls, John: Der Bereich des Politischen und der Gedanke eines übergreifenden Konsen106 Klaas Schüller ohnehin relativ unkontroverse Einzelheiten herbeizuführen; vielmehr hat er die Funktion, eine Vielfalt voneinander unterscheidbarer intermediärer kollektiver Zwecke hervorzubringen. Den verödeten Varianten liberaler Öffentlichkeit wird damit ein genuin politischer Ort im Sinne eines permanenten produktiven Konflikts entgegengestellt. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft In den vorangegangenen Abschnitten wurde zunächst verdeutlicht, um welche Art von kollektiven Zwecken es sich im vierten Modell sozialer Teleologie handelt. Anschließend wurde skizziert, wie diese Zwecke entstehen und sich weiterentwickeln. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft präzisieren. Im traditionellen, totalitären und liberalen Modell haben wir es jeweils mit einer einseitigen Beziehung zwischen diesen beiden Polen zu tun. Während die Gesellschaft in den ersten beiden Modellen das Leben der Individuen bestimmt, nutzt das Individuum die Gesellschaft im dritten Modell instrumentell zur Verwirklichung seiner autonom gesetzten persönlichen Zwecke. Im Gegensatz dazu ermöglicht das vierte Modell eine in beide Richtungen verlaufende Beziehung. Einerseits prägt das Individuum die Gesellschaft, aber gleichzeitig wirkt diese auf das Individuum zurück. Dies geschieht in einem niemals vollendeten, von beiden Seiten fortgeschriebenen Prozess. Das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft im vierten Modell kann demzufolge als iterativ und zirkulär beschrieben werden. Inwiefern ist dies der Fall? Wir haben gesehen, dass im vierten Modell sozialer Teleologie eine Öffentlichkeit existiert, die für alle Gesellschaftsmitglieder zugänglich ist. Es steht ihnen frei, ihre Ideen, Argumente und Praktiken in den öffentlichen Diskurs einfließen zu lassen. Diese Offenheit der Öffentlichkeit ist die Grundbedingung dafür, dass die Individuen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft nehmen können. Die Besonderheit des vierten Modells besteht jedoch darin, dass wir es mit einer Öffentlichkeit zu tun haben, die nicht nur vom Input der Individuen mitgeformt wird, sondern auch inhaltlich auf die Beiträge der Individuen reagiert. An der Öffentlichkeit haben Akteure teil, die den »Input« der Individuen rezipieren und sich von ihm affizieren lassen, ihn gleichzeitig aber ses, S. 340. 107 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 auch kommentieren und kritisieren. Mit anderen Worten handelt es sich um eine resonanzfähige Öffentlichkeit, d. h. eine Öffentlichkeit, die in einer verständigungsorientierten Weise antwortet. Die Reaktion der Öffentlichkeit wirkt wiederum auf das Individuum zurück, das seine Ansichten nun gegebenenfalls revidieren und sich von seinem veränderten Standpunkt aus erneut an die Öffentlichkeit wenden kann. Es ist genau dieses fortwährende Antworten auf beiden Seiten, das die Iterativität und die Zirkularität der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft ausmacht. Dieses allgemeine Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft spiegelt sich auch im Verhältnis von individuellen und kollektiven Zwecken wider. Das Individuum prägt durch sein öffentliches Engagement die kollektiven Zwecke der Gesellschaft mit. Gleichzeitig wirken die kollektiven Zwecke auf seine individuellen Zwecke zurück, indem sie als Orientierungsangebote fungieren, die Implikationen für den persönlichen Bereich haben können. Individuelle und kollektive Zwecke stehen im vierten Modell mithin in einem produktiven Austausch, ohne sich gegenseitig zu determinieren. Individuelle Implikationen Zu welchen weiteren Konsequenzen führen die geschilderten Eigenschaften des vierten Modells nun für die Stellung des Individuums? Die erste Konsequenz besteht darin, dass das Individuum durch die Möglichkeit des öffentlichen Engagements zu seinem gesellschaftlichen Umfeld in eine echte – und nicht nur einseitig-instrumentelle – Beziehung treten kann. Bereits die Entwicklung kollektiver Zwecke ist ein gemeinschaftlicher, in der Öffentlichkeit vorangetriebener Prozess, in den sich das Individuum aus freien Stücken einschalten kann. Die kollektiven Zwecke, die sich in diesem Prozess herausbilden, sind in diesem Fall so beschaffen, dass sich das Individuum aufgrund seiner eigenen Mitwirkung in ihnen wiedererkennen kann. Durch diese Identifikation begreift sich das Individuum nicht länger als eine von der Gesellschaft getrennte, isolierte Einheit. Es kann stattdessen teilhaben am Projekt einer gemeinsam gestalteten Gesellschaft, und dieses Hinausgehen über den privaten Bereich verleiht seinem Leben Orientierung 108 Klaas Schüller und eine zusätzliche Ebene von Sinn.25 Wir haben es also mit einem Individuum zu tun, das produktiv mit seinem gesellschaftlichen Umfeld verwoben sein kann, ohne dabei seine Persönlichkeit zu verlieren oder völlig in einem Kollektiv aufgehen zu müssen. Die zweite Konsequenz für die Stellung des Individuums bezieht sich auf dessen persönliche Freiheit. Wie wir gesehen haben, führt das Vorhandensein kollektiver Zwecke im traditionellen und im totalitären Modell zu einer Verringerung der individuellen Freiheit; der Zuwachs an kollektivem Sinn wird durch den Verzicht auf individuelle Selbstbestimmung erreicht. Das vierte Modell zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass dieser Zusammenhang durchbrochen und der individuelle Freiheitsspielraum durch die Existenz kollektiver Zwecke sogar erweitert wird. Die Grundbedingung hierfür ist zunächst, dass die negative Freiheit ähnlich wie im liberalen Modell erhalten bleibt. Da es sich bei den kollektiven Zwecken des vierten Modells um intermediäre Zwecke mit begrenzter Reichweite handelt, ist sichergestellt, dass das Individuum über eine autonome persönliche Sphäre verfügt, die nicht gegen seinen Willen von den kollektiven Zwecken berührt wird. Darüber hinaus bieten sich dem Individuum im vierten Modell jedoch größere Möglichkeiten zur Realisierung positiver Freiheit als im liberalen Modell. Dies ist der Fall, weil das Individuum im vierten Modell nicht darauf beschränkt ist, sich seine persönlichen Zwecke zu setzen. Es kann zudem den privaten Bereich transzendieren, indem es an der gemeinschaftlichen Gestaltung der Gesellschaft mitwirkt. Dies stellt eine erhebliche Erweiterung seines positiven Handlungsspielraums dar, und das konzertierte Handeln mit Anderen konstituiert eine Form von Macht, die ein Einzelner für sich allein niemals erreichen könnte.26 Gesellschaftliche Implikationen Zwei weitere Implikationen des vierten Modells beziehen sich auf die Ebene der Gesellschaft. Die erste betrifft die Steuerungsfähigkeit des Gemeinwesens. Die Kritik des liberalen Modells hatte ergeben, dass genuin kollektive Probleme, die 25Vgl. Singer, Peter: Wie sollen wir leben? Ethik in einer egoistischen Zeit. München 2004, S. 250–254. 26Vgl. Arendt, Hannah: Macht und Gewalt. München / Zürich 1970, S. 45, sowie Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 2007, S. 252 ff. 109 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 sich nicht auf die individuelle Ebene »herunterbrechen« lassen, dauerhaft ungelöst bleiben, sofern eine Gesellschaft über keine kollektiven Zwecke verfügt. Im vierten Modell kann sich die Gesellschaft hingegen an den vorhandenen intermediären Zwecken orientieren, um auf kollektive Probleme zu reagieren. Unter Berufung auf diese intermediären Zwecke kann sie kollektive Probleme bekämpfen, bevor sich diese so verschärft haben, dass sie die individuellen Zwecke der Gesellschaftsmitglieder direkt tangieren. Die intermediären Zwecke bilden somit die ideelle Voraussetzung dafür, die Entwicklung der Gesellschaft in einem stärkeren Maße bewusst und planvoll gestalten zu können. Kommen wir nun zur zweiten Implikation des vierten Modells auf der gesellschaftlichen Ebene. Oben wurde dargelegt, dass eine wesentliche Funktion der Öffentlichkeit in der Hervorbringung intermediärer kollektiver Zwecke besteht. Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit jedoch auch im Hinblick auf die Konstitution und die Integration der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Die Öffentlichkeit stellt ein Forum dar, in dem die Ansichten und Praktiken unterschiedlichster Diskursteilnehmer aufeinandertreffen und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der öffentliche Diskurs verbindet also Menschen miteinander, die ansonsten durch geographische und lebensweltliche Trennung gar nicht miteinander in Kontakt gekommen wären. Die Öffentlichkeit trägt daher einen wesentlichen Teil dazu bei, die Gesellschaft, über deren kollektive Zwecke sie berät, als soziale Einheit erst zu erschaffen. Diese durch die Öffentlichkeit ermöglichte gesellschaftliche Integration vollzieht sich einerseits dadurch, dass die Diskursteilnehmer in positiver Weise aufeinander Bezug nehmen. Durch die allgemein sichtbare und zugängliche Suche nach kollektiven Zwecken bilden sich Gemeinsamkeiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern heraus, und der Bestand an übereinstimmenden Ansichten und Werten wächst. Andererseits wird die gesellschaftliche Integration unter bestimmten Bedingungen auch – was in den Diskussionen über dieses Thema oftmals ignoriert wird – durch den öffentlichen Konflikt vorangetrieben. Denn gerade die kritische Auseinandersetzung mit abweichenden Vorstellungen erfordert ja, sich mit diesen ernsthaft zu beschäftigen und mithin intensiv auf diese bezogen zu sein, anstatt ihnen gleichgültig und somit unverbunden gegenüber zu stehen. Dies bedeutet, dass auch die Abgrenzung, sofern sie auf inhaltlichen Gründen basiert, eine Verknüp110 Klaas Schüller fung zwischen Individuen und Gruppen herstellen und somit zur gesellschaftlichen Integration beitragen kann. Hierfür bildet eine pluralistische und kritische Öffentlichkeit, in der auch grundlegend konträre Ansichten aufeinandertreffen und in einen friedlichen Diskurs überführt werden, einen passenden Rahmen. Ein kritischer Republikanismus In der Gesamtschau lassen sich mehrere spezifische Eigenschaften des vierten Modells sozialer Teleologie festhalten. Bei den kollektiven Zwecken des vierten Modells handelt es sich um intermediäre Zwecke, die zwar gesellschaftlich relevant, dabei aber nicht-dogmatisch, nicht für alle zustimmungspflichtig und nicht allumfassend sind. Diese intermediären Zwecke entstehen und wandeln sich dynamisch in den kritischen Diskursen einer expansiv verstandenen pluralistischen Öffentlichkeit. Durch die Resonanzfähigkeit der Öffentlichkeit wird ein Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ermöglicht, das als iterativ und zirkulär beschrieben wurde. Das Individuum kann infolgedessen mit der Gesellschaft in eine produktive Beziehung treten und sich in ihren kollektiven Zwecken wiederfinden. Aufgrund erweiterter kollektiver Handlungsmöglichkeiten vergrößert sich zudem seine positive Freiheit. Auf der gesellschaftlichen Ebene sind durch die Existenz intermediärer kollektiver Zwecke die ideellen Voraussetzungen für die Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft gegeben. Schließlich trägt das Zusammenspiel der Akteure in der Öffentlichkeit zur Konstitution und Integration der Gesellschaft bei. Diese Eigenschaften unterscheiden das vierte Modell grundlegend von den zuvor erörterten Ansätzen. Der Liberalismus wurde insbesondere wegen seiner kollektiven Sinnleere und der daraus resultierenden Probleme kritisiert. Die Diskussion der Alternativen hat jedoch verdeutlicht, dass es vor dem Hintergrund der liberalen Pathologien weder um eine sozialromantische Beschwörung der traditionellen Gemeinschaft noch um eine Rehabilitierung totalitärer Kollektivismen gehen kann. Vielmehr gilt es, die Konturen einer sozialen Teleologie herauszuarbeiten, die ein als sinnhaft wahrgenommenes Bezogensein des Individuums auf die Gesellschaft unter Beibehaltung negativer persönlicher Freiheiten ermöglicht. 111 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Während sich das vierte Modell demnach klar von traditionellen, totalitären und liberalen Ansätzen abhebt, bestehen wie bereits angedeutet Anknüpfungspunkte an republikanische Theorien der Politik. Deren kleinster gemeinsamer Nenner besteht darin, dass das Politische als eine allgemeine Beratung über die öffentlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft gedeutet wird.27 Genau dies stellt auch den Kern des hier entwickelten vierten Modells dar: Im Gegensatz zum »Implizitismus« des traditionellen Modells, zum Elitismus des totalitären Modells und zum Privatismus des liberalen Modells wird die Definition der kollektiven Zwecke in den öffentlichen Raum verschoben und zum Gegenstand einer allgemeinen Auseinandersetzung gemacht. Jenseits dieser Gemeinsamkeit ist das vierte Modell jedoch von Varianten des Republikanismus abzugrenzen, die insbesondere auf die »patriotische Identifikation«28 des Bürgers mit der Gesellschaft abstellen. Die Pointe des hier vorgeschlagenen Modells besteht gerade nicht darin, Traditionen »zu ehren und zu bewahren«29, sondern sie zu kritisieren und zu revidieren. Dies geschieht in einem in die Zukunft gerichteten, niemals abgeschlossenen Prozess, und genau dieses gemeinschaftliche Ringen um die kollektiven Zwecke ermöglicht eine aufgeklärte Identifikation mit dem Gemeinwesen und das Entstehen eines reflexiven Sinns. Es ist folglich eine Verbindung von Republikanismus und Kritizismus, die die besten Voraussetzungen für eine akzeptable soziale Teleologie bietet. 27Vgl. Brunkhorst, Hauke: Republikanismus. In: Gosepath, Stefan / Hinsch, Wilfried / Rössler, Beate (Hrsg.): Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie. Band 2: N–Z. Berlin 2008, S. 1117–1121. 28Taylor, Charles: Aneinander vorbei. Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus. In: Honneth, Axel (Hrsg.): Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt am Main 1993, S. 103–130, hier S. 117. 29Ebd., S. 123. 112 Klaas Schüller Traditionalismus alltägliche Lebenspraxis Totalitarismus übergeordnete Autorität Anhang: Kollektive Zwecke im Vergleich Zwecksetzende Instanz umfassender gesellschaftlicher Idealzustand sichere, explizite Erkenntnisse hoch Bezugsrahmen Lebenswelt des Gemeinwesens Epistemischer implizite Normen Status Zustimmungsgrad eher hoch niedrig Anordnung der übergeordneten Autorität eher niedrig Modus des unbewusste graduelle Zweckwandels Änderung sozialer Praktiken Flexibilität - mittel/variabel anspruchsvolle, aber eher bereichsspezifische gesellschaftliche Zustände revidierbare regulative Ideen kritischer Republikanismus in der Öffentlichkeit interagierende Individuen und gesellschaftlich-politische Akteure - öffentlicher Diskurs einschließlich sprachlicher und nichtsprachlicher Praktiken Liberalismus (keine kollektiven Zwecke vorhanden) - eher hoch - - 113 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Aufsätze Die Rächer von Elba Exil und Gewalt Claudia Simone Dorchain Metz E-Mail: [email protected] Abstract ‚Exile‘ is a polyvalent notion, referring to a number of phenomena historically linked with the process of sending a person away, to punish them or to put them under a stigma. Besides of the religious dimension of stigmatizing people, which has been largely discussed since René Girard explored the interaction of stigma and ritual killing (1975), exile remains both a process and a situation massively traumatizing for those confronted with it and losing their surroundings and sometimes even their habits and former concepts of identity. According to the psychological effects exile may cause, which are subject of many recent clinical and sociological studies, new investigations on the topic focus on the interdependence of exile and violence. In my short review, I stress the importance of Jan Phillip Reemtsma’s recent study on violence and trust (2008) and will show how exile can be seen as a kind of violence in itself, violence by means of deprivation, and how the hypothesis of exile as violence can be traced within European cultural history. Schlüsselwörter Exil,Verbannung, Raum, Gewalt, Opferkult, Philosophie 114 Claudia Simone Dorchain »Exile is a dream of a glorious return. Exile is a vision of revolution: Elba, not St. Helena. It is an endless paradox: looking forward by always looking back. The exile is a ball hurled high into the air.« Salman Rushdie (The Satanic Verses) ‚Exil‘ ist ein schillernder Begriff. Wenngleich man sich historisch mit ‚Exil‘ an Napoleons Verbannung erinnern und dieses Beispiel besonders populär sein mag, ist das Phänomen des Exils als solches doch ungleich vielschichtiger. Zeitgemäßer als das Beispiel Napoleons ist die differenzierte Aussage Salman Rushdies (1989), für den ‚Exil‘ wechselnde Qualitäten von Revolution bis Nostalgie beinhaltet. Das Problem des ‚Exils‘1 hat tatsächlich viele Aspekte: soziologische und ethnologische, historische und juristische, doch die eigentlich philosophische Dimension des Exils ist seine Verbindung mit der Gewalt. Wo immer ein Mensch gezwungenermaßen oder freiwillig ins Exil geht, findet eine Form von Gewalt statt, da ihm per Befehl oder aus eigenem Entschluss2 Lebensraum entzogen wird, und so eine symbolische oder faktische Reduktion seiner Lebensbedingungen stattfindet. Selten bedeutet das Exil tatsächlich eine Befreiung für den Betroffenen, selbst dann nicht, wenn es eine Form selbst gewählten Protests gegen einen Ort oder eine ortsgebundene Gesellschaft oder Politik darstellen soll, denn meist wird ein solcher Entzug von Lebensraum von Gefühlen der Unterlegenheit und der Ohnmacht begleitet. Oft zieht das als belastend empfundene Exil eine biografisch-psychologische Veränderung beim Exilanten nach sich, die sich im Erschaffen einer alternativen Lebenswelt in Kunst, Wissenschaft oder politischer Gegenkultur äußert. Das Leben in der ‚Fremde‘ und die Auseinandersetzung mit dem Fremden, das ambivalent als bedrohlich oder rettend empfunden werden kann, prägt nicht nur die Alltagspraxis der Exilierten, sondern auch ihr Denken und ihre Forschung, 1 Vgl. Papcke, Sven: Deutsche Soziologie im Exil. Gegenwartsdiagnose und Epochenkritik 1933–1945. Frankfurt a. M. 1993. 2 Man kann zu Recht fragen, inwiefern ein selbst gewähltes Exil ‚Gewalt‘ darstellen sollte, ginge man von der nominellen Identität von Gewalt und Fremdzufügung aus. Tatsächlich muss eine aus der Empirie menschlicher Beziehungen vorurteilsfrei schöpfende Soziologie dem Umstand Rechnung tragen, dass es auch Selbstzufügungen von Gewalt gibt – aus welchem Grund auch immer – und dass insofern ein selbst gewähltes Exil aufgrund der ihm stets immanenten Lebensraumveränderung auch eine Form von Gewalt darstellen kann. 115 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 wie Wolfgang Burisch mit Blick auf das Exilwerk des Soziologen Theodor Geiger nachgewiesen hat.3 Alle menschliche Erfahrung kann als Interaktion mit der räumlichen Umgebung definiert werden, wie es Kevin Lynch bereits in den 1960er Jahren innerhalb seiner Forschung über Städte als Wissenskategorien tat4, und insofern sind auch Exilierungen als drastische Veränderung der räumlichen Erfahrung ein ungehobener Schatz an Erfahrungswissen, der höchst unterschiedlich bewertet werden kann. Für manche ist das Exil offenbar ein Ort der Besinnung, für andere hingegen ein Ort der Vergeltung, und nicht wenige kommen zurück, um Rache für ein tatsächliches oder vermeintliches Unrecht zu üben. Wer exiliert wird, fühlt sich oft in seinem Recht verletzt und sieht eine vormals vertraute Ordnung bedroht, wenn nicht aufgehoben. Bereits diese ersten Betrachtungen zeigen, wie eng der Bezug zwischen Recht und Exil sein mag, und die philosophische Analyse des Problems möchte, über Einzelbeispiele hinaus, einen Zusammenhang zwischen der verweisenden Gesellschaft, dem Prozess der Vertreibung und dem durch Vertreibung verletzten Rechtsempfinden des Vertriebenen herstellen. Insbesondere zum Zusammenhang zwischen Exil und Rechtsempfinden, der sich als komplex herausstellt, da sowohl das Rechtsempfinden des Verbannung aussprechenden Kollektivs, als auch des abgeurteilten Einzelnen, verletzt werden kann, gibt die Studie ›Vertrauen und Gewalt‹ (2008) von Jan Phillip Reemtsma wichtige Aufschlüsse. Meine Untersuchung geht anhand des von Jan Phillip Reemtsma 2008 geprägten Begriffs der ‚lozierenden Gewalt‘5 (weg verweisende Gewalt) der Frage nach, wie sich der Zusammenhang von Exil und Recht darstellt, welche möglichen Motive dem Exil unterliegen und weshalb das Exil eine Form von Gewalt ist. Ortlosigkeit als persönliche Erfahrung oder: Wozu Exil? Salman Rushdie setzte sich 1989 in seinem internationalen Bestseller ›Die satanischen Verse‹ mit dem Eigenen und dem Fremden als angeblich rein mentalen, von konkreten Orten unabhängigen Phänomenen auseinander und beschrieb das Exil 3 Burisch, Wolfgang: Das Elend des Exils. Theodor Geiger und die Soziologie. Hamburg 1995. 4 Lynch, Kevin: The image of the city. Cambridge 1960, S. 1. 5 Reemtsma, Jan-Phillip: Vertrauen und Gewalt. Hamburg 2008. 116 Claudia Simone Dorchain als eine seelische Erfahrung der Entfremdung6. Im Exil – im Niemandsland nach einer Flugzeugexplosion – verzweifeln seine Protagonisten an ihrer Identität und zuletzt am Sinn ihrer Existenz. Dieser vielschichtige Roman über religiöse und kulturelle Differenz hat viele Deutungsebenen, wobei uns hier nur die Thematisierung des Exils interessieren soll. Das Exil sei im Grund ein imaginärer Ort ohne Namen, schreibt Rushdie, ein innerer Zustand, eine Empfindung, eine Metapher für Entfremdung. All das ist sicher wahr, und doch – bei aller Offenheit für den subjektiven Traum, die Illusion, die Revolte – das Exil bleibt auch ein unabhängig von der individuellen Wahrnehmung statthabender und objektivierbarer Prozess, eine rechtliche Praxis und eine faktische Bewegung, deren Untersuchung politische Einsichten vermitteln mag. Wenn wir uns zu sehr auf die subjektive Erfahrungsdimension des Exils besinnen, wie es Rushdie tat, verlieren wir möglicherweise den objektiven Prozess aus den Augen, und somit entgeht uns ein Aspekt der aktuellen Gewaltdebatte. Der Prozess des Exils ist zugleich auch eine Form von Gewalt. Das durch ein Exil dauerhaft verdeutlichte ‚Wegschicken‘ als eine Form von Bestrafung und zugleich als eine Form von sanktionierender Gewalt ist eine uns allen bekannte Praxis, deren juridische Konsequenzen bis heute fortwirken. Das ‚Wegschicken‘ als Form von Bestrafung bleibt indessen keine kulturell entfernte oder historisch überholte Praxis. Das aktuelle deutsche Gewaltschutzgesetz aus dem Jahr 20027 sieht vor, gewalttätige Partner per Wohnungsverweis aus dem Nahbereich ihres Opfers zu verbannen und dadurch eine Art von Exil zu etablieren. Somit wird gewalttätiges Verhalten sanktioniert und zugleich ein geschützter Raum für das Opfer geschaffen, innerhalb dessen keine Angst vor Wiederholung bestehen muss: Der Wegverweis des Täters ist also ein Sanktionsmittel, der Schutzraum für das Opfer eine Folge der Sanktion, doch in diesem Zusammenhang wird klar, dass ein ‚Exil‘ nicht nur fortverweist, sondern auch neue Räume schafft, oder die Qualität von bereits definierten Räumen verändert. Dieser Prozess des Wegverweisens von Personen zum Schaffen konfliktfreier Räume ist an sich nicht unproblematisch, da er in mehrfacher Hinsicht gerechtfertigt werden muss. Das neue deutsche Gewaltschutzgesetz wendet durch eine solche Platzverweisung des Täters selbst eine, wenngleich eine ganz legitime, Form der Gewalt 6 Rushdie, Salman: Die satanischen Verse. Frankfurt a.M. 62006. 7 GewSchG vom 1. Januar 2002 117 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 an: weg verweisend, über den Aufenthaltsort einer Person bestimmend. Doch das übergeordnete ethische Ziel dieses Gesetzes, der Gewaltschutz, ist in der Kulturgeschichte eher jung. Ein Exil diente nicht immer dem Frieden oder dem Entspannen von Konflikten. Wegverweise durch lozierende Gewalt waren traditionell meist nicht dem Gewaltschutz in seiner modernen Auffassung dienlich, sondern einfach ein Ausdruck der wirkenden Machtverhältnisse. Wir finden sie in der klassischen griechischen Tragödie durch die Verbannung des Frevlers oder Helden, in diskriminierender Politik innerhalb der Ghettoisierung von Personengruppen in besonderen Stadtteilen oder in Randbereichen (die Juden im mittelalterlichen ‚Stedtl‘, von denen Loic Wacquandt in seinen soziologischen Studien zu Ausgrenzungspraktiken berichtet8), als Sanktion für angebliche Beleidiger der Obrigkeit in autoritären Staaten, wie sie Wilhelm Raabe für ein Deutschland im Jahr 1857 beschreibt, in dem Kritiker ausgewiesen wurden,9 oder, in einem der frühesten bekannten Beispiele, im Alten Testament, beim Propheten Jesaja, der die Vertreibung des ‚Sündenbocks‘ in die Wüste beschreibt.10 Alle diese – historischen oder gegenwärtigen – Formen des Wegverweisens von Personen aus Orten können als Gewalt gedeutet werden. Exilierung als Gewalt Eine Ur-Form der lozierenden Gewalt finden wir in der Bibel, im Alten Testament: Der Prophet Jesaja berichtet über eine traditionelle kultische Handlung, die der von innerer Spannung bedrohten Gemeinschaft der Israeliten Zusammenhalt und Stabilität gewähren soll – also die klassischen Ziele eines heiligen Opfers. Und tatsächlich handelt es sich um dieses. Das Beispiel des ‚Sündenbocks‘ gilt als allgemein bekannt: »Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg; aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.«11 Der ‚Sündenbock‘ wird mittels einer magischen Handlung symbolisch mit den Sünden der Israeliten beladen und stellvertretend für diese in die Wüste geschickt – nebenbei bemerkt die Urge8 Zur Konstruktion eines Raumes der »Schließung und Kontrolle« vgl. Wacquandt, Loic: ›Was ist ein Ghetto? Konstruktion eines soziologischen Konzepts‹. In: Smelser, Neil J. (Hrsg): Encyclopedia of the social and behavioral sciences, London 2004, S. 133–147. 9 Raabe, Wilhelm: Die Chronik der Sperlingsgasse (1857). Reprint. Berlin 1980, S. 71. 10Jesaja 53,6. 11Ebd. 118 Claudia Simone Dorchain schichte, die unserem geflügelten Wort »jemanden in die Wüste schicken« unterliegt. Jener Vorgang war für den Kulturwissenschaftler René Girard der Impuls zu seiner umfangreichen Forschung über »Stellvertreter der Gewalt«12. Seine Hauptthese, die er in seinem 1975 erschienenen Werk ›Das Heilige und die Gewalt‹ erstmals formulierte, lautet, dass archaische Gesellschaften systematisch eine Person auswählen und isolieren, der sie stellvertretend für alle eine mythische Schuld aufbürden. Durch das ‚Opfer‘ dieser Person – sei es durch Wegschicken, Verbannung ins Exil oder rituellen Mord – würden Konflikte entspannt und die Gruppenstabilität wiederhergestellt. Girard sieht das Exil als stellvertretendes Opfer nicht nur in Stammesgesellschaften, sondern auch in literarischen Werken der klassischen Antike, insbesondere in der griechischen Tragödie (Ödipus flieht vor dem schicksalhaften Orakelspruch) oder bei Homer (Odyssee) in Szene gesetzt. Jene literarischen Klassiker seien, Girard zufolge, inhaltlich nur vor dem Hintergrund eines Verständnisses des ‚heiligen Opfers‘ archaischer Gesellschaften verständlich, welche durch Praktiken wie Exilierung eines Stellvertreters die Gruppe konsolidieren möchten. Hierbei ist anzumerken, dass die Verbannung als solche dem Opfer vorangeht, es also nicht ersetzt, sondern eine Stufe in einer sich steigernden Gewalteskalation darstellt, die mit dem Tod des Opfers endet. Dennoch ist die Verbindung von Exil und Gewalt schlüssig, da die Verbannung ein Glied in der Kette von Gewalthandlungen darstellt und einer Eskalation vorausgeht. Zurück zum biblischen Beispiel und zur Schlüssigkeit dieser Urgeschichte des Exils: behält Girard mit seiner These »Exil bedeutet Opfer und Opfer stabilisiert eine Gruppe« Recht, sollte durch diese weg verweisende Gewalt der Israeliten also tatsächlich Frieden gestiftet werden? In biblischer Zeit bedeutete das Wegverweisen oder Exilieren eines Menschen oder eines Tiers, welches stellvertretend für einen Menschen steht, weitaus mehr als nur der moderne Begriff von Konfliktentspannung. Die Gesellschaften der Antike waren ungleich stärker auf Kooperation und den Zusammenhalt ihrer Mitglieder angewiesen. Jemanden zu verbannen bedeutete nicht nur, seinen Lebensraum zu begrenzen, sondern effektiv seine Lebenschancen zu verringern. Eine Verbannung war ein symbolischer Tod. Der Ausschluss des Einzelnen aus der Gemeinschaft, welcher durch die Verbannung 12 Girard, René: Generative scapegoating. In: Hamerton-Kelly, Robert (Hrsg): Violent origins. Ritual killing and cultural foundation. Stanford 1986, S. 73–105. 119 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 sichtbar wurde, bedeutete nicht nur profan eine Verschlechterung der realen Lebensbedingungen, sondern auch eine kultisch-religiöse Ausgrenzung: Exilierung war eine Form von Stigma. Ein Stigma zu erschaffen und somit einen Menschen in gewisser Weise zu ‚opfern‘ ist jedoch eindeutig selbst eine Gewalt, welche der Rechtfertigung bedarf, und insofern mag es nicht überraschen, dass sich Zeugnisse von stigmatisierender – exilierender – Gewalt im Bereich des positiven Rechts ebenso wie in kultischen Kontexten finden. Die weg verweisende Gewalt ist für Jan Phillip Reemtsmas 2008 im Hamburger Institut für Sozialforschung erschienene Untersuchung »Vertrauen und Gewalt«13 nun genau diejenige Gewaltform, die den Körper des Opfers zu stigmatisieren und im Raum zu bewegen vermag; sie kann ihn hinverfügen oder, wie im Fall des Sündenbocks, hinwegverfügen und vertreiben. »Körper weg verweisen«: Reemtsmas Begriff der ‚lozierenden Gewalt‘ Das Ziel der lozierenden Gewalt,14 wie wir sie schon in ältesten Menschheitszeugnissen finden, ist für Reemtsma leicht zu benennen: »Lozierende Gewalt will den Körper aus dem Weg oder an einen anderen Ort schaffen«15. Doch das ist, mit Blick auf die Gewalt des Heiligen, zuwenig an Definition. Lozierende Gewalt im allgemeinen Sinn wende ich schon dann an, wenn ich mich an der Supermarktkasse vordrängle und den vor mir Anstehenden übergehe. Das ist natürlich ungezogen in der sozialen Bewertung, und auch unangemessen als ethische Handlung, doch ein solches Alltagsverhalten würde vorab völlig das vorbenannte Ziel lozierender Gewalt erfüllen. Betrachten wir nun das spezifische Problem der lozierenden Gewalt jedoch eingehender, wird offenbar, dass es sich hierbei nicht lediglich um ein ‚Wegschaffen‘ oder Verdrängen von Körpern zum Erreichen eines übergeordneten Ziels, wie der schnelleren Abfertigung meiner Waren an der Kasse, handeln kann. Menschen agieren nie nur instrumentell: Es ist Reemtsma zuzustimmen, wenn er betont, dass stets ein ‚existenzielles Moment‘16 im Spiel sei, wie sich bereits im von Girard untersuchten Opferkult zeigt, innerhalb dessen die Verbannung die Vorstufe einer Tötung ist. Hierbei ist zusätzlich zu bedenken, dass ein Wegverweis 13 Vgl. Reemtsma, Jan-Phillip: Vertrauen und Gewalt, S. 108. 14 Vgl. ebd. 15 Ebd., S. 113. 16 Ebd., S. 101. 120 Claudia Simone Dorchain vom Ort dem Exilierten eine neue räumliche Erfahrungsdimension aufnötigt, die nicht nur ungewollt ist, sondern auch sein Wissen verändern mag – der Platzverweis, mit Lynchs Vorstellung vom Ort als Wissenskategorie, verändert mit der Umgebung zugleich auch das Denken des Vertriebenen17. Die ‚existenzielle‘ Botschaft, die durch das meist nonverbale Verhalten des Verdrängens oder Wegverweisens ausgedrückt wird, ist die der Minderwertigkeit des derart behandelten Körpers. Die begleitende Aussage desjenigen, der lozierende Gewalt ausübt oder überhaupt ausüben darf, ist existenziell: die seiner Überlegenheit über den Verdrängten. Diese Überlegenheit über den Verdrängten kann in der Person des Lozierenden begründet sein und folglich ein dauerhaftes, stabiles Merkmal seiner Person darstellen (er ist Präsident und hat prinzipiell Vorrang) oder in seiner Funktion legitimiert werden und somit aufgabengebunden sein (er ist Saalordner und räumt den Konzertsaal) oder einfach in einer situativen Aufgabe bestehen (er ist Elternteil und bewahrt den Dreijährigen davor, auf die Straße zu laufen). Ein Sonderfall ist die lozierende Gewalt, die Jesus ausgeübt hat: Das Markus-Evangelium berichtet, dass er die Händler sogar »mit Geißeln aus Stricken«18 aus dem Tempel vertrieben habe. Die souveräne Macht, die in diesem Beispiel Jesus durch seine Vertreibungsgewalt ausübte, könnte ausnahmsweise kombiniert werden und somit durch die Person, die Funktion und die Situation zugleich bedingt gewesen sein. Durch die lozierende Gewalt wird, wie bei jeder anderen Gewaltform, die spezielle Machtstruktur zwischen den Handelnden durch die jeweilige Verfügungsgewalt über die Körper offenbart; bei diesem speziellen Gewalttypus handelt es sich jedoch um abgestufte Machtverhältnisse, die je nach der tatsächlichen Macht des Ausübenden entweder stabil, funktionell oder situativ sein können. Immer jedoch beinhaltet die lozierende Gewalt für ihr Opfer stets auch das Motiv der Unterordnung im strukturellen Sinn, respektive das Motiv der Unterlegenheit im existenziell-ontologischen Sinn. Das mag ein Grund dafür sein, dass lozierende Gewalt in der Wahrnehmung der Allgemeinheit gern als beschämend und degradierend empfunden wird und »Betreten verboten!«-Schilder oft so konsequent ignoriert werden. Lozierende Gewalt ist degradierend. Sie sagt uns, wo unser Körper unerwünscht ist – und wer uns das sagen darf, der verkörpert 17 Vgl. Lynch, Kevin: The image of the city. S. 1. 18Mk 11, 15–19. 121 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 also im buchstäblichen Sinn das leninsche Machtgefüge im Kontrast ‚Wer–wen‘19. Zusätzlich zur ein- und ausschließenden und somit wertenden Definition des Raumes impliziert die wegverweisende Gewalt also auch eine Verdeutlichung sozialer Hierarchien und Machtgefüge. ‚Exil‘ als Gewalt mit existenzieller Bedeutung Der autoritäre Wegverweis des Körpers als ein empfundener Ausdruck von Missachtung und Stigmatisierung des Wegverwiesenen gilt zugleich auch für die verschiedenen Untertypen dieser Gewaltform. Reemtsma unterscheidet genauer dislozierende und kaptive20 Gewalt als Teilaspekte der lozierenden Gewalt: Bei der dislozierenden Gewalt ist der Körper ein Hindernis, welches aus dem Weg geräumt wird, bei der kaptiven Gewalt gilt es, sich seiner zu bemächtigen, um ihn an einem bestimmten Ort gefangen zu halten21. Ich bin mir nicht sicher, ob man lozierende und dislozierende Gewalt tatsächlich unterscheiden muss, außer in einem strikt formallogischen Bezugsverhältnis von Oberbegriff und Unterkategorie. Das macht Sinn, da sich die Unterkategorie in Bezug auf Beispiele als teilidentisch mit dem Oberbegriff erweist, sprich da überall dort, wo Körper aus dem Weg geräumt werden, also disloziert wird, tatsächlich die lozierende Gewalt im Gange ist. Betrachten wir zur Illustration exemplarisch verschiedene »Einsatzgebiete« lozierender Gewalt als Wegverweis oder Gefangennahme von Körpern, ergibt sich ein klares Bild ihres Auftretens. Reemtsma sieht die klassischen Einsatzgebiete der lozierenden Gewalt in der militärischen Gewalt und der kriminellen Gewalt. Ersteres scheint offenkundig: militärische Gewalt, wie sie sich etwa in Invasionen äußert, zielt unmittelbar auf die Beseitigung von Körpern aus dem Raum oder auf die Aneignung eines Raumes ab. In Bezug auf die kriminelle Gewalt führt Reemtsma gängige Beispiele wie Raubüberfälle auf Banken und Panzerknackermethoden an,22 doch diese Beispielreihe ist viel zu vordergründig und vor allem auch unvollständig. Wie beim Propheten Jesaja zu erkennen, ist lozierende Gewalt nicht 19 Lenin bei der Rede in Brest-Litowsk; vgl. Reemtsma, Jan-Phillipp: Vertrauen und Gewalt, S. 437. 20Reemtsma schreibt »captive«, ich schreibe »kaptive« Gewalt, da uns diese Schreibweise heute geläufiger erscheint. 21 Reemtsma, Jan-Phillip: Vertrauen und Gewalt, S. 110. 22Ebd. 122 Claudia Simone Dorchain einfach ein Verdrängen von Körpern aus einem Raum, um sich Geld anzueignen, sprich um die Habgier zu befriedigen, sondern vielmehr ein Akt, der mit der Sphäre des Heiligen unmittelbar verbunden ist – nicht und erst recht nicht nur, weil sie hier beim Propheten zufällig oder weil er eben ein Prophet ist, in diesem Kontext auftritt, sondern weil sie allgemein als eine Form von Stigma oft in Kontexten des Heiligen auftritt. Der archaische Opferkult: ‚Exil‘ als Stigma Was die lozierende Gewalt zu einer speziellen Gewalt des Heiligen macht, sind vor allem zwei Aspekte: ihre systematische Verbundenheit mit dem Opfer, das heißt dem entrechteten und stigmatisierten Individuum, wie es der Sündenbock (oder der Held der griechischen Tragödie, der in die Verbannung geschickt wird) darstellt, und ihre Verbundenheit mit der mythischen Gewalt. Die Stigmatisierung des Individuums ist faktisch durch die Veranschaulichung der Machtasymmetrie zwischen Verdränger und Verdrängtem gegeben, welche zudem das Ich des Verdrängten als existenziell unterlegen darstellt. Die mythische Gewalt ist, wie Walter Benjamin feststellte, in der Hauptsache eine performativ-visuelle Gewalt, eine Zurschaustellung und Selbstmanifestation der Götter.23 Genau das ist die lozierende Gewalt auch in ihrem profan erscheinenden Sinn: eine Selbstmanifestation von Machtverhältnissen respektive der Machthaber, die als opfernde Priester fungieren, indem sie den Körpern Gewalt antun oder solches verbal oder symbolisch androhen (bei lozierender Gewalt ist der Charakter der Drohung, scheint mir, immanent). Erinnern wir uns an eine weitere bekannte Szene aus einem Besatzungskrieg: wenn Wilhelm Tell in Schillers Drama die Mütze von Vogt Gessler grüßen muss, macht er zwar gezwungermaßen etwas Absurdes, doch er steht in direktem Kontakt mit dem, was Benjamin die »mythische Gewalt« nennt. Er muss der Selbstmanifestation eines Machtverhältnisses sichtbare Anerkennung zollen, denn einen anderen, übergeordneten Zweck – wie »göttliche Gewalt« ihn hätte – hat dieser Mützen-Gruß offenbar nicht. Es geht lediglich um die Demonstration von Machtverhältnissen, die sichtbar werden, indem sie, symbolisch repräsentiert, Platz im Raum einnehmen oder Körper verdrängen. Da der übergeordnete Zweck des allgemein dienlichen Ordnungserhalts, wie ihn die so genannte »gött23Benjamin, Walter: Zur Kritik der Gewalt. Frankfurt a.M. 1918. Reprint, Frankfurt a.M. 2002, S. 40f. 123 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 liche Gewalt«24 im Sinn Benjamins innehätte, hier oft fehlt, oder zumindest nicht klar erkennbar ist, fordert die lozierende Gewalt oft Protest und Rebellion heraus. Vertreibung und Symbole der Macht Die lozierende Gewalt beginnt nicht erst, wie Reemtsma meint, mit einem aktiven Akt des Vertreibens; dies kann hinzukommen, sicher, doch es ist eigentlich sekundär. Die lozierende Gewalt beginnt offenbar schon dann, wenn ein Symbol der Macht Platz im Raum beansprucht und dem Bürger eine Anerkennung dieses Symbols abverlangt wird. Symbolische Machthabe jedoch kann nur durch irgendein Heiliges gerechtfertigt werden, da sie ohne dieses jeden Sinn als Hinverweis auf ein Abwesendes verlöre. Würde sich der Vogt Gessler nicht als Vertreter einer Ordnung sehen, die angeblich über seine Eigeninteressen hinausreicht, wäre seine Mütze nur ein Stück Stoff; sollte der ‚antifaschistische Schutzwall‘25 nicht angeblich menschenfreundlichen Zielen dienen, wie es die DDR-Medien behaupteten, wäre er eine Ansammlung von Steinen, und sowohl die Beanspruchung des Stoffs als auch der Steine im Raum wäre nicht zu begründen und noch weniger könnte die Anmaßung gegenüber den Menschen, die verdrängt oder zur Wahrnehmung der Symbole lozierender Gewalt gezwungen werden, aufrechterhalten werden. Reemtsma unterscheidet seine Gewalttypen intentional, folglich in Bezug auf die mutmaßliche Absicht des Täters. Für ihn ist die lozierende Gewalt ein profundes Desinteresse am Körper des Anderen, die vergewaltigende (»raptive«) und tötende (»autotelische«) Gewalt hingegen sei ein Ausdruck gesteigerten Interesses am Körper. Ich bin hier durchaus nicht Reemtsmas Meinung: Alle Gewaltformen als Formen des Opfers interessieren sich für den Körper – und sind zugleich auch völlig uninteressiert an ihm. Kein Gewalttäter, sei er profan Bankräuber oder sakral ein opfernder Priester, interessiert sich wirklich für den Körper des Opfers als solchen.26 Dieser ist nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar interessant: als ein 24Ebd. 25Zur Parolengebung der DDR mit ihren teils mythischen Metaphern zur Beschreibung von Raum, Exil und Raumbewertung vgl. Münkler, Herfried: Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin 2008. 26Man mag kritisieren, dass mancher Gewalttäter, insbesondere als Vergewaltiger (profan 124 Claudia Simone Dorchain Hinverweis auf die im Täter manifestierte Macht und dessen eigene Ziele (Lust, Profit, Machterhalt) sowie den Machterhalt vermittels Gewalt. Wenn der Täter berechnend klug ist, sehr wenig Kontrolle erfährt oder die von ihm beanspruchte Macht sehr traditionell ist, kann er seine eigenen persönlichen Ziele leicht mit dem Gemeinwohl verbinden und ihnen so eine angebliche »schicksalhafte Krönung«27 durch Gesetz verleihen, wie Walter Benjamin sagt. Kurz, der Körper des Opfers ist Mittel zum Zweck innerhalb der durch die ihm zugemutete Gewalt veranschaulichte Ordnungsstruktur. Wer also Körper weg verweisen oder gefangen nehmen darf, ist nicht nur Machthaber, sondern veranschaulicht durch diese Gewalt auch eine existenzielle Unterlegenheit der Verdrängten. Diese Unterlegenheit wird als Stigmatisierung empfunden und ist auch ausdrücklich so gemeint, in allen Prozessen lozierender Gewalt früher und heute – gleich ob im Alten Testament der erklärte ‚Sündenbock‘28 in die Wüste geschickt wird oder ob der Fraktionsausschuss die Vertrauensfrage stellt, deren Negativentscheid die Entsendung Eines aus der Gruppe bewirkt, welcher gewöhnlich darüber hoch empört ist und sich degradiert fühlt. »Warte, bis ich zurückkomme«: ‚Exil‘ und Rache Lozierende Gewalt ist nicht nur instrumentell und existenziell zu verstehen, sondern sie ist in ihrer Wirkweise vor allem auch suggestiv: Sie ist mehr als ihr äußeres Geschehen, sie antizipiert durch Raumverweis oder stabile Raumzuordnung das Opfer. Wir wissen, dass die Stigmatisierung durch Verfügung über den Körper im Raum traditionell ein erster Schritt zur Opferbank ist. Wer einmal von lozierender Gewalt betroffen wird, fühlt sich oft langfristig in jeder Hinsicht bedroht, wie Geiseln berichten. Der Grund suggestiver Furcht hierfür ist offensichtlich der selbst einer ganz profanen Geiselnahme unserer Gegenwart unterliegende sakrale Symbolcharakter lozierender Gewalt: dem Stigmatisierten, Ausgeschlossenen kann alles geschehen. Wenn jedoch alles mit einem Menschen geschehen kann, oder in historischer Zeit innerhalb der kultischen Prostitution), ein unbestreitbares Interesse am Körper des Anderen haben muss. Sogar dies würde ich verneinen. Wer immer wann immer als opfernder Priester auftritt, hat primär ein Interesse an der Veranschaulichung der ihn privilegierenden Macht durch Gewalt. Lust ist? ein Sekundäreffekt. 27Vgl. Benjamin, Walter: Zur Kritik der Gewalt, S. 42. 28Jes. 53, 6. 125 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 entfesselt das existenzielle Angst, Unterlegenheitsgefühle – und nicht selten den Wunsch des Exilierten, in die Heimat zurückzukehren, um sich zu rächen. Es mag nicht überraschen, dass Geschichte und Kunst voll sind mit Beispielen, in denen Exilierte zurückkommen, um Rache zu üben. Die rachsüchtige Rückkehr des Vertriebenen ist ein literarischer Topos, der über Jahrhunderte hinweg die Leserschaft in Europa beschäftigt hat. Theodor Fontane hat »aus einer märkischen Chronik« eine Geschichte nacherzählt, die sich so oder ähnlich im 17. Jahrhundert ereignet haben soll. Seine schöne Heldin ›Grete Minde‹ im gleichnamigen Roman wird vor dem Dorfrat als angebliche Hure beleidigt und verlässt unter Tränen das Dorf – ein Exil, das rechtlich zwischen ‚auferlegt‘ und ‚selbst gewählt‘ schwankt, da sie nicht offiziell juristisch zum Wegzug verurteilt wurde, ihr das Zusammenleben mit den Dorfbewohnern aber faktisch unmöglich erscheinen musste. Jahre später kehrt sie völlig verarmt und verlassen zurück und zündet die Dächer der Ratsherren an.29 Dieses fulminante Ende setzt einer Entwürdigungsgeschichte den Schlusspunkt, deren sich steigernde Dynamik durch mehrere Ortsverweise dargestellt wird. Die Frage nach der philosophisch-ethischen Rechtfertigung der Exilierten-Rache bleibt offen. In Benjamins Definition legitimer Gewalt als »rechterhaltend«30 ist die Rache des Exilierten, da als Selbstjustiz durchgeführt, überhaupt unstatthaft, und dennoch – oder auch gerade deshalb – bleibt das Rachethema eine (nicht nur) literarische Faszination mit ungebrochener Strahlkraft bis in die Gegenwart. Eine andere Rächerin ist Friedrich Dürrenmatts Heldin Claire Zachanassian, die als Sechzehnjährige hochschwanger ihre Heimat verließ, nachdem ihr Liebhaber sie durch einen Meineid der Hurerei bezichtigt hatte, um ihrer Vaterschaftsklage zu entgehen.31 Eine jahrzehntelange Odyssee, durch die sie sehr reich wurde, führt die Exilierte schließlich wieder in ihre Heimat. In Dürrenmatts Drama ›Der Besuch der alten Dame‹ aus dem Jahr 1956 wird deutlich, wie die hoch betagte Frau wieder an die Stätte ihrer Jugend zurückkehrt, um ihren früheren Liebhaber und alle anderen seinerzeit gleichgültigen Bewohner zu bestrafen. Wenn wir es nur bei diesen bekannten literarischen Beispielen belassen wollen, wird bereits deutlich: Exilierte haben offenkundig ein gutes Gedächtnis. 29Fontane, Theordor: Grete Minde (1880). Reprint. Stuttgart 2006. 30Benjamin, Walter: Zur Kritik der Gewalt, S. 45. 31 Dürrenmatt, Friedrich: Der Besuch der alten Dame (1956). Reprint. Stuttgart 2009. 126 Claudia Simone Dorchain Und dieses Gedächtnis hat nicht selten das Stigma des Ausgeschlossenseins in sich, welches als empfundene oder tatsächliche Gewalt, als Justizirrtum oder auferlegte Unrechtserduldung eine gewisse Form von Genugtuung erfordert, welche ihrerseits die Rückkehr des Exilierten motiviert. Vogelfrei und ortlos: Der Exilierte als Figur des Ausnahmezustands Dass ein Exil durch die Vertreibung aus der Heimat irrtümlich, willkürlich oder sonst zu Unrecht geschehen kann, ist eine Erkenntnis, die sicherlich so alt ist wie die Rechtsgeschichte – welche Möglichkeiten der Vergeltung einer unrechtmäßigen Vertreibung statthaft sind, unterliegt jedoch dem Rechtsgeschmack jeder Epoche. Hierbei spielen auch die positiven Rechtsmittel eine Rolle: Je weniger Rechte ein Bürger hatte, umso härter konnte ihn ein Unrechtsspruch treffen, und dies insbesondere im Fall einer Verbannung, die ihn aus seinen lebensnotwendigen Bedingungen riss. Insofern ist der Vergeltungsgedanke des Exilierten in der Geschichte umso ausgeprägter, als die Chancen legalen Protests in Verfahren in vordemokratischen Gesellschaften stark eingeschränkt waren. Aus dem Grund der Abwehr von möglicher Vergeltung wurden im Mittelalter entlassene Opfer der Inquisition (als Überlebende der Folter)32 gezwungen, die so genannte »Urfehde« zu schwören. Dadurch verpflichteten sie sich, wenn sie die Folter überlebten, unverzüglich in die Fremde wegzuziehen und nie mehr an den einstigen Gerichtsort zurück zu kehren, um Rache zu üben. Die Urfehde galt als richterliche Gnade und durfte nicht verletzt werden. Wer als solcherart Exilierter zurückkehrte und Rache übte, machte sich einer doppelten Verfehlung schuldig: der rächenden Gewalt und des Vertragsbruchs, welcher durch die Verletzung der Urfehde – die sehr ernst genommen wurde – entstand. Die so genannte Urfehde war eine bekannte, aber nicht die einzige Anwendung von exilierender Gewalt. Verbannungen wurden im mittelalterlichen Recht auch dann ausgesprochen, wenn es sich nicht um Folteropfer handelte, welche die »peinliche Befragung« der Inquisitoren überlebt hatten. Wurde ein Delinquent wegen irgendwelcher Delikte zum Exil verurteilt, 32Was mit den Überlebenden der inquisitorischen Folter geschah, beschreibt Vicor Hugo in seinem bekannten Roman ›Der Glöckner von Nôtre-Dame‹ (1831), dessen Erzählhandlung im 15. Jahrhundert angesiedelt ist. Der bucklige Glöckner Quasimodo ist offensichtlich ein Überlebender einer entstellenden Körperfolter, der sich nach dem Schwören der Urfehde in die Fremde und dort in die Abgeschiedenheit seines Berufes geflüchtet hat. 127 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 bedeutete das nicht nur profan die Verringerung seines Lebensraums und somit seiner Lebenschancen, und nicht nur kultisch ein Stigma, wie bereits in biblischen Zeiten, sondern hatte darüber hinaus noch eine zusätzliche juridische Bedeutung, die heute wenig bekannt ist. Giorgio Agamben erinnert mit Bezug auf mittelalterliche Rechtsordnungen daran, dass die lozierende Gewalt die Entrechtung des Vertriebenen bedeutete: Jemanden zu verbannen hieß, dass ihm jeder Gewalt antun konnte.33 Allerdings hatte auch diese Rechtspraxis zuweilen Ausnahmen aufzuweisen: manchmal sind im Mittelalter exilierte Stadtobere nach einer gewissen Zeit der Verbannung zurückgekehrt und wieder in ihre vormaligen Ämter eingesetzt worden. Die Verbannung war historisch betrachtet im Ausnahmefall auch ein Prozess der symbolischen Reinigung, nicht notwendig die lebenslange Entfernung. Dennoch bleibt bei den lebenslang Exilierten wie bei den ausnahmsweise Zurückkehrenden die Gemeinsamkeit, dass der Verbannung als solcher ein Stigma vorausging oder sie durch ein Stigma begründet wurde. Lozierende (exilierende) Gewalt ist eine mentale Vorwegnahme des Opfers, die sich bis zum Tod steigern kann. Wer verbannt wurde, änderte oftmals nicht nur seinen Lebensraum und somit seine Erfahrungs- und Wissenskategorien, sondern auch seinen Rechtsstatus. Diese Veränderung des Rechtsstatus war im Mittelalter objektiv: Ein Verbannter war vogelfrei und verlor seine Rechte. Heute mag ein Exil subjektiv noch als Rechtseinschränkung empfunden werden, wenngleich die durch das Stigma traditionell immanente Bedrohung – Opfer zu sein – hoffentlich nicht mehr vorkommt. Die (post-)moderne Art, weg verweisende Gewalt ethisch und gesellschaftlich zu legitimieren – meist um größere Gewalt zu vermeiden, oder um Konflikte zu entspannen – wie sie etwa im deutschen Gewaltschutzgesetz von 2002 praktiziert wird, sieht für den Wegverwiesenen keine Änderung seines Rechtsstatus als Person mehr vor, sondern nur eine Maßregel für ein situatives Verhalten. Bei selbstgewählten Exilen fällt zudem auch diese Verhaltensmaßgabe fort; ein frei gewähltes oder auferlegtes Exil ändert nicht mehr den Rechtsstatus der Person. Doch es bleibt ein Unbehagen, ein Gefühl von einer verletzten Ordnung in der Verbannung und im Ausschluss von einer Gesellschaft. Das Exil verändert nicht nur die Lebensumwelt drastisch, sondern auch das Denken des 33Agamben, Giorgio: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt a.M. 2002, S. 114. 128 Claudia Simone Dorchain Menschen, und die persönliche Erfahrungsdimension jenes Wandels ist meist von Gewalt geprägt.34 Rushdies »Elba« ist ein Ort, von dem man sich wegträumt. 34Zur Verbindung von Exilerfahrung und Gewaltempfinden vgl. Burisch, Wolfgang: Das Elend des Exils. 129 - jahrgang 7 - ausgabe 2 - 2011 Aufsätze Die Europäische Union in den georgischen Sezessionskonflikten Ein sicherheitspolitischer Akteur? Marianne Witt Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften E-Mail: [email protected] Abstract The European dealing with existing conflict fields demonstrates a lack of efficiency up to date, although the self-conception of the EU as civilian power implies mediating competences. This article reviews this problematic from a qualitative perspective of the specific role conception ‘civilianpower’, developed by Kirste and Maull. Referring to a case study, this article contains an analysis concerning the European conflict management in the Georgian conflicts of secession before the ‘Five-Day War’ in August 2008, as well as during the war and afterward. The military escalation is accompanied by exposed conflict management of the EU. Thus a discrepancy between the originally civilian character and the actual performance of the EU emerges. This analysis intends to carry out an adequate localization of the EU in the tension-filled relationship between the civilian role conception and the role conception of a security policy actor. Hence an explanation of the current European conflict engagement arises and leads to the outcome that the EU is situated in a long-term transformation process from a civilian to a security policy role conception. Schlüsselwörter EU, zivilmachtspezifische Rollenkonzeption, sicherheitspolitischer Akteur, georgische Sezessionskonflikte, Russland, Konfliktmanagement 130 Marianne Witt Der europäische Umgang mit vorhandenen Konfliktfeldern weist bis dato kein effizientes Bild auf, obwohl sich die Europäische Union (EU) als Zivilmacht mit streitschlichtenden Kompetenzen versteht. Dieser Aufsatz widmet sich der Problematik aus Perspektive der von Kirste und Maull initiierten, zivilmachtspezifischen Rollenkonzeption und führt am Beispiel der georgischen Statuskonflikte eine Effizienzanalyse europäischen Sicherheitsengagements durch. Ziel ist es, eine angemessene Verortung der EU im Spannungsverhältnis zwischen ziviler und sicherheitspolitischer Rollenkonzeption vorzunehmen, sodass eine Erklärung derzeitigen europäischen Konfliktengagements resultiert. Prolog Der voranschreitende Erweiterungsprozess rückt vermehrt Konfliktherde in den unmittelbaren Wirkungsbereich der EU. Diese formuliert bereits in ihrer im Jahr 2003 verabschiedeten Sicherheitsstrategie ein besonderes Interesse eben solche zu befrieden und begreift sich als Zivilmacht mit streitschlichtenden Kompetenzen1, wobei der tatsächliche Umgang mit vorhandenen Konfliktfeldern, insbesondere mit denen in den angrenzenden Nachbarschaftsstaaten, kein effizientes Bild aufweist. Dieser Artikel widmet sich der Problematik aus der Perspektive einer von Kirste und Maull initiierten, zivilmachtspezifischen Rollenkonzeption und führt eine Effizienzanalyse des sicherheitspolitischen Engagements der EU am Beispiel der georgischen Statuskonflikte durch. Die maßgebliche Relevanz des Konzeptes resultiert aus der Tatsache, dass europäisches Konfliktmanagement in der Forschung fortwährend im Kontext von Zivilmachtkonzepten (ZK) analysiert wird. Dabei sind die von Duchêne im Jahr 1973 getätigten Ursprungsüberlegungen durch die fragliche, künftige Rolle der EU im weltpolitischen Geschehen essenziell.2 Den innereuropäischen Integrationsprozess fokussierend entwickelt dieser ein primär nach innen gerichtetes ZK, welches »›demokratischen‹ und zivilen Werten gegenüber«3 materiellen Kapazitäten den Vorrang 1 Vgl. Europäische Union: Ein sicheres Europa in einer besseren Welt. Europäische Sicherheitsstrategie. 17.06.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cmsUpload/031208ESSIIDE.pdf, hier S. 8. 2 Vgl. Orbie, Jan: Civilian Power Europe. Review of the Original and Current Debates. In: Cooperation and Conflict, 41 (2006), S. 123-128, S. 123. 3 Duchêne, François: Die Rolle Europas im Weltsystem. Von der regionalen zur planetari- 131 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 einräumt und indes militärische Instrumentarien weder vollständig ausschließt noch dauerhaft negiert. Die unpräzise Ausgestaltung ermöglicht differierende ZK-Interpretationen und Diskurse.4 Mit Hills Übertragung der friedenspolitische Qualität des ZK auf Relationen der Europäischen Gemeinschaft (EG) zu Drittstaaten wird weiterhin die Frage aufgeworfen, wie die ideale Zivilisierung der internationalen Beziehungen erfolgen soll.5 So ist in der Politikwissenschaft bis dato umstritten, welchen Möglichkeiten und Grenzen sich die EU als Zivilmacht in der Gestaltung ihrer Außenpolitik ausgesetzt sieht.6 Wegweisende Ereignisse, wie das Ende des Ost-West-Konfliktes und der Maastrichter Vertrag (1992) mit dem Beschluss zur Entwicklung einer gemeinsame Verteidigungsdimension, leiten zu zwei miteinander konkurrierende Argumentationslinien, die das ursprüngliche ZK einerseits durch zwingende, andererseits durch qualitative Interpretationen forcieren.7 So bildet zum einen der Nicht-Besitz militärischer Kapazitäten eine unabdingbare Voraussetzung für den Status ‚Zivilmacht‘. Manners begreift bereits den Maastrichter Vertrag als einen fundamentalen Wandel der zivilen Union zur Militärmacht.8 Durch die unzureichende Umsetzung der Petersberger Aufgaben, von Hill als »capabilities-expectation gap«9 kritisiert, bemerkt Smith dennoch ein 4 5 6 7 8 9 schen Interdependenz. In: Kohnstamm, Max/Hager, Wolfgang (Hrsg.): Zivilmacht Europa – Supermacht oder Partner. Frankfurt am Main 1973, S. 11-35, S. 34. Vgl. auch Jünemann, Annette/Schörnig, Niklas: Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der „Zivilmacht Europa“. Ein Widerspruch in sich?. 29.06.2011, HSFK-Report 13 (2002), http:// www.hsfk.de/downloads/Rep1302.pdf, S. 4. Vgl. Orbie, Jan: Civilian Power Europe, S. 124 f. Vgl. Hill, Christopher: European Foreign Policy: Power Bloc, Civilian Model – or Flop?. In: Rummel, Reinhardt (Hrsg.): The Evolution of an International Actor, Western Europe‘s New Assertiveness. Colorado/Oxford 1990, S. 31-55, hier S. 55. Vgl. Jünemann, Annette/Schörnig, Niklas: Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der „Zivilmacht“ Europa, S. 5. Vgl. Smith, Karen E.: Beyond the Civilian Power EU Debate. In: Politique européenne, 17 (2005), S. 63-82. Vgl. Manners, Ian: Normative Power Europe: A Contradiction in Terms. In: Journal of Common Market Studies, 40 (2002), S. 235-258, hier S. 237. Hill, Christopher: The Capabilities-Expectation Gap, or Conceptualizing Europe’s Inter- 132 Marianne Witt konsistentes Verharren von Konzeptverfechtern.10 Dieses ist nach Philipps jedoch spätestens mit Initiierung der europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) nicht mehr zu rechtfertigen. Er beobachtet ein nicht zu leugnendes Spannungsverhältnis zwischen der zivilen Orientierung und den sicherheitspolitischen Vorhaben der EU.11 Aufgrund dessen argumentiert Smith, dass die EU trotz einigen idealtypischen, zivilen Eigenschaften nicht mehr als Zivilmacht zu betrachten ist.12 Sie fordert die Abkehr von der ursprünglichen Charakterisierung und positioniert die EU »somewhere along a spectrum between the two ideal-types of civilian or military power«.13 Dabei lassen ihre Ausführungen eine adäquate Erklärung vermissen. Manners und de Zutter verwerfen das Konzept ebenfalls, bemühen sich aber im Weiteren um die Generierung einer anderen Analyseeinheit, dem normative power-Konzept.14 Zum anderen kritisiert Stavridis die Debatte über verfügbare Kapazitäten, in welcher unerlässlich-zivilmachtspezifischen Besonderheiten jegliche Definitionsgewalt abgesprochen wird und erhebt indessen qualitative Anforderungen.15 Für ihn entwickelt sich die EU erst durch die gemeinsame Verteidigungsdimension zu einer Zivilmacht by design, welche fortan über die Fähigkeit verfügt ihren zivilen Zielen aktiv nachzukommen.16 Larsen zählt entsprechend neben zivilen, auch militärische Kapazitäten zu den Bestandteilen des europäischen Instrumentarienkatalogs17, wobei der Einsatz dieser, laut Withman, an zivilmachtspezifische Bedingungen zu knüpfen ist.18 Indirekt national Role. In: Journal of Common Market Studies, 31(1993) S. 305-328, hier S. 305 ff. 10Vgl. Smith, Karen: Beyond the Civilian Power EU Debate, S. 70. 11 Vgl. Philipps, Sören: The Birth of the European Union: Challenging the Myth of the Civilian Power Narrative. In: Historical Social Research, 34 (2009), S. 203-214, S. 205. 12 Vgl. Smith, Karen: Beyond the Civilian Power EU Debate, S. 70. 13 Ebd., S. 81. 14 Vgl. Manners, Ian: Normative Power Europe, S. 238./Vgl. De Zutter, Elisabeth: Normative power spotting: an ontological and methodological appraisal. In: Journal of European Public Policy, 17 (2010), S. 1106-1127, S. 1107 ff. 15 Vgl. Stavridis, Stelios: Why the ‘Militarising’ of the European Union is strengthening the concept of a ‘Civilian Power Europe’. In: EUI Working Papers, 17 (2001), S. 1-21. 16 Vgl. ebd., S. 20. 17 Vgl. Larsen, Henrik: A Global Military Actor?. In: Cooperation and Conflict, 37 (2002), S. 283-302, S. 292. 18Vgl. Whitman, Richard: ‘The Fall, and Rise, of the Civilian Power Europe?‘. In: National Europe Centre Paper, 16 (2002), S. 1-28, S. 21. 133 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 pflichten sie so den von Kirste und Maull in dem Aufsatz zur ›Zivilmacht und Rollentheorie‹ getätigten Überlegungen aus dem Jahr 1996 bei. Diese bedienen sich der soziologischen Rollentheorie, welche zur Mehrdimensionalität leitende konstruktivistische sowie reflexiv-interpretative Grundelemente in sich vereint.19 Unter Berufung auf die Gauppsche Rollendefinition, welche internationale Rollen »als geplante – d.h. kollektiv normierte und individuell konzipierte – und von Repräsentanten realisierte Einstellungs- und Verhaltensmuster von Staaten […] in internationalen Systemen«20 beschreibt, gelingt es den Autoren die System- mit der Akteursebene zu verknüpfen und ein idealtypisches Rollenkonzept der Zivilmacht zu entwickeln, welchem sich die EU dem Weberschen Idealtypus21 entsprechend mehr oder minder annähern kann. Generierte Analysekategorien ermöglichen hierbei eine Bewertung bezüglich der Übereinstimmung mit dem zivilen Idealtypus. Diese Herangehensweise impliziert eine fortwährende Gültigkeit der Idee ‚Zivilmacht‘ und unterbindet ein Abdriften in die theoretische Debatte über die EU als civilian-, normative- oder military-power. Ebendaher werden die theoretischen Annahmen Kirste und Maulls dem Erkenntnisziel dieses Artikels zu Grunde gelegt. In der Folge schließt sich die Übertragung des zivilmachtspezifischen Rollenkonzeptes auf die ESS an, welche zunächst bestätigt, dass diese als »well-written description of the EU’s ›role concept‹ as a civilian force« einzuschätzen ist.22 Der exponierte, europäische Vermittlungseinsatz im ‚Fünf-Tage-Krieg‘ (August 2008) zwischen den durch Russland gestützten Regionen Abchasien und Südossetien sowie dem georgischen Staat weist allerdings auf eine Neuerung im europäischen Konfliktmanagement hin. Die EU interveniert hier in einen innerstaatlich-ethnischen Konflikt, der von einem geostrategisch-brisanten, in19Vgl. Tritsch, Dirk: Die Europäische Union als Zivilmacht. Eine Analyse über das außenpolitische Verhalten der Europäischen Union in den Internationalen Beziehungen auf der Grundlage einer weiterentwickelten Zivilmachtkonzeption. Frankfurt am Main 2008, S. 36. 20Gaupp, Peter: Staaten als Rollenträger. Die Rollentheorie als Analyse-Instrument von Außenpolitik und internationalen Beziehungen. Bern 1983, S. 109. 21 »Die idealtypische Definition von Zivilmacht bedeutet dann, dass sich ein Staat oder eine staatenähnliche Organisation wie die EU dem Zivilmachtkonzept zwar auf ein Kontinuum annähren oder davon entfernen kann, der Idealtyp selbst aber nicht zu erreichen ist.« Jünemann, Annette/Schörnig, Niklas: Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der „Zivilmacht“ Europa, S. 5. 22Vgl. Maull, Hanns: Europe and the new balance of global order. In: International Affairs, 81 (2005), S. 775-799, S. 792. 134 Marianne Witt terstaatlichen Verhältnis zwischen Russland und dem georgischen Staat überschattet wird.23 Auf diese Weise dringt sie als sicherheitspolitischer Akteur in den machtpolitischen Einflussbereich Russlands und kommt eigens in der ESS formulierten Interessen nach. Das zuvor negierte Spannungsverhältnis zwischen dem ursprünglichen Charakter der EU und ihrem sicherheitspolitischen Agieren ist kaum zu leugnen. In dieser Entwicklung liegt die Motivation der fallspezifischen Effizienzanalyse europäischen Konfliktmanagements, welche das sicherheitspolitische Handeln der EU in Georgien vor und nach der August-Krise (2008) überprüft. Dadurch wird dem Ziel dieses Artikels, eine angemessene Verortung der EU zwischen ziviler und sicherheitspolitischer Rollenkonzeption vorzunehmen sowie eine instruktive Erklärung derzeitigen europäischen Konfliktengagements zu leisten, nachgekommen. Zivilmacht: eine spezifizierte Rollenkonzeption nach Kirste und Maull Mit der begründeten Übertragung der individuellen Rollentheorie auf kollektive Akteure konstruieren Kirste und Maull das idealtypische Rollenkonzept der Zivilmacht als »Konkretisierung des allgemeinen Begriffs ›Rollenkonzept‹ für einen bestimmten staatlichen Akteur«24. Der kognitive Prozess, in dem die Herausbildung des Konzeptes erfolgt, wird der Gauppschen Definition entsprechend sowohl durch externe, alter-part bedingte Einflüsse als auch durch interne, ego-part bedingte Erfahrungen kollektiv normiert. Die Systemebene erfasst den alter-part der sozialen Rolle, welcher beispielsweise Verhaltenserwartungen anderer Akteure impliziert. Diesem fühlt sich der außenpolitische Akteur im hiesigen Kontext verpflichtet, sodass der alter-part ferner durch dauerhaftes Bestehen internalisiert werden kann. Die Akteursebene beschreibt hingegen den ego-part, der auf dem kollektiven Selbstverständnis eines außenpolitischen Akteurs gründet und durch Werte, Normen sowie dem Sozialisationsprozess oder die Historie geprägt ist. Es ergibt sich, dass das langfristige Rollenkonzept in der Praxis »aus einem komplexen Rollenbündel besteht, das 23Vgl. Opitz, Maximilian: Der Kaukasus zwischen Minderheiten und Machtpolitik. In: APuZ, 13 (2009), S. 25-31, hier S. 27 f. 24Kirste, Knut/Maull, Hanns W.: Zivilmacht und Rollentheorie. In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 3 (1996), S. 283-312, hier S. 299. 135 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 über eine Vielzahl von Situationsrollen umgesetzt wird«25. Situationsrollen können dabei im Widerspruch zueinander stehen ohne dass das Rollenkonzept als solches in Frage zu stellen ist. Im Gegenteil: Sie sind für die Bildung eines Rollenkonzeptes sogar essentiell vorauszusetzen. Diese Herangehensweise ermöglicht infolgedessen nicht nur eine systemische Analyse, sondern beinhaltet Bewertungsmöglichkeiten durch einen Vergleich von: a. Rollenverständnis und Rollenverhalten eines Akteurs und b. dem Idealtypus der Rolle sowie dem konkreten Rollenverständnis bzw. Rollenverhalten. Hierbei definieren Kirste und Maull den anzustrebenden Idealtypus einer Zivilmacht als »ein[en] Staat, dessen außenpolitisches Rollenkonzept und Rollenverhalten gebunden sind an Zielsetzungen, Werte, Prinzipien sowie Formen der Einflußnahme [sic!] und Instrumente der Machtausübung, die einer Zivilisierung der internationalen Beziehungen dienen«.26 Wert- und normengebundenes Agieren zeichnet also den zivilen Charakter und kollidiert nicht mit der Vertretung von Interessen, weil außenpolitische Strategien und Ziele ausschließlich aus eben solchen Interessen, denen Normen und Werte übergeordnet sind, entwickelt werden. Weiterführend leitet dies zu dem Schluss, dass sich eine Zivilmacht durch die Akzeptanz des möglichst gewaltfreien Konfliktaustrags als Prämisse und die Bereitschaft zur Übertragung staatlicher Souveränität an supranationale Institutionen von anderen internationalen Akteuren abhebt.27 Um einen solch zivilen Akteur identifizieren zu können, generieren die Autoren Analysekategorien, die die Operationalisierung des Rollenbündels bzw. der Handlungsmaxime einer Zivilmacht ermöglichen. Sobald sich diese »in der deklaratorischen Außenpolitik eines […] Akteurs nachweisen [lassen] - […] kann davon ausgegangen werden, daß [sic!] diese […] handlungsleitend auf die operative Außenpolitik für den Akteur wirken.«28 25Ebd., S. 290. 26Ebd., S. 300. 27Ebd. 28Ebd., S. 303. 136 Marianne Witt So weist eine Zivilmacht idealtypischerweise einen Gestaltungswillen29 auf, der darauf abzielt, künftige Entwicklungen mit Hilfe partnerschaftlicher Bemühungen zu gestalten, sodass aus beispielhafter friedlicher Kooperation eine Vorbildfunktion resultiert. Weiterhin steht die Außenpolitik unter dem Primat nationaler Zielsetzungen, welche vorrangig von einem Sicherheitsbedürfnis und einer demokratisch-sozialstaatlichen Innenpolitik geprägt sind und auf die internationalen Beziehungen übertragen werden sollen. Entsprechend resultieren internationale Zielsetzungen, die mit der Zivilisierung internationaler Politik zusammenzufassen sind. Diese erfolgt beispielsweise durch die Förderung von Demokratisierungsprozessen, die Vertiefung internationaler Organisationen und die Erweiterung internationalisierter Kooperationszusammenhänge. Als wirksame außenpolitische Instrumente der Zivilmacht, um verflochtene Interessen und universale Werte, wie die Implementierung von good governance-Strukturen in anderen Staaten zu unterstützen, werden ‚positive bzw. negative Anreizsysteme‘ zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ausgewogenheit von Entwicklungsprozessen geschaffen. Im Bereich der aktiven Konfliktregulierung werden ebenfalls politische und wirtschaftliche Reglementierungsmaßnahmen bevorzugt. Verhandlungen, Kompromisse und Schlichtungsverfahren sind elementar, was nicht bedeutet, dass militärische Interventionen zum Zwecke der kollektiven Selbstverteidigung oder der kollektiven Sicherheit ausgeschlossen werden. Zivilmächte, so Kirste und Maull, seien nur mitnichten pazifistisch, bevorzugen jedoch in einem Gefüge von Kooperationspartnern »arbeitsteilige Verfahrensweisen, […] multilateral einsetzbare, möglicherweise sogar integrierte Instrumente, deren Einsatz durch kollektive Entscheidungen […] legitimiert sein [müssen].«30 Insgesamt bleibt festzustellen, dass eine idealtypische Zivilmacht in ihrem Streben nach Sicherheit und Stabilität spezifische außenpolitische Handlungsmuster aufweist, die sich in ihrem Verhältnis zu weiteren Akteuren, insbesondere im Be- 29Die im weiteren Verlauf dieses Kapitels und im anschließenden Kapitel kursiv gedruckten Analysekategorien sind von Kirste, Knut/Maull, Hanns W.: Zivilmacht und Rollentheorie, S. 301-303 übernommen. 30Ebd. 137 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 reich der Konfliktregelung, niederschlagen und militärische Interventionen zu einem Ultima Ratio werden lassen. Die Europäische Union – eine Zivilmacht trotz Sicherheitsstrategie? Kirste und Maull verweisen in ihren Ausführungen implizit auf die Kooperationsnotwendigkeit von Staaten, die sich der Rolle der Zivilmacht verschrieben haben. So legt Tewes »die Untersuchung internationaler Regime, Institutionen oder epistemic communities« nahe.31 Kombiniert mit einem kontinuierlichen Analyseschema rückt die Empfehlung von Tewes die EU in den Untersuchungsfokus. Diese bekennt sich bereits im Jahr 1973 im ›Dokument über die Europäische Identität‹ zur Wahrung der »Grundsätze der repräsentativen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit, die das Ziel des wirtschaftlichen Fortschritts [sind], sowie der Achtung der Menschenrechte als Grundelemente der europäischen Identität […].«32 Die Prämisse einer Zivilmacht, dass sowohl Ziele, Strategien und Interessen übergeordneten Normen und Werten unterworfen seien, ist damit erfüllt worden und wird bis dato beibehalten bzw. angestrebt, indem sich die EU den Bedingungen entsprechend dynamisch entwickelt ohne dabei jemals Abstand von dem Selbstverständnis eines zivilen Akteurs zu nehmen.33 Ob die im Jahr 2003 als Reaktion auf aktuelle, weltpolitische Veränderungen verabschiedete ESS ›Für ein sicheres Europa in einer besseren Welt‹, dieses widerspiegelt und nachweislich Elemente der von Kirste und Maull generierten Analysekategorien inkludiert, ist zu überprüfen – zumal die ESS die derzeitige Außenpolitik der EU deklaratorisch bestimmt. In der ESS wird ein entsprechender Gestaltungswille forciert, indem es heißt, dass »kein Land in der Lage [ist], die komplexen Probleme der heutigen Zeit im 31 Tewes, Henning: Das Zivilmachtkonzept in der Theorie der Internationalen Beziehungen. Anmerkungen zu Knut Kirste und Hanns W. Maull. In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 4 (1997), S. 347-359, S. 356. 32Rat der Europäischen Union: Dokument über die europäische Identität. 25.07.2011, http://www.omnia-verlag.de/europa/cdrom/media/Basis/Organe/ER/Pdf/Dokument_ Identitaet.pdf, S. 1. 33»Die Entwicklung der Europäischen Identität wird sich nach der Dynamik des europäischen Einigungswerks richten. In den Außenbeziehungen werden die Neun vor allem bemüht sein, ihre Identität im Verhältnis zu den anderen politischen Einheiten schrittweise zu bestimmen.« Ebd., S. 6. 138 Marianne Witt Alleingang zu lösen.«34 Daraus ergeben sich »[d]ie zunehmende Konvergenz europäischer Interessen und die Stärkung der gegenseitigen Solidarität«35, welche die EU zu einem handlungsstarken Akteur werden lassen, der unter dem Bekenntnis zur Charta der Vereinten Nationen (VN) willens ist Verantwortung im weltpolitischen Geschehen zu übernehmen. Weiterhin verfolgt die EU, als ein Zusammenschluss von Staaten, die ihren nationalen Zielsetzungen entsprechend Souveränität transferieren, internationale Zielsetzungen, wobei unter dem Primat der Sicherheit nachhaltig verflochtene Interessen und Werte zu fördern sind, um eine Zivilisierung der internationalen Politik herbeizuführen. Hierbei werden insbesondere die Bemühungen »um engere Beziehungen zu Russland«36 hervorgehoben. So ist der beste Schutz für die Sicherheit »eine Welt [von] verantwortungsvoll geführte[n] demokratische[n] Staaten.«37 In diesem Sinne präferiert die EU außenpolitische Instrumente in Form von politischen und sozialen Reformen sowie der Verbreitung verantwortungsvoller Staatsführung und setzt sich mit einer aktiven Bekämpfung von Korruption und Machtmissbrauch sowie der Einführung von Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz der Menschenrechte für zivilisatorische Prozesse ein. Aufkommenden Bedrohungen soll also mit entwicklungsfördernden Präventivmaßnahmen begegnet werden. Handelt es sich bereits um einen failed state können »militärische Mittel zur Wiederherstellung der Ordnung«38 in Erwägung gezogen und sowohl durch wirtschaftliche, als auch durch zivile Maßnahmen ergänzt werden. »Regionale Konflikte bedürfen [in erster Linie] politischer Lösungen, in der Zeit nach Beilegung des Konflikts können aber auch militärische Mittel und eine wirksame Polizeiarbeit vonnöten sein«39. Der Einsatz sicherheitspolitischer Instrumentarien ist dabei ebenfalls stets mit wirtschaftlichen und zivilen Wideraufbaumaßnahmen zu kombinieren. Hierbei ist das im Zuge dessen formulierte, besondere Interesse der europäischen Außenpolitik am Südkaukasus als künftige Nachbarregion mit regionalen Konflikten in Hinblick auf den weiteren Verlauf dieses Artikels hervorzuheben. 34Europäische Union: Europäische Sicherheitsstrategie, S. 1. 35Ebd. 36Ebd., S. 14. 37Vgl. ebd. S. 10. 38Ebd., S. 7. 39Ebd., S. 7. 139 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Grundsätzlich führt die Erwägung der Möglichkeiten der EU, sich neben zivilen auch militärischen Mitteln zu bedienen, zu der eigenen Einschätzung im Falle komplexer Situationen besonders gut gerüstet zu sein.40 Inwieweit dies der Realität entspricht, ist zu hinterfragen. Die ‚unpräzise Formulierung der ESS‘41 kann als wegweisender Indikator für mögliche Unzulänglichkeiten betrachtet werden, die im praxisbezogenen Einsatz der EU als sicherheitspolitischer Akteur zu Tage treten können. Dennoch offenbart die Anwendung der Analysekategorien auf die ESS auch, dass die EU außenpolitische Handlungsmuster einer wertorientierte Außenpolitik aufweist, die das zivile Selbstverständnis widerspiegeln. Dadurch nähert sich die EU dem idealtypischen ZK. Es fügt sich ein Vergleich von der soeben zu Grunde gelegten Strategie – dem Rollenverständnis – und der Praxis - dem Rollenverhalten - am Fallbeispiel der georgischen Sezessionskonflikte an, um die beiden Faktoren schlussendlich in Relation zum Idealtypus einer Zivilmacht zu setzen. Nur so kann das Verhältnis der idealtypischen, zivilmachtspezifischen Rollenkonzeption zu der eines sicherheitspolitischen Akteurs angemessen bestimmt werden. Die georgischen Sezessionskonflikte Die eingefrorenen Sezessionskonflikte42 Georgiens reichen bereits zum Teil in vorsowjetische Zeit zurück. Es kollidiert das statische Prinzip der territorialen Integrität des international anerkannten Staates Georgien mit dem dynamischen, nationalen Selbstbestimmungsrecht der Völker, auf welches sich die separatistischen Provinzen Abchasien und Südossetien berufen.43 40Vgl. ebd. 41Die ESS weist keinerlei fallspezifische Überlegungen und Vorgehensvorschläge bzw. Lösungsvorschläge auf. 42Sezession als »the formal withdrawal from an established, internationally recognized state by a constituent unit to create a new sovereign state.« (Bartkus, Viva Ona: The Dynamics of Secession. In: Cambridge Studies in International Relations, 65 (1999), S. 3)./ Sie streben nicht zwangsläufig eine Loslösung mit einhergehender selbstständiger Staatsgründung an; eine Eingliederung in einen bestehenden Staat ist möglich. (Vgl. Eder, Franz: Sicherheitspolitik im Südkaukasus. Zwischen balancing, Demokratisierung und zögerlicher Regimebildung. Baden-Baden 2008, S. 124). Zu diesem Themenbereich vgl. auch Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus. 03.06.2011, Stiftung Wissenschaft und Politik, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2010_S08_hlb_ks.pdf, S. 11. 43Vgl. Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, S. 9 140 Marianne Witt Joint Control Commission (JCC) 1991-1992 Georgien - Südossetien Russland vermittelt 1992-1994 Georgien - Abchasien Russische PeacekeepingTruppen unter Aufsicht von UNBeobachtungsmission (UNOMIG) Stationierung russischer Militärbasen auf georgischem Territorium GUS-Beitritt Georgiens »Abkommen über Waffenstillstand und Truppentrennung« (1994) OSZE-Mission zur Kontrolle der JCC und Unterstützung der von der JCC geführten Verhandlungen mit EU-Hilfen Sotschi-Abkommen (1992) JCC- Friedenstruppen unter russischem Kommando aus russischen, georgischen, nordund südossetischen Vertretern zusammengesetzt, leitet zum Exponierte Akteure und Abkommen in den georgischen Sessezionskonflikten Kriegerische Eskalationen Einfrieren der Konflikte ohne grundlegende Lösung durch…. Wahrung des Waffenstillstands und zugehörige Folgen Tabelle 1: eigene Darstellung 141 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Die innerstaatlichen Differenzen münden durch die zunehmende Verhärtung der ethno-nationalen Konfliktlinie kurz nach der im April des Jahres 1991 erlangten Unabhängigkeit des georgischen Staates jeweils in einem Krieg. Die kriegerischen Eskalationen resultieren aus Machtkämpfen zwischen konkurrierenden Parteikadern und Vertretern der Nationalbewegungen um die Kontrolle des Staatsapparates, welche unter Berufung auf nationalistische Argumentationen ihr fragiles Herrschaftsstreben zu einer Kontroverse zwischen Georgiern und angesiedelten, ethnischen Minderheiten transformieren.44 Wie die Tabelle 1 darlegt, positioniert sich Russland im Zuge der Beilegung der eskalierten Konflikte als vermittelnder Akteur und sichert seitdem sowohl in Südossetien, kontrolliert von der OSZE, als auch in Abchasien, unter Beobachtung der United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG), den Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien – während sich die OSZE und die VN bislang vergeblich um eine kerntreffende Lösung bemühen. Auf diese Weise bestehen die Konflikte bis heute fort. Der georgische Staat unterliegt der Bemühung, seine territoriale Integrität in der Gänze herzustellen und den russischen Einfluss zu minimieren.45 Südossetien strebt »eine Föderation mit Nordossetien als Teil Russlands«46 an, während Abchasien als eigene staatliche Entität mit assoziierten Beziehungen zum russischen Staat anerkannt zu werden möchte.47 Die Kontinuität der divergierenden Bestrebungen manifestiert fortwährende, innerstaatliche Defizite im postsowjetischen Georgien – verweist jedoch ebenfalls darauf, dass die innerstaatlichen Differenzen von einem konfliktträchtigen Verhältnis zwischen Russland und dem georgischen Staat überlagert werden. 44Vgl. Reisner, Oliver/Kvatchadze, Levan: Studien zur länderbezogenen Konfliktanalyse. Georgien. 23.06.2011, Friedrich-Ebert-Stiftung, http://library.fes.de/pdf-files/ id/04432.pdf, S. 31. 45Vgl. Gressel, Gustav C.: Der Krieg am Kaukasus. Geschehnisse und Konsequenzen. In: Reiter, Erich (Hrsg.): Die Sezessionskonflikte in Georgien. Wien/Köln/Weimar 2009, S. 15-49, S. 16. 46Jawad, Pamela: Europas neue Nachbarschaft an der Schwelle zum Krieg. Zur Rolle der EU in Georgien. 30.07.2011, HSFK-Report, 7 (2006), http://www.hsfk.de/fileadmin/ downloads/report0706.pdf, S. 8. 47Vgl. ebd., S. 11. 142 Marianne Witt Russland positioniert sich zwar unter dem Bekenntnis zur territorialen Integrität Georgiens als exponierter Mittler in den Sezessionskonflikten – de facto interagiert es jedoch nicht nach Peacekeeping-Prinzipien, sondern verfolgt eine Strategie des keeping in pieces.48 Als die georgische Seite eine Intensivierung der sicherheitspolitischen Partnerschaft mit den USA versiert und im Jahr 2002 mit amerikanischer Unterstützung die Modernisierung militärischer Strukturen einleitet sowie eine NATO-Mitgliedschaft anstrebt, kollidiert die Strategie der georgischen Regierung, eine Einbindung in westliche Strukturen und eine Internationalisierung der Konflikte zu erreichen, zunehmend mit außenpolitischen Zielsetzungen Russlands. Diese umfassen insbesondere das Wahren der machtpolitischen Einflusssphäre und sind energiepolitische ausgerichtet.49 Daraus resultiert eine ethnische sowie geostrategische Motivation der georgischen Statuskonflikte. Insbesondere die abchasische Region ist durch einen inkludierten Zugang zum Schwarzen Meer von besonderem Interesse. Russland fühlt sich durch das Handeln der georgischen Regierung unter Saakaschwili50 und der sich ergebenden Einflusskonkurrenz zu den USA provoziert und vollzieht einen Positionswechsel in den Konflikten, indem es Georgien seit dem Frühjahr 2008 durch offensichtlich unrechtmäßige Maßnahmen in einen Zustand der kontrollierten Instabilität versetzt.51 Die seit Jahren angespannte Situation im Südkaukasus verschlechtert sich und wird durch das das Vorgehen der Nato und den USA im Falle der diplomatischen Anerkennung des Kosovo geschürt.52 Georgische Drohgebärde tun 48Vgl. Halbach, Uwe: Die Georgienkrise als weltpolitisches Thema. In: APuZ, 13 (2009), S. 3-11, S. 10. 49Vgl. ebd. 50Seit 2004 im Amt. 51Die Vergabe von russischen Pässen, überdurchschnittlichen Pensionszahlungen, enge wirtschaftliche Anbindung der Gebiete, Durchdringen der politischen Strukturen mit russischen Gewährsleuten, eigene Positionierung als sicherheitspolitischer Garant sind hier beispielhaft anzuführen (vgl. Reisner, Oliver/Kvatchadze, Levan: Georgien, S. 31). Zu den Konfliktparteien vgl. auch Opitz, Maximilian: Kaukasus zwischen Minderheiten und Machtpolitik, S. 27 sowie Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, S. 34. 52Vgl. Schröder, Hans-Henning: Ein kurzer, siegreicher Krieg…Russische Sichtweisen der Kaukasus-Krise. In: Schröder, Hans-Henning (Hrsg.): Die Kaukasus-Krise. Internationa- 143 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 ihr Übriges, sodass Russland im August 2008 mit der ‚Operation zur Bestrafung und Teilung‘ der eigenen Notwendigkeit, den bröckelnden Supermachtstatus wiederherzustellen, nachkommt und die eingefrorenen Konflikte auftaut.53 Fortan wird Russland international in jedweder Hinsicht als Konfliktpartei wahrgenommen. Es bleibt festzuhalten, dass die Konfliktstruktur der georgischen Sezessionskonflikte außerordentlich komplex ist. Die innerstaatlichen Konflikte werden von einem brisanten interstaatlichen Verhältnis geschürt und erlangen mit der kriegerischen Eskalation im Jahr 2008 internationale Relevanz, wodurch das Verhältnis zwischen Russland und den westlichen Staaten immens belastet wird. Russland wirkt in vielerlei Hinsicht als Initiator mit innen54 – sowie außenpolitischen Zielsetzungen, sodass Reisner und Kvatchadze nicht unbegründet folgern, dass der Schlüssel zur Lösung der Konflikte in Moskau zu finden ist.55 Diese Annahme wird dadurch untermauert, dass Russland sowohl in der OSZE durch das Konsensprinzip als auch als Vetomacht im Sicherheitsrat der VN eine Lösung der Konflikte blockiert.56 Aufgrund dessen rückt die EU als vergleichsweise neutraler Akteur in den Fokus, sodass das sicherheitspolitische Engagement der EU in den georgischen Sezessionskonflikten als Analyseinteresse dieses Artikels von besonderer Relevanz ist - wobei Russland im Untersuchungsverlauf als konfliktschürender Faktor Berücksichtigung findet. Working around conflict? - Europäisches Engagement in den georgischen Sezessionskonflikten Bis 2003 zeigt die Europäische Union ein »schwaches, bisweilen recht diffuses Interesse […] an Georgien«57, welches kein exponiertes Engagement zur Befriedung le Perzeptionen und Konsequenzen für deutsche und europäische Politik. Berlin 2008, S. 7-11, S. 9. 53Vgl. Werkner, Ines-Jacqueline: EU zwischen West und Ost – eine Analyse des russischgeorgischen Krieges. In: Tuschl, Ronald H.: Auf dem Weg zum neuen Kalten Krieg? Vom neuen Antagonismus zwischen West und Ost. Wien 2009, S. 88-112, S. 94./Vgl. Halbach, Uwe: Die Georgienkrise als weltpolitisches Thema, S. 3 f. 54Die Berücksichtigung innenpolitischer Zielsetzungen Russlands würden den Rahmen dieser Analyse sprengen, vgl. dazu Halbach, Uwe: Die Georgienkrise als weltpolitisches Thema, S. 6 f. 55Reisner, Oliver/Kvatchadze, Levan: Georgien, S. 28. 56Vgl. Jawad, Pamela: Zur Rolle der EU in Georgien, S. 4. 57Franz, Andre: Die Europäische Union als externer Förderer von Demokratie und Rechts144 Marianne Witt der georgischen Sezessionskonflikte erkennen lässt. Bis zum Ende der 1990erJahre liegt der Schwerpunkt europäischen Engagements in der Region des Südkaukasus auf humanitärer Hilfe und technischer Unterstützung.58 Mit dem Inkrafttreten des Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen der EU und dem georgischen Staat im Jahr 1999 wird ein rechtlicher Rahmen für eine bilaterale Zusammenarbeit manifestiert, welcher vier Achsen der Kooperation59 mit wirtschaftlich-technischem Kern umfasst. Die Ausgestaltung des PKAs verweist auf ein vorrangig ökonomisches Interesse der EU. Georgien ist zunächst nur von fundamentaler Bedeutung, weil es der EU als Transportkorridor den Zugang zu Energiereserven des Kaspischen Beckens und somit eine Diversifizierung des Energiebedarfs ermöglicht.60 Externe Ereignisse, wie die veränderte, sicherheitspolitische Situation nach 9/11, die im selben Jahr erfolgte Aufnahme Georgiens in den Europarat und die georgische Rosenrevolution von 2003, die mit der bevorstehenden Osterweiterung der EU einhergehen, rufen im Jahr 2003 eine Expansion europäischer Interessen an der Region und am georgischen Staat hervor. Ergo zählt die EU in ihrer 2003 verabschiedeten ESS regionale Konflikte zu den derzeitigen Bedrohungsszenarien. Durch die bevorstehende Osterweiterung im Jahr 2004 und die sich 2007 anschließende Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in die EU rücken vielfältige Risiken in unmittelbare Nähe. Es gilt, potentielle spill-over Effekte der konfliktbehafteten Region des Südkaukasus zu unterbinden und einen »Ring verantwortungsvoll regierter Staaten«61 zu schaffen. »Georgien [ist insofern] von fundamentaler Relevanz […] weil [es] alle (positiven wie negativen) Herausforderungen verstaatlichkeit. Ansätze, Determinanten und Wirkungsweise am Beispiel von Georgien und Aserbaidschan. Berlin 2010, S. 112. 58Vgl. Werkner, Ines-Jacqueline: Eine Analyse des russisch-georgischen Krieges, S. 101. 59Entwicklung eines politischen Dialogs, »Unterstützung […] demokratischer und wirtschaftlicher Transition, […] Förderung von Handel und Investition« sowie die Intensivierung kultureller und sozialer Beziehungen. (Jawad, Zur Rolle der EU in Georgien, S. 24./ Vgl. Europäische Union: Partnerschafts- und Kooperationsabkommen PKA: Russland, Osteuropa, Südkaukasus und Zentralasien. 05.08.2011, http://europa.eu/legislation_ summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_ central_asia/r17002_de.html.) 60Vgl. Eder, Franz: Sicherheitspolitik im Südkaukasus, S. 208. 61 Europäische Union: Europäische Sicherheitsstrategie, S. 8. 145 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 körpert, mit denen sich die EU als Sicherheitsakteur […] konfrontiert sieht.« 62 Die durch die Rosenrevolution eingeleitete Demokratisierung Georgiens bildet hier das entscheidende Moment für die EU, sich als sicherheitspolitischer Akteur im Staat und durch eine normierte Außenpolitik gegenüber dem Staat zu positionieren. Die zugrunde liegende Strategie des ‚Wider Europe‘63 verknüpft ökonomische und sicherheitspolitische Interessen darüber hinaus eng mit der Festigung bzw. Ausweitung gemeinsamer Normen und Werte, wodurch eine Parallele zur Nyes Konzeption des ‚soft power‘-Ansatzes64 auszumachen ist. Das resultierende Interessengefüge, welches die Bearbeitung der georgischen Sezessionskonflikte veranlasst, ist also dreiseitig - wirtschaftlich, sicherheitspolitisch sowie normativ – konnotiert. Es äußert sich zunächst in der Ernennung eines Sondergesandten für den Südkaukasus (EUSR) im Juli 2003, wodurch in der Region erstmals ein politisches Instrument der EU zum Tragen kommt. Sein assistierendes Mandat bei bestehenden Reglementierungsmechanismen zur Konfliktprävention beizutragen und in bereits bestehenden zu vermitteln, verdeutlicht das wachsende Bewusstsein für eine einheitliche europäische Sicherheitspolitik.65 62Lynch, Dov: Why Georgia matters. In: Chaillot Paper, 86 (2006), S. 8. 63Wider Europe: Effektive Mechanismen der Wider Europe–Idee sind die präzise rechtliche Anpassung, objektive Veränderungen in wirtschaftlicher Struktur, sowie in subjektiven Überzeugungen, Erwartungen und schlussendlich in der individuellen Identität. Diese führen »zu einem politischen Willen, die europäischen Normen zu akzeptieren«. (Soghomonyan, Vahram: Europäische Integration und Hegemonie im Südkaukasus. Armenien, Aserbaidschan und Georgien auf dem Weg nach Europa. Baden-Baden 2007, S. 103.) 64Soft power: »It is just as important to set the agenda and structure the situation in world politics as to get others to change in particular cases. […] If a state […] can establish international norms consistent with the society, it is less likely to have to change. If it can support institutions that make other states wish to channel or limit their activities in ways to the dominant state prefers, it may be spared the costly existence of coercive or hard power.« (Nye, Joseph S.: Soft Power. In: Foreign Policy, 80 (1990), S. 153-171, S. 166 f.) 65Vgl. Official Journal of the European Union: Council Joint Action 2003/496/CFSP of 7 July 2003 concerning the appointment of an EU Special Representative for the South Caucasus. 07.08.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/L1698.7.2003.pdf 146 Marianne Witt Europäische Nachbarschaftspolitik Mit der im Jahr 2004 vollzogenen Aufnahme der südkaukasischen Staaten in die Strategiepapiere der ENP forciert die EU neben der Erweiterungs-, die Generierung einer effektiven Außenpolitik, um dem eigenen Interessengefüge unter dem Primat der Sicherheit Folge zu leisten.66 Die ENP stellt ein »Instrument zur Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und den Partnerländern [dar, mit der Zielsetzung,] die Vorteile der EU-Erweiterung von 2004 mit den Nachbarländern zu teilen, indem Stabilität, Sicherheit und Wohlstand aller Betroffenen gestärkt werden.«67 Im Rahmen von länderspezifischen Aktionsplänen (AP) ergeben sich unterhalb der Beitrittsperspektive zu verortende ‚privilegierte Partnerschaften‘ mit gegenseitig prioritären Verpflichtungen, die gemeinschaftlich ausgearbeitet werden. Da es sich bei den APs, den georgischen eingeschlossen, jedoch nur um »politische Dokumente«68 handelt, die als »Richtschnur für die Zusammenarbeit«69 dienen und den kein rechtlich verbindlichen Status zu eigen ist, kommt den »Abkommen letztlich nur die Funktion einer gemeinsamen Willensbekundung zu«70. Die Effizienz der ENP als konfliktregulierendes Instrumentarium ist trotz expliziter Intention, die Lösung bestehender Konflikte zu fördern, im Fall Georgiens in Frage zu stellen. Europäisch-georgischer Aktionsplan Auf Grundlage des PKAs erfolgt durch den AP eine Intensivierung der europäischgeorgischen Beziehungen. Diese werden von europäischer Seite nach dem Prinzip der Pfadabhängigkeit gestaltet. Indizien dafür sind der Umstand, dass »[d]ie Fortschritte bei der Einhaltung der vereinbarten Prioritäten […] in den durch das 66Vgl. Jawad, Pamela: Zur Rolle der EU in Georgien, S. 15. 67Europäische Kommission: Mitteilung zur Europäischen Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier. 07.08.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200 4:0373:FIN:DE:PDF, S. 3. 68Ebd., S. 1. 69Europäische Union: Europäische Nachbarschaftspolitik. Aktionsplan EU-Georgien. 03.08.2011, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/georgia_enp_ap_final_ de.pdf, S. 33. 70Werkner, Ines-Jacqueline: Eine Analyse des russisch-georgischen Krieges, S. 104. 147 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 [PKA] […] eingerichteten Gremien überwacht [werden]«71 sowie die in dem AP auf Grundlage der Zielsetzungen der ENP manifestierten, acht georgienspezifische Schwerpunktbereiche72 mit dem Fokus auf Aspekten der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Zusammenarbeit. Dennoch kann im Zuge georgischer Zielsetzungen, welche die Lösung der innerstaatlichen Konflikte als oberste Priorität in die Verhandlungen zum AP einbringen, erreicht werden, dass sich die EU bereiterklärt »Mitverantwortung in Sachen Konfliktprävention und Konfliktlösung«73 zu übernehmen. Infolgedessen widmet sich der sechste Schwerpunktbereich unter »Achtung der georgischen Souveränität und territorialen Integrität innerhalb seiner international anerkannten Grenzen«74 der unmittelbaren Konfliktlösung durch Implementierung spezifischer Maßnahmen, welche mit der »Weiterentwicklung der Rolle des [EUSR] […] im Rahmen seines Mandats«75 einhergehen. Sein assistierendes Mandat wird zu einem gestalterischen gestreckt.76 Die Schwerpunkte europäischen Konfliktengagements liegen auf der Unterstützung der OSZE und den VN in ihren Verhandlungsbemühungen ohne dabei eine Duplizierung von Strukturen herbeizuführen; Vertrauensbildung, Einbeziehen der Zivilgesellschaften der abtrünnigen Provinzen, aktiven Beiträgen zum Entmilitarisierungsprozess, Verbesserung der Wirksamkeit von Verhandlungsmechanismen sowie der konstruktiven Zusammenarbeit mit weiteren an der Region in71 Europäische Kommission: ENP-Strategiepapier, S. 3. 72»Stärkung der Rechtsstaatlichkeit; Verbesserung des Geschäfts-und Investitionsklimas; Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und sozialer Maßnahmen; Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Freiheit und Sicherheit; Stärkung der regionalen Zusammenarbeit; Förderung friedlicher Lösungen bei internen Konflikten; Zusammenarbeit in Außen- und Sicherheitspolitik sowie Verkehr und Energie« (Vgl. Europäische Union: Aktionsplan EU-Georgien, S. 3 ff./hier: Zusammenfassung nach Werkner, Ines-Jacqueline: Eine Analyse des russisch-georgischen Krieges, S. 103.) 73Vgl. Europäische Union: Aktionsplan EU-Georgien, S. 1. 74Ebd., S. 6. 75Vgl. ebd. S. 14. 76Official Journal of the European Union: Council Joint Action 2006/121/CFSP of 20 February 2006 appointing the European Union Special Representative for the South Caucasus. 08.08.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ l_04920060221en00140016.pdf. 148 Marianne Witt teressierten internationalen Akteuren und der Aufnahme der Problematik in den europäisch-russischen Dialog.77 Zusätzlich, um das Bemühen der Konfliktparteien zu fördern, werden bei erkennbaren Fortschritten zur Konfliktlösung, dem Konditionalitätsprinzip entsprechend, vermehrte Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt. Die im georgischen Staat unter höchster Priorität eingeleitete Rechtsstaatsreform EU Rule of Law Mission to Georgia (EUJUST THEMIS) unterstreicht diesen Schluss. Sie bildet nach Lynch »das Gravitationszentrum staatlicher Konsolidierung, der Konfliktlösung und wirtschaftlicher Entwicklung.«78 Demgemäß werden die vom European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) für Georgien im Zeitraum 2007 bis 2010 vorgesehenen Ressourcen in Höhe von 120, 4 Millionen Euro durch das National Indicative Programme (NIP) zugewiesen. Der erste Schwerpunktbereich »Unterstützung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung« erhält 31,5 Millionen Euro, während dem vierten »Unterstützung bei der friedlichen Beilegung der internen Konflikte in Georgien« nur 19 Millionen Euro zugestanden werden.79 Die Wahrnehmung der EU als Finanzier, welcher sich über den EU-spezifischen Weg einer funktionierenden Wirtschaft und institutionellen Kapazitäten um Stabilitäts- und Sicherheitsförderung bemüht, ist folgerichtig und ebenfalls in den Sezessionsgebieten festzustellen. Dort tritt die EU seit dem Jahr 2006 als Hauptförderer auf.80 Die langfristigen Stabilisierungsmaßnahmen im georgischen Staat und seinen abtrünnigen Provinzen werden lediglich durch den Sondergesandten als alleiniges politisches Instrumentarium ergänzt. Vornehmlich erhöht der EUSR die politische Präsenz der EU in der südkaukasischen Region, indem er sich beispielsweise mit Beihilfe eines support teams um vertrauensbildende Maßnahmen an der russisch-georgischen 77 Vgl. Europäische Union: Aktionsplan EU-Georgien, S. 8. 78Lynch, Dov: Security Sector Governance in the Southern Caucasus – Towards an EU Strategy. In: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Fcrces (DCAF) (Hrsg.): Security Sector Governance in the Southern Caucasus: Challenges and Visions. Genf 2004, S. 34-47, S. 46. 79 Vgl. Europäische Union: European Neighbourhood and Partnership Instrument. Georgia. National Indicative Programme 2007-2010. 25.08.2011, http://ec.europa.eu/world/enp/ pdf/country/enpi_csp_nip_georgia_en.pdf, S. 4. 80Vgl. Bardakçi, Mehmet: EU engagement in conflict resolution in Georgia: Towards a more proactive Role. In: Caucasian Review of International Affairs, 4 (2010), S. 214-236, S. 227. 149 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Grenze bemüht sowie in Zusammenarbeit mit der OSZE und den VN eine Lösung der Sezessionskonflikte anstrebt.81 Seine Wirksamkeit ist trotz Mandatserweiterung umstritten. So weisen die Ausgestaltung und die sich anschließende Umsetzung des europäisch-georgischen APs einen weichen Charakter konfliktregulierender Instrumentarien auf. Obwohl sich die EU zur expliziten Mitverantwortung im Zuge der Konfliktprävention und Konfliktlösung verpflichtet, bedient sie mit Ausnahme der Rechtsstaatsreform keinerlei ESVP-Instrumentarien und partizipiert allein durch die Mandatserweiterung des EUSR aktiv im Rahmen der Konfliktbeilegung.82 Unter dem Vorrang langfristiger Orientierung und Unterstützung gilt es derweil »den Boden für nachhaltige Konfliktlösung und Stabilisierung vorzubereiten«83 ohne dabei die europäisch-russischen Beziehungen zu belasten. Prinzipien der Konfliktprävention bzw. des Post-Konfliktmanagements werden auf diese Weise zwar erfüllt, lassen jedoch traditionelle DDR- und SSR-Maßnahmen sowie eine Partizipation im direkten politischen Dialog mit den Konfliktparteien größtenteils vermissen. Im Zuge dessen erklärt Popescu die Dimension der Konfliktregulierung für konzeptionell unterentwickelt und stellt fest, dass die Sezessionsgebilde de-facto von der ENP ausgeschlossen sind.84 Es fehlt nicht nur die direkte Beteiligung an der Lösung der Konflikte, sondern zusätzlich der rechtliche Rahmen einschließlich der Weisungsbefugnis, um zumindest die sachgemäße Umsetzung der bilateralen Aktionspläne sicherzustellen. Zwischenergebnis Nach Khasson u.a. handelt es sich bei der ENP um ein Instrumentarium, welches die Prämissen des europäischen Zivilmachtkonzeptes par excellence erfüllt.85 Cameron untermauert diese Annahme durch die Feststellung, dass die ENP die ge81Vgl. Official Journal of the European Union: Council Joint Action 2006/121/CFSP of 20 February 2006 appointing the EUSR for the South Caucasus. 82Vgl. Popescu, Nicu: The EU in Moldova - Settling conflicts in the neighbourhood. In: Occasional Paper, 60 (2005), S.11 sowie vgl. Bardakçi, Mehmet: EU Engagement in Conflict Resolution in Georgia, S. 224 f. 83Vgl. Eder, Franz: Sicherheitspolitik im Südkaukasus, S. 217. 84Vgl. Popescu, Nicu: The EU in Moldova, S. 10 ff. 85Vgl. Khasson u.a.: ‘Everybody Needs Good Neighbours‘: The EU and its Neighbourhood. In: Orbie, Jan (Hrsg.): Europe’s Global Role. External Policies of the European Union. Cornwall 2009, S. 217-257, S. 220. 150 Marianne Witt nerelle Philosophie der EU im internationalen Beziehungsgefüge widerspiegelt. Außenpolitischen Herausforderungen wird in diesem Kontext mit politischen, wirtschaftlichen und kooperativen Verfahren begegnet.86 Formulierung und Umsetzung des europäisch-georgischen APs bestätigen die These. Im wissenschaftlichen Diskurs ruft das sicherheitspolitische Agieren der EU differierende Bewertungen hervor. Lediglich die Wahrnehmung der EU als »honest broker«87 erfährt allseitige Zustimmung. Eder urteilt im Zuge dessen, dass die europäische Rolle in der Region im Vergleich zu anderen Akteuren eine neuartige ist, weil sie eine area in between einnimmt.88 Als Katalysator für Regimebildung ohne machtpolitische Schritte fördert sie nicht nur den Aufbau des georgischen Staates, sondern auch die regionalen Interdependenzstrukturen. Gemäß der klassifizierenden Einheit der strukturellen Macht werden »Interaktionen so kontrolliert […], dass die Strukturen, die daraus entstehen, langfristig den Zielen eines Akteurs dienen. Dabei werden kurzfristige Interessen, sofern nötig, zurückgestellt.«89 Voraussetzung dafür ist das Generieren eines rechtlichen Rahmens mit Hilfe der Implementierung institutioneller Strukturen. Auf diese Weise erfolgt die Gestaltung des regionalen Umfelds nach spezifischen Kriterien »ohne dabei notwendigerweise auf militärische Mittel rekurrieren zu müssen.«90 Eine Zivilmacht ist zwar nur mitnichten pazifistisch - dennoch berücksichtigt der AP die von der georgischen Regierung geforderte substantielle sicherheitspolitische Arbeit nicht. Die International Crisis Group (ICG) übt diesbezüglich konstruktive Kritik und verlangt im Weiteren zumindest nach einer Kombination »weicher und harter«91 Konfliktregulierungsmechanismen. Neben der langfristigen Ausrichtung sollten kurzfristige, spezifische Instrumentarien, die bei einer potentiellen Eskalation der Konflikte von Nöten sind, zur Verfügung stehen sowie die Wirkung langfristigen Engagements verstärkt werden. Die EU muss demzufolge ihre Sichtbarkeit 86Vgl. Cameron, Fraser: The European Neighbourhood Policy as a conflict prevention tool. In: EPC Issue Paper, 47 (2006), S. 20. 87ICG: Conflict Resolution in the South Caucasus, S. i. 88Vgl. Eder, Franz: Sicherheitspolitik im Südkaukasus, S. 218. 89Mayer, Sebastian: Die Europäische Union im Südkaukasus. Interessen und Institutionen in der Auswärtigen Politikgestaltung. Baden-Baden 2006, S. 247. 90Ebd. S. 249. 91 ICG: Conflict Resolution in the South Caucasus, S. i. 151 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 in den Sezessionsgebieten erhöhen, die Beteiligung der Zivilgesellschaft und den Vertrauensbildungsprozess forcieren, um das Agieren nach top-down-Prinzipien zu reformieren. Bis dato positioniert sie sich durch pfadabhängiges Vorgehen im georgischen Staat. Wirtschaftliche und technische Förderungen bilden den Schwerpunkt, sodass die georgischen Sezessionskonflikte zwar zunehmend über die Institutionalisierung der Beziehungen durch den AP in den Vordergrund rücken, diesen aber de facto mit herkömmlich-zivilen Mitteln der EU begegnet wird. Sicherheitspolitisches Engagement traut sich die EU zwar zu, setzt dieses in der Realität jedoch nicht um, sondern bestätigt das Prinzip des ‚working around conflict‘92. Konfliktmanagement der EU seit dem ‚Fünf-Tage-Krieg‘ Die Eskalation der Statuskonflikte im Fünf-Tage-Krieg im August 2008 ist Ausdruck der zunehmend kollidierenden Interessen Georgiens und dem russischen Staat. Sie demonstriert aber auch zuvor festgestellte Unzulänglichkeiten europäischer Konfliktprävention in den georgischen Sezessionskonflikten. Umso verwunderlicher ist das europäische Krisenmanagement in der Augustkrise des Jahres 2008. Unter exponiertem Engagement des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in seiner damaligen Eigenschaft als Ratspräsident bemüht sich die EU um einen für alle Konfliktparteien akzeptablen zum Waffenstillstand führenden Kompromiss. Weder die »volle Achtung der Souveränität und territorialen Integrität Georgiens«93 noch »Formen internationaler Begleitung«94 finden allseitige Akzeptanz und müssen im Rahmen des Dokumentes verworfen werden. Damit bewirkt die Sechs-Punkte-Vereinbarung95 (SPV) am 12. August 2008 ein erneutes 92Working around conflict: »[T]reating conflict as an impediment or negative externality that is to be avoided.« (Department for International Development DFID: Conducting Conflict Assessments: Guidance Notes. 25.08.2011, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/documents/publications/conflictassessmentguidance.pdf, S. 22.) 93o.V.: Kaukasus-Krieg. Der Sechs-Punkte-Plan. In: Frankfurter Allgemeine, 15.08.2008, http://www.faz.net/s/Rub97F2F5D596354F4BBE619038133D791F/Doc~E846F2FCF16 2C465BBB582C0614EC15A6~ATpl~Ecommon~Scontent.html. 94Ebd. 951. »Kein Rückgriff auf Gewalt zwischen den Protagonisten« 2. »Definitive Einstellung 152 Marianne Witt Einfrieren der kriegerischen Auseinandersetzungen, beseitigt die Spannungen zwischen den Konfliktparteien aber nicht. Überwacht wird die Einhaltung der SPV mit den zugehörigen Umsetzungsmaßnahmen von einer im Oktober 2008 unter dem Schirm der ESVP entsandten, zivilen European Union Monitoring Mission (EUMM), welche in besonderer Abstimmung mit den VN und der OSZE sowie »unter Wahrung der Kohärenz mit anderen Maßnahmen der EU«96 zur langfristigen Stabilität der Region beitragen soll. Gemäß den vier formulierten Hauptaufgabenbereichen soll vorrangig der Stabilisierungsprozess und die uneingeschränkten Erfüllung der SPV gefördert werden. Bezugnehmend auf zivilgesellschaftliche Entwicklungen obliegt der Mission weiterhin das Beobachten von Normalisierungsprozessen: Den Kern bilden »Rechtsstaatlichkeit, wirksam[e] Strafverfolgungsstrukturen und ein[e] angemessen[e] öffentliche Ordnung«,97 infrastrukturelle Gegebenheiten, sowie die Rückkehr von Vertriebenen. Ergänzt werden die Inspektionsaufträge durch die Initiierung vertrauensbildender Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien. Auf diesem Weg soll die Beobachtungsmission einen Beitrag zur Verwirklichung europäischer Politik sowie Interessen leisten. Durch die formellen Unabhängigkeitserklärungen der Sezessionsgebiete und der am 26. August 2008 folgenden diplomatischen Anerkennung durch Russland ergibt sich jedoch eine Situation mit verengten »Kompromissmöglichkeiten und Handlungsspielräumen«98. Der entstandene völkerrechtliche Gegensatz zwischen Russland, »das Abchasien und Südossetien als eigenständige Staatsgebilde und damit die Teilung Georgiens aner[kennt], und dem [Großteil] der Welt«99, der sich zur territorialen Integrität Georgiens bekennt, hemmt nicht nur die Umder Feindseligkeiten« 3. »Gewährung freien Zugangs für humanitäre Hilfe« 4. »Die georgischen Streitkräfte sollen sich auf ihre üblichen Stationierungsorte zurückziehen.« 5. »Die russischen Streitkräfte sollen sich auf Linien vor Beginn der Feindseligkeiten in Südossetien zurückziehen. In Erwartung eines internationalen Mechanismus werden die russischen Friedenstruppen vorläufig Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.« 6. »Eröffnung internationaler Diskussionen über die Modalitäten der Sicherheit und Stabilität in Abchasien und Südossetien«. (Ebd.) 96 Rat der Europäischen Union: Gemeinsame Aktion 2008/736/GASP des Rates vom 15. September 2008 über die Beobachtermission der Europäischen Union in Georgien, EUMM Georgien. 10.08.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2008:248:0026:0031:DE:PDF. 97 Ebd. 98 Werkner, Ines-Jacqueline: Eine Analyse des russisch-georgischen Krieges, S. 95. 99 Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukasus, S. 33. 153 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 setzung der SPV durch die EUMM, sondern auch konfliktlösende Verhandlungen. Die De-facto-Staaten und ihre Anlehnungsmacht Russland verwehren der EUMM infolgedessen den Zugang zu den Provinzen, obgleich das europäische Beobachtungsmandat für das Gesamtterritorium gilt.100 Das Handeln der EUMM ist demgemäß auf die vorgelagerten Gebiete der Sezessionsregionen beschränkt, wodurch sie entgegen der eigenen Haltung die De-Facto-Grenzen absichert.101 Zusätzlich lanciert die über bisherige peacekeeping-Kontingente hinaus aufgestockte, russische Militärpräsenz in den Sezessionsgebieten zu der Unmöglichkeit, den Status quo ante bellum wiederherzustellen oder gar das friedenspolitische Mandat sachgemäß zu erfüllen. Russland erachtet die Waffenstillstandsvereinbarungen für vollführt, da es sich aus dem übrigen Territorium Georgiens zurückgezogen hat.102 Halbach diagnostiziert im Zuge dessen das Dilemma, dass in den georgischen Sezessionskonflikten »[n]ichts […] ohne Russland, schon gar nichts gegen Russland, aber bislang auch nichts mit Russland [geht].«103 Die russische Regierung nutzt bis zu diesem Zeitpunkt lediglich die Lücken der SPV und die Mandatierung der EUMM, um eigenen Interessen nachzukommen. So verhindert die EUMM in Zusammenarbeit mit der OSZE und der UNOMIG-Mission gemäß der SPV lediglich eine erneute Eskalation der bestehenden Feindseligkeiten zwischen den Konfliktparteien. Zugleich wird eine langfristige Lösung innerhalb der Genfer Verhandlungen angestrebt. An diesen beteiligen sich unter dem Co-Vorsitz der EU sowohl die separatistischen Regionen als auch Russland und Georgien. Daher sind der Verhandlungsverlauf, die enge Abstimmung mit den VN und der OSZE sowie eine einheitliche Strategie gegenüber Russland erfolgsentscheidend. Als Russland jedoch im Dezember 2008 durch ein Veto die Mandatsverlängerung der OSZE-Mission in Südossetien und im Juli 2009 die der UNOMIG-Mission in Ab100 Vgl. Halbach, Uwe: Die Europäische Beobachtermission in Georgien: Friedenssicherung auf umstrittener Grundlage. In: Asseburg, Muriel/Kempin, Ronja (Hrsg.): Die EU als strategischer Akteur in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Eine systematische Bestandsaufnahme von ESVP-Missionen und –Operationen. Berlin 2009, S. 124-137, hier S. 129. 101 Sporadischen Zugang zu den Sezessionsgebieten bietet lediglich der Incident Prevention and Response Mechanism (IPRM), welcher insbesondere in Zusammenarbeit mit der OSZE für Südossetien implementiert werden kann (Vgl. Halbach, Uwe: EUMM in Georgien). 102 Vgl. Halbach, Uwe: EUMM in Georgien, 127. 103 Ebd., S. 135. 154 Marianne Witt chasien unterbindet, wird die EUMM, deren Mandat zunächst auf ein Jahr limitiert ist, zur alleinigen internationalen Friedensmission in dem konfliktträchtigen Gebiet und ist bis heute dort stationiert. Die europäische Verantwortung hat sich auf diese Weise signifikant erhöht. Eine Exit-Strategie steht nicht zur Debatte, solange keine allseitig akzeptable Regelung der Konflikte gefunden ist. Es ist also mehr denn je im Interesse der EU die Konflikte beizulegen, Profil zu bekennen und sich bestenfalls als sicherheitspolitischer Akteur zu beweisen. Die EUMM stellt jedoch in keiner Weise ein allumfassendes Instrumentarium der harten Konfliktbearbeitung in Hinblick auf Peacekeeping und Stabilitätssicherung dar, weil ihr friedenspolitisches Mandat unzureichend ausgerichtet ist, um externen Einschränkungen zu trotzen.104 Anstatt das in der Augustkrise gewonnene politische Profil im Rahmen der Arbeit am Konflikt auszuweiten, indem beispielsweise eine effizientere Ausgestaltung der EUMM erfolgt, besinnt sich die EU auf den herkömmlichen Instrumentarienkatalog einer Zivilmacht. Infolgedessen wird die Östliche Partnerschaft (ÖP) als Vertiefung der ENP generiert, um unter anderem den georgischen Staat durch europäische eine engere Anbindung an den europäischen Raum zu stabilisieren. Östliche Partnerschaft – eine langfristige Konfliktlösungsmöglichkeit? Bereits im Mai 2008 wird das Projekt der ÖP durch eine schwedisch-polnische Initiative angestoßen.105 Unter dem Eindruck der Georgienkrise, auch als Manifest für das Scheitern »europäische[r] Konfliktkultur«106 geahndet, »resultier[t] ein ›Gefühl der Dringlichkeit‹ zur Heranführung der östlichen Nachbarn an die EU.«107 Infolgedessen beschleunigt die EU-Kommission ihre Arbeit, sodass die ÖP beim Prager Gipfeltreffen im Mai des Jahres 2009 lanciert wird. 104 Vgl. Halbach, Uwe: Ungelöste Regionalkonflikte im Südkaukaukasus, S. 33. Vgl. auch Halbach, Uwe: EUMM in Georgien, S. 137. 105 Sowohl Schweden als auch Polen zählen zu den europäischen Mitgliedstaaten, die einen konfrontativen Kurs gegenüber Russland einschlagen und eine enge Bindung der südkaukasischen Region an die EU forciert (vgl. Werkner, Ines-Jacqueline: Eine Analyse des russisch-georgischen Krieges, S. 105). 106 Halbach, Uwe: Ungelöste Konflikte im Südkaukasus, S. 31. 107 Halbach, Uwe: Die Georgienkrise als weltpolitisches Thema, S. 5. 155 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Hauptsächlich sieht die Zusammenarbeit im Rahmen der ÖP neue Assoziierungsabkommen u.a. zur Entwicklung umfassender Freihandelszonen für östliche Staaten vor. »Damit steht das Konzept der Konvergenz mit dem EU-Acquis bei Handel, Regulierungspolitik und flankierenden Politiken im Mittelpunkt«108 und richtet ein klares Angebot an die Partnerländer. In diesem Bereich liegen die Stärken europäischer Politik, weil sie hier explizite Anreize im Sinne eines effektiven Konditionalitätsprinzips instrumentalisieren kann. Multilaterale Dialoge auf verschiedenen Ebenen fungieren in direkter Gegenüberstellung zur ENP als wirkliche Neuerung. Neben im zweijährigen Turnus stattfindenden Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs und jährlichen Treffen der Außenminister, werden vier thematische Diskussions-Plattformen zu den Hauptbereichen Demokratie und Stabilität; wirtschaftliche Integration; Energiefragen und dem Ausbau gesellschaftlicher Kontakte eingerichtet.109 Das Resultat ist, dass trotz der katalysierenden Wirkung der Georgienkrise und der in der Erklärung des Prager Gipfeltreffens einleitend formulierten »Notwendigkeit, Konflikte so bald wie möglich auf der Grundlage von Grundsätzen und Normen des Völkerrechts und der in diesem Rahmen gebilligten Entscheidungen und Dokumente beizulegen«110, in der Ausgestaltung der ÖP keinerlei direkte Konfliktregulierungsmaßnahmen berücksichtigt werden, indem eine dahingehende Strategie formuliert oder beispielsweise die EUMM zumindest durch namentliche Erwähnung gestützt wird. Entgegen jedweder Erwartung ignoriert die ÖP schlichtweg die georgischen Sicherheitsbelange.111 »[D]er inkrementellen Weiterentwicklung […] zwischen Erweiterung und klassischer Außenpolitik«112 fehlt zudem die Beitrittsperspektive, so Jobelius und Krumm.113 Deshalb bleibt Georgien lediglich die Instrumentalisierung der ersten Plattform, welche demokratie- und stabilitätsfördernde Überlegungen erfasst, um die Lösung der Sezessionskonflikte zu diskutieren und um abzusichern, dass 108 Lippert, Barbara: Europäische Nachbarschaftspolitik, S. 172. 109 Vgl. Rat der Europäischen Union: Östliche Partnerschaft, S. 9. 110 Ebd. 111 Vgl. Khidasheli, Tamar: Georgia’s European Way. In: IPG 3 (2011), S. 95-108, S. 102. 112 Böttger, Katrin: Im Osten nichts Neues? Ziele, Inhalte und erste Ergebnisse der Östlichen Partnerschaft. In: Integration, 4 (2009), S. 372-387, S. 387. 113 Vgl. Jobelius, Matthias/Krumm, Reinhard: Der Kaukasus-Konflikt. Russland und Georgien ein Jahr danach. 10.08.2011, Friedrich-Ebert-Stiftung, http://library.fes.de/pdffiles/id/ipa/06747.pdf, S. 7. 156 Marianne Witt die EU den De-facto-Staaten die diplomatische Anerkennung weiterhin verwehrt. Diesbezügliche Lobbyarbeit wird durch den vorläufigen Ausschluss Russlands aus der ÖP ermöglicht, wobei sich die ÖP wesenhaft dem Grundsatz verschrieben hat, parallel zur strategischen Partnerschaft mit Russland zu interagieren.114 Demgemäß kann Russland auf Basis gemeinsamer Interessen punktuell einbezogen werden. Die dennoch offenkundig-ablehnende Haltung Russlands in Bezug auf die ÖP trifft die EU jedoch nicht unerwartet – Bereits der im Dezember 2008 formulierte Bericht über die Umsetzung der ESS bemerkt, dass sich die »Beziehungen zu Russland […] infolge des Konflikts mit Georgien verschlechtert [haben]«115, fordert aber ebenso gemeinsame Anstrengungen der EU, der VN, der OSZE und Russlands zwecks dauerhafter Stabilität in der europäischen Nachbarschaft. Damit erfolgt eine Relativierung der in der ESS 2003 vorbehaltlos formulierten Zielsetzung, engere Beziehungen zu Russland als wichtigen Faktor für Sicherheit und Wohlstand im Zuge gemeinsamer Werte anzustreben.116 Auf diese Weise limitiert insbesondere die zu überdenkende Ursprungsstrategie gegenüber Russland eine direkte Positionierung der EU in den georgischen Sezessionskonflikten. Die Initiierung der ÖP stellt, ebenso wie die SPV und die EUMM, einen Kompromiss dar. Außenpolitische Denk- und Handelsmuster Russlands wirken in diesem Kontext strukturbildend.117 Infolgedessen besinnt sich die EU in der Krisensituation auf bewährte Instrumentarien und vollzieht im Rahmen der ENP eine regionale Integration. Die resultierende ÖP sieht nach eigener Einschätzung »einen echten Wechsel in den Beziehungen zu [den] östlichen Nachbarn vor.«118 De facto stellt sie aber eine pfadabhängige Maßnahme dar, die die ENP zwar vertieft und zugleich um eine multilaterale Ebene erweitert, letztlich jedoch das der ENP zugrunde liegende Prinzip des working around conflict aufgreift. Die EU bemüht sich folglich um Stabilität im georgischen Staat, sodass bei einer erfolgreichen 114 Vgl. Wirtschaftskammer Österreich (Hrsg.): Europäische Nachbarschaftspolitik. „A Ring of Friends“. Wien 2010, S. 6. 115 Europäische Union: Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie. 23.08.2011, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/DE/ reports/104634.pdf, S. 10. 116 Vgl. Europäische Union: Europäische Sicherheitsstrategie, S. 14. 117 Vgl. Stewart, Susan: Russland und die Östliche Partnerschaft. Harsche Kritik, punktuelles Kooperationsinteresse. 11.04.2012, Stiftung Wissenschaft und Politik, http://www. swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2009A21_stw_ks.pdf, S. 4. 118 Europäische Union: Bericht über die Umsetzung der Sicherheitsstrategie, S. 10. 157 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Implementierung der Reformen zumindest die Bedingungen für eine Lösung der Konflikte verbessert werden. Solange die Konflikte aber fortbestehen ist keine vollständige Umsetzung der ÖP möglich. Es liegt ein Zirkelschluss vor, den die EU augenscheinlich nur unzureichend reflektiert hat. Andrew Wilson kritisiert dahingehend: »The Eastern Partnership is a step forward. But it’s still a typical EU solution – a long-term, technocratic instrument for a region full of short-term crises.«119 Zusammengefasst bleibt festzustellen, dass die ÖP eine Lösung der Regionalkonflikte zwar für wichtig erachtet, aber nicht auf eine solche ausgerichtet ist. Russland als exponierte Konfliktpartei ist nicht in die ÖP integriert, sodass diese aufgrund ihrer Ausgestaltung nicht als konfliktlösendes Forum instrumentalisiert werden und nur unter Einschränkung die Bedingungen für eine mögliche Konfliktlösung verbessern kann. Eine effektive Verknüpfung der direkten Konfliktbearbeitung im Zuge der EUMM und der indirekten durch die ÖP wäre wünschenswert gewesen. Auf diese Weise wäre die EU der im Zwischenfazit dargelegten Idee der ICG, harte und weiche Instrumentarien zu kombinieren, nachgekommen und hätte dem eigens in der ESS formulierten Anspruch, zivile und militärische Mittel miteinander zu verknüpfen, Folge geleistet. Stattdessen wird die EUMM nicht reformiert und findet keinen Eingang in die ÖP-Initiative. Das working on conflict120-Moment wird revidiert. Schlussbetrachtung Bezugnehmend auf die zugrunde liegenden theoretischen Überlegungen nach Kirste und Maull, unterliegt die zivilmachtspezifische Rollenkonzeption der EU sowohl ego-part als auch alter-part bedingten Einflüssen. Der Einschätzung Holstis zufolge ist dem ego-part innerhalb einer Rollenkonzeption ein überwiegender Einfluss zu Teil, der die manifeste Außenpolitik entscheidend prägt. Zum 119 Wilson, Andrew zitiert nach Rettman, Andrew: EU summit text loaded with eastern tension. 20.08.2011, EUobserver.com, http://euobserver.com/24/28081. 120 Working on conflict: »conscious attempts to design policy and programmes with a primary focus on conflict prevention, management or resolution.« (Department for International Development DFID: Conducting Conflict Assessments: Guidance Notes. 25.08.2011, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/documents/publications/conflictassessmentguidance.pdf, S. 22.) 158 Marianne Witt einen ergeben sich daraus Beschränkungen für die Gestaltung dieser, zum anderen kann die jeweilige Rollenkonzeption strukturbildend zu Stabilität und Wandel des internationalen Systems beitragen. Der europäische ego-part bzw. das kollektive Selbstverständnis der EU als Zivilmacht generiert sich innerhalb der eigenen Entstehungsgeschichte durch die Internalisierung alter-part bedingter Einforderungen der USA nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Als ursprünglich wirtschaftlicher Zusammenschluss von Nationalstaaten, die im Sozialisationsprozess unter dem Bekenntnis zu gemeinsamen Normen und Werten wohlweißlich einen Teil ihrer Souveränität transferiert haben, deklariert die EU in der ESS Interessen einer wertorientierten Außenpolitik. Die in der ESS betonte Notwendigkeit, zur Beilegung regionaler Konflikte in der unmittelbaren Nachbarschaft beizutragen, rückt die georgischen Statuskonflikte in den Fokus. Bereits vor der kriegerischen Eskalation im August des Jahres 2008 bemüht sich die EU durch Aufnahme Georgiens in die ENP um eine Aussöhnung der Konflikte. Wie Vorhergegangenes belegt, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Grund hierfür ist die Anwendung von indirekten Konfliktregulierungsinstrumentarien innerhalb des länderspezifischen APs, die den – externen, alter-part bedingten Einflüssen ausgesetzten - ego-part widerspiegeln. Sowohl Russland als auch der georgische Staat wirken in diesem Kontext auf das Verhalten der EU. Hierbei kommt die EU den georgischen, alter-part bedingten Forderungen nach einem direkten sicherheitspolitischen Engagement nicht nach. Eine instruktive Begründung ist in den innereuropäischen Divergenzen gegenüber dem gewichtigeren alter-part Russland zu finden. Geteilt in zwei Lager werden innerhalb der EU einerseits, aufgrund der energetischen Versorgungsabhängigkeit, kooperative Beziehungen zur Russischen Föderation angestrebt – andererseits das Ziel verfolgt »dem russischen Imperialismus« zu trotzen. Die dem europäischen ego-part eigene Heterogenität limitiert infolgedessen die sicherheitspolitische Positionierung in den georgischen Konflikten – wirkt gemäß ihrer zivilen Rollenkonzeption jedoch zugleich strukturbildend. Erst die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Konfliktparteien veranlasst eine Veränderung innerhalb des europäischen Konfliktmanagements. Aus der Notwendigkeit heraus resultiert ein der Situation angemessenes Rollenverhalten, indem die EU die Waffenstillstandsvereinbarung vermittelt sowie die erste europäische Beobachtungsmission 159 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 in die Region entsendet. Durch die postwendende Reaktion gewinnt sie an sicherheitspolitischem Profil hinzu, wobei sie im Rahmen der Mandatierung der EUMM der eigens in der ESS formulierten Einschätzung, durch den Einsatz militärischer in Verknüpfung mit zivilen Mitteln besonders effizient interagieren zu können, nicht Folge leistet. Die sicherheitspolitische Strategie der EU (Rollenverständnis) und die Umsetzung in die Praxis (Rollenverhalten) stehen immer noch nicht in Einklang miteinander. Somit ist das in der Augustkrise in Erscheinung getretene Potential sicherheitspolitisch zu agieren noch nicht ausreichend in das kollektive, europäische Selbstverständnis internalisiert worden, wobei dennoch eine dahingehende Entwicklung festzustellen ist. Manifestationen dafür sind die Initiierung der ESS und nichtsdestotrotz das hier kritisch dargelegte Engagement in der südkaukasischen Region. Die EU reagiert auf die veränderte weltpolitische Situation des 21. Jahrhunderts – ihrer ego-part bedingenden Entwicklungsgeschichte entsprechend jedoch nicht in postwendender Geschwindigkeit und ohne derweil die eigene zivile Rolle im internationalen Staatengefüge infrage zu stellen. Dies bekommt auch der georgische Staat zu spüren. Das europäische Konfliktmanagement in den georgischen Sezessionskonflikten ist entsprechend von Pfadabhängigkeit geprägt. Die EU hält an ihrem spezifischen Gestaltungswillen fest und besinnt auf die «Förderung demokratischer Institutionen und […] [die] regionale Vernetzung, also die Konfliktlösung durch Interdependenzstrukturen»121. So vermeidet sie das Duplizieren von sicherheitspolitischen Strukturen im georgischen Staat und strebt eine kooperative Zusammenarbeit mit der OSZE und den VN an. Ein direkt in den Konflikt eingreifendes Engagement steht infolgedessen bis zur Augustkrise des Jahres 2008 außerhalb der Erwartungen und ist schlussendlich auf das machtpolitische Streben der damaligen französischen Ratspräsidentschaft zurückzuführen, wie Initiierung und Ausgestaltung der ÖP belegen. Die zivilmachtspezifische Rollenkonzeption wird eben durch einer Vielzahl von möglicherweise in Widerspruch zueinander stehenden Situationsrollen gestaltet. Mit der alleinigen Verantwortung, den Status Quo zwischen den Konfliktparteien zu sichern, wird der EU im Jahr 2009 jedoch ein sicherheitspolitisches Rollen121 Eder, Franz: Sicherheitspolitik im Südkaukasus, S. 216. 160 Marianne Witt konzept nahezu oktroyiert, wodurch sich die Dringlichkeit von Konvergenz der ESS und dem tatsächlichen Rollenverhalten in Form einer effizienten Sicherheitspolitik signifikant erhöht. Bislang positioniert sich die EU dennoch nur durch die Stabilisierungsmaßnahmen der ENP und ÖP sowie durch das bis zum September 2012 verlängerte, aber nicht vertiefte EUMM-Mandat, und forciert die Konfliktregelung innerhalb der Genfer Verhandlungen, welche bis heute keinerlei Durchbruch erzielt haben. Infolgedessen offenbart das europäische Konfliktmanagement Unsicherheiten hinsichtlich der eigenen Positionierung im internationalisierten Gefüge um die georgischen Sezessionskonflikte und auch vier Jahre nach dem erneuten Einfrieren der Statuskonflikte lässt die EU eine »klare politische Vision, die der neuen Lage Rechnung trägt«122 vermissen. So führt die Analyse zu dem Schluss, dass das europäische Engagement in den georgischen Sezessionskonflikten die EU zu einem außenpolitischen Akteur sui generis werden lässt, der sich derzeit in einem langwierigen Wandlungsprozess von ziviler zur sicherheitspolitischer Rollenkonzeption befindet. 122 Boden, Dieter: Keine Lösung in Sicht? Die Konflikte in Georgien zwei Jahre nach dem August-Krieg. 31.07.2011, Friedrich-Ebert-Stiftung, http://library.fes.de/pdf-files/ id/07415.pdf, S. 1. 161 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Gelesen Zur Aktualität der Klassenfrage Sebastian Klauke Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften E-Mail: [email protected] Der im Jahr 2010 erschienene und bereits 2011 in zweiter Auflage veröffentlichte Sammelband Klassen im Postfordismus ist der jüngste Beitrag zu einem Thema mit langer Tradition, das im heutigen universitären Lehrbetrieb und auch sonstigen akademischen Diskussionen und Zusammenhängen ein eher kümmerliches Dasein fristet, auch wenn seit einigen Jahren ein stärkeres Interesse und größere Aufmerksamkeit insbesondere aus dem linken Spektrum an den Fragen von Klasse und Klassenanalyse beobachtet werden kann. Der Band stellt den ambitionierten Versuch dar, die Kategorie der Klasse für die Analyse der heutigen politischen und sozialen Verhältnisse fruchtbar zu machen, sich hierbei von bisherigen Publikationen grundsätzlich abzuheben und deren theoretische Schwächen zu überwinden. Die Motivation, sich erneut mit diesem klassischen Thema zu beschäftigen, ergibt sich aus der Feststellung von Hans-Günter Thien, dem Herausgeber des Buches, dass das bisher aus dem Gebiet der Klasse Publizierte als Versuche des „Vagen“ zu charakterisieren sei, bei dem es sich um „Anläufe“ handle, die häufig „im Spekulativen“ verblieben.1 Um dem Anspruch des Bandes, eine „Neugestaltung“ des noch immer wichtigen Themas der Klassenanalyse gerecht zu werden,2 wird in den vorliegenden Beiträgen der aktuelle Kapitalismus als Ausgangspunkt der jeweiligen Analysen berücksichtigt. Die Begriffe des Fordismus und Postfordismus sind hierbei als Rahmung zu verstehen. Der theoretische Gegner der Publikationen ist derjenige Poststrukturalismus, der die kapitalistische Produktionsweise zugunsten der intensiven Auseinandersetzung mit der reinen Politik vernachlässigt. 1 Thien, Hans-Günter: Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Klassen im Postfordismus. Münster2 2011, S. 7-20, hier S. 10. 2 Ebd., S. 17. 162 Sebastian Klauke Klassen im Postfordismus versammelt neben der Einleitung insgesamt zwölf Beiträge, die in ihrer Gesamtheit in drei Teile untergliedert sind. Der erste Teil „Annäherungen: Erinnerungen an die Klassentheorie“ umfasst drei ältere Beiträge mit dem Ziel, den bisherigen Stand der Diskussion wiederzugeben und zu verdeutlichen. Die grundlegenden Aspekte der Marxschen Klassentheorie werden hier einer intensiven Kritik unterzogen und erweitert. Der zweite Teil „Klassen heute“ befasst sich mit der Fortsetzung und Erweiterung einzelner Aspekte wie auch des Gesamtthemas. Im Fokus stehen die derzeitigen Klassenverhältnisse sowie die Bestimmung von Klasse als Gegenstand der wissenschaftlichen Beschäftigung. In diesem Zusammenhang werden Begrifflichkeiten wie Armut und Prekariat mit in die Analyse aufgenommen. Im dritten Teil geht es um die Transnationalisierung von Klassenverhältnissen, darunter findet sich auch ein älterer Beitrag. Aus einer inter- und transnationalen Perspektive heraus werden Annahmen anderer marxistischer Theoretiker wie die von Beverly Silver oder Nicos Poulantzas berücksichtigt und kritisch fortentwickelt. Bis auf die erwähnten Ausnahmen wurden alle Beiträge für dieses Gemeinschaftswerk neu verfasst. Es schreiben namenhafte und altgediente Theoretiker wie Joachim Hirsch, aber auch Nachwuchswissenschaftler wie Stefan Schmalz. Auch internationale Beiträge wie der von Marcel van der Linden und David Lockwood sind vertreten. Alle Autoren sind dem emanzipatorisch-linken, kritischen Lager der Wissenschaft zuzuordnen, ohne allerdings eine einheitlich Perspektive und Meinung einzunehmen und zu vertreten. Ein gutes Beispiel für das hohe Niveau des Sammelbandes ist der Beitrag „Die Gegenwart der Bourgeoisie“ von Hanns Wienold. Der Artikel stellt zum einen den gelungenen Abschluss des zweiten Teils dar, ist aber zugleich das Verbindungsstück zum dritten und letzten Teil, verknüpft also auf überzeugende Weise eine nationalstaatliche mit der internationalen Perspektive. Nach einer einleitenden Darstellung der allgemeinen „Existenz[weise] und [dem] Wirken der Bourgeoisie“ 3 mithilfe von grundlegenden Begriffen und Formen wie Unternehmen, Kapital und Staat, unternimmt Wienold den interessanten und gelungenen Versuch auf Grundlage empirischer Daten beispielsweise aus den Beständen des Statistischen 3 Wienold, Hanns: Die Gegenwart der Bourgeoisie. Umrisse einer Klasse. In: Hans-Günter Thien (Hrsg.): Klassen im Postfordismus, S. 235-283, hier S. 237. 163 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Bundesamtes oder des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie „die Zusammensetzung der Bourgeoisie und ihre Fraktionierungen“4 für das Beispiel der BRD aufzuzeigen. Hierfür untersucht Wienold insbesondere die deutsche Unternehmensstruktur und nimmt Bezug auf die gesellschaftliche Verteilung von Einkommen und Reichtum. In einem letzten Abschnitt geht der Autor der Frage nach, inwiefern sich die Umrisse einer transnationalisierten nationalen Bourgeoisie ausmachen lassen und leitet damit direkt über in den Beitrag von Joachim Hirsch und Jens Wissel, die sich ausschließlich mit der Transnationalisierung der Klassenverhältnisse beschäftigen. Überzeugend wird von Wienold dargelegt, dass eine theoretische Trennung der Bourgeoisie in eine nationale auf der einen und eine transnationale auf der anderen Seite, nicht funktional ist. Vielmehr verhalte es sich so, dass die Bourgeoisie ein europäisches, globales und gleichzeitig auch nationales Gesicht habe.5 Die deutsche Bourgeoisie ist in diesem Kontext insofern als transnationalisiert anzusehen, als dass zahlreiche Manager und Unternehmer über verschiedene Gremien und Vereinigungen auf internationaler Ebene eng mit nichtdeutschen Strukturen verknüpft seien. Im Bezug auf die Frage nach den Klassenverhältnissen wird von Wienold konzertiert, dass die Hauptkonfliktlinie zwischen den nationalen Staaten und den nationalen Arbeitnehmern auf der einen und dem transnationalen Kapital auf der anderen Seite verläuft. Letztere sprenge den nationalstaatlich verankerten wirtschaftlichen Rahmen auf und bewege sich über jegliche territoriale Grenzen hinweg.6 Das Buch verdeutlicht, dass das Thema der Klassenanalyse nicht an Relevanz für das Verständnis der nationalen und internationalen gesellschaftlichen Ordnung verloren hat. Insbesondere im dritten Teil wird die zentrale Bedeutung der Europäischen Union sowie der europäischen Ebene insgesamt für die Ökonomie und die Klassen deutlich herausgearbeitet. Gerade auch die Einblicke in vergangene Debatten und Beiträge verhindert, dass das Rad neu erfunden werden muss. Diesbezüglich ist es stellenweise sehr überraschend zu erfahren, dass bereits in den 1980er Jahren Themen diskutiert wurden, die auch heute noch auf der ungelösten Agenda stehen. Das Buch zeigt auch auf, dass sich die marxistisch geprägten De4 Ebd. 5 Vgl. ebd., S. 258. 6 Vgl. ebd., S. 273. 164 Sebastian Klauke batten um Klasse als Analysekategorie auf der Höhe der Zeit befinden und andere Kategorien wie gender längst mit in das Analyseraster aufgenommen haben. Der Forderung nach Intersektionalität wird daher durchaus Folge geleistet. Auch wird überzeugend betont, wie wichtig auch auf diesem Gebiet die empirische Unterfütterung ist, um nicht im luftleeren Raum Theorien über die soziale Realität zu entwickeln, die aber eigentlich von dieser losgelöst sind. Deutlich wird zudem, dass es bei dem Prozess der Globalisierung um eine politisch gewollte und gestützte Entwicklung handelt. Vor allem durch den Beitrag von Wienold wird deutlich, wie sehr die einzelnen Beiträge in ihren verschiedenen Perspektiven dennoch und gerade deswegen gut ineinander greifen und eine Einheit aus Vielfalt bilden. Das im Vorwort ausgerufene Ziel der Neugestaltung des Themas kann dementsprechend als gelungen angesehen werden. Dieser Sammelband bildet den neuen Referenzpunkt für die zukünftige Auseinandersetzung mit dem Thema Klasse. Hans-Günter Thien (Hrsg.): Klassen im Postfordismus. Münster2 2011, 29,90 €. 165 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Autorenverzeichnis Claudia Simone Dorchain, Dr. phil., M.A., geb. 1976; studierte Philosophie, Psychologie und Kunstgeschichte und erwarb im Jahr 2000 an der Universität Saarbrücken den Grad der Magistra Artium. Ihre Dissertation (Universität Rostock 2004) handelte von der Erkenntnislehre Meister Eckharts. Claudia Simone Dorchain war DFG-Stipendiatin, Honorardozentin an der Universität Trier, wissenschaftliche Supervisorin für das Justizministerium Luxemburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin der ägyptischen Botschaft in Berlin. Ihre Studien „Die Gewalt des Heiligen“ (im Rahmen des „Kolloquiums Jüdische Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin) und „Contemporary Jewish Reality in Germany“ erschienen im Juni 2012. Phillipp Hölzing, Dr. phil., geb. 1978; studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Mittlere und Neuere Geschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt a. M.; derzeit Lektor im Wissenschaftslektorat des Suhrkamp Verlags und lebt in Berlin; zuletzt erschienen: Republikanismus und Kosmopolitismus. Eine ideengeschichtliche Studie, Frankfurt a. M. 2011. Sebastian Klauke, M.A., geb. 1984; studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Anglistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Abschluss 2011 mit einer Magisterarbeit über die Hegemonietheorie von Antonio Gramsci, Louis Althusser und Nicos Poulantzas; derzeit wissenschaftliche Hilfskraft am Arbeitsbereich Internationale Politische Soziologie des Instituts für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; promoviert bei Prof. Dirk Nabers mit einer Arbeit über „Die ‚multiple‘ Krise und der Zusammenhang von Krise und Staatlichkeit“. Klaas Schüller, Dipl.-Politologe, geb. 1982; studierte Politikwissenschaft in Bremen; ist derzeit Koordinator des Master-Studiengangs „International Relations: Global Governance and Social Theory“ an der Jacobs University Bremen und der Universität Bremen; ist Doktorand an 166 Autorenverzeichnis der Bremen International Graduate School of Social Sciences; Arbeitstitel der Dissertationsschrift „Von der ‚Gruppe der Sechs‘ zur ‚Gruppe der Zwanzig‘: Institutioneller Wandel und die Pluralisierung globalen Regierens“. Gottfried Schweiger, Dr., geb. 1980, Promotion in Philosophie zur Naturphilosophie von Georg W. F. Hegel und Friedrich Engels; seit 2011 Senior Scientist am Zentrum für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg und seit 2009 research fellow am internationalen Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen. Forschungsschwerpunkte in der Sozialphilosophie sowie Fragen der Armut und sozialen Exklusion und Nebentätigkeit in der Philosophie des Sports und der Naturphilosophie. Meike Siegfried, Dr. phil, geb. 1979; Studium Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum; 2009 Promotion in Philosophie mit einer Arbeit zu Martin Heidegger und Martin Buber (2010 erschienen unter dem Titel „Abkehr vom Subjekt. Zum Sprachdenken bei Heidegger und Buber“); derzeitige Forschungsschwerpunkte: politische Philosophie und Philosophie der Kunst; zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem BMBF-Projekt „Kulturen der Gerechtigkeit“ (RuhrUniversität Bochum) sowie Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie der Ruhr-Universität Bochum und der Folkwang Universität der Künste. Marianne Witt, B.A., geb. 1987; studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der CAU Kiel, derzeit Studentin des Masterstudiengangs Internationale Politik und Internationales Recht an der CAU Kiel; besondere Forschungsinteressen: GASP der Europäischen Union, Konfliktforschung. 167 - jahrgang 8 - ausgabe 1 - 2012 Impressum Redaktionsanschrift gesellschafts- und geisteswissenschaftliche interventionen z. H. Ines Weber Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft Olshausenstr. 40 D-24098 KIEL E-Mail: [email protected] Im Internet: www.politik.uni-kiel.de/diskurs Das Team: Anja Franke-Schwenk, Ingmar Hagemann, Daniel Kuchler, Matthias Lemke, Bastian Walter, Ines Weber Board of Reviewers (alphabetisch) Johanna Bödege-Wolf, Karl-Heinz Breier, Peter Breiner, Thomas Großbölting, Edward Keynes, Martin Kintzinger, Wilhelm Knelangen, Martin Lücke, Lothar Maier, Christian Martin, Renate Martinsen, Dirk Nabers, Stephan Sandkötter, Morton Schoolman, Hans Rainer Sepp, Daniel Siemens dis|kurs bedankt sich für die freundliche Unterstützung durch Prof. Dr. Tine Stein, CAU Kiel, Institut für Sozialwissenschaften. Verlag Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG | Am Hawerkamp 31, D-48155 MÜNSTER E-Mail: [email protected] Im Internet: www.mv-verlag.de ISSN: 1865-6846 ISBN: 978-3-86991-637-8 Titelgestaltung, Layout, Satz Grundhitze; Daniel Kuchler © Für diese Ausgabe – gesellschafts- und geisteswissenschaftliche interventionen, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Institut für Sozialwissenschaften Olshausenstr. 40, D-24098 Kiel Germany 168