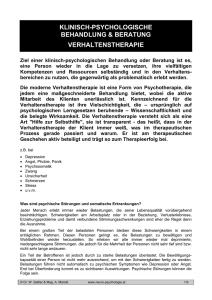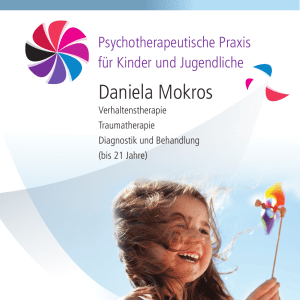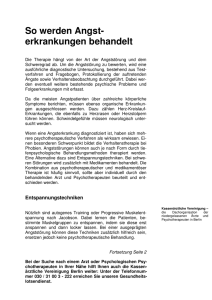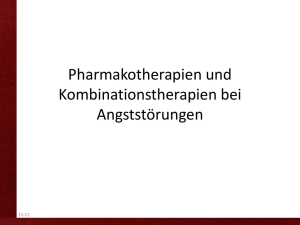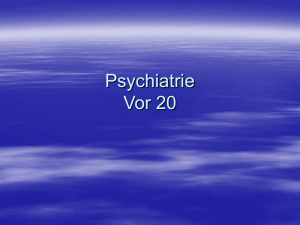Band 1 Kapitel 11 - Arbeitseinheit Klinische Psychologie
Werbung

11 11 Therapieindikation Jürgen Margraf 11.1 Die Qual der Wahl: Indikation als Problem – 202 11.2 Arten von Indikationsfragen – 202 11.3 Uniformitätsmythos, Einzelfallanalyse und störungsbezogene Indikation – 204 11.4 Probleme der differenziellen Therapieindikation 11.5 Pragmatische Lösungsansätze – 205 11.6 Schlussbemerkung – 205 – 210 Zusammenfassung – 210 Literatur – 211 Weiterführende Literatur – 212 J.Margraf, J.Margraf, S.Schneider S.Schneider (2009).Lehrbuch (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie der Verhaltenstherapie Band Band 1. 3.1. Auflage. 3. Auflage. Springer:Heidelberg Springer:Heidelberg 202 Kapitel 11 · Therapieindikation 11.1 Die Qual der Wahl: Indikation als Problem Indikationsentscheidungen werden bei jeder therapeutischen Tätigkeit tagtäglich und in großer Zahl getroffen. Dies beginnt mit der Frage, ob überhaupt eine Behandlung angezeigt ist, wird fortgeführt mit der Auswahl verschiedener Verfahren bzw. deren Anpassung an den jeweiligen Einzelfall und reicht bis zur Entscheidung über das Ende der Therapie oder den Sinn weiterer Maßnahmen. Grundsätzlich geht es bei Indikationsentscheidungen um die optimale Zuordnung bzw. Anpassung von Patienten und Behandlungen (und je nach Definition auch weiterer Bedingungen wie Therapeuten, Settings etc.). Nach Müller-Oerlinghausen und Linden (1981) lässt sich die Indikationsfrage letztendlich auf die Frage nach dem Wirksamkeitsnachweis therapeutischer Maßnahmen zurückführen. Insbesondere sollte bei Methodenkombinationen und erst recht bei Methodenkonkurrenz, für jedes der vorgesehenen therapeutischen Verfahren die Wirksamkeit unter dem gleichen Güteanspruch nachgewiesen sein (…). Ohne Erfüllung dieser Grundforderung wird Therapie zu einem unzulässigen Experiment am Menschen. (MüllerOerlinghausen & Linden 1981, S. 217, kursiv im Original). 11 Es ist somit nicht überraschen, dass die Indikationsfrage häufig als eines der wichtigsten Probleme der Psychotherapie angesehen wird (s. Zielke 1979, 1994, 2001; Baumann 1981; Bommert et al. 1990). Gleichzeitig wird jedoch immer wieder beklagt, wie wenig sich die Forschung mit der Indikationsfrage befasst habe, wie mangelhaft ihre bisherigen Antwortversuche ausfielen oder gar, dass viele Indikationsfragen aus wissenschaftstheoretischer Sicht falsch gestellt und damit unlösbar seien. Solche Diskrepanzen mögen mit dazu beigetragen haben, dass bewussten Indikationsentscheidungen oft aus dem Weg gegangen wird und die Entscheidungsfindung in unüberlegter, impliziter oder irrationaler Weise erfolgt. Dies wird durch mangelnde Klarheit über die relevanten Fragen und übermäßige Betonung der damit verbundenen Probleme in der Fachliteratur begünstigt. Kein Therapeut kann Indikationsentscheidungen jedoch wirklich ausweichen. Das vorliegende Kapitel setzt sich daher explizit mit den anstehenden Fragen auseinander und stellt Ansätze für praktikable Lösungen auf der Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes dar. ! Auch wenn Indikationsfragen viele Schwierigkeiten bergen, kann einer Lösung in der Praxis nicht ausgewichen werden. 11.2 Arten von Indikationsfragen Der Begriff der Indikation stammt vom lateinischen Wort indicare, das »anzeigen« bedeutet. Er wurde aus der Medizin in den Bereich der Psychotherapie und damit auch der Verhaltenstherapie übertragen. Hier ist von den in der Medizin verwendeten Indikationstypen vor allem die symptomatische Indikation von Bedeutung. Mit der zunehmenden Verwendung moderner Klassifikationssysteme auf der Basis operationalisierter, symptomorientierter Diagnosekriterien nähert sich allerdings die »Indicatio morbi« bei psychischen Störungen der symptomatischen Indikation an. Die Verwendung des Indikationsbegriffs auf psychotherapeutische Entscheidungen ist vorwiegend auf den deutschen Sprachraum begrenzt. Im englischen Sprachgebrauch wird allenfalls der Begriff der Kontraindikation verwandt. Anstelle von Indikation wird hier eher von »prescription« gesprochen. Interessanterweise wird die Frage der Kontraindikation von psychotherapeutischen Maßnahmen erheblich seltener diskutiert als die der Indikation. Dies entspricht der viel geringeren Beschäftigung mit negativen Therapieeffekten im Vergleich zu Therapieerfolgen. Medizinische Indikationsbegriffe In der somatischen Medizin wird unter Indikation bzw. Heilanzeige die zwingende Notwendigkeit der Anwendung eines bestimmten Heilverfahrens bei einem gegebenen Krankheitsfall verstanden. Solche Heilanzeigen können auf verschiedener Basis erfolgen. 4 Indicatio causalis: Heilanzeige aufgrund der Ursache des Leidens. Da die meisten psychischen Störungen multifaktoriell bedingt sind, die Einflussfaktoren in der Regel eher probabilistisch als deterministisch wirken und zudem oft weitgehende Unklarheit über ihre Ursachen besteht, kommt die kausale Indikation für 6 psychotherapeutische Entscheidungen nur selten zur Geltung. 4 Indicatio morbi: Heilanzeige aufgrund der Krankheit selbst. Der Krankheitsbegriff ist bei psychischen Störungen in der Regel zu unscharf oder anderweitig problematisch, so dass auch das Konzept einer krankheitsbedingten Indikation für die Verhaltenstherapie nur von geringem Wert ist. 4 Indicatio symptomatica: Heilanzeige aufgrund der Symptome des Leidens. Gerade im Kontext einer operationalisierten, weitgehend an Symptomen orien- J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 203 11.2 · Arten von Indikationsfragen tierten Diagnostik kommt dieser Form der Indikation die größte Bedeutung für die Verhaltenstherapie zu. 4 Indicatio vitalis: Heilanzeige aufgrund einer Lebensgefahr. Diese Form der Indikation ist vor allem bei akuterLebensgefahr relevant. Sie betrifft damit vor allem Fragen wie die Krisenintervention bei Suizid- Die Indikationsentscheidungen von Psychotherapeuten sind in einen größeren Kontext eingebettet, an dem vorwiegend Laien und andere Berufsgruppen mitwirken. Der Entscheidungsablauf bei einer psychotherapeutischen Indikation umfasst typischerweise die folgenden vier Stufen (Baumann & v. Wedel 1981). 4 Entscheidungen durch Laien wie z. B. die Betroffenen selbst, Freunde und Bekannte; 4 Entscheidungen durch Professionelle außerhalb des Gesundheitssystems wie z. B. Pfarrer, Sozialarbeiter, Lehrer oder Juristen; 4 Entscheidungen durch Angehörige des Gesundheitssystems ohne spezielle psychotherapeutische Qualifikation wie etwa Allgemeinärzte oder somatische Fachärzte; 4 Entscheidungen durch Psychotherapeuten vor und während der Therapie. In der Tat ist es ernüchternd festzustellen, dass der größere Teil der Indikationsentscheidungen nicht durch Fachleute im engeren Sinn getroffen wird, so dass hier auch nicht von einer fachlichen Begründung ausgegangen werden kann. Grundsätzlich beinhaltet die Indikationsstellung in der Psychotherapie nacheinander Antworten auf die folgenden Fragen (Bastine 1992; Fiedler 2005): 4 Ist im konkreten Fall überhaupt eine Psychotherapie angezeigt? 4 Wenn ja, welche psychotherapeutischen Maßnahmen sind angebracht? 4 Wie können die Maßnahmen an den Einzelfall bzw. den Verlauf der Behandlung angepasst werden? Weitere häufig zu klärende Fragen lauten (Baumann 1982; Fiedler 2005): 4 Welche Therapieziele sind für einen bestimmten Patienten angezeigt? 4 Mit welchen Patienten kann ein bestimmter Therapeut am besten arbeiten? 4 Welche Patienten sind für die von einer Einrichtung oder einem Therapeuten angebotenen Methoden geeignet? 4 Sind unabhängig oder ergänzend zur Psychotherapie weitere Möglichkeiten psychosozialer Hilfeleistung sinnvoll oder gar notwendig? Bei der Beantwortung dieser Fragen können Entscheidungen mit Hilfe verschiedener Strategien getroffen werden: 11 alität oder die Zwangsernährung bei schweren Anorexien. 4 Kontraindikation: Der Indikation entgegengesetzt ist die Kontraindikation (Gegenanzeige), von der gesprochen wird, wenn es einen zwingenden Grund gibt, ein Verfahren nicht anzuwenden. 4 So können z. B. geeignete Therapieverfahren für bestimmte Patienten oder umgekehrt geeignete Patienten für eine bestimmte Therapiemethode ausgewählt werden. In diesen Fällen spricht man von »selektiver Indikation«, da es sich um ein Selektionsproblem handelt. 4 Als Gegensatz dazu wird oft die »adaptive Indikation« gesehen, bei der es um die Anpassung des therapeutischen Vorgehens an den jeweiligen Einzelfall geht. Da diese Anpassung häufig erst im Verlauf des therapeutischen Prozesses erfolgt, spricht man hier manchmal auch von »prozessualer Indikation«. 4 Sobald es um die Entscheidung zwischen verschiedenen Therapieverfahren geht (also nicht mehr einfach um Fragen wie »Ist dieser Patient für meine Therapie geeignet?«), handelt es sich um ein Problem der »differenziellen Indikation«. Dabei geht es im einfachsten Fall um Fragen wie »Welche Therapie ist für diesen Patienten geeignet?«. Eine allgemeinere Form der differenziellen Indikationsfrage wurde von Paul (1967) formuliert: Nach Pauls Ansicht lautet die wesentliche Frage der Psychotherapieforschung »Welches ist für dieses Individuum mit diesem spezifischen Problem die effektivste Behandlung, durch wen und unter welchen Umständen?« (Paul 1967, S. 111, Übersetzung durch den Autor). In der Folge wurden Varianten dieser Formulierung durch eine ganze Reihe von Autoren (teilweise sehr verschiedener theoretischer Herkunft) vorgeschlagen. Keine hat sich jedoch so durchgesetzt wie die Fassung Pauls. Bei der Verwertung von Diagnosen geht es vor allem um die selektive und differenzielle Indikation, bei der Durchführung der Behandlung eher um die adaptive oder prozessuale Indikation. Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass Indikation keine einmalige »Ja-Nein-Entscheidung« ist, sondern als ein kontinuierlicher Prozess der Urteilsbildung verstanden werden muss. Indikationsentscheidungen betreffen die verschiedenen in der klinischen Praxis existierenden Therapieansätze, welche in drei große Gruppen eingeteilt werden können: in psychotherapeutische, psychopharmakologische und soziotherapeutische Verfahren, die, je nach Störung, auch in J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 204 Kapitel 11 · Therapieindikation Kombination Anwendung finden können. Dabei muss für jedes zusätzliche therapeutische Verfahren geprüft werden, inwiefern spezifische, durch die bisher getroffenen Therapieentscheidungen noch nicht abgedeckte Wirkungen zu erwarten sind, ob die verschiedenen Therapieansätze kompatibel sind, welche positiven oder negativen Wechselwirkungseffekte auftreten können und ob ein sinnvoller Bezug der Therapieansätze zueinander hergestellt werden kann (Freyberger et al. 2002). Ist die Entscheidung für eine psychotherapeutische Behandlung gefallen, so müssen weitere Indikationsentscheidungen getroffen werden (selektive, adaptive bzw. prozessuale und differenzielle Indikation). Die wesentlichen Bestimmungsstücke der differenziellen Indikation sind Patienten-, Störungs-, Therapeuten-, Behandlungs- und Settingvariablen. Beispielsweise ist das spezifische Behandlungsangebot des jeweiligen Psychotherapeuten »gegenüber anderen psychotherapeutischen Behandlungsangeboten und deren Nutzen« für den Patienten abzuwägen, wobei sowohl die Ressourcen als auch die Defizite des Patienten und seiner Umwelt zu berücksichtigen sind. Auch liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Psychotherapeuten zu prüfen, inwiefern die Indikation einer zusätzlichen diagnostischen Abklärung besteht (z. B. medizinische Untersuchung, psychiatrische Anamnese etc.), um bei Bedarf Vertreter angrenzender Berufe in die Diagnostik und Therapieplanung einzubeziehen. 11.3 11 Uniformitätsmythos, Einzelfallanalyse und störungsbezogene Indikation Eine Voraussetzung für das Stellen von Indikationsfragen ist es, dass überhaupt relevante Unterschiede zwischen verschiedenen Störungen, Therapieverfahren etc. vorliegen. Sie basieren demnach auf der Zurückweisung des »Uniformitätsmythos«. Dieser Begriff wurde zuerst von Colby (1964) eingeführt, der damit die unzulässige Gleichsetzung aller Patienten bezeichnete. Popularisiert wurde der »Uniformitätsmythos« in einem Artikel von Kiesler (1966), der inzwischen zu den Klassikern der Psychotherapieforschung gehört. Kiesler wies vor allem darauf hin, dass auch die angebliche Gleichheit aller Therapeuten bzw. Therapieverfahren den Charakter eines Mythos hat. Die seiner Meinung nach fahrlässige Annahme, alle Therapeuten seien im Wesentlichen gleich und was immer sie täten, stelle in gleicher Weise »Psychotherapie« dar, hat äußerst negative Folgen für die Versorgung der Patienten gehabt und das Verständnis der Wirkungsweise psychotherapeutischer Behandlungen behindert. Viele von Kieslers Kritikpunkten treffen auch heute noch unvermindert zu. So zeigen sich fortschrittshemmende Auswirkungen bei solchen Psychotherapieformen, die noch immer den diversen Uniformitätsmythen anhängen. Beispielsweise postulieren manche tiefenpsychologische oder gesprächspsychotherapeutische Ansätze eine weitgehend einheitliche Pathogenese der (nichtpsychotischen und nichtorganischen) psychischen Störungen. Aus der angenommenen Homogenität der Ursachen ergibt sich eine Gleichheit der Behandlungsverfahren. Nosologische Diagnostik wird dabei nicht nur als unnötig, sondern gar als potenziell schädlich angesehen (z. B. Menninger 1974; s. Schuster 1985; Kröber 1986). Allerdings gilt auch für diese Therapieformen, dass eine Grobklassifikation zumindest implizit akzeptiert wird, da die Abgrenzung von psychotischen und organisch bedingten Störungen vorausgesetzt wird. ! Zu den bedeutendsten Fortschritten im Bereich der Psychotherapie gehört die Entwicklung störungsbezogener Therapieverfahren. Für die meisten psychischen Störungen wurden inzwischen spezielle Therapieprogramme entwickelt und überprüft, die ganz gezielt auf die Besonderheiten der jeweiligen Störung zugeschnitten sind. Idealerweise bauen solche störungsspezifischen Interventionen auf zwei Wissensquellen auf: 4 zum einen auf dem »Störungswissen«, d. h. hinreichenden Informationen und Modellen über Erscheinung und Verlauf sowie über prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen der Störung; 4 zum anderen auf dem »Veränderungswissen«, d. h. Kenntnissen über die Möglichkeiten zur Beeinflussung psychischer Störungen, wobei diese Methoden störungsübergreifend oder störungsspezifisch sein können. Das störungsspezifische Vorgehen ist typisch für kognitivverhaltenstherapeutische Verfahren, andere psychotherapeutische Ansätze haben dagegen seltener störungsbezogene Verfahren entwickelt. Wie das »Psychotherapie-Gutachten« des Bundesgesundheitsministeriums (Meyer et al. 1991) feststellt, erweisen sich störungsspezifische Vorgehensweisen in der Psychotherapieforschung meist als erfolgreicher als unspezifische Verfahren. Die umfassenden Berner Literaturauswertungen der Psychotherapieforschung zeigen deutlich, dass die Wirksamkeit dieser Methoden bei den Störungen, für die sie entwickelt wurden, besonders gut belegt werden konnte (Grawe 1992; Grawe et al. 1994). Es erstaunt dann nicht, dass solche klinisch sehr gut bewährten störungsspezifischen Therapien sich in der Summe als wirksamer erweisen als diejenigen Psychotherapieformen, die nicht mit derartigen störungsspezifischen Vorgehensweisen arbeiten. (Meyer et al., 1991, S. 91) J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 205 11.5 · Pragmatische Lösungsansätze In der Verhaltenstherapie hat sich dabei das störungsspezifische Vorgehen in den letzten Jahren noch weiter gewandelt. In den »Gründerjahren« bedeutete Verhaltenstherapie zu einem guten Teil die Anwendung allgemeinpsychologischer (vorwiegend lerntheoretischer) Prinzipien auf den Einzelfall. Daraus ergab sich, dass die Therapie zwar auf den Einzelfall bezogen war, gleichzeitig aber die Darstellung des Vorgehens eher in abstrakten Begriffen erfolgte. Im Laufe der Zeit wurde das Vorgehen immer konkreter und detaillierter in Form von Therapiemanualen beschrieben. Diese Manuale wurden nicht für einzelne Patienten erstellt, sondern bezogen sich auf Gruppen von Patienten bzw. Problemen, wobei zur Klassifizierung seit der Veröffentlichung des DSM-III zunehmend mehr dessen Diagnosen dienten. Für die einzelnen Störungskategorien wurden routinemäßig anzuwendende Standardprogramme erstellt, die sich in der empirischen Überprüfung regelmäßig als sehr effektiv erwiesen. Als inzwischen geradezu klassisches Beispiel können die Reizkonfrontationsverfahren bei der Agoraphobie dienen. Hier konnten Schulte et al. (1991, 1992) sogar belegen, dass ein konfrontatives Standardprogramm individuell maßgeschneiderten Therapien überlegen war, wenn diese nicht ebenfalls aus Reizkonfrontation bestanden. Ein ähnliches Ergebnis erzielte Emmelkamp (1990, zitiert nach Schulte 1992) bei der Behandlung von Zwangspatienten mit Reizkonfrontation. Auch Jacobson et al. (1989) fanden bei der kognitiven Verhaltenstherapie von Partnerschaftsproblemen zumindest keine Unterlegenheit der standardisierten im Vergleich zur individualisierten Behandlung. ! Störungsspezifische Therapiemaßnahmen und Einzelfallanalysen machen Indikationsentscheidungen notwendig. 11.4 Probleme der differenziellen Therapieindikation Mit dem Vorliegen empirisch gut abgesicherter, spezifischer Therapieverfahren für eine Vielzahl von Störungen ist es möglich geworden, aus der nosologischen Einordnung der Patienten direkt Indikationen für das therapeutische Vorgehen abzuleiten. Allerdings basieren diese Indikationsentscheidungen nicht auf einer vollständigen Antwort auf die oben dargestellte allgemeine Frage der differenziellen Indikation im Sinne Pauls (1967). Eine ideale und vollständige Beantwortung dieser Frage würde aufgrund der multifaktoriellen Bedingtheit psychischer Störungen riesige faktorielle Versuchspläne voraussetzen, bei denen alle genannten Variablengruppen (Patienten, Störungen, Therapeuten, Therapieverfahren, Umgebungen) systematisch variiert werden müssten. Solche Studien sind aus rein praktischen Gründen nicht durchführbar. Selbst mit einer Datenbasis von dem Umfang der Metaanalyse der Psychotherapiefor- 11 schung von Smith et al. (1980) ist eine befriedigende Antwort auf diese Frage nicht möglich, wie die Autoren dieser inzwischen ebenfalls klassischen Arbeit feststellen mussten. Darüber hinaus ist diese Frage als Grundfrage der Psychotherapieforschung auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht kritisiert worden (s. unten). Exkurs Kritik an der Kritik: Ist die differenzielle Indikationsfrage wissenschaftstheoretisch überholt? Resultierte die Beschäftigung mit der Indikationsproblematik aus der Kritik am »Uniformitätsmythos«, so blieb auch die Kritik an der Kritik nicht lange aus. Westmeyer (1981) sieht in der differenziellen Indikationsfrage ein Relikt des frühen logischen Empirismus und damit eines andernorts überwundenen wissenschaftstheoretischen Standpunkts. Da eine einzelne Studie die allgemeine Indikationsfrage nicht beantworten könne, sei eine kumulative Antwort über verschiedene Studien nötig. Die damit implizierte induktive Methodologie des frühen logischen Empirismus setzte jedoch einen einheitlichen, geschlossenen Bereich der Psychotherapieforschung voraus. Dieser müsse über eine Einheitstheorie mit allgemein akzeptierten Sprachregelungen, Taxonomien etc. verfügen – nach Westmeyer eine illusorische Forderung. Anstelle der anspruchsvollen allgemeinen Indikationsfrage könne lediglich die bescheidenere Frage bearbeitet werden: »Wie lässt sich therapeutisches Handeln rechtfertigen bzw. begründen?« Unabhängig davon, ob man der wissenschaftstheoretischen Analyse Westmeyers grundsätzlich zustimmt oder nicht, kann nicht bestritten werden, dass eine praktikable Lösung der allgemeinen Indikationsfrage nicht in Sicht ist. Daher ist die Begrenzung auf bescheidenere Formulierungen in jedem Fall angebracht. Allerdings reicht es nicht aus, sich mit der Kritik an dieser Grundfrage zu begnügen, da Indikationsfragen von großer praktischer Bedeutung sind. Die Formulierung der Kritik muss also durch die Diskussion möglichst rationaler Handlungsalternativen ergänzt werden. Im Vordergrund steht dabei die Klärung von Teilaspekten der differenziellen Indikation unter Praxisbedingungen. 11.5 Pragmatische Lösungsansätze Worin können praktikable (Teil-)Lösungen des Indikationsproblems bestehen, wenn eine rundum befriedigende Antwort auf die allgemeine Indikationsfrage nicht erreicht werden kann? In der Praxis müssen Therapeuten über fachwissenschaftliche Begründungen hinaus auf andere Wissensbereiche zurückgreifen. Dazu zählen auch nicht überprüfte Annahmen, individuelle praktische Erfahrungen, J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 206 Kapitel 11 · Therapieindikation Experten- und Kollegenmeinungen sowie Alltagswissen. Nach meiner Auffassung ist es die derzeit beste Lösung, bei spezifischen Störungen und Problemkonstellationen soweit wie möglich diejenigen Therapieverfahren anzuwenden, deren Wirksamkeit in der bisherigen Therapieforschung bereits wissenschaftlich abgesichert werden konnte. Falls bei einer Störung bzw. einem Problemtyp mehrere Ansätze existieren, ist es die Aufgabe der Forschung, direkte Vergleiche durchzuführen, um die Wahl der Therapie auf eine rationale Basis zu stellen (vgl. auch die Charakterisierung von Psychotherapie im deutschen Psychotherapeutengesetz). … Psychotherapie … ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. (Psychotherapeutengesetz – PsychThG vom 16. Juni 1998, §1, BGBl, I S. 1311) Als Richtschnur für die Beurteilung empirischer Validierung können Kriterien herangezogen werden, die eine ei- gens eingesetzte »Task Force« der American Psychological Association vorschlug (APA 1995, zweite Erweiterung in Chambless et al. 1998). Diese Kommission schloss Vertreter verhaltenstherapeutischer, interpersoneller und psychodynamischer Richtungen ein, die sich auf den in der folgenden Übersicht dargestellten Kriteriensatz für empirisch gut abgesicherte Behandlungen einigten. Um anzuerkennen, dass nicht nur eine »science base« im engeren Sinne, sondern auch Erkenntnisse im Sinne einer »experience base« von Bedeutung sind, wurden dabei neben den klassischen, kontrollierten Gruppenstudien auch Einzelfallexperimente und Fallserien anerkannt, wenn sie Mindestvoraussetzungen zum Schutz vor Verzerrungen genügten. Es liegt auf der Hand, dass die ausschließliche Absicherung mittels einer »experience base« weniger sicher ist. Da Grenzziehungen zwischen genügend und ungenügend stets ein gewisses Ausmaß an Willkürlichkeit anhaftet, beschloss die Kommission, zusätzlich eine Kategorie für wahrscheinlich wirksame Verfahren vorzuschlagen. Verfahren, deren Absicherung nur diese Kriterien erfüllen, sollten vorerst als experimentelle Behandlungen angesehen werden. Kriterien für empirisch validierte Behandlungen: Gut abgesicherte Behandlungen. (Nach APA 1995) I. 11 Mindestens 2 gute Gruppendesignstudien zeigen Effektivität in einer oder mehr der folgenden Weisen: A. Überlegenheit gegenüber einem Pillen- oder psychologischen Placebo oder einer anderen Behandlung B. Äquivalent mit einer bereits etablierten Behandlung in Studien mit einer angemessenen statistischen Power (ca. N=30 pro Gruppe) oder II. Eine große Serie von Einzelfallstudien (N≥9) zeigen Wirksamkeit. Diese Studien müssen über die folgenden Merkmale verfügen: A. Gute experimentelle Versuchspläne B. Vergleich der Intervention mit einer anderen Behandlung wie in IA. Weitere Kriterien für I und II: III. Die Studien müssen mit Behandlungsmanualen durchgeführt worden sein IV. Die Charakteristika der Patientenstichproben müssen klar spezifiert worden sein V. Die Effekte müssen von mindestens zwei verschiedenen Untersuchern oder Arbeitsgruppen demonstriert worden sein. Kriterien für empirisch validierte Behandlungen: Wahrscheinlich wirksame Behandlungen. (Nach APA 1995) I. Mindestens 2 gute Gruppendesignstudien zeigen (statistisch signifikante) Überlegenheit gegenüber einer Wartelistenkontrollgruppe oder II. Mindestens 1 gute Gruppendesignstudie erfüllt die Kriterien IA oder IB, III und IV, jedoch nicht V. Die Kommission veröffentlichte eine vorläufige, explizit als noch unvollständig ausgewiesene Liste von empirisch überprüften Behandlungsverfahren, die den beiden Kriteriensätzen genügen. Diese Liste wurde 1995 von Sanderson und Woody erweitert und wird seitdem jährlich aktualisiert (Chambless et al. 1998). Um die den APA-Kriterien genü- oder III. Eine kleine Serie von Einzelfallstudien mit Versuchsplänen, die die restlichen Kriterien II, III und IV für gute Absicherung erfüllen, zeigen Wirksamkeit. genden Behandlungsverfahren nicht nur aufzulisten, sondern praktizierenden Therapeuten Hinweise auf konkrete Therapiemanuale zu geben, veröffentlichten Woody und Sanderson (1998) eine Übersicht über vorliegende Manuale wissenschaftlich gut abgesicherter, wirksamer psychotherapeutischer Behandlungen für folgende psychische Stö- J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 207 11.5 · Pragmatische Lösungsansätze rungen: generalisierte Angststörung, Zwangsstörung, Panikstörung, Sozialphobie, spezifische Phobie, Depression, Bulimie, chronische Kopfschmerzen, Schmerzen bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Enuresis, Copingstrategien bei Stress, Paar- und Eheprobleme sowie Störung mit oppositionellem Trotzverhalten im Kindesalter. 11 Klinisch geschulte Psychotherapeuten können mit Hilfe dieser wissenschaftlich anerkannten Therapiemanuale gezielte Behandlungen bei spezifischen Störungen vornehmen. Auch empirisch validierte Ausbildungen in bestimmten psychotherapeutischen Verfahren werden im Hinblick auf die genannten APA-Kriterien jährlich überprüft. Beispiele empirisch validierter Behandlungen. (Nach Chambless et al. 1998) Gut abgesicherte Behandlungen 4 Angst und Stress: – Kognitive Verhaltenstherapie bei Paniksyndrom mit und ohne Agoraphobie – Kognitive Verhaltenstherapie bei generalisiertem Angstsyndrom – Konfrontationstherapie bei Agoraphobie – Reizkonfrontation bei spezifischer Phobie* – Konfrontation und Reaktionsverhinderung bei Zwangsstörung – Stress-Inoculations-Training und Coping mit Stress 4 Depression: – Verhaltenstherapie bei Depression* – Kognitive Therapie der Depression – Interpersonale Therapie der Depression 4 Gesundheitliche Probleme: – Verhaltenstherapie für Kopfschmerzen – Kognitive Verhaltenstherapie bei Bulimie – Multikomponenten-Schmerzbehandlung mit kognitiver Verhaltenstherapie bei rheumatischen Erkrankungen* – Multikomponenten-Rückfallprävention mit kognitiver Verhaltenstherapie bei Raucherentwöhnung* 4 Psychische Probleme in der Kindheit: – Verhaltensmodifikation bei Enuresis – Elterntrainingsprogramme bei Kindern mit oppositionellem Trotzverhalten 4 Eheprobleme: – Behaviorale Partnertherapie Wahrscheinlich wirksame Behandlungen 4 Angst: – Angewandte Entspannung (»applied relaxation«) bei Paniksyndrom – Angewandte Anspannung bei generalisierter Angststörung – Kognitive Verhaltenstherapie bei Sozialphobie* – Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangsstörung* – Paarkommunikationstraining als Zusatz zur Konfrontationstherapie bei Agoraphobie* – EMDR (»eye movement desentization and processing« bei posttraumatischer Belastungsstörung* – Konfrontationstherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung – Konfrontationstherapie bei Sozialphobie* – Stress-Inoculations-Training bei posttraumatischer Belastungsstörung – Rückfallpräventionsprogramm bei Zwangsstörung – Systematische Desensibilisierung bei Tierphobien* – Systematische Desensibilisierung bei Angst vor öffentlichem Sprechen* – Systematische Desensibilisierung bei Sozialphobie* 4 Substanzmissbrauch und Abhängigkeitserkrankungen: – Verhaltenstherapie bei Kokainmissbrauch – Dynamische Kurzzeittherapie bei Opiatabhängigkeit – Kognitive Verhaltenstherapie: Rückfallprävention bei Kokainabhängigkeit* – Kognitive Therapie bei Opiatabhängigkeit – Kognitive Verhaltenstherapie bei Benzodiazepin-Entwöhnung von Patienten mit Panikstörung – Gemeindebasierte Verstärkerprogramme bei Alkoholabhängigkeit* – Reizkonfrontation als Zusatz zur stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit* – Projekt CALM bei Alkoholabusus und -abhängigkeit (behaviorale Paartherapie plus Disulfiram)* – Soziales Kompetenztraining bei stationärer Behandlung der Alkoholabhängigkeit* 4 Depression: – Dynamische Kurzzeittherapie – Kognitive Therapie bei geriatrischen Patienten – Gedächtnis-/Erinnerungstherapie bei geriatrischen Patienten – Selbstkontrolltherapie – Soziales Problemlösetraining* 4 Gesundheitliche Probleme: – Verhaltenstherapie bei Fettsucht in der Kindheit – Kognitive Verhaltenstherapie bei Binge-Eating-Störung* – Kognitive Verhaltenstherapie bei Physiotherapie von chronischem Schmerz* – Kognitive Verhaltenstherapie bei chronischem Rückenschmerz* – EMG-Biofeedback bei chronischen Schmerzen* – Hypnosetherapie als Zusatz zur kognitiven Verhaltenstherapie bei Adipositas* – Interpersonelle Therapie bei Binge-Eating-Störung* 6 J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 208 Kapitel 11 · Therapieindikation – Interpersonelle Therapie bei Bulimie* – Multikomponenten-Behandlung mit kognitiver Therapie bei Schmerzen bei Reizdarmsyndrom* – Multikomponenten-Behandlung mit kognitiver Verhaltenstherapie bei Schmerzen aufgrund Sichelzellerkrankung* – Multikomponenten-Behandlung mit operanter Verhaltenstherapie bei chronischen Schmerzen* – Geplantes, reduziertes Rauchen bei Multikomponenten-Verhaltenstherapie bei Raucherentwöhnung* – Thermales Biofeedback bei Raynaud-Syndrom* – Thermales Biofeedback mit autogenem Training bei Migräne* 4 Psychische Probleme in der Kindheit: – Verhaltensmodifikation bei Enkopresis – Kognitive Verhaltenstherapie bei ängstlichen Kindern (Trennungsangst, generalisierte Angststörung)* – Konfrontationstherapie bei einfacher Phobie* – Angstmanagementtraining für Familien bei Angststörungen 4 Eheprobleme: – Emotional fokussierte Paartherapie bei moderaten Eheproblemen* – Einsichtsorientierte Ehetherapie 4 Sexuelle Funktionsstörungen: 11 Ein zwiespältiges Verhältnis: Verhaltenstherapie und Störungsklassifikation Die früher oft geäußerte Ansicht, aus der Störungsdiagnostik könnten keine Hinweise für die Therapieindikation abgeleitet werden, kann spätestens seit den neuesten Fortschritten der modernen Klassifikationssysteme im Gefolge des DSM-III und der Überprüfung störungsspezifischer Therapieprogramme nicht mehr aufrechterhalten werden. Gerade in der Verhaltenstherapie fiel aber auch schon früher, als die Kritik an der Störungsdiagnostik noch weitaus berechtigter war, eine deutliche Diskrepanz zwischen dieser grundsätzlichen Kritik und der gleichzeitigen Verwendung von Störungsklassifikationen auf. Die typische Gliederung verhaltenstherapeutischer Sammeldarstellungen basierte auf der nosologischen Einteilung psychischer Störungen, Therapieverfahren wurden für Depressionen, Ängste, Schizophrenien, Alkoholmissbrauch etc. vorgestellt. Die störungsbezogene Indikationsstellung hat also in der Verhaltenstherapie eine lange Tradition. Im Unterschied zur klassischen psychiatrischen Vorgehensweise wurde sie allerdings schon immer durch detaillierte Analysen der individuellen Problemlage ergänzt. – Hurlberts kombinierter Behandlungsansatz für die Frau bei Störung mit verminderter sexueller Appetenz* – Masters und Johnsons Sexualtherapie bei sexuellen Funktionsstörungen der Frau* – Zimmers kombinierte Sexual- und Paartherapie bei Libidostörungen der Frau* 4 Andere: – Verhaltensmodifikation bei Sexualstraftätern – Dialektische Verhaltenstherapie bei Borderline-Persönlichkeitsstörung – Familienintervention bei Schizophrenie* – Habit-Reversal-Training and Habit-Control-Techniken – Soziales Kompetenztraining für verbesserte soziale Anpaassung schizophrener Patienten* – Geschützte Arbeit für schwer geistig behinderte Patienten* Anmerkung: *Behandlungen, die seit der Publikation von Chambless et al. (1996) hinzugekommen sind oder die sich bezüglich der Empfehlung verändert haben. Zwei Therapieverfahren wurden seit der Veröffentlichung von 1996 von der Liste der empirisch überprüften Behandlungsverfahren gelöscht: Münzsysteme (»Token Economy«) und Verhaltensmodifikation bei Entwicklungsstörungen. Beide Verfahren sind zu allgemein und wurden daher nicht mehr als spezifische Behandlungsverfahren bei speziellen Störungen angesehen. Da die nun vermehrt angewandten Therapieprogramme auf der nosologischen Diagnostik aufbauen, wird der Stellenwert der ursprünglichen verhaltenstherapeutischen Problemanalyse relativiert. Inzwischen reicht auch in der Verhaltenstherapie eine reine Problemanalyse nicht mehr aus. Ideal für das praktische Vorgehen ist die Ergänzung von nosologischer Diagnose und Problemanalyse, wobei Letztere aufgrund des inzwischen vorliegenden Störungswissens oft vereinfacht werden kann (7 Kap. I/20 und I/21). Dabei steht außer Frage, dass auch Standardverfahren auf eventuelle Besonderheiten des Einzelfalles zugeschnitten werden müssen (vgl. adaptive Indikation). Auch die in ausführlichen Therapiemanualen beschriebenen standardisierten »Routineverfahren« können daher nur von umfassend ausgebildeten Klinikern hinreichend flexibel angewandt werden. Auf eine nähere Darstellung spezifischer Therapieindikationen, die aus der Differenzialdiagnose etwa nach dem DSM-IV folgen können (vgl. differenzielle Indikation), wird an dieser Stelle verzichtet, da Band 2 des vorliegenden Lehrbuches mit seinen Störungskapiteln genau dieser Thematik gewidmet ist. Stattdessen muss auf Ergänzungen zum störungsbezogenen Vorgehen hingewiesen werden. Die in den Störungskapiteln aufgeführten Therapieverfahren betreffen in der Regel nur das störungsspezifische J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 209 11.5 · Pragmatische Lösungsansätze Vorgehen. Daneben kommen natürlich im therapeutischen Prozess auch andere, weniger auf die Störung zugeschnittene Therapieinterventionen zur Anwendung. Neben den Technikvariablen sind hier vor allem die Faktoren der therapeutischen Beziehung, der Gesprächsführung und des Umgangs mit Widerstand von Bedeutung (7 Kap. I/27, I/29). Darüber hinaus muss im Auge behalten werden, dass sich im Verlauf der Therapie weitere Problembereiche ergeben können, die neuer Therapieinterventionen bedürfen. So können im Anschluss an eine Reizkonfrontationstherapie bei einem agoraphobischen Patienten weitere Probleme im Sozialbereich oder in der Partnerbeziehung auftauchen, die bislang von der Agoraphobie überlagert und daher nicht sichtbar waren. In solchen Fällen müssen neue diagnostische Schritte eingeleitet werden und ggf. weitere therapeutische Interventionen folgen (vgl. prozessuale Indikation). In der stationären, aber auch in der ambulanten Behandlung psychischer Erkrankungen werden oft verschiedene therapeutische Elemente ausgewählt (vgl. selektive Indikation), die in einen Gesamtbehandlungsplan eingebunden werden, welcher auf die individuellen und störungsspezifischen Problembereiche des Patienten abge- 11 stimmt ist (Freyberger et al. 2002). Bei der Anpassung der Therapie an den Einzelfall ist eine sorgfältige Beachtung der Stärken und Schwächen des jeweiligen Patienten wichtig. Kliniker sind in besonderem Maße in Gefahr, einseitig auf Schwächen oder pathologische Aspekte abzuheben und die positiven Ressourcen zu vernachlässigen. Von Bedeutung sind auch Persönlichkeit und Motivation (z. B. allgemeine Motivationen etwa zu beruflichem Erfolg, persönlichen Kontakten, spezifische Therapiemotivation, Extraversion/ Introversion), die aktuelle Lebenssituation (z. B. Partnerschaft, Stressfaktoren, soziale Situation) und die bisherige Lebenserfahrung (s. unten). Auch die Wahl des Therapiesettings kann einen bedeutenden Einfluss haben, ohne dass jedoch einfache allgemeingültige Regeln aufgestellt werden könnten. So mag es zwar generell günstiger sein, Probleme ambulant und damit in der natürlichen Umgebung der Betroffenen zu behandeln. Wenn aber die heimische Lebenssituation massiv belastend ist, kann eine stationäre Therapie wiederum effektiver sein. Manche Probleme können besser im Familien- oder Partnerschaftskontext angegangen werden. Wenn dort jedoch starke Widerstände oder ausgeprägte kontraproduktive Haltungen vorliegen, kann eine Einzeltherapie dennoch sinnvoller sein. Fallbeispiel Brigitte war eine gepflegte Frau im Alter von 36 Jahren. Sie lebte zusammen mit ihrer 14-jährigen Tochter am Stadtrand einer Finanzmetropole, in deren Zentrum sie als Chefsekretärin einer anspruchsvollen Arbeit nachging. Ihr Problem war eine Agoraphobie mit der typischen Fülle von angstauslösenden und vermiedenen Situationen. Dabei hatte sie aber eine selbst für eine Agoraphobie ganz außerordentlich starke Angst vor dem »Umfallen«. Soziale oder zwischenmenschliche Probleme lagen nicht vor, das Leben ohne festen Partner war ihr freier Wunsch. Die Möglichkeit, etwa in einer belebten Einkaufszone niederzustürzen und vor aller Augen auf der Straße zu liegen, bereitete ihr bereits in der Vorstellung solch massive Qualen, dass sie jegliche Menschenansammlung vermied und das Einkaufen völlig ihrer Tochter überließ. Schon ein halbes Jahr nach ihrem ersten Angstanfall war ihre Mobilität stark eingeschränkt, ihr bislang gutes Selbstvertrauen angeschlagen und ihre Lebenszufriedenheit verschwunden. Ihre Vorgeschichte wies eine mehrjährige Heroinabhängigkeit mit zusätzlichem Alkoholmissbrauch auf. Aus diesen Problemen hatte sie sich in den ersten zwei Jahren nach der (ungeplanten) Geburt ihrer Tochter aus eigener Kraft befreit. Sie hatte ihren ganzen Bekanntenkreis verlassen und ein neues Leben angefangen. Auch ohne höheren Schulabschluss hatte sie sich eine verantwortungs- volle Stellung erarbeitet, wobei ihr ein ausgeprägtes Organisationstalent, soziale Kompetenz und Selbstständigkeit halfen. Während ihrer »Junkie-Zeit« hatte sie häufig in der Bahnhofsgegend gefixt und gesoffen, dabei oft in Ecken, Nischen, Eingängen oder eben buchstäblich »auf der Straße« gelegen. Der Gedanke, jetzt wieder – wenngleich aus ganz anderen Gründen – auf der Straße zu »landen«, war für sie gleichbedeutend mit dem Zurückfallen in diese längst überwundene, schlimmste Phase ihres Lebens. In der Behandlung war es wichtig, sie nicht nur mit den angstauslösenden Situationen zu konfrontieren, sondern auch gezielt das Thema des vermeintlichen Rückfalls anzugehen. Die allgemeine Therapieindikation »Konfrontation in vivo« wurde also durch eine individualisierte kognitive Komponente ergänzt. Für den Fall einer Ohnmacht nahm sie an, dass die Passanten sie für eine »Süchtige« halten würden. Erst als sie sich klar machte, dass die meisten Menschen eine abgerissene und ungepflegte Jugendliche anders einschätzen würden als eine wohlgekleidete, gepflegte Frau, war sie bereit, die von ihr am meisten gefürchtete Einkaufsstraße aufzusuchen. Bereits nach einer einzigen Übung war ihre Angst vor dieser Art von Situation abgebaut. Der weitere Verlauf der Behandlung mit Übungen in einer ganzen Reihe weiterer gefürchteter Situationen entsprach dann einer »klassischen« Konfrontationstherapie. J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 210 Kapitel 11 · Therapieindikation Die genannten Beispiele belegen die Vielgestaltigkeit der zu treffenden Entscheidungen. Aus dieser Komplexität sollte jedoch nicht der Schluss gezogen werden, die Problematik entziehe sich rationaler Zugangsweisen und sei lediglich auf der Basis der Intuition und individueller Erfahrung zu lösen. Indikationsentscheidungen sollten vielmehr stets explizit getroffen werden, so dass das Ausmaß ihrer Rationalität beachtet werden kann (s. unten). Wenn Indikation rational sein soll Bommert et al. (1990) geben die folgenden Kriterien an, mit deren Hilfe bestimmt werden kann, ob Indikationsentscheidungen mehr oder weniger rational sind: 4 Die Entscheidung verfolgt ein bestimmtes, definiertes Ziel. 4 Die zur Zielerreichung verwendeten Mittel und Methoden werden bewusst ausgewählt und eingesetzt. 4 Die Annahmen, die die gewählten Mittel und Ziele miteinander verknüpfen, sind empirisch, theoretisch oder praktisch begründet. 4 Die Präferenz für bestimmte Ziele wird durch explizite normative Annahmen begründet. Auch Supervision und kontinuierliche Fortbildung stellen wertvolle Rückmeldeschleifen zur Verfügung, die das »Einschleifen« rigider Bahnen verhindern und zur immer wieder neuen Verbesserung des Handelns beitragen können. 11 Kurz zusammengefasst: Ein pragmatischer Ansatz 4 Bei spezifischen Störungen und Problemkonstellationen möglichst die dafür empirisch abgesicherten Verfahren anwenden. 4 Anpassung an den Einzelfall nach Problemanalyse und Therapieverlauf. Dabei beachten: 4 Individuelle Stärken und Schwächen 4 Persönlichkeit 4 Motivation 4 Lebenssituation 4 Therapiesetting 4 Mögliche Interaktionen der genannten Faktoren 11.6 Schlussbemerkung Für viele Jahre folgte die Indikationsstellung in der Psychotherapie dem oft beklagten YAVIS-Stereotyp (nach Schofield 1964: »young, attractive, verbal, intelligent, social«). Paradoxerweise wählen viele Psychotherapeuten noch immer besonders häufig solche Patienten aus, die ihrer Behandlung besonders wenig bedürfen. Im Gegenzug werden Patienten, die über ein niedriges Ausgangsniveau der ge- 4 Es werden alle relevanten Kenntnisse für die Indikationsstellung herangezogen. 4 Die einzelnen Indikationsentscheidungen sind in eine größere Strategie eingebettet, um sicherzustellen, dass die Verfolgung verschiedener Ziele nicht zu gegenseitigen Behinderungen führt. 4 Die Entscheidungen werden mittels logischer Prozeduren gültig aus den Vorannahmen abgeleitet. 4 Die Entscheidungen erfolgen unter Abwägung von Bedarf, Kosten, Nutzen und Effektivität aller verfügbaren Alternativen. 4 Die moralischen und ethischen Dimensionen des Umgangs mit Menschen werden berücksichtigt. nannten Fertigkeiten verfügen und daher eigentlich die Behandlung besonders nötig hätten, bevorzugt abgelehnt. Diese Praxis steht in der Tradition Freuds, der bereits 1905 den »allgemeinen Wert der Person« als Auswahlkriterium empfahl und u. a. geringen Bildungsstandard, fehlende Motivation, hohes Alter oder die Notwendigkeit der raschen Beseitigung drohender Erscheinungen als Kontraindikationen angab. In die gleiche Richtung wiesen die ursprünglich von Rogers (1942) für die Gesprächspsychotherapie benannten »Eignungskriterien«, die allerdings im Zuge der generellen Ablehnung diagnostischer Maßnahmen später wieder zurückgenommen wurden. Für die Verhaltenstherapie besteht ein gewisser Trost darin, dass empirische Untersuchungen zeigten, dass Verhaltenstherapeuten weniger anfällig für »YAVIS-Entscheidungen« sind (z. B. Blaser 1977). Dennoch gilt auch hier, dass bevorzugt Patienten mit einem guten Verhaltensrepertoire für die Behandlung ausgewählt werden. Es ist mein Eindruck, dass mit fortschreitender Professionalisierung gerade in der Verhaltenstherapie angemessenere Indikationskriterien zunehmnede Bedeutung erlangen. Zusammenfassung Bei Indikationsentscheidungen geht es vor allem darum, ob bzw. welche therapeutischen Maßnahmen im konkreten Fall angezeigt sind und wie diese ggf. an den Einzelfall und den Verlauf der Behandlung angepasst werden müssen. Psychotherapeutische Indikationsentscheidungen werden nur zum kleineren Teil von Fachleuten getroffen. Ist die Entscheidung für eine Psychotherapie gefallen, so können J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 211 Literatur die weiteren Fragen mittels verschiedener Strategien beantwortet werden (selektive, adaptive bzw. prozessuale und differenzielle Indikation). Die allgemeine differenzielle Indikationsfrage (»Welches ist für dieses Individuum mit diesem spezifischen Problem die effektivste Behandlung, durch wen und unter welchen Umständen?«) ist aus wissenschaftstheoretischer und forschungspraktischer Sicht kritisierbar. Auch wenn sie nicht in idealer Weise zu beantworten ist, kann einer Lösung von Teilaspekten in der Praxis nicht ausgewichen werden. Für praktikable (Teil-)Lösungen müssen Therapeuten über fachwissenschaftliche Begründungen hinaus auch nicht auf überprüfte Annahmen, individuelle praktische Erfahrungen, Experten- und Kollegenmeinungen sowie Alltagswissen zurückgreifen. Bei spezifischen Störungen und Problemkonstellationen sollten möglichst die dafür empirisch abgesicherten Verfahren angewendet werden. Bei der Anpassung von Standardverfahren an eventuelle Besonderheiten des Einzelfalles müssen je nach Problemanalyse und Therapieverlauf individuelle Stärken und Schwächen, Persönlichkeit, Lebenssituation und Therapiesetting berücksichtigt werden. Das Ausmaß der Rationalität von Indikationsentscheidungen kann mit Hilfe definierter Kriterien bestimmt werden. Wertvolle Rückmeldungen bieten auch Supervision und kontinuierliche Fortbildung. Literatur American Psychological Association (APA) (1995). Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures. Training in and dissemination of empirically validated psychological treatments: Report and recommendations. The Clinical Psychologist, 48 (1), 3–23. Bastine, R. (Hrsg.) (1992). Klinische Psychologie (Bd. 2, Kap. 10.4). Stuttgart: Kohlhammer. Baumann, U. (Hrsg.) (1981). Indikation zur Psychotherapie. Perspektiven für Forschung und Praxis. München: Urban & Schwarzenberg. Baumann, U. (1982). Patientenbezogene Differentialindikation psychotherapeutischer Verfahren aus psychologischer Sicht. In H. Helmchen et al. (Hrsg.), Psychotherapie in der Psychiatrie. Berlin: Springer. Baumann, U. & Wedel, B. v. (1981). Stellenwert der Indikationsfrage im Psychotherapiebereich. In U. Baumann (Hrsg.), Indikation zur Psychotherapie. Perspektiven für Praxis und Forschung. München: Urban & Schwarzenberg. Blaser, A. (1977). Der Urteilsprozeß bei der Indikationsstellung zur Psychotherapie. Bern: Huber. Bommert, H., Henning, T. & Wälte, D. (1990). Indikation zur Familientherapie. Stuttgart: Kohlhammer. Chambless, D. L., Sanderson, W. C., Shoham, V. et al. (1996). An update on empirically validated therapies. The Clinical Psychologist, 49, 5–18. Chambless, D. L., Sanderson, W. C., Shoham, V. et al. (1997). An update on empirically validated therapies. Washington, DC: Division of Clinical Psychology, American Psychological Association. Chambless, D. L., Baker, M. J., Baucom, D. H. et al. (1998). Update on empirically validated Therapies, II. The Clinical Psychologist (51), 1, 3–16. Colby, K. M. (1964). Psychotherapeutic processes. Annual Review of Psychology, 15, 347–370. Fiedler, P. (2005). Indikation und Behandlungsentscheidungen. In: M. Linden & M. Hautzinger M. (Hrsg.), Verhaltenstherapiemanual (5. Aufl.). Berlin: Springer. 11 Freud, S. (1905). Über Psychotherapie. In S. Freud, Gesammelte Werke, Band V. Frankfurt: Fischer (1961). Freyberger, H. J., Stieglitz, R.-D. & Schneider, W. (2002). Therapieverfahren in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Überblick. In: H. J. Freyberger, W. Schneider & R.-D. Stieglitz (Hrsg.), Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin. Basel: Karger. Grawe, K. (1992). Psychotherapieforschung zu Beginn der neunziger Jahre. Psychologische Rundschau, 43, 132–162. Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Göttingen: Hogrefe. Jacobson, N., Schmaling, K. B., Holtzworth-Munroe, A., Katt, J. L., Wood, L. F. & Follette, V. M. (1989). Research-structured vs. clinically flexible versions of social learning-based marital therapy. Behaviour Research and Therapy, 27, 173–180. Kiesler, D. J. (1966). Some myths of psychotherapy research and the search for a paradigm. Psychological Bulletin, 65, 110–136. Kröber, H. L. (1986). Gefährdet Psychopathologie die Psychotherapie? Anmerkungen zur Diskussion um das DSM-III. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 36, 89–90. Menninger, K. (1974). Das Leben als Balance. München: Piper. Meyer, A.-E., Richter, R., Grawe K., Schulenburg, J.-M. v. der & Schulte, B. (1991). Forschungsgutachten zu Fragen eines Psychotherapeutengesetzes. Bonn: Bundesgesundheitsministerium. Müller-Oerlinghausen, B. & Linden, M. (1981). Rationalität der Indikation zu pharmakologischer Behandlung. In U. Baumann (Hrsg.), Indikation zur Psychotherapie. Perspektiven für Praxis und Forschung. München: Urban & Schwarzenberg. Paul, G. L. (1967). Strategy of outcome research in psychotherapy. Journal of Consulting Psychology, 31, 109–118. Rogers, C. R. (1942). Counseling and psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. Sanderson, W. C. & Woody, S. (1995). Manuals for empirically validated treatments. A project of the Task Force on Psychological Interventions. Washington, DC: Division of Clinical Psychology, American Psychological Association. Schofield, W. (1964). Psychotherapy, the purchase of friendship. Englewood Cliffs/NJ: Prentice Hall. Schulte, D., Künzel, R., Pepping, G. & Schulte-Bahrenberg, T. (1991). Maßgeschneiderte Psychotherapie vs. Standardtherapie bei der Behandlung von Phobikern. In D. Schulte (Hrsg.), Therapeutische Entscheidungen. Göttingen: Hogrefe. Schulte, D., Künzel, R., Pepping, G. & Schulte-Bahrenberg, T. (1992). Tailor-made vs. standardized therapy of phobic patients. Advances in Behaviour Research and Therapy, 14, 67–92. Schuster, D. (1985). Zum Problem der Nosologie bzw. Klassifikation in der Psychiatrie anhand des DSM-III unter besonderer Berücksichtigung der Neurosen und Persönlichkeitsstörungen. Psychotherapy, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 35, 75–77. Smith, M. L., Glass, G. V. & Miller, T. I. (1980). The benefits of psychotherapy. Baltimore/MD: Johns Hopkins University Press. Westmeyer, H. (1981). Allgemeine methodologische Probleme der Indikation in der Psychotherapie. In U. Baumann (Hrsg.), Indikation zur Psychotherapie. Perspektiven für Praxis und Forschung. München: Urban & Schwarzenberg. Woody, S. R. & Sanderson, W. C. (1998), Manuals for empirically supported treatments: 1998 update. Washington, DC: Division of Clinical Psychology, American Psychological Association. Zielke, M. (1979). Indikation zur Gesprächspsychotherapie. Stuttgart: Kohlhammer. Zielke M (1994) Indikation zur stationären Verhaltenstherapie. In Zielke M, Sturm J (Hrsg.) Handbuch Stationäre Verhaltenstherapie (S. 193249). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Zielke M (2001) Stationäre Indikationsstellungen zur Verhaltenstherapie bei Angststörungen: Grundsätze und Erfahrungen. In M. Zielke, H. von Keyserlingk & W. Hackhausen (Hrsg.), Angewandte Verhaltensmedizin in der Rehabilitation (S. 107–135). Lengerich: Pabst. J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 212 Kapitel 11 · Therapieindikation Weiterführende Literatur Bastine, R. (Hrsg.) (1992). Klinische Psychologie (Bd. 2, Kap. 10.4). Stuttgart: Kohlhammer. Baumann, U. (Hrsg.) (1981). Indikation zur Psychotherapie. Perspektiven für Forschung und Praxis. München: Urban & Schwarzenberg. Blaser, A. (1977). Der Urteilsprozeß bei der Indikationsstellung zur Psychotherapie. Bern: Huber. Bommert, H., Henning, T. & Wälte D. (1990). Indikation zur Familientherapie. Stuttgart: Kohlhammer. Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Göttingen: Hogrefe. Longabaugh, R., Stout, R., Kriebel, G. W., McCullough, L. & Bishop, D. (1986). DSM-III and clinically identified problems as a guide to treatment. Archives of General Psychiatry, 43, 1097–1103. 11 J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg 275 Weiterführende Literatur Wlazlo, Z. (1990). Exposure in-vivo bei sozialen Ängsten und Defiziten. Therapievergleichs-/Verlaufsstudie unter Berücksichtigung der differentiellen, prognostischen und Langzeiteffekte bei zwei Formen sozialer Gehemmtheit und Erfolgs/Mißerfolgspatienten. Regensburg: Roderer. Zimmer, D. (1996). Anfängerfehler in der Behandlung prognostisch ungünstiger Patienten – Folgerungen für die Verhaltenstherapie. In H. Bents, R. Frank & E.-R. Rey (Hrsg.), Erfolg und Misserfolg in der Psychotherapie. Regensburg: Roderer. 16 Weiterführende Literatur Foa, E. B. & Emmelkamp, P. M. G. (1983). Failures in behavior therapy. New York: Wiley. Lutz, W., Kosfelder, J., Joormann, J. (2004). Misserfolge und Abbrüche in der Psychotherapie. Erkennen – Vermeiden – Vorbeugen. Bern: Huber. J.Margraf, S.Schneider (2009).Lehrbuch der Verhaltenstherapie Band 1. 3. Auflage. Springer:Heidelberg