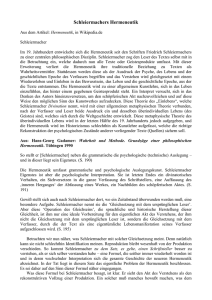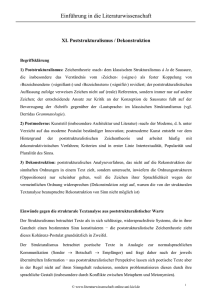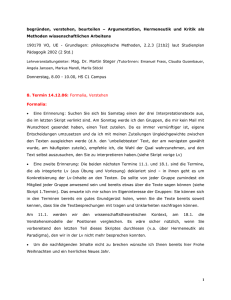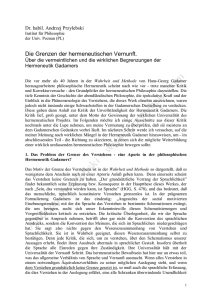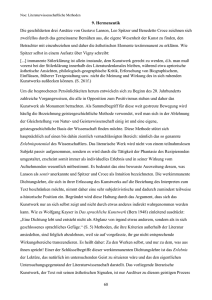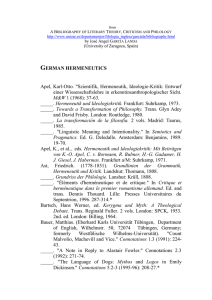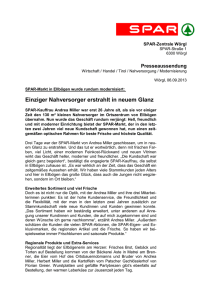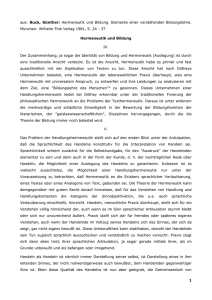Essay: Hermeneutik - UK
Werbung

Hermeneutik, Dekonstruktion und Perspektiven der anglistischen Literaturwisschenschaft Steht auch die explizite Debatte zwischen Hermeneutik und Dekonstruktion nicht unbedingt im Vordergrund der anglistischen Literaturwissenschaft, so spielen diese doch eine kontroverse Rolle bei der im Gang befindlichen Neuorientierung des Faches, wobei sich die Dominanz des dekonstruktivistischen Poles anzuzeigen scheint. Hat erstere - die Hermeneutik - für mehr als ein Jahrhundert eine Theorie (oder Philosophie) und ein Programm zur Verfügung gestellt, das trotz aller auseinanderstrebender Interessen im einzelnen die fraglose Basis der Geisteswisssenschaften und insbesondere der Philologien war, so wurde ebendiese von letzterer - der Dekonstruktion - radikal in Frage gestellt. Die Dekonstruktion (oder der Dekonstruktivismus) hat zweifellos einen großen Einfluß auf die anglistische Literaturwissenschaft - oder auf English Studies - gewonnen, nicht nur auf die Literaturtheorie und den Textbegriff und auf die Textarbeit. Sie hat auch ihren Anteil an der Akzentverlagerung des Faches in Richtung auf eine Kulturwissenschaft, und sie hat grundlegende Konzepte etwa in den gender studies oder im New Historicism mit angeregt. Der Dekonstruktivismus prägt zweifellos die Literaturwissenschaft, insbesondere die anglistische, so daß angesichts seiner grundsätzlichen Hermeneutikkritik von einer „antihermeneutischen Wende“ - als Antipode zu der „hermeneutischen Wende“ des 19. und frühen 20. Jahrhunderts - die Rede ist.1 Dennoch ist die Hermeneutik aus der Praxis des Faches, dem Bereich des practical criticism, nicht verschwunden.2 Es wird auch vermehrt die Forderung erhoben, die Relevanz des hermeneutischen Paradigmas müsse neu erkannt werden, was bisweilen mit der Forderung nach einer „neuen Hermeneutik“ verbunden wird, welche den Dekonstruktivismus integriert.3 Wie eine solche neue Hermeneutik aussehen könnte, kann und soll nicht Gegenstand dieses Beitrags sein. Wohl geht es mir in diesem Beitrag, der auf einen Vortrag in der Kölner Ringvorlesung Perspectives of English Studies im Wintersemester 2002/03 zurückgeht, darum, eine Lanze dafür zu brechen, daß auch bei der Neuausrichtung der Anglistik - genauer der anglistischen Literaturwissenschaft - eine hermeneutische Fundierung oder Orientierung unverzichtbar ist. Ich will zu diesem Zweck versuchen, das Selbstverständnis und die Prinzipien von Hermeneutik und Dekonstruktion zu skizzieren und kritisch zu vergleichen, um auf dieser Basis meine Argumentation zu entwickeln. Obschon ich keine historische Darstellung von Hermeneutik und Dekonstruktion geben will, möchte ich – zwecks Vgl. Richard Shusterman, „Interpretation, Intention, Truth“, The Journal of Aesthetics and Art Crtiticism 46 (1988): 300 - 410; hier 399. Shusterman spricht allerdings auch von einem neueren „intentionalist backlash“. Manfred Frank beschreibt die „hermeneutische Wende“ im 19. und frühen 20. Jahrhundert: „Diese Wende bestand in der grundsätzlichen Reflexion auf Deutungsabhängigkeit jeder, auch der automatisierten Sinnzuweisung und der Maxime, nichts für selbstverständlich zu halten. („Vieldeutigkeit und Ungleichzeitigkeit: Hermeneutische Fragen an eine Theorie des literarischen Textes“, Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 57 (1986): 20 - 30; Zitat 20. 2 Vgl. I. A. Richards, Practical Criticism (New York 1952). 3 Manfred Frank widmete sich einer solchen Aufgabe und äußerte die Hoffnung, daß eine „reformulierte Hermeneutik der zeitgenössischen, zwischen zwei divergierenden methodologischen Optionen zerspaltenen Literaturwissenschaft zur Rückgewinnung ihrer theoretischen Praxis verhelfen könnte.“ (Das individuelle Allgemeine: Textstrukturierung und -interpretation nach Schleiermacher (Frankfurt/M. 1985) 11). - Mit ähnlicher Intention spricht Werner Jung von einer „neuen Hermeneutik“ ( „Neuere Hermeneutikkonzepte“, in: Literaturtheorie: Eine Einführung, ed. Klaus-Michael Bogdal (Opladen 1990)154 - 175; 156). - Bogdal glaubt nicht, daß sich solche Hoffnungen erfüllen („Problematisierungen der Hermeneutik im Zeichen des Poststrukturalismus“, in: Grundzüge der Literaturwissenschaft, ed. Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering (München 1996) 139). - Gleichermaßen skeptisch äußert sich Gerd Gemünden in seiner Auseinandersetzung mit M. Frank („Der Unterschied liegt in der Differenz: On Hermeneutics, Deconstruction, and Their Compatability“, New German Critique 48 (1989): 176 - 192; hier 190 - 192.) 1 1 Konkretion und historischer Verortung – aus dem Werk einiger ihrer markantesten Vertreter einige Aspekte hervorheben, die in ein solches allgemeines Bild der beiden Denkrichtungen und Ansätze eingehen, wie es sich mir heute darstellt. Die Hermeneutik als eine dem Experten als Vermittler, „Interpreten“, vorbehaltene kunstgerechte Auslegung kanonischer Schriften ist seit der Zeit Platons bekannt, in der sie wegen des zeitlichen und kulturellen Abstands vor allem auf Homer angewandt wurde. Im Mittelpunkt der Exegese stand lange Zeit natürlich die Bibel. Besondere Anschübe erhielt die Hermeneutik der Neuzeit dann durch Luther und die protestantische Theologie, welche die allegorische Exegese ablehnte zugunsten einer vorwiegend kontextuell verstandenen Selbstauslegung der Hl. Schrift, und durch das starke Anwachsen und die Diversifizierung von säkularer Literatur und Leserschaft im 18. Jh., die eine fachkundige Vermittlung angeraten erschienen ließen. Es ist dann die Romantik, die mit ihrer Subjektphilosphie und ihrem symbolischen und expressiven Verständnis von Kunst – anstelle eines mimetischdidaktischen – die Ausbildung einer Hermeneutik als universale, auf alle Manifestationen des menschlichen Geistes, alle „Lebensäußerungen“ in der Terminologie Diltheys, gerichtete Philosophie des Verstehens hervortrieb.4 Als eigentlicher Begründer dieser „neuen Hermeneutik“ wird seit Dilthey F. Schleiermacher genannt.5 Im Mittelpunkt steht dabei seine Universalisierung des Mißverstehens, seine Unterscheidung zwischen einer „laxeren Praxis“ der Hermeneutik, nach der die Verständlichkeit eines Textes als Regel und das Mißverständnis als aufklärungsbedürftiger Einzelfall angesehen wird, und einer „strengeren Praxis“, die davon ausgeht, „daß sich das Mißverstehen von selbst ergiebt und das Verstehen auf jedem Punkt muß gewollt und gesucht werden“.6 Für eine heutige Hermeneutik erscheint mir neben diesem allgemeinen Ausgangspunkt sein wichtigster Beitrag in dem zu liegen, was Manfred Frank im Begriff des „individuellen Allgemeinen“ zusammenfaßt.7 Der Text ist insofern ein Allgemeines, als der Sprecher oder Autor von der grammatischen und konzeptuellen Struktur seiner Sprache abhängt, konditioniert ist; aber er ist nicht völlig von ihr determiniert; vielmehr gestaltet er sie auch in einem individuellen, intentionalen und sinngebenden Akt (der Erzeugung eines Textes). Im Hinblick auf Sprecher und Sprache sagt Schleiermacher: „Er ist ihr Organ, und sie ist seins.“8 Diesen reziproken „Akt“ zu rekonstruieren, bedeutet den Sinn zu erschließen. Dazu sind die grammatische Auslegung (die Analyse des sprachlichen Systems und Kontexts) und die psychologische Auslegung (die Analyse des Entstehenskontexts, Studien zum Autor etc.) notwendig. - Ein zweiter Grundgedanke besteht in dem, was wir heute Codeüberschneidung nennen würden, d.h. die Übereinstimmung „in der Sprache und im Denken des Sprechenden und des Hörenden“. Verstehen ereignet sich nur - und auch da ist Schleiermacher sehr modern - bei einer partiellen Übereinstimmung. Bei voller Übereinstimmung wäre Verstehen nicht nötig, bei vollem Auseinanderklaffen nicht möglich. Hinsichtlich des Denkens hält Schleiermacher allerdings beide Extreme für theoretisch, so daß Verstehen zur grundlegenden zwischenmenschlichen Tätigkeit wird.9 Schleiermacher begründet damit einige allgemeine Prinzipien der Hermeneutik: 1. Texte werden als Materialisierungen kommunikativer Akte betrachtet, die verstanden werden 4 Vgl. Jean Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik (Darmstadt 2001) 99f. Vgl. Peter Szondi, Einführung in die literarische Hermeneutik (Frankfurt/M. 1975) 135f. Szondi selbst relativiert die Bedeutung Schleiermachers. 6 Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik, ed. Heiner Kimmerle (Heidelberg 1958) 86f. 7 Frank 1985. Vgl. Schleiermacher 1958, 37: “Man kann ein Gesprochenes nicht verstehen ohne das Allgemeinste, aber auch nicht ohne das persönlichste und besonderste“. 8 Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, ed. Manfred Frank (Frankfurt/M. 1977) 86f. 9 Schleiermacher 1977, 178. Vgl. Peter Rusterholz, „Zum Verhältnis von Hermeneutik und neueren antihermeneutischen Strömungen”, in: Grundzüge 157-179; 157f. In fast gleicher Formulierung findet sich diese Idee in aphoristischer Weise in Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften Bd. VII: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (Stuttgart/Göttingen 1958) 225. 5 2 wollen. 2. Sie sind Teile eines sprachlichen und kulturellen Systems, aber auch individuelle Phänomene, die einem individuellen Gestaltungs- und Ausdruckswillen entspringen. 3. Der auf sie gerichtete Verstehensprozeß hat notwendigerweise einen dialogischen Charakter: Der Text stellt Fragen an uns, und wir richten Fragen an ihn, ein Prozeß, den Schleiermacher mit dem verständnissuchenden Gespräch vergleicht, das wir miteinander und mit uns selbst führen.10 Für Wilhelm Diltheys Bedeutung in der Geschichte der Hermeneutik wird vor allem sein Versuch der methodischen Unterscheidung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften und der theoretischen Grundlegung der ersteren als eigenständiger Wissenschaft verantwortlich gemacht, wobei die Opposition zwischen Verstehen und Erklären die zentrale Rolle spielt. Dies erscheint in Diltheys kategorialer Form heute als fragwürdig. Für die heutige Rolle der Hermeneutik möchte ich aber die folgenden Gedanken Diltheys hervorheben: Verstehen hat für ihn als Geschichtsphilosophen vor allem eine historische Dimension. An Schleiermacher anknüpfend, aber dies stärker betonend, erweitert er den hermeneutischen Zirkel in die Geschichte. Dessen traditionelles, vor allem durch die protestantische Tradition der Bibelauslegung begünstigtes, Verständnis betraf ja das dialektische Verhältnis zwischen dem Ganzen und seinen Teilen. Das Einzelne des Textes wird aus dem sich allmählich erschließenden Ganzen verstanden, dessen Verständnis wiederum durch das begreifende Erfassen einer wachsenden Zahl von Details ansteigt. – Dazu kommt jetzt das Bewußtsein, daß der Text insgesamt nur aus dem Horizont seiner Epoche verstanden werden kann, deren Verstehen wiederum aus den studierten Texten resultiert. Individuum, historisch-kulturelle Epoche und Texte als kulturelle Zeugnisse sind „in sich zentriert“, aber auch Teil des „Wirkungszusammenhangs der Geschichte“. Beides ist für ihr Verstehen relevant, ihre eigentliche Bedeutung allerdings liegt in ihrem Sinn in der Geschichte.11 Eine andere, dritte Dimension des hermeneutischen Zirkels (wenn auch von Dilthey nicht explizit formuliert) betrifft die Rolle des Erkenntnissubjekts. Dilthey spricht dem Subjekt im Prozeß des Verstehens eine aktive Rolle zu. Sie kann als „Empathie“ im Sinne des Einfühlens in fremde Individuen und fiktionale Charaktere verstanden werden. Dies erfuhr viel Kritik als reine Projektion und als kurzschlüssige Einverleibung des Textes.12 Dilthey spricht jedoch bewußt von einem Sich-Hineinversetzen in die Welt des Textes, in der zwar auch Individuen nacherlebbar, aber erst in ihrer Interaktion mit den kulturellen Ordnungen verstehbar werden. „Der objektive Geist [die geschichtlich gebildeten kulturellen Ordnungen] und die Kraft des Individuums bestimmen zusammen die geistige Welt. Auf dem Verständnis dieser beiden beruht die Geschichte.“13 Dilthey spricht vom „Nacherleben“ oder „Nachbilden“ der Textwelten. Dies ist ein konstruktiver Akt, der das Subjekt mit ihm sonst unzugänglichen Erfahrungshorizonten konfrontiert und damit der „Determination“ entgegenwirkt, die der „Lebenslauf [...] an jedem Menschen [vollzieht]“. Das Verstehen „des Geschichtlichen“ und der Kunst versetzen den Menschen „in Freiheit“.14 Auch wenn Dilthey hier natürlich nicht von der Idee des interkulturellen Lernens im heutigen Sinne spricht, erscheint mir sein 10 Vgl. Grondin 2001, 110-112. Dilthey geht vom „Wirkungszusammenhang“ der Geschichte in den einzelnen Epochen aus. Letztere übernehmen Elemente aus der Geschichte und integrieren sie – „in sich selbst in einem neuen Sinn zentriert“ – auf neue Weise. Ebenso realisiert das einzelne Individuum diesen Wirkungszusammenhang in seinem „Lebenslauf“, in dem dieser sich, wie in der Kultur einer Epoche insgesamt, in der „Setzung von Zwecken, Gütern und Normen“ ausdrückt. Das „Werk“ der Kunst schließlich trägt in analoger Weise „sein eigenes Leben und Gesetz in sich“ (die „Gesetze der dichterischen Komposition“) und muß aus ihnen verstanden werden, aber auch aus eben dem „Wirkungszusammenhang“ der Geschichte, der sich auch in ihm erfüllt (Dilthey 1958, 153157). Vgl. auch Bogdal 1996, 143. 12 Vgl. Peter Rusterholz, “Hermeneutische Modelle”, in: Grundzüge 101-136; hier 117-119. 13 Dilthey 1958, 213. 14 Dilthey 1958, 208-213; Zitat 215 und 216; vgl. auch 214: “Die Seele geht die gewohnten Bahnen [...] Unzählige Wege sind offen in Vergangenheit und in Träume der Zukunft; von den gelesenen Worten gehen unzählige Wege der Gedanken aus.” 11 3 universalgeschichtliches Verständnismodell potentiell transkulturelll angelegt und kann als Vorbereitung eines fundamentalen Prinzips des interkulturellen Lernens verstanden werden. Gemeint ist das des Perspektivenwechsels, der in der Fachdidaktik zweifellos zu einem Neuaufstieg des hermeneutischen Ansatzes geführt hat.15 Eine weitere zentrale, auch oft kritisierte Vorstellung Diltheys stellt die von der Kunst als Lebensdeutung dar. Auch hier ist jedoch der Zusammenhang zu beachten, in dem Dilthey diese Maxime ausdrückt und der auch heute noch, gerade im Blick auf die Dekonstruktion, bedenkenswert ist: Gemeint ist Diltheys Beschreibung seines positivistischen Zeitalters, das er mit einem Fabrikbetrieb mit Fließbandarbeit vergleicht. In dieser Gesellschaft sei „der mit der isolierten Technik seines Einzelberufs Ausgerüstete in der Lage eines Arbeiters, der ein Leben hindurch an einem einzelnen Punkte dieses Betriebs beschäftigt ist, ohne die Kräfte zu kennen, welche ihn in Bewegung setzen, ja ohne von den anderen Teilen des Betriebs und ihrem Zusammenwirken zu dem Zwecke des Ganzen eine Vorstellung zu haben“. Dies führe zu einem „Chaos im Innenleben der Menschen. Sie werden in eine dunkle, unerklärliche und als empirisches Datum hinzunehmende Welt von Antrieben und Gefühlen versenkt ohne ein Element des Gemeinen und Vernünftigen in sich.“ Ähnlich wie Matthew Arnold weist Dilthey der Kunst, der Literatur, insbesondere aber den Geisteswissenschaften, die Funktion zu, sich um die Herstellung dieses Zusammenhangs zu bemühen.16 Mit Martin Heidegger und Hans-Georg Gadamer vollzieht sich im 20. Jahrhundert die eigentliche, von Dilthey bereits vorbereitete „ontologische Wende“ der Hermeneutik.17 Beide, aufeinander aufbauend, übten einen entscheidenden Einfluß auf die Literaturtheorie aus, obschon z.B. Uwe Japp den praktischen Einfluß der ontologischen Hermeneutik auf die Literaturwissenschaft für gering hält.18 Aus Heideggers Werk möchte ich nur einen für meine Argumentation zentralen Gedanken herausstellen, auf den ich in meinem Schlußteil zurückkomme. Heidegger rückt, worin ihm Gadamer folgt, die existentielle Bedeutung des Verstehens in den Mittelpunkt der Hermeneutik. Verstehen bezieht sich auf alle Lebensbereiche, realisiert sich aber exemplarisch in Kunst und Literatur (worauf auch Heideggers eigene Interpretationen hinweisen). Für Heidegger vermittelt das Verstehen zwischen Dasein und Sein (zwischen uns Menschen als Seienden und unserem uns nur in Verstehensakten zugänglichen Sein). „Das Dasein entwirft im Verstehen sein Sein auf Möglichkeiten hin.“ „Auslegung ist Ausarbeitung solchen bewußt gewordenen Verstehens“; und durch „Rückschlag [des Verstehens] in das Dasein wird dieses ein Sein-Können.“ Solches Verstehen wird immer von „Fremdem“, z.B. der Kunst, „angestoßen“ (oder: „erhält einen Stoß“). Dies eröffnet dem Menschen eben die Möglichkeiten des Seins, auf die hin er sich entwerfen kann, gibt also dem Menschen die Möglichkeit zu „sein“ und damit, nach Heidegger, auch zu handeln. Es ist für Heidegger daher ein Existential.19 Gadamer unterstreicht diese Auffassung des Verstehens.20 Auch für ihn vollzieht sich Verstehen im Lebenszusammenhang von Subjekt und Objekt. Er bezieht dies aber wieder stärker auf die historische Dimension.21 Eben weil wir von der Geschichte geprägt sind, ist die grundsätzliche Voraussetzung für Verstehen gegeben, finden wir im zeitlich entfernten Text trotz seiner Fremdheit das Eigene wieder, kann es also zur „Horizontverschmelzung“ 15 Vgl. Lothar Bredella und Herbert Christ (ed.), Didaktik des Fremdverstehens (Tübingen 1998). Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften Bd. I: Einleitung in die Geisteswissenschaften (Stuttgart/Göttingen 1958) 3. Nach Rusterholz 1996, 117f. Eine ähnliche Forderung erhebt Habermas; vgl. diese Arbeit S. 15. 17 Vgl. Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik I: Wahrheit und Methode (Tübingen 1992) 270f. 18 Uwe Japp, “Hermeneutik”, in: Literaturwissenschaft: Ein Grundkurs, ed. Helmut Brackert und Jörn Stückrath (Reinbek, 4. Aufl. 1996) 581-593; hier 590f. 19 Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen 2001) 32; 148-153. 20 Vgl. Hans-Georg Gadamer, “Text und Interpretation”, in: Text und Interpretation, ed. Philippe Forget (München 1984) 24-55; hier 25f.; Wahrheit und Methode (1990) 263f. 21 Vgl. Gadamer 1990, 268f. 16 4 kommen, und im Zuge dieses Prozesses werden wir uns unseres Platzes in der Geschichte, in der Tradition, bewußt.22 Dies birgt für Kritiker wie Jürgen Habermas die Gefahr eines unkritischen, „ideologischen“ Verstehens der kulturellen Tradition. Ein Beispiel: In der Rezeption der bürgerlichen Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts z.B. lerne ich die Geschichte des bürgerlichen Idealismus verstehen. Und gleichzeitig verstehe ich mich selbst mehr und mehr in Termini dieser Ideologie. So kommt es über sich wiederholende Akte der Fusion zu einer immer ausgedehnteren Horizontverschmelzung zwischen mir und meiner kulturellen Tradition. Dies würde auf ein rein affirmierendes Verstehen hinauslaufen. Hinzutreten muß daher nach Habermas ein Hinterfragen der Prämissen des Verstandenen selbst mit Hilfe der übergeordneten „kritischen Vernunft“ im Prozeß der „Tiefenhermeneutik“.23 Hinsichtlich des hermeneutischen Zirkels postuliert Gadamer öfters einen „Vorgriff von Vollkommenheit des Sinns“, also die Antizipation einer vollkommenen Einheit von Sinn, der wir uns im stetigen Durchlaufen des Zirkels immer mehr annähern.24 Andererseits verneint Gadamer die Möglichkeit eines letztendlichen Ankommen bei dieser Sinntotalität des Textes entschieden, so wie es auch schon Schleiermacher tat.25 Noch stärker relativiert er diese Vorstellung in seinem berühmten Treffen mit Jacques Derrida 1986; hier betont er die Polysemie der Zeichen und die strukturelle Komplexität der Texte – vor allem literarischer Texte, die Gadamer durchaus im Sinne von Roman Jakobson als „selbstpräsent“ bezeichnet, die also als ästhetische Gebilde hervortreten und nicht hinter ihrer Mitteilungsfunktion verschwinden26 - ebenso wie die Interessenvielfalt der Interpreten so stark, daß er die „Sprachlichkeit des Verständigungsgeschehens“ als „eine unübersteigbare Schranke“ bezeichnet. Er hält aber letztendlich an der Möglichkeit oder an der Annahme eines einheitlichen Sinns als Voraussetzung des Verstehens und an der existentiellen Notwendigkeit des Verstehens fest.27 Unaufhebbare Fremdheit und mögliche verstehende Verständigung halten sich hier die Waage. Im Bild von „Brücke und Schranke“ für „Sprachlichkeit“ bringt Gadamer das zentrale Moment der „ontologischen Hermeneutik“ zum Ausdruck: Für den Aufbau von „Selbstigkeit“ ist „Kommunikation“ mit der „Andersheit“ existentiell notwendig; dieses wiederum ist nicht möglich ohne Verstehen als letztes Telos.28 Sinn wird in der Kommunikation gefunden, ist aber nichts metaphysisch Präsentes, vielmehr im Heideggerschen Sinne „ein beständig sich wandelnder Versuch oder „eine [...] Versuchung, sich auf etwas einzulassen und sich mit jemandem einzulassen“.29 Sinn also muß von jedem Interpreten für sich gewonnen und verhandelt werden. Für diesen Prozeß ist nach Heidegger die „Vorhabe“ eine entscheidende Voraussetzung. Wir können hierunter die ernsthafte Interpretationsfrage verstehen, die ein sinnvolles Gespräch mit dem Text allererst ermöglicht. Robert Magliola, von Heidegger ausgehend, legt am Beispiel einer Interpretation der Kurzgeschichte „The River“ von Flannery O’Connor dar, daß dies eine Frage ist, die für den Fragenden relevant und dem Text angemessen ist.30 Nur sie setzt das dialogische Verfahren des Zirkels in Gang und erfüllt damit Heideggers Diktum: 22 Vgl. Gadamer 1990, 270-312. Jürgen Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften (Tübingen 1967); vgl. bes. 169f. 24 Gadamer 1996, 296. Das Bild einer “hermeneutischen Spirale” wird hier nahegelgt. 25 Vgl. Grondin 2001, 107. 26 Vgl. Gadamer 1984, 49f. 27 Gadamer 1984, 39. 28 Gadamer 1984, 31. 29 Gadamer 1984, 29. 30 Robert Magliola, „Ground and Common(s), and a Heideggerian Recension", Papers on Language and Literature 17 (1981): 80-87; (einer von vier Beiträgen zu: „A Symposium: Hermeneutics, Post-Structuralism, and ‚Objective‘ Interpretation“, 48-87). 23 5 „Ihn [den Zirkel – wegen der Gefahr der Zirkularität] vermeiden zu wollen, hieße das Verstehen mißzuverstehen. Es geht darum, auf rechte Weise in ihn hineinzukommen.“31 Sinnfindung, Erschließen der Bedeutungsdimensionen des Textes, Dialog mit dem Text, in dem letzterer ein gleichberechtigter Partner ist – ein solches Konzept des Verstehens oder der Möglichkeit eines solchen Verstehens wird nun von der Dekonstruktion radikal in Frage gestellt. Das gilt dann auch für den Begriff des Textes selbst als einem festen „Gebilde“, als etwas „Bleibendem“, an dessen „Verständlichkeit“ immer neue Interpreten arbeiten, indem sie „ihre Gründe beibringen“ und dann wieder hinter dem Text verschwinden, wie es Gadamer in seinem Pariser Vortrag darstellt.32 In der Dekonstruktion wird dem Text Einheit und Fixierung abgesprochen, der Begriff des Textes verliert seine Bedeutung ebenso wie der der Interpretation, da der Interpret, der jetzt kein „Interpret“ mehr ist, aus seiner Dienst- und Vermittlungsfunktion herausgeholt und in die volle Freiheit eines souveränen Spielers in der Welt der „Texte“ versetzt wird, in die auch sein eigener Text gleichberechtigt eintritt. In der Auseinandersetzung mit dieser Position konzentriere ich mich auf Derrida und die Yale Critics – genauer gesagt auf Paul de Man und John Hillis Miller -, um auch hier, soweit es der Raum zuläßt, möglichst konkret und pointiert, vielleicht überspitzt, die Aspekte herauszustellen, die meine Thesen einleuchtend machen, daß die Notwendigkeit eines hermeneutischen Grundansatzes gerade in der Konfrontation mit der Dekonstruktion evident wird. Ich beginne mit Jacques Derrida, der ebenso wie Gadamer auf Heidegger aufbaut, ihn aber in Richtung Nietzsche radikalisiert. - Derridas Dekonstruktion möchte ich unter drei Aspekten zusammenfassen:33 1. Derrida revidiert die in der abendländischen Philosophietradition herrschende Unterordnung der Schrift unter das Wort bzw. die gesprochene Sprache, den abendländischen „Logo- oder Phonozentrismus“, den er von Platon bis zu de Saussure zu beobachten glaubt. In Platons Dialog Phaidros stuft Sokrates die Schrift unter die „lebendige Sprache“ – den Dialog – herab, da sie eine Mimesis auf dritter Ebene darstellt, vor allem aber da sie von Sprecher und Hörer, also vom Kommunikationsakt abgetrennt ist: „Sie weiß nicht, von wem sie spricht und zu wem sie reden will. Befragt, weiß nicht zu antworten.“ Die Lösung aus dem Kommunikationsakt macht die Schrift, das Geschriebene, uneindeutig, unzuverlässig. Wer sie verstehen will, muß sie auf das zu rekonstruierende „Gespräch“ zurückbeziehen.34 Derrida knüpft explizit an diesen Dialog Platons an, kehrt aber die hierarchische Beziehung um. Die Schrift geht der Sprache voraus, Sprache existiert primär als Schrift. 35 Die Bedeutung einer solchen Umkehrung läßt sich vor Augen führen, wenn wir sie auf den Beginn des Johannes-Evangeliums bezögen, das wir dann umschreiben müßten: „Am Anfang war das Wort“ wird zu „Am Anfang war die Schrift“. Von diesem Anfang aus entstände eine andere Art von „Evangelium“. Am Anfang steht nicht mehr ein transzendentes wollendes Wesen und sein intentionaler, seinen Sinn verwirklichender Akt, sondern die Schrift, ein (anonymes) System. Derrida negiert also, daß Schrift – als Text – Niederschlag eines 31 Heidegger 2001, 153. Gadamer 1984, 45-55. Gadamer sucht dies selbst in seiner Interpretation der letzten Zeile von Mörikes “Auf eine Lampe” zu demonstrieren. Das letzte Zitat – aus dem Schlußsatz des Vortrags – ist von mir syntaktisch verändert. 33 Eine solche Zusammenfassung verbietet sich allerdings vom dekonstruktivistischen Standpunkt her, und sie ist im Falle von Derrida auch risikoreich; vgl. Gary B. Madison, “Beyond Seriousness and Frivolity: A Gadamerian Response to Deconstruction”, in : Gadamer and Hermeneutics, ed. Hugh J. Silverman (New York/London 1991) 119-135; 120: “I do not pretend to know what Derrida means, wants to say, and am not surprised when he intimates that there is nothing he wants to say, that the whole vouloir-dire is a hopelessly metaphysical notion.” 34 Platon, Phaidros, 275 E/276 A. Sokrates bzw. Platon nehmen hier die modernen Begriffe der “Entkontextualisierung” bzw. der “Situationsabstraktheit” als diskutierte Kriterien für den literarischen (fiktionalen) Text vorweg. 35 Jacques Derrida, “La pharmacie de Platon”, in: La dissémination (Paris 1972). 32 6 intentionalen sinnvermittelnden Aktes (eines Logos) oder – als Geschriebenes insgesamt – vieler solcher intentionaler Akte ist. Vielmehr ist dieser Akt bereits ein Moment der Schrift, eine „Stelle“ in ihrem „System“.36 Der Kommunizierende beherrscht die Schrift nicht als gehorsamen Code, er ist ihr ausgeliefert. In den Vordergrund tritt ihre Materialität und ihre Strukturalität. Sie wird als strukturales System, nicht als Realisierung oder Niederschlag performativer Akte betrachtet. Schrift ist ein semiotisches System. Die „Welt“ begegnet dem Menschen ausschließlich in Form solcher semiotischer Systeme; denn alles, was ihm begegnet, ist ihm durch Sprache bzw. Schrift vermittelt; d.h. er ist umgeben von Systemen von Interpretationen, die auf andere Interpretationen verweisen. 2. Derrida verkennt trotz der Betonung der Materialität der Zeichen nicht deren Verweisungscharakter. Die Zeichentheorie de Saussures, die er immer noch in der abendländischen logozentrischen Tradition befangen sieht (Überordnung der Sprache, zweiseitiges Zeichenmodell: der Zeichenkörper dient dem Verweis auf die Sache und verschwindet hinter ihr), dekonstruiert Derrida von innen mit Hilfe der Begriffe der Arbitrarität und der Differenz, die bei de Saussure selbst wesentlich sind. Die Zeichen sind keine festen Substanzen an einem fixen Platz der Struktur (so daß sie immer auf dasselbe verweisen könnten), sie gewinnen ihre jeweilige Identität (und damit auch ihre jeweilige Signifikanz oder Funktion) aus der Differenz zu den anderen Zeichen. Da die Differenz aber keine „Präsenz“ ist, befinden sich die Zeichen – etwa die Wörter der Sprache – in einem freien Spiel, in dem sie ihre Signifikation chamäleonartig verändern. Auf der Ebene der Signifikate nimmt Derrida dieselbe auf Differenz beruhende Struktur an, so daß sich auch dort keine feste Identität ergibt. Zeichen sind daher bei ihrer Wiederholung im aktuellen Benutzungsakt nicht stabil, vielmehr sind sie einem unendlichen fröhlichen Spiel der ständigen Fluktuation unterworfen. Bedeutung, Sinn, wird jeweils durch momentanes Verharren in einem bestimmten Kontext suggeriert, aber nie garantiert, vielmehr immer alsbald aufgehoben.37 Derrida benutzt für seinen Kernbegriff der Differenz im Französischen den Terminus différance, ein Kunstwort, das seine grundlegenden Ideen anzeigt: 1. Es verweist auf den Primat der Schrift; 2. es denotiert als Partizip von differér sowohl unterscheiden als auch aufschieben; 3. es signalisiert – als Partizip – den Prozeßcharakter.38 3. Dieses freie Spiel und das mit ihm verbundene endlose Aufschieben von Sinn ließe sich nur anhalten, wenn in einem Akt von Willkür und Macht ein Element bestimmt würde, das eine eigene, intrinsische, von der Struktur unabhängige Identität besäße und nicht mehr am Spiel der Zeichen teilnähme, da es nur auf sich selbst verwiese. Ein solches transzendentes Zentrum würde mit seinem festen Platz das Spiel blockieren, die Struktur einfrieren und so in einer festen Begrenzung und einer fixen Ordnung erstarren lassen. Nur dies aber würde den (jetzt fixierten) Zeichen und ihren Relationen einen festen, wiederholbaren, ebenfalls transzendenten Sinn verleihen. Die Setzung eines solchen Zentrums, Ursprungs oder Grunds entspringt nach Derrida der Angst vor dem unbeherrschbaren Spiel. Er bezeichnet die Geschichte der abendländischen Metaphysik als die aus der Angst geborene Suche nach Konzepten, mit denen sich dieses transzendente Zentrum besetzen ließ, „ – eidos, arche, telos, energeia, ousia (essence, existence, substance, subject), aletheia, transcendentality, consiuosness, God, man, and so forth.“39 36 Jacques Derrida, Grammatologie (Frankfurt/M. 1983) insbes. 19-26, 65, 83. Vgl. Rusterholz 1996,162-167. Derrida 1987, 19-65; vgl. Caroline Pross und Gerald Wildgruber, “Dekonstruktion”, in: Grundzüge 409-429; hier 411-416. 38 Jacques Derrida, “Différence” in: Margins of Philosophy (Chicago 1972) 1-27. 39 Jacques Derrida, “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”, in: Modern Criticism and Theory: A Reader, ed. David Lodge (Harlow 1988) 88-103; Zitat 91. 37 7 Es wird deutlich, daß die Philosophie Derridas auf dem Weg einer Sprachphilosophie letztendlich auf ein Zu-Ende-Führen von Heideggers Dekonstruktion der Metaphysik abzielt. Dekonstruiert werden sollen vor allem die Prinzipien der binären Opposition und der Hierarchie. Die Dekonstruktion der Opposition und des hierarchischen Überordnungsverhältnisses zwischen Sprache und Schrift, Bezeichnetem und Bezeichnendem, Zentrum und Rand legt hierfür die Grundlage. Von einem Verstehen im Sinne eines Erschließens eines von der Struktur ablösbaren Sinns oder im Sinne einer Rekonstruktion eines intentionalen komplexen Sprechakts kann keine Rede mehr sein. Der Idee Gadamers von einem sich in konzentrischen Kreisen ausweitenden Verstehen setzte Derrida - bei der gemeinsamen Tagung in Paris 1986 - seine Idee eines sich in Brüchen oder Sprüngen vollziehenden jeweiligen, vorübergehenden, Verstehens entgegen.40 Die Yale-Critics dürfen als die exponiertesten und einflußreichsten Dekonstruktivisten in den USA angesehen werden. Sich auf sie zu konzentrieren, ist in unserem Zusammenhang sinnvoll, da sie unmittelbar von Derrida inspiriert wurden und seine Philosophie auf die Interpretation literarischer Texte bezogen. Interpretation dient jetzt der Dekonstruktrion der traditionellen Vorstellung von einer – organischen oder funktionalen – strukturellen – Einheit des Textes und eines notwendigerweise auf eine solche angewiesenen Sinns. Paul de Man und J. Hillis Miller betreiben ihre Dekonstruktion in einer akribischen, einer – in den Worten von Roland Barthes – zeitlupenhaft verlangsamten Lektüre der Texte.41 Dabei stößt de Man auf eine „konstative“ Seite des Textes, d.h. die von den Worten des Textes in ihrem syntaktischen Zusammenhang vermittelte referentielle Bedeutung, die ihm als sprachlicher Äußerung durchaus eigen ist. Jeder Text, besonders aber der literarische, offenbart dem Leser jedoch auch eine figurative oder „rhetorische“ Seite, die ihre eigene Bedeutung hat bzw. die einen zweiten, „performativen“ Akt konstituiert. Und deren „Sinne“, „what the text says and what the text does“, sind so widersprüchlich, daß der Text seinen ständig erzeugten Sinn auch ständig wieder aufhebt. Dies demonstriert de Man vor allem mit Hilfe einer eindringlichen, aber auch eigenwilligen Analyse der Metaphern des Textes.42 So wird in seiner bekannten Interpretation von Shelleys „The Triumph of Life“ die Lektüre des Textes als Ausdruck der Unmöglichkeit eindeutiger Signifikation auf eine sich immer weiter verästelnde, gleichzeitig aber höchst spekulative und von einer Reihe autoritativer Setzungen vorangetriebene Analyse und Deutung der Bildersprache der Passage 343-418 aufgebaut, in der Rousseau von seiner Begegnung mit „a shape all light“ berichtet und die de Man zur Kernstelle des Werks ausruft. Vom Kontext her naheliegende „einfachere“ Bedeutungen werden nicht bedacht, ein Anschluß an traditionellere Interpretationen (Abrams, Reimann) findet kaum statt; und die Interpretation ist allein auf das Ziel ausgerichtet, die Undurchdringlichkeit der Textur des Werks auszuweisen und es damit als exemplarischen 40 Gadamer in Forget 1984, 24-55, bes. 45f.; Derrida ibid., 57, 62-67 und 73-77. De Mans Anliegen ist die Analyse der Lektüre, nicht eine Literaturtheorie oder eine Auseinandersetzung mit Theorien, z.B. der Hermeneutik. Mit Bezug auf seine akribische Lektüre spricht er von “Return to Philology” (“The Resistance to Theory”, in Lodge 1988, 331-34). – Assmann sieht im Dekonstruktivismus eine Wende vom “Interpretieren zum Lesen” durch die Konzentration auf die Zeichenkörper: “Das neue Schlagwort von der Materialität der Zeichen lenkt den Blick vom Text als transparentem und instrumentellem Kommunikationsmedium auf den Text als unhintergehbare Konfiguration von Zeichen. Diese Schicht des Textes hatte die Hermeneutik der zweiten Phase geflissentlich übersehen und verdrängt.“ Assmann spricht auch von der „mühsamen Entzifferung von Spuren“ in der akribischen Lektüre, was auf Lesarten des Feminismus und des New Historicism verweist. Aleida Assmann, „Einleitung“, in: Texte und Lektüren: Perspektiven der Literatutwissenschaften, ed. A. Assmann (Frankfurt/M. 1996) 7-28; Zitat 17. Demgegenüber bescheinigt Rusterholz de Man eine „programmatische Textimmanenz“ (Grundzüge 429) und spricht von einer Form des close reading. (ibid. 167f.) 42 Paul de Man, Allegories of Reading (New Haven/London 1979) bes. Kap. 1-3, 7. De Man entwickelt seine Konzeption, die keine „Theorie“ sein soll, bezeichnenderweise an „Lektüren“, z.B. von Rilke, Proust, Nietzsche. Vgl. Assmann 1996, 15. 41 8 Text schlechthin aufzuweisen.43 Es ist gewiß kein Zufall, daß „The Triumph of Life“ in der Zeit des Poststrukturalismus eine Renaissance erfahren hat. Für eine Lektüre im Sinne de Mans böte sich vielleicht auch Shelleys „Mont Blanc“ an, dessen Beginn z.B. eine Vielzahl lose miteinander verbundener konnotationsreicher Naturbilder enthält, die mit den teils elliptischen reflexiven Passagen in einem oft unklaren syntaktischen Zusammenhang stehen. Voraussetzung wäre aber, daß man die geduldige Suche nach Kohärenz durch eine ebenso geduldige Suche nach Divergenz und Diskrepanz ersetzt. Als wenig einladend für dekonstruktivistische Lesarten erwiesen sich aber bisher Shelleys „exoterische“ (sein eigener Terminus), d.h. politisch-gesellschaftskritische Gedichte wie „Queen Mab“, „The Mask of Anarchy“ oder „The Revolt of Islam“. Den performativen Widerspruch de Mans könnte ich wohl auch kaum in Blakes „London“ entdecken; denn es scheint doch recht offensichtlich, daß die durchaus prominenten rhetorischen Figuren, etwa die zahlreichen Wiederholungen und Parallelismen und die gewiß komplexen und auffälligen Bilder (Metaphern und Metonymien) nicht anders zu lesen sind, als daß sie die soziale Anklage des Textes intensivieren und ihr sogar zusätzliche gedankliche oder semantische Dimensionen verleihen. Ich meine mit letzterem, daß sie die Darstellung der Not nicht nur sinnenfälliger und emotional eindringlicher machen, sondern auch Ansätze zu einer Interpretation des Elends geben, das der Sprecher zunächst sieht und hört und uns authentisch darstellend vermittelt – z.B. die Anklage des Staates, der seine Verantwortung gegenüber dem „hapless soldier“ nicht wahrnimmt oder den Kausalnexus zwischen dem Schicksal der Prostituierten und der bürgerlichen Ehe. Diese Unterschiede mögen zeigen, welch einebnende Wirkung die Anwendung einer dekonstruktivistischen Lektüre auf Dichtung schlechthin hätte. Bei J. Hillis Miller geschieht die Dekonstruktion über die Semantik der Wörter. Er nimmt dabei die Vorstellung von Derrida auf, daß jedes Zeichen Spuren seiner unendlich oft wiederholten Verwendung in unendlich vielen Kontexten in sich trägt. Er „ontologisiert“ dieses Konzept der trace. Bei Derrida geht es in erster Linie darum aufzuzeigen, wie in der jeweiligen Verwendung bestimmte Spuren aufleuchten, dabei für einen Moment Sinn suggerieren, bei weiterem „Hinsehen“ aber wieder verlöschen. Das Zeichen gewinnt eine momentane Stabilität, die aber immer wieder zerfällt, der Fluktuation preisgegeben wird. Der Leser, der davor nicht die Augen verschließt, sich nicht von der vermeintlichen (momentanen) Dauer petrifizieren läßt, verfolgt dieses Spiel vom Aufleuchten und Verlöschen von Sinn mit Verwirrung: Seine Suche nach Sinn, sein „Hunger nach Bedeutung“ bleibt unbefriedigt, wird frustriert. Aber von ihm (im Sinne Heideggers) „angestoßen“, folgt der Geist dieser oszillierenden Bewegung, dieser Flucht der Signifikation, in einem Zustand euphorischer Freude.44 Hillis Miller legt es darauf an, Texte und ihre Lesarten von innen heraus zu destabilisieren, indem er in einer akribischen philologischen Arbeit die in den Schlüsselbegriffen des Textes enthaltenen „Spuren“ freilegt, d.h. die semantischen De- und Konnotationen, die ein Wort aus seiner Etymologie und aus seinen vielfältigen Verwendungen in verschiedenen Sprachen in Paul de Man, „Shelley Disfigured“, in: The Rhetoric of Romanticism (New York 1984) 93-123. Mit meiner letzten Bemerkung im Text bezog ich mich auf 120f., vgl. dazu Allegories, 17. – Die „Gegenrichtung“ einer poststrukturalistischen Interpretation wird exemplifiziert durch Herman Rapaport, „Staging Mont Blanc“, in: Displacement: Derrida and After, ed. Mark Krupnick (Bloomington/Indiana 1983) 59-73, in der aus einer weitausgreifenden Zusammenschau von Artikulationen des psychoanalytischen Konzepts der „rahmenden“ (verhüllend-enthüllenden) Funktion von Traumbildern (mit kurzer, kaum nachvollziehbarer Summierung des Themas von Prometheus Unbound) eine Perspektive für eine Lacan folgende Interpretation des Gedichts entwickelt wird (Berg als „Bühne“ für die Inszenierung des verborgenen und ambivalenten - pleasure und terror, eros und thanatos involvierenden - Begehrens nach der Brust der Mutter), deren tatsächliche Substantiierung aus dem Gedichttext zwei Seiten umfaßt und sich auf eine einzige Passage – den Beginn von Teil III, Z. 49-61 – stützt, ohne Berücksichtigung des weiteren Kontexts - vor allem der hinführenden Teile I und II mit ihren Reflexionen zu Schlucht/Fluß und Geist (mind). 44 Derrida 1982, 23-27; vgl. Derrida 1988, 99-103. 43 9 sich trägt, d.h. die es jemals gehabt hat bzw. die der Philologe entdecken kann. Alle diese Bedeutungen sind jetzt gleichberechtigt präsent. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür findet sich in Millers berühmtem Aufsatz „The Critic as Host“.45 Miller geht hier von der Behauptung von M. H. Abrams aus, eine dekonstruktivische Lektüre eines gegebenen Textes sei „’plainly and simply parasitical’ on the obvious or univocal reading“. Dabei zitiert Abrams im ersten Teil seines Zitats Wayne Booth. Dieses Zitat im Zitat betrachtet Miller als Beispiel für eine prinzipiell endlose Kette, die er hier auf ihr Wesen hin befragen will. Dazu untersucht er in der besagten Weise die beiden Termini der behaupteten Opposition, host und parasite. Er zeigt in der Etymologie des Wortes host, etwa im Vergleich mit verwandten indoeuropäischen Wörtern, z.B. deutsch Gast, auf, daß dieses Wort die Merkmale Gastgeber und Gast gleichermaßen in sich trägt. Noch intensiver arbeitet er heraus, daß im Wort parasite das griechische Präfix para (neben) schon in sich, erst recht dann aber in seinen vielen Verbindungen, im Englischen etwa parachute, paraclete, parallel, paramedical etc. (Miller zählt 26 Beispiele auf), eine Grenzverwischung zwischen Jenseits und Diesseits, Außen und Innen, Ferne und Nähe, Ähnlichkeit und Differenz signalisiert. Schließlich nimmt Miller noch die Bedeutung von host als Eucharistie (sich jemandem zur Speise geben) hinzu sowie die Bedeutung von griechisch sitos als Korn, Getreide: Beide, Wirt und Parasit, sitzen neben dem Mahl, beide essen, beide könnten aber auch die Speise sein. Jetzt erkennen wir also endgültig: Beide Terme verlieren ihre Identität, beide enthalten die Merkmale des anderen in einer „osmotischen Mischung“, sind in sich voll von „uncanny antithetical relation ... a host is a guest and a guest is a host. A host is host.“ So sind denn auch die „eindeutige“ und die „dekonstruktivistische“ Lesart in ihrer Identität ununterscheidbar, „fellow guests ‘beside the grain’, host and guest, host and host, host and parasite, parasite and parasite.“46 Man beachte, wie Miller selbst hier mit der rhetorischen Potenz der Sprache arbeitet, wie er in dieser Reihung allein durch die Verschiebung der Terme die Bedeutung - und vielleicht auch die Orientierung des Lesers - ins Schwimmen bringt. Auch Miller betont wie Derrida den befreienden und euphorischen Charakter dieser Erfahrung der „unheimlichen“ Natur der Sprache: „ [...] the hyperbolic exuberance, the letting language go as far as it will take you. [...] the way the prison-house of language may be a place of joy, even of expansion in spite of remaining an enclosure and a place of suffering and deprivation.“47 Die dekonstruktivistische Lektüre Millers ist für jemanden, der damit nicht vertraut ist, verblüffend, provokativ, vielleicht in sich selbst „uncanny“; sie ist extrem erfindungs- und ressourcenreich, und sie setzt eine Kernidee des Dekonstruktivismus in eine genialische Lektüre um, für die Miller bekannt ist.48 Um Miller aber nicht nur um des Spiels willen zu folgen, muß man doch fragen, ob man sich seiner (und der dekonstruktivistischen) Auffassung von Semantik anschließen kann. Von einem die Polysemie begrenzenden Prozeß einer kontextuellen Monosemierung ist hier nicht mehr die Rede. Und es stellt sich die Frage: Sind die Referenzen und Konnotationen, die ein Wort in „der ganzen Familie der indoeuropäischen Sprachen und der gesamten Literatur und dem konzeptionellen Denken in diesen Sprachen“ hat und hatte, in dieser konkreten Verwendung in diesem englischsprachigen Ausdruck des 20. Jahrhunderts enthalten bzw. für seine Bedeutung J. Hillis Miller, „The Critic as Host“, in: Lodge 1988, 254-262; ursprünglich in Critical Inquiry 3 (1977). Miller 1988, 259. 47 Miller 1988, 259. Henriette Herwig bezeichnet diese euphorische Freude als typisch für den Dekonstruktivismus (Henriette Herwig, „Postmoderne Literatur oder postmoderne Hermeneutik“, Kodikas/Code: Ars Semiotica 13 (1990): 225-244; hier 227-229); Magliola dagegen bezeichnet genau diese Haltung als „absurd-tragischen Nihilismus“ (Magliola 1981; hier 85). 48 Vgl. M.H. Abrams, „The Deconstructive Angel“, in: Lodge 1988, 242-253; 250: Abrams spricht von „delight in his resourceful play of mind and language and the many and striking insights yielded by his wide reading and by his sharp eye for unsuspected congruities and differences in our heritage of literary and philosophical writing“ (250). 45 46 10 relevant? Dann allerdings sähe sich der philologische Ausgräber wahrhaftig einer unabschließbaren Aufgabe gegenüber. Mit dem Ausdruck prison-house of language nimmt Miller den Titel von Fredric Jamesons bekannter Kritik des Strukturalismus und Formalismus auf.49 In einem späteren Artikel stellt Jameson fest, daß sowohl der formalistische Strukturalismus als auch der „Neostrukturalismus“ die Wände des Gefängnisses der Sprache, aus denen nach Miller die dekonstruktivistische Lektüre den Leser entfliegen läßt, noch enger schließen, ja geradezu erst aufbauen.50 Für ihn ist die Euphorie des die Sprache manipulierenden Dekonstruktivisten eine autistische, selbstverliebte, unfruchtbare Freude, die an den Ästhetizismus anknüpft. Tatsächlich formulierte Walter Pater schon 1876: Experience, already reduced to a swarm of impressions, is ringed round for each one of us by that thick wall of personality through which no real voice has ever pierced on its way to us, or from us to that, which we can only conjecture to be without. Everyone of these impressions is the impression of an individual in his isolation, each mind keeping as a solitary prisoner its own dream of a world.51 Ein Überwinden dieser Mauern und eine wahre „Erweiterung“ des (lesenden) Individuums im Sinne einer Selbsttranszendierung ist für Jameson nur durch die Anerkennung der mimetischen, repräsentationalen oder referentiellen Funktion der Sprache möglich, trotz einer gesteigerten Komplexität der Repräsentationsmodelle. Am Ende von „The Critic as Host“ verweist Miller auf Shelleys „The Triumph of Life“, dessen Bedeutung für die dekonstruktivistische Lektüre wir schon sahen. Nach Miller „beherbergt“ es eine tief in die Geschichte reichende Reihe von sich überlagernden intertextuellen Verweisen, durch die es ebenso „destabilisiert“ wird wie durch seine unauflöslichen Widersprüche zwischen seiner „logozentrischen Metaphysik“ 52 (Neoplatonismus) und seinem Nihilismus. Nun ist die Schwierigkeit einer kohärenten Deutung dieses fragmentarischen Textes schon früher betont worden. Die letztgenannten Widersprüche, die sich bei Shelley immer wieder finden und zu kontroversen Interpretationen geführt haben, treten in „The Triumpf of Life“ tatsächlich besonders hervor; das Gedicht bleibt sprunghaft und – etwa hinsichtlich der Bedeutung der Figur Rousseaus – dunkel. Es hebt sich als Text aber eben dadurch deutlich von anderen ab, etwa von Prometheus Unbound, das gerade durch seinen hohen Grad an Integration heterogener poetischer und thematischer Elemente auffällt. Solche Unterschiede in der Qualität von Texten können aber, wie schon angesprochen, in der dekonstruktivistischen Lektüre nicht erkennbar werden; sie spielen keine Rolle, da es ja in jeder Textlektüre um die Aufhebung der Lesbarkeit geht.53 Wenden wir uns einer späteren, ausführlicheren Interpretation von „The Triumph of Life“ zu, der ich dann Millers Interpretation eines Gedichts von Thomas Hardy gegenüberstellen möchte, so wird noch deutlicher, wie durch die auf den Moment der Unlesbarkeit ausgerichtete immanente Lektüre so unterschiedliche Texte eingeebnet und entkontextualisiert werden und wie nahe diese letztendlich doch an einer hermeneutischen Interpretation bleiben. In seinen summarischen Bemerkungen zu „The Triumph of Life“ am Ende von „The Critic as Host“ verweist Miller auf das im Entstehen begriffene Shelley-Kapitel in seinem Buch The 49 Fredric Jameson, The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism (Princeton 1972). 50 Fredric Jameson, „Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism“, New Left Review 146 (1984): 53-92. 51 Walter Pater, The Renaissance: Studies in Art and Poetry (Berkeley/Los Angeles/London 1980) 187f. („Conclusion“) 52 Miller 1988, 261f. 53 So auch Rusterholz 1996, 168f.; Abrams 1988, 249. 11 Linguistic Moment.54 Hier arbeitet Miller die Ambivalenzen des Werkes - die z.B. durch die Fülle von sich ablösenden Bildern, durch die sich gegenseitig aufhebenden Oppositionspaare und durch strukturelle Ambiguitäten verursacht werden – detailliert heraus. Interessant ist aber, daß es letztlich gar nicht um eine wirkliche „Unlesbarkeit“ des Textes geht, sondern daß Miller in seiner durchaus kohärenten, und die einzelnen Elemente auf Kontexte beziehenden Deutung den Erweis erbringt, daß „The Triumph of Life“ ein proto-dekonstuktivistisches Gedicht ist. Die fast Heideggersche Interpretationsfrage lautet: Of what are all these repeated projections figures? What, for Shelley, is the base, the origin, or the goal that controls this internal and external play of substitutions? This question arises inevitably in the reader’s mind as he works his way into the poem and through it.55 Die paradoxe Antwort ist, daß dieser „Grund“ die Erfahrung der Grundlosigkeit der Sprache ist, die sich im fortwährenden Prozeß der Katachrese, der unendlichen substititiven metaphorischen Signifikation erweist, der sich der Kontrolle sowohl des Autors wie auch des Lesers (und des Interpreten) entzieht, da beide in der Sprache gefangen sind.56 In seiner Interpretation von Thomas Hardys Gedicht „In Front of the Landscape“ widmet sich Miller einem Text, dessen Zuordnung zum Realismus ebenso auf der Hand zu liegen scheint wie die für Hardy typische Thematik:57 die Vergänglichkeit menschlicher Beziehungen und die Tragik, die darin liegt, daß deren Wert immer erst zu spät erkannt wird. Der Sprecher begegnet auf der Wanderung zu Gräbern den anklagenden geisterhaften Gestalten der Toten. Miller beachtet den literaturhistorischen Kontext nicht, geht aber von dieser Thematik aus. Er arbeitet zwar eine Reihe von Ambivalenzen heraus, die vor allem durch elliptische Syntax entstehen, kommt aber dennoch immer wieder auf das genannte Thema zurück, auf das er sowohl die Bilder als auch die Metrik bezieht. Dennoch stellt er explizit die Einheit des Gedichts in Frage. Durch eine typische Sezierung des Wortes translation („they [...]/ show, too, with fuller translation than rested upon them./ As living kind“), das er von „Übersetzung“ zu „Mißverständnis“, „Übertragung“, „Metapher“, „Prosopopoeia“ verschiebt, lenkt er die Interpretation zur Aussage, daß das Gedicht nicht mehr ist als ein linguistisches Ereignis, das sich der Kontrolle des Autors und der Sinnsuche des Lesers entzieht, obschon die von ihm ausgehende Wirkung immer wieder Leser in ihren Bann schlagen und sie zur „Beschwörung“ (im Sinne von Prosopopoeia) einer „perception“ anregen wird. Folgt man diesem spekulativen Kreisen um das Wort translation nicht – hält man sich vielmehr an die, wie Miller selbst einräumt,58 kontextuell naheliegende Deutung, daß sich dem Sprecher der Wert der Beziehungen erst nach dem Tod klarer zeigt – und akzeptiert dementsprechend auch die im letzten Drittel des Aufsatzes erfolgende dekonstruktivische Wende nicht –, so bietet Miller hier durchaus eine hermeneutische Interpretation, in der er naheliegende und mögliche Erklärungen der Perspektivierung einer menschlichen Grunderfahrung für eine weitere Diskussion anbietet, die er am Schluß des Aufsatzes auch anzudeuten scheint. Hillis Miller und de Man wollen zeigen, daß der literarische Text nicht dekonstruiert wird, sondern sich selbst dekonstruiert. Die Lektüre offenbart nur dessen Unlesbarkeit. Damit wird der literarische Text zum Paradigma des Textes und der Sprache schlechthin, die diesen ihren 54 J. Hillis Miller, The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens (Princeton 1985) 114-179. Miller 1985, 131. 56 Vgl. bes. Miller 1958, 175-179. 57 J. Hillis Miller, „Topography and Tropography in Thomas Hardy’s ‚In Front of the Landscape‘“, in: Poststructuralist Readings of English Poetry, ed. Richard Machin und Christopher Norris (Cambridge 1987) 332-347. 58 Miller 1987, 343. 55 12 Charakter im Normalgebrauch verschleiern, zum Exempel also, das uns vor dem verblendenden oder verführenden Charakter der Sprache warnt. Darin sieht de Man auch die einzige didaktische Funktion von Literatur. Als Literatur werden von ihm eben die Texte definiert, die wegen ihrer Widerständigkeit diese Funktion erfüllen.59 Diese – in sich konsequente – Verabsolutierung des dekonstruktivistischen Konzepts von Text, Literatur und Lektüre ruft allerdings doch einige kritische Fragen hervor, die schon angeklungen sind, auf die ich hier im letzten Teil meines Beitrags etwas systematischer eingehen möchte. Eine naheliegende und auch öfters vorgetragene Kritik an der Dekonstruktion besteht darin, daß sie ihre eigene Theorie durch ihre logisch argumentierenden, interpretatorisch und analytisch demonstrierenden, um Stringenz bemühten und wohlgeformten Texte selbst widerlegt. Obschon Derrida sich mehr und mehr bemüht, diesen Stil zu durchbrechen, bleibt doch festzuhalten, daß die Dekonstruktion mit Nachdruck ein Kultur-, Sprach- und Textkonzept vertritt, das Gültigkeit beansprucht, ja das nicht mehr hintergehbar ist und insofern durchaus einen „metaphysischen“ oder „transzendenten“ Charakter hat und das etwa Derrida und besonders Hillis Miller mit beachtlichem Pathos vertreten. Auch erwies sich, daß de Man und Miller ihre These von der „Unlesbarkeit“ durch eine Lektüre demonstrieren, die in sich als hermeneutisch angesehen werden kann. Eine solche Kritik würde aber einen Dekonstruktivisten kaum treffen. Derrida selbst sagt, daß dieser auf die Sprache der traditionellen Philosophie zurückgreifen muß, da ihm keine andere zur Verfügung steht: „We cannot give up this metaphysical complicity without also giving up the critique we are directing against this complicity.“ 60 Und Gerald L. Bruns bezeichnet die Dekonstruktion als poetics of doublebind: „By its workings, any theory, position, discipline, or outlook, whether positive or negative, can be turned against itself in the very terms by which it is constituted“.61 Es läge eigentlich in der Logik der Sache, daß sich der Dekonstruktivismus selbst dekonstruieren müßte. Diese Kritik gleicht also mehr einem Ping-Pong-Spiel. Die sich daraus ergebenden, für uns essentiellen Fragen sind aber die, ob wir bei der (erforschenden und interpretierenden) Lektüre der Texte auf Verstehen überhaupt verzichten können und worin dieses bestehen kann, ob die dekonstruktivistische Lektüre wirklich „befreiend“ ist und was als Sinn oder Zweck der Lektüre, auch der literaturwissenschaftlichen Interpretation und Forschung, festgehalten werden kann und sollte. Man kann natürlich der Hermeneutik ihrerseits entgegenhalten, sie sei von Anfang an so auf „Bedeutung und Sinnproduktion“ angelegt, daß sie diese nicht verfehlen könne. Aleida Assmann, von der dieses Zitat stammt, fährt fort: Mit diesem Instrumentarium ist es keineswegs schwierig, Nicht-Sinn in Sinn zu übersetzen. Wer hermeneutisch liest, kann eigentlich gar nicht anders als harmoneutisch zu verfahren. So wie das Auge nach Plato sonnenhaft ist, ist das Auge des Interpreten eben sinnenhaft.62 59 Vgl. Paul de Man, Blindness and Insight (New York 1971) 136f. Derrida 1988, 92. Vgl. auch Linda Hutcheon, die auf das Paradox der antifoundationalist theory hinweist, doch ein fundamental annehmen muß, das sie mit einem Zitat aus einer Vorlesung von Stanley Fish wiedergibt: „Ye shall know that truth is not what it seems and that truth shall set you free“ (13). Anders formuliert: Die Dekonstruktion „demaskiert“ die Rhetorizität allen Wissens und beansprucht dennoch den Status eines „theoretischen Wissens“. Hutcheon weist aber auch darauf hin, daß sich die Dekonstruktivisten dieses Paradoxes oder dieser „Komplizenschaft“ selbst bewußt sind. 61 Gerald L. Bruns, „Structuralism, Deconstruction, and Hermeneutics“, Diacritics (1984): 12-23 (Rezension von J. Culler, On Deconstruction). 62 Assmann 1996, 14. 60 13 Man könnte auch Harro Müller heranziehen, der hermeneutisches Verstehen als „Sinnzentrierungspolitik mit [...] Heteronomiebeseitigungsverfahren“ bezeichnet.63 Aber: Gibt die dekonstruktivistische Lektüre dem Text wirklich seine Fremdheit, seine Andersheit, zurück? Setzt sie ihn wieder in sein Recht, statt ihn zu apropriieren? Dieser Vorwurf ist ja dem Verstehen in der Nachaufklärung immer wieder gemacht worden, und die Sorge gegenüber einem solchen zentrierenden und einverleibenden Verstehen ist der eigentliche Grund der dekonstruktivistischen Theorie. Bei dem erwähnten Treffen in Paris bemühte sich Gadamer, die „Macht des guten Willens“ im Verstehensprozess aufzuzeigen. In seiner Antwort interpretierte Derrida dies als den „guten Willen zur Macht“.64 Meine kritische Befassung mit der Theorie und der Praxis der Dekonstruktion im Hinblick auf den literarischen Text hat aber, wie ich hoffe, das Urteil von M.H. Abrams untermauert, daß bei der dekonstruktivistischen Lektüre das Ergebnis trotz aller überraschenden Details vollständig determiniert ist: And the uncanny critic, whatever the variousness and distinctiveness of the texts to which he applies his strategies, is bound to find that they all reduce to one thing and one thing only. In Miller’s own words: ‘Each deconstructive reading, performed on any literary, philosophical or critical text [...] reaches, in the particular way the given text allows it, the same moment of an aporia [...] the reading comes back again and again, with different texts to the same impasse’.65 Man fühlt sich in diesem Zusammenhang auch an Harold Blooms Konzept des strong reading erinnert. Ein solches Lesen ist nach Bloom immer ein misreading, das sich von vorherigen Lesarten absetzt und die Originalität des Lesers beweist (wobei Bloom wohl den professionellen Interpreten im akademischen Betrieb im Auge hat). „We read to usurp, just as the poet writes to usurp“, also um der Macht willen, die in der Befreiung von der Herrschaft früherer Stile (bezüglich des Autors) und früherer Interpretationen (bezüglich des Lesers) besteht. Bloom impliziert, daß es auch ein weak reading gibt, das sich den Text nicht aneignet, sondern sich ihm unterwirft, aber: „It is only the strong reader [...] whose readings will matter to others and to himself.“ Blooms Konzept des strong reading läuft also auf die Beherrschung des Textes durch den geschulten Interpreten hinaus, der seine Innovationskraft in der Dekonstruktion beweist.66 Damit wende ich mich der zweiten Frage, der nach der Natur des „Sinns“, der „Wahrheit“ des Textes, zu. Der Dekonstruktivismus weist uns eindringlich darauf hin, daß ein vom Text ablösbarer Sinn, eine Referenz auf eine textexterne Wahrheit oder Welt, eine in sich feste, wiederholbare Bedeutung eine Fiktion und eine instabile Konstruktion ist. Dies scheint ihm ein zentrales Anliegen zu sein, zum einen als ehrliche Antwort auf die postmoderne Mentalität, zum andern, um der Verfestigung einer Ideologie zum Zweck von Macht vorzubeugen. Nun wird aber die damit verbundene Behauptung, die Hermeneutik postuliere einen solchen Sinn in Form einer transzendenten, zeitlosen, hypostasierten oder reifizierten Wahrheit out there, die gefunden, vollständig formuliert und fixiert werden könnte, durch 63 Harro Müller, Giftpfeile: Zur Literatur und Theorie der Moderne (Bielefeld 1994) 23. Forget 1984, 56-58 und 62-77. Hinsichtlich Gadamers ebd. 24-55, bes. 38. 65 Abrams 1988, 249. So wie Abrams Miller selbst anführt, könnte man auch Paul de Man zitieren: „The allegory of reading narrates the impossibility of reading“ (Blindness and Insight, 77). 66 Harold Bloom, Agon: Towards a Theory of Revisionism (London 1982) 16,17, 24f., 35-43; A Map of Misreading (London 1975) 4. Dieselbe These von Kampf und Innovation unterliegt für Bloom der Geschichte der Literatur selbst; vgl. The Anxiety of Influence, 1973. Eine kritische Auseinandersetzung mit Bloom und der Dekonstruktion, in der der Innovationsdruck der Akademie eine Rolle spielt, findet sich bei Shusterman 1988, 403-405. 64 14 häufige Wiederholung nicht wahrer.67 Schon Schleiermacher spricht davon, daß „das Nichtverstehen sich niemals gänzlich auflösen will“; Grondin interpreteiert seine Universalisierung des Mißverständnisses als „Anleitung zum fortwährenden Weiterinterpretieren“ und bezeichnet das „Besserverstehen als unerreichbares Telos“.68 Gadamer bezieht sich mehrfach auf Heideggers Rede von der Als-Struktur des Verstehens – ich verstehe z.B. den Hammer als Werkzeug, als schwer, als untauglich etc. – und betont demzufolge, daß Verstehen immer auf die Bedeutung für uns gerichtet ist. Allerdings postuliert er ebenso, daß diese Bedeutung im Text angelegt ist, daß der Text „etwas sagen will“, was für mich gemeint ist. Letzteres schließt auch ein, daß, da wir durch Geschichte und menschliche Natur verbunden sind, dieses für mich Gemeinte ein uns Angehendes ist, und so ergibt sich, daß es nur durch den doppelten Dialog – mit dem Text und „mit anderen Denkenden“ – zu einem kontinuierlichen expandierenden Anwachsen des Verstehens kommen kann.69 Diese hermeneutische Grundidee impliziert also die Relevanz dieser Wahrheit für mich, daher ich sie auch „für mich“, in meinem Interesse, begreifen und ausarbeiten möchte, sie impliziert zum anderen die Rolle des Textes als Ausgangsort dieser mir zunächst noch „fremden Wahrheit“ und damit die von Jameson geforderte Selbstexpansion oder Selbsttranszendierung,70 und sie impliziert schließlich die Ausarbeitung dieser Wahrheit im Dialog mit den „Mitlesenden“, wie es Gadamer des öfteren mit Blick auf die historischgesellschaftliche Natur des Menschen und die Perspektivenvielfalt der „Lesenden“ (d.h. auch der vermittelnden Interpreten) fordert. Es wäre eine im Sinne von Jürgen Habermas zu „verhandelnde“ Wahrheit, und ein solcher hermeneutischer Ansatz könnte vielleicht tatsächlich einen Beitrag liefern zur Rückkopplung der Expertenkultur an die Lebenswelt und zum Brückenschlag zwischen Teilbereichen der Gesellschaft, wie sie Habermas für notwendig erachtet und wie schon von Dilthey gefordert, zur Aufhebung von Trennungen also, die ich durch Dekonstruktion oder Poststrukturalismus – die Habermas als neuen Konservativismus beurteilt – noch weiter getrieben sehe.71 Die Hermeneutik geht geradezu aus dem Wissen oder aus der Überzeugung hervor, daß eine solche relevante „Wahrheit“ im Sinne von empowering knowledge and understanding heute nicht gelehrt werden kann und auch nicht mehr Allgemeingut im Weltmodell der Gesellschaft ist. Sie gehört zu dem Bereich, den Paul Ricoeur disclosive behaviours nennt, die Welt schaffen und enthüllen (im Unterschied zu den sich auf alltäglich-praktische Situationen beziehenden disclosive behaviours). Zu ihnen zählt er die literarischen Werke, die „in ihren Strukturen gedeutete oder auf Deutung angelegte Welt“ vermitteln.72 In literarischen Werken liegt nach Ernst Bloch immer ein utopisches Moment, ein Vor-Schein menschlicher Möglichkeiten.73 In ihnen enthüllt sich die Geschichte des menschlichen Seins, „Sein, das sich erschließt“ nach Heidegger, in geschichtlicher Entfaltung.74 Im Bemühen um sein Verstehen entwerfen wir uns 67 Vgl. Madison 1991, 122f. und 129-132. Grondin 2001, 107; Schleiermacher 1958, 328. Vgl. Dilthey 1958, 214 und 220. 69 Gadamer in Forget 1984, 26 und 29: „Was beim Sprechen herauskommt, ist nicht eine bloße Fixierung von intendiertem Sinn, sondern ein beständig sich wandelnder Versuch oder besser, eine ständig sich wiederholende Versuchung, sich auf etwas einzulassen und sich mit jemandem einzulassen. 70 Vgl. Anm. 50. 71 Jürgen Habermas, „Untiefen der Rationalitätskritik“, in: Die neue Unübersichtlichkeit, Kleine politische Schriften V (Frankfurt/M. 1985) bes. 135. Ders. „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“, in : Wege aus der Moderne, ed. Wolfgang Welsch (Weinheim 1988) 177-192. Vgl. diese Arbeit S. 4. 72 Vgl. Michael Murray, „Poetic Sense and Poetic Reference“, Papers on Language and Literature 17 (1981): 53-61. 73 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 1954-1959. 74 Vgl. Vernon Gras, „Understanding, Historicity, and Truth“, Papers on Language and Literature 17 (1981): 48-53 (erster Beitrag zum Symposium „Hermeneutics, Post-Structuralism, and ‚Objective‘ Interpretation“); vgl. 49f.: „If truth is existence disclosing itself in time, we become aware that ‚worlds‘ are made, that they undergo 68 15 auf unsere Möglichkeiten hin, im „Rückschlag in unser Dasein wird dieses ein SeinKönnen“.75 Wenn wir Literatur im hermeneutischen Sinn lesen und studieren, erkunden wir die „Möglichkeiten des Seins“ - und seine Verhinderungen - in ihren geschichtlichen Manifestationen, die bedingenden Strukturen und die sich für uns eröffnenden Horizonte. Wir haben uns hier einer Dimension angenähert, die seit den späten 80er Jahren unter dem Begriff eines ethical turn in Literatur und Kritik diskutiert wird76. Die Frage nach einer ethischen Dimension von Literatur kann dabei kaum von der nach der hermeneutischen Dimension der Literaturwissenschaft abgelöst werden. Der Kontext der „Postmoderne“ verstärkt meine Überzeugung, daß diese Dimension nicht verloren gehen, und auch nicht aus dem Zentrum rücken sollte. Ich habe schon die Frage angeschnitten, ob das „Spiel der Signifikation“ oder die „hyperbolic exuberance [of] letting language go as far as it will take you“ nach Derrida oder den Yale Critics unendlich fortgesetzt werden könnten – wie es die Dekonstruktion selbst impliziert.77 Foucault bringt die „dezentrierende“ und gleichzeitig höchst individualistische Dimension der „Postmoderne“ in seiner Philosophie des Selbst zum Ausdruck, die Josef Früchtl mit dem Begriff „Ästhetik der Existenz“ bezeichnet: die im Bild des Künstlers zentrierte Vorstellung von der Verwirklichung des Selbstentwurfs des Individuums in einem frei gewählten und potentiell stets wechselnden „Lebensstil“.78 Diesem Selbst wird Tiefe und Kontinuität ebenso abgesprochen wie ein Telos („Mensch zu sein“), da dies Mittel der Fremdgestaltung wären.79 Früchtl legt Wert darauf, Foucault aus der Nähe des Hedonismus in die des Existenzialismus zu rücken, und die Rolle Foucaults im Kampf von Minoritäten und in der postkolonialen Debatte sind unbezweifelbar. Aber eignet sich dieses postmoderne Lebenskonzept wirklich als allgemeine Maxime? Woran orientiert der sich rein von innen (aber nicht aus einer ethisch besetzten „Tiefe“) generierte, freischwebende „Planentwurf“ des Menschen, oder hat dieser eine Orientierung nicht nötig? Schon die ambivalente Behandlung Foucaults bei Früchtl im Kontext des Existenzialismus, aber auch von Kierkegaards Konzeption des Lebenskünstlers und des Dandyismus des 19. Jahrhunderts sowie von kritischen Untersuchungen der postmodernen Erlebnis- und Vergnügungsgesellschaft durch Daniel Bell und Robert W. Bellah – sowie mit weniger pessimistischer Perspektive durch Gerhard Schulze – lassen erhebliche Zweifel daran aufkommen.80 Solche Zweifel bilden den Ausgangspunkt für Charles Taylors umfangreiche und gründliche historisch-kritische Untersuchung der Herausbildung und der Quellen des modernen Selbst und seiner Relation zu Moral und Ethik.81 Er zeigt die Unzulänglichkeit einer rein „prozessuralen“ Moraltheorie, die sich auf die einzelne Norm und deren Anwendung im Einzelfall konzentriert, ohne der Ebene der Ethik eine größere Bedeutung zuzusprechen.82 construction and destruction [...] Truth must always include this feature of self-understanding.“ “Literary criticism, while changing our relation to past works, also invariably changes us.” 75 Vgl. Anm. 19. 76 Eine überzeugende Diskussion dieses Begriffs unter den Aspekten der Notwendigkeit/Begründung und der methodischen Implikationen findet sich in Heinz Antor, „The Ethics of Criticism in the Age After Value“, in: Why Literature Matters: Theories and Functions of Literature, ed. Rüdiger Ahrens und Laurenz Volkmann (Heidelberg 1996) 65-85. 77 Vgl. Anm. 47 78 Josef Früchtl, Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil (Frankfurt/M. 1996) 130-134 und 149-156. 79 Früchtl 1996, 133. 80 Früchtl 1996, 137-148. Früchtl bezieht sich auf: D. Bell, Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus (Frankfurt/New York 1991); R.N. Bellah et al., Gewohnheiten des Herzens: Individuum und Gemeinschaft in der amerikanischen Gesellschaft (Köln 1987); G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart (Frankfurt/M./New York 1993). 81 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge/Mass. 1989). 82 Exponent einer solchen rationalistischen Begründungs- und Abwägungsethik ist R.M. Hare, Freedom and Reason (Oxford 1963): Indem wir die (möglicherweise konfligierenden) ethischen Normen, die Ansprüche an 16 Demgegenüber vertritt Taylor die letztlich aristotelische Konzeption, daß sowohl die Selbstverwirklichung des Menschen als auch sein moralisches Entscheiden und Handeln von seiner Vorstellung vom „guten Leben“ bedingt sind. Die übergeordnete und nach Taylor universale Norm ist die des Respekts vor dem Menschen als Menschen, was die Anerkennung der Möglichkeit für jeden einschließt, ein erfülltes („gutes“) Leben zu führen. Was dies impliziert, hängt vom Bild des Menschen von sich selbst ab. Der spezifischen Ausbildung und Realisierung der Normen liegt also eine komplexe Vorstellung vom Menschen und seiner Relation zu Gesellschaft und Universum zugrunde. Die Vorstellung vom „guten Leben“ ist für Taylor auch maßgeblich für die Herausbildung der Identität des Menschen. Sie bildet einen "ethischen Raum", dessen Bezugspunkte die Selbstverortung des Individuums ermöglichen, die wiederum das Maß seiner Orientierung – oder Orientierungslosigkeit darstellt.83 Die in der Konzeption des „guten Lebens“ enthaltenen Werte, Normen und Güter sind kulturell vermittelt, heute daher natürlich auch Gegenstand interkultureller Verhandlung.84 Was Taylors Studie in unserem Zusammenhang interessant macht, ist, daß er der Kunst und besonders der Literatur einen wesentlichen, ja einen zentralen Beitrag zu dieser Vermittlung beimißt. Sie leistet dies auf durchaus explizite (wie in der Kunst der Aufklärung) oder auf implizite Weise, was für die Literatur (und Malerei) seit der Romantik zutrifft. Taylor meint hier eine Kunst, die sonst nicht zugängliche „Wahrheit“ aufscheinen läßt, und zwar in den „transformierten“ Gegenständen (etwa der Natur) oder in dem „Raum“ der montageartig versammelten Gegenstände. Taylor spricht hier insgesamt von epiphanic art, entweder einer epiphany of being oder einer epiphany of interspaces (die er auch interspatial oder framing epiphanies nennt).85 Er nimmt hier Konzeptionen der romantischen und der modernen Dichtung auf. Bedenkenswert in unserem Zusammenhang ist, daß er einer in der geschichtlichen Entfaltung der Literatur selbst entwickelten Konzeption von Dichtung eine eminente Relevanz für die Gegenwart zuspricht, und das gerade unter dem Aspekt der Gegenwart als „Postmoderne“.86 Wir gehen noch einmal davon aus, daß die Vorstellungen vom „guten Leben“ kulturell vermittelt sind, daß aber die Zeit der großen, geschlossenen Weltmodelle vorbei ist. Was bedeutet das für das ethische Handeln und die Selbstbestimmung des Menschen? Zwar sind die uns überlieferten Werte wie Freiheit, Gleichheit, Mitmenschlichkeit weitgehend fraglos akzeptiert, die Begründungen jedoch, warum wir sie achten sollten, werden in den Bereich des Privaten abgedrängt, verfallen einem resignativen Relativismus oder einer desinteressierten Lethargie. – Dem programmatischen Relativismus der Dekonstruktion, so emanzipatorisch er angelegt ist, wirft Taylor in diesem Zusammenhang ein Höchstmaß an Selbstzentrierung (in paradoxem Gegensatz zur „Dezentrierung“ des Subjekts) vor, und damit auch die von Heidegger konstatierte „Seinsvergessenheit“ unserer Zeit.87 Taylor stellt dem die These gegenüber: „High standards need strong sources.“88 Angesichts eines fehlenden allgemein akzeptierten Sinn- und Normgefüges kann der Mensch darüber nicht „belehrt“ werden, auch würde eine solche Belehrung im Menschen keine unser Handeln stellen, konkret im jeweiligen Fall (wie sie im jeweiligen Fall realisiert würden) so vollständig wie möglich beschreiben und vergleichen, lassen sich stets – bis auf extrem seltene „tragische“ Ausnahmefälle – rationale Kriterien für eine moralische Entscheidung gewinnen. Früchtl widmet Hare aus einer kantianischen Perspektive eine erheblich positivere Würdigung als Taylor (Früchtl 1996, 331-348). 83 Taylor 1989, 3-110; zum letzten Punkt bes. 25-52. 84 U.a. Taylor 1989, 61f. 85 Taylor 1989, 305-494 und passim. Taylor entwirft ein umfassendes und differenziertes Bild von der Entwicklung der Kunst seit der Aufklärung. Zu unserem Aspekt vgl. bes. 456-487. 86 Diese Sicht ist nicht unumstritten. Vgl... 87 Taylor 1989, 487-493; der Bezug auf Heidegger findet sich dort nicht explizit. 88 Taylor 1989, 516. 17 Vitalität entfalten.89 „[...] Ways of seeing good which are still credible to us, which are powerful enough to sustain these [moral] standards“90 können nur erworben werden „through languages which resonate within him or her, the grasping of an order which is inseparably indexed to a personal vision“.91 Voraussetzung für eine solche „exploration of order through personal resonance“, die uns Güter wie die Würde des Menschen zu eminenten Werten macht, ist, daß wir mit solchen „moral schemes“, mit Vorstellungen des „guten Lebens“, in denen sich diese Werte zu einem konkreten Bild verbinden, in einen lebendigen Kontakt kommen, der in uns ein Echo auslöst. Dies bedeutet „a work of retrieval“. Taylor versteht seine Studie als solche, als „an attempt to uncover buried goods through rearticulation.“92 Und hier bildet die Kunst, die Taylor im weitesten Sinne epiphanic nennt, einen hervorragenden Ort der Begegnung. Taylor bezieht sich, was seine Auseinandersetzung mit Literatur und Kunst angeht, nicht explizit auf die Hermeneutik; doch läßt eine solche Sicht von Literatur nur eine Lektüre zu, welche ihr Sinnpotential durch eine für uns relevante, uns angehende oder für uns bedeutsame „Reartikulation“ aufschließt, uns zu einer Auseinandersetzung mit ihr befähigt und auch dem Gespräch der Sinnsuchenden zugänglich macht. (Ich wähle diesen Begriff bewußt). Dieser Dialog der Verstehen-Wollenden ist eine Dimension, um die man Taylors Erklärung der Rolle der Literatur ergänzen müßte. Hier aber bewegen wir uns auf dem hermeneutischen Weg. Dem hermeneutischen Prinzip widerspricht es keineswegs, die literarischen Texte in ihrem kulturellen Kontext zu studieren oder das Studium an bestimmten Fragestellungen auszurichten, die das Erkenntnisinteresse leiten und zur theoretisch-methodischen Fundierung unseres „Gesprächs mit dem Text“ werden, solange dieses Gespräch dialogisch ist, d.h. auch der Text zu seinem Recht kommt und er als künstlerische Einheit im Sinne von unit bestehen bleibt, als „System“ aufeinander bezogener – wenn auch möglicherweise disparater, hart montierter – Bestandteile. Die Einheit des Textes im Sinne der Annahme einer stets möglichen closure ist für die Hermeneutik – im Unterschied zu dem dem Organismuskonzept verpflichteten New Criticism – kein zentrales oder unverzichtbares Postulat. Auch postmoderne Texte können „sinnvoll“ hermeneutisch gelesen werden. Eine völlige Auflösung des Textbegriffs und auch des Konzepts von Literatur (und Literaturwissenschaft) in einer allgemeinen Kulturwissenschaft wäre allerdings auszuschließen; in ihr könnten sich die hier angedeuteten Potentiale des Textes in ästhetischer, ethischer und kommunikativer Hinsicht nicht erfüllen.93 Ich möchte dieses Plädoyer mit einem Blick auf T.S. Eliots Dichtungskonzept abschließen. Eliot postuliert eine Dichtung, in der im Diskurs ein Bewußtsein konstituiert wird, dessen Erleben, Erfahren und Deuten seiner Welt sich durch die scharf abgegrenzten, plastischen Bilder der Lebenswelt als objektiven Korrelaten vermittelt. Er weitet aber diese begrenzte Perspektive durch intertextuelle Bezüge auf unsere gesamte Kulturtradition, um dem Leser eine Expansion seiner Perspektive auf seine Gegenwart zu ermöglichen und um ihm kulturelle Versatzstücke (die ihrerseits historische Antworten auf gesellschaftliche Zustände und Probleme waren) für eine mögliche Sinnfindung und -lösung zu bieten. „These fragments I have shored against my ruin“, hofft der Sprecher am Ende von The Waste Land (430). Der Leser soll an einem Bewußtseinsprozeß teilnehmen, der durch Szenen der modernen Welt getrieben wird, er soll in die Tiefe der menschlichen Geschichte und Erfahrung geführt werden und schließlich zurück zu sich selbst. Die anfangs dargestellten Dimensionen des hermeneutischen Zirkels greifen hier ineinander, aber auf alle müßte sich 89 Taylor 1989, 512. Taylor 1989, 517. 91 Taylor 1989, 520. 92 Taylor 1989, 520. 93 Vgl. Hans-Robert Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik Bd. I: Versuche im Feld der ästhetischen Erfahrung (München 1977) 63; dazu Früchtl 1996, 48. 90 18 der Leser einlassen, der der Einladung des Sprechers am Anfang von „The Love Song of Alfred J. Prufrock“ folgen will: „Let us go then, you and I [...]“. Auf diesem Wege mag der Text sich als widerständig und verlockend zugleich erweisen und so seine Rolle als Dialogpartner ausspielen, vielleicht als Gewirr von Streets that follow like a tedious argument Of insidious intent To lead you to an overwhelming question. (8-10)94 Auf jeden Fall wird er ausreichend Gelegenheit haben, durch sprachlich-formale Analyse und ästhetisches Mitschwingen der „Selbstpräsenz“ des Textes gerecht zu werden, zu literaturund kulturhistorischer Forschung, und er wird sich dazu aufgerufen fühlen, den Text als denkendes, erfahrendes und geschichtliches Wesen zu „verstehen“, auf eine für ihn relevante Weise zu interpretieren, als Individuum und als Mitglied einer „Gemeinde“, in unserem Falle vielleicht der oft beschworenen interpretive community. 94 T.S. Eliot, Collected Poems (London 1963) 13 und 79. 19