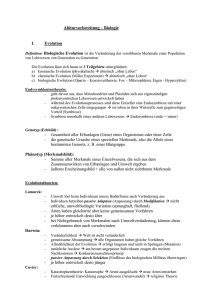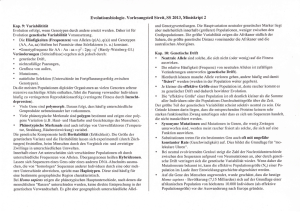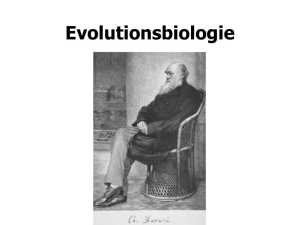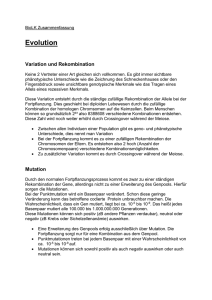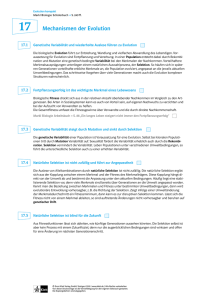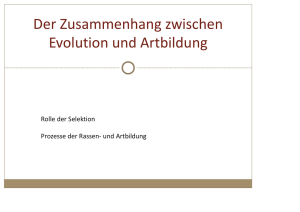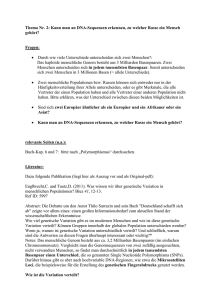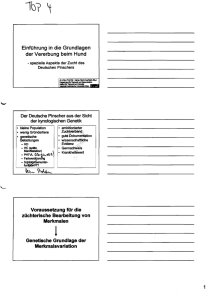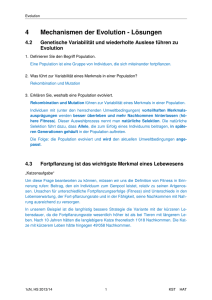Kapitel 21: Die Evolution von Populationen
Werbung

Kapitel 21: Die Evolution von Populationen (englische Version: Kap. 23) Die Synthetische Evolutionstheorie integrierte den Darwinismus und den Mendelismus: Wie Forschung funktioniert Die Entstehung der Arten überzeugte die meisten Biologen davon, dass Organismenarten Produkte der Evolution sind; die Behauptung, die natürliche Selektion sei der Mechanismus der Evolution, blieb aber auf der Strecke. Darwin selber hatte keine Erklärung für seine Hypothese, denn er verfügte nicht über Genetikkenntnisse. Sein Zeitgenosse Mendelson hätte ihm das fehlende Puzzlestück zu seiner Theorie liefern können, leider schenkte man aber seinen Entdeckungen keine grosse Beachtung zu dieser Zeit. Als Mendels Forschungsartikel zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt und neu bewertet wurden, glaubten viele Genetiker komischerweise, die Gesetze der Vererbung stünden nicht in Einklang mit Darwins Theorie der natürlichen Selektion. Das Verwirrende war, dass sie noch nicht wussten, dass Merkmale nicht nur von einem einzigen Gen abhängig sind, sondern auch mit anderen Genen gekoppelt sein können. Während der 20er Jahre glaubte man, dass die Evolution in raschen Sprüngen geschehe, hervorgerufen durch radikale Veränderungen im Phänotyp infolge von Mutationen. Viele vertraten auch die Theorie der „Orthogenese“. Diese Theorie besagt, dass die Evolution ein vorhersehbarer Fortschritt zu immer perfekteren Lebensformen sei. Ein bedeutender Wendepunkt für die Evolutionstheorie war die Geburt der Populationsgenetik, welche die genetische Variabilität innerhalb einer Population hervorhebt und quantitative Merkmale berücksichtigt. Mit den Fortschritten in der Populationsgenetik in den 30er Jahren wurden der Darwinismus und der Mendelismus in Einklang gebracht und die genetische Basis von Variabilität und natürlicher Selektion erarbeitet. Zu Beginn der 40er Jahre wurde eine umfassende Theorie der Evolution erstellt, die als Synthetische Evolutionstheorie bekannt wurde. Sie vereinigt Ideen und Entdeckungen aus folgenden Wissenschaftsbereichen: Paläontologie, Taxonomie, Biogeographie und Populationsgenetik. Die Synthetische Evolutionstheorie betont die Bedeutung der Populationen als Einheiten der Evolution, die zentrale Rolle der natürlichen Selektion als wichtigster Mechanismus der Evolution und die des Gradualismus zur Erklärung dafür, wie grosse Veränderungen als Anhäufung kleiner Veränderungen über lange Zeiträume evolvieren können. 1 Eine Evolution weist eine genetische Struktur auf, die durch die Alle- und Genotypfrequenzen ihres Genpools definiert ist Population: eine lokal begrenzte Gruppe von Individuen, die derselben Art angehören Art: Gruppe von Populationen, die sich in der Natur potentiell fortpflanzen können Es kann vorkommen, dass eine Population von den anderen Populationen derselben Art isoliert ist und mit diesen nur selten genetisches Material austauscht. Besonders häufig ist eine solche Isolation bei Populationen, die auf entlegene Inseln, nicht miteinander verbundene Seen oder durch Tiefländer getrennte Gebirgszüge beschränkt sind. Ein dichtes Populationszentrum kann aber fliessend in ein zweites übergehen, wobei in der Zwischenregion die Vertreter der Art weniger zahlreich sind. Obwohl die Populationen also nicht getrennt sind, sind die Individuen dennoch auf Zentren konzentriert und pflanzen sich wahrscheinlich eher mit Mitgliedern derselben Population fort als mit Vertretern anderer Populationen. Den Gesamtbestand an Genen in einer Population zu einem bestimmten Zeitpunkt bezeichnet man als Genpool der Population. Sofern alle Vertreter einer Population homozygot für dasselbe Allel sind, bezeichnet man dieses Allel als im Genpool fixiert. Es gibt jedoch öfter zwei oder mehr Allele für ein Gen, von denen jedes in einer relativen Populationsgenetiker verwenden den Begriff Frequenz (Häufigkeit) im Genpool vorkommt. genetische Struktur zur Bezeichnung der Allel- und Genotypfrequenzen einer Population. Das Hardy-Weinberg-Gesetz beschreibt eine nicht evolvierende Population Die Genetik einer nicht evolvierenden Population wird im Hardy-Weinberg-Gesetz beschrieben. Es sagt aus, dass die Frequenzen von Allelen und Genotypen im Genpool einer Population über Generationen konstant bleiben, solange nicht andere Faktoren als die geschlechtliche Rekombination auf sie einwirken. Anders ausgedrückt, das sexuelle Vermischen der Allele bei der Meiose und der zufälligen Befruchtung wirkt sich nicht auf die genetische Gesamtstruktur einer Population aus. Für einen Genort, bei dem nur zwei Allele in einer Population auftreten, verwenden die Populationsgenetiker den Buchstaben p für die Frequenz des einen Allels und den Buchstaben q für die Häufigkeit des anderen. Beispielsweise in einer Wildblumenpopulation können p = 0,8 und q = 0,2 sein. p steht für die Frequenz des dominanten Allels A und a für diejenige des rezessiven Allels. Die kombinierte Häufigkeit aller möglichen Allele muss 100 Prozent der Gene dieses Genortes in der 2 Population ausmachen (p + q = 1). Wenn es nur zwei Allele gibt und man die Häufigkeit des einen kennt, kann man die Frequenz des anderen berechnen: Wenn p + q = 1, dann ist 1 – p = q oder 1 – q = p Kombinieren Gameten ihre Allele, um Zygoten zu bilden, beträgt die Wahrscheinlichkeit für die Bildung eines AA Genotyps p². Die Wahrscheinlichkeit, dass eine A-Spermazelle eine A-Eizelle befruchtet und eine AA-Zygote bildet, beträgt p² oder 0,8 x 0,8 = 0,64 (= 64%). Die Häufigkeit von Individuen, die für das andere Allel (aa) homozygot sind, beträgt q² oder 0,2 x 0,2 = 0,04 (= 4%). Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Aa-Genotypen entstehen können, je nachdem, welcher Elternteil das dominante Allel weitergibt. Daher liegt die Frequenz der heterozygoten Individuen in der Population bei 2pq = 0,32 (= 32%). Wenn man die Häufigkeit aller möglichen Genotypen richtig berechnet hat, dann sollten sie zusammenaddiert Eins ergeben: p² + 2pq + q² = 1 (= 100%) Für unsere Wildblumen lautet diese Gleichung 0,64 + 0,32 + 0,04 = 1. Mikroevolution ist ein Wandel in den Genotypfrequenzen einer Population von Allel- oder Generation zu Generation Weichen die Allel- oder Genotypfrequenzen von den nach der Hardy-Weinberg-Gleichung zu erwartenden Werten ab, so evolviert die Population. → Evolution ist der Wandel in den Allel- oder Genotypfrequenzen von Generation zu Generation – ein Wandel in der genetischen Struktur einer Population. Weil ein solcher Wandel in einem Genpool Evolution im kleinsten Massstab ist, bezeichnet man ihn als Mikroevolution. Sofern eine Population von den folgenden fünf Bedingungen abweicht, die für die Erhaltung des Hardy-Weinberg-Gleichgewichts in einer Population erforderlich sind, evolviert sie: 1. Eine sehr grosse Population 2. Isolation von anderen Populationen 3. Keinerlei Mutationen 4. Völlig zufällige Paarungen 5. Keine natürliche Selektion 3 Genetische Drift kann über zufällige Schwankungen im Genpool einer kleinen Population Evolution bewirken Je kleiner eine Stichprobe ist, desto grösser sind die Zufallsabweichungen von einem idealisierten Ergebnis. Wenn eine neue Population von Organismen ihre Allele nach dem Zufallsprinzip erhält, wird sie den Genpool der vorherigen Generation um so genauer repräsentieren, je grösser die Population ist. Bei einer kleinen Population hingegen kann der existierende Genpool in der nächsten Generation aufgrund eines Zufallsereignisses nicht genau repräsentiert werden. Das nennt man Mikroevolution durch genetische Drift – Veränderungen im Genpool einer Population aufgrund des Zufalls. Zwei Situationen können zu Populationen führen, die klein genug für eine genetische Drift sind: der sogenannte Flaschenhalseffekt und der Gründereffekt. Der Flaschenhalseffekt Der Flaschenhalseffekt ist die unselektive Vernichtung von Individuen einer Population infolge von Katastrophen. Das kann zur Folge haben, dass die genetische Ausstattung der Überlebenden die ursprüngliche Population nicht mehr genau repräsentiert. Flaschenhalseffekte und die darauffolgende genetische Drift verringern in der Regel die genetische Variabilität einer Population insgesamt, weil die Allele für zumindest einige Genorte wahrscheinlich aus dem Genpool verloren gehen. Der Gründereffekt Genetische Drift in einer neuen Kolonie bezeichnet man als Gründereffekt. Je kleiner die Stichprobe, desto weniger wird die genetische Ausstattung der Besiedler den Genpool der grösseren Population repräsentieren, von der sie stammen. Der extremste Fall wäre die Gründung einer neuen Population durch ein trächtiges Weibchen oder einen einzelnen Pflanzensamen. 4 Genfluss kann durch Übertragung von Allelen zwischen Populationen Evolution bewirken Eine Population kann durch Genfluss – einen genetischen Austausch aufgrund von Wanderungen fruchtbarer Individuen oder Gameten zwischen Populationen – Allele hinzugewinnen oder verlieren. Genfluss verringert tendenziell die Unterschiede, die sich zwischen Populationen infolge natürlicher Selektion oder genetischer Drift angesammelt haben. Ist der Genfluss intensiv genug, kann er letztendlich benachbarte Populationen zu einer einzigen Population mit einer gemeinsamen genetischen Struktur vermischen. Mutationen können Evolution auslösen, indem in einem Genpool ein Allel durch ein anderes ersetzt wird Eine Mutation an einem bestimmten Genort ist ein sehr seltenes Ereignis. Mutationsraten variieren zwar je nach Organismenart und Genlocus, doch unter natürlichen Bedingungen ist eine Rate von einer Mutation pro Genort pro 10⁵ bis 10⁶ Gameten typisch. Ist ein Allel mit einer Häufigkeit von 10⁻⁵ Mutationen pro Generation zu einem anderen Allel, dann wären 2000 Generationen erforderlich, um die Frequenz des ursprünglichen Allels von 0,50 auf 0,49 zu reduzieren. Noch weniger wäre der Genpool betroffen, wenn die Mutation reversibel ist, was für die meisten zutrifft. Wenn irgendein neues, durch eine Mutation entstandenes Allel seine Häufigkeit in einer Population signifikant erhöht, geschieht dies, weil die Träger des mutierten Allels infolge natürlicher Selektion oder genetischer Drift eine unverhältnismässig grosse Zahl an Nachkommen hervorbringen. Nichtzufällige Paarungen können zu Evolution führen, indem sie die Häufigkeit von Genotypen in einem Genpool verschieben Um das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht zu halten, müsste ein Individuum seine Geschlechtspartner völlig zufällig aus der Population auswählen. In Wirklichkeit paaren sich aber die Individuen häufiger mit engen Nachbarn als mit weiter entfernten Mitgliedern der Population. Die 5 räumliche Nähe fördert also Inzucht – Paarungen zwischen nahe verwandten Partnern. Der extremste Fall der Inzucht ist die besonders bei Pflanzen häufige Selbstbefruchtung. Inzucht hat zur Folge, dass sich die relative Frequenz der Genotypen in den kommenden Generationen verändert. Die Häufigkeit homozygoter Genotypen kann sich beispielsweise auf Kosten heterozygoter erhöhen. Eine andere Konsequenz kann sein, dass sich bei einem grösseren Anteil von Individuen rezessive Phänotypen zeigen. Die Werte für p und q, die Gesamthäufigkeiten der beiden Allele, bleiben gleich. Eine weitere Form der nichtzufälligen Paarung ist die assortative Paarung, auch sortengleiche oder übereinstimmende Paarung genannt, bei der Individuen Partner auswählen, die ihnen in bestimmten phänotypischen Merkmalen entsprechen. Die genetische Struktur einer Population ist durch die Häufigkeit ihrer Allele und Genotypen definiert. Folglich können Inzucht oder assortative Paarungen, indem sie die Frequenz verschiedener Genotypen verschieben, zur Evolution einer Population führen. Die natürliche Selektion kann über einen unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg verschiedener Mitglieder einer Population Evolution bewirken Populationen bestehen aus unterschiedlichen Individuen, und in der Regel hinterlassen manche von ihnen mehr Nachkommen als andere. Dieser unterschiedliche Fortpflanzungserfolg ist natürliche Selektion. Die Selektion führt dazu, dass Allele in einer Anzahl an die nächste Generation weitergegeben werden, die nicht ihrer relativen Häufigkeit in der gegenwärtigen Generation entspricht. Die natürliche Selektion häuft vorteilhafte Genotypen in einer Population an und erhält sie. Sollte sich die Umwelt verändern, reagiert die Selektion und begünstigt nun Genotypen, die an die neuen Bedingungen angepasst sind. 6 Genetische Variabilität ist die Grundlage für die natürliche Selektion Welches Ausmass hat die genetische Variabilität innerhalb und zwischen Populationen? Individuelle Variation tritt in Populationen aller sich sexuell fortpflanzenden Arten auf. Diese feine Unterschiede zwischen Individuen einer Population sind jene Variabilität, über die Darwin am meisten als das Ausgangsmaterial für die natürliche Selektion schrieb. Sowohl qualitative als auch quantitative Merkmale tragen zur Variabilität in einer Population bei. Die meiste erbliche Variabilität besteht aus polygenen Merkmalen, die quantitativ in einer Population variieren. Die Grösse von Pflanzen z. B. könnte kontinuierlich variieren von ganz kleinen bis hin zu sehr hohen Individuen. Qualitative (diskrete) Merkmale, wie rosa oder weisse Blüten, variieren normalerweise nicht kontinuierlich, weil sie durch einen einzigen Genlocus mit unterschiedlichen Allelen bestimmt werden, die zu abweichenden Phänotypen führen. Polymorphismus (das Auftreten polymorpher Merkmale) Wenn zwei oder mehr Formen eines Merkmals (diskrete Variation) in einer Population vertreten sind, bezeichnet man diese als Morphen. Man nennt eine Population polymorph für ein Merkmal, wenn zwei oder unterschiedliche Morphen jeweils in ausreichend hoher Häufigkeit repräsentiert sind, um sie ohne weiteres zu bemerken. Ermitteln der genetischen Variabilität Populationsbiologe verwenden mehrere quantitative Definitionen für genetische Variabilität. Zwei häufige Masse sind der Prozentsatz der Genorte, die in einer Population von zwei oder mehr Allelen repräsentiert sind, sowie der durchschnittliche Prozentsatz von Genorten, die bei den Individuen einer Population heterozygot sind. Die Variabilität ist morphologisch grösstenteils unsichtbar, doch sie manifestiert sich in molekularen Unterschieden, die durch biochemische Methoden nachweisbar sind. Eine beliebte Methode, um bei den Individuen einer Population Variationen in den Proteinprodukten bestimmter Genloci zu untersuchen, ist die Elektrophorese. Solche Variationen repräsentieren unterschiedliche Allele an einem Locus. 7 Geographische Variation Die meisten Arten zeigen eine geographische Variation, also Unterschiede in der genetischen Struktur zwischen Populationen. In lokal begrenztem Massstab kann geographische Variation auch innerhalb einer Population auftreten, entweder, weil ihr Lebensraum eine fleckenhaft verteilte Variabilität aufweist, oder, weil sich die Population aufgrund einer begrenzten Ausbreitung der Individuen in Unterpopulationen gliedert. Ein bestimmter Typ geographischer Variation, eine sogenannte Cline, ist die kontinuierliche Veränderung entlang einer geographischen Achse, also ein Merkmalsgradient. In manchen Fällen kann eine Cline durch graduelle Überlappung benachbarter Populationen zustande kommen, deren Mitglieder sich untereinander kreuzen. In anderen Fällen kann die Abstufung eines abiotischen Umweltfaktors zu einer Cline führen. Wie entsteht genetische Variabilität? Mutation und sexuelle Rekombination sind die beiden Prozesse, die genetische Variabilität erzeugen. Mutation: Neue Allele entstehen nur durch Mutation. Eine Mutation, die sich auf irgendeinen Genort auswirkt, ist ein seltenes und zufälliges Ereignis. Die meisten Mutationen treten in somatischen Zellen auf und verschwinden mit dem Tod des Individuums. Nur Mutationen, die in Zell-Linien, die Keimzellen produzieren, können an Nochkommen weitergegeben werden. Beim Menschen kommt etwa auf alle 100'000 bis 200'000 Genreplikationen eine Mutation. Da der Mensch ungefähr 100'000 Genorte oder eine diploide Zahl von 200'000 Genen besitzt, trägt jede Person im Schnitt ein oder zwei mutierte Allele. Die meisten Punktmutationen – jene, die eine einzige Base in der DANN betreffen – sind vermutlich relativ harmlos. Ein Grossteil der DNA von Eukaryoten codiert keine Proteinprodukte, und es ist unwahrscheinlich, dass sich die Änderung eines einzelnen Nucleotids in diesen Intronregionen negativ auf das Lebewesen auswirkt. Sogar Mutationen an Strukturgenen, die Proteine codieren, können mit geringem oder überhaupt keiner Wirkung für den Organismus auftreten. In seltenen Fällen vermag ein mutiertes Allel seinen Träger besser an seine Umwelt anzupassen und den Fortpflanzungserfolg eines Individuums zu steigern. In einer stabilen Umwelt ist dies nicht besonders wahrscheinlich; wenn sich aber die Umwelt verändert, können sich Mutationen, die bisher von der Selektion ausgelesen wurden, auf einmal als vorteilhaft erweisen. Die Verdoppelung von Chromosomen ist wie andere Chromosomenmutationen beinahe immer nachteilig. Stört der wiederholte Abschnitt die Entwicklung jedoch nicht, so kann er über Generationen hinweg bestehen bleiben und zu einem erweiterten Genom mit zusätzlichen Genorten führen, die schliesslich vielleicht durch Mutation neue Funktionen übernehmen können. Neue Gene 8 können auch aus existierenden DNA-Abschnitten durch Vermischen der Exons innerhalb des Genoms entstehen. Bei Bakterien und anderen Mikroorganismen mit sehr kurzer Generationszeit können Mutationen sich in relativ kurzer Zeit beachtlich auf die Variabilität einer Population auswirken. Bakterienpopulationen können aufgrund der explosiven ungeschlechtlichen Vermehrung von Klonen (nicht weniger als eine Teilung alle 20 min), die durch die lokale Umwelt begünstigt werden, durch eine einzige Mutation evolvieren. Die genetische Variabilität von Tieren und Pflanzen hängt weitgehend von der sexuellen Rekombination. Doch auch die meisten Bakterien steigern ihre Genetische Variabilität, indem sie gelegentlich miteinander Gene austauschen und diese so neu kombinieren. Rekombination: Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung werden Allele neu kombiniert und nach dem Zufallsprinzip verteilt; auf diese Weise entstehen neue individuelle Genotypen. Während der Meiose tauschen homologe Chromosomen durch Crossing-over einige ihrer Gene aus, und danach verteilen sich die homologen Chromosomen zufällig auf verschiedene Gameten. Deshalb variieren die Gameten eines Individuums stark in ihrer genetischen Ausstattung, und jede aus einer Befruchtung hervorgehende Zygote enthält infolge der zufälligen Vereinigung einer Sperma- mit einer Eizelle eine einzigartige Ansammlung von Allelen. Wie wird die genetische Variabilität erhalten? Diploidie: Rezessive Allele, die weniger vorteilhaft sind als ihre dominanten Gegenstücke – oder in der gegenwärtigen Umwelt sogar nachteilig – können aufgrund ihrer Ausbreitung durch heterozygote Individuen in einer Population überdauern. Diese latente Variabilität ist der Selektion nur dann unterworfen, wenn zwei gleiche rezessive Kopien eines Allels in einer Zygote zusammenkommen. Je seltener das rezessive Allel ist, desto grösseren Schutz geniesst es durch die Heterozygotie. Beträgt die Frequenz des rezessiven Allels beispielsweise 0,01 und die des dominanten Allels 0,99, dann sind 99% der Kopien des rezessiven Allels in Heterozygoten vor der Selektion geschützt, und nur 1% der rezessiven Allele ist in Homozygoten vorhanden. In Heterozygoten verbirgt sich ein riesiger Genpool von Allelen, die für die gegenwärtig herrschenden Bedingungen vielleicht nicht geeignet sind, die aber neue Vorteile bringen könnten, sobald sich die Umwelt ändert. Balancierter Polymorphismus: Die Selektion selbst kann die Variabilität an einigen Genorten bewahren. Diese Fähigkeit der natürlichen Selektion, die Diversität einer Population zu erhalten, bezeichnet man als balancierten Polymorphismus. Einer der Mechanismen für diese Erhaltung der Variation ist der Heterozygotenvorteil (Heterosiseffekt). Wenn Individuen, die für einen bestimmten Genort heterozygot sind, eine bessere Überlebenschance und einen grösseren Fortpflanzungserfolg haben als jegliche Formen von Homozygoten, bleiben durch die natürliche Selektion zwei oder mehr Allele an diesem Locus erhalten. 9 Eine fleckenhafte Umwelt, in der die natürliche Selektion in verschiedenen Teilregionen innerhalb der geographischen Grenzen einer Population unterschiedliche Genotypen begünstigt, kann ebenfalls zu einem balancierten Polymorphismus führen. Ein weiterer Grund für einen balancierten Polymorphismus ist die häufigkeitsabhängige Selektion, bei welcher der Fortpflanzungserfolg irgendeiner Morphe zurückgeht, wenn dieser Phänotyp in der Population zu häufig wird. Die natürliche Selektion ist der Mechanismus der adaptiven Evolution Adaptive Evolution ist eine Mischung aus Zufall und Auslese – Zufall bei der Entstehung neuer genetischer Variationen durch Mutation und sexuelle Rekombination, Auslese dagegen beim Einwirken der Selektion, wenn diese die Ausbreitung einiger Varianten gegenüber anderen begünstigt. So erhöht die natürliche Selektion die Häufigkeiten bestimmter Genotypen und passt Lebewesen an ihre Umwelt an. Fitness Die Darwin-Fitness, das entscheidende Mass für die Selektion, ist der relative Beitrag eines Individuums zum Genpool der nächsten Generation. Populationsgenetiker definieren die relative Fitness als den Beitrag eines Genotyps zur nächsten Generation im Vergleich zu den Beiträgen alternativer Genotypen. Überleben allein garantiert keinen Fortpflanzungserfolg. Doch Überleben ist natürlich eine Voraussetzung für die Fortpflanzung, und Langlebigkeit erhöht die Fitness, sofern sie dazu führt, dass bestimmte Individuen eine überdurchschnittliche hohe Zahl von Abkömmlingen hinterlassen. Ausserdem könnte ein Individuum, das schnell geschlechtsreif und in einem frühen Alter bereits fruchtbar wird, ein grösseres Fortpflanzungspotential haben als Individuen, die länger leben, aber später heranreifen. Somit sind die Komponenten der Selektion all die Faktoren, die sich sowohl auf das Überleben als auch auf die Fruchtbarkeit auswirken. Worauf wirkt die Selektion ein? Ein Lebewesen setzt seinen Phänotyp – seine körperliche Merkmale, seinen Stoffwechsel, seine Physiologie und sein Verhalten – und nicht seinen Genotyp der Umwelt aus. Durch ihre Einwirkung auf 10 Phänotypen passt die Selektion eine Population an deren Umwelt an, indem sie vorteilhafte Genotypen im Genpool zunehmen lässt oder erhält. Die relative Fitness eines Genotyps an irgendeinem Genort hängt von dem gesamten genetischen Umfeld ab, in dem er wirkt. Beispielsweise sind Allele, welche die Wachstumsgeschwindigkeit des Stammes und der Äste eines Baumes steigern, unter Umständen nutzlos oder sogar nachteilig, wenn keine Allele an anderen Loci vorhanden sind, welche die Wachstumsrate der Wurzeln steigern, die notwendig sind, um den Baum zu tragen. Andererseits bleiben Allele, die nichts zum Erfolg eines Lebewesens beitragen oder sogar eine geringfügig schlechtere Anpassung bewirken, vielleicht erhalten, weil Individuen mit hoher Gesamtfitness sie tragen. Wirkungsweisen der natürlichen Selektion Die natürliche Selektion kann sich auf die Häufigkeit eines Merkmals in einer Population auf drei unterschiedliche Weisen auswirken. Diese drei Formen der Selektion bezeichnet man als stabilisierende, gerichtete und disruptive Selektion. Die stabilisierende oder optimierende Selektion wirkt gegen extreme Phänotypen und begünstigt die gewöhnlicheren, dazwischenliegenden Varianten. Diese Form der Selektion verringert die Variabilität den gegenwärtigen Zustand für ein bestimmtes phänotypisches Merkmal. Die gerichtete Selektion ist am häufigsten in Zeiten von Umweltveränderungen, oder wenn Vertreter einer Population in einen neuen Lebensraum mit anderen Umweltbedingungen abwandern. Sie verschiebt die Häufigkeitskurve für Variationen eines phänotypischen Merkmals in die eine oder andere Richtung, indem sie zunächst relativ seltene Individuen begünstigt, die für dieses Merkmal vom Durchschnitt abweichen. Die disruptive Selektion ist vermutlich ein eher seltenes Phänomen. Sie tritt auf, wenn sich Umweltbedingungen auf eine Weise ändern, die Individuen an beiden Extremen eines phänotypischen Spektrums gegenüber den dazwischenliegenden Phänotypen begünstigt. Sexuelle Selektion Zwischen Männchen und Weibchen vieler Tierarten gibt es neben ihren primären Geschlechtsmerkmalen, den typischen Fortpflanzungsorganen, weitere deutliche Unterschiede, die sog. sekundären Geschlechtsmerkmale. Ein solch abweichendes Erscheinungsbild von Männchen und Weibchen bezeichnet man als Sexualdimorphismus oder Geschlechtsdimorphismus. Oft äussert sich dieser als Grössenunterschied. Sexualdimorphismus umfasst aber auch Merkmale wie farbenprächtiges Gefieder bei männlichen Vögeln, Mähnen bei Löwenmännchen, Geweihe bei männlichen Hirschen und andere Zierden Zahlreiche sekundäre Geschlechtsmerkmale scheinen in allgemeiner Hinsicht nicht adaptiv zu sein; ein Prachtgefieder hilft männlichen Vögeln vermutlich nicht, mit ihrer Umwelt besser zurechtzukommen, und lockt unter Umständen sogar Feinde an. Wenn solche Aufmachungen dem 11 Individuum jedoch helfen, einen Partner zu finden, werden sie begünstigt, weil sie den Fortpflanzungserfolg steigern. In vielen Fällen stellt Sexualdimorphismus ein Kompromiss zwischen sexueller und adaptiver Selektion. Bei manchen Arten erfüllt das Geschlechtsmerkmal eine doppelte Funktion, indem es auch noch als Anpassung an die Umwelt dient. So kann ein Hirsch beispielsweise sein Geweih dazu benutzen, sich gegen Wölfe zu verteidigen. Bringt die Evolution vollkommene Lebewesen hervor? Die Antwort auf diese Frage lautet nein. Es gibt mindestens vier Gründe dafür, warum die natürliche Selektion keine Vollkommenheit erzeugen kann. 1. Lebewesen sind in historische Beschränkungen eingebunden . Jede heutige Art stammt von einer langen Reihe altertümlicher Formen ab. Die Evolution kann nicht die Anatomie dieser Ahnen über Bord werfen und jede innovative Struktur von Grund auf neu schaffen, sondern sie ist auf existierende Strukturen angewiesen und passt diese an neue Situationen an. 2. Anpassungen sind oft Kompromisse. Zum Beispiel wir Menschen verdanken unsere Vielseitigkeit und Athletik grösstenteils unseren greiffähigen Händen und beweglichen Gliedmassen, die uns aber auch anfällig für Verstauchungen, Bänderdehnungen und Verrenkungen machen; die Verstärkung der Strukturen wurde zugunsten der Beweglichkeit vermieden. 3. Nicht jeder Evolutionsschritt ist adaptiv. Zufall wirkt sich auf die genetische Struktur von Populationen vermutlich stärker aus, als man einst dachte. Wenn beispielsweise ein Sturm Insekten Hunderte von Kilometern über das Meer auf eine Insel weht, erwischt er dabei nicht unbedingt jene Exemplare, die sich am besten für die neue Umgebung eignen. Und nicht alle durch genetische Drift im Genpool der Gründerpopulation fixierten Allele sind besser für diese Umwelt geeignet als nun verloren gegangene Allele der Stammpopulation. Ähnlich kann auch der Flaschenhalseffekt eine nichtadaptive Evolution oder sogar eine schlechte Anpassung verursachen. 4. Die Selektion kann nur existierende Varianten begünstigen . Die natürliche Selektion begünstigt nur die am besten angepassten der verfügbaren Varianten; das müssen nicht unbedingt ideale Merkmale sein. 12