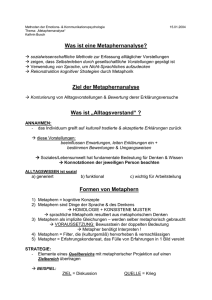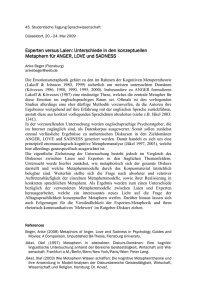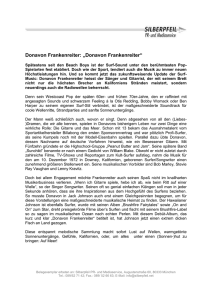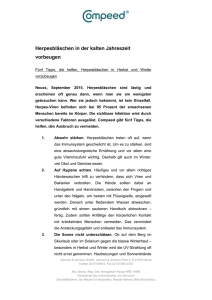1. Metapher und Sinnlichkeit - Evangelisch
Werbung
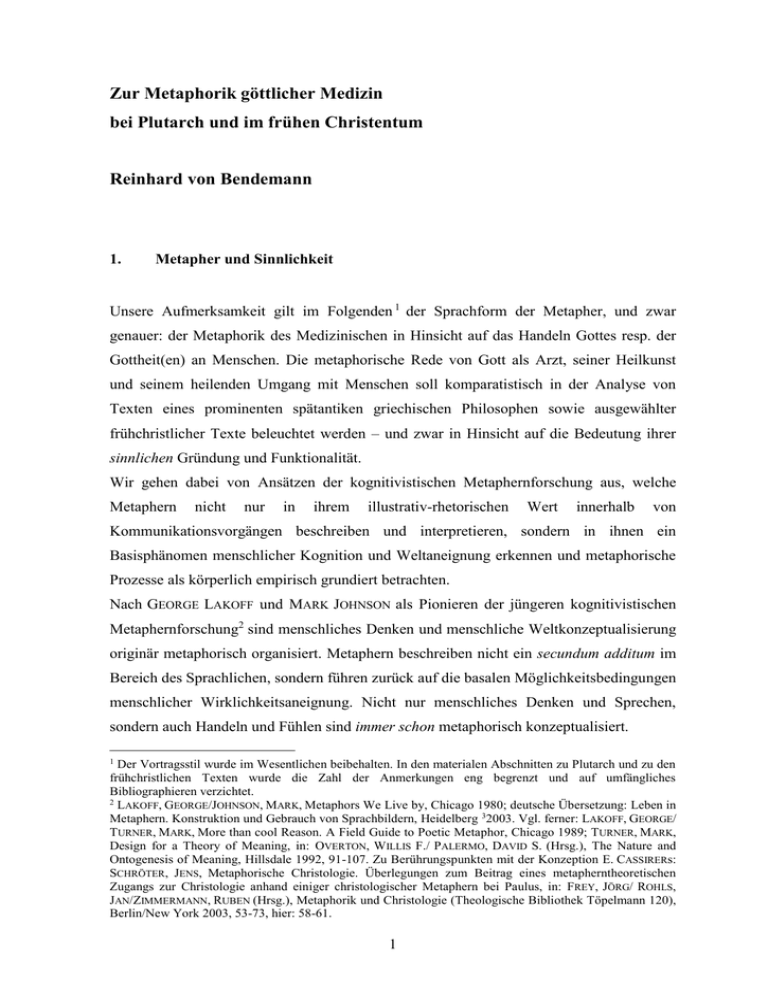
Zur Metaphorik göttlicher Medizin bei Plutarch und im frühen Christentum Reinhard von Bendemann 1. Metapher und Sinnlichkeit Unsere Aufmerksamkeit gilt im Folgenden 1 der Sprachform der Metapher, und zwar genauer: der Metaphorik des Medizinischen in Hinsicht auf das Handeln Gottes resp. der Gottheit(en) an Menschen. Die metaphorische Rede von Gott als Arzt, seiner Heilkunst und seinem heilenden Umgang mit Menschen soll komparatistisch in der Analyse von Texten eines prominenten spätantiken griechischen Philosophen sowie ausgewählter frühchristlicher Texte beleuchtet werden – und zwar in Hinsicht auf die Bedeutung ihrer sinnlichen Gründung und Funktionalität. Wir gehen dabei von Ansätzen der kognitivistischen Metaphernforschung aus, welche Metaphern nicht nur in ihrem illustrativ-rhetorischen Wert innerhalb von Kommunikationsvorgängen beschreiben und interpretieren, sondern in ihnen ein Basisphänomen menschlicher Kognition und Weltaneignung erkennen und metaphorische Prozesse als körperlich empirisch grundiert betrachten. Nach GEORGE LAKOFF und MARK JOHNSON als Pionieren der jüngeren kognitivistischen Metaphernforschung2 sind menschliches Denken und menschliche Weltkonzeptualisierung originär metaphorisch organisiert. Metaphern beschreiben nicht ein secundum additum im Bereich des Sprachlichen, sondern führen zurück auf die basalen Möglichkeitsbedingungen menschlicher Wirklichkeitsaneignung. Nicht nur menschliches Denken und Sprechen, sondern auch Handeln und Fühlen sind immer schon metaphorisch konzeptualisiert. 1 Der Vortragsstil wurde im Wesentlichen beibehalten. In den materialen Abschnitten zu Plutarch und zu den frühchristlichen Texten wurde die Zahl der Anmerkungen eng begrenzt und auf umfängliches Bibliographieren verzichtet. 2 LAKOFF, GEORGE/JOHNSON, MARK, Metaphors We Live by, Chicago 1980; deutsche Übersetzung: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern, Heidelberg 32003. Vgl. ferner: LAKOFF, GEORGE/ TURNER, MARK, More than cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago 1989; TURNER, MARK, Design for a Theory of Meaning, in: OVERTON, WILLIS F./ PALERMO, DAVID S. (Hrsg.), The Nature and Ontogenesis of Meaning, Hillsdale 1992, 91-107. Zu Berührungspunkten mit der Konzeption E. CASSIRERs: SCHRÖTER, JENS, Metaphorische Christologie. Überlegungen zum Beitrag eines metapherntheoretischen Zugangs zur Christologie anhand einiger christologischer Metaphern bei Paulus, in: FREY, JÖRG/ ROHLS, JAN/ZIMMERMANN, RUBEN (Hrsg.), Metaphorik und Christologie (Theologische Bibliothek Töpelmann 120), Berlin/New York 2003, 53-73, hier: 58-61. 1 In den neuen Zugängen zum Phänomen des Metaphorischen 3 wird etwas in der Metaphernforschung bislang Uneingelöstes herausgearbeitet: der Primat der Sinne im Zusammenspiel mit empirischer Evidenz, des Physischen, Emotionalen und Mentalen. Die Basis metaphorischer Übertragungen konstituiert sich aus vertrauten Erfahrungen der Sinneswahrnehmung wie räumlicher Orientierung, Sehen, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken u.a. Metaphern ermöglichen in ihrer Körperbezogenheit Abstraktionen und erzeugen Kohärenzen. Auf unser Thema bezogen, ergibt sich damit eine besondere Relevanz metaphorischer Sprachformen im Blick auf das religiöse Feld. Dieses wird nicht allein durch die Wissensdimension, sondern auch durch die Dimensionen von Erfahrung und Handeln, schließlich aber auch durch eine „materiale“ Dimension bestimmt wird, in der Dinge, natürliche Gegebenheiten und materiale Grundlagen die Vorstellungen, sozialen Entwicklungen und Praktiken prägen können. Fragt man, wie Evidenzen im religiösen Erfahrungsbereich hergestellt werden können, so ermöglichen Metaphern, die in basalen Strukturen menschlicher Weltaneignung und -erschließung gründen und auf das Sinnliche 3 Es ist an dieser Stelle nicht möglich, einzelne Vertreter der kognitivistischen Metapherntheorie und ihre Modelle vorzustellen. Auch ist hier nicht der Ort, in eine Methodendiskussion einzutreten. Es stellt sich u.a. die Frage, ob die fundamentale These von LAKOFF/JOHNSON, nach der metaphorische Rede in empirischer Evidenz auf eine metaphorische Gesamtstrukturierung von Prozessen der Wirklichkeitsaneignung und repräsentation in der menschlichen Kognition verweise (zu ihren Voraussetzungen in der holistischen kognitiven Semantik, der kognitiven Grammatik LANGACKERs, der Gestaltpsychologie und der Prototypentheorie ROSCHs siehe BALDAUF, CHRISTA, Sprachliche Evidenz metaphorischer Konzeptualisierung. Probleme und Perspektiven der kognitivistischen Metapherntheorie im Anschluss an George Lakoff und Mark Johnson, in: ZIMMERMANN, RUBEN, Bildersprache verstehen. Zur Hermeneutik der Metapher und anderer bildlicher Sprachformen [Übergänge 38], München/Paderborn 2000, 117-132, hier: 120-125), zu beweisen ist bzw. als bewiesen gelten kann. So fragt sich, wieweit sich im Ansatz von LAKOFF/JOHNSON beim entscheidenden Schritt der Rückverankerung sprachlich vorfindlicher Metaphernkonzepte in prototypischen Kognitionsschemata eine Zirkularität der Begründung vollzieht, insofern einerseits situiert wird, dass Menschen ihre Realität stets von Metaphern her definieren und auf ihrer Grundlage handeln, dies andererseits aber mit der anderen (nicht als bewiesen vorauszusetzenden) These fundiert wird, dass Menschen Erfahrungen immer schon metaphorisch strukturieren (vgl. LAKOFF/JOHNSON, Leben, 182. Zur Kritik: BALDAUF, Evidenz, 125-132). Damit ist zugleich die Frage impliziert, wie die Resultate von LAKOFF/JOHNSON sich zu sprachlichen Äußerungen von Kulturen verhalten, die zeitlich erheblich von neuzeitlichen (nordamerikanischen) Evidenzen differieren. Die Autoren bringen die Frage nach Faktoren der kulturellen Dependenz metaphorischer Konzeptualisierungen zwar in Rechnung (a.a.O., 28, zur Rede von „kulturelle[r] Kohärenz), zielen zugleich jedoch auf eine globale, nicht epochal, ethnisch, politisch o.ä. limitierte Theorie der Mentalitätsvorgänge. In der Selbstverortung der Theorie in der Historie der Bemühungen um die Metapher sind zudem deutliche Simplifikationen zu verzeichnen. Es muss als erhebliche Verkürzung gelten, wenn abendländisch-philosophischem Umgang mit der Metapher unterstellt wird, dieser reduziere das Problem in einem Röhrenmodell rhetorischer Kommunikation (vgl. LAKOFF/JOHNSON, Leben, 236-240). LAKOFF/JOHNSON arbeiten hier auch mit einem a priori belasteten negativen Begriff von „Abstraktion“ (vgl. a.a.O., 127-129). Besonders kritisch erscheint die Leistungsfähigkeit des kognitivistischen Zugangs im Fall nicht-lexikalisierter Metaphern (vgl. TAURECK, BERNHARD H.F., Metaphern und Gleichnisse in der Philosophie. Versuch einer kritischen Ikonologie der Philosophie, Frankfurt/Main 2004, 71). Es gilt jedoch: „Metaphorische Texte sowie Kontextverbindungen sind niemals ausnahmslos innovativ, sondern stellen immer ein ‚corpus permixtum’ aus traditionellen und innovativen Momenten dar“ (BUNTFUSS, MARKUS, Tradition und Innovation. Die Funktion der Metapher in der theologischen Theoriesprache [Theologische Bibliothek Töpelmann 84], Berlin/New York 1997, 51). 2 rückbezüglich sind, die Koordination und Formung von Wissen, Traditionen, Gefühlen und Handlungen. Nimmt man die von LAKOFF/JOHNSON in ihrer Pionierarbeit vorgeschlagenen Klassifikationen als heuristischen Ausgangspunkt 4 , so ist festzuhalten: Sogenannte „Orientierungsmetaphern“ entstehen aus menschlicher Raumorientierung, die unmittelbar mit körperlichen Erfahrungen zusammenhängt. 5 Weit reichende Bedeutung beansprucht dabei die metaphorisch-konzeptionelle Differenzierung von „oben“ und „unten“. „Die meisten unserer basalen Konzepte werden nach einer oder mehreren Metaphern der räumlichen Orientierung organisiert“. Ferner gilt: „Zwischen den verschiedenen Raummetaphern besteht eine äußere Gesamtsystematik, die deren Kohärenz definiert“.6 Die orientierende Feststellung eines „oben“ ist mit physischer Präsenz, Aktivität, Überlegenheit, Macht, gehobenem Status, Einfluss, Tugendhaftigkeit, Intelligenz und Kontrolle, zugleich aber auch mit dem Unbekannten konnotiert. Das metaphorische Konzept des „unten“ kann mit den je antonymen Begriffen umschrieben werden7. Ähnlich ist die Orientierung in den Unterscheidungen von „Nähe“ und „Ferne“ im Sinn von vorhandenem oder fehlendem Einfluss zu begreifen. Hiervon abzuheben ist die strukturelle „vorne“/„hinten“-Organisation metaphorischer Wirklichkeitsaneignung. Orientierungsmetaphern weisen in das Feld des Sozialen. Sie verbinden sich mit prototypischen Empfindungen und Wahrnehmungen von Nähe und Ferne, von entsprechender aktiver Einflussmöglichkeit im Blick auf das Nahe oder der Die Metapher ist nach LAKOFF/JOHNSON eine „auf der Imagination beruhende Rationalität“ (Leben, 220), sie ist ein kardinales Instrument der Erfahrungs- und Wirklichkeitsverarbeitung. Die Frage, was zuerst da war, ein sachhaltig-begriffliches und regelgeleitetes Sprachsystem oder die Metapher (siehe hierzu ECO, UMBERTO, Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, München 1987, 134f.; MAYER, ANNEMARIE C., Sprache der Einheit im Epheserbrief und in der Ökumene [Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe 150], Tübingen 2002, 93), ist also im Sinn von LAKOFF/JOHNSON gar nicht alternativ entscheidbar. „Metapher“ steht nicht (nur) für einzelne Begriffe oder Syntagmen in einer konkret vorfindlichen Sprache oder konkreten Texten, sondern kongruiert mit einem kontinuierlichen „Konzeptsystem“ (LAKOFF/JOHNSON, Leben, 14). Dieses „Konzeptsystem“ ist nach LAKOFF/JOHNSON infolge kondensierter Erfahrung per se systematisch ausgelegt, wobei „solitäre metaphorische Ausdrücke“ eine gewisse Ausnahme darstellen (a.a.O., 68f.). Basiert alles Verstehen auf metaphorischen Grundvollzügen, so ist auch jede „Theorie“-Bildung als ein erweitertes metaphorisches Konzeptsystem darstellbar. Nicht allein Gegenstandsbereiche, sondern vor allem auch Handlungsfelder werden metaphorisch konzeptualisiert. In der Aktivierung eines metaphorischen Zusammenhangs rücken jeweils nur bestimmte Aspekte in den Vordergrund, während andere Ableitungen und Aspekte in den Hintergrund treten. Ein metaphorisches System arbeitet stets so, dass kontext- und kulturgebundene Aspekte fokalisiert („benutzter“ Teil), andere dagegen „verborgen“ werden („unbenutzter“ Teil). Vgl. a.a.O., 66; vgl. 128 zu „Asymetrien“. Ausschlaggebend für konkrete Nutzung oder Nichtnutzung der metaphorischen Dimensionen kann ein „Modifikator“ (hedge) sein (a.a.O., 142-146). 5 Nach LAKOFF/JOHNSON emergieren die „Orientierungsmetaphern“ nicht metaphorisch, sondern vielmehr direkt (vgl. Leben, 84). D.h., bei ihnen wird ein Konzept „... nicht von einem anderen her strukturiert“. Vielmehr wird durch Orientierungsmetaphern „... ein ganzes System von Konzepten in ihrer wechselseitigen Bezogenheit organisiert ...“ (a.a.O., 22). 6 LAKOFF/JOHNSON, Leben, 26. 7 Vgl. LAKOFF/JOHNSON, Leben, 22-30. 4 3 Unmöglichkeit des Einflusses im Blick auf das Ferne. Nach dem Unterscheidungsmuster „vorne“/ „hinten“ – „nah“/„fern“ wird auch Zeit konzeptualisiert; sei es, dass die Zeit als ein bewegliches Objekt mit einer linearen Bewegungsrichtung imaginiert ist (wir erfahren die Zeit als voranschreitend), oder sei es, dass die Zeit als solche statisch gedacht, dagegen der Mensch in linearer Bewegung („vorne“/„hinten“) durch sie hindurch vorgestellt ist (wir bewegen uns im Strom der Zeit). Prototypisch tendieren Menschen nach den kognitivistischen Metapherntheorien zu Konzepten wie „eher HIER als DORT“, „eher VORNE als HINTEN“, „eher AKTIV als PASSIV“8. Prototypisch begründet in körperlichen und sinnlichen Primärerfahrungen sind ferner die sogenannten „ontologischen Metaphern“. Ontologische Metaphern konzeptualisieren sinnliche Wahrnehmung und Wirklichkeit in Gestalt des Dinglichen und Substanzhaften.9 Abstrakte Erfahrungen werden in sogenannten „Gefäßmetaphern“ erschlossen. Menschen projizieren ihre „Innen-außen-Orientierung auf andere physische Objekte, die durch Oberflächen begrenzt sind“10. Derart werden auch Ereignisse, Handlungen und Zustände wie Liebe oder auch Formen von Erkrankung metaphorisch als Objekte konzeptualisiert11. Unter die „ontologischen Metaphern“ rechnen LAKOFF/JOHNSON Personifikationen, die Gegenstandsbereiche im Sinne ontologischer Konzepte unter der Frage von Eigenschaften, Motivationen und Zielsetzungen erschließen 12 . Die „Metonymie“ fungiert dagegen als Strukturkonzept, das Beziehung generiert, „so daß wir eine Entität benutzen können, damit diese für eine andere Entität steht“13. Distinktionen wie die der „ontologischen Metaphern“, „Orientierungsmetaphern“ und auch „Strukturmetaphern“ 14 verweisen nicht auf eine übergeordnete konsistente Logik. Wohl aber sind sie auf „relative“ Kohärenzen und Vernetzung hin zu befragen.15 8 LAKOFF/JOHNSON, Leben, 154. Vgl. LAKOFF/JOHNSON, Leben, 35-39. 10 LAKOFF/JOHNSON, Leben, 39. 11 LAKOFF/JOHNSON, Leben, 41f. 12 Vgl. LAKOFF/JOHNSON, Leben, 44f. 13 LAKOFF/JOHNSON, Leben, 47. 14 Nach LAKOFF/JOHNSON wird in „Strukturmetaphern“ „... ein Konzept von einem anderen Konzept her metaphorisch strukturiert ...“ (dies, Leben, 22). Genauer gründen die Strukturmetaphern „... in systematischen Korrelationen innerhalb unserer Erfahrung“ (a.a.O., 75). Strukturmetaphern sind damit – im Anschluss an ELEANOR ROSCH – „prototypisch“ beeinflusst (vgl. a.a.O., 86f., 203). Ihnen kommt „metaphorische Emergenz“ zu, und sie sind auf metaphorische Amplifikation angelegt. Diese Klassifikation der „Strukturmetapher“ ist in der Konstruktion von LAKOFF/JOHNSON in ihrer Distinktheit problematisch. BALDAUF, CHRISTA, Metapher und Kognition. Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher (Beiträge zur Sprachwissenschaft 24), Frankfurt/Main u.a. 1997, 82, beurteilt die Bezeichnung als missverständlich, insofern es die generelle Eigenart von Metaphern sei, Strukturen zu übertragen. Sie favorisiert demgegenüber eine linguistische Gruppierung von Metaphern auf der Grundlage der Konzeptstruktur des jeweiligen Herkunftsbereiches und möchte Attributmetaphern, ontologische Metaphern, bildschematische Metaphern und Konstellationsmetaphern unterscheiden (ebd.); vgl. DIES., Evidenz, 117132. Zu Weiterentwicklung und Kritik des Ansatzes von LAKOFF/JOHNSON vgl. auch RANTZOW, SOPHIE, 9 4 In der Untersuchung von Quellen der antik-philosophischen und der frühchristlichen Literatur sind kognitivistische Metapherntheorien nicht einfach „anwendbar“ – Es besteht das Risiko, die kulturelle und zeitliche Dependenz von metaphorischen Aussagen zu nivellieren. Doch ist der Grundansatz attraktiv, da er zunächst nicht von der Metaphorik des Extravaganten und Irregulären ausgeht (sog. „kühne Metapher“), sondern vom Regulären, von Grundorganisationsformen menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns. Jede Kommunikation stellt sich vor dem Hintergrund von Alltagserleben als metaphorisch dar. Auch religiöse Kommunikation ist nicht einem Sonderreservat zuzuweisen. Dasjenige metaphorische Konzept, das wir nun im Folgenden genauer untersuchen wollen, ist das der Gottheit resp. Gottes als Arzt (und Apotheker), der Menschen physisch erfahrbar behandelt. Es geht – je nach zugrunde gelegter kognitivistischer Kategorienbildung – um ein „ontologisches“ Metaphernkonzept, in enger Verbindung mit orientierenden Elementen. 2. „Schneiden und Brennen schmerzt“ – Zur Metaphorik göttlicher Medizin bei Plutarch von Chaironeia Die Schriften Plutarchs von Chaironeia spiegeln, angefangen bei der Berücksichtigung medizinischer Gesichtspunkte in seinen biographischen Texten über das psychologische Ausleuchten von Krankheiten und Leiden in seinen philosophischen Traktaten bis hin zu Christus Victor Temporis. Zeitkonzeptionen im Epheserbrief (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 123), Neukirchen/Vluyn 2008, 59-72; GERBER, CHRISTINE, Paulus und seine ‚Kinder’. Studien zur Beziehungsmetaphorik der paulinischen Briefe (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 136), Berlin/New York 2005, 81-111. 15 Vgl. LAKOFF/JOHNSON, Leben, 57. Mit der Rede von „Kohärenz“ beziehen sich LAKOFF/JOHNSON auf die Beobachtung, dass Metaphern, die differente Erfahrungsbereiche und einschlägige Bildsequenzen eröffnen, eine neue systematische Logik generieren können. Mögliche gemeinsame Ableitungen müssen dabei auf der Basis der Theorie wiederum auf Kongruenzen im Metaphorischen bzw. im kognitiven Konzeptsystem selbst zurückverweisen (a.a.O., 114). LAKOFF/JOHNSON verwenden an dieser Stelle auch den Begriff vieldimensionaler „Gestalten“ (a.a.O., 102; vgl. 103-124, 193). Im Schritt der Übertragung auf die textuelle Analyse stellt sich mit dem kognitivistischen Modell die Frage, inwieweit konkrete Texte „körperlich“metaphorisch zu betrachten sind. Nach LAKOFF/JOHNSON bestimmen die verschiedenen Klassen und Konzepte von Metaphern Texte als auskristallisierte Zeugnisse der Kognition grundsätzlich in sämtlichen Formen der sprachlich-syntaktischen und semantischen Verknüpfung. In Hinsicht auf die Raumorientierung betrifft dies z.B. die Sequenz der Syntax. „Unser Sprechen ist linear angeordnet, das heißt, daß wir immer entscheiden müssen, in welcher Reihenfolge wir unsere Wörter sagen ... Die Schriftsprache erlaubt uns, die formulierten Sätze viel leichter und plastischer als räumliche Objekte mit einer linear angeordneten Abfolge von Wörtern zu konzeptualisieren“ (a.a.O, 147). 5 den moralischen Therapeutika 16 in einem hohen Maß medizinische Bildung. Plutarch bringt in seine verschiedenen Schriftgattungen immer wieder Vorstellungen ein, wie sie bereits in der hippokratischen Medizin entwickelt wurden. Zugleich ist Plutarch über die medizinischen Schulrichtungen seiner Zeit wohl orientiert. Dabei beschäftigt Plutarch die Medizin grundsätzlich nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten um ihrer selbst willen. Vielmehr macht er sich die enge Verwandtschaft von philosophischem und medizinischem Schuldiskurs zunutze, indem er medizinale Beobachtungen und Einsichten in der Deskription und Analyse menschlichen Handelns aktiviert. Über die Medizin können die verschiedensten Felder der Philosophie und Lebens- und Handlungsorientierung miteinander verschränkt werden.17 Plutarch knüpft hiermit an griechische und auch römische Ansätze der Philosophie an, die im Philosophen funktional den Arzt erkennen, dessen Handeln nicht allein körperliche Gesundheit, sondern vor allem die Integrität der Seele und damit des Lebens insgesamt intendiert. Im Rahmen der mittelplatonischen Philosophie zeichnet sich Plutarchs Werk durch den hohen Umfang aus, in dem medizinale Metaphern und Bilder auch theologisch gebraucht sind.18 Die folgende Analyse nimmt ihren Ausgang von ausgewählten Textzusammenhängen aus der dem Avidius Quietus gewidmeten Schrift „De sera numinis vindicta“ (Plutarch, Moralia 548 A-568 A; PERI TWN UPO TOU QEIOU BRADEWS TIMWROUMENWN). Diese Schrift erscheint nicht nur deshalb besonders geeignet, da sie unter die ausgereiftesten Texte aus dem umfassenden Œuvre Plutarchs zu rechnen ist – es ist eine Schrift, die in die delphische Spätphase gehört und am Ort des delphischen Orakels spielt – , sondern auch darum, weil in ihrem Zentrum eine dezidiert theologische Fragestellung Vgl. zu den Schriften der „psychotherapeutischen“ Behandlung einzelner Laster und Begierden: ZIEGLER, KONRAT, Plutarchos von Chaironeia, Stuttgart 1949.21964 (vgl. DERS., in: Paulys Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft XI 2, 636-963), 136-168 (im Unterschied zu den philosophischen Abhandlungen im engeren Sinn); ferner: INGENKAMP, HEINZ GERD, Plutarchs Schriften über die Heilung der Seele (Hypomnemata 34), Göttingen 1971; VAN HOOF, LIEVE, Plutarch’s Practical Ethics. The Social Dynamics of Philosophy, Oxford 2010; zu Plutarchs moralischer Psychologie: OPSOMER, JAN, Eros in Plutarchs moralischer Psychologie, in: GÖRGEMANNS, HERWIG u.a. (Hrsg.), Plutarch. Dialog über die Liebe. Amatorius (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia 10), Tübingen 2006, 208235. 17 Zu Medizinischem bei Plutarch: DURLING, RICHARD, Medicine in Plutarch’s Moralia, in: Traditio 50, 1995, 311-314; BOULOGNE, JACQUES, Plutarque et la médicine, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II.37.3, Berlin/New York 1996, 2762-2792. 18 Eine entsprechende theologische Applikation konnte sich für Plutarch insbesondere mit seiner Funktion als Priester des Gottes Apollon in Delphi nahelegen, der (vor seinem Sohn Asklepios) als der Heilgott der Antike zu gelten hat. 16 6 steht. Medizinal-metaphorische Rede kann somit in ihrer besonderen religiösen Verwendungsweise untersucht werden. Aufbau, Einzelargumentation und traditionsgeschichtliche Hintergründe von „De sera numinis vindicta“ sollen uns dabei nur insoweit beschäftigen, als sie die Einordnung der einzelnen ausgewählten medizinalen Bezugspunkte ermöglichen.19 Die Schrift lehnt sich in ihrem Rahmen an die Form des sokratischen Dialoges an. Konstitutiv ist die grobe Zweiteilung in einen argumentativen Part (lo,goj), der sich in drei Gesprächsgänge untergliedern lässt, sowie ein mythisches Finale (mu/qoj). Der „Mythos“ erlaubt abschließend die Beleuchtung der im „Logos“ angesprochenen Argumente und Erwägungen unter einer veränderten Gattungs- und Wahrnehmungsperspektive. Das Thema der Schrift ist das Problem der von Gott/der Gottheit zurückgehaltenen bzw. verzögerten Strafe für Fehlverhalten.20 Es geht im Kern um die Relation der Vorstellung einer göttlichen Vorsehung zum Schicksalsglauben bzw. zu menschlichen Schicksalserfahrungen – seien diese individuell oder kollektiv. Wie lässt sich ein planvolles Handeln Gottes/der Gottheit von kontingenten menschlichen Erfahrungen bzw. Zufälligem unterscheiden bzw. lassen sich Widerfahrnisse und Ereignisse so aufeinander beziehen, dass sie auch dann als Folge von Tat und göttlicher Strafe zu interpretieren sind, wenn sie zeitlich weit auseinanderliegen bzw. Straffolgen scheinbar ausbleiben? Mit der Frage der Sinnhaftigkeit von Selbstwirksamkeitszusammenhängen und der Erklärung von Kontingenzen im menschlichen Leben ist zugleich die Frage der Gerechtigkeit der Gottheit in ihrem Geschichtshandeln aufgeworfen21. 19 Für eine ausführliche Analyse (mit Literatur) vgl. VON BENDEMANN, REINHARD, Konzeptionen menschlicher Schuld und göttlicher Strafe/Gerechtigkeit bei Plutarch von Chaironeia, in: BEYERLE, STEFAN/ ROTH, MICHAEL/SCHMIDT, JOCHEN (Hrsg.), Schuld. Interdisziplinäre Versuche ein Phänomen zu verstehen (Theologie – Kultur – Hermeneutik 11), Leipzig 2009, 231-270; vgl. GÖRGEMANNS, HERWIG (unter Mitarbeit von FELDMEIER, REINHARD/ASSMANN, JAN), Plutarch. Drei Religionsphilosophische Schriften (Sammlung Tusculum), Düsseldorf/Zürich 2003, 318-339. Zu medizinischen Bildern in „De sera numinis vindicta“: HIRSCH-LUIPOLD, RAINER, Plutarchs Denken in Bildern. Studien zur literarischen, philosophischen und religiösen Funktion des Bildhaften (Studien und Texte zu Antike und Christentum 14), Tübingen 2002, 225-281; weitere Literatur zur Medizin bei Plutarch: a.a.O., 228f. Anm. 7; vgl. VAN HOOF, Ethics, 211-254, besonders zur Schrift Peri. diai,thj u``gieinh/j / „De tuenda sanitate praecepta“. 20 Zum Problemkreis der Theologie und Dämonologie Plutarchs, der im Folgenden nicht weiter diskutiert werden kann, vgl. HIRSCH-LUIPOLD, RAINER, Der eine Gott bei Philon und Plutarch, in: DERS. (Hrsg.), Gott und die Götter bei Plutarch. Götterbilder – Gottesbilder – Weltbilder (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 54), Berlin/New York 2005, 141-168. 21 Wie komplex das ist, was Plutarch in dieser Schrift in Angriff nimmt, zeigt sich auch daran, dass schon die Vorstellung einer „strafenden“ oder „richtenden“ Gottheit metaphorische Rede impliziert – die in der Schrift durch medizinale Metaphorik expliziert wird. Die Fragestellung von „De sera numinis vindicta“ ist von der späteren Leibniz’schen „Theodizeeproblematik“ zu unterscheiden. Vgl. hierzu FELDMEIER, REINHARD, Theodizee? Biblische Überlegungen zu einem unbiblischen Unterfangen, in: Berliner Theologische Zeitschrift 18, 2001, 24-39; DERS., Wenn die Vorsehung ein Gesicht bekommt. Theologische Transformationen einer problematischen Kategorie, in: SPIECKERMANN, HERMANN/KRATZ, REINHARD 7 Wir betrachten nun thematische Schnittstellen der Schrift und analysieren, welche Bedeutung medizinische Metaphern und Bilder im Blick auf die Klärung des Problems gewinnen. 2.1. Zum akademisch-methodischen Ausgangspunkt der Metaphorik göttlicher Medizin Es ist nicht zuletzt dem fiktionalen Ort des Dialoges – Delphi – geschuldet, wenn sich die von Plutarch aufgeworfenen Fragen sowie die in verschiedenen Lösungsanläufen gesuchten Antworten in einem moderaten Rahmen bewegen, innerhalb dessen allzu kritische Zuspitzungen im religiösen Diskurs abgefangen werden. Der Plutarch des Dialogs bringt diesen Rahmen in der Einleitung auf den Begriff der „Behutsamkeit“ bzw. des zurückhaltenden Maßes in Hinsicht auf das Göttliche (pro.j to. qei/on euvla,beia; 549 E). Hierbei handelt es sich zunächst um ein Axiom der akademischen Skepsis, die Zurückhaltung übt, da der menschlichen Wahrnehmung enge Grenzen gesetzt sind. Zugleich bedeutet dieser Zugang bei Plutarch jedoch nicht allein ästhetische Zurückhaltung, sondern impliziert auch einen Respekt vor dem Göttlichen in positiver Hinsicht („Scheu“ / „Ehrfurcht“). Dieser doppelte Aspekt der euvla,beia verbindet sich nun gleich im Einleitungsteil mit der Metaphorik der Gottheit als Arzt und wird durch diese vertieft. Kapitel 4 eröffnet das medizinale Metaphernfeld, welches „De sera numinis vindicta“ an entscheidenden Stellen der Argumentation immer wieder strukturiert: Aktiviert wird das Modell des Arztes als Spezialist im Unterschied zum unkundigen Patienten (549 F).22 Empfindet der Patient Schmerzen, und stellen sich Schmerzen gerade auch durch die Anwendung von Medikamenten und ärztlichen Therapieformen ein, so steht hinter solcher Erfahrung doch die Intention des Arztes, Heilung zu erwirken. Impliziert ist, dass der Patient auf diese heilvolle Wirkabsicht des Arztes zu vertrauen hat, auch wenn ihm die gegebenenfalls unangenehmen therapeutischen Maßnahmen als solche uneinsichtig bleiben mögen. Plutarch fasst hier (550 A) die medizinische Behandlung der Seele als „Recht und Gerechtigkeit“ (di,kh de. kai. dikaiosu,nh). Damit ist die entscheidende Gleichung benannt, die im Hintergrund der bildhaften Verbindung von Heilkunst und göttlichem Strafrecht steht, wie sie im weiteren Verlauf der Schrift gegebenenfalls reaktiviert werden kann: Was der Heilung und Gesundheit dient, GREGOR (Hrsg.), Vorsehung, Schicksal und göttliche Macht. Antike Stimmen zu einem aktuellen Thema, Tübingen 2008, 147-170. 22 Zur Anknüpfung der Metaphorik Plutarchs an Platon: HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 241f. 8 kann per definitionem nicht ungerecht sein (auch wenn es schmerzt). In der Heilkunst ist das Nützliche (to. crh,simon) auch „gerecht“ (di,kaio,n evstin). Darum wird – so argumentiert Plutarch innerhalb der Verteidigung generationenübergreifender Strafe – niemand therapeutische Praktiken kritisieren, die bei anderen Organen ansetzen als bei den vordergründig von Krankheit affizierten Körperteilen.23 Die Arztmetaphorik hat damit zunächst die Funktion, etwas Unanschauliches und Unverständliches im Bereich der Erfahrungen zu thematisieren und zu strukturieren. Das „Gesundheitssystem“, das Plutarch metaphorisch aufruft, artikuliert sich näherhin in Orientierungsmetaphern, die auf eine „oben“/„unten“-Differenzierung zurückzuführen sind: Das hierarchische Gefälle von Arzt und Patient bzw. Fachmann und Laien – eine Struktur, auf die in „De sera numinis vindicta“ immer wieder zurückgegriffen wird. Die struktur- und orientierungsmetaphorischen Differenzierungen ermöglichen Kontingenzbewältigung. Auf der Grundlage eines Grundvertrauens in den Beruf des Arztes und dessen heilvoller Intention eignet ihnen ein affirmativer Aspekt. Der Preis dieses Metaphernkonzepts zeigt sich darin, dass die Gottheit, die straft und die Strafe gegebenenfalls verzögert, im Sinne der euvla,beia von kritischen Rückfragen und Klagen der „Patienten“ resp. Dritter weit gehend ausgenommen wird. Die Metaphorik der göttlichen Medizin kann einer Immunisierung der Gottheit gegenüber menschlicher Kritik Vorschub leisten. 2.2. Handlungsspielräume im Bereich der Metaphorik göttlicher Therapie Die derart bereits im Einleitungsteil methodisch verankerte medizinische Metaphorik durchzieht den ersten, argumentierenden und am „Wahrscheinlichen“ (558 D; vgl. 561 B: to. eivko,j) orientierten Teil von „De sera numinis vindicta“. Stellt sich der „Logos“ als eine Folge unterschiedlicher Lösungsanläufe dar, die auch in Spannung zueinander treten, so ergibt sich durch die medizinale Metaphorik eine hintergründige Kohärenz. Dabei werden im medizinischen Metaphernfeld unterschiedliche Funktionen in den Vordergrund gespielt. Auch hier fragen wir anhand von ausgewählten Beispielen nach der sinnlichen Gründung der einzelnen Metaphernbereiche und ihrer Bedeutung für die Argumentation. 23 Im 16. Kapitel (559 F) bezieht er sich auf die Praxis, Hüftkranken den Daumen zu kauterisieren, bei Leberabszess die Bauchdecke aufzuritzen und Rindern im Fall von Huferweichung die Hörnerspitzen einzuölen (zum medizinhistorischen Hintergrund: GÖRGEMANNS, Plutarch, 376 Anm. 3). 9 Im 6. Kapitel wird ein erster Komplex der Argumentation geprüft. Inwieweit eröffnet die Verzögerung von Strafe Möglichkeiten zur Korrektur üblen Verhaltens? Im Blick auf den Einzelnen und seine Verhaltensänderungsmöglichkeiten scheint hier die Plutarchische Psychologie durch: Der Mensch qua „Seele“ hat die Möglichkeit, einerseits krank zu werden, das heißt: triebhaftem Verhalten zu erliegen; andererseits gibt es jedoch – in begrenztem Umfang – die Möglichkeit eines grundlegenden Richtungswechsels, der einer Heilung zuträglich sein kann. Plutarchs psychologische Position gewinnt dabei ihr Profil insbesondere im Unterschied zu stoischen Vorstellungen. Anders als die Stoiker geht Plutarch grundsätzlich nicht davon aus, dass der Mensch seine Triebe völlig besiegen und ausmerzen könne. Je nachdem, wie dieser Ansatz akzentuiert wird, bedeutet er, dass Menschen in einem begrenzten Maß mit Krankheiten leben müssen, bzw. dass sie sich eben nie ganz selbst zu heilen vermögen, sondern in jedem Fall der ärztlichen Kunst bedürfen. Im Einzelnen fächert Plutarch hier solche Erwägungen nicht auf; er begnügt sich mit Hinweisen zur Wandelbarkeit des Charakters von Menschen (551 E/F). Akzentuiert sind die diagnostischen Fähigkeiten der Gottheit, die Einblick in den Seelenzustand nehmen kann und gegebenenfalls hinreichend „körpereigene Abwehrkräfte“ in Hinblick auf das Üble/Schädliche/Krankmachende erkennt und deren Mobilisierung abwartet: „Wenn die Gottheit über eine kranke Seele richtet, so darf man voraussetzen, dass sie ihre leidenschaftlichen Triebe durch und durch erkennt (diora/n), ob sie vielleicht nachgiebig werden und Ansätze zur Reue zeigen …“ (551 C). Nur Unheilbares wird von der Gottheit sogleich ausgelöscht (551 D). Die Differenzierung ergibt sich dabei – sokratisch – anhand des Kriteriums des Wissens um das Böse bzw. des intentionalen Wollens. Vorausgesetzt ist, dass der Patient des Arztes bedarf und diesen im Fall der Krankheit früher oder später wieder aufsuchen wird. Wer zur Reue nicht fähig ist, der wird an der Therapie Gottes nicht vorbeikommen. Im Einzelnen gewinnt die medizinische Metaphorik im Zusammenhang der verschiedenen Beispiele und Erwägungen im Argumentationszusammenhang damit zugleich eine bedrohliche Komponente. Im Vordergrund steht hier nämlich weniger die Zuständigkeit des Arztes für die Gesundheit und Abwendung von Schaden als vielmehr der Aspekt, dass dem Arzt – früher oder später – niemand entkommen wird. Ärztliche Kunst und göttliches Strafhandeln, dem keiner entrinnen wird (vgl. Jesus Sirach 38,15), das vielmehr punktgenau eintreffen wird, werden einander stark angenähert. 10 2.3. Sinnstiftung von bitteren Therapieerfahrungen durch Orientierungsmetaphorik und ontologische Bildersprache Im 7. Kapitel (552 D-553 D) spielt Plutarch ein weiteres Argument für die Sinnhaftigkeit des Aufschubs von Strafe durch die Gottheit durch. Böse Menschen könne die Gottheit gezielt am Leben erhalten und ihnen einen Aufschub gewähren, um durch sie Übel zu verhindern bzw. Gutes zu vollbringen, so wie nach ägyptischem Brauch eine zum Tod verurteilte schwangere Frau nicht getötet wird, bis sie ihr Kind geboren hat (552 D). In politischer Hinsicht gehört hierher auch die Vorstellung, dass sogar Tyrannen zeitweise positive Funktionen im Plan der Gottheit übernehmen können. Plutarch vertieft auch dieses Argument unter Nutzung medizinischer Metaphern, genauer führt er aus der Pharmazeutik bittere und unliebsame Medikamente vergleichend an. Wie die Verabreichung von Hyänengalle medizinischen Nutzen haben könne, 24 oder auch das Lab des Seehundes, welches man gegen Epilepsie verschreibt25, so könne noch ein grausamer Herrscher in der göttlichen Pädagogik für einzelne und ganze Staaten eine positive Funktion übernehmen (552 F; 553 A). Auch hier ermöglicht die metaphorische Rede eine unmittelbare Erfahrungs- und Sinnesgründung des Arguments: Wer einmal Galle geschmeckt hat und auf ärztlichen Rat hin bittere Medizin einnehmen musste, dem erschließt sich unmittelbar was gemeint ist. Im Hintergrund steht auch hier das autoritative Gefälle: Zur Aufgabe des Arztes gehört es, zur Erreichung von Gesundheit der Patienten gegebenenfalls auch Bitteres zu verordnen. Damit wird zugleich eine Sinnstiftung des Bitteren, Ekelhaften und Schmerzlichen erreicht. Die Arztmetaphorik hilft nicht allein dazu, die Gerechtigkeitsproblematik zu klären, sie beantwortet auch die Frage, wofür es Ekliges und Bitteres überhaupt gibt. Die Erfahrung wird durch die Verschiebung im Metaphernfeld sinnvoll. In der Aktivierung der Metaphern ist wiederum ein Primat der Sinne festzustellen: Das Argument wird von Plutarch nicht allein aus der Perspektive des behandelnden Arztes entworfen; es wird vielmehr umgekehrt erst plausibel aus der Sinneserfahrung von Patienten heraus, denen unangenehme Therapien auferlegt werden. 24 Zur Galle als Ursache von Krankheiten und Therapeuticum in der antiken Medizin vgl. LEVEN, KARLHEINZ, Artikel „Galle“, in: DERS. (Hrsg.), Antike Medizin. Ein Lexikon, München 2005, 322f. 25 Zur Verbindung von Hyäne und Seehund: HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 248f. Zur Epilepsie und ihrer Therapie in der Antike vgl. VON BENDEMANN, REINHARD, Heilige Krankheit? Epilepsie im Spannungsfeld physiologisch-sozialer und religiöser Deutungen im Neuen Testament und im rabbinischen Judentum, in: ROTH, MICHAEL/SCHMIDT, JOCHEN (Hrsg.), Gesundheit. Humanwissenschaftliche, historische und theologische Aspekte (Theologie – Kultur – Hermeneutik 10), Leipzig 2008, 11-44. 11 2.4. Grenzbereiche der Metaphorik göttlicher Medizin Die Kapitel Kapitel 9-11 (553 F-556 E) beschreiben einen neuen Ansatzpunkt innerhalb der verschiedenen Argumentationskreise, die Plutarch im ersten Teil des „Logos“ von „De sera numinis vindicta“ durchläuft. Göttliche Strafe wird hier nicht unter dem Aspekt ihres Ausstehens, sondern vielmehr unter dem ihres bereits in der Gegenwart Eingetroffen- und Greifbarseins angesprochen. Die Bosheit bereitet dem Täter selbst Beschwer, ähnlich einem Verbrecher, der körperlich die Last des Kreuzes spürt, das er zu seiner eigenen Hinrichtung tragen muss (554 A), oder wie bei einem Fisch, der bereit den Angelhaken im Maul stecken hat (554 E). Die Schlechtigkeit führt aus sich heraus (evx auvth/j) zu einer Minimierung des Lebens des Täters der bösen Tat (554 B). Plutarch argumentiert hier anthropologischphänomenologisch, in dem er auf eintretende Schamgefühle, Ängste und unaufhörliche Beunruhigungen verweist. Impliziert ist der Gedanke, dass die Gottheit den Täter des Üblen einem erbarmungswürdigen Zustand anheimstellt und überlässt. Das Argument, dass die vermeintliche Hinauszögerung der Strafe für Übles tatsächlich nur Dehnung des Leidens bedeute, wird wiederum mit der Metaphorik göttlicher Medizin gestützt und erweitert, wenn Plutarch auf die – nach Plato durch den an Schwindsucht (fqi,sij) erkrankten Herodikos von Selymbria in die Medizin „eingemischte“ und von Platon gering geachtete (vgl. Plato, Politeia 406a-408b) – Gymnastik verweist, die auf den Tod zulaufendes Leiden nicht heile, sondern lediglich verlängere (554 D). Wer die Strafe Gottes verdient, den behandelt Gott im Modus der Gymnastik: Strafe wird nicht für ein späteres Alter aufgehoben, sondern üble Menschen werden in einer schmerzhaften Therapie unter andauernder Strafe alt (ouvde. ghra,santej evkola,sqhsan( avll v evgh,rasan kolazo,menoi).26 Dieser Schritt ist in „De sera numinis vindicta“ überaus bemerkenswert: Das metaphorische Grundkonzept changiert hier unvermittelt und wird bis an Spannungsgrenzen ausgereizt. In diesem Zusammenhang erscheint die Gottheit als Leiden verlängernder, ja geradezu als quälender Arzt, der etwas im Sinne der Heilkunst Widersinniges tut, indem er etwas Schmerzendes und dabei Unwirksames verordnet.27 26 Vgl. zur Bewertung der Gymnastik in Plutarchs diätetischem Werk: VAN HOOF, Ethics, 231-235. Zum „langen Tod“, den die Gymnastik bedeutet: HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 255f. 27 HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 250f., bindet diesen Aspekt grundsätzlich an die pädagogische Zielsetzung der Philosophie Plutarchs zurück. 12 Auch hier zeigt sich im medizinisch-metaphorischen Konzept von „De sera numinis vindicta“ deutlich der Primat der Sinne. Die metaphorische Kohärenz, die Plutarch erreicht, erschließt sich in vielen Abschnitten der Schrift nicht allein aus der Perspektive des Arztes, sondern aus der umgekehrten Richtung, aus der Perspektive des Patienten: Vom Patienten her betrachtet haben die verschiedenen Metaphernfelder einen hohen Kohärenzgrad. Ausgangspunkt der Konzeptualisierung der Metaphern ist bei Plutarch zwar grundsätzlich der gute, auf das Erwirken von Gesundheit und Wohlsein hin orientierte Arzt28; aus der Sicht des Patienten – seinen Sinnesempfindungen, sofern sie ärztlichen Maßnahmen ausgesetzt sind – kann sich diese gute Intention jedoch verdunkeln. Mit diesem von den Sinnen her entworfenen Perspektivwechsel arbeitet „De sera numinis vindicta“ immer wieder. 29 2.5. Metaphorische Koordination der Zusammenhänge von Zeiten und Generationen – Ärztliche Prognostik und Prophylaxe Die Kapitel 12-21 beschreiben einen eigenen und in sich höchst komplexen Argumentationsverbund innerhalb von „De sera numinis vindicta“.30 Im zweiten Teil des argumentierenden „Logos“ geht es um eine Frage, die im Eingang der Schrift bereits aus dem Mund des Timon anklang und nun durch diesen eröffnet wird (556 D/E), nämlich die, wie sich die Vorstellung der Gerechtigkeit der Gottheit und die eines generationenübergreifenden Strafhandelns zueinander verhalten. Die Vorstellung, dass Vgl. klassisch zum „Gutsein“ und auch zur „Gerechtigkeit“ des Arztes: Corpus Hippocraticum De medico I 9: „Im Charakter gut und tüchtig, als solcher gegen alle gemessen und freundlich“ (to. de. h=qoj ei=nai kalo.n kai. avgaqo.n, toiou/ton d v o;nta pa/si kai. semno.n kai. fila,nqrwpon). I 16: „In allem Verkehr mit den Menschen muss der Arzt gerecht sein; denn oft muss Gerechtigkeit ihm aushelfen. Auch stehen die Kranken in einem bedeutsamen Verhältnis zum Arzt, geben sie sich doch den Ärzten in die Hand; und zu jeder Stunde kommen sie mit Frauen, Mädchen und wertvollsten Besitztümern zusammen. All dem gegenüber muss er an sich halten“ (Di,kaion de. pro.j pa/san o``mili,hn ei=nai\ crh. ga.r polla. evpikoure,ein dikaiosu,nhn, pro.j de. ivhtro.n ouv mikra. sunalla,gmata toi/si nosou/si,n evstin\ kai. ga.r auvtou.j u``poceiri,ouj poie,ousi toi/j ivhtroi/j, kai. pa/san w[rhn evntugca,nousi gunaixi,n, parqe,noij, kai. toi/j avxi,oij plei,stou kth,masin\ evgkrate,wj ou=n dei/ pro.j a[panta e;cein tau/ta). Zum antiken Ärztebild (mit Literatur): VON BENDEMANN, REINHARD, Christus des Arzt – Krankheitskonzepte in den Therapieerzählungen des Markusevangeliums, in: Biblische Zeitschrift 54, 2010, 36-53, 162-178, hier: 52f., 162- 164. 29 Die Auffassung von HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 279, wonach die medizinische Metaphorik in „De sera numinis vindicta“ Gott in seinem Umgang mit dem Menschen „als heilenden, helfenden Arzt ...“ charakterisiere bzw. „das Bild eines auch in seinem Strafhandeln guten, helfenden Gottes, der die Menschen zu ihrem Heil führen“ wolle, vermittele, wird diesem Befund nur zum Teil gerecht. 30 Zu traditionsgeschichtlichen Voraussetzungen der Vorstellung kollektiver Haftung: GÖRGEMANNS, Plutarch, 333f. 28 13 nicht die Täter selbst, sondern gegebenenfalls erst ihre Kinder und weiteren Nachfahren Strafe erfahren, löst die Strafe von den Verursachern des Bösen und verlagert sie in eine Zukunft, in der gegebenenfalls selbst Unschuldige von den Taten ihrer Vorfahren eingeholt werden. Im Eingang der Schrift klang an diesem Punkt bereits das Problem an, dass Strafe, die nicht sogleich erfolgt und den Täter trifft, ihren pädagogischen Effekt zu verlieren droht (549 C). Dieser lange und hermeneutisch sehr schwierige Abschnitt von „De sera numinis vindicta“, in dem insbesondere Beispielen der antiken Mythologie eine zentrale Funktion zukommt, zerfällt in verschiedene argumentative Einzelfiguren. In ihnen spielen medizinale Metaphern in vielfältiger Weise eine stützende Rolle. a) Der Plutarch des Dialoges rekurriert auf das eingangs etablierte Prinzip der respektvollen Behutsamkeit in religiösen Fragen. Im 14. Kapitel (558 D/E) nimmt er „den Faden wieder auf“ und erinnert an die Gefahr von Verdunkelung und Irrwegen in der Rede vom Göttlichen, die einen eindeutigen Zugriff auf die Wahrheit verwehrt. Beispiele für in einem weiteren Sinn laienmedizinische bzw. magische Praktiken belegen, dass mit „Wirkungen“ auch dort gerechnet wird, wo sich Handlungen in ihrer Sinnhaftigkeit kaum entschlüsseln lassen. Dies gilt für den Brauch, nach einem Todesfall durch Schwindsucht oder Wassersucht die Kinder des Toten so lange mit ihren Füßen in ein Wasserbad zu setzen, bis die Leiche des Verstorbenen verbrannt ist. Derart soll ein magisch vorgestelltes ‚Überspringen’ der Krankheit des Verstorbenen gehemmt werden. Es klingt die Furcht an, die hinter entsprechenden Praktiken steckt. Vor allem ist ein erster Ansatzpunkt für die Erwägung gewonnen, dass es „Kräfte“ (duna,meij) gibt, die Fernwirkungen entfalten und über Distanzen, seien diese zeitlich oder räumlich, auf andere einwirken können (558 E).31 Die Pest von Athen fungiert als ein Beispiel für eine raum- und zeitübergreifende Krankheitsausbreitung. b) In einem weiteren Schritt betrachtet Plutarch den Stadtstaat sowie das „Geschlecht“ unter dem Aspekt ihrer jeweiligen Einheitlichkeit und Verbundenheit als „Lebewesen“ (zw|/on). Leben wird in ihnen von den Vorfahren her wesenhaft geprägt (559 E). Es gibt in ihnen eine Sympathie zwischen den einzelnen Körpern und Gliedern, und zwar in diachroner wie in synchroner Hinsicht. In einer Reihe unterschiedlich gelagerter und untereinander nicht spannungsfreier Beispiele und Erwägungen aus den Bereichen von Medizin und Pädagogik arbeitet Plutarch im 16. Kapitel (559 E-560 A) die 31 Zur Kombination der Bilder in „De sera numinis vindicta“ 558D/E: HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 261. 14 verborgene Sympathie von Körpern bzw. Körperteilen bei Mensch und Tier heraus, die im Fall von Erkrankungen virulent wird und folglich „übergreifende“ Maßnahmen der Heilkunst zur Erzielung von Gesundheit/Gerechtigkeit erfordert. Zugleich bereitet Plutarch hier den für „De sera numinis vindicta“ am Ende entscheidenden Übergang von der Rede von Körpern (vgl. 560 A: sw,mati dia. sw,matoj) zu der von der Seele (ebd.: yuch|/ dia. yuch/j) vor. Damit ist die Grundlage für den „Mythos“ vom postmortalen Geschick eines Übeltäters geschaffen. c) Bevor der Plutarch des Dialogs in die mythische Erzählung wechselt, führt er jedoch noch ein weiteres diskursives Argument ein (561 B/C). Dieses wird wiederum aus dem Feld der Heilkunst gewonnen. In der Frage, ob Verfehlungen von Eltern sich auf die Kinder übertragen können, nimmt Plutarch im 19. Kapitel seinen Ausgang von einem Wort des Bion von Borysthenes, nach dem die Vorstellung einer göttlichen Strafe an den Kindern der Bösen noch lächerlicher sei als die eines Arztes, der den Enkel oder den Sohn des kranken Großvaters oder Vaters behandele (561 C). Plutarch analysiert dieses dictum in Hinsicht auf seine „Ähnlichkeit“ und seine „Unähnlichkeit“. Im Fall von akuten Leiden wie Fieber oder Augenentzündungen ist eine Wirkübertragung der Therapie auf andere nicht möglich. Dagegen übersieht Bion – so der Plutarch des Dialogs –, dass es Krankheitsfälle gibt, in denen „Anlage“ oder Gewohnheit von Kranken sich auf die Folgegeneration(en) auswirken. Der Arzt hat in diesem Fall die Aufgabe, dies diagnostisch zu erkennen und prophylaktisch den „kleinen Keim eines großen Leidens“ zu bekämpfen (mega,lou pa,qouj spe,rma mikro,n; 561 D). Als Beispiele für generationenübergreifende Krankheitsprophylaxe, die gegebenenfalls auch die Kinder und Enkel einbeziehen wird, verweist Plutarch auf Medikamentation und diätetische Anweisungen im Fall von Epilepsie, Melancholie und Podagra.32 Fragt man nach der Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Metaphorik göttlicher Medizin, so verhilft sie in diesem überaus schwierigen Teil der Schrift zunächst zu phänomenologischen Unterscheidungen. Mit ihrer Hilfe kann nicht nur festgestellt werden, dass es Bitteres und Schmerzen gibt, die durch Verordnung sinnvoll werden. Vielmehr zeigt die metaphorische Klärung, dass sich zuweilen destruktive Dynamiken feststellen Zur überaus komplexen Argumentation in diesem Teil von „De sera numinis vindicta“: HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 266-175, der mit Recht fragt, inwieweit es Plutarch gelingt, die Anfrage Bions überzeugend zu entkräften (a.a.O., 269). 32 15 lassen. Nicht alle Krankheiten sind Erbkrankheiten, aber der Arzt hat damit zu rechnen, dass es sie gibt. In diesem Abschnitt der Schrift, innerhalb dessen sich die Vorstellung sinnlosen und unschuldigen – durch die Gottheit hervorgerufenen oder vermehrten – Leidens so nahe legt, changiert das zugrunde liegende Arztbild/Gottesbild beträchtlich. Einerseits wird auch hier an der These festgehalten, dass die Heilkunst gegebenenfalls als „Strafe“ zu interpretieren ist – so bei der ärztlichen Prophylaxe im Fall von Menschen, die zum Ehebruch oder zur Gewalttätigkeit o.ä. neigen.33 Andererseits sucht Plutarch zugleich, der Vorstellung des guten und qualifizierten Arztes, der das Richtige erkennt, das Hauptgewicht zu geben. Ausdrücklich wird vermerkt, dass im Fall eines von einem schlechten/kranken Körper gezeugten Körpers nicht von Strafe (timwri,a) zu sprechen sei – sondern von Heilkunst und ärztlicher Aufmerksamkeit (561 E). Mit Notwendigkeit wird der Plutarch des Dialoges in diese Differenzierung zwischen göttlichem Strafhandeln an Schuldigen einerseits und der heilvollen Zuwendung zu den Nachkommen andererseits gedrängt. Zudem wird sichergestellt, dass sich keine festen Gesetzmäßigkeiten des Übergreifens von Krankheiten/Übeln über die Generationenschranken hinweg ausrechnen lassen. Damit liegen aber auch die entsprechenden therapeutischen Maßnahmen nicht einfach fest (562 E). Das Prinzip der generationenübergreifenden Schuld- und Strafsolidarität kann zudem durchbrochen werden. Ein übler Vater kann einen rechtschaffenen Sohn haben wie – medizinisch betrachtet – ein robuster Mensch von einem Kränklichen abstammen kann (562 F). Plutarch modifiziert hier das medizinale Modell: Die gute Tat kann krankhafte Zusammenhänge und Dynamiken suspendieren. In einer Zwischenbilanz ist festzuhalten: Wir haben bei Plutarch so weit gesehen, dass die Metaphorik des göttlichen Arztes und seiner Heilkunst die Bedingungen einer ontologischen Metapher erfüllt, die zugleich Orientierungsfunktionen übernimmt. Gott als Arzt ist – in den kognitivistischen Kategorien beschrieben – als ein Gefäß konzeptualisiert, verbunden mit der orientierenden Wertung von richtig und falsch. Die Metapher fungiert dabei in zwei Richtungen. Einmal wird ausgehend von der Sinneserfahrung des Schmerzes gefragt, wie dessen Vorhandensein zu erklären ist. Im Verbund der Schrift steht damit das Gerechtigkeitsproblem zur Disposition. Unter der besonderen Fragestellung der 33 In 562 D verwendet Plutarch einige Mühe darauf, Grenzziehungen im Bild des Göttlichen vorzunehmen, die dieses von Rachsucht und affektivem Handeln absetzen. 16 Verzögerung – diese soll ja plausibel gemacht werden – wird Schuld als medizinische Dysfunktion erklärt. Kontingenz kann so bewältigt werden. Zum anderen strukturiert die Metapher das ätiologische Feld möglicher Schmerzursachen und -folgen. Unterscheidbar werden z.B. akute von chronischen Krankheiten bzw. der besondere Fall von generationenübergreifender Krankheitsveranlagung. Fragt man vom argumentierenden „Logos“ her, warum die Arztmetaphorik überhaupt solche Funktionen übernehmen kann, so ist festzuhalten: Möglich wird dies einmal dadurch, dass der Arzt auf der nichtmetaphorischen Ebene per definitionem ein Helfer in Krisen und Kontingenzsituationen ist. Plutarch baut hier auf dem etablierten Ärztebild seit der hippokratischen Medizin auf. Zum anderen aber ist ein ganz wesentlicher Aspekt in der Aktivierung medizinaler Metaphern durch Plutarch, dass das Aufsuchen des Arztes mit zusätzlichen sinnlichen Schmerzen verbunden sein kann. Menschen haben Schmerzen, und auch der Arzt verursacht Schmerzen – aber sein Ziel ist die Heilung. 2.6. Metaphorik und mythische Erzählung von postmortalem Leiden und Scham Der „Mythos“, mit dem die Schrift „De sera numinis vindicta“ schließt, eröffnet zuletzt die Möglichkeit, den fraglichen Zusammenhang von menschlichem Tun und göttlicher Strafe noch aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Der darstellerische Modus wechselt am Ende der Schrift von der argumentativen Rede zur eschatologischen resp. mythischen Erzählung. Eine solche Erzählung vermag eine Zeit und einen Raum zu antizipieren, die dem diskursiven „Logos“ verschlossen bleiben. Setzt der Plutarchische „Mythos“ als Gattung am Ende der Schrift das platonische Schrifttum voraus, so gilt dies auch für die ihm zugrunde liegende Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele. Diese wird in einer wichtigen Gelenkstelle bereits im „Logos“ in Kapitel 17f. verankert.34 Insbesondere kann Plutarch im Modus der mythischen Erzählung das schwierige Postulat eines generationenübergreifenden Strafhandelns der Gottheit nochmals aufgreifen. Einzelne dramatische Episoden des „Mythos“ führen aus, wie der generationenübergreifende Verbund und die kollektive Dimension göttlicher Strafe 34 Zu Platon als Ausgangspunkt der Plutarchischen Mythen sowie zur Traditionsgeschichte und Funktion des Mythos in „De sera numinis vindicta“: ALT, KARIN, Weltflucht und Weltbejahung. Zur Frage des Dualismus bei Plutarch, Numenios, Plotin, Mainz/Stuttgart 1993, 91-94; VON BENDEMANN, Konzeptionen, 260-263 mit Anm. 81f.; zum Schlussmythos in „De facie in orbe lunae“: WÄLCHLI, PHILIPP, Studien zu den literarischen Beziehungen zwischen Plutarch und Lukian (Beiträge zur Altertumskunde 203), München/Leipzig 2003, 199-216. 17 vorzustellen sind. Plutarch stellt diese Verbindung schon im „Logos“ (in 561 A/B) sicher, mit der ausdrücklichen Zielbestimmung einer Pädagogik der Abschreckung bzw. Ermunterung von schlechten Menschen. Der „Mythos“ illuminiert die Schmerzen und Krankheitsfolgen, die sich in Folge der Missachtung der Regeln göttlicher Heilkunst ergeben. Als ein Modellfall wird der Übeltäter Thespesios aus Soloi eingeführt, der von einer grundlegenden Wandlung seines verkehrten Lebens in Folge von Widerfahrnissen in einem todesähnlichen Zustand zu berichten weiß 35 . In der dritten Person wird erzählt, wie Thespesios in diesem Zustand schon bald die Bewegung der Seelen verfolgt, unter denen er auch Bekannte erkennt, die sich bald in beklagenswerter Gesellschaft befinden (564 B). Sodann wird er Zeuge der Instanzen jenseitigen Strafvollzuges an den Seelen. Seelen derer, die im Diesseits ungestraft davon kamen, werden von der Di,kh den Vorfahren vorgeführt. Eine erste, gegebenenfalls schmerzvolle, Begegnung der Generationen findet statt (565 B). Unter Qualen und Schmerzen (565 B: avlghdo,si kai, po,noij) werden die Leidenschaften/Begierden der Seelen entfernt.36 Am Strafort sieht Thespesios im 30. Kapitel (566 E-567 D) nicht allein Freunde, Angehörige und Bekannte furchtbare Leiden, Schmerzen und Strafen erdulden, sondern vielmehr auch seinen eigenen Vater aus einer Kluft aufsteigen, der von Brandmalen und Narben bedeckt ist (566 E). Der Vater wird von den Strafvollstreckern beschämt, indem er gezwungen ist, seinem Sohn gegenüber eine schwere Verfehlung zu bekennen. Er hat aus Habgier Gäste vergiftet und somit die Gastfreundschaft auf schlimmste Weise verletzt. Erst im Jenseits wurde diese Freveltat aufgedeckt. Unheilvolle Strafe vollzieht sich damit nicht nur in somatischem Schmerz, sondern in einer sich über die Generationengrenzen hinaus erstreckenden Scham und Beschämung. In einer weiteren Jenseitsepisode wird im 31. Kapitel von einer dramatischen Begegnung über die Generationengrenzen hinweg berichtet. Seelen, die ihre Höllenstrafen bereits abgeleistet zu haben meinen, treffen auf ihre Nachfahren, denen sie durch ihre Untaten schlimmes Geschick erwirkt haben. Die Vorfahren werden aufs Neue von den Strafvollstreckern gequält. Die Nachfahren, die sich wie zornige Bienen- oder Fledermausschwärme an ihre Vorfahren hängen, können hieran zugleich ablesen, auf welches Geschick sie selbst zusteuern (567 D/E). 35 Zum philosophiegeschichtlichen bzw. psychologischen Hintergrund des Sturzes auf den Hals (563 D) vgl. GÖRGEMANNS, Plutarch, 377f. Anm. 4. 36 Siehe zu den Vorstellungen im Einzelnen: ALT, Weltflucht, 92-94. 18 Fassen wir zusammen: Wir haben ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige ausgewählte Stellen der Plutarchischen Schrift „De sera numinis vindicta“ auf die Nutzung medizinaler Metaphernsprache hin befragt. Unser leitendes Interesse war dabei die Untersuchung der Gründung der metaphorischen Rede von Gott als Arzt in sinnlichen Körpererfahrungen. Insgesamt zeigte sich, dass medizinale Metaphern für die Thematik von Schicksal, Vorsehung und göttlicher Strafe so geeignet sind, da sie an Krankheitserfahrungen anschließen, für die Spezialisten mit ihrem Repertoire besonderer Behandlungsmaßnahmen zuständig sind: die Ärzte. In Hinsicht auf das Verständnis des Handelns der Gottheit entspricht das Axiom des grundsätzlich guten Arztes, der das Wohlsein seiner Patienten anzielt und der unbedingte Autorität beansprucht, dem gewählten methodischen Vorgehen, welches unter der Prämisse der euvla,beia in bonam partem fragt und argumentiert. Aus der Sicht der Patienten kann sich die gute Intention des Arztes freilich verdunkeln und können entsprechende Axiome an Grenzen stoßen. Vor allem in dieser Hinsicht wird die Gründung in der Sinneswahrnehmung aktiviert: Nicht nur Krankheitswiderfahrnisse, sondern auch Erfahrungen mit Ärzten können schmerzhaft und leidvoll sein, Therapien uneinsichtig, uneffektiv und am Ende leidvermehrend. Der „Mythos“ zeigt – in Aufnahme und Fortführung platonischer Mythen – die Grenzen der metaphorischen Rede von Gott als Arzt. Diese versagt im Fall nicht erkennbarer Schuld, sie wird dunkel im Fall der erblichen Erkrankung. Dies ist ein grundsätzlich interessanter Vorgang: Um die Grenzen der Metapher als einer sinnbasierten Konzeption von Leben und Welt zu beschreiben, bedarf es am Ende der Erzählung des „Mythos“, die Konsistenz schafft. Auch im „Mythos“ spielen dabei die Sinne eine wichtige Rolle, sie sind angesprochen in der Gestalt von Narben (ouvlai,), Striemen (mw,lwpej), Schmerzen (pa,scein), Betrübnis (lupei/n), schlimmem Schicksal (avtu,chma), Schande (aivsci,ein) resp. Aufhebung von Ehre (timh,) und Scham (vgl. 561 A/B; 565 B). Solche Jenseitsqualen werden mythisch nicht mehr ausdrücklich über die Arztmetaphorik eingeholt. Doch sind die entsprechenden Bezüge in der verstärkenden Verklammerung von „Mythos“ und „Logos“ sichergestellt (vgl. die wichtige Gelenkstelle in Kapitel 18f.). Krankheit heißt: In der Hölle, am Peinigungsort, nicht zur Ruhe kommen, vielmehr immer wieder aufs Neue Schmerzen leiden müssen.37 37 Zur Kohärenz von „Logos“ und „Mythos“: HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 278f. 19 3. Christus, der Arzt des Leibes und der Seelen – Zur Metaphorik göttlicher Heilkunst in altchristlichen Texten Wenden wir den Blick vom griechischen Apollo-Priester und philosophischen Schriftsteller Plutarch – einem großen Einzelnen – zum Feld der Literatur der frühen Christen, so geschieht dies unter der Voraussetzung, dass nach einem weitreichenden common sense der Forschung das Plutarchische Schrifttum nicht allein eine wichtige Brücke zwischen griechischem Mittelplatonismus und römischer Kaiserzeit schlägt, sondern sich in ihm – unter den Vorzeichen zunehmender Hellenisierung – zugleich auch ein Brückenschlag zur frühchristlichen Literatur erkennen lässt. Es überrascht insgesamt nicht, dass sich zu nahezu jeder Aktualisierungsform der Metaphorik göttlicher Medizin enge Parallelen im frühchristlichen Schrifttum benennen lassen. Einschränkend ist dabei festzuhalten, dass es in den ersten zwei Jahrhunderten keinen christlichen Text gibt, der in ähnlich umfassender und enzyklopädischer Weise auf die Metaphorik des Medizinischen zurückgreift.38 Der Betrachtungsmodus ändert sich darum in diesem Schritt. Wir gehen im Folgenden nicht von einem konkreten frühchristlichen Text aus, sondern benennen verschiedene metaphorische Aspekte und Konzepte und greifen hierfür auf unterschiedliche Beispiele zurück. Besonders lohnend ist es dabei, diachrone Entwicklungen metaphorischer Konzepte mit im Blick zu halten. Das frühe Christentum ist zunächst unterwegs zu einem metaphorischen Differenzierungsgrad, wie wir ihn im Schrifttum Plutarchs feststellen können; es geht unter veränderten Rahmenparametern zugleich in der Verwendung ganz ähnlicher ontologischer und orientierender Metaphern strukturell über ihn hinaus. Hierbei muss ich im folgenden zahlreiche Forschungsprobleme, die sich im Detail einzelner Schriften stellen, abschattieren. 3.1. Differenzen der Sinnstrukturierung, Orientierung und Ontologisierung der Metaphorik göttlichen Heilens Der Topos des „Christus medicus“ / Cristo.j ivatro,j findet sich explizit noch nicht in den neutestamentlichen Schriften. In den synoptischen Evangelien begegnet das Nomen „Arzt“ nur an drei Stellen: In der metaphorischen Aussage Jesu im Zusammenhang der Sündenvergebung (Mk 2,17 par Mt 9,12 par Lk 5,31), im Erzähleingang der Heilung der „Blutflüssigen“, die umsonst Ärzte konsultiert und ihr Vermögen an sie verwendet hat (Mk 5,26 par Lk 8,43) sowie in der ironisch-sprichwörtlichen Aufforderung, die Jesus nach Lk 4,23 entgegengehalten wird: „Arzt, heile dich selbst!“ (siehe antike Vergleichsstellen bei NOLLAND, JOHN, Classical and Rabbinical Parallels to ‘Physician, Heal Yourself’ [Lk. IV 23], in: Novum Testamentum 21, 1979, 193-209). 38 20 Zunächst ist festzuhalten: Sowohl Plutarch als auch die frühchristlichen Schriftsteller rechnen mit der Möglichkeit sinnlicher Erfahrung, dass Gott resp. die Gottheit kranke Menschen tatsächlich in medizinischem Sinn gesund zu machen vermag. 39 Im frühchristlichen Schrifttum wird solche Überzeugung allerdings unter differenten Vorzeichen zum Ausdruck gebracht. Zwei entscheidende Differenzpunkte seien herausgehoben: 1. Im Hintergrund steht im frühen Christentum die Überzeugung, dass Krankheit und Leiden Zeichen einer vergehenden und verlorenen Welt sind, die Gott zu überwinden im Begriff ist. Im weiteren Sinn wäre hier über den frühjüdisch-apokalyptischen Rahmen frühchristlicher Interpretation von Krankheit und Leid zu sprechen. – Ein Überzeugungsrahmen, der dem griechisch-römischen Denkens Plutarchs im Grundansatz fremd ist. Metaphorologisch betrachtet ändern sich die Vorzeichen – vergleicht man sie mit hellenistisch-römischen Zeugnissen – vor allem im Bereich der Orientierungsmetaphorik, d.h. der Strukturen von „nah“/„fern“, „vorne“/„hinten“ und auch „oben“/„unten“. Eine veränderte Sinnstrukturierung, die ihre Voraussetzungen traditionsgeschichtlich dem Judentum verdankt, macht im ältesten Christentum ganz andere Wahrnehmungen möglich und führt zu differenten Ontologisierungen von Krankheit und Heilung. Plutarchs Zeitvorstellung ist eine andere als die der frühjüdischen und frühchristlichen Eschatologie(n). Einschränkend ist dabei nochmals festzuhalten, dass sich eine summarische Position des ältesten Christentums (und auch des frühen Judentums) nicht bestimmen lässt, sondern Entwicklungen im Metaphorischen in Rechnung zu bringen sind. Die Nutzung medizinischer Vorstellungen erfolgt im Christentum bis zum Ende des 2. Jahrhunderts deutlich zurückhaltender und undifferenzierter als in der zeitgenössischen hellenistischen Philosophie festzustellen. Eine dem Plutarchischen Schrifttum vergleichbare Aneignung medizinischer Paideia stößt im frühen Christentum unter frühjüdischen Denkvoraussetzungen, wie wir sie beispielsweise im Sirach-Buch im 2. Jahrhundert v. Chr. (Jesus Sirach 38,1-15 [Septuaginta]) greifen können, auf beträchtliche Widerstände. Erst ab der Mitte des 2. Jahrhunderts kommt es – allmählich und nicht gleichmäßig – zu einer positiven Annäherung an die Einsichten der wissenschaftlichen Schulmedizin der Zeit und werden theologische bzw. christologische Reserven zurückgestellt. Der niedrigere Mit Recht HIRSCH-LUIPOLD, Denken, 233: „Eine Dichotomie zwischen der Behandlung des Leibes und der Seele, die bei einem metaphorischen Gebrauch vorausgesetzt sein müßte, besteht bei Plutarch gerade nicht. Die beiden Bereiche rücken so nahe aneinander und werden ineinander verschränkt, daß sie zum Teil kaum unterschieden werden können.“ 39 21 Differenzierungsgrad hängt dabei u.a. auch mit den differenten Bildungsvoraussetzungen der frühen Christen zusammen. Er ist in Hinsicht auf die sinnliche Basierung zugleich darin begründet, dass Christinnen und Christen in der Frühzeit überwiegend als Unterschichtsangehörige auf Grund ihrer begrenzten materiellen Ressourcen weniger Erfahrungen mit der heilenden Fähigkeit von Ärzten hatten. 2. Im Zentrum der Sinn- und Überzeugungswelt der frühen Christen steht eine Rettergestalt, der Heilungspotenzen in singulärer Weise zuzuschreiben sind. Der sinnliche Bezug ist dabei in nicht-metaphorischer Weise vorgegeben: Christus ist nach Überzeugung der ältesten Christen Arzt. Eine solche singuläre Gestalt mit Heilfähigkeiten, die an der räumlichen und zeitlichen Schaltstelle einer Weltenwende zu verorten wäre, ist dem religionsphilosophischen Denken Plutarchs inkommensurabel.40 Zusammengefasst finden wir im Schrifttum Plutarchs einen hohen Differenzierungs- und Elaborationsgrad der Metaphorik göttlicher Medizin. Entsprechende traditionsgeschichtliche Konzepte des zeitgenössischen Christentums sind dagegen noch in statu nascendi. Es ergeben sich aus dem Alten Testament und frühjüdischen Traditionspunkten erste Ansatzpunkte für die Vorstellung Gottes als Arzt; von hier aus ist dann eine längere Entwicklung in den ersten Jahrhunderten nachzuzeichnen. D.h. es ergibt sich auf dem religiösen Feld des frühen Christentums die spannende Möglichkeit, die Entstehung der ontologischen Metaphorik göttlicher Medizin in einem neuen Rahmen beobachten und sie in ihrer Entwicklung weiter verfolgen zu können. Vergleicht man schematisch, so ließe sich feststellen: Bei Plutarch ergänzt der „Mythos“ den „Logos“; das eigentliche Gewicht aber trägt in „De sera numinis vindicta“ der „Logos“, nicht der „Mythos“. Den „Mythos“ stellt Plutarch nur auf Nachfrage, zögerlich und mit einigen distanzierenden Bemerkungen ans Ende (vgl. De sera numinis vindicta 561 B; 563 B). Im frühen Christentum dominiert dagegen zunächst der „Mythos“ den „Logos“: Der „Mythos“ von Christus als sinnlich erfahrbarem Retter. Solche fundamentale 40 Wenn Plutarch das frühe Christentum gekannt hätte, hätte er es wahrscheinlich ähnlich verstehendmissverstehend mit religionsgeschichtlichem Interesse wie das Judentum wahrgenommen; es wäre ihm im Übrigen als Gestalt der deisidaimoni,a resp. superstitio erschienen (vgl. Plutarch, Quaestiones convivales IV [669 E-672 C] zu Plutarchs Sicht des Judentums). Vgl. STERN, MENAHEM, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Bd. I: From Herodotus to Plutarch, Jerusalem 21976; FELDMAN, LOUIS H., The Jews as Viewed by Plutarch, in: DERS., Studies in Hellenistic Judaism, Leiden 1996, 529-552. Zum Problem des superstitio-Vorwurfs: GUTTENBERGER, GUDRUN, Superstitio. Facetten eines antik-religionstheoretischen Diskurses und die Genese des frühen Christentums als religio, in: KRAUS, WOLFGANG (Hrsg.), Beiträge zur urchristlichen Theologiegeschichte (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 163), Berlin/New York 2009, 183-227. 22 Differenz schließt nun allerdings nicht aus, dass im Darstellerischen gleichwohl zahlreiche Parallelen zwischen frühchristlichen Erzählungen des Heiltäters Jesu bzw. zwischen der diskursiven Soteriologie der frühchristlichen Briefliteratur und der Plutarchischen Rede von der Gottheit als Arzt und seinen therapeutischen Bemühungen zu verzeichnen sind. 3.2. Ansatzpunkte und Entwicklungsstadien der Metaphorik göttlicher Medizin im ältesten Christentum Medizinische Metaphorik, die der Explikation der heilvollen Intention Gottes und der Möglichkeitsbedingungen realer Transformation des Lebens dient, findet sich bereits im christlichen Schrifttum des 1. Jahrhunderts. Aus dem Neuen Testament seien zwei Beispiele herausgegriffen. Diese Beispiele sollen dann noch genauer auf Ansatzpunkte einer Entwicklung hin befragt werden. 1. Im Epheserbrief spielt das Bild des „Leibes Christi“ eine zentrale Rolle. Es wird gegenüber der Leib Christi-Metaphorik des Paulus entscheidend weiterentwickelt. Schon Paulus setzt im 12. Kapitel seines ersten Briefes nach Korinth ein Körpermodell voraus, das sich auch antik-medizinischen Vorstellungen vergleichen lässt und in dem bestimmte Körperzonen und -funktionen besonders hervorgehoben erscheinen. 41 Der Verfasser des Epheserbriefes hat dieses auf die Vorstellung kirchlicher Einheit hin konzeptualisierte Körpermodell des Paulus weiterentwickelt. Besonders betont sind dabei im Epheserbrief im 4. Kapitel die Sehnen und Bänder, die die Kirche als Einheit umgreifen. Eph 4,16 ist dabei nicht, wie in der früheren Forschung vielfach postuliert wurde, vom Modell des Skelettbaus des Körpers her zu verstehen. Vielmehr steht die Vorstellung der „nervlichen“ Steuerung und Versorgung des Körpers vom Kopf her im Hintergrund, wie sie sich verschieden im Corpus Hippocraticum und auch bei Erasistratos findet. Zugleich wird die Einheit des vom Kopf her bestimmten Körpers betont. In kephalozentrischer Sicht erscheint der Leib von Christus als Kopf her organisiert, versorgt, aufgebaut und organologisch geeint. In der Konzeption des Epheserbriefes wird dabei den 41 Vgl. zur Nutzung der Leib-Metaphorik in 1. Korinther 12: ZELLER, DIETER, Der erste Brief an die Korinther (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament 5), Göttingen 2010, 394-404. „Paulus hat absichtlich gleichgestaltete (die Extremitäten) bzw. funktionsverwandte (zwei Sinnesorgane) Glieder gewählt, um zu zeigen, dass dennoch keines von ihnen überflüssig ist, sondern jedes seine eigene Aufgabe im Leib hat“ (a.a.O., 399). Diskutiert wird auch, ob es einen konkreten Bezug zu den Organdarstellungen als Votivgaben im Asklepieion von Korinth gibt (hierzu: FITZMYER, JOSEPH A., First Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary [The Anchor Yale Bible], New Haven/London 2008, 475f.). 23 kirchlichen Funktionsträgern eine besondere verbindungsstiftende und näherend-steuernde Funktion zugeschrieben. 42 Die entscheidende Differenzierungsmöglichkeit eröffnet sich über die kefalh,-Metaphorik, die sich wiederum durch antik-medizinische Konzepte erschließt: Im einen Fall wird die Funktionalität eines menschlichen Körpers von der kefalh, her erschlossen; nach anderen Konzepten ist eher ein Gegenüber von Kopf und Seele bzw. Geist und Leib zu konstatieren. 2. Ein zweites Beispiel: Die Bezeichnung „gesund machende Lehre“ (1Tim 1,10: u``giai,nousa didaskali,a; 2Tim 4,3; Tit 2,1) bzw. „gesund machende Worte“ (vgl. 1Tim 6,3: u`giai,nousin lo,goij toi/j tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/; 2Tim 1,13; vgl. Tit 2,8) bzw. die Rede vom Gesundsein resp. werden „im Glauben“ (Tit 1,13: i[na u`giai,nwsin evn th/| pi,stei; 2,2: u`giai,nontaj th/| pi,stei) markiert eine Besonderheit der in der dritten frühchristlichen Generation entstandenen Pastoralbriefe. Die Pastoralbriefe führen dabei eine Linie fort, die wir anders auch bei Plutarch feststellen konnten: Die wahre Philosophie ist eine Medizin, die richtige do,xa, die richtige Lehrmeinung, heilt von Trugschluss und Irrtum. Der Philosoph ist der Doktor nicht allein des Körpers, sondern auch zugleich der der Seelen. Das von Plutarch vorausgesetzte autoritative Gefälle zwischen Arzt und Klienten findet in den Pastoralbriefen eine enge funktionale Entsprechung im hierarchischen Gefälle zwischen dem idealen kirchlichen Amtsträger – in Gestalt von Episkopen und Ältesten – und kirchlichen Laien bzw. einfachen Gläubigen. Es handelt sich um ein metaphorisches Konzept, das nicht auf einen zeitgenössischen Ist-Zustand kirchlicher Ordnung zu befragen ist, sondern für einen begrenzten Raum ein ideales, anzustrebendes Modell („oben“/„unten“; „vorne“/„hinten“; siehe oben Punkt 1.) konzeptualisiert. Im Hinblick auf die Verwendung medizinischer Ausdrücke und Metaphern ist dabei die Applikation auf den Bereich christliche Lehre, des Lehrens und Lernens, besonders auffällig und signifikant. Antonym zu den Ältesten-Bischöfen als Garanten des Heils und der „gesunden Lehre“ ist das Verhalten der Gegner bzw. der von ihnen hervorgerufene Abfall vom rechten Glauben als „krankhaft“ einzustufen.43 42 Siehe zum Hintergrund der medizinischen Metaphern und ihrer Auslegung im Epheserbrief: LINCOLN, ANDREW T., Ephesians (Word Biblical Commentary 42), Nashville 1990, 262f.; SELLIN, GERHARD, Der Brief an die Epheser (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament 8), Göttingen 2008, 349-351. 43 Zu den Irrlehrern in den Pastoralbriefen vgl. ROLOFF, JÜRGEN, Der erste Brief an Timotheus (EvangelischKatholischer Kommentar zum Neuen Testament 15), Zürich u.a. 1988, 230-239. Vgl. a.a.O., 331, zu 1Tim 24 Der bildhafte Sprachgebrauch, der hier in den Pastoralbriefen aktiviert wird, ist sowohl in der griechisch-hellenistischen, der römischen als auch in der hellenistisch-jüdischen Antike gut vorbereitet. Insbesondere in der hellenistisch-römischen Philosophie kann das Vernünftige, Richtige, Ausgewogene, Maßvolle und der Ordnung Entsprechende als „gesund“ qualifiziert werden. Ähnlich den Distinktionen der Pastoralbriefe können in der kynisch-stoischen Popularphilosophie „gesunde“ von „kranken“ Lehrmeinungen unterschieden werden. Vorausgesetzt ist, dass die „Seele“ des Menschen durch die richtige Philosophie kräftig und gesund sein kann, durch verfehlte Meinungen dagegen physischen Schaden nimmt. Der Philosoph hat dementsprechend wie ein heilender Arzt zu agieren, der menschenfreundlich und empathisch die richtigen Lehren vertritt und so Gesundung der Seelen erwirkt. Hier stoßen wir auf dasjenige Selbstverständnis antiker Philosophie, das grundsätzlich den Schriften Plutarchs zugrunde liegt, darüber hinaus bei römischen Popularphilosophen wie Seneca oder auch bei Griechen wie Lukian und Dio Chrysostomus weit verbreitet war. Der besondere Akzent der Pastoralbriefe ist dabei in der grenzziehenden und teilweise polemischen Akzentgebung der Metaphorik gegen die Irrlehrer zu greifen. Diese betrifft einerseits die Lehre als solche und andererseits die unmittelbar mit ihr verknüpfte Praxis, d.h. das ethische Verhalten. Ihnen steht der ideale Gemeindeleiter gegenüber, dessen Bild die Briefe ausarbeiten. In seiner Lehre wird das apostolische Erbe gewahrt; auf seine „gesunde Lehre“ sollen die Christen achten und sich nach ihr ausrichten und sich von krankmachenden Lehren fernhalten.44 Fassen wir diese Textbeobachtungen noch einmal im Hinblick auf die metaphorischen Prozesse zusammen: 1. Überaus aufschlussreich ist nicht nur die Bedeutung, die die Leib-Metaphorik im frühen Christentum gewinnt, sondern vielmehr ihre besondere Verbindung mit der Frage nach der Funktion der kefalh, – des Kopfes. Es handelt sich um ein weiteres Beispiel für eine ontologische metaphorische „oben“/„unten“-Strukturierung von Wirklichkeit, für die in 1,10: „Die beiden beigelegten Prädikate ‚gesund’ und ‚der Frömmigkeit entsprechend’ umschreiben die Auswirkungen beider Traditionskomplexe und sind nahezu synonym gebraucht: ‚gesund’ ist das, was sich im Lebensvollzug der Kirche bewährt … und zu einem sinnvollen Miteinander gestalteten Lebens, d. h. zur ‚Frömmigkeit’ (euvse,beia) führt“. Dagegen gelten die Irrlehrer in 1Tim 6,4 als „krank“ (nosei/n). 44 Siehe zu den „gesunden Worten“ bzw. der „gesunden Lehre“ in den Pastoralbriefen und ihrem traditionsgeschichtlichen Hintergrund: ROLOFF, 1. Timotheus, 76-79; WEISER, ALFONS, Der zweite Brief an Timotheus (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament 16/1), Düsseldorf u.a. 2003, 130132. 25 den kognitivistischen Metaphernmodellen primäre Sinngrundierung beansprucht wird (siehe oben Punkt 1). Im Vergleich mit Plutarch muss dabei als besonders auffällig gelten, dass mit der gewählten Metaphorik im frühchristlichen Schrifttum die kollektive Identität thematisiert wird, kaum dagegen die individuelle Identität. Im Fall von „De sera numinis vindicta“ verhält sich dies anders, wie wir sahen: Mit Ausnahme des längeren Abschnittes in Kapitel 12-21, der um die Frage generationenübergreifender Schuld kreist und in dem auch soziale Vorstellungen der Mikrokosmos-Makrokosmos-Entsprechung genutzt werden, ist bei Plutarch die Frage der Bestrafung individueller Schuld bzw. der Ansatz beim individuellen Leiden konstitutiv. Dort wo sich im ältesten christlichen Schrifttum ähnliche metaphorische Figuren wie bei Plutarch finden, changiert ihre Anwendung. Übergänge lassen sich besonders gut im Verhältnis der anerkannt echten Paulusbriefe und derjenigen Briefe studieren, die im weiteren Sinn von Schülern des Paulus stammen. 2. Bei Paulus selbst, in Texten wie 1Kor 12 und Röm 12, geht es dabei in der metaphorischen Konzeptualisierung nicht um die Arztsorge für den kranken Leib, sondern vielmehr um die Selbstsorge des Leibes. Das metaphorische Konzept von Krankheit und Heilung bzw. das zugrunde liegende Gesundheitssystem konzeptualisiert hier die Lebenssituation einer Gruppe, die sich noch überwiegend – im engen Verbund zum antiken Judentum – als arztlose Gesellschaft weiß. Die Frage, die Paulus beschäftigt, ist darum, auch wenn er in 1Kor 12 mit charismatischen Wunderheilungen rechnet (vgl. 1Kor 12,9.23.30: iva,mata), nicht die, wer herzukommen wird, um den gestörten Organismus zu heilen, bzw. die, was der Arzt tun wird, sondern die den Text bewegende Fragestellung ist die, wie der Körper selbst so zu leben vermag, dass er als organische Einheit Erkrankung vermeidet oder überwindet. Strukturell kann man die Überordnung der Liebe über das Heilungswunder in 1Kor 13 oder auch die Metaphorik vom Fortschaffen des alten Sauerteiges in 1Kor 5,6 vergleichen. 3. Im Epheserbrief finden wir eine gegenüber Paulus veränderte Konzeption vor. Nicht mehr nur die Selbstorganisation des Leibes wird metaphorisch ausgearbeitet. Vielmehr wird mit der stärker betonten Orientierungsmetaphorik von „oben“ und „unten“ – Christus als Haupt in den Himmeln und sein Leib auf der Erde (vgl. Eph 1,22f.; 2,19; 4,10-13.15f.; 5,23f.; vgl. Kol 1,18) – Raum geschaffen für die Möglichkeit, dass Gott resp. Christus an 26 seinem Leib auch als Arzt handelt. Im Epheserbrief selbst ist dies allerdings nicht konsequent mit der Metaphorik göttlicher Medizin durchgeführt. 4. In gewisser Weise kann man die Pastoralbriefe als eine konsequente Fortführung der Metaphorik in der deuteropaulinischen Literatur begreifen, wobei im Hintergrund Paulus selbst steht. Die Gemeindeleiter fungieren als „Ärzte“, indem sie mit „gesunder Lehre“ bzw. „gesunden Worten“ behandeln, die sich bis hinein in konkrete diätetische Vorschriften ausdifferenzieren (vgl. 1Tim 5,23). Allerdings tritt in den Pastoralbriefen im Vergleich zum Kolosser- und Epheserbrief die Leibmetaphorik zurück. Und auch der oben angesprochene apokalyptische Orientierungsrahmen wird konzeptionell stark zurückgenommen. Zu fragen wäre auch, wie sich die Vorstellung der „gesunden Worte“ und der „gesunden Lehre“ zum etwa zeitgleichen nicht-metaphorischen Zugriff auf Jesus als konkreten Wundertäter in der Evangelienliteratur verhalten. Die Pastoralbriefe spiegeln so eine Konzeption, die sich nur bedingt in eine übergreifende Entwicklung medizinischer Metaphorik im frühen Christentum integrieren lässt. Ihr besonderer Beitrag lässt sich so beschreiben: Das frühe Christentum betritt mit seinen besonderen heilkundlichen Metaphern die philosophische Arena. Der ideale Amtsträger übernimmt dabei Funktionen des den Leib und die Seele therapierenden Philosophen. Dabei spielt das Konkurrenzmotiv gegenüber den Irrlehrern eine herausragende Rolle. Zugleich bleibt – anders als bei Plutarch – die Dominanz des „Mythos“ über den „Logos“ gewahrt. Die Wahrheit der „gesunden Lehre“ wird über den „Mythos“, die apostolische Tradition, begründet; sie wird demgegenüber – anders als bei Plutarch – weniger argumentativ-metaphorisch erschlossen. Hiermit hängt auch zusammen, dass die Basis eigener Erfahrungen der Leserschaft mit konkreter körperlicher Dysfunktionalität und leiblicher Heilung nicht so deutlich angesprochen ist, wie im Fall der untersuchten Plutarchstellen. 4. Das Christologumenon des Arztes – Zur weiteren Entwicklung der Metaphorik göttlicher Heilkunst im frühchristlichen Schrifttum Die religiöse Verwertung medizinischer Metaphern ist im ältesten christlichen Schrifttum nur ansatzweise und zurückhaltend durchgeführt. Dies entspricht insgesamt den Befunden für das alttestamentliche und frühjüdische Schrifttum. – Die Gründe, die sich hierfür anführen lassen, sind mehrgestaltig; die immer wieder bemühte These vom sogenannten 27 Heilungsmonopol des Gottes Israels ist für sich genommen nicht suffizient. Unter anderem sind auch die oben bereits angesprochenen Bildungsvoraussetzungen der frühen Christen mit in Rechnung zu bringen. Jedenfalls ist auffällig, dass erst im Laufe des 2. Jahrhunderts eine Entwicklung einsetzt, die dann durch die Alte Kirche hindurch weiter zu verfolgen ist: In immer stärkerem und differenzierterem Ausmaß gewinnt die Metaphorik der göttlichen Medizin zur Explikation des Heils an Konjunktur.45 1. Die Entwicklung zentriert sich dabei weniger in der Vorstellung vom deus medicus, die sich in der folgenden Väterliteratur auch immer wieder findet, als vielmehr in dem Christologumenon: Christus als Arzt. Die metaphorische Rede von Christus als Arzt begegnet erstmals in einem frühchristlichen Brieftext, nämlich bei Ignatius von Antiochien in seinem Brief an die Gemeinde von Ephesos. Im Epheserbrief des Ignatius (IgnEph 7,2) ist eine im Judentum theologisch gefasste Vorstellung christologisiert worden46, wenn es heißt: „einer ist Arzt, fleischlich und zugleich geistlich, gezeugt und ungezeugt, in Fleisch gewordener/erschienener Gott, im Tod wahrhaftiges Leben …“ / ei-j ivatro,j evstin( sarkiko,j te kai. pneumatiko,j( gennhto.j kai. avge,nnhtoj( evn sarki. geno,menoj qeo.j( evn qana,tw| zwh. avlhqinh, …). Funktional ist das Arzt-Attribut hier der Rede von der „gesunden Lehre“ in den Pastoralbriefen vergleichbar: Es hat eine antihaereseologische Spitze. Der Kontext von IgnEph 7,1f. gibt zu erkennen, dass sich das Bekenntnis – metaphorisch – gegen „tollwütige“ und bissige Hunde richtet: ou]j dei/ u``ma/j fula,ssesqai o;ntaj dusqerapeu,touj. Tollwut gilt in der antiken Medizin als „elendste Form der Krankheit“ (Celsus, De Medicina V 27,2: „miserrimum genus morbi“).47 Der Arzt ist somit eher ein „bodyguard“, ein „Wächter“, als ein medizinischer Fachmann. Die Intention des Ignatius ist dabei darin zu erkennen, die Gleichgewichtigkeit und -bedeutsamkeit von 45 Vgl. den allgemeinen Überblick über die Entwicklung von Heilungskonzepten in der Alten Kirche: NIELSEN, HELGE K., Heilung und Verkündigung. Das Verständnis der Heilung und ihres Verhältnisses zur Verkündigung bei Jesus und in der ältesten Kirche (Acta Theologica Danica 22), Leiden u.a. 1987, 216-252. 46 Vgl. schon die christologische Deutung von Jes 53,5.7LXX in Barnabasbrief 5,2; vgl. Philo, De sacrificiis Abelis et Caini 70 von Gott: evpi. to.n mo,non ivatro.n yuch/j; vgl. Theophilus, Autolyc 1,7; dagegen Acta Thomae 10,6 (im Kontext): o` ivatro,j tw/n evn no,sw| katakeime,nwn yucw/n kai. swth,r pa,shj kti,sewj; 143,3: pisteu,sate tw|/ pa,ntwn ivatrw/| o``ratw/n te kai. avora,twn swthri,an tw/n yucw/n. 47 Vgl. STAMATU, MARION, Artikel „Tollwut“, in: LEVEN, KARL-HEINZ (Hrsg.), Antike Medizin. Ein Lexikon, München 2005, 870f. 28 fleischlicher und pneumatischer Realität Christi unter soteriologischem Vorzeichen festzuhalten.48 2. Als zweites sei ein Beispiel aus der altchristlichen erzählenden Literatur 49 herausgegriffen, in dem das Christologumenon des Arztes im Zusammenhang der Praxis Dabei kann hier das Problem offen gehalten werden, inwieweit die „kranke Lehre“, gegen die Ignatius den Arzt Christus bemüht, als „Doketismus“ bezeichnet werden darf. Überhaupt müssen hier weitere Vergleichsschritte zurückgestellt werden, die die religiösen „Kontakttypen“ betreffen. In religionsgeschichtlicher Hinsicht wäre sonst das Konkurrenzproblem zwischen Asklepios und Christus zu thematisieren – eine Frage, die angefangen beim vierten Evangelium über die apokryphen Johannesakten bis hin zu Justin sehr umstritten ist (zur Entwicklung der gegenseitigen Wahrnehmung und des Verhältnisses von Asklepioskult und werdendem Christentum in der Zeit des Prinzipats: STEGER, FLORIAN, Asklepiosmedizin. Medizinischer Alltag in der römischen Kaiserzeit [Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beiheft 22], Stuttgart 2004, 95-104; mit weiterer Literatur). Anders als RENGSTORF, KARL HEINRICH, Die Anfänge der Auseinandersetzung zwischen Christusglaube und Asklepiosfrömmigkeit (Schriften der Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Wilhelmsuniversität zu Münster 30), Münster 1953, meinte, ist für die Quellen des 1. Jahrhunderts noch kein vitaler Streit um den Vorrang Christi oder des Asklepios als „Heiland“ vorauszusetzen (vgl. zum vierten Evangelium und hier besonders zu Joh 4: a.a.O., 7, 11-13, 16, 20-25, 30-32). Die These einer kritischen Grenzziehung im Johannesevangelium gegenüber Asklepiosvorstellungen begegnet seitdem immer wieder (vgl. z.B. WOHLERS, MICHAEL, Heilige Krankheit. Epilepsie in antiker Medizin, Astrologie und Religion [Marburger Theologische Studien 57], Marburg 1999, 81, zu Joh 5,2-9b), bleibt aber mit vielen Unsicherheiten verbunden und beschreibt entsprechend bis heute keinen Konsens (kritisch im Blick auf Joh 5: THEOBALD, MICHAEL, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-12 [Regensburger Neues Testament], Regensburg 2009, 372-375; zur Kritik auch DÖRNEMANN, MICHAEL, Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter [Studien und Texte zu Antike und Christentum 20], Tübingen 2003, 283f., der den jüdischen Hintergrund stark gewichtet und z.B. die 38 Jahre Krankheit in Joh 5,5 von Dtn 2,14 her erklären möchte). ARBESMANN, RUDOLPH, The concept of ‚Christus Medicus’ in St. Augustine, in: Traditio 10, 1954, 1-28, vertrat die These, dass das Christologumenon vom Arzt im 2. und 3. Jahrhundert aus dem Kampf mit dem Asklepioskult resultierte (besondere Bedeutung haben Origenes, Arnobius und Lactantius), nach dieser Auseinandersetzung jedoch an Bedeutung verloren habe. Augustin habe die Vorstellung dann im Sinn des medicus humilis revitalisiert. Zur produktiven Funktion des Konkurrenzverhältnisses zum Asklepioskult sowie des Hintergrundes des kynisch-stoischen Philosophie bei der Entstehung des Christus medicus-Motivs vgl. klassisch: FICHTNER, GERHARD, Christus als Arzt. Ursprünge und Wirkungen eines Motivs, in: Frühmittelalterliche Studien 16, 1982, 1-18; KNIPP, DAVID, ‚Christus Medicus’ in der frühchristlichen Sarkophagskulptur. Ikonographische Studien zur Sepulkralkunst des späten vierten Jahrhunderts (Supplements to Vigiliae Christianae 37), Leiden u.a. 1998, 3f. Als eine „pagane“ Reaktion auf christliche Vorstellungen interpretiert Justin Aussagen über Asklepios (Apologie I 22,6; 30f.; 54,10; Dialogus 69,3 u.a.; siehe DÖRNEMANN, a.a.O., 89-91). Origenes integriert in „Contra Celsum“ seine Stellungnahme zu Asklepios in die weitere Kontroverse mit der paganen Götterwelt, in der er die Überlegenheit Christi aufzuzeigen versucht (Herakles, Dionysos, Apollon u.a.; vgl. Origenes, Contra Celsum III 22-26; 42; DÖRNEMANN, a.a.O., 122-124). Insgesamt zeigt ein Durchgang durch die Belege für Gott resp. Christus als Arzt bei den christlichen Kirchenvätern, dass das Syntagma „Christus als Arzt“ seinen Ort nicht primär in der Auseinandersetzung mit „paganen“ Kulten hat. DÖRNEMANN erwägt, ob diese nicht gerade zu einer Verminderung des Topos geführt haben könnte: „denn es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass Jesus und die anderen Heilgötter qualitativ vergleichbar seien“ (a.a.O., 287). 49 Wiederholt wird die Vorstellung von Christus als Arzt in den apokryphen Apostelakten aktiviert (vgl. DÖRNEMANN, Krankheit, 69-79). In den ans Ende des zweiten Jahrhunderts oder in die erste Hälfte des dritten Jahrhunderts zu datierenden Johannesakten gilt Christus als von Gott gesandter Arzt (Acta Johannis 56). Hierbei wird die Exklusivität stark betont (vgl. das mo,noj in Acta Johannis 108). Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt ist die Auskunft, dass Christus und seine Apostel – anders als in anderen Heilkulten üblich –ohne Zahlungsforderungen heilen (Acta Johannis 108: dwrea,n; so auch im Gebet Acta Johannis 22 im Zusammenhang einer Totenerweckung). In Acta Johannis 56 bietet Antipatros dem Johannes in Smyrna zehntausend Goldstücke für die Heilung seiner beiden Söhne, wogegen dieser kontert, dass sein Arzt keinen Geldlohn nimmt, vielmehr als Ernte die Seelen der Geheilten empfängt. Beide Aspekte lassen sich im Sinne einer Profilierung der eigenen Heiltätigkeit im Vergleich mit antiken Konkurrenten, allen voran Asklepios (zu seiner Geldgier: Clemens Alexandrinus, Protreptikos II 30,1f.: e;ceij kai. ivatro,n, 48 29 der Apostel zentrale Bedeutung hat. Obwohl es sich um einen in den weiteren Umkreis der werdenden Gnosis führenden Text handelt, eignet sich dieser, Merkmale, die wir so weit festgestellt haben, noch einmal zusammenfassend zu benennen. In den (auf einer nicht erhaltenen griechischen Vorlage basierenden und möglicher Weise schon im 2., wahrscheinlicher erst im 3. Jahrhundert entstandenen) koptischen (erst später so benannten) „Taten des Petrus und der zwölf Apostel“ (Nag Hammadi Codex VI) 50 machen sich die Apostel am Ende auf den Weg zur Stadt des Lithargoël (eingeführt in 5,16-18 als Perlenhändler).51 Dieser kommt – von den Aposteln unerkannt – aus der Stadt in der Gestalt eines Arztes, mit einer Salbbüchse unter dem Arm sowie einem Schüler im Gefolge, der einen Arzneimittelbehälter trägt. In einem folgenden Zwiegespräch mit Petrus entpuppt sich Lithargoël als der auferstandene Christus (9,14-21). Die elf Jünger werfen sich vor ihrem Herrn nieder und befragen ihn nach seinem Auftrag. Lithargoël übergibt ihnen daraufhin die Salbbüchse sowie den Arzneikasten und sendet sie in die „Inselstadt“, womit die Welt gemeint ist, u.a. mit dem Auftrag, sich der Armen anzunehmen. Sodann sollen die Jünger den Arzneimittelkasten dafür gebrauchen, die an den Namen Jesu Glaubenden zu heilen (10,31-34). Es erfolgt dann ein Einwand im Blick auf die mangelnde ouvci. calke,a mo,non evn qeoi/j. o`` de. ivatro.j fila,rguroj h=n, vAsklhpio.j o;noma auvtw|/), interpretieren. Die Aussage der unentgeldlichen Heilung findet sich in Verbindung mit der doppelten Arztfunktion für Körper und Seelen auch in einem Gebet des Judas in den wahrscheinlich zu Beginn des dritten Jahrhunderts in Ostsyrien entstandenen Thomasakten (Acta Thomae 156; zu weiteren Belegen: DÖRNEMANN, a.a.O., 73-75). Das Christologumenon des Arztes steht hier in semantischer Nachbarschaft zu Christus als „Herberge“ und „Hafen“ sowie zur Vorstellung der Katabasis und ist eng mit der Soteriologie der Thomasakten verwoben (hierzu DRIJVERS, HAN J.W., Thomasakten, in: HENNECKE, EDGAR/SCHNEEMELCHER, WILHELM, Neutestamentliche Apokryphen. Bd. II: Apostolisches. Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen 51989, 289-303, hier: 294f.). 50 Vgl. Einleitung und Übersetzung in: PARROTT, DOUGLAS M. (Hrsg.), Nag Hammadi Codices V, 2-5 and VI with Papyrus Berolinensis 8502, 1 and 4 (Nag Hammadi Studies 11. The Coptic Gnostic Library), Leiden 1979, 197-229; SCHENKE, HANS-MARTIN, Die Taten des Petrus und der zwölf Apostel, in: HENNECKE /SCHNEEMELCHER, Neutestamentliche Apokryphen II, 368-380; deutsche Übersetzung auch: DERS., in: Nag Hammadi Deutsch 2. Band: NHC V,2-XIII,1, BG 1 und 4. Eingeleitet und übersetzt von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften, hrsg. von SCHENKE HANS-MARTIN/BETHGE, HANS-GEBHARD/KAISER, URSULA ULRIKE (GCS NF 12; Koptisch-Gnostische Schriften III), Berlin/New York 2003, 443-453. Vgl. zu den einleitungswissenschaftlichen Fragen: RÖWEKAMP, GEORG, Artikel: „Petrus-Literatur“, in: Lexikon der antiken christlichen Literatur, 496f.; KLAUCK, HANS-JOSEF, Apokryphe Apostelakten. Eine Einführung, Stuttgart 2005, 191-201. Vgl. SELL, JESSE, Simon Peter’s ‚Confession’ and The Acts of Peter and the Twelve Apostles, in: Novum Testamentum 21, 1979, 344-356. Die Frage der Zuordnung des Textes zur werdenden Gnosis ist umstritten. Vgl. auch LÜDEMANN, GERD, Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von LÜDEMANN, GERD/JANSSEN, MARTINA, Stuttgart 1997, 318 (möglicherweise „Produkt asketischenkratitischer Kreise“). 51 Zu den Spannungen zu den beiden vorausgegangenen Teilen und zum Namen Lithargoël siehe SCHENKE, Taten, in: HENNECKE/SCHNEEMELCHER II, 368-374, hier: 373. Zur Nähe zum Heilungsauftrag des Erzengels Raphael im Tobitbuch: DÖRNEMANN, Krankheit, 78. 30 medizinische Ausbildung der Jünger. 52 Hieran schließt eine Differenzierung zwischen leiblicher Heilung und Heilung der Herzen als Aufgabe der Seelenärzte an (11,14-26). Die relevanten Passagen lauten in der Übersetzung von H.-M. SCHENKE: „Siehe, da kam Lithargoël heraus, in einer anderen Gestalt als der, die wir kannten, (nämlich) in der Gestalt eines Arztes, der ein Arzneikästchen unter der Achsel trug und dem ein Schüler mit einem Koffer voller Arznei folgte …“ (8,14-16). „Er überreichte ihnen das Medizi<n>kästchen und den Koffer, den der Schüler hatte …“ (9,30-32). „Da antwortete Johannes und sprach: ‚Herr, wir scheuen uns vor dir zu sehr, um viele Worte zu machen. Aber du verlangst von uns, daß wir diese Kunst ausüben. Wir sind nicht in ihr ausgebildet worden, um als Arzt wirken zu können. Wie also sollen wir die Fertigkeit haben, an Körpern Heilungen zu vollziehen, wie du es uns aufgetragen hast?’ Er antwortete ihnen: ‚Vortrefflich hast du, Johannes, (einmal) gesagt: „Ich weiß, daß die Ärzte der Welt (nur) die weltlichen (Krankheiten) heilen, die Ärzte der Seelen aber das Herz heilen. Heilt also zuerst die Körper, damit auf Grund dieser aufweisbaren Wunder der Heilung ihres Leibes, (die) ohne Arznei aus diesem Äon (erfolgt), sie euch glauben, daß ihr die Vollmacht habt, auch die Krankheiten der Herzen zu heilen’“ (11,6-26). In diesem Text sind drei Aspekte ineinander geflossen, die wir so weit bereits beobachten konnten: Erstens begegnet hier die für christliche Texte als typisch erachtete epochale metaphorische „jetzt“/„dann“- bzw. „hier“/„dort“- und „vorne“/„hinten“-Unterscheidung: Die Weltgeschichte zerfällt in zwei Epochen: Eine vor der christlichen Mission und eine unter ihrem Einfluss in Folge der Auferstehung Jesu. Der eigentliche Akzent liegt in der christlichen Sicht auf der neuen Epoche. Zweitens kann man bestätigt finden, dass Erfahrungen von Heilung mit dem Wundertäter Jesu den Ausgangspunkt der frühchristlichen Überzeugungen beschreiben: Lithargoël-Christus ist der Arzt, der physisch Kranke physisch gesund macht. Das Christentum geht also nicht nur metaphorisch mit Heilung um, sie „bedeutet“ nicht nur etwas, sie ist – auch in der Heiltätigkeit der Apostel nach Ostern – körperlich konkret erfahrbar. Drittens aber ist hier die Linie der metaphorischen Konzeptualisierung des christlichen Aposteldienstes in der Gestalt der Heilung der Herzen zu greifen, die auf die Ebene der christlichen Lehre, des christlichen Glaubens verweist, der auch die Seele gesund zu machen vermag. 3. Im Blick auf die weitere altchristliche Entwicklung müsste nach Zeiten, Orten, individuellen Autoren sowie vor allem auch nach Textgattungen dezidiert differenziert Ob man aus dieser Stelle schließen darf, dass es in der „Gemeinde“ der „Taten“ einen eigenen Ärzte- (und Apotheker-)stand gegeben hat (so WOHLERS, Krankheit, 85; vgl. a.a.O., 235), muss unsicher bleiben. 52 31 werden. Die Annahme kontinuierlicher und übergreifender traditionsgeschichtlicher Entwicklungen ist in vielen Fällen nicht zu erhärten. Um wenigstens einige wenige Stichworte zu geben: Neben vielen anderen 53 hat vor allem Origenes von dem Christologumenon des Arztes Gebrauch gemacht. Christus wird bei ihm zum Engel und Propheten überragenden „Oberarzt“ (avrciatro,j), der allein auch von der evpiqumi,a zu heilen vermag, da er selbst ohne Krankheit/Sünde war.54 Bei Euseb von Caesarea erschließt sich die Weltgeschichte als eine therapeutische Geschichte Gottes mit den Menschen. Der beste und alle überragende Arzt aber war Christus (Eusebios, Praeparatio Evangelica I 5,5: kai. o`` me.n tw/n ivatrw/n a;ristoj eivj me,son parelqw.n a[ te crh. profula,ttesqai kai. a] prosh,kei dra/n w[sper tij a;rcwn kai. ku,rioj met v evpisth,mhj prosta,ttei [….]; vgl. Eusebios, Historia Ecclesiastica X 4,11: ivatrw/n a;ristoj). Erst allmählich wird so auch in der Wahrnehmung medizinaler Phänomene und in ihrem metaphorisch-deutenden Gebrauch ein ähnlicher Differenzierungsgrad erreicht, wie er für das Schrifttum Plutarchs festzustellen war. 55 Sehr nahe kommt Plutarch mit seiner 53 Wie viele christliche Väter kennt auch Clemens Alexandrinus die Rede vom deus medicus vor und neben dem Christus medicus. Vgl. vom väterlichen lo,goj: Paidagogos I 2,6; vgl. I 9,88 u.a. Bei Justin heißt Christus in der Verteidigung gegen Anschuldigungen der „paganen“ Welt zwar nie ivatro,j, aber vergleichbar qerapeuth,j (Justin Apologie I 33). Siehe DÖRNEMANN, Krankheit, 89-91. 54 Vgl. Origenes, Homilien zu Samuel V 6, von der „Katabasis“ des „Oberarztes“ zu den Kranken; vgl. Homilien zu Jeremia 18,5. Zur Sündlosigkeit/Krankheitslosigkeit Christi: Contra Celsum IV 15: „Freilich entgeht der Arzt, wenn er die schrecklichen Dinge sieht und sich mit den widrigen Sachen befassen muß, keineswegs der Gefahr, in dieselben (Krankheiten) verfallen zu können. Derjenige aber, der ‚die Wunden’ unserer Seelen durch den in ihm wohnenden Logos Gottes heilt, war selbst unempfänglich für jede Sünde“. Origenes verbindet Jes 53,3f. mit der christologischen Arztmetapher (Homilien zu Leviticus VII 2; siehe DÖRNEMANN, Krankheit, 154). Vgl. bei Origenes die Aufnahme von Mk 2,17 in Contra Celsum II 67: wvj ivatro.j avgaqo,j (vgl. Irenaeus, Adversus Haereses III 5,2). Nach Origenes, Contra Celsum III 54 u.a.m. heilen die Christen mit der Arznei der Glaubenslehre. Origenes akzentuiert so vor allem die göttliche Medizin. Hierbei spielt der Gedanke der göttlichen Pädagogik eine wesentliche Rolle (siehe DÖRNEMANN, a.a.O., 131-141; DERS., Medizinale Inhalte in der Theologie des Origenes, in: SCHULZE, CHRISTIAN/IHM, SIBYLLE [Hrsg.], Ärztekunst und Gottvertrauen. Antike und mittelalterliche Schnittpunkte von Christentum und Medizin [Spudasmata 86], Hildesheim u.a. 2002, 9-39). Im Vergleich mit dem menschlichen Arzt ist Gott kein Leiden unüberwindlich – was Origenes von Mk 2,17 her vorrangig auf die Sünde bezieht (Contra Celsum VIII 72). Christologisch ist die Arzttitulatur in die Epinoiai-Lehre des Origenes einzuzeichnen. Siehe den Überblick bei DUMEIGE, GERVAIS, Le Christ médecin dans la littérature chrétienne des premiers siècles, in: Rivista di Archeologia Cristiana 48, 1972, 115-141; DÖRNEMANN, Krankheit, 141-157; nach FERNÁNDEZ, SAMUEL, Cristo Médico según Orígenes. La Actividad Médica como Metáfora de la Acción Divina (Studia Ephemeridis Augustinianum 64), Rom 1999, 280, überwiege bei theologischer Anwendung im Werk des Origenes der Vergleich, bei christologischer Applikation dagegen die Metapher. Im Licht der jüngeren kognitivistischen Metapherntheorien ist derart kaum mehr zu differenzieren (siehe oben Punkt 1.; vgl. GERBER, Paulus, 103-105). 55 Es geht zu weit, wenn MATOUŠEK meint, das Christentum habe grundsätzlich die gesamte wissenschaftliche Medizin abgelehnt (MATOUŠEK, MILOSLAV, Zur Frage des Verhältnisses des Urchristentums zur Medizin, in: Zeitschrift für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin 1, 1960, 74-79, hier: 76). Doch ist festzustellen, dass erst allmählich einzelne Kirchenväter die positive 32 metaphorischen Entgegensetzung von medizinischem Spezialisten und Laien, von schmerzhaften Therapieformen und der Sehnsucht der Klienten nach Wohlsein und Heilung auch Irenaeus in „Adversus haereses“ III 5,2: „Welcher Arzt, der einen Kranken heilen will, richtet sich aber nach dem, was der Kranke sich wünscht, und nicht nach dem, was die Heilkunde verlangt?“56. Insgesamt gewinnt der Christus medicus im christlichen Schrifttum bald den Charakter eines fundamentalen metaphorischen Netzwerkes, das sich in verschiedene Subkonzepte ausdifferenzieren lässt. Dieses Netzwerk eröffnet Wege für eine immer differenziertere Entfaltung, die sich auf alle Aspekte der christlichen Lehre in ihrer Applikabilität richtet. Medizinische Metaphern finden sukzessive Eingang in die Beschreibung verschiedenster theologischer, anthropologischer, ethischer, besonders aber soteriologischer Lehranschauungen. Breite Bedeutung erhält das metaphorische Konzept des Cristo.j ivatro,j z.B. in der altchristlichen Sakramentologie. Taufe und Herrenmahl werden zu ontologischen Metaphern. Die Taufe kann so als „aqua medicinalis“ gelten (Tertullian)57 oder das Herrenmahl als „Arznei der Unsterblichkeit“ (fa,rmakon avqanasi,aj; Ignatius, Epheserbrief 20,2). Als Hintergrund für solche Aussagen stellt sich dabei auch Funktion der Medizin hervorheben und sich selbst auch auf medizinische Fachtexte berufen. Gegenüber dem Gros der neutestamentlichen Schriften beschreibt es einen innovativen Schritt, wenn Clemens Alexandrinus ohne jede Kritik die Heilkunst auf einen Ureinwohner Ägyptens zurückführen (Stromata I 75,2) und ausführen kann: „So kommt z.B. die Gesundheit durch die Heilkunst und das körperliche Wohlbefinden durch Übung in den Ringschulen und der Reichtum durch die Kunst, sich ein Vermögen zu erwerben, zustande und tritt so in Erscheinung zwar entsprechend der göttlichen Vorsehung, aber doch unter Mitwirkung von Menschen … “ (Stromata VI 157,2). Tertullian beruft sich nicht allein auf die frühe hippokratische Medizin, sondern auch auf den großen alexandrinischen Arzt Herophilos, ferner auf Galen, Soran u.a. Nach SCHIPPERGES bezog er eine Mittlerrolle zwischen der dogmatischen und empirischen Schulrichtung der Medizin (SCHIPPERGES, HEINRICH, Artikel: „Krankheit IV. Alte Kirche“, in: Theologische Realenzyklopädie 19, 686-689, hier: 688). Auch Origenes kann in der „scientia sanitatis“ eine „sapientia a Deo“ erkennen (Origenes, Homilien zu Numeri XVIII 3 [GCS Or. VII/2 171; vgl. DÖRNEMANN, Krankheit, 124 mit Anm. 113]: „Omnis sapientia a Deo est. Iam vero de medicinae scientia nec dubitari puto. Si enim est ulla scientia a Deo, quae magis ab eo erit quam scientia sanitatis, in qua etiam herbarum vires, et succorum qualitates, ac differentiae dignoscuntur?“ Vgl. Sir 1,1: „Alle sofi,a ist vom Herrn …“. Das Argument, dass die Medizin von Gott geschaffen ist, wird von den Vätern häufiger genutzt [auch Clemens]). Solches „intellektuelle“ Urteil über Beruf und Wissenschaft ist dabei natürlich nicht eo ipso für literarisch ungebildete Zeitgenossen vorauszusetzen. Es wurde in Fällen begünstigt, wo einzelne Väter selbst in Berührung mit medizinischer Fachausbildung kamen. Insgesamt hat jedenfalls der Vorbehalt, den das frühe Christentum mit dem Judentum teilte, noch längere Zeit mit nachgewirkt, nach dem für Heilung allein der eine Gott Israels zuständig sein könne, auf den allein auch die Frage nach den Ursachen von Erkrankungen zu beziehen sei. Der Vorwurf des Celsus, die Christen würden die Menschen von „kundigen Ärzten“ fernhalten, bezieht sich zwar metaphorisch auf die Philosophie (Origenes, Contra Celsum III 75), inkludiert aber den generellen Vorwurf der Wissenschaftsfeindlichkeit. 56 Siehe zur Stelle DÖRNEMANN, Krankheit, 96f. 57 Siehe zu Tertullians Entwicklung im Blick auf Taufe und zweite Buße: DÖRNEMANN, Krankheit, 169f. 33 die Frage, inwieweit sich ein eigener christlicher Arztstand und ein christliches Arztethos auszuentwickeln beginnen.58 5. Schluss und Ausblick Wir waren ausgegangen von jüngsten Ansätzen kognitivistischer Interpretationen der Sprachform der Metapher. Diese erkennen in der Metapher nicht allein ein rhetorisches Mittel der Illumination und Überzeugung, sondern ein unmittelbar in sinnlicher Erfahrung gegründetes Instrument der Wirklichkeitserschließung, das als solches nicht suspendierbar, nicht vermeidbar ist – besonders auch dort, wo es um religiöse Erfahrungen geht. Unsere Untersuchung setzte an bei der Metaphorik der göttlichen Heilkunst, also bei der religiösen bzw. theologischen (d.h. auf Gott resp. die Gottheit bezogenen) Nutzung medizinalen Wissens in der Gestalt metaphorischer Konzepte. Wir begannen unsere Analyse bei Plutarch von Chaironeia als einem philosophisch gebildeten griechischen Schriftsteller, in dessen Schrifttum wir wesentliche literarische Voraussetzungen für die Konzeptualisierung von Heil durch die ältesten Christen finden können. Plutarch nutzt in breitem Umfang ontologische Metaphern göttlicher Medizin, die mit Orientierungsmetaphern einhergehen und insgesamt eine metaphorische Substruktur erzeugen. Diese ist dabei nicht nur aus der Sicht des Arztes entworfen, sondern gerade auch aus der Sicht der Schmerz leidenden Patienten mit ihren Sinneserfahrungen im Umgang mit Krankheiten und ärztlicher Kunst. Die metaphorisch-medizinale Sprache, wie Plutarch sie im Zusammenhang der Thematik von Geschick, Vorsehung und Strafe in seiner Schrift „De sera numinis vindicta“ einsetzt, bezieht sich dabei immer wieder nicht so sehr auf positiv-heilvolles Ergehen als vielmehr auf Erfahrungen von Schmerz und Bitterkeit. Heil, Heilung hat es mit „Medikamenten“ wie Hyänengalle und Seehundlab zu tun. Die Menschen haben Schmerzen; der Arzt heilt, indem er schneidet, brennt, schröpft und bittere Substanzen verschreibt und indem er damit 58 SCHULZE untersucht die Rolle des Christentums beim Transfer medizinischen Wissens von der hellenistisch-römischen Antike ins frühe Mittelalter. Nach ihm ist eine Verbindung von Medizin und christlicher Theologie in der Zeit vom 2./3. Jahrhundert „erstmalig historisch sicher … greifbar“ (SCHULZE, CHRISTIAN, Medizin und Christentum in Spätantike und frühem Mittelalter [Studien und Texte zu Antike und Christentum 27], Tübingen 2005, 19). Seine Untersuchung der Prosopographie medizinisch tätiger Christen bis zum 7. Jahrhundert führt zum Ergebnis, dass der Arztberuf auf christlicher Seite regional weit gestreut und nicht unterdurchschnittlich häufig ausgeübt gewesen sei. Die Medizinrezeption der Alten Kirche erklärt sich SCHULZE mit dem Hintergrund eines bereits etablierten positiven Arztbildes in der Antike sowie einer christlichen Öffnung gegenüber den artes liberales. 34 seinerseits den Menschen ekelerregende und schmerzende Erfahrungen nicht ersparen kann. Hier gibt es über die untersuchten traditionsgeschichtlichen Berührungsflächen und Schnittpunkte der medizinischen Metaphorik hinaus einen letzten möglichen Vergleichspunkt mit der christlichen Sichtweise – der allerdings den Abstand der Konzeptionen nicht nivellieren kann und darf59: „Religion für die Sinne“ erschließt sich nicht in „Wellness-Erfahrungen“; solche wären nach Plutarch illusionär, nach alttestamentlichem und frühjüdischem Verständnis auch in religiöser Hinsicht problematisch. Anders ist und bleibt auf die medizinische Metaphorik gesehen der auferstandene und erhöhte Arzt Christus für die frühen Christen der Gekreuzigte. Hier hat „Religion für die Sinne“ in frühchristlicher Sicht ihren ureigenen Ort. Origenes formuliert es in Hinsicht auf die Aufgabe des medizinischen Personals so: „Ärzte müssen zu den Orten gehen, wo die Soldaten leiden, und sie müssen dort eintreten, wo der schlimme Geruch von ihren Wunden herrscht. Das verlangt die menschenfreundliche Heilkunde […]“ (Origenes, Homilien zu Samuel V 8 [SC 328, 200 NAUTIN])60. 59 Für den Griechen und delphischen Priester Plutarch hat Religion keineswegs nur oder auch vorrangig mit bitterem und quälendem Erleben zu tun. Die Annäherung unter dem Aspekt der Sinnesbasierung kann die gravierenden Differenzen nicht übersehen. 60 Der ersten Aussage ist Corpus Hippocraticum Prognostikon 25 zu vergleichen – als Basis für die richtige ärztliche Prognose; DÖRNEMANN, Krankheit, 141 Anm. 184. 35