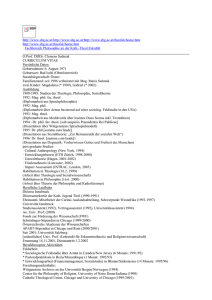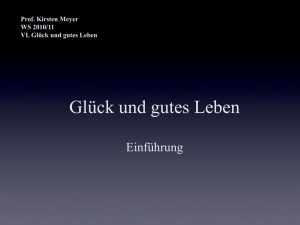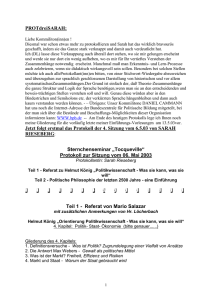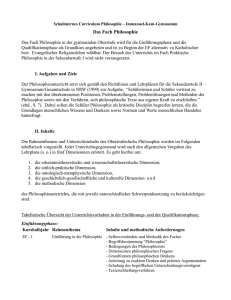GL Einleitung
Werbung

Einleitung Inhalt |11 S. 11-48 Dieser Grundriss >Philosophische Gotteslehre< soll in den Bereich philosophischen Ringens mit der Gottesfrage einführen. Als Teil der Reihe >Leitfaden Theologie< wird der Bezug zur christlichen Theologie besonders beachtet. Als philosophische Untersuchung unterscheidet sich die philosophische Gotteslehre jedoch sowohl von der Offenbarungstheologie wie auch von der Religionswissenschaft. Außerdem werden die religionskritischen Stellungnahmen zur Gottesfrage nur insoweit einbezogen, als sie für die Systematik unerlässlich sind, da der Religionskritik ein eigener Leitfaden gewidmet ist. Ein solches Unternehmen ist Zeugnis der Sicht des Autors. Die Aufgabe einer Einführung und der dadurch begrenzte Umfang bedingen die Auswahl. Im Blick auf das geschichtliche Phänomen philosophischer Auseinandersetzung mit der Gottesfrage sind einige Grundzüge herauszuarbeiten, die nach Meinung des Verfassers innerhalb der gegebenen Grenzen verständlich gemacht werden und für eine gegenwärtige Auseinandersetzung mit der Gottesfrage eine Hilfe sein können. Die Verschiedenartigkeit philosophischer Positionen und das Wiederkehren typischer Denkweisen erfordern einen einführenden problemgeschichtlichen Überblick. Dieser bietet zugleich Gelegenheit, Zusammenhänge aufzuweisen und terminologisch festzuhalten, die die Stellung dieses Leitfadens zu den verschiedenen Zugängen zur Gottesfrage besser verstehen lassen. Durch diesen Überblick soll auch die systematische Gliederung motiviert werden. Die Analyse der klassischen Gottesbeweise dient nicht nur ihrer historischen Kenntnis. Es geht gleichermaßen darum, ihre logische Struktur, ihre geschichtlichen Bedingungen und die damit zusammenhängenden Weiterführungen dieser Gedankengänge zu erläutern. Dadurch sollen ihre Bedeutung wie auch ihre Grenzen |12 aufgezeigt und die begrifflichen Unterscheidungen, mit deren Hilfe philosophisch darüber gesprochen wird, eingeführt werden. Das Denken der Neuzeit hat neue Zugänge zur Gottesfrage gebracht und damit neue Problemzusammenhänge. Eine Auseinandersetzung mit ihnen dient einem Verständnis der gegenwärtigen Lage philosophischer Gotteslehre. Die neu bedachten Probleme werden daher unter systematischer Rücksicht in Hinblick auf bestimmte Themen gegenwärtiger Stellungnahmen aufgegriffen: Die Herausforderung durch die neuzeitliche Naturwissenschaft stellt die Frage nach der Weltbildabhängigkeit. Die Auseinandersetzung mit Kants Kritik der Gottesbeweise macht die erkenntnistheoretische Eigenart philosophischer Gotteslehre deutlicher. Der Hinweis auf Standpunkte zur Gottesfrage mit postulatorischem Charakter läßt sowohl den Lebensbezug der Gottesfrage wie auch die Notwendigkeit theoretischer Analyse deutlich werden. Einsichten, die in der sprachanalytischen Diskussion über die Rede von Gott aufgezeigt wurden, sollen Gesichtspunkte aufweisen, welche die Eigenart religiösen Sprechens berücksichtigen lassen. | 13 1 Die Gottesfrage im philosophischen Denken Worum geht es in der philosophischen Gotteslehre, und wie verhält sie sich zu verwandten Disziplinen wie Religionswissenschaft, Religionsphilosophie und Theologie (vgl. 3.3)? Zur Klärung bedarf es eines Verständnisses der Aufgabe philosophischen Denkens, das sich jedoch im Verlauf der Geschichte selbst gewandelt hat. Das blieb nicht ohne Einfluß auf die Aufgabe, die der philosophischen Gotteslehre zugedacht war. So erfordert die Behandlung der gestellten Frage zunächst einen wenn auch nur schematischen Überblick über die Problemgeschichte der Beschäftigung philosophischen Denkens mit der Gottesfrage (vgl. 1 und 2). 1.1 Das griechische Denken 1.1.1 Die Frage nach dem Urgrund Am Beginn philosophischen Denkens im Abendland, bei den Vorsokratikern (ab 6. Jh. v. Chr.), steht die Frage nach dem Urgrund von allem (archē pāntōn) in einer Spannung zu den anthropomorphen (vermenschlichenden) Göttervorstellungen der Mythen. Aufgrund dieser Spannung besteht oft Zurückhaltung, den Urgrund Gott zu nennen. Er wird eher neutral als göttlich bezeichnet. Als Beispiel seien Fragmente des ca. 570 v. Chr. in Kolophon in Ionien geborenen Xenophanes, eines Vorläufers von Parmenides, dem Gründer der Philosophenschule zu Elea in Unteritalien, genannt: »Jedermann hat ja von Anfang her an Homer sich geschult. Alles hingen den Göttern sie an, Hesiod und Homer, was bei den Menschen als Schande gilt und Tadel hervorruft: Stehlen, Untreue gegen den Gatten, einander Betrügen. Aber die Sterblichen wähnen, die Götter würden geboren, |14 und sie hätten Gestalt und Tracht und Sprache wie sie. Hätten die Ochsen, Rosse und Löwen Hände und könnten malen und Werke sie schaffen und bilden gleich Menschen, dann würde das Pferd wie ein Ross und ähnlich dem Ochsen der Ochse seine Götter gestalten und Körper würden sie bilden, so wie jegliches selbst das eigene Aussehen kennt. Äthiopier sehn ihre Götter stumpfnasig, schwarz, glänzenden Augs, rothaarig stellen die Thraker sie dar. Wahrlich nicht alles enthüllten die Götter den Menschen von Anfang. Erst im Laufe der Zeit und suchend finden sie Bessres.«1 Die im Text sich ausdrückende religionskritische Haltung wendet sich nicht gegen die Anerkennung eines göttlichen Urgrundes, sondern gegen die unzulänglichen Vorstellungen, welche sich Menschen davon machen. Das zeigen die Fragmente aus der Schrift von Xenophanes >Über die Natur<: »Ein Gott ist unter Göttern und unter den Menschen der größte, nicht an Gestalt den Sterblichen gleich und nicht in der Einsicht. Gott ist ganz Auge, ganz Denken und alles vernimmt er. Mühelos lenkt er das All, allein mit der Kraft des Gedankens. Ewig verharrt er am nämlichen Orte, sich nirgends bewegend, kommt es doch nimmer ihm zu, bald hierhin, bald dorthin zu wandern. «2 Das tastende und zögernde Suchen nach der Beziehung des in den Göttererzählungen Angesprochenen, wonach Zeus der höchste der Götter ist, zu dem Urgrund, der bei Heraklit als lōgos - in der Veränderung und im Gegensätzlichen waltendes Weltgesetz - bezeichnet wird, zeigt sich auch in einem Fragment von Heraklit: »Eines, das allein Weise, will nicht und will doch auch Zeus genannt werden. «3 Die vielfältigen gegensätzlichen Meinungen, welche sich die ersten |15 Philosophen über den Urgrund gebildet haben, führten bei den Sophisten (Protagoras, Gorgias - Mitte des 5. Jhs. v. Chr.) zu einem Agnostizismus, das heißt zu der Auffassung, daß wir bezüglich der letzten Erklärung der Wirklichkeit keine Gewißheit erlangen können. Bei den Sophisten ist diese Auffassung verbunden mit der Beobachtung, dass in verschiedenen Kulturen jeweils andere Normen anerkannt werden. Mit der Entdeckung des kulturschöpferischen Handelns des Menschen wird ein Relativismus verbunden, das heißt eine Auffassung, welche den für gültig 1 Frgmt. 10-18, Diels/Kranz 1, 131-133. Diels/Kranz (Hrsg.), Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 Bde., Berlin 1954, ist die gebräuchliche Sammlung der Bruchstücke von Schriften der Vorsokratiker. Die im Text verwendete Übersetzung ist genommen aus der deutschen Ausgabe von E. Howald, Die Anfänge der abendländischen Philosophie, Zürich 1949, 48, dort überschrieben mit: »Aus den Spottgedichten«. 2 Frgmt. 23-26, Diels/Kranz 1, 135, Howald 49. 3 Frgmt. 32, Diels/Kranz I, 159, Howald 63. 7 angesehenen Einsichten und Normen eine absolute Geltung abspricht und die Geltung nur für bestimmte Menschengruppen als bestehend betrachtet: »Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, wie sie sind, der nicht seienden, wie sie nicht sind.«4 »Über die Götter besitze ich kein Wissen; weder daß sie existieren, noch daß sie nicht existieren, noch wie beschaffen an Gestalt sie sind. Denn vieles hindert daran, (über sie) etwas zu wissen: einmal die Ungewißheit, dann die Kürze des menschlichen Lebens.«5 Sokrates, 399 v. Chr. wegen »Einführung neuer Götter und Verführung der Jugend« zum Tode verurteilt, sucht im lebendigen Gespräch (Dialog) das oberflächliche Scheinwissen und den damit verbundenen Relativismus zu entlarven. Er führt den Partner zu Einsicht und persönlicher Überzeugung. Diese bezieht sich zunächst auf rechtes Handeln: eher Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun; gerechtes Leben dem Leben überhaupt vorzuziehen; in Gefahr auszuharren. Was hier als Gewissen mit seiner absoluten Forderung auftritt, nennt Sokrates daimōnion. Er versteht es als göttlichen Anruf, dem mehr zu gehorchen ist als allen Freunden und als den Gesetzen der pōlis, auch wenn er diesen so viel Respekt entgegenbringt, daß er sich der Verurteilung nicht durch Flucht entzieht. |16 1.1.2 Philosophisches Fragen 1.1.2.1 Wissenschaft und Weltanschauung Der Aufbruch abendländischen Philosophierens wurde als Übergang vom Mythos zum Logos gekennzeichnet. »Philosophie löst sich los von Mythos, Religion und traditioneller, ohne Kritik befolgter Lebensgestaltung, ihre Entstehung ist damit zugleich ein Stück der Loslösung des individuell-persönlichen vom kollektiven Denken und Leben. Philosophie setzt den Philosophen voraus, dessen Persönlichkeit seiner Philosophie das Gepräge gibt: « 6 »Der Philosoph kann dem Propheten, dem Religionsstifter, dem Volksführer und -erzieher nahe verwandt bleiben, und er kann sich zum Denker entwickeln, der mit den Waffen der Logik den Problemen zu Leibe geht, die ihn innerlich ergriffen haben. - Zu ihrer vollen Entwicklung ist die Philosophie in diesem letzten Sinne nur an einer Stelle gekommen, in dem Volk, dessen Sprache uns auch das Wort und den Begriff geschenkt hat: bei den Griechen. In der griechischen Philosophie verfolgen und beobachten wir den Weg zur Wissenschaft, die ja selbst eine spezifische Schöpfung des europäischen Abendlandes und nicht denkbar ist ohne das Begriffswerkzeug, das die griechische Philosophie geschaffen hatte.«7 Aristoteles hat im Rückblick die ersten Philosophen von denjenigen abgehoben, die zuerst »Theologie betrieben« hätten, wie Homer und Hesiod. Den Gegensatz sieht er in der Weise, wie vorgegangen wird: »Die um Hesiod also und die Theologen (Vertreter der mythischen Philosophie) gingen nur darauf aus, für sich selbst eine annehmbare Lösung zu finden, und haben auf uns keine Rücksicht genommen. ... Aber es lohnt sich nicht, Philosopheme, die nur in mythischer Form auftreten, ernstlich zu untersuchen. Dagegen von denen, die eine 4 Frgmt. 1, Diels/Kranz II, 263, Howald 158. Frgmt. 4, Diels/Kranz II, 265, Howald 158. 6 E. von Aster, Geschichte der Philosophie, Stuttgart 11949, XIX. 7 Ebd. XXI. 5 Begründung ihrer Behauptung geben, darf man Bescheid verlangen und fragen, warum ...«8 |17 Wenn also auch im Inhalt der Fragen, nämlich im weltanschaulichen Anliegen, zwischen Mythos und Philosophie Ähnlichkeit besteht, so unterscheidet sich die Philosophie vom Mythos dadurch, daß sie ihre Behauptungen begründet und bereit ist, Fragen gegenüber Rede und Antwort zu stehen. Darin können wir das anfängliche wissenschaftliche Anliegen sehen. Entscheidend für die Berechtigung philosophischer Behauptungen ist nicht die Berufung auf eine überlieferte Auffassung, sondern der Appell an eigene Einsicht und Erfahrung. 1.1.2.2 Geschichtlichkeit Diese Eigentümlichkeit der Philosophie, argumentierend Rechenschaft zu geben, schließt nicht aus, daß Philosophen bestimmte, noch nicht ausdrücklich begründete Meinungen haben oder daß sie von Überlieferungen, insbesondere ihrer kulturellen Herkunft, bestimmt sind. Ausgeschlossen wird nur, daß diese Auffassungen als Grundlage zur Rechtfertigung philosophischer Behauptungen herangezogen werden, bevor sie selber als berechtigt ausgewiesen worden sind. Manche dieser Vormeinungen werden erst im Laufe der Geschichte als Voraussetzungen bewußt und philosophisch fragwürdig - manche von ihnen beziehen sich auch darauf, was von einer philosophisch argumentierenden Rechtfertigung überhaupt zu fordern ist. Damit enthält der Ansatz philosophischen Fragens eine Dynamik grundsätzlichen Fragens, die sich in der Geschichte in immer neuen Fragen entfaltet. So ist das tatsächliche Philosophieren geschichtlich bedingt durch die Fragen, die tatsächlich in den Blick kommen. Diese Bedingtheit kann vielfach erst aus geschichtlicher Distanz erkannt werden, zum Teil aus dem Gegensatz verschiedener Philosophen. Dennoch ist es der Philosophie aufgegeben, Wege zur Klärung dieser Voraussetzungen zu suchen, weil sie logisch unabhängig von diesen Voraussetzungen zu sein beansprucht, das heißt sich nicht ohne Prüfung auf sie berufen kann. In diesem Sinne ist |18 der Philosophie ein radikales Fragen eigen.9 Ihr geht es wesentlich um die Berechtigung der Grundlagen, sie ist daher Grundwissenschaft. 1.1.2.3 Philosophie und Leben Wird Philosophie als Grundwissenschaft angesprochen, so heißt das nicht, daß menschliche Erfahrung und Lebenspraxis, einzelne Wissenschaften und Formen der Lebensorientierung erst von Gnaden der Philosophie bestehen dürften. Philosophie kann und will nicht das Leben mit seinen vielfältigen Äußerungen ersetzen. Wohl aber treten im Leben Probleme auf, insbesondere Konflikte von Ansprüchen, die mit diesen Lebensäußerungen verbunden werden und die zu ihrer Lösung eine Klärung und Prüfung dieser Ansprüche auf Geltung von Erkenntnis oder Geltung von Normen oder Werten erfordern. Die Auseinandersetzung mit diesen Ansprüchen sollte zu einer kritischen Integration führen - zu einer Zusammenordnung (integrum = lat.: das Ganze) durch Unterscheidung (krinein = griech.: unterscheiden) der berechtigten von unberechtigten Ansprüchen. Von daher kommt der Philosophie der Charakter einer Gesamtwissenschaft zu - nicht als Vereinheitlichung aller Wissenschaften, sondern als Streben nach Verständnis des Vielfältigen im menschlichen Leben im Hinblick auf dessen Ganzheit. Insofern ein solches Verständnis in einer Lebensauffassung oder Weltanschauung enthalten ist, ist dies das weltanschauliche Anliegen der Philosophie. Im Laufe der Geschichte der Philosophie ist immer wieder eine Spannung zwischem dem wissenschaftlichen Anliegen rationaler Klärung und Prüfung und dem weltanschaulichen 8 Aristoteles, Metaphysik III, 4; 1000a9-24. Bei den Werken von Aristoteles wird neben Buch und Kapitel gewöhnlich hinzugefügt Seitenzahl, Spalte (a oder b) und Zeilenzahl in der klassischen Gesamtausgabe von 1. Becker: Aristotelis Opera, 5 Bde., Berlin 1831-1870. 9 W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, II, Darmstadt 1972,185-206. Anliegen eines universalen Verständnisses der verschiedenen Wirklichkeits- und Lebensbereiche zutage getreten. Wenn die an die beiden Anliegen geknüpften Erwartungen als nicht zugleich realisierbar angesehen wurden, kam es in verschiedenen philosophischen Richtungen zur Akzentuierung des einen oder des anderen Anliegens. |19 1.1.2.4 Philosophische Begriffsbildung Aristoteles (384-322 v. Chr.) erlangte Bedeutung als erster großer Systematiker der Philosophie. Auf ihn gehen viele Termini der Philosophie zurück, die - zum Teil mit beträchtlich gewandelter Bedeutung - in unserer Bildungssprache verwendet werden,. z. B.: Kategorie; die Begriffspaare Substanz - Akzidens, Form - Materie; Wirk- und Zielursache. Diese Begriffe halten Gesichtspunkte, Unterscheidungen und Zusammenhänge fest, die wir in unserem gewöhnlichen Sprechen über die Wirklichkeit berücksichtigen, aber für so selbstverständlich halten, daß wir sie meist nicht besonders beachten. In der Auseinandersetzung mit den ihm vorausgegangenen Philosophen erweist es sich für Aristoteles als notwendig, diese selbstverständlichen Unterscheidungen ausdrücklich zu machen. Dadurch kann er zeigen, unter welcher Rücksicht die zunächst vielfältigen und gegensätzlichen Meinungen in ihrem berechtigten Kern verstanden werden können, das Unberechtigte aber als ein Nichtbeachten von Gesichtspunkten aufgefaßt werden kann, die zur Ergänzung notwendig wären. Hier tritt bereits der reflektierende und abstrakte Charakter wissenschaftlichen Philosophierens hervor. Reflektierend ist Philosophie, insofern sie nicht zuallererst bestimmte Einsichten in die Wirklichkeit und die Zusammenhänge menschlichen Lebens gewinnt, sondern bereits gewonnene, oft aber nicht genügend bedachte Einsichten ausdrücklich macht, prüft und das Berechtigte in ihnen in seinem Verhältnis zu anderen Erfahrungen und Einsichten bestimmt. Dadurch erhält die Philosophie einen Zug, der oft als enttäuschend empfunden wird: daß sie nämlich nicht direkt bestimmte Lebensfragen beantwortet, sondern.die Gesichtspunkte und Unterscheidungen herausstellt, die bei einer begründeten und verantwortbaren Meinungsbildung bezüglich dieser Fragen zu berücksichtigen sind. Dabei orientiert sich die Philosophie an den bisherigen Bemühungen der Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Wohl wird man es dem Fragesteller nicht verargen können, wenn er sich an den Philosophen wendet mit der Aufforderung, zu sagen, welche Meinung er sich selbst unter Berücksichtigung jener Ge- |20 sichtspunkte gebildet hat. Oft ist-wenn auch in unterschiedlichem Maß - die Frucht dieser Meinungsbildung vorweg schon eingearbeitet in die Untersuchungen, die ein Philosoph anstellt. Ein solches engagiertes Philosophieren tritt oft in Gegensatz zur Meinungsbildung anderer Philosophen. Das weckt neues kritisches Reflektieren und führt oft zur Entfaltung und Prüfung bisher nicht beachteter Voraussetzungen und Gesichtspunkte. Gerade in Fragen, die für den Menschen als wichtig und seine Stellungnahme herausfordernd empfunden werden - wie dies wohl gerade in der Gottesfrage der Fall ist -, wird man mit dieser Spannung zwischen engagiertem und reflektierendem Philosophieren rechnen müssen. Anlass zur Enttäuschung durch Philosophie und zum Missverständnis ihrer Formulierungen bietet auch der formale und abstrakte Charakter der in reflektierendem Philosophieren herausgearbeiteten Grundbegriffe. Sie sind formal, weil sie nicht die Erfahrungen und Einsichten ersetzen, sondern diese in ihrer Eigenart charakterisieren und sie unterscheidend zu anderen Erfahrungen und Einsichten in Beziehung setzen. Abstrakt sind diese Charakterisierungen und Unterscheidungen deshalb, weil sie von dem konkreten Inhalt an Erfahrung und Einsicht weitgehend absehen, wenn sie auch gleichsam den Rahmen für diesen Inhalt klären und ausdrücklich machen. Allerdings ist auch hier zu beachten, daß - besonders bei engagiertem Philosophieren - die abstrakten Charakterisierungen mit Erfahrungen und Einsichten des betreffenden Philosophen oder auch der Menschen seiner Zeit verbunden werden. Oft sind bei einem Philosophen abstrakte Begriffe, die auch heute noch zu berücksichtigende Zusammenhänge herausstellen, mit konkreten inhaltlichen Erfüllungen verbunden, die wir als zeitbedingt und überholt ansehen. Wenn es bei einer Auseinandersetzung mit diesem Philosophen nicht nur um eine philosophiegeschichtlich treue Darstellung geht, sondern um das Gewinnen eines Beitrags für gegenwärtige Fragestellungen, dann werden oft mit Recht zwei typische Interpretationstendenzen wirksam, die sich ergänzen müssen (vgl. 4.4.2). Will man herausarbeiten, warum manche Anschauungen angesehener Philosophen nicht ohne weiteres übernommen werden kön- |21 nen, dann wird man in kritischer Interpretation vor allem die zeitbedingten und heute nicht mehr begründbaren Inhalte herausarbeiten. Da hier der Nachdruck auf das Abzulehnende gelegt wird, könnte man auch von einer negativen Interpretation sprechen. Sie wird zwar nicht dem gesamten Denken des Philosophen gerecht, hilft aber, die notwendige kritische Distanz zu gewinnen. Geht es aber darum, von dem betreffenden Philosophen zu lernen und das Berechtigte zu übernehmen, wird man die Aufmerksamkeit auf jene Zusammenhänge abstrakter Art lenken, die auch bei anderer inhaltlicher Erfüllung und damit auch in gegenwärtigem Denken zu berücksichtigen sind. Eine solche Interpretation in systematischer Absicht beachtet die Gründe für die von dem betreffenden Philosophen verwendeten Unterscheidungen und aufgewiesenen Zusammenhänge, die auch für gegenwärtiges Denken von Bedeutung sind. Da das auch heute Annehmbare im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und daher als wesentlich an der Auffassung des Denkers betrachtet wird, könnte man von einer positiven Interpretation sprechen. Bereits bei der Auseinandersetzung, die Aristoteles mit seinen Vorgängern führte, kann man diese Interpretationstendenzen am Werk sehen. 1.1.3 Theologie bei Platon und Aristoteles Platon (427-347 v. Chr. ) war Vorläufer und Lehrer von Aristoteles. Er ist der erste abendländische Philosoph, dessen Schriften, vorwiegend Dialoge, in denen er Sokrates seine eigene Ansicht vertreten läßt, in größerem Umfang erhalten sind. Sein Denken fand bis heute immer wieder starken Widerhall. Sokrates hatte aufgewiesen, daß uns trotz vielfacher geschichtlicher Bedingtheit echte Einsichten möglich sind. Platon sucht diese Tatsache verständlich zu machen. In einem kühnen Entwurf, der wegen seiner dichterischen Sprache und der Vermengung mit mythischen Vorstellungen nicht immer leicht zu interpretieren ist, entwickelt er seine Ideenlehre: Er deutet das Phänomen der Einsicht in Zusammenhänge, die wir weder nur durch Übernahme von Lehrmeistern noch einfach aus einem Blick auf die Gehalte der Sinneswahrnehmung erfassen, als Wiedererinnerung an eine frü- |22 here Schau von Urbildern, nach denen die erfahrbaren Dinge gebildet sind. Weil die Dinge Abbilder dieser Urbilder sind, erschließen uns solche Einsichten Züge der Wirklichkeit. Diese Urbilder oder Ideen sind selbst wieder untereinander geordnet, an ihrer Spitze steht, sie überragend, als höchste die Idee des Guten und Schönen. Diese ist letzter Grund sowohl unserer Erkenntnis wie auch der erkannten Dinge. Aristoteles ist stark von Platons Philosophie beeinflußt. Insbesondere übernimmt er die Problemstellung, daß wir tatsächlich Einsichten in Zusammenhänge der Wirklichkeit haben können, die sich nicht bloß in den Gehalten der Sinneswahrnehmung erschöpfen. Seine Deutung dieser Tatsache ist aber viel nüchterner; darin setzt er sich von Platon ab und deutet dessen Ideenlehre negativ: Die Einsicht ist nicht eine Erinnerung an eine Schau der von den Dingen getrennten Urbilder; die Einsicht ist vielmehr die Frucht der Auseinandersetzung unseres Wissensvermögens mit den durch die Sinne gegebenen Dingen und erfaßt nicht Urbilder, die von diesen Dingen getrennt wären, sondern das, was der Kern dieser Dinge ist, ihr Wesen. So hat man gelegentlich den Unterschied beider Denker dadurch gekennzeichnet, daß Aristoteles die Ideen in die Dinge selbst verlegt habe. In späterer Zeit hat man sich oft auf diesen Gegensatz bezogen. Unter Platonismus versteht man oft ein Denken, das für unsere Begriffe eigene Gegenstände annimmt, die von den konkreten Dingen unterschieden sind. Mit dieser Charakterisierung erhebt man zugleich den Einwand, dies sei eine Verdoppelung der Wirklichkeit. Demgegenüber betonen Verteidiger einer solchen Auffassung, hier liege eine negative Interpretation vor, denn es handle sich bei diesen »Ideen« nicht um Dinge, sondern um Gründe der Dinge, die selbst nicht dinghaft vorzustellen seien. Außerdem sei ihr Unterschied von den erfahrbaren Dingen nicht so aufzufassen wie der der erfahrbaren Dinge untereinander, vielmehr seien sie als Gründe der Dinge in diesen gegenwärtig. Der Gegensatz zu Aristoteles sei daher nicht so groß, wie es die negative Interpretation der Ideenlehre vermuten lasse.10 |23 Ungeachtet dieser einschränkenden Bemerkungen hat sich der Gegensatz immer wieder neu entfacht. Im christlichen Denken gilt z. B. Augustinus als eher von Platon angeregt, während Thomas von Aquin stärker von Aristoteles geprägt scheint. Allerdings hat gerade Thomas die Intuition Platons zu seiner besonderen Seinsauffassung umgeformt, dergemäß die Eigenschaften der erfahrbaren Dinge teilhaben am Sein als Grund und nur dadurch wirklich sein können. Dagegen stellten sich dann mittelalterliche Denker und neuscholastische im Gefolge von Franz Suarez, die diese Seinsauffassung als zu platonisch empfanden und ablehnten. Andererseits hat man in der Seinsauffassung von Thomas ein Gegengewicht gegen den kosmologischen Charakter aristotelischen Denkens gesehen, ja sogar eine Tiefe des Seinsverständnisses, wie sie durch das Denken Heideggers neu angeregt wird. Der Ausdruck Theologie (theōs = griech.: Gott; lōgos = griech.: Rede, Sinn, Lehre) tritt zuerst bei Platon und Aristoteles auf. Bei Platon ist mit »Theologie« zunächst noch die dichterischmythische Rede von Gott und Göttern gemeint, die er in der >Politeia< 11 der Kritik unterwirft, ähnlich wie schon Xenophanes. Die Kritik macht aber selbst schon von Vorstellungen darüber, wie das Göttliche aufzufassen sei, Gebrauch und entwickelt sie. Bei Aristoteles wird »Theologie treiben« im Sinn der mythischen Rede von den Göttern verstanden, »theologisch« aber auch verwendet als eine der Kennzeichnungen der grundlegenden Wissenschaft, der »Ersten Philosophie«, die dann später den Namen »Metaphysik« erhalten hat. Unter den »theoretischen« Wissenschaften (theōria = griech.: Schau), die sich mit dem befassen, was ist, im Unterschied zu dem, was der Mensch in seinem Handeln tut (prāxis = Handlung) oder hervorbringt (poiēsis = Gestaltung; tēchnē = Kunstfertigkeit), hebt Aristoteles die »Erste Wissenschaft« (prōtē philosophia), die er auch »Sophia« (Weisheit) oder »theologische Wissenschaft« |24 (theologikē epistēmē) nennt, von der »Physik«, die sich mit dem Bereich der erfahrbaren veränderlichen Dinge beschäftigt, und von der »Mathematik« ab, die sich mit den aus den erfahrbaren Dingen herausgesonderten und idealisierten Gestalten und Größen befaßt, die jedoch nicht für sich bestehen. Die »Metaphysik«, wie die Erste Philosophie später genannt wurde, untersucht das, was ist, das Seiende, nicht unter einer bestimmten Rücksicht, als Bewegtes, wie die Physik, oder als Größe, wie die Mathematik, sondern einfach als Seiendes. Damit ist die Betrachtung nicht auf einen Sonderbereich eingeschränkt, sondern grundsätzlich auf die gesamte Wirklichkeit ausgerichtet und soll deren allgemeinste Bestimmungen herausarbeiten. In diesem Sinn weist ihr Aristoteles als Gegenstand »das Seiende als Seiendes« (ōn hē ōn) zu - sie ist Seinslehre, in der Neuzeit verwendet man dafür auch den Ausdruck »Ontologie«. Da Wissenschaft nach Sachgründen, Ursachen forscht, die Sachgründe von allem aber auch die Gründe einzelner Bereiche umfassen und begründen, kann Aristoteles die Aufgabe der Ersten Philosophie auch als Erforschung der »ersten Ursachen« umschreiben. Insofern nun ein göttlicher Urgrund als erster Sachgrund aufgefaßt wird, ist die Metaphysik »Theologik«, theologische Wissenschaft. Dies ist natürlich nicht zu verwechseln mit der späteren 10 J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie, I, Freiburg 51961, 113-115. Politeia II, 379a. Seiten- und Abschnittszahlen sind der dreibändigen Platon-Ausgabe von Henricus Stephanus, Paris 1578, entnommen. Zur Geschichte des Begriffs »Theologie« vgl. W. Kern/F. J. Niemann, Theologische Erkenntnislehre (Leitfaden Theologie 4), Düsseldorf 1981,37-49. 11 Verwendung des Wortes »Theologie«, wo dieses etwa die methodische und systematische Entfaltung christlichen Glaubensverständnisses meint. Der Aufgabe der »Physik« entsprechend entfaltet Aristoteles ein philosophisches Verständnis der Bewegung- jeder Art von Veränderung des Wirklichen, insbesondere aber auch der Ortsveränderung. In seiner Auffassung darüber, wie Bewegungen ablaufen, ist er durch das damalige Naturverständnis bestimmt, demgemäß die Körper ihrem »natürlichen Ort« zustreben, z. B. die Luft nach oben, die Erde nach unten, und durch die damalige Astronomie, dergemäß sich die Bewegung von den äußeren Himmelsschalen auf die inneren überträgt. Philosophisch jedoch sucht er die Schwierigkeiten, welche die ihm vorausgehenden Denker aufgeworfen haben, zu lösen. Diese hatten entweder das Bleibende (Parmenides) oder den ständigen Wechsel (Heraklit) als Grundzug |25 des Wirklichen herausgestellt, unter Vernachlässigung des jeweils anderen Moments. Aristoteles unterscheidet diese beiden Momente und faßt ihre Zusammenordnung als Eigentümlichkeit alles in Bewegung befindlichen Seienden. Demnach ist in der Bewegung ein Zugrundeliegendes (hypokeimenon, Subjekt der Veränderung) vorauszusetzen, das zwar fähig ist, die Möglichkeit (griech.: dýnamis; lat.: potentia) hat, verschiedene Bestimmungen aufzunehmen, diese jedoch nicht immer als Wirklichkeit (griech.: enērgeia, lat.: actus) hat. Die Bewegung wird so verstanden als »Verwirklichung (Akt) dessen, was der Möglichkeit nach (in Potenz) ist, insofern es möglich (in Potenz) ist«. 12 Zugleich entfaltet Aristoteles, ebenfalls in Auseinandersetzung mit seinen Vorgängern, vier einander ergänzende Weisen der Erklärung des Bewegten, vier Typen von Ursache. Die Angabe der »Materie« gibt ein Verständnis, insofern auf das Zugrundeliegende verwiesen wird, auf das, woraus etwas gemacht ist. Eine Erklärung durch die Angabe der Bestimmung, die das Zugrundeliegende erhalten hat, gibt die »Form« an. Was später »Wirkursache« genannt wurde, ist nach Aristoteles das, »woher die Bewegung« kommt und verständlich wird, während das »Ziel« (griech.: tēlos; lat.: finis) angibt, »weswegen« etwas ist, durch die Wirkursache bewirkt wurde. Dabei setzt Aristoteles voraus, daß Wirkliches nur durch Wirkliches hervorgebracht sein kann. Für alle Weisen der Bewegung und Veränderung meint er aufweisen zu können, daß »alles, was in Bewegung ist, notwendig ein anderes voraussetzt, von dem es bewegt wird« (einen »Beweger«).13 Diese Aussage, welche die ursächliche Abhängigkeit alles in Veränderung oder Bewegung Befindlichen behauptet, wurde später als »Bewegungssatz« bezeichnet und stellt eine spezielle Form des metaphysischen Kausalprinzips dar, der Aussage nämlich, daß Seiende, insofern sie bestimmte Züge aufweisen (z. B. in Bewegung sind), eine von ihnen verschiedene Ursache (griech.: aitia; lat.: causa), meist zunächst in Form einer entsprechenden Wirkursache, voraussetzen (z. B. ei- |26 nen Beweger). Bei Platon 14 wird dies formuliert für Seiendes, das entsteht: »Es ist notwendig, daß alles, was wird, durch eine Ursache wird.« Für Aristoteles ergibt sich aus diesen Einsichten, daß die in vielfältiger Bewegung befindliche Wirklichkeit, die als solche notwendig eine Akt-Potenz-Spannung aufweist und auf einen Beweger zurückverweist, ein Bewegendes voraussetzt, das selbst nicht in einer solchen AktPotenz-Spannung steht, daher unbewegt ist. Diesen Gedankengang entfaltet er sowohl in der >Physik< (Phys. VIII, 3-6) als auch in der >Metaphysik< (Metaph. XII, 6-7). Hier wird dann auch die Tätigkeit dieses ersten Bewegenden, das auch als »der Gott« (ho theōs15) angesprochen wird, als »Denken des Denkens« (nōēsis noēseōs) bestimmt, also als geistige Lebenstätigkeit. Das Verhältnis zur bewegten Wirklichkeit wird verglichen mit der Weise, »wie das Geliebte das Liebende« bewegt - also in zielursächlicher Erklärungsweise. 12 Aristoteles, Physik III, 1; 201a10.. Phys. VII, 1; 241624. 14 Platon, Timaios 5; 28a. 15 Aristoteles, Metaph. XII, 7; 1072b25-30. 13 1.1.4 Antike Lebensweisheit In den folgenden Jahrhunderten treten in der hellenistischen Philosophie (3.-1. Jh. v. Chr.) und der Philosophie der römischen Kaiserzeit (l. Jh. v. Chr.-526 n. Chr.) verschiedene Schulen auf, die zwar einige Gedanken bisheriger Philosophie weiterführen, deren Schwerpunkt aber auf einer Art Lebensphilosophie liegt, die auch zum Religionsersatz für Gebildete wird. Fragen der Ethik, der rechten Lebensführung, die zu einem glücklichen Leben anleitet, zu einer ungetrübten Heiterkeit, die über Furcht, unnützen Streit und Begierde erhaben ist, stehen im Vordergrund, damit aber auch Fragen nach dem Sinn menschlichen Lebens. Die Skeptiker (griech.: skeptikōs = Zweifler) sehen den Weg zum glücklichen Leben in der Entwicklung einer Haltung der ataraxia (Unerschütterlichkeit). Zu ihr führt die Einsicht in die Unerkennbarkeit der Dinge, aus der sich die epochē (Enthaltung vom Urteil) ergibt, insbesondere in weltanschaulichen Fragen. Darin besteht eine Ähnlichkeit mit dem Agnostizismus der Sophisten. |27 Epikur (341-270 v. Chr.) vertritt eine sensualistische Erkenntnislehre (lat.: sensus = Sinn(eswahrnehmung)), die nur das durch Sinneswahrnehmung Erfaßbare für erkennbar hält, und eine auf Demokrit zurückgehende mechanistische Wirklichkeitsauffassung, die das Geschehen auf zufällige Verknüpfungen der Atome zurückführt. Die Lust (griech.: hēdonē), nach der der Mensch strebt, besteht nicht in augenblicklicher Bedürfnisbefriedigung, sondern in einer Gemütsruhe, ataraxia, die höher steht als die Lust des Fleisches (griech.: sārx). Da die Furcht vor dem Tod und vor den Göttern als eine der stärksten Bedrohungen der Gemütsruhe angesehen wird, muß der religiöse Aberglaube abgebaut werden durch das Wissen darum, daß es keine übersinnlichen, den Menschen belohnenden oder bestrafenden Mächte gibt - selbst wenn es »Götter« gibt, kümmern sie sich nicht um den Menschen. Die stoische Schule hingegen versteht die Welt als durchwaltet von einer göttlichen Weltvernunft. Diese zeigt sich in teleologisch (zielstrebig) geordnetem Naturgeschehen, sie begründet die Überzeugung von einer göttlichen Vorsehung und Vorherbestimmung alles Seienden, sie ist im »Inneren« jedes Menschen anwesend und zeigt sich in dessen Geist und Vernunft. Echte Weisheit ist es daher, wenn der Mensch mit der Natur und dem sie durchwaltenden Gesetz übereinstimmt, nicht mit seinem Geschick hadert und sich in Apathie (griech.: pāthos = Leidenschaft) von allen Leidenschaften freihält. Für die philosophische Gotteslehre ist hier von Bedeutung, daß nach der Auffassung von Stoikern dem Menschen die Überzeugung eingewurzelt ist, es gebe Götter. Daraus werde verständlich, daß alle Völker gewisse Grundvorstellungen von Göttern haben. So ist bei den Stoikern nicht nur der Gedankengang, der von der Übereinstimmung der Völker (e consensu gentium) auf die Existenz Gottes zu schließen sucht, vorgezeichnet. Ihrem Denken entsprechen auch die Wege aus der zielstrebigen Ordnung der Natur (teleologischer Beweis) und aus dem Inneren des Menschen (aus dem Gewissen bzw. der Einsicht) - Gedanken, die besonders von Augustinus aufgenommen und weitergeführt werden. Bei den Stoikern wird aber auch die philosophische Gotteslehre als solche von anderen »Theologien« abgehoben. Von Panaitios von |28 Rhodos (185-109 v. Chr.) und seinem Schüler Mucius Scaevola wird berichtet, daß sie drei Formen der Theologie unterschieden hätten: die der Dichter, die anthropomorph und daher falsch und unglaubwürdig sei; die der Philosophen, die rational und wahr sei, aber nicht brauchbar für das Volk; und die der Staatsmänner, die den herkömmlichen Kult als für das Volk unentbehrlich aufrechterhalte. Bei M. T. Varro entsprechen dem die mythische, die natürliche, um die es in der Philosophie geht, und die staatliche Theologie. Das dem religiösen Bedürfnis am meisten entgegenkommende und zugleich denkerisch kühnste System entsteht im Neuplatonismus: Plotin (203-269), Proklos (410-485). Es bildet Elemente der pythagoreischen und der platonischen Philosophie weiter, unter Einfluß orientalischer, jüdischer und christlicher Religion, mit stark mystischer Tendenz. Die menschliche Sehnsucht nach Erfüllung wird abgehoben von der Vereinzelung der vielfältigen Dinge und dem damit verbundenen Leid. Sie geht auf Vereinheitlichung. Die Welt wird zurückgeführt auf einen Urgrund, das Ur-Eine, von dem man eigentlich nicht aussagen kann, was es ist, sondern nur, was es nicht ist (negative Theologie), weil all unser Sprechen Vielheit in dieses Eine hineinträgt. Das Vielfältige der Welt wird aufgefaßt als in einem abgestuften Prozeß aus dem Ureinen mit Notwendigkeit hervorgegangen und wieder zu diesem zurückstrebend. Je mehr sich der Mensch von dem Vielfältigen befreit, desto mehr gelangt er zur Verwirklichung seiner höchsten Bestimmung - voranschreitend über Abkehr von der Alltagswelt, über begriffliches Erkennen und dieses überbietende schauende Betrachtung bis zur ekstatischen mystischen Vereinigung mit dem Ur-Einen. 1.2 Christlicher Gottesglaube und Philosophie 1.2.1 Anfänge christlichen Denkens In vielen Punkten stand das in den ersten Jahrhunderten sich ausbreitende Christentum in Gegensatz nicht nur zu den Volksreligionen, sondern auch zu den philosophischen Schulen: der strenge Ein-Gott-Glaube, der sich auf Offenbarung Gottes in der Geschichte stützt, die Abhebung des persönlichen und freien Schöp- |29 fergottes von der Welt bei gleichzeitiger engster Verbindung dieses Gottes mit den Menschen im Gottmenschen Jesus Christus. Dieser wird von Menschen aller Schichten als tiefgreifende ethische Herausforderung zu einer Lebensform tätiger Liebe und als Unterpfand der Hoffnung auf Erlösung des ganzen Menschen, nicht nur des Geistes, in endzeitlicher Erfüllung geglaubt. Bereits in den neutestamentlichen Schriften und bei den frühchristlichen Schriftstellern treten zwei charakteristische Beziehungen zur Philosophie auf: einmal eine Entgegensetzung, dann aber auch der Hinweis auf philosophische Einsicht. So warnt Paulus vor der »Weisheit der Welt« (1 Kor 1,20) und ihrer Verführung (Kol 2,8). Für Tertullian (165-220) sind die Philosophen die Patriarchen der Häretiker. Dass hier die Philosophie als Weltanschauung und Lebensweise aufgefaßt wird, die zugleich/' die Rolle der Religion übernimmt, zeigt sich auch, wenn Justin der Märtyrer (2. Jh.) den Gegensatz dadurch ausdrückt, daß er das Christentum die allein sichere und heilsame Philosophie nennt, und wenn Chrysostomus die christlichen Mönche als die einzigen echten Philosophen, die es noch gibt, bezeichnet. Zugleich finden wir aber bei Paulus auch den Hinweis darauf, daß Gott dem Menschen in solcher Weise erkennbar ist, daß auch außerhalb der christlichen Offenbarung Stehende keinen Entschuldigungsgrund für eine Nichtanerkennung Gottes haben (Röm 1,19ff). Paulus zitiert auf dem Areopag (Apg 17,2231) auch griechische Philosophen zur Stützung seiner Verkündigung und nimmt als Anknüpfungspunkt, daß Er »nicht fern von jedem von uns ist«, »denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir«. In der Auseinandersetzung des Christentums vor allem mit den gebildeten Heiden wurden philosophische Begriffe und Argumente verwendet, die zum damaligen Bildungsgut gehörten, unter anderem auch die Kritik der Stoiker und Epikureer am antiken Polytheismus. In Alexandrien, wo sich um die Zeitenwende Philon (25 v. Chr.-40 n. Chr. ) um die Verbindung des alttestamentlichen Gottesbegriffs mit der griechischen Philosophie bemüht hatte, traten die Vorbehalte gegenüber der Philosophie immer mehr zurück. Für Clemens von Alexandrien (gestorben um |30 215) bereitet die Philosophie den Hellenen den Weg zu Christus wie das Alte Testament den Hebräern. Immer mehr wurden philosophische Begriffe und Argumente in der Entfaltung des Verständnisses christlichen Glaubens theologisch verwendet. Augustinus (354-430) kommt, auch was den Einfluß auf die Folgezeit betrifft, besondere Bedeutung zu. Es seien nur einige für die Gotteslehre wichtige Punkte erwähnt: Persönlich hat sich Augustinus von der gnostischen Sekte der Manichäer gelöst, die einen Dualismus vertreten hat, der zwei erste Urgründe annimmt, einen des Lichtes, des Guten, des Geistes, und einen der Finsternis, des Bösen und der Materie. Er ringt mit dem Problem des Ursprungs des Übels und des Bösen. Für ihn geht alles letztlich auf Gott als Schöpfer und einzigen Urgrund zurück. Das Übel und das Böse stellen keine eigene Wirklichkeit dar, sondern sie sind als Mangel an der geschaffenen Wirklichkeit zu verstehen. Beim sittlich Bösen geht dieser Mangel auf den Mißbrauch geschaffener Freiheit zurück. Gegenüber dem Zweifel der Skeptiker verweist Augustinus auf die Selbstgewissheit des Denkens: Wenn jemand zweifelt, weiß er, daß er nichts Sicheres weiß, daß er nicht grundlos seine Zustimmung geben darf. Die darin sich zeigende grundsätzliche Möglichkeit wahrer und gewisser Erkenntnis verweist nach Augustinus auf Gott als Urwahrheit. Waren bei Platon die Ideen als Urbilder der bestehenden Dinge Grund ihrer Erkennbarkeit und ihres Seins, so sind dies jetzt bei Augustinus die schöpferischen Gedanken Gottes. Wie bereits bei Philon werden die platonischen Ideen nun als Gedanken des Schöpfergottes verstanden. Augustinus verbindet auch Grundgedanken der stoischen Philosophie mit dem Schöpfungsglauben. Was bei den Stoikern das Weltgesetz war, das sich zugleich auch im menschlichen Wissen und Gewissen manifestiert, das wird bei Augustinus das vom Schöpfergott in die Dinge hineingelegte Naturgesetz. Dieses Gesetz hat für die freien Geschöpfe den zwar nicht physisch - zwingenden, aber - ethisch - verpflichtenden Charakter des Sittengesetzes. Von den Stoikern übernimmt Augustinus auch den Gedanken von Keimkräften (lat.: rationes seminales, griech.: lōgoi spermatikoi), die erst allmählich in einem Entwicklungsprozeß zur Entfaltung ge- |31 bracht werden. Der Rahmen dafür ist aber mit der Schöpfung gegeben, durch die erst eine raum-zeitliche Ordnung entstanden ist. 1.2.2 Scholastik Die Philosophie des Mittelalters hat ihren Ausgang genommen von den Kloster- und Domschulen zur Zeit Karls des Großen. Das legte auch die Bezeichnung »Scholastik« (lat.: schola = Schule) für das Denken bis zur Schwelle der Neuzeit nahe. Diese Schulen griffen das Erbe der antiken Bildung und das Denken der Kirchenväter auf. Besondere Bedeutung kam dabei dem Denken Augustins zu. Von Aristoteles hingegen waren nur einige logische Schriften bekannt. Dieses Denken des christlichen Mittelalters findet seine erste richtungweisende Ausprägung bei Anselm von Canterbury (1033 bis 1109), dem »Vater der Scholastik«. Die Denkhaltung Augustins, die ein Verständnis des Glaubensinhaltes sucht - fides quaerens intellectum (Glaube, der Einsicht sucht) -, wird nun Programm einer systematischen Durchdringung des Glaubens. Insofern steht dieses Denken auf dem Boden des christlichen Glaubens. Philosophische Elemente dienen der Systematisierung und dem Herausstellen von Zusammenhängen. Dabei werden jedoch Analysen angestellt, die philosophisch von Bedeutung sind. Dazu gehört ein von Anselm in seiner Schrift >Proslogion< vorgelegter Gedankengang, der aus der Tatsache, daß wir den Gedanken eines höchsten Wesens fassen können, folgert, daß dieses höchste Wesen auch notwendig existieren müsse: Unter Gott verstehe man das Wesen, größer als das nichts gedacht werden könne (id quo maius cogitari non potest). Nun aber sei etwas, das sowohl gedacht wird als auch wirklich besteht, mehr als das, das nur gedacht wird, aber nicht wirklich besteht. Darum müsse das Wesen, größer als das nichts gedacht werden kann, auch wirklich bestehen, weil gegenüber einem Wesen, das nur gedacht wird, ein größeres gedacht werden könne, nämlich eines, das nicht nur im Denken, sondern auch außerhalb des Denkens, also wirklich besteht. Dieser Gedankengang, der seit Kant »ontologischer Gottesbeweis« genannt wird, steht bei Anselm zunächst im Kontext eines gläubi- |32 gen Bekenntnisses. Später wurde er vielfach in philosophischem Kontext aufgegriffen, weitergeführt und kritisiert. Übrigens ist dieser Gedankengang von Anselm nicht mit anderen Gedankengängen zu verwechseln, die er andernorts, nämlich im >Monologion<, entfaltet hat und die an platonischem und augustinischem Denken orientiert sind. Allerdings denkt man meistens, wenn einfachhin vom Anselmianischen Argument gesprochen wird, an den von ihm im >Proslogion< vorgebrachten und später »ontologisch« genannten Gedankengang. 1.2.3 Thomas von Aquin Die Gründung der Universitäten, das wissenschaftliche Leben und die Ordensstudien der neu entstandenen Orden der Franziskaner und Dominikaner, die im 12. Jahrhundert bekannt gewordenen Schriften des Aristoteles und die Auseinandersetzung mit ihnen und mit den arabischen (Averroes, Avicenna) und jüdischen (Avicebron, Moses Maimonides) Kommentatoren führte im 13. Jahrhundert zu einem Höhepunkt des mittelalterlichen Denkens, zur Hochscholastik. Die große Leistung des Thomas von Aquin (1224-1274) besteht in der durch Albert den Großen vorbereiteten christlichen Interpretation des aristotelischen Gedankenguts und dessen systematischer Verbindung mit dem augustinisch geprägten theologischen Erbe der Scholastik. Diese Leistung ist wohl der sachliche Grund für das starke Weiterwirken seiner Synthese, gerade auch für die Philosophie. Das liegt daran, daß er methodisch klar Philosophie und Theologie unterscheidet - auch wenn er philosophische Argumentationen in sehr verschiedenen Zusammenhängen verwendet: in Kommentaren zu Aristoteles, in kleinen Schriften zu philosophischen Problemen, im Zusammenhang theologischer Fragestellungen im Rahmen seiner Summen und in anderen Schriften. Thomas übernimmt den aristotelischen Wissenschaftsbegriff. Den Unterschied zwischen Theologie, die sich auf die christliche Offenbarung stützt, und Philosophie sieht er in der Eigenart der Prinzipien, der ersten Sätze, von denen her Folgerungen gezogen und Zusammenhänge des Gegenstandsbereichs der Wissenschaft abgeleitet oder erklärt werden. Während in der Philosophie diese er- |33 sten Sätze grundsätzlich für einsichtig gehalten werden, werden die ersten Sätze der Theologie geglaubt. Für beide gilt, daß diese ersten Sätze selbst nicht abgeleitet werden können - wohl aber könnnen sie gegenüber Einwänden und Bedenken verteidigt werden, und zwar unter Verwendung der Voraussetzungen, auf die sich der Gesprächspartner beim Erheben des Einwandes stützt. So unterscheidet Thomas deutlich jene Theologie, mit der sich Philosophen beschäftigen und die von der metaphysischen Betrachtung der Gesamtwirklichkeit zu Gott als Urgrund gelangt, von der Theologie, die sich auf die im Glauben angenommene christliche Offenbarung stützt und direkt Gott zum Gegenstand hat. Hier wird also in methodischer Hinsicht, nämlich hinsichtlich der Grundlage, auf die sich die Begründung und Rechtfertigung der Aussagen stützt, deutlich zwischen einer philosophischen Gotteslehre und der Offenbarungstheologie unterschieden. In der Quaestio 5 seines Kommentars zu dem Werk von Boethius >De Trinitate< bringt Thomas seine wissenschaftstheoretische Auffassung zur Darstellung. Im 4. Artikel schließt er seine Darlegungen mit der zusammenfassenden Stellungnahme: »Sic ergo theologia sive scientia divina est duplex: una, in qua considerantur res divinae non tamquam subiectum scientiae, sed tamquam principia subiecti, et talis est theologia, quam philosophi prosequuntur, quae alio nomine metaphysica dicitur; alia vero, quae ipsas res divinas considerat propter seipsas ut subiectum scientiae, et haec est theologia, quae in sacra Scriptura traditur. - So ergibt sich, dass die Theologie oder Gotteslehre zweifach ist: eine, in der das Göttliche nicht als Gegenstand der betreffenden Wissenschaft behandelt wird, sondern als Erklärungsgrund des Gegenstandes, und dergestalt ist die Theologie, welche die Philosophen betreiben und die mit einem anderen Namen Metaphysik heißt; die andere (Theologie) ist jedoch jene, welche das Göttliche selbst um seiner selbst willen zum Gegenstand der Wissenschaft hat, und das ist die Theologie, die in der Heiligen Schrift überliefert ist. 16 « Folgendes ist hier zu beachten, weil es für die Rolle der Philosophie in Hinblick auf die Offenbarungstheologie wichtig ist: 16 In Boeth. de trin: q.5, a.4, resp. Deutsch vom Verfasser. a) Philosophie und Offenbarungstheologie sind unterschieden |34 durch die Eigenart ihrer Erkenntnis, durch die Grundlagen, auf die sich die Argumentationen stützen. Daher kann grundsätzlich dasselbe sowohl theologisch als auch philosophisch behandelt werden. Der entscheidende Unterschied liegt also nicht in der Thematik, sondern in der Beweisgrundlage. In der >Summa theologiae< heißt es: »Unde nihil prohibet de eisdem rebus, de quibus philosophicae disciplinae tractant, secundum quod sunt cognoscibiles lumine naturalis rationis, etiam aliam scientiam tractare, secundum quod cognoscuntur lumine divinae revelationis. - Daher ist nicht ausgeschlossen, daß über Dinge, über die die philosophischen Disziplinen handeln, sofern sie mit dem Licht der natürlichen Vernunft erkennbar sind, auch eine andere Wissenschaft handelt, sofern sie mit dem Licht göttlicher Offenbarung erkennbar sind.«17 b) Das Verhältnis philosophischer Erkenntnis zu der auf Offenbarung gegründeten wird näher bestimmt: - Es gibt Gehalte der Offenbarung (z. B. Dreifaltigkeit), die philosophisch nicht erkannt werden können. - Zwischen den Gehalten der Offenbarung und dem philosophisch Erkannten kann es keinen Widerspruch geben. - Das Dasein Gottes kann philosophisch aufgewiesen werden. - Die philosophische Erkenntnis Gottes ist schwierig, weshalb auch philosophisch von Gott Erkennbares geoffenbart wurde, »quia veritas de Deo per rationem investigata, a paucis hominibus et per longum tempus et cum admixtione multorum errorum proveniret - weil die mit der Vernunft erforschte Wahrheit von Gott nur wenigen Menschen, nach langer Zeit und mit Beimischung vieler Irrtümer erreichbar wäre. «18 Philosophische Argumentationen dienen zum Aufweis dessen, was an Gehalten oder Vorbedingungen der Offenbarung der menschlichen Vernunft zugänglich ist, zur Entkräftung von Schwierigkeiten, die sich der Offenbarung entgegenzustellen scheinen, und zur systematischen Entfaltung der Glaubensgehalte und als Hilfe für Folgerungen daraus. |35 Thomas kommentiert den in der aristotelischen Physik und Metaphysik vorgelegten Gedankengang, der von den bewegten Dingen ausgeht und deren Abhängigkeit von einem unbewegten Beweger aufweist. Diesen Bewegungsbeweis, zusammen mit Gedanken anderer Philosophen (Platon Leges) und christlicher Denker (Augustinus u. a.), baut er in seine >Summe wider die Heiden< ein - denn bevor systematisch von Gott bzw. von der Beziehung des Menschen zu ihm gehandelt wird, ist sein Dasein aufzuweisen - da nach aristotelischer Wissenschaftslehre die Fragen nach den Eigenschaften von etwas dessen Dasein voraussetzen. Bei Thomas steht nicht im Vordergrund, durch den Beweis Gottes Dasein Menschen nahezubringen, die es leugnen würden. Es geht vielmehr zunächst um die Entfaltung der Überzeugung, daß das Bemühen der vom Glauben erleuchteten Vernunft, das Verständnis der Offenbarung zu entfalten, an den in philosophischen Überlegungen sich ausdrückenden Verweis der erfahrbaren Welt auf einen Urgrund, der religiös als Gott anzusprechen ist, anknüpfen kann. In seiner >Summa theologiae< kommt den philosophischen Wegen zum Erweis des Daseins Gottes dieselbe systematische Stellung zu. Zunächst wird, wie übrigens auch in der anderen Summe, der vom Begriff Gottes ausgehende Weg Anselms abgelehnt. Dann werden neben dem aristotelischen Weg aus der Bewegung der Dinge noch vier weitere angeführt: aus der Ursachebeziehung unter den Dingen, aus der Kontingenz des Entstehenden und Vergehenden, aus der Vielfältigkeit der Verwirklichung 17 18 S. th. 1, q. 1, a. 1, ad 2. Deutsch vom Verfasser. S. th. 1, q. 1, a.l c. Deutsch vom Verfasser. bestimmter Gehalte, die als Abstufung einer vollkommensten Verwirklichungsweise verstanden werden, und aus dem Vorkommen zielgerichteten bzw. zweckmäßigen Wirkens in der Natur. Dem Stil des Werkes entsprechend sind diese fünf Wege (quinque viae), auf denen das Dasein Gottes aufgewiesen werden kann, an dieser Stelle (S, th. I, q.2, a.3 c) knappe Zusammenfassungen. Die in ihnen verwendeten philosophischen Grundsätze treten auch an vielen anderen Stellen auf und werden dort weiter vertieft. Auf das in den fünf Wegen entfaltete Verständnis von Gott als letztem Urgrund wird immer wieder zurückgegriffen, auch wo im Kontext systematischer Offenbarungstheologie von Eigenschaften Gottes gesprochen wird. |36 1.2.4 Einheit und Vielfalt von Ansätzen Christliches Verständnis von Gott als Schöpfer und das damit verbundene Verständnis der menschlichen Person führen, zusammen mit Elementen arabischer und jüdischer philosophischer Auseinandersetzung mit aristotelischem Denken und mitbestimmt durch augustinische Gedanken, zu einer deutlicheren Herausarbeitung philosophischer Grundeinsichten. Diese Vorarbeiten ermöglichen Thomas eine kritisch-systematische Interpretation von Aristoteles, die mit dem christlichen Glauben nicht nur vereinbar ist, sondern zu dessen theologischer Entfaltung das Rüstzeug bereitstellt. Allerdings zeigt sich auch hier die Schwierigkeit philosophischen Denkens: Die Akzentuierung und die Interpretation von philosophischen Grundeinsichten sind von vielfältigen geschichtlichen und persönlichen Faktoren mitbedingt und nicht allen Denkern gemeinsam - auch nicht im Mittelalter. Wenn auch die bewundernswerte Synthese des Thomas später große Beachtung gefunden und Wirkung ausgeübt hat, so hatten andere Theologen des Mittelalters gerade in den grundlegenden philosophischen Auffassungen andere Akzentuierungen vorgenommen: in der Auffassung von Wissenschaft, in dem für die Entfaltung der Metaphysik grundlegenden Verständnis des »Seienden« und bezüglich der Eigenart und Tragweite menschlicher Erkenntnis. Bei oft zunächst ähnlichen Formulierungen zeigt sich der Unterschied des Verständnisses in der Divergenz der Folgerungen. So betont etwa Bonaventura (1221-1274) mehr Elemente der augustinischen Tradition. Die Wissenschaft, für die Aristoteles der Meister ist, soll zur Weisheit und Liebe führen, um die es Augustinus gegangen ist. In seinem >Weg zu Gott< (>Itinerarium mentis in Deum<) geht Bonaventura nicht von allgemeinen Strukturen der Welt aus, die auf einen ersten Grund zurückweisen, sondern es geht ihm mehr darum, in verschiedenen Schritten zu zeigen, wie die Erfahrung, die der Mensch von den Dingen und vor allem von sich selbst hat, transparent wird auf Gott hin und zu einer vertieften lebendigen Gottesbeziehung führen kann. Hier zeigt sich ein Gegensatz, der immer wieder auftritt: auf der |37 einen Seite eine Betonung der konkreten Erfahrung und ihrer Deutung, auf der anderen Seite das philosophische Herausarbeiten und Prüfen der bei dieser Deutung vorausgesetzten und konkret angewendeten Denkweisen. Damit verbunden ist oft auch die Spannung zwischen einer Akzentuierung des existentiellen und rationalen Aspekts philosophischen Fragens: Bei Fragen wie jener um Gott handelt es sich um Lebensfragen, die den Menschen zutiefst herausfordern und seine ganze Einstellung zum Leben betreffen und die letztlich nicht ohne Stellungnahme zu religiöser Praxis ernst genommen werden können. Gerade bei einer so wichtigen Frage aber geht es um eine vernünftig zu verantwortende Stellungnahme, deren vernünftige Entscheidungsgrundlagen so weit als möglich analysiert und herausgearbeitet werden müssen - wenn auch natürlich dadurch die Stellungnahme nicht ersetzt wird, wohl aber die Voraussetzungen ihrer Verantwortbarkeit geklärt werden. Als anderes Beispiel sei Duns Scotus (1266-1308) genannt. Den Beinamen »Doctor subtilis« hat er wegen seines hervorstechenden Scharfsinns erhalten, mit dem er Gedankengänge analysiert, kritisiert und weiterführt. Dabei geht er allerdings von anderen Voraussetzungen, besonders von einem etwas anderen Seinsverständnis aus als Thomas. Das führt ihn dazu, daß er bezüglich der Möglichkeiten philosophischer Erkenntnis und der Aussagen von Gott noch zurückhaltender ist. Der aristotelische Bewegungsbeweis wird abgelehnt. Gedanken von Anselm und Augustinus werden weitergeführt. Die Leibniz'sche Form des ontologischen Arguments wird dadurch vorweggenommen. Vor allem aber wird bei der Entfaltung des Gedankenganges von der Wirkursächlichkeit, Zielbestimmtheit und Ordnung der Wesenheiten her die Analyse der ursächlichen Abhängigkeit wesentlich bereichert. Eine vergleichbare Weiterführung der Analysen philosophischer Wege zu Gott finden wir wenn auch wieder von einem etwas anderen Seinsverständnis geleitet, das sich von platonischen Einflüssen distanziert - in der Neuzeit bei Suarez (1548-1617). Seine >Disputationes metaphysicae< gelten als die erste systematische Darstellung der Metaphysik. Sie haben sowohl auf die protestantische Theologie, besonders die Hochorthodoxie, als auch auf das neu- |38 zeitliche Philosophieren (Descartes, Rationalismus vor Kant) großen Einfluss ausgeübt. Für die philosophische Gotteslehre ist es hier zunächst wichtig, festzuhalten, daß bei diesen Denkern sichtbar wird, wie die besondere Ausgestaltung der philosophischen Wege zu Gott mit bestimmten Auffassungen über die Grundzusammenhänge der Wirk-. lichkeit verbunden sind. Sowohl dadurch wie auch wegen unterschiedlicher Interpretation der dabei verwendeten Ausdrücke fällt die Einschätzung der einzelnen Beweisgänge verschieden aus. Ohne eine bestimmte Weise der Entfaltung der Grundstrukturen der Wirklichkeit, das heißt ohne eine bestimmte Metaphysik oder Ontologie, scheint eine ins einzelne gehende Entfaltung des Verweises der vorgegebenen Wirklichkeit auf ihren letzten Grund nicht möglich zu sein. Eine vergleichende Untersuchung der verschiedenen Wege läßt bestimmte Strukturelemente erkennen, die immer wieder vorkommen und als tragend aufzufassen sind. Auf diese wird eine spätere Analyse solcher Gedankengänge besonders zu achten haben. 1.3 Fragestellungen neuzeitlicher Philosophie Das neuzeitliche Denken seit der Renaissance stellt die philosophische Beschäftigung mit der Gottesfrage in neue Zusammenhänge: Im Humanismus kommt ein stärker werdendes Interesse am Menschen mit seiner persönlichen Entscheidung und Freiheit zum Ausdruck. Soziale und religiöse Ordnungen fächern sich auf oder werden abgelöst: Aufsteigen des Bürgertums als Träger einer neuen Wirtschaftsform, die stark vom Unternehmergeist einzelner abhängt; die Stärkung der Städte und die Herausbildung von Nationalstaaten; die Reformation. Eine neue Beziehung zur Natur zeigt sich einerseits in einer staunenden und forschenden Zuwendung zur Natur und zur Stellung des Menschen in der Natur, andererseits in einer auf Naturbeherrschung ausgerichteten Naturwissenschaft. Beides führt zu einem neuen Weltbild, das in Gegensatz zu dem überlieferten und sowohl mit dem christlichen Glauben verbundenen als auch von der mittelalterlichen Philosophie vielfach vorausgesetzten Weltbild trat. Im philosophischen Denken tritt eine Be- |39 sinnung auf die Möglichkeiten und Wege der Erkenntnis der Wirklichkeit in kritischer Abhebung vom Überlieferten und im Suchen nach neuen Methoden hervor. In diesem Prozes wird bei Christian Wolff (1679-1754) in einer neuen Systematik der Philosophie die philosophische Gotteslehre als eigene Disziplin der speziellen Metaphysik verselbständigt. Im Zusammenhang der Aufklärung wird von der Philosophie die.Begründung einer Vernunftreligion erhofft. Das Scheitern dieser Bemühungen führt zur Kritik der Möglichkeit philosophischer Gotteslehre und zur philosophischen Reflexion über das Kulturphänomen Religion und zur Religionskritik. Im folgenden sollen einige kennzeichnende Positionen und Tendenzen dieser Zeit herausgestellt werden. 1.3.1 Das neue Ideal der Wissenschaft Einer der charakteristischen Züge der Neuzeit ist der Aufbruch naturwissenschaftlichen Denkens. Vorbereitet wurde dieses Denken bereits im Spätmittelalter, als Programm entworfen von Francis Bacon von Verulam (1561-1626) und zunächst in der Mechanik verwirklicht durch Galileo Galilei (1564-1642) bis Isaak Newton (1642-1727). Als Hauptanliegen erweist sich eine zielgerichtete methodische Erweiterung unseres Wissens durch Erfahrung. Gesucht wird ein verbessertes Verständnis der Natur, das uns die Natur besser beherrschen läßt. Dadurch erhofft man sich zugleich ein Überwinden von Grenzen der spontanen Erfahrungserkenntnis, auf die man sich früher gestützt hatte. Die Grenzen zeigten sich nach Bacon einmal in den verschiedenen Arten von Vorurteilen, von denen die spontane Überzeugung abhängig war, und zum anderen in der Zufälligkeit dessen, was gerade beachtet worden war. Die bisherige, an Aristoteles orientierte Wissenschaft sei höchstens zur Systematisierung des zufällig zustande kommenden Wissens tauglich gewesen, nicht jedoch zu einer echten Erklärung, die uns in die Lage setzt, den Verlauf der Natur vorauszusehen und technisch zu gestalten. Bereits bei Galilei tritt der schematisierend-konstruktive Charakter dieser neuen Naturerkenntnis deutlich hervor. Für ihn liegt das Buch der Natur offen vor aller Augen, lesen kann es nur derjenige, |40 der die Sprache und die Züge kennengelernt hat, in der es geschrieben ist: nämlich die Sprache der Mathematik und die Schriftzüge von Dreieck, Kreis und anderen geometrischen Figuren. 19 Damit aber wird von Idealisierung gesprochen. Galilei selbst macht davon Gebrauch: für »freier Fall im Vakuum« und »ideale Pendel« gibt es im Bereich der Phänomene keine unmittelbaren Beispiele, nur verschieden große Annäherungen. So bedarf es für die Analyse der Naturphänomene der schöpferischen Phantasie, die zur Annahme entscheidender Faktoren führt - z. B. von Fallstrecke und Fallzeit für den freien Fall. Dann können Experimente ersonnen werden, welche Faktoren meßbar machen und ihr Verhältnis bestimmen lassen und in denen Störungen kontrolliert werden können. Aufgrund solcher Experimente kann das Verhältnis der Meßzahlen der Faktoren als Gleichung oder Funktion formuliert und experimentell weiter überprüft werden. In der späteren wissenschaftstheoretischen Diskussion wurde diese Art von Erklärung als funktionale charakterisiert und der entscheidende Punkt darin gesehen, daß ein Phänomen dann naturwissenschaftlich im Sinn der funktionalen Erklärung als erklärt angesehen wird, wenn ein dieses Phänomen beschreibender Satz aus den als gültig anerkannten Gesetzesaussagen und Randbedingungen, welche die konkrete Situation charakterisieren, abgeleitet werden kann. 20 Aufgrund der für die praktisch-technische Anwendung wichtigen Leistung, Prognosen über den Verlauf des Naturgeschehens erstellen zu können, spricht man gelegentlich auch von prognostischer Relevanz dieses Typs von Erklärung. So liegt die Bedeutung dieser Form von Erklärung der Natur a) in einem Verständnis des regelmäßigen und vorhersehbaren Ablaufs der Naturvorgänge; b) in der Bereitstellung eines Wissens, das zu einer technischen Gestaltung der Natur befähigt; c) in der Möglichkeit einer |41 intersubjektiven Überprüfung durch die Erfahrung anderer Experimentatoren. 19 Vgl. J. Losee, Wissenschaftstheorie, München 1977 (engl. 1972), 58ff. In unserem Jahrhundert bekannt als »nomologisch-deduktive Erklärung«, benannt nach den Wissenschaftstheoretikern Hempel und Oppenheim als H-0Schema. Sie untersuchten im einzelnen, welchen weiteren Bedingungen die Ableitung (Deduktion) eines Beobachtungssatzes aus Gesetzes- (nomologischen) Aussagen und Randbedingungen genügen muß, damit man sie als naturwissenschaftliche Erklärung des durch den Beobachtungssatz dargestellten Sachverhalts auffassen kann. 20 Diese Charakteristika naturwissenschaftlicher experimenteller Erfahrungserkenntnis haben immer mehr das Ideal des Wissens geprägt und bestimmen in der Gegenwart weitgehend die Erwartungen, die von vielen an Wissenschaft gestellt werden. Dieses neue Ideal des Wissens ist wohl zu unterscheiden vom aristotelischen Wissensideal, das z. B. auch den klassischen Gottesbeweisen zugrunde liegt. Der Nachteil des aristotelischen Erklärens liegt darin, daß es keine Voraussagen des Naturlaufs gestattet, keine prognostische Relevanz hat. Andererseits leistet aber die aristotelische Erklärung etwas, was nicht durch die funktionale Erklärung geleistet werden kann - nämlich die Klärung des Verhältnisses verschiedener Gegenstandsbereiche und Wissensformen, die der Mensch verwendet, zueinander; darin besteht also ihre Relevanz für das Verständnis der Ganzheit menschlichen Lebens und Entscheidens. Diese integrative Funktion philosophischer Erklärung hat Bedeutung für die Orientierung menschlicher Lebensgestaltung und für die Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens. Es bedurfte einer längeren Denkentwicklung, um über der Begeisterung für die neue und erfolgreiche Methode der Erfahrungswissenschaften auch ihrer grundsätzlichen Grenzen gewahr zu werden. Zunächst gab es nämlich Versuche, aus dem neuen Zugang zum Verständnis der Natur auch gleich eine Weltanschauung zu errichten: den mechanistischen Materialismus, der seinen ersten Höhepunkt bei den französischen Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts gefunden hat. Bezüglich der Gottesfrage war er oft verbunden mit dem in der Aufklärungszeit vertretenen Deismus (deus = lat.: Gott), der zwar einen persönlichen Gott annimmt, der die Natur mit ihren Gesetzen geschaffen hat, der sich aber vom Theismus (theōs = griech.: Gott) dadurch unterscheidet, daß Gott keinen weiteren Einfluß auf das Weltgeschehen und die Geschichte ausübt, insbesondere daß er sich nicht übernatürlich offenbart. Bei einigen, wie z. B. bei Diderot (1713-1784) und Holbach (1723 bis 1789), war der Materialismus mit einem Atheismus verbunden: Gott werde für die Erklärung der Welt überflüssig, da diese durch die Naturgesetze der Bewegung erklärt werden könne. Als Motiv |42 für den Atheismus ist hier aber nicht nur die Entgegensetzung von naturwissenschaftlicher und theologischer Erklärung der Welt maßgebend, sondern auch ein religionskritisches Anliegen: eine Kritik an der Kirche, an der Intoleranz der Konfessionen und an dem Festhalten an nicht einsichtigen Traditionen. 1.3.2 Das erkenntniskritische Anliegen Für das neuzeitliche philosophische Denken wurde - wohl auch angesichts konfessioneller Spannungen im Gefolge der Reformation und in Absetzung vom aristotelischmittelalterlichen Erkenntnisideal - die Frage nach den Grundlagen unseres Wissens bestimmend. Die Behandlung dieser Frage prägte sich aus in den beiden Positionen des englischen Empirismus und des kontinentalen Rationalismus. Diese Spannung und die materialistische Deutung der Mechanik sind zugleich Ausgangsposition für das Denken Kants. 1.3.2.1 Rationalismus Der Rationalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff) sucht die Mängel der spontanen Erfahrungserkenntnis dadurch zu beheben, daß er prüft, in welchem Ausmaß sich Erkenntnisinhalte, vor allem allgemeine Aussagen, auf unmittelbar einsichtige und gewisse erste Sätze zurückführen und von ihnen deduktiv ableiten lassen. Wird die Geltung der Erkenntnis vor allem in Hinblick auf die Ableitbarkeit von ersten Sätzen beurteilt, spricht man gelegentlich von einem deduktiven Geltungsideal. Descartes (1596-1650) geht aus von der Suche nach einem sicheren Fundament für unser Wissen. Diese Grundlage findet er zunächst in der unbezweifelbaren Selbstgewißheit unseres Denkens, im »Cogito ergo sum«21: Das ist 21 Descartes, Principia Philosophiae 1, 7 (Buchenau, 2). Die deutsche Ausgabe der Prinzipien der Philosophie von Descartes wurde besorgt von A. Buchenau, Hamburg 71965 =41922. es, was uns am klarsten ist: daß ich denke und daß ich bin. Als Kriterium der Wahrheit gilt ihm die Klarheit und Deutlichkeit des Gedankens. Manche unserer Gedanken (Ideen) sind uns angeboren, und die Klarheit und Deut-|43 lichkeit verbürgt uns die Wahrheit ihres Inhalts. Dazu gehöre auch die Idee Gottes als eines vollkommensten Wesens. In verschiedenen Ansätzen sucht Descartes zu zeigen, daß es Gott als vollkommenstes Wesen geben müsse: es würde sonst ein angemessener Grund für die Tatsache fehlen, daß uns diese Idee angeboren ist. Außerdem wandelt er das ontologische Argument Anselms ab: Zum Begriff des höchst vollkommenen Wesens gehöre das Dasein dieses Wesens, so wie zum Begriff des Dreiecks gehöre, daß die Winkelsumme gleich zweier rechter Winkel sei. Diese Form des ontologischen Beweises tritt im Rationalismus wiederholt auf. Bei Leibniz wird sie dadurch ergänzt, daß er die innere Möglichkeit (Widerspruchsfreiheit) des vollkommensten Wesens aufzuweisen sucht. In dieser Form erhält dieser Gedankengang von Kant den Namen »ontologischer Gottesbeweis«. Er steht dann im Zentrum der Kritik Kants an den Gottesbeweisen. Im Rationalismus wird vernachlässigt, dass die ersten Sätze und die in ihnen vorkommenden Begriffe auf Abstraktionen aus unserer alltäglichen, lebensweltlichen Erfahrung beruhen und dass es eine zentrale philosophische Frage ist, was Sinn, Geltung und Anwendungsbereich dieser Sätze ist. Eine Funktion der Unterscheidungen, die Aristoteles entwickelt hat, war die Präzisierung von Antworten auf diese Frage. Die aposteriorischen Gottesbeweise bei Thomas werden systematisch verwendet als Klärung des Sinnes und der Anwendbarkeit der Prädikate, die Gott zugesprochen werden. Im Rationalismus besteht die Tendenz, bei den Gottesbeweisen vor allem die allgemeinsten Begriffe und Prinzipien herauszuarbeiten. Das ist sicher eine Hilfe, um die logische Struktur der Gedankengänge besser zu durchleuchten. So wird etwa der Bewegungssatz auf das Kausalprinzip und dieses wieder auf das Prinzip vom zureichenden Grund zurückgeführt. Offen bleiben aber zwei Problembereiche: Worauf stützt sich die Geltung dieser allgemeinsten Grundsätze? Worauf stützen sich Sinn und Geltung der besonderen Begriffe, durch welche diese allgemeinsten Sätze auf besondere Bereiche angewendet werden? Darauf kann sich dann Kant in seiner Kritik der Gottesbeweise beziehen. Bezüglich der Begriffe, die in Aussagen von Gott verwendet wer den, zeigt sich die rationalistische Vernachlässigung der Erfah- |44 rungsgrundlage und der dadurch bedingten Differenzierungen etwa in der Schwierigkeit, die bereits Descartes empfindet, »Substanz« und »Gott« auseinanderzuhalten - da beide, wenn auch in anderer Weise, unabhängig sind: die Substanz bezüglich der Inhärenzbeziehung, durch welche die Akzidentien von einem Träger abhängig sind, Gott jedoch hinsichtlich der Wirkursächlichkeit, insofern er absolute, unverursachte Erstursache ist. Descartes korrigiert seine Substanzdefinition noch durch den Zusatz, der den Einfluß Gottes auf die Substanz festhält, so daß es neben Gott auch endliche Substanzen geben kann: »Unter Substanz können wir nichts anderes verstehen als eine Sache, die so existiert, daß sie keiner anderen Sache zu ihrer Existenz bedürfe (quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum). Und zwar kann als Substanz, welche überhaupt keines anderen Dinges zu ihrer Existenz bedarf, nur eine einzige verstanden werden, nämlich Gott. Alle anderen aber fassen wir so auf, daß sie nur durch das Mitwirken Gottes existieren können.« 22 Bei Spinoza wird die volle Konsequenz aus der Gleichsetzung von Substanz und Gott gezogen, so daß es nur eine einzige Substanz geben kann. Die Folge davon ist, daß alles andere in ihr ist, alles also Gott ist - eine Form des Pantheismus (pän = griech.: alles). 22 PrincipiaPhilosophiae I, 51 (Buchenau, 17). Der Pantheismus sieht die gesamte Wirklichkeit als Gott an, während der Theismus Gott zwar als ermöglichenden Grund von allem ansieht, der jedoch selbst unterschieden bleibt von dem durch ihn Begründeten. Die nicht genügende Klärung von grundlegenden Begriffen betrifft nicht nur den Substanzbegriff, sondern auch den der Ursächlichkeit. Die Folge davon ist, daß die wirkursächlichen Zusammenhänge zwischen endlichen Substanzen - z. B. zwischen Leib (res extensa) und Seele (res cogitans) bei Descartes, oder auch zwischen verschiedenen Körpern nicht genügend geklärt werden. Das führt zur Leugnung echten Wirkens der Dinge aufeinander, deren Zustände dann nur als Gelegenheiten (occasio = lat.: Gelegenheit) für das alleinige Wirken Gottes angesehen werden. Diese |45 Lehre des Okkasionalismus tritt im Gefolge von Descartes auf (Geulincx, Malebranche). Für den besonderen Fall von Leib und Seele führt dies zu den verschiedenen Theorien über die Lösung des Leib-Seele-Problems: nach der Wechselwirkungslehre von Descartes und der okkasionalistischen Lösung die Identitätstheorie von Spinoza und der Parallelismus von Leibniz. Vor dem Hintergrund dieser zuwenig erfahrungsbezogen geklärten Begriffe von Substanz und Ursache und der daraus entstehenden Schwierigkeiten mag die empiristische Kritik, die Hume an der Verwendung dieser Begriffe übt, eher verständlich werden. 1.3.2.2 Empirismus Der Empirismus (Locke, Berkeley, Hume) betont gegenüber einer zu rationalistischen Verwendung der Grundbegriffe und einer Berufung auf angeborene Ideen die Rolle der Erfahrung. Er sieht in der - allerdings meist als Sinnesempfindung oder innere Wahrnehmung aufgefassten - Erfahrung den einzigen Zugang zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Dies kann gegenüber der aristotelischen Auffassung insofern als empiristisch und damit einseitig eingeschätzt werden, als die Einsichtigkeit und Geltung jener Zusammenhänge, welche die Erfahrung ermöglichen und die in der lebensweltlichen Erfahrung bereits einschlussweise erfasst sind, zuwenig berücksichtigt wird. Leibniz betont das auf seine Weise, indem er23 die Lockesche These, dass nichts im Verstand sei, was nicht in den Sinnen gewesen sei (nempe nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu), durch den Zusatz ergänzt: »außer dem Verstande selbst« (nisi ipse intellectus). In Kants Transzendentalphilosophie wird dieses Verstandeselement dann als Möglichkeitsbedingung der Erfahrung entfaltet und in seiner Geltung begründet - jedoch nur für den Bereich von Gegenständen möglicher Erfahrung. Lohn Locke (1632-1704) zählt zu den Vätern der Aufklärung und gilt als Begründer der empiristischen Erkenntnistheorie. Soll sich der Mensch - dem Anliegen der Aufklärung gemäß - in seiner Lebensführung von der Vernunft leiten lassen, dann bedürfe es ange- |46 sichts der Erfahrung fruchtloser Diskussionen über Lebensfragen zunächst einer kritischen Prüfung der Fähigkeit unserer Vernunft. Als Prüfstein dafür gilt ihm die Erfahrung. In seinem Werk >Versuch über den menschlichen Verstand< (1690), in dem er diese Untersuchungen durchführt, vertritt er24 die Auffassung, daß wir auf dieser Grundlage zu einem sicheren Wissen von Gott als dem ewigen, allmächtigen und weisen Ursprung der Welt gelangen können. Selbst für einen einfachen und verständlichen Kern der christlichen Offenbarung, den er als überkonfessionell betrachtet, beansprucht er vernünftige Glaubwürdigkeit. Hier besteht noch eine Verbindung von Bibelgläubigkeit und Tendenz zu einer Vernunftreligion. Im weiteren Verlauf der Aufklärung wird dann die Idee der Vernunftreligion immer deutlicher der Offenbarungsreligion mit ihren konfessionellen Ausprägungen entgegenstellt. David Hume (1711-1776) ist in seiner empiristischen Erkenntnislehre radikaler als Locke. Er kritisiert Begriffe wie »Ursache« und »Substanz« und damit alle Metaphysik. In Übereinstimmung damit wird auch eine vernunftgemäße Auffassung Gottes, wie sie im 23 Leibniz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, 11,1 § 2, hrsg. von E. Cassirer, Hamburg 1915, 84. 24 Kap. 10 des 4. Buches. 3 Deismus der Aufklärungszeit vertreten wurde, kritisiert: da unsere Vorstellungen nicht weiter reichen als unsere Erfahrung, wir aber von Gottes Eigenschaften keine Erfahrung haben, können wir auch nicht die Natur des göttlichen Wesens erkennen. Auffallend ist, daß in dieser Kritik der Möglichkeit der Vernunfterkenntnis ein Anliegen spürbar ist, das bereits in Formen des alten Skeptizismus wirksam war und bei Kant wieder auftreten wird: Gegenüber den fruchtlos erscheinenden Versuchen, in den zentralen religiös-weltanschaulichen Lebensfragen eine Entscheidung durch Vernunftargumente zu gewinnen, wird betont, daß die persönliche Stellungnahme zu diesen Fragen niemandem durch eine Beweisführung abgenommen werden könne, die mit der Sicherheit einer Berufung auf direkt aufweisbare Gegebenheiten vergleichbar wäre.. Diese Zurückhaltung hat sich nicht nur auf die Gottesfrage gerichtet, sondern auch auf andere weltanschauliche Standpunkte, wie etwa auf den mechanistischen Materialismus. Gerade Berkeley (1684-1753) hat die empiristische Kritik verwendet, um die Mei- |47 nung zu kritisieren, aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnis lasse sich eine mechanistische Vorstellung der Wirklichkeit beweisen. 1.3.3 Physikotheologie Parallel dazu wurde von Naturwissenschaftlern und Philosophen an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert die Nähe Gottes, wie sie sich in den Wundern der Schöpfung, vor allem in sinn- und zweckvollen Naturerscheinungen, zeigt, herausgestellt.25 Anliegen war, gegenüber einem Hinausrücken Gottes aus dem Kosmos im Deismus und gegenüber einem Gefühl der Verlorenheit des Menschen im Universum gerade - wenn auch inspiriert von christlichem Glauben - angesichts der Sinnhaftigkeit von Naturobjekten, z. B. von Instinkthandlungen oder dem Bau des Auges,26 zu fragen: »Zeigt sich nicht in solchen Erscheinungen, daß es da ein unkörperliches, lebendiges, intelligentes Wesen gibt?«27 Vor diesem Hintergrund nennt Kant den Gottesbeweis aus der Beobachtung von Zweckmäßigkeit in der Natur »Physikotheologie«. Literatur Allgemein: W. Weischedel, Der Gott der Philosophen, 1: Wesen, Aufstieg und Verfall der Philosophischen Theologie, Darmstadt 1971 J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie, 2 Bde., Freiburg 1 51961, II 41960 Qu. Huonder, Die Gottesbeweise, Stuttgart 1968 Artikel »Gott«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, III, Basel 1974, 721-814 speziell für die Neuzeit: U. Neuenschwander, Gott im neuzeitlichen Denken, 2 Bde., Gütersloh 1977 H. Küng, Existiert Gott?, München 1978 W. Schulz, Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, Pfullingen 41969 Religionskritik: H. Zirker, Religionskritik (Leitfaden Theologie 5), Düsseldorf 1982 K. H. Weger (Hrsg.), Religionskritik von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Autorenlexikon von Adorno bis Wittgenstein, Freiburg 1979 25 S. Parker (1640-1688), Tentamina physico-theologica de Deo, London 1665; W. Derham, Physicotheology, London 1713, deutsch 1732. 26 Vgl. I. Newton, Optics,31721. 27 Ebd. gegen Schluss. INHALT: Einleitung S. 11-12 Die Gottesfrage im philosophischen Denken S. 13-48 Das griechische Denken Die Frage nach dem Urgrund Philosophisches Fragen Wissenschaft und Weltanschauung Geschichtlichkeit Philosophie und Leben Philosophische Begriffsbildung Theologie bei Platon und Aristoteles Antike Lebensweisheit Christlicher Gottesglaube und Philosophie Anfänge christlichen Denkens Scholastik Thomas von Aquin Einheit und Vielfalt von Ansätzen Fragestellungen neuzeitlicher Philosophie Das neue Ideal der Wissenschaft Das erkenntniskritische Anliegen Rationalismus Empirismus Physikotheologie