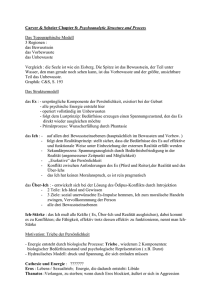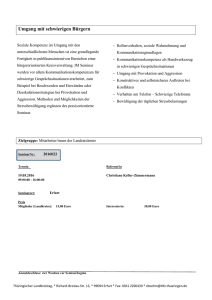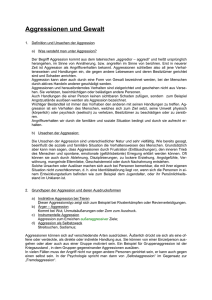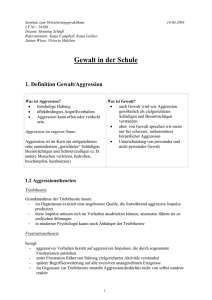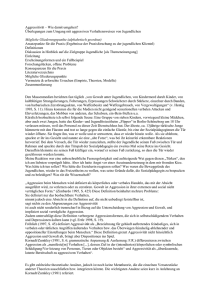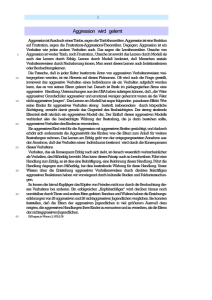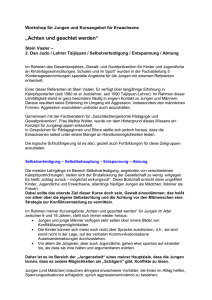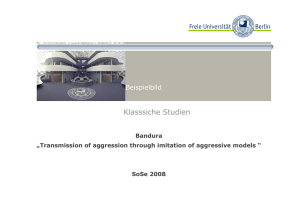Wozu ist die Schule da?
Werbung
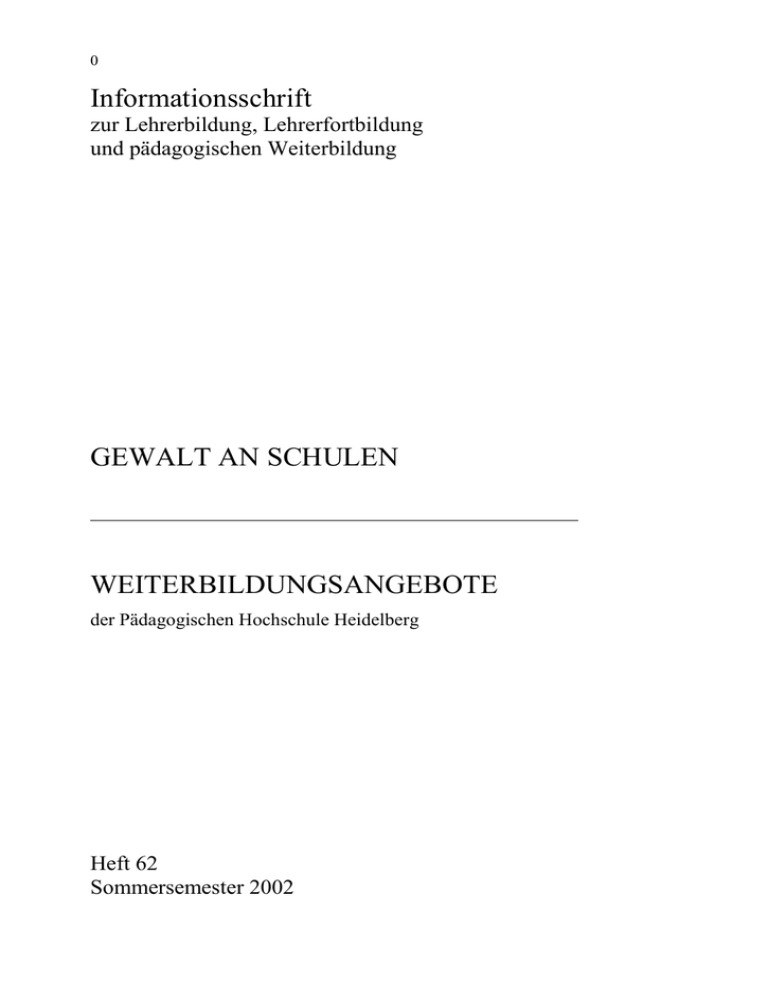
0 Informationsschrift zur Lehrerbildung, Lehrerfortbildung und pädagogischen Weiterbildung GEWALT AN SCHULEN WEITERBILDUNGSANGEBOTE der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Heft 62 Sommersemester 2002 1 Pädagogische Hochschule Heidelberg Institut für Weiterbildung 69120 Heidelberg, Keplerstraße 87 Telefon 06221/477 522, Telefax 06221/477 437, email: [email protected], homepage: www.ph-heidelberg.de/org/ifw Leiter: Dr. Willi Wölfing, Akad. Direktor Sprechstunde: Montag, 13.00 -14.00 Uhr, Raum 26, 477 519 Sekretariat: Janine Jahnke Öffnungszeiten: Mo.- Do.: 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr, Raum 25, 477 522 Abteilung I: Lehrerfortbildung Sylvia Selke, Lehrerin Sprechstunde: nach Vereinbarung, Raum 24, 477 520 Abteilung II: Außerschulische Weiterbildung Dr. Veronika Strittmatter-Haubold Sprechstunde nach Vereinbarung, Mozartstraße 29, Raum 05, 477 402 Sekretariat: Bettina Grünewald-Töpfer 477-401, Fax: 477 155, email: [email protected], homepage: www.ph-heidelberg.de/org/ifw Beratende Kommission des Instituts für Weiterbildung: Rektor: Prof. Dr. Ludwig Schwinger Dekan Fakultät I: Prof. Dr. Theo Klauß Dekan Fakultät II: Prof. Dr. Gerhard Härle Dekan Fakultät III: Prof. Dr. Gerhard Hofsäß Dekan Fakultät IV: Prof. Dr. Ulrich Bubenheimer Impressum Redaktion Sylvia Selke, Schönau; Willi Wölfing, Dossenheim Redaktionsausschuss Peter Buck, Heidelberg; Konrad Gieringer, Hirschberg; Hans Peter Henecka, Bruchsal; Franz-Karl Krug, Karlsruhe; Karl Christoph Schäfer, Heidelberg; Sylvia Selke, Schönau; Inge Vinçon, Heidelberg; Willi Wölfing, Dossenheim Textbearbeitung Sylvia Selke, Schönau; Janine Zacher, Mannheim Druck Druckerei & Verlag Steinmeier, Reutheweg 29-31, 86720 Nördlingen, Telefon: 0908129640, internet: www.steinmeier.net Auflage 4500 Exemplare Nachdruck, fotomechanische Reproduktion, Anfertigung von Mikrofilmen, auch von Auszügen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion zulässig. 2 INHALT Gewalt an Schulen Impressum 2 Wozu ist die Schule da? - Zur erzieherischen Funktion von Schule 4 diskutiert am Thema „Aggression und Gewalt“ Frank Lipowsky Gewalt an Schulen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 24 Geider, Barth, Jünger, Becker, Klaus „Arizona“ - ein Programm zur Förderung der „Eigenverantwortung“ 42 oder ein Disziplinierungsinstrument? Betrachtungen aus der Perspektive der psychoanalytischen Pädagogik Rolf Göppel Künstlerische Bildung und die Schule der Zukunft 58 Symposium zur künstlerischen Bildung in der nachindustriellen Gesellschaft Arbeits- und Ergebnisbericht Carl-Peter Buschkühle Autorenverzeichnis 67 Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Inhalt 68 Gruppe 10 72 Veranstaltungen der Fachgruppen Gruppe 20 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung 76 Anmeldeformular 77 Gruppe 30 99 Offene Veranstaltungen aus dem Lehrangebot der Pädagogischen Hochschule 3 Gruppe 40 Forum Schule 104 Kontaktveranstaltungen 105 Einladung zu öffentlichen Veranstaltungen Hauptseminar: „Pillen für den Störenfried?“ 106 Tagung: „Families in context: International Perspectives on Change“ 107 Tagung: „... alle Kinder alles lehren“ - Perspektiven der Erziehung und Bildung von Schülerinnen und Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung 108 Heidelberger Weiterbildung Veranstaltungen der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung 110 4 Wozu ist die Schule da? - Zur erzieherischen Funktion von Schule diskutiert am Thema ‘Aggression und Gewalt’ Frank Lipowsky 1. Wozu ist die Schule da? - Zur Aktualität des Themas Die Frage „Wozu ist die Schule da?“ bzw. „Welche Schule brauchen wir?“ wird seit einigen Jahren immer drängender an Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch an Bildungspolitiker gerichtet. Auslöser dieser Debatte waren u.a. die Befunde der TIMSStudie. Die Studie ergab, dass deutsche Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe im naturwissenschaftlich-mathematischen Unterricht im internationalen Vergleich nur im unteren Mittelfeld rangieren (vgl. Baumert & Lehmann u.a. 1997). Auch die jüngsten Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, dass deutsche Schülerinnen und Schüler bei der Anwendung ihrer Kompetenzen nur einen Platz im unteren Mittelfeld belegen. Die Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudien rückten die Schulpolitik und die Qualität von Schule und Unterricht ins Rampenlicht der öffentlichen Diskussion. Bildungspolitiker von Bund und Ländern, Eltern und Pädagogen fordern eine neue Bildungsreform, die hinsichtlich ihrer Zielsetzung Parallelen aufweist zur bislang größten Reform in der deutschen Bildungsgeschichte in den 60er Jahren. Damals wie heute geht es um die Verringerung des Einflusses der sozialen Herkunft auf die Schul- und Lebenskarrieren der nachwachsenden Generation. Neben schulorganisatorischen Fragen wird aktuell vor allem darüber diskutiert, wozu die Schule da ist, was und wie Schüler lernen sollen und können, wie der Unterricht anwendungsorientierter gestaltet werden kann, wie die Lehrerausbildung verändert werden muss und ob und in welchem Umfang die Schule noch eine erzieherische Funktion übernehmen kann angesichts der Versäumnisse im Elternhaus. Gerade die pädagogischen Aufgaben führen bei vielen Lehrern zu frühzeitigem ‚Burnout’. Der Focus berichtet unter dem reißerischen Titel ‘Höllenjob Lehrer’ am 9.4. 2001 über die Belastungen, denen Lehrerinnen und Lehrern bei der täglichen Arbeit ausgesetzt sind. Nach Untersuchungen erreichen nur 4% der Lehrerinnen und Lehrer die normale Dienstaltersgrenze, der Rest scheidet vorher aus (vgl. Sieland 2001, S. 36). Unter dem Titel ‘Die Elternkatastrophe’ beklagt die ZEIT am 26.4. 2001 auf ihrer Titelseite die Erziehungsversäumnisse in der Familie und fordert statt einer Bildungsoffensive eine Erziehungsoffensive. Und auch die deutschen Kinder selbst stellen ihren Eltern schlechte Noten aus: Sie bemängeln das geringe Interesse und die geringe Zuwendung ihrer Eltern, wie die Begleituntersuchung im Rahmen der PISA-Studie ergab. Die Schule, dies wird mittlerweile von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung so gesehen, ist als ‘Reparaturanstalt’ für gesellschaftliche und 5 erzieherische Probleme überfordert und kann Erziehungsversäumnisse der Eltern nicht kompensieren. Die aktuelle Diskussion über die Qualität und die Funktion von Schule zeigt, dass es um eine Neudefinition und Austarierung des Verhältnisses von Unterricht und Lernen einerseits und Erziehung andererseits geht. Mit seinem Funkvortrag „Wozu ist die Schule da?“ regte der streitbare Erziehungswissenschaftler Hermann Giesecke bereits 1995 dazu an, über die Funktion der Schule neu nachzudenken. Seine Frage und seine provokanten Antworten haben, wenn man die aktuelle Diskussion berücksichtigt, nichts an Aktualität verloren. 2. Die Thesen Hermann Gieseckes im Überblick Mit seinen Thesen löste Giesecke 1995 eine heftige und kontroverse Debatte über die Funktion von Schule aus. Auf den Vortrag von Giesecke gingen über 500 Hörerzuschriften beim NDR ein, zumeist von Lehrerinnen und Lehrern. Der erziehungswissenschaftliche Disput wurde vor allem in der Neuen Sammlung geführt (vgl. Fauser 1996). Gieseckes Argumentationsstrang knüpft an die hohe Quote von Lehrern an, die vor Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden. Ursächlich verantwortlich macht er hierfür die zunehmende Disziplinlosigkeit und Gewalt in der Schule. Ausgehend hiervon entwickelt er folgende Thesen: 1 Die Schule wird mit gesellschaftlichen Aufgaben, für die sie nicht zuständig ist, überfrachtet. 2 Der Zweck der Schule ist Unterricht, nicht Erziehung. Lehrerinnen und Lehrer haben ein einseitiges Berufsverständnis, weil sie sich vor allem über ihre Erziehungsaufgaben definieren. 3 Alles Nachdenken über Schule muss bei ihrer gesellschaftlichen Funktion ansetzen. Die Welt ist nicht kindgerecht, die ‘reformpädagogische’ Strategie ist gescheitert. 4 Schule hat sich als Institution von den Eltern und vom Leben außerhalb ihrer Mauern deutlicher abzugrenzen und diese Grenzen bewusst zu vertreten. Und zur Gewaltproblematik vertritt er folgende Thesen und Lösungsvorschläge: 5 Die Schule hat durch ihre reformpädagogische Orientierung einen Anteil an der Schulmisere. Lehrer tragen zur Gewaltproblematik bei, weil sie Verbalaggressionen im Unterricht zulassen und den Schülern keine deutlichen Grenzen setzen. Die Schule ist insofern Täter, nicht Opfer. 6 Die Schule muss das ‘normale’ Schülerverhalten definieren und Abweichungen hiervon sanktionieren. 7 Die Eltern haben dafür Verantwortung zu tragen, dass ihre Kinder unterrichtsfähig und lernwillig sind. Wenn die Eltern hierzu nicht in der Lage sind, muss die Jugendhilfe einspringen, nicht die Schule. 8 Die Schule muss abweichende Schülerinnen und Schüler ausgrenzen und selektieren. Ziel ist, homogene statt heterogene Lerngrup- 6 pen zu bilden. In diesem Zusammenhang ist auch ‘Sitzenbleiben’ pädagogisch sinnvoll. Ad 1. Die Schule ist mit der Kompensation gesellschaftlicher Probleme überfordert. Giesecke wendet sich damit gegen eine zunehmende Sozialpädagogisierung der Schule, wie sie z.B. vom Hamburger Erziehungswissenschaftler Struck (1994) als Antwort auf veränderte Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen vertreten wird (vgl. Giesecke 1996b, S. 267f.). Ad 2: Der zentrale Zweck der Schule ist der Unterricht, denn alle anderen „Zwecke werden von den übrigen Sozialisationsinstanzen mindestens ebenso gut und vor allem billiger erfüllt“ (Giesecke 1996a, S. 12). Giesecke (1996b, S. 287ff.) kritisiert in diesem Zusammenhang das Berufsverständnis der Lehrerinnen und Lehrern und hält ihre Professionalität für beschädigt, denn sie betonen vor allem die Erziehungsaufgaben. „Wer mit Lehrern über die Probleme der Schule diskutiert, wird oft die Erfahrung machen, dass sie geradezu fixiert sind auf ihre angebliche Erziehungsaufgabe, die sie als ständig umfangreicher werdend vorstellen. Deren Reduzierung auf das mit dem Unterricht Zusammenhängende empfinden sie leicht als Attacke auf ihre berufliche Identität. Zutreffend ist jedoch das Gegenteil. Solange die Lehrer an ihren umfassenden Erziehungsvorstellungen festhalten, wird die Öffentlichkeit sie auch dafür in Haftung nehmen, und die Eltern werden auf dieser Schiene Ansprüche einklagen, die eigentlich ihrer Ver- antwortung unterliegen. Nur eine konsequente Beschränkung des beruflichen Selbstverständnisses auf Unterricht und auf das, was als dessen Voraussetzung und Umfeld anzusehen ist, kann professionelles Ansehen fundieren“ (Giesecke 1996b, S. 289f.). Ad 3: „Alles Nachdenken über Schule muss...bei ihrer gesellschaftlichen Funktion ansetzen (Giesecke 1996a, S. 9). Giesecke kritisiert die reformpädagogische Strategie der Schule, der er eine Mitverantwortung für die Schulmisere gibt. Die Schule, so sein Hauptvorwurf, habe sich zu sehr den Interessen und Wünschen der Schüler unterworfen (vgl. Giesecke 1996a, S. 8; 1996b, S. 237). Ad 4: Ein weiterer Vorwurf Gieseckes an die Schule lautet, dass sie sich als öffentliche Institution mit einem gesellschaftlichen Auftrag nicht deutlich genug von den privaten Erwartungen und Interessen der Eltern und dem Leben außerhalb ihrer Mauern abgrenzt. „Der Niedergang des Lehrerberufs korrespondiert mit dem Aufstieg der Elternmacht....Die Elternmitbestimmung in der Schule hat nicht zu einer Verbesserung des rationalen Diskurses über pädagogische und unterrichtliche Fragen geführt, sondern eher den familiären Egoismus in die Schule transportiert“ (Giesecke 1996b, S. 281ff.). „Zu den falschen Erwartungen an die Schule gehört fast folgerichtig, dass viele Eltern ihre eigene pädagogische Verantwortung für ihre Kinder an der Schultüre abgeben in der Annahme, die Lehrer würden es schon 7 richten, sie würden schließlich dafür bezahlt“(Giesecke 1996a, S. 7). Die bildungspolitische Konsequenz hieraus lautet für Giesecke (1996b, S. 296): „Die Schulen müssen wieder organisatorisch wie rechtlich in die Lage versetzt werden, ihren öffentlichen Bildungsauftrag auch gegen den Willen von Eltern und solcher politischer Gruppen, die sich für ihre eigenen Ziele bedienen wollen, zu begreifen und durchzusetzen.“ Giesecke (1996b, S. 298) hält nichts davon, den Schulen mehr Autonomie zuzugestehen, denn eine Lokalisierung der Schulpolitik würde den Einfluss der Elternschaft noch verstärken. Ein weiterer Fehlschluss des pädagogischen Zeitgeistes besteht für Giesecke darin, sich dem Leben außerhalb der Schule zu öffnen. Die Aufgabe der Schule und des Unterrichts ist es, in Distanz zum üblichen Leben zu treten. „Unterricht ist immer eine konstruierte, künstliche Situation, die im normalen Leben nicht vorkommt und deshalb auch mit diesem nicht verwechselt werden darf. Das Leben aber unterrichtet nicht. Wer unterrichtet wird, verlässt zu diesem Zwecke das ‘normale’ Leben, um anschließend wieder zu ihm zurückzukehren“ (Giesecke 1996b, S. 280). Ad 5: „Eine der bis zum Überdruss wiederholten Erklärungen des Zeitgeistes ist, dass die Schüler ihre Probleme mit in die Schule brächten und sie dort eben auch ausleben müssten. Das ist allenfalls die halbe Wahrheit, denn jeder Mensch schleppt seine Probleme überall mit hin, aber der Prozess der Zivilisierung besteht ja gerade darin, dass man seine Pro- bleme nicht an jedem sozialen Ort jedermann um die Ohren haut. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass die Schule ...das Problem selbst produziert, indem sie den Schülern einen gegen Disziplinlosigkeit und Gewalt machtvoll abgesicherten Raum verweigert, in dem vielleicht ihre mitgebrachte Aufregung und Labilität zur Ruhe kommen könnten. Die Schule ist hier Täter, nicht Opfer“ (Giesecke 1996b, S. 209f.). Indem Lehrer Schimpfkanonaden und Verbalaggressionen zulassen, verhält sich die Schule verwahrlosend. Sie lässt es zu, dass die ‘Diktatoren der letzten Bank’ die Macht übernehmen (vgl. Giesecke 1996b, S. 208). Mit ihrer reformpädagogischen Strategie züchtet der Schule die Verwahrlosung des öffentlichen Verhaltens (vgl. Giesecke 1996b, S. 210). Ad 6: „Jede Institution muss ...den Zweck, dem sie dient, auch durchsetzen können. Wenn nun Zweck der Schule Unterricht ist ..., dann folgt daraus, dass sie als Institution auch Sanktionen ergreifen können muss, um ihren Zweck zu sichern. Sie muss also Strafmaßnahmen gegen solche Schüler ergreifen können, die z.B. durch Disziplinlosigkeit oder gar Gewalttätigkeit die ordnungsgemäße Durchführung des Unterrichts erheblich behindern“ (Giesecke 1996a, S. 12f). Strafmaßnahmen der Schule sind keine Ausgrenzung, denn schließlich grenzt sich der undisziplinierte Schüler selbst aus. „Die Institution Schule kommt nicht darum, den ‘Normalfall’ zu definieren, und der kann nur heißen, dass die Schüler grundsätzlich bereit und in der Lage sind, dem Unterricht zu 8 folgen ... Politisch gesprochen ist die Defi-nition des Normalfalls eine Machtfrage ... Klärt die Institution die Machtfrage nicht, werden dies andere tun, z.B. die ‘Diktatoren der letzten Bank’“ (Giesecke 1996a, S. 12f.). Ad 7: „Nicht die Lehrer, sondern die Eltern sind dafür verantwortlich, dass der Schüler den Schulzweck akzeptiert und eine hinreichende Lernfähigkeit und Lernwilligkeit mitbringt... Er [Der Lehrer] muss sich auch weigern, ... Kinder in seinen Unterricht zu nehmen, ... [die] nicht unterrichtsfähig sind“ (Giesecke 1996a, S. 12ff.). „Wenn sich in unseren Massenschulen tatsächlich zunehmend Kinder befinden, die weder die sozialen noch die intellektuellen Voraussetzungen haben, um bei wenigstens mittlerem guten Willen erfolgreich am Unterricht teilzunehmen, dann kann die Schule dies genauso wenig verändern wie das Finanzamt für Steuergerechtigkeit sorgen kann. Dann muss vielmehr diejenige öffentliche Institution um Unterstützung gebeten werden, die dafür vorgesehen und dafür fachlich besser ausgestattet ist: Nämlich die Jugendhilfe“ (Giesecke 1996a, S. 14). Ad 8: Die Schule hat für Giesecke (1996b, S. 215f.) keine sozial-integrative Funktion mehr: „So groß heute die Startunterschiede der Kinder in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht auch sein mögen, sie rechtfertigen keine ... integrative Anstrengung mehr.“ Für Giesecke besteht somit keine politische Notwendigkeit mehr für eine soziale Integrationsfunktion der Schule. Pädagogischen Forderungen nach heterogenen Lerngruppen erteilt Giesecke (1996b, S. 216) eine Absage. Statt dessen ist nach Giesecke die Selektionsfunktion der Schule stärker zu betonen. „Aufgabe der Schule ist..., jedem Kind die Chance zu geben, seine Fähigkeiten im optimalen Maße zu entfalten, damit es in einer Gesellschaft voller Optionen eine individuell befriedigende Balance zwischen objektiven Anforderungen und subjektiven Bestrebungen finden und darauf seine persönliche Lebensplanung, z.B. in beruflicher Hinsicht gründen kann... Zu fördern sind die ...’guten’ wie die ‘schlechten’ Schüler, aber so, dass sie einander dabei nicht behindern und etwa die letzteren das Tempo für alle bestimmen... Aus dem Prinzip des chancengleichen Zugangs resultiert u.a. der pädagogische Sinn des Sitzenbleibens, was der ... Zeitgeist für Ausgrenzung hält...Was hat denn ein weniger begabtes Kind davon, wenn es durch die anderen ständig an seine Mängel erinnert wird, anstatt unter seinen Begabungsgleichen die Chance einer wenigstens mittleren Erfolgserfahrung zu gewinnen?“ (Giesecke 1996a, S. 9f.). 3. Kritische Anmerkungen zu den Thesen Gieseckes Gieseckes Thesen und Lösungsvorschläge fanden vor allem unter Lehrerinnen und Lehrern ein starkes Echo. Viele der antwortenden Lehrer fühlten sich durch seine Thesen bestätigt und verstanden. Seine Lösungsvorschläge versprechen auf den ersten Blick erhebliche Entlastung von den immer schwieriger werden- 9 den pädagogischen Aufgaben der Schule. Unterzieht man seine Thesen und Lösungsvorschläge einer wissenschaftlichen Analyse, so werden an vielen Stellen pauschale und undifferenzierte Behauptungen erkennbar, die einer empirischen Überprüfung nicht standhalten. Bevor genauer auf das Thema ‘Aggression und Gewalt’ eingegangen wird, folgen zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zum Duktus und zum Argumentationsstrang seines Beitrags. Giesecke lässt es insgesamt an wissenschaftlicher Gründlichkeit vermissen. Er schreibt und spricht von der Schule und differenziert weder nach Schularten noch nach Konzepten oder Aufgaben. Er schreibt und spricht von dem Schüler und differenziert weder nach Entwicklungsstand, Persönlichkeit oder familiärem Hintergrund und offenbar gibt es für ihn auch nur den Lehrer bzw. die Lehrerin. Darüber hinaus argumentiert er grundsätzlich ohne Rückgriff auf empirische Studien und Befunde, berücksichtigt keine wissenschaftlichen Theorien und lässt auch historische und gesellschaftliche Zusammenhänge weitgehend ausgeklammert. Differenzierung tut also not. Bei der Entwicklung seines Argumentationsstrangs rekurriert er im Wesentlichen auf Erfahrungsberichte von Lehrerinnen und Lehrern, die resignierend ein pessimistisches Bild der Schulwirklichkeit zeichnen. Er zieht an keiner Stelle Berichte heran, die zufriedene, optimistisch eingestellte, begeisterte und engagierte Pädagoginnen und Pädagogen zu Wort kommen lassen. Befunde aus der Sozialpsychologie, aus der Persönlichkeitspsychologie und aus der Lehrerforschung zeigen deutlich, dass es höchst unterschiedliche Lehrertypen mit unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, mit unterschiedlichen Motivationslagen für den Beruf, unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen und einer unterschiedlichen Belastungsfähigkeit gibt (vgl. Terhart u.a. 1994; Hurrelmann 1996, S. 21). Nicht alle Lehrer klagen und sind frustriert, viele Lehrer lassen sich trotz der täglichen Belastungen und trotz mancher Rückschläge nicht entmutigen und von ihren - als richtig erkannten - pädagogischen und unterrichtlichen Zielen abbringen. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass Lehrer erheblichen psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Lehrerberuf erfordert damit nicht nur didaktisch-methodische, fachliche, diagnostische, reflexive, soziale und emotionale Fähigkeiten, sondern auch Kompetenzen und Strategien zur Erhaltung der eigenen Gesundheit. Besonders belastend wirkt sich neben den konkreten Problemen die hohe Entscheidungsdichte im Lehrerberuf aus. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Folgen und Ergebnisse des pädagogischen Handelns nicht unmittelbar bestimmen und nicht immer zielgenau lenken und beeinflussen lassen. Anerkennung und Dankbarkeit bleiben Lehrern häufig versagt. Wie Lehrerinnen und Lehrer Situationen ihres Berufsalltags wahrnehmen, erleben und verarbeiten, ist in 10 hohem Maße abhängig von ihrer Persönlichkeit, von ihrem sozialen Netzwerk, ihren Interessen und damit auch von ihrem Privatleben. Schutz vor psychischen Belastungen bieten auf der Individuumsebene eine optimistische Haltung, eine gesunde Rollendistanz, Selbstakzeptanz und Selbstsicherheit, Genussfähigkeit und Ausgeglichenheit, Ich-Stärke, Kompetenzen im Bereich Konflikt- und Problemlösungsmanagement sowie ein befriedigendes Privatleben und die Fähigkeit, um- bzw. abzuschalten (vgl. Sieland 2001, S. 36f.). Darüber hinaus stellt das Gefühl der eigenen Wirksamkeit und Kompetenz eine wichtige belastungsreduzierende Ressource dar, d.h. Lehrerinnen und Lehrer, die eher davon überzeugt sind, auch in schwierigen Situationen etwas ausrichten und bewirken zu können, ‘brennen seltener aus’ als Lehrer mit einer geringeren Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Brockmeyer & Edelstein 1997, S. 150; Schwarzer & Schmitz 2000). Als belastungsreduzierend und unterstützend wirken zudem Supervision und Teamarbeit. Gieseckes Thesen und Lösungsvorschläge zur Belastungsproblematik, die einen Schwerpunkt seiner Argumentationsfigur bilden, sehen vor, dass Lehrer den Erziehungsauftrag weitgehend zurückweisen und sich auf das Unterrichten konzentrieren. Ob sich dadurch tatsächlich die Belastungen reduzieren lassen, muss auf der Basis oben genannter Befunde bezweifelt werden. Weitere Kritikpunkte, die hier nicht näher ausgeführt werden, betreffen die Trennung von Erziehung und Un- terricht, die Vernachlässigung bzw. Unterordnung der Individuierung unter die gesellschaftliche Funktion der Schule, das einseitige Bildungsverständnis, das Giesecke vertritt (vgl. Fauser 1996) sowie unhaltbare Annahmen über die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern in heterogenen Klassen und die Effekte der Nichtversetzung. 4. Gewalt in der Schule 4.1 Definition von Aggression und Gewalt Aggression und Gewalt werden im alltäglichen Sprachgebrauch häufig synonym verwendet. Aus wissenschaftlicher Sicht gilt der Aggressionsbegriff als der weitere Begriff und kann als Oberbegriff betrachtet werden. Der Gewaltbegriff bildet eine Teilmenge des Aggressionsbegriffs. Zu den Aggressionsformen, die man üblicherweise nicht dem Gewaltbegriff zurechnet, zählen z.B. Durchsetzungsfähigkeit und -verhalten sowie Konkurrenzorientierung, ferner Autoaggressionen, umgekehrt fällt Vandalismus nicht unter den Aggressionsbegriff (vgl. Tillmann u.a. 1999, S. 24). Unter dem Gewaltbegriff subsumiert man neben physischen auch psychische Formen der Schädigungen, daneben Vandalismus als Gewalt gegen Sachen sowie verbale und nonverbale Aggressionen. Strukturelle Gewalt soll hier ausgeklammert werden, damit der Gewaltbegriff nicht zu unscharf wird. Unter struktureller Gewalt versteht man in der Regel institutionelle und strukturelle Bedingungen, die die Entwicklungs- 11 möglichkeiten des Einzelnen einschränken (vgl. Valtin 1995, S. 10). Im Zusammenhang mit der Schule sind dies bspw. die Schulpflicht, der Notendruck oder der Stoffplan. Unter Gewalt soll hier eine zielgerichtete direkte Schädigung von Personen oder Sachen verstanden werden, die von Personen ausgeübt wird. Dabei kann es sich um physische oder um psychische Gewaltaktivitäten handeln (vgl. Rauschenberger 1995; Valtin 1995, S. 8; Tillmann u.a. 1999, S. 24). Gewalthandlungen in der Schule werden in der Regel nach verschiedenen Erscheinungsformen klassifiziert: aggressives verbales und nonverbales Verhalten (beschimpfen, verspotten, auslachen, beleidigen, gemeine Gesten u.a.) Gewalt unter Schülerinnen und Schülern (Körperverletzung, Drohung, Erpressung, sexuelle Übergriffe u.a.) Gewalt gegenüber Lehrerinnen und Lehrern (Körperverletzung, Drohung u.a.) sowie aggressives Verhalten von Lehrkräften gegenüber Schülerinnen und Schülern (vgl. Valtin 1995, S. 10). 4.2 Überblick über theoretische Modelle und Erklärungsansätze Warum üben Menschen Gewalt aus? Die Psychologie und die Soziologie haben hierzu eine Reihe unterschiedlicher Modelle und Erklärungsansätze entwickelt, um diese Frage zu beantworten. In den letzten Jahren sind auch verstärkt integrative Ansätze entstanden, die Elemente ver- schiedener Theorien miteinander kombinieren. Die klassischen psychologischen Theorien erklären Aggression als Trieb, als Ergebnis einer Frustration, als Lernerfahrung, als Folge einer Interaktion zwischen Personen, als Ausdruck einer schweren Persönlichkeitsstörung oder als Folge phylogenetischer oder neurophysiologischer Prozesse. Neuere psychologische Theorien fokussieren den Entwicklungsgedanken, beziehen sich auf entscheidungstheoretische Grundlagen oder erklären Aggression als Folge gescheiterter schulischer Anerkennung. Klassische soziologische Theorien erklären Aggression als Anpassungsvorgang an widersprüchliche sozialstrukturelle Verhältnisse oder als Ergebnis gesellschaftlicher Etikettierungs- und Zuschreibungsprozesse. Neue soziologische Ansätze bringen aggressives Verhalten in Verbindung mit gesellschaftlichen Individualisierungs- und Desintegrationsprozessen oder erklären Gewalt in der Schule mit ihrer anomischen Struktur. Daneben existieren verschiedene kriminalsoziologische Modelle und integrative Erklärungsansätze, die das Geschlecht oder die Schule als zentrale erklärende Variable einbeziehen (vgl. Schubarth 2000, S. 13ff.; Nolting 1997). Keine dieser Theorien kann jedoch alle Formen von Aggression und Gewalt widerspruchsfrei erklären. 4.3 Erscheinungsformen schulischer Gewalt Das Thema „Gewalt an Schulen“ ist in den letzten Jahren auf große Resonanz in der Öffentlichkeit und den 12 Medien gestoßen. Seit ca. 5 Jahren liegen umfassende empirische Ergebnisse verschiedener Forschungsprojekte zum Thema „Gewalt in der Schule“ vor. Die Studien gingen u.a. der Frage nach, ob Gewalt an Schulen tatsächlich zugenommen hat. Zwar variieren die Ergebnisse von Studie zu Studie, dennoch lässt sich eine gemeinsame Tendenz ausmachen: Das Ausmaß an Gewalt hat außerhalb und damit auch innerhalb der Schule leicht, aber nicht so dramatisch zugenommen wie dies Berichte in den Medien suggerieren (vgl. Schubarth 2000, S. 75f.; Lamnek 2000, S. 7; Valtin 1995, S. 7; Tillmann 1997, S. 18f.). Neben quantitativen Veränderungen wird vor allem von einer neuen Qualität, von einem Herabsinken der Hemmschwellen berichtet. Differenziert man nach den Erscheinungsformen der Gewalt, so rangieren in allen Studien verbale Aggressionen an erster Stelle. Diese Gewaltform ist nicht nur die häufigste, sondern auch diejenige, die am stärksten zugenommen hat. Verbalen und nonverbalen Aggressionen wird in den meisten Studien eine hohe Vorhersagerelevanz für tätliche Gewalt zugeschrieben, d.h. Verbalaggressionen senken die Hemmschwelle für tätliche Gewalt: Wer sich nicht mehr mit Kraftausdrücken oder Gesten zu helfen weiß, greift zum nächst stärkeren Mittel, dem tätlichen Angriff (vgl. Hanewinkel; Niebel & Ferstl 1995, S. 32). Dahinter folgen - je nach Studie in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlicher Reihung - Gewalt unter Schülerinnen und Schülern, Vandalismus und Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrern. Gewalt von Lehrkräften gegenüber Schülern wurde bisher nur selten erhoben. Die wenigen Studien kommen zu dem Ergebnis, dass ca. ein Drittel der Schülerinnen und Schüler Gewalt oder aggressives Verhalten von Lehrkräften erlebt oder beobachtet hat (vgl. Schubarth 2000, S. 84). Differenziert man die Gewalthandlungen der Schüler nach der Schwere, so lässt sich übereinstimmend feststellen: Die wirklich schweren und besonders spektakulären Gewalthandlungen wie massive Körperverletzungen, Erpressungen, Bandenschlägereien kommen relativ selten vor (vgl. Tillmann 1997, S. 15; Schubarth 2000, S. 82ff.). Befragt man die Forschungsergebnisse danach, wie viele Schüler von aggressivem Verhalten und Gewalthandlungen betroffen sind, so ergibt sich folgendes Bild: Ungefähr 5% bis 8% der Schülerinnen und Schüler bilden den ‘harten’ Kern und sind für einen Großteil der schweren Gewalthandlungen verantwortlich. Sie sind oft Mehrfachtäter (vgl. Lamnek 2000, S. 11). Daneben gibt es einen Anteil von ca. 30%-50%, die gelegentlich Gewalt ausüben bzw. sie unter bestimmten Umständen billigend in Kauf nehmen. Zwischen 5% bis 10% sind ausschließlich Opfer. Demgegenüber sind - je nach Studie zwischen 50%-70% der Schülerinnen und Schüler weder Opfer noch Täter und damit unbeteiligt. Bis zu 50% der Opfer sind in den verschiedenen Untersuchungen auch Täter sowie umkehrt ein Teil der Täter auch Op- 13 fer ist (vgl. zusammenfassend Tillmann 1997, S. 17). Geht man der Frage nach, wie viele Lehrer schon einmal Opfer von aggressivem Verhalten gewesen sind, ergeben sich divergierende Ergebnisse, die auch auf unterschiedliche Fragen und Methoden der Untersuchungen zurückgeführt werden können. Nach Angaben einer Erhebung in Schleswig-Holstein haben 50% der befragten Schülerinnen und Schüler schon mal erlebt, wie Lehrkräfte ‘fertiggemacht’ wurden (vgl. Hanewinkel, Niebel & Ferstl 1995, S. 26). Nach einer Kasseler Untersuchung sind 29% der Lehrerinnen und Lehrer schon mal Opfer verbaler Gewalt von Schülern gewesen, 7% der Kasseler Lehrerinnen und Lehrer waren schon mal Opfer körperlicher Gewalt (vgl. Greszik; Hering & Euler 1995). Lamnek (2000, S. 8) stellt fest, dass für Lehrer im Allgemeinen nur eine geringe Gefahr besteht, Opfer von Schülergewalt zu werden. 4.4 Risikofaktoren und Entstehungsbedingungen für Gewalt Befragt man die empirischen Studien nach statistisch nachweisbaren Zusammenhängen über Bedingungen und Risikofaktoren für die Entstehung von Gewalt, so kristallisieren sich vier große Faktorenbündel heraus, die sich teilweise gegenseitig bedingen bzw. in Zusammenhang stehen. Bedeutsam für das Entstehen von Gewalt sind vor allem die familiären Bedingungen: Gestörte und instabile Familienbeziehungen, ein restriktiver autoritärer elterlicher Erziehungsstil, ein vernachlässigendes und wenig fürsorgliches Erziehungsverhalten sowie Gewalterfahrungen in der Familie fördern die Gewaltorientierung und die Gewaltaffinität von Kindern und Jugendlichen. Das Ausmaß des jeweiligen Zusammenhangs unterscheidet sich aber von Studie zu Studie (vgl. zusammenfassend: Schubarth 2000, S. 96; Grundmann & Pfaff 2000, S. 294; Tillmann 1999, S. 169f.; Olweus 1996, S. 49). Die Mehrheit der Täter wächst in einem problematischen familiären Milieu auf. Auch der Umkehrschluss ist zulässig: Je wohler sich Jugendliche in der Familie fühlen und je positiver sie die Erziehung ihrer Eltern bewerten, desto seltener wenden sie Gewalt an (vgl. Schubarth 2000, S. 96; Tillmann 1999, S. 169). Als weitere Risikofaktoren erweisen sich väterliche Arbeitslosigkeit und ein fehlender Schulabschluss der Eltern (vgl. Tillmann 1999, S. 167). Schüler aus sozial schwächerem Milieu sind gewalttätiger als Kinder und Jugendliche aus gehobeneren Schichten (vgl. z.B. Hanewinkel, Niebel & Ferstl 1995, S. 32; Tillmann 1999, S. 197). Einen großen Einfluss für die Entstehung von physischer Gewalt innerhalb und außerhalb der Schule hat die peer group. Einige Studien sehen in der peer group sogar den bedeutendsten Einflussfaktor überhaupt, wenn es um die Erklärung gewalttätigen Verhaltens geht. Besonders die gewaltbejahenden Werthaltungen und das aggressive Klima in den Gleichaltrigengruppen weisen einen engen Zusammenhang zum Ausmaß physischer Gewalt in der Schule auf (vgl. Tillmann 1999, S. 180f.; Schu- 14 barth 2000, S. 96; Olweus 1996, S. 51f.). Gewaltbereitschaft und Gewaltaktivitäten in peer groups wirken sich häufig auch auf das Klima der Schule aus (vgl. Tillmann 1999, S. 295). Familiäre Einflüsse und die Einflüsse der peer group überlagern sich vielfach, d.h. Schüler, die in der Familie restriktives Erziehungsverhalten erleben, schließen sich häufig peer groups an, die aggressive Konfliktlösungen bevorzugen (vgl. Tillmann 1999, S. 186; Schubarth 2000, S. 97). Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich auch bei der Mediennutzung. Der Konsum von Horror-, Sex- und Kriegsfilmen steht in enger Verbindung mit physischer Gewalt und Vandalismus. Gleichzeitig zeigt sich, dass diese Filme in erster Linie von Schülerinnen und Schülern aus einem problematischen familiären Kontext konsumiert werden. Der familiäre Hintergrund interagiert in diesen Fällen mit dem Gewaltverhalten in der Schule, mit der Auswahl der Freunde und der Mediennutzung (vgl. Schubarth 2000, S. 97; Olweus 1996, S. 53). Auch zwischen schulischen Faktoren und dem Ausmaß an Gewalt zeigen sich Zusammenhänge. Während die Größe einer Schule keine Rolle spielt, zeigt sich in nahezu allen Untersuchungen ein deutlicher Zusammenhang zwischen Schulform und Gewaltbelastung. In Gymnasien und Grundschulen ist die Gewaltbelastung am geringsten, in Sonderschulen für Lernbehinderte am höchsten. Haupt- und Realschulen liegen dazwischen. Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht unabhängig von den Schülern, d.h. dort, wo sich relativ viele Schüler mit Lernproblemen und Versagenserfahrungen befinden, ist auch die Gewaltbelastung am höchsten (vgl. Tillmann 1999, S. 237; Meier 1997, S. 260). Auch das Schulklima hat Einfluss auf das Auftreten von Gewalthandlungen. In einer reformpädagogisch orientierten Lernkultur mit einem durch Vertrauen, wechselseitiger Akzeptanz und Liberalität geprägten Sozialklima tritt Gewalt seltener auf als in einer Schule, deren Klima sich durch Restriktivität auszeichnet. Auch schülerorientierter, lebensweltbezogener Unterricht wirkt sich offenbar gewalthemmend aus, indem er Schulunlust verringert. Langeweile im Unterricht und Schulunlust hängen wiederum eng mit Vandalismus und etwas schwächer mit dem Auftreten physischer Gewalt zusammen (vgl. Tillmann 1999, S. 233; Grundmann & Pfaff 2000, S. 303; Meier 1997, S. 239; Hurrelmann 1995, S. 77). Nach Befunden einer Untersuchung aus Sachsen-Anhalt steigt die Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen mit abnehmender Schulfreude, mit wachsendem Schulfrust, mit schlechten Schulleistungen und sinkender Leistungsselbsteinschätzung (vgl. Grundmann & Pfaff 2000, S. 300). Aber auch hier bleibt letztlich offen, in welcher Richtung der Zusammenhang besteht: Führt abnehmende Schulfreude zur Gewaltbereitschaft oder aber sorgen zunehmende Gewaltbereitschaft, der Umgang mit gewalttätigen Freunden in einer Clique und die damit verbundenen Reaktionen der schulischen 15 Umwelt zur Abnahme der Schulfreude? Zum Zusammenhang zwischen Leistungsstatus und Gewaltniveau ist die Befundlage uneinheitlich. Während einige Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangen, dass der Leistungsstatus relativ hoch mit der Einstellung zur Schule, mit dem Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler und mit der Cliquenorientierung korreliert und sich über diese Faktoren auch auf das Gewaltniveau auswirkt (vgl. zusammenfassend Schubarth 2000, S. 89), belegen andere Studien nur einen schwachen Zusammenhang zwischen Schulleistung und Gewaltaktivitäten (vgl. Tillmann 1999, S. 252; Hanewinkel, Niebel & Ferstl 1995, S. 33). Ein enger Zusammenhang existiert zwischen schulischen Etikettierungsprozessen und Gewalt. Etikettierungen meinen Bewertungen, die die Jugendlichen in Abweicher-Rollen drängen. Diese fühlen sich ‘abgestempelt’ und kommen aus dieser Rolle nicht mehr heraus. Sie verhalten sich ihrem Etikett entsprechend gewalttätig, was wiederum weitere Prozesse der Stigmatisierung und Etikettierung nach sich zieht. Zwischen Gewaltaktivitäten und sozialen Bewertungen besteht also offenbar eine negative Abwärtsspirale, aus der sich viele Jugendliche nicht befreien können oder wollen. Die Wahrnehmung der sozialen Etikettierungen können in den vorliegenden Untersuchungen Gewaltaktivitäten zu einem vergleichsweise hohen Prozentsatz aufklären (vgl. Tillmann 1999, S. 273; Meier 1997, S. 242). Diese empirischen Befunde zur Etikettierung bestätigen den Ansatz des labeling approach, wonach diejenigen Schüler, die in der Schule auffallen, besonders von negativen Zuschreibungen und Stigmatisierungen betroffen sind. Auf Gewalttätigkeiten folgen Strafen, erneute Abweichungen, härtere Strafen usw. Schließlich kommt es zu einer Verfestigung des Verhaltens. Der Jugendliche verhält sich so, wie es seine Umwelt von ihm erwartet, das Fremdbild wird zum Selbstbild (vgl. Schubart 2000, S. 35). Tillmann (1999, S. 273) weist in seiner Untersuchung darauf hin, dass solche Etikettierungsprozesse auch von Mit-schülerinnen und -schülern ‘angeheizt’ werden können. Mit solchen Stigmatisierungsprozessen und in Verbindung mit schwachen Schulleistungen sind häufig auch Selbstabwertungen und Verunsicherungen des Selbstwertgefühls verbunden (vgl. Hurrelmann 1995, S. 77). Insofern stellen schulische Bedingungen einen auslösenden Faktor für Gewalt und Aggression dar. Die Erfahrung der Ausgrenzung wirkt sich in der Regel gewaltverstärkend aus. Umgekehrt gilt, nicht nur für die Schule, sondern auch für andere Institutionen der Gesellschaft: Je stärker die Integration, desto geringer ist die Gewaltbelastung (vgl. Lamnek 2000, S. 6). Ausgrenzung und Repression verstärken die negativen Erfahrungen der gewalttätigen Jugendlichen, denn vielfach haben sie in ihren Familien statt Zuwendung, Liebe, Anerkennung und Förderung bereits umfassende Erfahrungen mit Ablehnung und Ausgrenzung gesammelt (vgl. Lamnek 2000, S. 11). 16 Darüber hinaus wird hier vermutet, dass es gewalttätigen Schülern auch an alternativen Erfahrungen eigener Wirksamkeit mangelt: Wer dagegen glaubt, durch seine Handlungen etwas Sinnvolles bewirken und ausrichten zu können, wird kaum versuchen, dieses Gefühl über gewalttätige Handlungen zu erlangen. Die Ergebnisse zum Einfluss der Schule auf das Entstehen von Gewalt decken sich im Wesentlichen mit Befunden der Schulqualitätsforschung. Diese Forschungsrichtung geht der Frage nach, warum Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen und ihrem familiärem Hintergrund, an bestimmten Schulen mehr lernen und leisten und sich angemessener verhalten als an anderen. Die entsprechenden Befunde reihen sich ein in die Befunde zur Gewaltforschung. Demnach zeichnen sich solche Schulen u.a. durch eine effektive Leitung, durch eine klare Strukturierung, durch ein Maximum an Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern und durch ein positives Schulklima aus, das durch Lob, Anerkennung und gegenseitige Wertschätzung geprägt ist (vgl. Aurin 1990, S. 66ff.; Steffens & Bargel 1993, S. 42ff.; Boenicke 2000, S. 141). Es geht also nicht um ein EntwederOder von Sachorientierung und Schülerorientierung, Kontrolle und Hilfe, Festlegung klarer Normen und Grenzen einerseits und Verständnis andererseits, sondern um eine Verbindung dieser Pole. Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass der Einfluss schulischer Faktoren auf Gewaltaktivitäten bei weitem nicht so hoch ist wie der Einfluss der Familie und peer group. Dennoch ist der schulische Faktor so bedeutend, dass es sich lohnt, pädagogische Maßnahmen zu ergreifen, um Gewaltaktivitäten in der Schule einzudämmen. Tillmann (1999, S. 238) bewertet den Einfluss der Schule insgesamt als ambivalent: Zwar kann die schulische Umwelt gegenüber Gewalttätigkeiten hemmend bzw. abfedernd wirken, die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass der Einfluss der Schule begrenzt ist. Die Befunde machen deutlich, dass es nicht eine Ursache für Gewalt an Schulen gibt, sondern ein komplexes Wirkgefüge verschiedener Faktoren. Daher greifen eindimensionale, einfache Lösungsstrategien, die darauf abzielen, Gewalttäter, unabhängig von der Schwere ihrer Tat und der Häufigkeit ihres abweichenden Verhaltens, hart zu bestrafen und auszusondern, viel zu kurz. 4.5 Merkmale der Person und ihre Einflüsse auf Gewaltniveau und Gewaltbereitschaft Untersucht man empirische Studien danach, welche Merkmale des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin einen Zusammenhang zum Gewaltniveau aufweisen, so ergibt sich übereinstimmend, dass das Geschlecht die zentrale Rolle spielt. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede prägen sich bereits im Alter von 2-3 Jahren aus. In der Schule sind sie in der Phase der Pubertät am größten, während sie sich im Erwachsenenalter vermindern und im Seniorenalter kaum noch nachweisbar sind (vgl. Euler 1997, S. 193). 17 Schüler üben häufiger als Schülerinnen physische Gewalt aus. Je schwerer die Gewalttat, desto größer ist die Differenz zwischen den Geschlechtern. Körperverletzungen werden in 80%-90% aller Fälle von Jungen begangen. Dagegen bestehen hinsichtlich verbaler Formen der Gewalt kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Jungen sind Täter, aber auch weitaus häufiger als Mädchen Opfer. Trotz geringer Gewalterfahrungen haben Mädchen aber mehr Angst, Opfer von Gewalthandlungen zu werden (vgl. Schubart 2000, S. 89). Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinsichtlich gewalttätiger Handlungen sind in den letzten 15 Jahren größer geworden. Der generelle Anstieg der Jugendgewalt in den letzten 15 Jahren ist zu 85% auf die Jungen und nur zu 15% auf die Mädchen zurückzuführen (vgl. Lamnek 2000, S. 7). Jungen sind nicht nur gewalttätiger, sondern auch gewaltbereiter als Mädchen (vgl. Geider 2001). Differenziert man nach dem Alter, so erreicht das Gewaltniveau im Alter zwischen 13-16 Jahren seinen Höhepunkt und nimmt dann wieder ab. Ein Anteil von ca. 5% der Jugendlichen bleibt über die Phase der Pubertät hinaus gewalttätig. Diese gewalttätigen und kriminellen Erwachsenen fallen vergleichsweise häufig bereits im Grundschulalter durch entsprechendes Verhalten auf. Klassifiziert man nach den Erscheinungsformen der Gewalt, so lässt sich feststellen, dass Vandalismus in der Phase der Pubertät mit zunehmendem Alter eher zunimmt, körperliche Gewalt eher abnimmt. Dass die größte Gewaltbelastung in der Phase der Pubertät liegt, lässt sich u.a. mit entwicklungspsychologischen Problemen im Kontext der Identitätsentwicklung der Jugendlichen erklären. Vereinzelt wird aber auch auf ansteigende Gewalt unter den 9-12jährigen hingewiesen. Einige empirische Ergebnisse sprechen dafür, dass Kinder die vorübergehende ‘Probierphase’ früher erreichen, aber auch früher wieder verlassen (vgl. Lamnek 2000, S. 8). Immer wieder wird in den Medien der Eindruck erweckt, ausländische Jugendliche seien häufiger in Gewalthandlungen verstrickt als deutsche Jugendliche. Jugendstudien, die nicht auf den Bereich der Schule beschränkt sind, weisen zwar mehrheitlich einen entsprechenden Zusammenhang nach, dennoch gilt auch hier: Nicht die Tatsache, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin im Ausland geboren ist, macht ihn bzw. sie mehrheitlich zum Gewalttäter. Vielmehr zeigt sich, dass vor allem diejenigen Jugendlichen gefährdet sind, die nicht integriert und die sozialstrukturell benachteiligt sind (vgl. Lamnek 2000, S. 6ff.; Schubarth 2000, S. 93). Zudem ist zwischen den einzelnen Nationalitäten stärker zu differenzieren. Eine abweichende Position zum Entstehen von Aggression und Gewalt vertreten einige Psychologen. Sie nehmen an, dass Aggressivität und Gewaltaffinität genetisch bedingt sind bzw. vererbt werden oder sich evolutionstheoretisch erklären lassen. Euler (1997, S. 201) vertritt die Ansicht, dass Jungen und Männern eine 18 gewisse Affinität zu Gewalt und Aggression angeboren ist. Sie hat sich in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit als ein notwendiges Instrument erwiesen, um eigene Interessen im intersexuellen Wettbewerb gegen Rivalen durchzusetzen und eigene Nachkommen zu schützen. Genetischen Faktoren schreibt Euler einen bedeutenderen Einfluss auf die Ausbildung geschlechtsspezifischer Unterschiede zu. Daneben hält er einen wechselseitigen Zusammenhang zwischen genetischen Faktoren und der Selbstsozialisation im Umgang mit außerfamiliären Gleichaltrigen für wahrscheinlich, familiäre Sozialisation werde demgegenüber in ihrer Wirkung auf Kinder überschätzt (vgl. Euler 1997, S. 206). Asendorpf (2000, S. 17) berichtet von einer Längsschnittstudie, nach der die Aggressivität von Kindern durch die Aggressivität ihrer Eltern im Grundschulalter vorhergesagt werden kann. Mit anderen Worten: Wer als Kind durch massives aggressives und antisoziales Verhalten auffällt, hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch aggressive Kinder. Auch Asendorpf hält die Vererbung aggressiven Verhaltens zumindest zu einem gewissen Prozentsatz für wahrscheinlich. Asendorpf (2000, S. 15ff.) verweist auf mehrere Untersuchungen, wonach nicht der autoritäre elterliche Erziehungsstil die Aggressivität der Kinder fördert, sondern umgekehrt, die Aggressivität der Kinder zu einem autoritär elterlichen Erziehungsverhalten führt. Wodurch das aggressive Verhalten der Kinder bedingt ist, kann Asendorpf jedoch nicht erklären. Er hält genetische Ursachen für möglich, geht aber insgesamt von einer Wechselwirkung zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und Aggressionsverhalten des Kindes aus. Er zieht Langzeitstudien aus den USA, Neuseeland und England heran, die zeigen, dass ein großer Anteil asozialen und aggressiven Verhaltens pubertätsbedingt und vorübergehend ist und dass sich das aggressive Verhalten nur bei einem kleinen Teil der gewalttätigen Jugendlichen über die Pubertät hinaus chronifiziert. 4.6 Opfer und Täter Zwischen 50-70% aller Schüler sind weder Opfer noch Täter und somit an Gewalthandlungen unbeteiligt. Die übrigen Schülerinnen und Schüler lassen sich in vier Teilgruppen aufteilen: Ungefähr 5%-8% der Schülerinnen und Schüler sind Täter, ca. 30%-50% Episoden-Täter, d.h. sie treten seltener als die Täter gewalttätig in Erscheinung, 5%-10% sind Opfer und 3%-4% Täter/Opfer (vgl. Rostampour & Melzer 1997, S. 169ff.; Schubarth 2000, S. 79). Die Tätergruppe setzt sich vor allem aus Jungen zusammen. Die Täter haben eine hohe Aggressionsbereitschaft, betrachten Gewalt als normal, sind Mitglied einer gewalttätigen Clique und wachsen in einem belasteten Herkunftsmilieu auf, das sich durch kumulierende Risikofaktoren wie Scheidung, Alkoholmissbrauch, Arbeitslosigkeit, Elternkonflikte kennzeichnen lässt. Täter sind zwar in außerschulischen Cliquen, nicht aber in ihrer Klasse integriert. Gewalt reizt sie zum Nachahmen. Zum Gewaltpotenzial dieser Cliquen zählen Vandalismus, Beschimpfungen, Er- 19 pressungen, Telefonterror, ausländerfeindliche Sprüche und physische Gewalt. Die Mitglieder dieser Gruppe lassen sich überdies als antisozial bezeichnen, sie sind impulsiv und dominant, aber nicht ängstlich. Zu einem hohen Prozentsatz fallen diese Jugendlichen bereits im Kindesalter und in der Grundschule durch asoziales und verbal aggressives Verhalten sowie durch Probleme mit Funktionen der Handlungskontrolle auf. Die Täter bilden den ‘harten’ Kern des gewalttätigen Milieus. Das Verhalten des harten Kerns ist im Jugendalter bereits stark chronifiziert. Diese Gruppe macht ca. 5% der Bevölkerung aus (Asendorpf 2000, S. 16). Die Mitglieder der Opfergruppe bilden die Peripherie des gewalttätigen Milieus. Opfer werden regelmäßig gehänselt, geschlagen, bedroht und drangsaliert. Sie werden von ihren Eltern besonders restriktiv und autoritär erzogen und entstammen häufig einem überprotektiven Milieu. Opfer sind am wenigsten in Gruppen integriert, sie sind relativ häufig Außenseiter und haben von daher nur wenig Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Sie haben von allen Gruppen das geringste Selbstwertgefühl, bezeichnen sich selbst als ängstlich, unsicher, depressiv und zurückgezogen. Vermutlich tragen diese Persönlichkeitsmerkmale dazu bei, dass diese Kinder und Jugendlichen häufig als Opfer ausgewählt werden (vgl. Rostampour & Melzer 1997, S. 180f.; Lösel; Bliesener & Averbeck 1997, S. 152). 4.7 Gewaltintervention und -prävention in der Schule Die dargestellten empirischen Ergebnisse und die angeführten theoretischen Perspektiven zeigen bereits deutliche Anknüpfungspunkte für schulische Interventions- und Präventionsstrategien gegen Gewalt auf, verdeutlichen aber auch andererseits die Grenzen schulischer Maßnahmen. Aus sozialisationstheoretischer Perspektive kann Schule Erziehungsdefizite höchstens ansatzweise kompensieren, denn familiäre und außerfamiliäre Faktoren haben einen größeren Einfluss auf das Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen und begrenzen bzw. konterkarieren damit schulische Wirkungen. Wenn Schule etwas ausrichten will, muss sie sich daher verstärkt um Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen der Jugendhilfe bemühen. Hier ist bspw. an einen verstärkten Einsatz von Schulsozialarbeitern und Psychologen zu denken, die in Schulen Beratungs- und Trainingsangebote übernehmen könnten. Aber auch der Kontakt zu Jugendamt, Polizei, Beratungsstellen, Kirchen und Vereinen ist herzustellen und zu pflegen. Aus schultheoretischer Perspektive ist das Verhältnis zwischen Integration und Selektion zu überdenken und Prozesse der Persönlichkeitsbildung sind stärker zu berücksichtigen (vgl. Schubarth 2000, S. 116). Konsequenzen in diese Richtung lassen sich nicht mit Gieseckes Thesen vereinbaren. 20 Er setzt eher auf Selektion statt auf Integration und betont die gesellschaftliche Funktion der Schule statt ihrer Aufgabe im Bereich der Persönlichkeitsbildung. Aus der Perspektive der Schulentwicklung wird deutlich, dass schulische Gewaltprävention und -intervention möglich ist, nämlich dann, wenn sie in ein Rahmenkonzept von Schulentwicklung integriert wird. Merkmale, die eine gute Schule ausmachen, sind auch Merkmale einer Schule, an der es wenig Gewalt gibt (vgl. Aurin 1990; Tillmann 1999, S. 297ff.). Schulen mit einem besonderen pädagogischen Profil, in denen sich Schüler aufgehoben fühlen, in denen ein positives Schul- und Lernklima herrscht, sind Schulen, in denen sich Schülerinnen und Schüler weniger gewalttätig verhalten (Boenicke 2000, S. 141; Tillmann 1999; Schubart 2000, S. 106). Die Forschergruppe um Tillmann u.a. (1999, S. 302ff.) gelangt auf der Basis ihrer empirischen Ergebnisse zu einer Reihe von Empfehlungen im Hinblick auf Gewaltprävention, die sich insgesamt auch als ein Beitrag zur Verbesserung der Schulqualität begreifen lassen. Sie können hier nur kursorisch dargestellt werden: 1 Die primäre Prävention setzt vor dem Auftreten von Gewalt ein. Entsprechende Maßnahmen zielen auf eine Verbesserung der Lernkultur, des Sozialklimas und der Kommunikationsformen ab. Sie umfassen das Training sozialer und kommunikativer Kompetenzen, besonders für die Jungen, die Unterbindung verbaler Aggressionen, die Verwirklichung eines schülerorientierten und abwechslungsreichen Unterrichts sowie die Leistungsförderung der Schüler. Darüber hinaus sollte die Schule außerschulische Kooperationspartner für eine intensivere Jungenarbeit gewinnen. Aktivitäten wie Bodybuilding, Triathlon, Judo, Karate, Klettern oder andere sport- und erlebnispädagogische Angebote können den reflexiven Geschlechtsrollenerwerb unterstützen und stellen Möglichkeiten dar, Aggressionen ‚kultiviert‘ auszuleben. 2 Die sekundäre Prävention setzt ein, wenn sich bei Schülerinnen und Schülern erste Gewalttendenzen zeigen. Hier erscheinen Maßnahmen auf Klassenebene und auf Schulebene angebracht, z.B. die Schaffung eines gemeinsamen Grundwerte- und Normensystems auf Schulebene oder die Einrichtung eines Streitschlichterprogramms (vgl. Jeffereys-Duden 1999; Braun & Hünicke 1995). Darüber hinaus sind spezielle individuumsbezogene Maßnahmen notwendig. Täter sind zurechtzuweisen. Ihre Taten müssen Konsequenzen haben, wobei sich diese an den Taten und am Opfer bzw. an einer Wiedergutmachung und einem Ausgleich orientieren sollten. Opfer sollten integriert werden und so nach und nach ihre Außenseiterrolle verlieren. Gewalttätigkeiten sind sofort zu unterbinden und sollten öffentlich geächtet werden. Gewalttätern sollte klar werden, dass ihre Tätlichkeiten weder geduldet noch akzeptiert werden. 21 3 Die tertiäre Prävention setzt ein, wenn verfestigte Gewaltformen bei Jugendlichen auftreten. Hier sind Schule und Lehrerkollegium alleine überfordert. Polizei, Jugendamt und andere Kooperationspartner sollten eingebunden und Beratungsstellen kontaktiert werden. Verhaltenskorrekturen können auf dieser Ebene nur mit professioneller Unterstützung und mit dem Ziel, das Netzwerk des Jugendlichen neu zu strukturieren, erreicht werden. Während Maßnahmen der ersten Stufe darauf abzielen, auf der Ebene der Schule Gewaltphänomene gar nicht erst in dem Umfang entstehen zu lassen, geht es auf der individuumsorientierten zweiten Stufe bereits um gezielte Interventionen, bei der die Schule bzw. die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer noch einen wesentlichen aktiven Beitrag leisten können. Auf der dritten Stufe sind die direkten Einflussmöglichkeiten der Schule begrenzt. Hier muss es für die Schule vorrangig um den Schutz der anderen Schulmitglieder gehen. Einen guten Überblick über Maßnahmen der Gewaltprävention und – intervention enthält das Buch von Schubarth (2000). In der Praxis hat sich besonders das Konstanzer Trainingsmodell für Lehrer bewährt. Zwei oder mehrere Kollegen besuchen sich gegenseitig im Unterricht, dokumentieren Störungen und Konflikte, rekonstruieren Situationen, reflektieren gemeinsam die problematischen Situationen, analysieren die Reaktionen des Lehrers bzw. der Lehrerin, entwickeln neue Hand- lungsstrategien, spielen Alternativen durch, setzen diese um und überprüfen sie (vgl. Tennstädt u.a. 1991). Aktuell wird an vielen Schulen das Arizona-Modell durchgeführt (vgl. Göppel in diesem Heft). 5. Wozu ist die Schule da? Vergleicht man die Vorschläge zur Gewaltprävention und -intervention mit den Thesen und Lösungsvorschlägen von Giesecke, so zeigen sich nur an einzelnen Stellen Berührungen. Diese beziehen sich auf die Setzung klarer Grenzen, auf die Errichtung aggressionsfreier Kommunikationsräume und auf einen Mindestkonsens im Kollegium in Fragen der Erziehung. Im Grundtenor stehen sich die Lösungsansätze jedoch unversöhnlich gegenüber: Giesecke fordert in erster Linie Selektion. Die hier vertretenen Positionen warnen vor Ausgrenzung und setzen dagegen so weit wie möglich auf Integration. Giesecke fordert eine Unterrichtsschule, die sich an der Gesellschaft zu orientieren habe. Die hier dargestellten Positionen favorisieren eine umfassendere Lernkultur, die sich auch an den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert, ihre Probleme wahrnimmt und Leistung fordert, aber auch fördert. Giesecke fordert eine Abkehr bzw. eine starke Einschränkung von schülerorientierten Unterrichtsformen, die hier vorgestellten Konzepte verlangen genau das Gegenteil. Giesecke fordert eine Abgrenzung der Schule vom Leben außerhalb ihrer Mauern und eine ‘Entmachtung’ der Eltern. Die Konzeption 22 einer guten Schule, wie sie oben entwickelt wurde, beinhaltet dagegen eine Öffnung der Schule gegenüber dem Stadtteil. Giesecke stellt die gesellschaftliche Funktion in den Mittelpunkt, die oben formulierten Vorschläge setzen bei der Persönlichkeitsbildung der Schüler an. Giesecke fordert härtere Strafen; die hier vertretenen Positionen gehen davon aus, dass härtere Strafen bei den meisten Jugendlichen nur Gegendruck erzeugen und keine Verhaltensänderung bewirken. Das Lösungsmodell, das von Giesecke vertreten wird, ist eindimensional und einfach und wird damit der differenzierten und komplexen Problemlage nicht gerecht. Das Modell, das hier favorisiert wird, ist differenzierter. Es umfasst eine Doppelstrategie: Einerseits zielt es auf eine Optimierung von Schul- und Unterrichtsqualität einschließlich der Schaffung eines klaren Werte- und Normensystems, das verlässliche Strukturen und klare Grenzen umfasst und für Schüler Orientierungen ermöglicht. Andererseits umfasst es gezielte Präventionsmaßnahmen, die auf den empirischen Ergebnissen zur Opfer-/ Täterproblematik basieren. Literatur Asendorpf, J. (2000). Zwei Formen des antisozialen Verhaltens. In Lehren und Lernen 26 (12), S. 1523. Aurin, K. (Hrsg.). (1990). Gute Schulen - worauf beruht ihre Wirksamkeit? Bad Heilbrunn. Baumert, J., Lehmann, R. u.a. (1997). TIMSS - Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich. Opladen 1997. Boenicke R. (2000). Leistung und Qualitätssicherung. In Die Deutsche Schule 92 (2), S. 139-151. Braun, G. & W. Hünicke (1995). Schülerinnen und Schüler als ‘Streitschlichter’. In Praxis Schule 6 (5), S. 24-27. Brockmeyer, R. & W. Edelstein (Hrsg.). (1997). Selbstwirksame Schulen. Wege pädagogischer Innovation. Oberhausen. Euler, H. E. (1997). Geschlechtsspezifische Unterschiede und die nicht erzählte Geschichte in der Gewaltforschung. In Holtappels, H.-G. u.a., Forschung über Gewalt an Schulen. Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention. Weinheim, S. 191-206. Fauser, P. (Hrsg.). (1996). Wozu die Schule da ist. Sonderband der Zeitschrift ‘Neue Sammlung’. Seelze. Geider, F.J. (2001). Gewalt in der Schule. Unveröffentlichtes Manuskript. Pädagogische Hochschule Heidelberg. Giesecke, H. (1995). Wozu ist die Schule da? In Neue Sammlung 35 (1995) 3, S.93-104. Giesecke, H. (1996a). Wozu ist die Schule da? In Fauser, P. (Hrsg.), Wozu die Schule da ist. Seelze, S. 5-16. Giesecke, H. (1996b). Wozu ist die Schule da? Stuttgart. Greszik, B., Hering, F. & Euler H. A. (1995). Gewalt in den Schulen: Ergebnisse einer Befragung in Kassel. In Zeitschrift für Pädagogik 41 (2), S. 265-284. Grundmann, G. & Pfaff, N. (2000). Gewaltorientierungen bei Schülerinnen und Schülern. In Die Deutsche Schule 92 (3), S. 289-307. Hanewinkel, R., Niebel, G. & R. Ferstl. (1995). Zur Verbreitung von Gewalt und Aggression an Schulen - ein empirischer Überblick. In Valtin, R. & R. Portmann (Hrsg.), Gewalt und Aggression: Herausforderungen für die Schule. Frankfurt: Arbeitskreis Grundschule, S. 26-38. 23 Holtappels, H.-G. (1997). Sozialwissenschaftliche Theorien und Konzepte schulischer Gewaltforschung. In Holtappels, H.-G. u.a., Forschung über Gewalt an Schulen. Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention. Weinheim, S. 27-44. Hurrelmann, K. (1995). Gewalt - ein Symptom für fehlende soziale Kompetenz. In Valtin, R. & R. Portmann (Hrsg.), Gewalt und Aggression: Herausforderungen für die Grundschule. Arbeitskreis Grundschule, Band 95, S. 75-84. Hurrelmann, K. (1996). Gewalt ist ein Phänomen für fehlende soziale Kompetenz. In Hurrelmann, K.; Rixius, N. & H. Schirp, Gewalt in der Schule. Ursachen, Vorbeugung, Intervention. Weinheim, S. 11-26. Jeffereys-Duden, K. (1999). Das Streitschlichterprogramm. Mediatorenausbildung für Schülerinnen und Schüler der Klasse 3-6. Weinheim. Lamnek, S. (2000). „Gewalt macht Spaß...“? Die Mär von der entgrenzten Generation. In Lehren und Lernen 26 (12), S. 3-14. Lösel, F., Bliesener, T. & M. Averbeck (1997). Erlebens- und Verhaltensprobleme von Tätern und Opfern. In Holtappels, H.-G. u.a., Forschung über Gewalt an Schulen. Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention. Weinheim, S. 137-154. Meier, U. (1997). Gewalt im sozialökologischen Kontext der Schule. In Holtappels, H.-G. u.a., Forschung über Gewalt an Schulen. Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention. Weinheim, S. 225-242. Nolting, H.-P. (1997). Lernfall Aggression. Reinbek. Olweus, D. (1996). Gewalt in der Schule. Bern. Rauschenberger, H. (1995). Aus der Kinderstube der Gewalt - Pädagogische Überlegungen. In Valtin, R. & R. Portmann (Hrsg.), Gewalt und Aggression: Herausforderungen für die Grundschule. Arbeitskreis Grundschule, Band 95, S. 39-45. Rostampour, P. & W. Melzer (1997). Täter-Opfer-Typologien im schulischen Gewaltkontext. In Holtappels, H.-G. u.a., Forschung über Gewalt an Schulen. Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention. Weinheim, S. 169-189. Schubarth, W. (2000). Gewaltprävention in Schule und Jugendhilfe. Luchterhand. Schwarzer, R, & G. Schmitz. (2000). Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern. Längsschnittbefunde mit einem neuen Instrument. In Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 14 (1), S. 12-25. Sieland, B. (2001). Was ist am Lehrerberuf wirklich belastend? In Grundschule 33 (3), S. 36-39. Steffens, U. & T. Bargel (1993). Erkundungen zur Qualität von Schule. Neuwied. Struck, P. (1994). Erziehung gegen Gewalt. Neuwied. Tennstädt, K.-Ch. u.a. (1991). Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM). Neue Wege im Schulalltag. Ein Selbsthilfeprogramm für zeitgemäßes Unterrichten und Erziehen (Bd. 1). Bern. Terhart, E. u.a. (1994). Berufsbiographien von Lehrern und Lehrerinnen. Frankfurt. Tillmann, K.-J. (1995). Gewalt in der Schule - ein altes oder neues Thema? In Valtin, R. & Portmann, R. (Hrsg.), Gewalt und Aggression: Herausforderungen für die Schule. Frankfurt: Arbeitskreis Grundschule, S. 66-74. Tillmann, K.-J. (1997). Gewalt an Schulen: öffentliche Diskussion und erziehungswissenschaftliche Forschung. In Holtappels, H. G. u.a. (Hrsg.), Forschung über Gewalt an Schulen. Weinheim, S. 11-25. Tillmann, K.-J. u.a. (1999). Schülergewalt als Schulproblem. Weinheim. Valtin, R. (1995). Der Beitrag der Grundschule zur Entstehung und Verminderung von Gewalt Einleitende Überlegungen. In Valtin, R. & R. Portmann (Hrsg.), Gewalt und Aggression: Herausforderungen für die Grundschule. Arbeitskreis Grundschule, Band 95, S. 7-20. 24 Gewalt an Schulen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung Geider, F. J., Barth, A.-R., Jünger, W., Becker, M. & Klaus, A. 1. Beschreibung und Ziele des Projekts Ausgangspunkt des hier beschriebenen Projektes bildete eine Anfrage der Stadtverwaltung Östringen (Baden-Württemberg) an das Institut für Weiterbildung (IfW) der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Man war auf der Suche nach Personen und Institutionen, mit deren Hilfe man eine Reihe von Maßnahmen zur Verminderung von Gewalt an den örtlichen Schulen planen und durchführen wollte. Das IfW nahm sich dieser Anfrage an, suchte nach entsprechenden Kooperationspartnern und fand in fünf Mitgliedern des Faches Pädagogische Psychologie (s.o.) eine interessierte Gruppe für die maßnahmenbegleitende Evaluation eines solchen Vorhabens. Nach ersten Absprachen nahm diese Gruppe dann im Dezember 2000 ihre Arbeit auf. Das im folgenden dargestellte Projekt gliedert sich in zwei Phasen und verfolgt mehrere Ziele. Die erste Phase betrifft eine Bestandsaufnahme: die Erfassung zentraler Merkmale von Aggression und Gewalt im schulischen Umfeld, deren Verbreitung sowie Ausprägungen und Einstellungen der Betroffenen bezüglich dieser Merkmale. Als Betroffene wurden Schüler, deren Lehrer und die Eltern befragt. Als zweite Phase sollte auf dieser Grundlage eine breit angelegte Interventionskonzeption ausgearbeitet und durchgeführt werden. Am Ende dieser Phase ist dann eine zweite Erhebung geplant mit dem Ziel einer abschließenden Bewertung des gesamten Konzepts. Die hier vorgestellten Ergebnisse aus unserer Untersuchung betreffen somit die Bestandsaufnahme, die Intervention ist bisher noch nicht abgeschlossen. Das Besondere an dieser Studie ist, dass sie auf Initiative und im Auftrag dreier gemeinsam verwalteter Orte in Baden-Württemberg durchgeführt wurde. Die Orte zeichneten sich auf den ersten Blick nicht durch besondere Aggression und Gewalt an ihren Schulen aus. Gleichwohl wurde die Initiative ergriffen, um Informationen zu erhalten und präventiv Maßnahmen einzuleiten. Die Datenerhebung mittels Fragebogen an Schüler, Lehrkräfte und Eltern erfolgte im Februar 2001. Befragt wurden die 4., 5., 7. und 9. Klassenstufen sämtlicher Schularten, also Grund-, Haupt-, Realschule und Gymnasien (allerdings keine Sonderschulen) der drei Orte, insgesamt 1078 Schülerinnen und Schüler (561 Mädchen und 514 Jungen). Die Befragung der Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis 16 Jahren erfolgte im Rahmen des Unterrichts. Gleichzeitig beteiligten sich die 82 Lehrkräfte dieser Klassen an der Untersuchung (41 Lehrerinnen und 38 Lehrer). 25 Neben dieser nahezu flächendeckenden Erhebung (Ausfälle wegen Krankheit zum Untersuchungstermin und fehlende Werte bei einzelnen Fragen) wurden den Schülern für ihre Eltern Fragebogen nach Hause mitgegeben. Insgesamt beteiligten sich 889 Eltern (710 Mütter und 172 Väter) an der Untersuchung, das entspricht einer außerordentlich hohen Rücklaufquote von 82,5%. Wenn man dazu bedenkt, dass manche Eltern mehr als ein Kind in den befragten Klassen hatten, aber eventuell nur einen der Fragebogen beantworteten, kann von einer noch höheren Beteiligung ausgegangen werden. Mütter N=710 80,5% Väter N=172 19,5% E Elternfragebogen N=889 Rücklaufquote 82,5% GS HS RS GY N % 142 179 240 323 16,1 20,2 27,1 36,5 Mädchen N=561 52,2% Jungen N=514 47,8% S Schülerfragebogen N=1078 GS HS RS GY N % 167 215 291 402 15,5 20,0 27,1 37,4 Frauen N=41 51,9% Männer N=38 48,1% L Lehrerfragebogen N=82 GS HS RS GY N % 13 17 15 36 16,0 21,0 18,5 44,4 Abb. 1: Übersicht über den Rücklauf von Fragebogen zur vorliegenden Untersuchung Die drei eigens konzipierten Fragebögen für Schüler, Lehrkräfte und Eltern enthielten einige identische Fragen, so dass Vergleiche der jeweiligen Sichtweisen angestellt werden konnten, andere Fragen waren auf die jeweilige Personengruppe und deren Erfahrungshintergrund abgestimmt. Der Fragebogen an die Schüler enthielt neben den allgemeinen Angaben zu Geschlecht, Alter, Geschwistern, Noten, Klasse und Schulart insgesamt 11 (zum Teil etwas umfangreichere) Fragenkomplexe, die ausschließlich durch Ankreuzen beantwortet werden sollten. Die Schüler sollten allgemeine Aussagen zu aggressivem Verhalten abgeben und fiktive Gewaltszenen einschätzen, aber auch Angaben zu eigenem aggressivem Verhalten und zu eigenen Reaktionen auf aggressives Verhalten anderer Personen machen. Auch wurden mögliche Hemmungen, selber aggressives Verhalten zu zeigen, ermittelt und es wurde erfragt, wovor die Schüler Angst in der Schule haben. Schließlich wurden noch Informationen erhoben zu Orten der Gewalt (dies einheitlich bei allen 26 drei Personengruppen) und zur Fremdenfeindlichkeit bei deutschen Schülern. Die ausländischen Schüler wurden dagegen zur Einschätzung ihrer deutschen Mitschüler aufgefordert. Die Neuntklässler der Haupt- und Realschulen beantworteten noch einige zusätzliche Fragen zur Einschätzung ihrer beruflichen Zukunft. Der Fragebogen an die Lehrkräfte enthielt neben den allgemeinen Angaben insgesamt 12 Fragen. Die Lehrkräfte schätzten die Gewalt an ihrer Schule und die ihrer eigenen Schüler ein, machten Angaben zu den ihrer Meinung nach am häufigsten auftretenden Formen und Ursachen der Gewalt, gaben ihre Reaktionen auf Gewalt an und äußerten sich zur Zufriedenheit und der Stressbelastung hinsichtlich ihrer Arbeit. Schließlich wurden die Orte der Gewalt erfragt und es wurde gebeten, in freier Beantwortung Vorschläge zur Prävention von Gewalt abzugeben. Der Fragebogen an die Eltern stellte einen etwas kritischen Teil der Untersuchung dar, da die Eltern die Fragebogen auf dem Weg über ihre Kinder erhielten und eine einigermaßen vollständige Rückgabe der Fragebogen sehr unsicher schien. Neben einigen allgemeinen Angaben wurden deshalb auch nur sechs Fragen gestellt. Auch die Eltern schätzten die Gewalt an der Schule ihrer Kinder ein und es wurde ihre Sicht erhoben über das Ausmaß der Gewalt, das ihr Kind beobachtet, erfahren oder aber auch selbst ausgeübt hat. Angaben über Formen und Orte der Gewalt wurden analog zur Lehrerbefragung ermittelt. Schließlich sollten sich die Eltern noch in freier Beantwortung zu möglichen Ursachen der Gewalt äußern. Wie bereits erwähnt, erwiesen sich die Bedenken bezüglich des Rücklaufs dieser Fragebogen glücklicherweise als unzutreffend. 2. Die Ergebnisse der Untersuchung Nach dem Rücklauf der Fragebogen konnten ab Ende März 2001 die ersten Auswertungen der Daten vorgenommen werden. Im Mai fand die erste Präsentation der Ergebnisse vor einer Gruppe von Vertretern der betreffenden Stadtverwaltung, den örtlichen Schulleitern, der Elternvertretung sowie einigen engagierten Lehrerinnen und Lehrern statt. Im Juli folgte ein weiterer Vortrag vor interessierten Eltern und eingeladener Presse. Die Datenanalysen erbrachten, wie erhofft, eine Fülle von Informationen. In wissenschaftlicher Hinsicht können sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden, zumal ein wesentlicher Teil der Untersuchungsabsichten und des Untersuchungsplanes in einem evaluationsbezogenen Vorher-NachherVergleich von Ergebnissen besteht und die zweite Erfassungsphase (NachherErfassung) ja noch aussteht. Dennoch konnten die Ergebnisse der durchgeführten Ist-Analyse (Vorher-Erfassung) eine ganze Reihe von Aussagen und Hinweisen zu den vom Auftraggeber eingebrachten Fragestellungen bieten. Einige der Hauptaussagen, die aus der bisherigen Datenanalyse getroffen werden konnten, werden im Folgenden vorgestellt. 27 2.1 Ergebnisse der Schülerbefragung Die Schülerstichprobe umfasst die Klassenstufen 4, 5, 7 und 9; mit dieser Auswahl wird die Sekundarstufe I in angemessener Breite vertreten und ein direkter Vergleich sämtlicher weiterführender Schularten ermöglicht. Die Beschränkung auf Klassenstufe 4 als Repräsentant der Grundschule erfolgte nach der Auswertung von Vorstudien, die Verständnisprobleme bei der Fragebogenbearbeitung in Klassenstufe 3 offen legten. Die nachfolgende (Teil-)Auswertung bezieht sich auf zwei grundlegende Aspekte: Zum Einen auf die Epidemiologie von Aggression und Gewalt aus der Perspektive von "Täter" und "Opfer"; dabei wird nach verbalen, sachbezogenen und körperlichen Aggressionshandlungen unterschieden und es werden typische "Orte" aus dem Umfeld von Schule und Unterricht aufgezeigt. Zum Zweiten werden auf der Basis unterschiedlicher Skalen diverse aggressionsrelevante Einstellungen ermittelt. Ergänzend soll die Nutzung bestimmter Freizeitangebote in Zusammenhang gesetzt werden mit einer Gesamtskala der individuellen Aggressionsbereitschaft. 2.1.1 Epidemiologische Aspekte von Aggression und Gewalt In einem ersten Zugriff wurde erfasst, wie häufig bestimmte Formen aggressiven Verhaltens bei den Schülern vorkommen. Im Blickfeld standen dabei das Geschlecht und bestimmte Arten der Aggression. Die Befunde verdeutlichen, dass verbale Aggressionen weit verbreitete und gängige Verhaltensweisen darstellen. Dieses wird Jungen gegenüber deutlich häufiger angewandt als gegenüber Mädchen. Tab. 1: Häufigkeit eigener verbaler Aggressionen (Beschimpfen / Beleidigen) gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern im Zeitraum von zwei Wochen Nie 1 mal 2-3 mal Mehr als 3 mal gegenüber Mitschülern N % 410 39 301 28 209 20 141 13 gegenüber Mitschülerinnen N % 608 57 256 24 125 12 70 7 Einen interessanten Vergleich - und gleichsam eine Art Validierung der eigenen Angaben - stellen die Häufigkeiten aus der Sicht des Opfers aggressiver Handlungen dar. Die Antwort auf die Frage, wie oft man selbst im Vergleichszeitraum beschimpft oder beleidigt wurde, legt hier die Annahme einer gewissen "Dunkelziffer" zugunsten der eigenen Aggressionen nicht nahe, d.h. die Angaben in den Tab. 1 und 2 erscheinen relativ einheitlich und lassen bei dieser Aggressionsart auf ein hohes Maß an Ehrlichkeit schließen. 28 Tab. 2: Häufigkeit erlebter verbaler Aggressionen (Beschimpfen/Beleidigen) durch Mitschülerinnen und Mitschüler im Zeitraum von zwei Wochen Nie 1 mal 2-3 mal Mehr als 3 mal Mitschüler als Aggressoren N % 451 43 264 25 172 16 168 16 Mitschülerinnen als Aggressoren N % 661 63 191 18 119 12 76 7 Die nachfolgenden Tabellen 3 und 4 stellen die Häufigkeit des Auftretens sachbezogener Aggressionen aus der Perspektive von Täter (Tab. 3) und Opfer (Tab. 4) einander gegenüber. Hier wird einerseits dokumentiert, dass das Zerstören von Sachen mit einem Prozentanteil von ca. 3 % relativ selten vorkommt und dass Täter dabei keine geschlechtsspezifischen Unterschiede zu machen scheinen: Sachbezogene Aggressionen sind gegenüber Mitschülerinnen wie Mitschülern gleichermaßen selten. Auch hier kann die relativ hohe Übereinstimmung der Täter-OpferPerspektive als gelungene "Validierung" der Erfassungsmethode erachtet werden. Tab. 3: Häufigkeit eigener sachbezogener Aggressionen (Zerstören) gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern im Zeitraum von zwei Wochen Nie 1 mal 2-3 mal Mehr als 3 mal gegenüber Mitschülern N % 1018 96,5 24 2 9 1 4 0,5 gegenüber Mitschülerinnen N % 1023 97 16 1,5 8 1 4 0,5 Tab. 4: Häufigkeit erlebter sachbezogener Aggressionen (Zerstören) durch Mitschülerinnen und Mitschüler im Zeitraum von zwei Wochen Nie 1 mal 2-3 mal Mehr als 3 mal Mitschüler als Aggressoren N % 974 93 54 5 15 1,5 6 0,5 Mitschülerinnen als Aggressoren N % 1011 97 26 2,5 7 0,5 1 0 Der Blick auf die Häufigkeiten körperlicher Aggressionen (Verletzen) legt offen, dass dieses Mittel bei den Jungen häufiger Anwendung findet als die auf Sachen bezogene Form der Aggression. Es ist anzunehmen, dass es sich hier um eine recht spontane und stark emotionale Reaktionsform handelt, die deshalb bevorzugt wird, 29 weil sie einen unmittelbareren Spannungsabbau ermöglicht als das Beschädigen von Dingen. Tab. 5: Häufigkeit eigener körperlicher Aggressionen (Verletzen) gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern im Zeitraum von zwei Wochen Nie 1 mal 2-3 mal Mehr als 3 mal gegenüber Mitschülern N % 961 91 51 5 28 3 14 1 gegenüber Mitschülerinnen N % 1004 96 27 3 12 1 9 1 Tab. 6: Häufigkeit erlebter körperlicher Aggressionen (Verletzen) durch Mitschülerinnen und Mitschüler im Zeitraum von zwei Wochen Nie 1 mal 2-3 mal Mehr als 3 mal Mitschüler als Aggressoren N % 906 87 103 10 23 2 15 1 Mitschülerinnen als Aggressoren N % 1004 96 30 3 10 1 6 1 Ein zweiter epidemiologischer Aspekt bezieht sich auf die Frage, an welchen Orten überhaupt aggressive Handlungen stattfinden. Zu diesem Zweck wurden die Schüler aufgefordert, diejenigen Orte zu nennen, an denen sie einerseits selbst bedroht bzw. geschlagen wurden und andererseits gesehen haben, wie jemand anderes bedroht oder geschlagen wurde. Bei diesem Item gab es sowohl Vorgaben, die angekreuzt werden konnten, als auch die Möglichkeit der freien Angabe von Orten. 67,7 auf dem Pausenhof 47 Bus, Bahn, Haltestelle 46 im Klassenzimmer 43,8 wo man sich in der Freizeit aufhält 34,9 auf den Gängen in der Schule 33,2 beim Fußweg zur Schule 23,7 an sonstigen Orten 6,1 zu Hause in der Familie 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Abb. 2: Orte der Gewalt: Ausprägungen beobachteter Aggressionen (Bedrohen/ Schlagen) im Umfeld Schule (Angaben in Prozent) 30 21,1 im Klassenzimmer 20,1 auf dem Pausenhof 15,6 wo man sich in der Freizeit aufhält 13,3 beim Fußweg zur Schule 13,2 Bus, Bahn, Haltestelle 10,8 an sonstigen Orten 9,7 auf den Gängen in der Schule 8,1 zu Hause in der Familie 0 5 10 15 20 25 Abb. 3: Orte der Gewalt: Ausprägungen erfahrener Aggressionen (Bedrohen/ Schlagen) im Umfeld Schule (Angaben in Prozent) Die Befunde (siehe Abb. 2 und Abb. 3) verdeutlichen, dass ein hohes Maß an aggressiven Handlungen im unmittelbaren Bereich der Schule stattfindet. Klassenzimmer, Pausenhof und Schulgänge, die ja im Grunde unter der Kontrolle der Lehrenden stehen sollten, sind deutlich häufiger Orte aggressiver Auseinandersetzungen als die relativ unkontrollierten Bereiche Schulweg (Bus, Bahn, Fußweg) bzw. Freizeit. Hier darf die mangelnde Übereinstimmung der Angaben zwischen erfahrener und beobachteter Aggression nicht als Indikator für Unehrlichkeit gewertet werden, denn die meisten Auseinandersetzungen finden eben doch ungeniert in der Öffentlichkeit statt. Ein Pausenhof erlaubt letztlich mehr Beobachter als der Fußweg zur Schule oder gar die Familienumgebung zu Hause. Insofern sind die beiden Blickwinkel auch von grundsätzlich unterschiedlicher Qualität. Die Perspektive der eigenen Bedrohung erlaubt eine objektivere Quantifizierung von Aggressionshandlungen und stellt die epidemiologisch valideste Befundlage dar. Die Sicht der Beobachter rückt eher die Frage nach der Zahl der (indirekt) Beteiligten in den Mittelpunkt und repräsentiert damit die Menge an Möglichkeiten potentieller Imitation durch Beobachtungslernen. Die oben angesprochene offene Antwortmöglichkeit (‚an sonstigen Orten‘) ergab eine Vielfalt von Nennungen. Am häufigsten wurden Schüler nach eigenen Angaben an folgenden Orten bedroht oder geschlagen: Auf der Straße/in der Stadt (30,2%), auf dem Spielplatz (14,5%), auf dem Sportplatz (12%) und bei öffentlichen Veranstaltungen (12%). Wie reagieren nun Jugendliche typischerweise auf Angriffe wie Beschimpfungen oder Beleidigungen? Um die Bandbreite der Reaktionsformen zu ermitteln, wurden fünf Kategorien vorgegeben, die unterschiedliche Aggressionsgrade abbilden sollen. Dabei ist Kategorie 3 der Ankerpunkt, bei dem quasi auf analoger Ebene Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Daneben sind zwei intensivere Aggressionsfor- 31 men (sach- und körperbezogene Aggression), aber auch eine schwächere Form (mit Worten wehren) bzw. ein Aus-dem-Weggehen möglich. 40,6 aus dem Weg gehen 41,9 mit Worten wehren 10,7 mit gleicher Münze heimzahlen 1 etwas kaputt machen 5,8 schlagen oder treten 0 10 20 30 40 50 Abb. 4: Reaktionsmöglichkeiten auf Beschimpfungen/Beleidigungen (Angaben in Prozent) Nach diesen Befunden sollten Aggression und Gewalt unter Jugendlichen eigentlich kein brisantes Thema sein. Nur etwa 7% der Befragten lassen sich durch Beschimpfungen und Beleidigungen derart provozieren, dass sie zu graduell stärkeren Mitteln der Aggression greifen; die meisten (82,5%) wehren sich verbal oder gehen einem Streit aus dem Weg (siehe Abb. 4). Angesichts der vorangegangenen Befundlage stellt sich die Frage, ob es sich hier nicht eher um die theoretische Sicht der Dinge handelt (Handlungskompetenz), die stark von einer sozialen Erwünschtheit beeinflusst wird und sich von der (emotionaleren) Wirklichkeit oft deutlich unterscheidet. Urteile dieser Art sind primär kognitiv gesteuerte Produkte, die aus einer eher emotionsneutralen Position abgegeben werden. Im wirklichen Leben (Handlungsperformanz) sieht es dann oft ganz anders aus: Aggressive Handlungen sind eher die Folge hoher Erregung und reduzierter Selbstkontrolle. Ein Befund, der mit den vorangegangenen Ergebnissen übereinstimmt, ist die wiederum deutlich höhere Quote der körperlichen Aggressionen (5,8%) gegenüber der sachbezogenen (1,0%). 2.1.2 Einstellungen zu Aggression und Gewalt Die Erfassung von Einstellungen zur Aggression ist deshalb von Bedeutung, weil es sich um ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal zu handeln scheint, welches entscheidend das Ausmaß der Aggressionsbereitschaft und der ausgelebten Aggression mitbestimmt. Mit Hilfe einer 40 Aussagen umfassenden Liste mit vierstufigen Rating-Antworten von "stimmt voll und ganz" bis "stimmt überhaupt nicht" wurden mehrere Hauptaspekte der Einstellung zur Aggression (30 Items) sowie der Empathiebereitschaft und -fähigkeit (10 Items) ermittelt. Die Bildung von Skalen- 32 werten für einzelne "Dimensionen" der Aggression und der Empathie erfolgte auf der Basis von dimensionsanalytischen Ergebnissen aus vorausgegangenen Studien. Einen Überblick über Mittelwertsergebnisse zu diesen Faktoren bzw. Skalen gibt Tab. 7 wieder. Hier finden sich zusätzlich noch Skalenbildungen zu einer weiteren Liste von 14 Items, die ebenfalls mit dem Schülerfragebogen beurteilt wurden. Die Urteile zu diesen 14 Aussagen wurden allerdings nur über "stimmt" und "stimmt nicht"-Antworten erhoben. Um eine Vergleichbarkeit der Skalen herzustellen, wurden alle Skalen auf den Bereich von 0 bis 10 standardisiert und in ihrer Ausrichtung von 0 = minimale Ausprägung bis 10 = maximale Ausprägung gepolt. Tab. 7: Mittelwerte zu unterschiedlichen Skalen der Aggression, der Empathie und zu Hemmfaktoren der Aggression (Die einzelnen Skalen wurden jeweils auf die Skalenbreite von 0 (= minimal) bis 10 (= maximal) Skalenpunkte standardisiert, N ist jeweils maximal angegeben, geringe Ausfälle durch fehlende Werte bei einzelnen Items bzw. Skalen) Gesamt N=1056 Mädchen N=551 Jungen N=507 Agg. aus erhöhter Reizbarkeit heraus Agg. als Reaktion (Feindschaft) Agg. aus Mangel an Mitgefühl Agg. als Akzeptanz einer Veranlagung Agg. aus Streitlust Agg. als Triebabfuhr (Abreagieren) Agg. als Wettbewerbskomponente 5,58 5,04 4,64 4,78 4,18 3,77 6,49 5,46 4,66 4,11 4,34 4,02 3,51 6,24 5,70 5,46 5,23 5,26 4,34 4,05 6,77 Bereitschaft zur Empathie Fähigkeit zur Empathie 7,32 7,38 7,68 7,87 6,92 6,84 Soziale Beißhemmung Hemmung durch Vernunft Hemmung d. Angst vor Imageverlust Hemmung durch Angst vor Strafe 6,54 7,95 7,33 4,82 7,33 8,63 7,76 5,19 5,68 7,20 6,84 4,43 Aus Tabelle 7 sind in erster Linie Unterschiede ersichtlich, die sich auf die Ausprägung bestimmter aggressionsrelevanter Faktoren zwischen Mädchen und Jungen beziehen. Deutlich erkennbar ist, dass auf allen sieben angeführten Aggressionsskalen die Jungen die deutlich höheren Werte zeigen. Im Gegensatz dazu scheinen Mädchen wiederum eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Empathie aufzuweisen, ebenso höhere Werte im Bezug auf diverse andere Merkmale, die Hemmungsfaktoren bezüglich eines Auslebens empfundener Aggression widerspiegeln. 33 2.1.3 Freizeitgestaltung der Schüler Neben den Fragen zur Verbreitung aggressiver Handlungen und aggressionsrelevante Einstellungen wurde auch danach gefragt, ob und in welchem Umfang die Schüler bestimmte Freizeitangebote nutzen. In Tabelle 8 sind einige dieser Ergebnisse dargestellt. Als geschlechtstypischer Unterschied ist aus der Tabelle klar ersichtlich, dass die Jungen deutlich mehr Zeit vor einem Computer- oder Fernsehbildschirm verbringen als die Mädchen. Die Antworten auf die beiden anderen freizeitbezogenen Feststellungen zeigen dagegen keine nennenswerten Abweichungen zwischen den beiden Geschlechtern. Die Mitgliedschaft von insgesamt 70% der Befragten in einem Verein oder einer Jugendgruppe kann durchaus als hoch angesehen werden, ist jedoch hauptsächlich auf den Beitrag der Substichprobe der Gymnasiasten zurückzuführen. Die Hauptschüler bilden hier allem Anschein nach die mitgliedschaftsschwächste Gruppe, während sie mit 47,4% am wenigsten wissen, was sie in ihrer Freizeit machen sollen und mit 54,9% am häufigsten einen großen Teil ihre Freizeit vor einem Bildschirm sitzend verbringen. Setzt man jedoch gerade dieses Item in einen Bezug zum jeweiligen Aggressionspotential der Schüler (als eine Gesamtskala der Aggression, gebildet aus den sieben Einzelskalen der Aggression aus Tabelle 7), so zeigt sich mit einer Korrelation von r = 26 ein hochsignifikanter positiver Zusammenhang. Dieses Ergebnis muss wohl dahingehend interpretiert werden, dass ein ungünstiges Freizeitverhalten sicher einen großen Einfluss auf Aggression und Gewalt an der Schule haben dürfte. Tab. 8: Einige Aussagen von Schülern zu ihrer Freizeitgestaltung (Angaben in Prozent der JA-Antworten, GS=Grundschule, HS=Hauptschule, RS=Realschule, GY=Gymnasium) "Ich sitze meistens mehr "Ich bin Mitglied in als 3 Stunden vor einem einem Verein oder einer Bildschirm" Jugendgruppe mit Leiter(in)" Gesamt (N=1067) 39,3 % Gesamt (N=1070) 70,0 % "Ich weiß in meiner Freizeit meistens nicht, was ich machen soll" Mädchen (N=556) 30,6 % Mädchen (N=559) 69,6 % Jungen (N=508) 48,6 % Jungen (N=508) 70,9 % Mädchen (N=559) 31,8 % Jungen (N=504) 33,1 % GS (N=165) HS (N=213) RS (N=286) GY (N=400) GS (N=166) HS (N=213) RS (N=286) GY (N=398) 28,5 % 54,9 % 39,2 % 35,5 % GS (N=166) HS (N=213) RS (N=288) GY (N=400) 68,7 % 55,9 % 69,4 % 78,3 % Gesamt (N=1066) 32,5 % 44,0 % 47,4 % 29,7 % 21,6 % 34 2.2 Ergebnisse der Lehrerbefragung Bei den Lehrkräften handelt es sich überwiegend um sehr erfahrene Lehrkräfte, drei Viertel der Lehrkräfte weisen ein Dienstalter von 19 Jahren und darüber (nach der zweiten Lehramtsprüfung) auf, 12% der Lehrkräfte hatten ein Dienstalter zwischen 10 und 17 Jahren, und 13% hatten 1-6 Jahre Diensterfahrung nach der zweiten Lehramtsprüfung. Gymnasiallehrkräfte waren am stärksten vertreten (44%), Lehrkräfte an Hauptschulen zu 21%, Lehrkräfte an Realschulen zu 18% und Lehrkräfte an Grundschulen zu 16% (siehe auch Abb. 1). Tab. 9: Wie hoch sind Aggressivität und Gewalt Ihrer Schüler und wie sehr bereitet Ihnen die Aggressivität Ihrer Schüler Probleme? (81 Lehrkräfte) Gar nicht (1) Etwas (2) Ziemlich (3) Sehr (4) Höhe der Aggressivität 10,0% 76,5% 12,0% 1,0% Mittelwert: 2,05 Probleme dadurch 13,5% 65,5% 17,0% 4,0% Mittelwert: 2,11 Sowohl die Einschätzung der Aggressivität und Gewalt der eigenen Schüler als auch die Probleme der Lehrkräfte damit werden, wie aus Tab. 9 ersichtlich, im Durchschnitt relativ gering mit „etwas“ eingeschätzt. Die meisten Lehrkräfte schätzen das Ausmaß der Gewalt eher niedrig ein und haben damit auch geringe Probleme. Eine kleine Gruppe von Lehrkräften (13%) bemerkt allerdings ein erhebliches Ausmaß von Gewalt und Aggressivität ihrer Schüler und hat damit auch erhebliche Probleme (21%). Tab. 10: Verhaltensweisen der Lehrkräfte bei aggressiven und störenden Schülerhandlungen (365 Nennungen von 82 Lehrkräften) Lehrerverhaltensweisen Abbrechen, Stoppen Mahnen Regelsysteme vereinbaren Ermutigen, positive Ansätze fördern Kompromiss vorschlagen Bestrafen Integrieren Drohen Einfühlen Gespräche Beobachten, Ignorieren Mediation, Streitschlichtung Prozentangaben (Mehrfachnennungen) 78% 65% 59% 52% 52% 45% 29% 22% 13% 13% 6% 6% 35 In einigen der häufig genannten Verhaltensweisen (siehe Tab. 10) spiegelt sich der Widerwille und das Unvermögen vieler Lehrkräfte wider, mit aggressivem Verhalten ihrer Schüler umzugehen oder sich sogar einzumischen: Sie brechen es ab, stoppen es während ihrer Anwesenheit (78% der Nennungen), geben Ermahnungen (65%), bestrafen (45%) oder drohen (22%). Die Wirksamkeit ist bei einigen Maßnahmen und vor allem in besonderen Situationen sicher als umstritten anzusehen. Doch die Aufgaben der Lehrkräfte sind vielfältig, die Ausbildung in Bezug auf den Umgang mit aggressiven Schülerverhaltensweisen mangelhaft und diese Maßnahmen lassen, zumindest vordergründig, das unerwünschte Schülerverhalten sofort verschwinden. Vielversprechendere Maßnahmen, die mehr Zeit kosten und es erfordern, dass die Lehrkraft ihren Widerwillen überwindet, sich mit diesen Schülerverhaltensweisen zu befassen, sind das Vereinbaren von Regelsystemen (59% der Nennungen), das Ermutigen und Fördern positiver Ansätze (52%), das Vorschlagen von Kompromissen (52%), das Integrieren (29%) und Einfühlen (13%). Maßnahmen, die sehr viel Zeit und Engagement erfordern, die eventuell nur in besonderen Fällen eingesetzt werden und die auch eine gewisse Professionalität (Ausbildung) erfordern, sind die relativ seltenen Gespräche (13% der Nennungen) und die Mediation oder Streitschlichtung (6%). Insgesamt spiegeln die Antworten den Bedarf der Lehrkräfte an Fortbildung und Unterstützung wider, der auch in der Beantwortung der freien Frage nach Vorschlägen für Maßnahmen zur Verminderung von Aggressivität und Gewalt (Tab. 14) zum Ausdruck kommt. Tab. 11: Ursachen für aggressives Verhalten von Schülern (365 Nennungen von 82 Lehrkräften) Ursachen für aggressives Verhalten Spannungen mit anderen Schülern Schwierigkeiten mit Eltern Zu große Klassen Überforderung durch Leistungsdruck Mangelnde Zukunftsperspektive Spannungen mit Lehrern Bevormundung durch Lehrkräfte Unterrichtsinhalte ohne Alltagsbezug Medien, negative Vorbilder Schlechte Ausstattung der Schule zu wenig Bewegung Prozentangaben (Mehrfachnennungen) 82% 72% 63% 61% 30% 23% 12% 12% 11% 7% 6% 82% der Lehrkräfte (siehe Tab. 11) nennen Spannungen mit anderen Schülern als die häufigste Ursache für aggressives Schülerverhalten, das sich in der Tat hauptsächlich gegen andere Schüler (weniger gegen Sachen oder die Lehrkräfte selbst) richtet. Ein bemerkenswertes Ergebnis ist aber, dass Lehrkräfte der Meinung sind, 36 aggressives Verhalten liege erheblich in Schwierigkeiten mit den Eltern begründet: Diese Schwierigkeiten im Elternhaus wirken sich nun in aggressivem Verhalten, das sich in der Schule zeigt, aus! Eine ganz spezifische und häufig geäußerte Forderung der Lehrerschaft nach kleineren Klassen spiegelt sich in der Nennung wider, dass zu große Klassen die Ursache für aggressives Schülerverhalten seien. Sicherlich ist in kleinen Klassen die Auftretenswahrscheinlichkeit aggressiven Schülerverhaltens niedriger, der Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte geringer und die Zeit, die sie durchschnittlich jedem Schüler widmen können, größer. Dadurch haben Lehrkräfte größeren Einfluss und dies begründet auch die (politische) Forderung nach kleineren Klassen. Dass viele Schüler durch den Leistungsdruck (61% der Nennungen) überfordert werden, ist den Lehrkräften als Ursache für aggressives Verhalten ebenfalls bewusst, unmittelbar daran schließt sich die mangelnde Zukunftsperspektive der Schüler an (30%). Eine sehr kritische Haltung gegenüber dem eigenen Berufsstand geht aus den Ursachennennungen - Spannungen mit Lehrkräften (23%), Bevormundung durch Lehrkräfte (12%) und Unterrichtsinhalte ohne Alltagsbezug (12%) - hervor. Schließlich werden negative Vorbilder (in den Medien) (11%), schlechte Ausstattung der Schulen (7%) und zu wenig Bewegung (6%) genannt. 4 3,68 3,5 3 2,5 2,72 2,05 2 1,5 3,04 2,83 1,33 1,61 1,45 1,66 1,65 1 Öffentlichkeit Kollegium Vorgesetzte Wichtigkeit der Erwartungen Eltern Schüler Problematik der Erwartungen Abb. 5: Erwartungen an die Lehrkräfte: Wichtigkeit, den Erwartungen verschiedener Gruppen zu entsprechen und Problematik des Umgangs mit diesen Gruppen (Skala jeweils von 1 = unwichtig/unproblematisch bis 4 = wichtig/problematisch) Den Lehrkräften erscheint es am wichtigsten, den Erwartungen ihrer Schüler zu entsprechen, mit denen sie auch zeitlich am meisten zu tun haben. An zweiter Stelle kommen dann die Eltern, die den Lehrkräften erhebliche Schwierigkeiten bereiten können. Erst danach kommen bei den (weitgehend etablierten und erfahrenen) Lehrkräften die Vorgesetzen, dann das Kollegium. Lehrkräfte sind durch ihre Arbeitssituation „Einzelkämpfer“, Austausch und Teamarbeit sind nach wie vor relativ selten, deshalb kommen die Erwartungen der Kollegen an vorletzter Stelle. Die 37 Erwartungen der Öffentlichkeit sind den Lehrkräften am unwichtigsten, allerdings belastet das negative Image und die (allerdings in letzter Zeit nicht mehr ganz so provokativen) Schlagzeilen in der Presse die Lehrerschaft doch erheblich. Die Problematik im Umgang mit allen fünf Gruppen wird jedoch von den Lehrkräften als eher unproblematisch bis unproblematisch eingestuft. 2.3 Ergebnisse der Eltern-Befragung Insgesamt wurden 889 Eltern befragt. Davon nahm in 89,5% der Fälle die Mutter an der Befragung teil. Die Schularten, die die Kinder der befragten Eltern besuchten waren: Gymnasium (36,5%), Realschule (27,1%), Hauptschule (20,2%) und Grundschule (16,1%). Tab. 12: Berichtete Erfahrungen mit Aggression und Gewalt in der Schule Wie oft hat ihr Kind in den letzten Wochen berichtet, dass es ..... selbst aggressive und gewalttätige Handlungen beobachtet hat? (Prozentangaben) nie 1 mal 2-3 mal mehr als 3 mal 52,1 29,2 13,9 4,8 selbst in aggressive und gewalttätige Handlungen als Opfer verwickelt war? 80,9 13,7 4,1 1,4 selbst in aggressive und gewalttätige Handlungen als Täter verwickelt war? 93,6 5,0 1,2 0,2 Angst vor körperlicher Bedrohung hat? 80,3 14,5 3,2 0,0 2.0 Angst vor Erpressung durch Mitschüler hat? 91,3 6,6 1,5 0,0 0.7 Auf die Frage, wie häufig das Kind in den letzten zwei Wochen über bestimmte Erfahrungen im Zusammenhang mit Gewalt und Aggression in der Schule berichtet hat, zeigte sich, dass fast die Hälfte der Schüler über gewalttätige Handlungen berichtet haben, die sie beobachtet hatten. Eigene Verwicklungen der Kinder in solche Handlungen werden seltener berichtet. Immerhin 14,5% der Kinder berichteten im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen ihren Eltern mindestens 1 mal, dass sie Angst vor körperlicher Bedrohung hatten. 6,6% der Eltern erfuhren im gleichen Zeitraum 1mal, dass ihr Kind Angst vor Erpressungen durch Mitschüler hatte (siehe Tab. 12). 38 Als mögliche Gründe, die bei Kindern und Jugendlichen zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten führen können, nennen die Eltern auf eine offene Frage hin am häufigsten die Gewalt in den Medien, Reizüberflutung, Gewalt in der Familie und Erziehungsfehler. Auch ein falscher Freundeskreis, schlechte Vorbilder sowie Leistungsdruck, Stress und Arbeitslosigkeit werden häufig genannt (siehe Tab. 13). Tab. 13: Vermutungen der Eltern bzgl. möglicher Gründe, die zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten führen (Mehrfachnennungen möglich) Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 14 Prozentangaben Gewalt in Medien, Reizüberflutung Gewalt in der Familie, Erziehungsfehler Falscher Freundeskreis, schlechte Vorbilder, Gruppenzwang, keine Freunde Leistungsdruck, Stress, Arbeitslosigkeit Konsumgesellschaft, Neid, Markenkleidung Langeweile Fehlende Grenzen und Werte, Gesellschaftsproblem Unzufriedenheit, Alltagsprobleme, Minderwertigkeitskomplexe Konkurrenzdenken, Angeberei Bewegungsmangel Fehlende Anerkennung Kommunikationsprobleme Drogen, Alkohol Ausländerhass Schulinterne Probleme, falsches Lehrerverhalten Erpressung, Beleidigungen Sonstiges Gesamt 24,4 24,4 9,3 7,0 6,3 5,4 5,2 4,3 2,6 2,1 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 1,3 100,0% 2.4 Vergleichende Ergebnisse Interessante Aufschlüsse über unterschiedliche Ansichten zu denselben Themen zeigen sich, wenn man die beiden Befragtengruppen der Lehrkräfte und Eltern einander gegenüberstellt. Insgesamt zeigen sich bei diesem Vergleich etwa beide Personengruppen in mittlerem Ausmaß besorgt über die Aggressivität und Gewalt an den betreffenden Schulen. Die Eltern sind durchschnittlich sogar in einem etwas höherem Maße besorgt, fast ein Viertel der Eltern äußern sich sehr besorgt. Es verwundert, dass gerade von den Eltern, die ja die Gegebenheiten an der Schule ihrer Kinder nur "aus der Ferne" beurteilen können, noch mehr Besorgnis geäußert 39 wird als von den Lehrkräften, die ihr Urteil aus Beobachtungen ziehen, die sie "aus nächster Nähe" machen konnten (siehe Tab. 14). Tab. 14: Wie stark besorgt Sie die Aggressivität und Gewalt an Ihrer Schule (82 Lehrkräfte)/an der Schule Ihres Kindes (882 Eltern)? Ausprägung der Besorgnis Gar nicht (1) Etwas (2) Ziemlich (3) Sehr (4) Lehrkräfte Eltern 2,5% 52,5% 36,5% 8,5% Mittelwert: 2,51 8,0% 40,0% 29,5% 22,5% Mittelwert: 2,66 Die Eltern sind etwas pessimistischer als die Lehrkräfte über den möglichen Einfluss der Schule darauf, Aggressivität und Gewalt zu vermindern. Dies äußert sich v.a. in der Einschätzung von 12% der Eltern (keine Lehrkraft ist dieser Meinung), dass es der Schule gar nicht gelänge, dieses zu tun (siehe Tab. 15). Tab. 15: Wie gut gelingt es Ihrer Schule (81 Lehrkräfte)/der Schule Ihres Kindes (849 Eltern), Aggressivität und Gewalt zu vermindern? Verminderung der Gewalt durch die Schule Gar nicht (1) Etwas (2) Ziemlich (3) Sehr (4) Lehrkräfte Eltern 0 47,0% 49,0% 4,0% Mittelwert: 2,57 12,0% 41,5% 40,5% 6,0% Mittelwert: 2,42 An herausragender Stelle werden von Lehrkräften und Eltern übereinstimmend als Orte der Gewalt die Verkehrsmittel Bus oder Bahn oder deren Haltestellen genannt (siehe Tab. 16). Auch der Pausenhof ist ein kritischer Ort für Aggression und Gewalt unter Schülern, für Lehrkräfte, die unmittelbar mit dabei sind, allerdings etwas weniger als für Eltern. Ein weiterer kritischer Ort ist der Fußweg zur Schule. Die Gänge und das Klassenzimmer selbst werden von den direkt anwesenden Lehrkräften häufiger genannt als von den Eltern, den Freizeitbereich geben die Eltern aus ihrer Erfahrung häufiger an. In diesen Antworten spiegelt sich die Sichtweise und die Erfahrung der Betroffenen wider. Das Gleiche gilt, allerdings in umgekehrter Weise, für den Ort „Zu Hause“. Die Eltern, die hier unmittelbar zugegen sind, nennen diesen Ort nur vereinzelt, die Lehrkräfte vermuten hier eine deutlich höhere Aggression. 40 Tab. 16: Orte der Gewalt laut Lehrkräften und Eltern (Mehrfachnennungen) Orte der Gewalt Bus, Bahn, Haltestelle Pausenhof Fußweg zur Schule Gänge Klassenzimmer Freizeitbereich zu Hause in der Familie Lehrkräfte 84,4% 66,3% 43,2% 43,2% 42,0% 27,2% 26,3% Eltern 71,4% 76,4% 50,6% 36,3% 30,4% 40,5% 5,7% Da die Frage nach möglichen "Orten" von aggressivem Verhalten auch den Schülern gestellt wurde (Abb. 3), liegt die Frage nahe, ob Eltern und vor allem Lehrer eine realistische Sicht der Dinge haben und die Lage korrekt einschätzen. Beide Erwachsenengruppen sehen ja primär den Bereich Bahn/Bus/Haltestelle (ca. 80%) als viel gefährlicher an als die engere Schulumgebung Klassenzimmer/Pausenhof (ca. 40%). Schüler dagegen sehen das Klassenzimmer als häufigste Quelle von Aggressionen, den Schulweg dagegen als weitaus weniger belastet. Auf den ersten Blick scheinen sich diese Befunde zu widersprechen; allerdings muss berücksichtigt werden, dass rein zeitlich gesehen die Wahrscheinlichkeit für Auseinandersetzungen im Klassenzimmer weitaus höher liegt als beim Schulweg. Darüber hinaus sollten sich die beiden Angaben Fußweg und Bus/Bahn/Haltestelle additiv ergänzen, da Schüler in der Regel nur eine der beiden Schulweg-Möglichkeiten nutzen. Dann wiederum sind die Einschätzungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern wieder etwas stimmiger. Festzuhalten bleibt dennoch, dass die befragten Lehrer dazu neigen, die Gewalt im Klassenzimmer zu unterschätzen. Tab. 17: Formen von Aggression und Gewalt aus der Sicht von Lehrkräften und Eltern (Mehrfachnennungen) Formen der Gewalt Beschimpfungen, Beleidigungen Körperliche Auseinandersetzungen Beschädigung von Sachen Ablehnung, Ausgrenzung, Intrigen Aktive Störung des Unterrichts Drohen, Erpressen Verweigerung der Mitarbeit Diebstahl von Sachen Lehrkräfte 98,8% 74,4% 65,9% 61,0% 41,5% 24,4% 15,9% 14,6% Eltern 92,8% 66,2% 61,2% 51,2% 33,1% 40,7% 15,8% 40,8% Aus dem Vergleich der Ergebnisse von Tabelle 17 mit den Angaben der Schüler in Abbildung 4 (siehe Kapitel 2.1.1) wird ersichtlich, dass alle Beteiligten hinsichtlich der Verteilung der Aggressionsformen gut übereinstimmen: Verbale Aggressionen werden als häufigste Ausdrucksform in Auseinandersetzungen genannt, gefolgt 41 von körperlicher und sachbezogener Aggression. Gerade auch Eltern und Lehrkräfte stimmen, wie Tabelle 17 zeigt, in einem hohem Maße darin überein, wie häufig praktizierte Formen der Aggression und Gewalt bei Schülern aussehen. An erster Stelle stehen Beschimpfungen und Beleidigungen, dann kommen körperliche Auseinandersetzungen, dann die Beschädigung von Sachen, schließlich Ablehnungen, Ausgrenzungen und Intrigen unter Schülern. Bei Diebstahl von Sachen, ein Punkt, bei dem Eltern sich sicherlich stark involviert fühlen, weil es auch häufig ihr finanzieller Schaden ist, sowie in ähnlicher Weise auch bei Drohungen und Erpressungen unter Schülern, gehen die Einschätzungen von Lehrkräften und Eltern etwas auseinander. Die aktive Störung des Unterrichts und die Verweigerung der Mitarbeit wird dagegen bei den unmittelbar betroffenen Lehrkräften häufiger genannt. 3. Ausblick Auf der Basis der vorliegenden Daten, die im Forschungsbericht natürlich in vielschichtig differenzierter Weise ausgewertet sind, werden derzeit Interventionsmaßnahmen zur Verminderung von Aggression und Gewalt an den betreffenden Schulen durchgeführt. Diese Maßnahmen werden von einem Mediatorenteam geplant und gestaltet, das in allen beteiligten Gemeinden und in Zusammenarbeit mit Schülern, Lehrern, Eltern, Gemeindeverwaltung und Vereinen tätig sein soll. Alle Beteiligten finden sich in regelmäßigen Abständen zu einem Forum ("runder Tisch") zusammen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Ergebnisse dieser Bemühungen bereits in einigen Punkten sichtbar: Zum einen organisiert eine Elterninitiative die Aufsicht an Bushaltestellen, zum anderen wird etwa die Einbindung der Jugendlichen in Vereine intensiviert mit dem Ziel, aktive Vereinsarbeit zu leisten. Andere Aktivitäten sind in der Erprobung oder noch in der Diskussion. Nach Beendigung dieser Interventionsphase wird sich gegen Ende des Jahres 2002 eine umfangreiche Nacherhebung durch unsere Projektgruppe anschließen, welche die Wirkung der gewählten Interventionsmaßnahmen untersuchen soll und sie dann (hoffentlich) auch bestätigen kann. 42 „Arizona“ – ein Programm zur Förderung der „Eigenverantwortung“ oder ein Disziplinierungsinstrument? Betrachtungen aus der Perspektive der psychoanalytischen Pädagogik Rolf Göppel 1. Der Ausgangspunkt: Die Zunahme von Disziplinproblemen an den Schulen Die Klage über die Zunahme von Disziplinschwierigkeiten und Verhaltensstörungen an den Schulen ist vielfältig und in den Medien immer wieder Thema: vom „Tollhaus Schule“, vom „Horror-Job Lehrer“ und von den „kleinen Monstren“ war in Spiegel-Titeln der letzten Jahre die Rede. Natürlich kann man sagen, dass es sich dabei um medientypische Übertreibungen handelt, dass Klagen dieser Art so alt sind wie die Schule selbst und dass „Jammern“ in diesem Sinne eben einfach zum Geschäft gehört. Aber es gibt durchaus auch härtere Indizien, die darauf hindeuten, dass die Situation an den Schulen tatsächlich schwieriger geworden ist. Das Leiden der Lehrer an den bestehenden Verhältnissen dokumentiert sich vielleicht am deutlichsten in der Zunahme krankheitsbedingter Frühpensionierungen. Zwei größere Studien hierzu wurden in jüngster Zeit vorgestellt. Schaarschmidt kommt zu dem Ergebnis, dass es vor allem drei Bedingungen sind, die von Lehrerinnen und Lehrern als besonders belastend angegeben werden: Das Verhalten schwieriger Schüler, die Klassenstärke und die Anzahl der zu unterrichtenden Stunden (Schaarschmidt u.a. 1999). Der Arbeits- und Sozialmediziner Andreas Weber hat 7103 Gutachten zur Frage einer vorzeitigen Dienstunfähigkeit ausgewertet. Dabei war neben einer stetigen Zunahme der Dienstunfähigkeitsquote über die letzten Jahre hinweg vor allem die Tatsache auffällig, dass psychische und psychosomatische Erkrankungen mit 52% die mit Abstand häufigste Diagnose in den entsprechenden Gutachten darstellten. Diese Quote ist auch deutlich höher als bei anderen Sozialberufen (Weber u.a. 2001). Giesecke hat die dahinterstehende Problematik folgendermaßen zugespitzt beschrieben: „Das Problem vieler Lehrer in vielen Schulen ist nicht, dass sie des Unterrichts müde wären, sondern dass sie gar nicht mehr dazu kommen, in Ruhe und Gelassenheit ihren Unterricht zu erteilen, weil ihre Klassen zu sozialpädagogischen Problemgruppen geworden sind und die meiste Anstrengung darauf gerichtet werden muss, sie disziplinarisch im Zaum zu halten“ (Giesecke 1995, S. 94). In der Regel reichen einige wenige schwierige Schüler in einer Klasse aus, um jenes Ziel des ruhigen und gelassenen Unterrichtenkönnens nachhaltig in Frage zu stellen. Natürlich ergibt sich daraus nicht nur ein Problem für die Lehrer, sondern auch für den Rest der Klasse, sprich für die im Prinzip lernbereiten Schüler. In diesem Sinn heißt es bei Giesecke weiter: „Der eigentliche Skandal an vielen Schu- 43 len ist, dass eine kleine Minderheit von undisziplinierten Schülern die Mehrheit der lernwilligen Schüler terrorisieren darf und dafür dann nicht nur besondere Aufmerksamkeit der Lehrer erhält, sondern auch noch als prototypisch für die Probleme aller Schüler bzw. Jugendlichen ausgegeben wird“ (ebd., S. 96). Entsprechend fordert er, die Schule müsse wieder wirksamere Sanktionen gegen solche störenden Schüler verhängen können. Dieser Aufsatz Gieseckes hat bekanntlich ziemlichen Wirbel und Unmut ausgelöst, auf den ich aber hier nicht näher eingehen will. Ich teile auch nicht seine Auffassungen von Schule. Aber ich denke es besteht ein reales Problem, es gibt eine echte Not bei vielen Lehrerinnen und Lehrern. Viele von ihnen stellen sich heute die Frage, wie sie es wohl anstellen könnten, wieder mehr in Ruhe und Gelassenheit zu unterrichten. Es scheint so zu sein, dass der „Autoritätsvorrat“, den die Lehrkräfte früher gewissermaßen gratis, d.h. allein Kraft ihres Amtes, also qua Lehrerrolle zuerkannt bekamen, ziemlich geschmolzen ist. Gerade in Schulen in sozialen Brennpunkten müssen sich Kollegien heute zwangsläufig mit der Frage auseinandersetzen, wie sie gemeinsame Strategien entwickeln können, um die Disziplinprobleme „in den Griff zu bekommen“. Natürlich steht dabei implizit immer auch die Frage „Wohin mit den Störern ?“ (Gerspach 1998) zur Diskussion. Die Nachfrage nach brauchbaren Konzepten, die die Situation an den Schulen erträglicher machen können, ist also groß. Ich möchte im Folgenden ein solches Konzept und seine konkrete Realisierung an einer Schule zunächst vorund dann zur Diskussion stellen. Ich schicke dabei gleich voraus, dass meine eigene Position ambivalent ist, dass ich einige Aspekte daran durchaus interessant finde, dass ich andererseits aber auch erhebliche Zweifel habe, ob unter der Hand aus diesem Programm nicht doch ganz leicht etwas anderes wird als die schönen Beschreibungen versprechen. 2. Das EV-Konzept Das Konzept läuft hier auch unter dem Titel „Arizona-Programm“, weil es von seinem „Erfinder“, Edward E. Ford 1994 zunächst an einer Schule in Phoenix, Arizona eingeführt wurde. Es handelt sich also ähnlich wie bei Weidners „Anti-Aggressionstraining“ (vgl. Weidner 1996) um einen USA-Import. Wie andere amerikanische Konzepte zur Konfliktregulation (etwa das „Second Step® Programm, das dem deutschen Faustlos-Konzept zugrunde liegt, oder Gordons „Teacher Effectiveness Training, „TET®“) ist es mit einem eingetragenen Markenzeichen geschützt und wird entsprechend als „Responsible Thinking Process“, „RTP®“ promoted. Unter www.responsiblethinking.com kann die entsprechende Internetseite der „Responsible Thinking Incorporation“ aufgerufen werden. Gleich auf der Homepage kommt einem dabei eine Warnung entgegen, die den Exklusivitätsanspruch für die Rechte an dem Konzept unterstreicht: „Warning: Both in the U.S. and in other countries, there are some educators 44 teaching RTP, that are not accredited by RTP, Inc.“ Das Konzept wird derzeit offensichtlich (mit oder ohne offizieller Akkreditierung durch RTP?) von den Oberschulämtern in Baden Württemberg propagiert und den Schulen nachdrücklich zur Adaption empfohlen. Es hat inzwischen wohl auch schon eine beträchtliche Verbreitung erfahren. Stefan Balke, der das Konzept hierzulande bekannt gemacht hat, fasst die Grundintention des Ganzen folgendermaßen zusammen: „Das Programm zielt darauf ab, für Lehrer ein ungestörtes Unterrichten und für Schüler einen störungsfreien Unterricht zu ermöglichen. Als Voraussetzung dafür muss die Schule die Einhaltung vernünftiger sozialer Um-gangsregeln gewährleisten können“ (Balke 1998, S. 46). Dies hört sich recht verheißungsvoll an, verspricht es doch präzise die Lösung der eingangs beschriebenen Grundproblematik. Im Kern besteht das Konzept aus vier Bestandteilen: Den Klassenregeln, dem „Eigenverantwortungsraum“, aus der Idee der Verträge und Verhandlungen für die Rückkehr ins Klassenzimmer sowie aus einem Katalog gestufter Konsequenzen für die wiederholte Nichtbeachtung der Regeln. Hinzu kommen zwei Prinzipien, die die Haltung der beteiligten Personen bestimmen und die gleichzeitig ihrerseits durch das ganze Konzept bei den Schülern gefördert werden sollen: wechselseitiger Respekt und Verantwortlichkeit für das eigene Handeln. Die Grundregeln, die in der Klasse eingeführt werden sollen, sind sehr schlicht und prägnant. Ausdrücklich sollen sie auch nur vorgestellt bzw. bekannt gemacht, nicht aber zur Diskussion oder gar zur Disposition gestellt werden. Sie lauten: 1. Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 2. Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 3. Jede/r muss stets die Rechte der anderen respektieren. Stört ein Schüler durch sein Verhalten den Unterricht, so soll er zunächst an die Regeln erinnert und aufgefordert werden, zu entscheiden, ob er sich im weiteren Verlauf der Stunde an die Regeln halten will, oder aber ob er die Klasse verlassen und in den „Trainingsraum“ bzw. in den „EV-Raum“ gehen will. Weiteres Störverhalten wird dann als implizite Entscheidung gegen die Regeln und für das Verlassen des Klassenraumes gewertet. Auch diese „Entscheidung“ soll der Idee nach vom Lehrer akzeptiert werden. D.h. es geht gewissermaßen darum, den so häufigen, Nerven und Zeit raubenden „kommunikativen Kampf“, das eskalierende Wechselspiel von Stören, Ermahnen, Schimpfen, Provozieren, Drohen, Entwerten, Aufbrausen, Sich-Empören, Vorwürfe machen, Sich-Rechtfertigen, Beleidigt-Sein, etc. ... zu vermeiden, indem man sich möglichst respektvoll und sachlich quasi auf eine gemeinsame „Geschäftsordnung“ beruft und Verstöße gegen diese Geschäftsordnung eher formal und ohne große Aufregung „abhandelt“. In diesem Sinn heißt es bei Balke: „Der Lehrer hat nicht die 45 Aufgabe und nicht die Macht, einen störenden Schüler gegen dessen Willen zum Einhalten der Klassenregeln zu bewegen. Der Lehrer hat aber die Aufgabe, die Klasse vor den Störungen zu bewahren und den störenden Schüler vor die Entscheidung zu stellen, entweder im Sinne der Klassenregeln auf die Störung zu verzichten oder die Klasse zu verlassen und in den Trainingsraum zu gehen“ (ebd., S. 49). Im Regelfall besteht ja für den Lehrer immer eine Spannung zwischen dem Auftrag, mit der gesamten Klasse auf der „Inhaltsschiene“ den Unterrichtsstoff durchzunehmen und der Notwendigkeit, sich auf einer eher „erzieherischen Schiene“ mit einzelnen störenden Schülern auseinander zusetzen. Interventionen auf der zweiten Schiene unterbrechen natürlich immer den Fluss des Geschehens auf der ersten. Deshalb werden sie in diesem Konzept gewissermaßen „ausgelagert“, an einen anderen Ort, wo sie mit mehr Zeit, Ruhe und Sachlichkeit bearbeitet werden können. Im „Trainings- bzw. Eigenverantwortungsraum“, einem eigens dafür an der Schule eingerichteten Raum, soll über den ganzen Schulvormittag ein Pädagoge für klärende Gespräche zur Verfügung stehen. Wenn man so will also eine Art „Outsourcing“ des schulischen Konfliktmanagements. Ein Schüler, der von einem Lehrer wegen der wiederholten Verletzung der Regeln aus dem Klassenzimmer verwiesen wurde, erhält einen „Laufzettel“, auf dem die Art der Regelverletzung, die Zeit und die Unterschrift des Lehrers vermerkt sind. Mit diesem muss er sich dann beim „EV-Lehrer“ im „EV-Raum“ melden. Um in den Klassenraum zurückzukehren, ist es erforderlich, dass der Schüler einen „Plan“ erstellt, in dem er darlegt, wie er solche Störungen künftig vermeiden will. Dabei geht es jedoch nicht nur um vage Absichtserklärungen, sondern um möglichst konkrete, nachvollziehbare Handlungspläne. Dieser Plan soll dann zunächst mit dem Lehrer des Trainingsraumes besprochen werden, um schließlich auf der Basis dieses Plans mit dem Lehrer der Klasse über die Rückkehr ins Klassenzimmer zu verhandeln. Auch für diesen „Plan“ gibt es ein Formular, in dem der Schüler aufgefordert wird, zu verschiedenen Aspekten des Vorfalls, zu seinem grundsätzlichen Verhältnis zu dem betroffenen Lehrer und zu seinen Vorstellungen hinsichtlich seines künftigen Verhaltens in der Schule Stellung zu beziehen. Dabei ist freilich auch eine Sparte vorgesehen, in der der Schüler begründen kann, warum er der Meinung ist, dass er ungerecht behandelt wurde, weil er aus seiner Sicht gar keine Regelverletzung begangen hat. In jedem Fall wird dem Schüler eine relativ ausführliche und differenzierte Reflexion der Konfliktsituation und seines eigenen Verhaltens abverlangt. Prinzipiell haben die Schüler auch das Recht, aus eigenem Antrieb etwa wenn sie sich besonders angespannt, geladen, unruhig oder unkonzentriert fühlen, das Klassenzimmer zu verlassen und in den EV-Raum zu gehen, um dort für sich alleine zu arbeiten. Der EV-Lehrer steht der Idee nach auch jederzeit als Ge- 46 sprächspartner und Berater für Sorgen und Nöte der Schüler zur Verfügung. Auch Schlichtungsgespräche im Rahmen eines Streitschlichterprogramms können in diesem Raum stattfinden. Wenn Schüler trotz erstellter Pläne und gefasster Vorsätze wiederholt in den Trainingsraum kommen, dann sollen dort in Beratungsgesprächen die Ursachen für die Probleme analy1. Ein Schüler hält sich nicht an die Regel 2. Ein Schüler hält sich wieder nicht an die Regel siert werden und neue, bessere Vorschläge und Pläne erarbeitet werden. In der konkreten Schule, von der ich berichten will, ist das ursprüngliche Arizona-Konzept um einen abgestuften Katalog von „verschärfenden Maßnahmen“ ergänzt worden, die bei wiederholten „Zwangsbesuchen“ des EV-Raums in Kraft treten. Dieser Maßnahmenkatalog sieht so aus: 4. Ein Schüler kommt zum 4. Mal in den EV-Raum - 5. Ein Schüler kommt zum 5. Mal in den EV-Raum - 3. Ein Schüler kommt zum 3. Mal in den EV-Raum 6. Ein Schüler kommt zum 6. Mal in den EV-Raum - 7. Ein Schüler kommt zum 7. Mal in den EV-Raum - Ein Schüler der Schule, der den EVRaum schon mehrfach besucht hatte und mit dem ich über das Konzept gesprochen habe, konnte mir diesen komplexen Katalog haarklein in allen Details aufsagen. „Verschärfung“ heißt dabei vor allem, dass der Schüler sein störendes Verhalten und seine Änderungsvorsätze vor einem Laufzettel „Mein Plan“ Laufzettel „Mein zweiter Plan“ Beobachtungsbogen Laufzettel „Mein dritter Plan“ 1. Vertrag mit Lehrern Laufzettel 2. Vertrag mit Unterschrift der Eltern Sozialtraining Laufzettel Montag 7. Stunde vor das EVTeam Laufzettel Schulleiter-Eltern-Gespräch Androhung des zeitweiligen Unterrichtsausschlusses Unterrichtsausschluss zunehmend größeren Kreis von Personen erklären muss und dass die Eltern involviert werden. Auf Stufe fünf etwa muss ein Schüler am Montag in der 7. Stunde vor dem versammelten EV-Team, d.h. vor einer Gruppe von 10-12 Lehrern erscheinen und sich dort einem Gespräch über sein Verhalten stellen. 47 Die beteiligten Lehrer betonen jedoch ausdrücklich, dass die geschilderte Stufenleiter von verschärfenden Maßnahmen nicht zwangsläufig und unerbittlich Stufe für Stufe so durchgesetzt würde, sondern dass durchaus die Möglichkeit bestehe, sie im Einzelfall flexibler zu handhaben und individuelle Sondervereinbarungen zu treffen. Inzwischen werden manche Leser vielleicht dennoch schon ganz entsetzt sein, angesichts dieser doch zunächst sehr rigide und formalistisch und bürokratisch erscheinenden Weise des Umgangs mit störenden Schülern. Sie widerspricht nahezu in allem dem, was aus der psychoanalytisch-pädagogischen Tradition im Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen bekannt ist. Ich selbst habe einmal am Beispiel verschiedener Episoden von Aichhorn, Zulliger, Erikson und Redl unterschiedliche Strategien zum Umgang mit aggressiv aufgeladenen Konflikten unter den Stichworten „Ignorieren“, „Ritualisieren“, „Informieren“ und „Rekonstruieren“ dargestellt und bin dabei, auf der Suche nach den übergreifenden Gemeinsamkeiten, etwas scherzhaft auf die Formel gekommen, dass das Gemeinsame dieser Beispiele aus der Tradition der psychoanalytischen Pädagogik vor allem darin bestünde, dass die entsprechenden Interventionen a) unkonventionell und b) erfolgreich gewesen seien. In der Regel sind es gerade die genialen, spontanen, intuitiven Einfälle und die unerwarteten Reaktionen der Pioniere psychoanalytischer Pädagogik, die überraschende Wendungen zustande brach- ten und zum Erfolg führten (vgl. Göppel 1998/99). Hier, in diesem neuen Konzept, ist nun nichts von Originalität und Kreativität im Umgang mit Konflikten (Zulliger) und oder von „absoluter Milde und Güte“ (Aichhorn) zu erkennen. Auch nichts vom Versuch, die unbewussten individuellen lebensgeschichtlich geprägten Motive provokativen, störenden Schülerverhalten zu entschlüsseln oder sie als Übertragungsphänomene zu analysieren (Erikson, Redl), sondern hier wird den Schülern sehr klar und bestimmt dargestellt, welche Regeln im Kontext des Unterrichts gelten, welches Verhalten erwartet wird und welche Konsequenzen das Nichteinhalten dieser Regeln nach sich zieht. Von daher könnte man dieses Konzept, zumal, da es sich, wie gesagt um einen USA-Import handelt, leicht mit Begriffen wie „Law-and-Order“, „Nulltoleranz“, „neue Harte Linie“, „rigides Durchgreifen“ etc. assoziieren. Dagegen hat es sich selbst ausdrücklich die Schlüsselbegriffe „Respekt“ und „Eigenverantwortung“ auf die Fahnen geschrieben. Ist dies bloßer Etikettenschwindel? Oder noch schlimmer: Handelt es sich gar um ein malignes unbewusstes Bündnis der Pädagogen mit der Institu-tion? Von Seiten der Psychoanalytischen Pädagogik ist in jüngster Zeit am deutlichsten wohl Bernd Ahrbeck der modernen Tendenz entgegengetreten, Erziehung einseitig als Bedürfnisbefriedigung und Selbstwertförderung aufzufassen. Erziehung in unserer Gesellschaft sei, so formuliert er überspitzt, „weitgehend zur narzisstischen Wachstumsförderung gewor- 48 den, ... Grenzsetzungen und Einschränkungen kindlicher Wünsche gelten deshalb als gefährlich und werden häufig vermieden“ (Ahrbeck 1998, S. 129). Er schreibt diese Tendenz überwiegend den Einflüssen der Humanistischen Psychologie (Rogers, Maslow) und ihrem Credo der Selbstverwirklichung zu. Dies verkennt freilich, dass die (popularisierten) psychoanalytischen Erziehungslehren wohl mindestens ebenso großen Anteil hieran hatten. 3. Evaluation: Das Konzept im Urteil von Schülern und Lehrern Doch vor einer solchen kritischen Diskussion möchte ich zunächst darstellen, wie diese „Neuerung“ von den Lehrerinnen und Lehrern sowie von den Schülerinnen und Schülern einer Hauptschule in Mannheim, an der das Konzept vor zwei Schuljahren eingeführt wurde, bewertet wird. Ich beziehe mich dabei auf die Ergebnisse einer Evaluationsstudie die von Kathrin Weigel im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit durchgeführt wurde. Sie hat in dieser Arbeit jedoch nicht nur eine Befragung bezüglich der Akzeptanz und der Effekte des „EV-Projekts“ durchgeführt, sondern sie hat den ganzen Schulentwicklungsprozess, der an dieser Schule stattgefunden hat, differenziert dargestellt und zudem selbst an dieser Schule für eine Gruppe häufiger „EV-Raum-Kandidaten“ ein „Sozialtraining“ angeboten (vgl. Weigel 2001). Ich möchte zugleich betonen, dass ich grundsätzlich großen Respekt vor der Arbeit der Gruppe engagierter Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule habe, die aus einer von allen als sehr belastend erlebten Krisensituation heraus versucht haben, neue Konzepte und Strukturen für einen verträglicheren Umgang und für einen erträglicheren Alltag an ihrer Schule zu entwickeln. In persönlichen Gesprächen konnte ich mich davon überzeugen, dass es sich bei Ihnen durchaus um einfühlsame und besonnene Pädagogen und keineswegs um „disziplinversessene Hardliner“ handelt. Von den im Rahmen dieser Evaluationsstudie an alle 297 Schüler der Schule ausgegebenen Fragebögen wurden 262 ausgefüllt zurückgegeben. In den Fragebögen wurden die Schüler auf einer fünfstufigen Einschätzskala u.a. um Stellungnahmen zu folgenden Statements gebeten: - Ich finde, wenn ein Schüler oder eine Schülerin während der Stunde in den EV-Raum geschickt wird, dann wird es anschließend ruhiger in der Klasse. - Ich habe den Eindruck, dass ich mich besser auf den Unterricht konzentrieren kann, seit es den EVRaum gibt. - Ich fühle mich besser, wenn ich im EV-Raum war. - Ich finde der Lehrer im EV-Raum ist ein guter Gesprächspartner. - Ich habe das Gefühl, dass mir im EV-Raum geholfen wird. - Ich glaube, dass die Gespräche mit dem Lehrer im EV-Raum mir helfen. Daneben gab es auch noch zwei offene Fragen, bei denen die Schüler einfach zur Ergänzungen der Sätze „Ich finde den EV-Raum gut, weil...“ bzw. „Ich finde den EV-Raum nicht 49 gut, weil....“ aufgefordert waren. Das Ergebnis der Schülerbefragung lässt sich in seinen Grundtendenzen folgendermaßen zusammenfassen: - Die Schüler sind überwiegend der Meinung, dass das Konzept gewisse Effekte im beabsichtigten Sinne der Beruhigung der Klassensituation und der Förderung einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre hat. - Obwohl der Lehrer im EV-Raum von den allermeisten Schülern durchaus als guter Gesprächspartner anerkannt wird, erleben die betroffenen Schüler den Aufenthalt im EV-Raum doch ganz überwiegend als unangenehme Angelegenheit. Vermutlich eben doch als Strafe oder als schambesetzte Ausgrenzungsmaßname. Dieses Unbehagen nimmt in den höheren Jahrgangsstufen auch kontinuierlich zu. - Entsprechend haben fast nur die Schüler der Unterstufe das Gefühl, dass ihnen im EV-Raum geholfen wird bzw. dass ihnen die Gespräche dort nützlich sind, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen. - Obwohl nur eine Minderheit angab, den EV-Raum bisweilen auch freiwillig aus eigenem Antrieb, aufzusuchen, fand es doch die überwiegende Mehrheit der Schüler sehr gut, dass sie prinzipiell das Recht haben, dies zu tun. - Nach den eigenen Angaben nehmen die meisten Schüler die Vorsätze in ihren Plänen und Verträgen durchaus ernst, d.h. sie geben an, dass sie sich meistens bemühen, ihre Pläne und Verträge einzuhalten. Etwa ein Drittel der Schüler gibt dabei zu, dass ihnen dies eher schwer fällt. Allerdings ist auch hier wieder ein deutlicher Alterstrend feststellbar, und zwar in dem Sinn, dass die Ernsthaftigkeit dieses Bemühens mit wachsendem Alter nachlässt. Immerhin ein Viertel bis ein Drittel der 8.- und 9.Klässler gibt an, dass sie sich selten oder nie darum bemühen, ihre Pläne und Verträge einzuhalten. Die Hoffnung der Lehrer richtet sich freilich darauf, dass dieser Alterstrend nachlässt, wenn erst einmal die ersten Jahrgänge, die seit der fünften Klasse an das Programm gewöhnt sind, die gewissermaßen mit ihm „aufgewachsen“ sind, die Abschlussklasse erreichen. - Insgesamt also eine relativ große Akzeptanz des Konzepts in der Unterstufe und eine deutlich größere Reserviertheit in der 8./9. Klasse. Dies entspricht dem generellen Trend einer zunehmenden Distanzierung der Schüler von den Ansprüchen und Forderungen der Schule im Verlauf der Pubertätsentwicklung (vgl. Ziehe 1997, Fend 2000, Bittner 2002). Von den 27 an die Lehrer der Schule ausgegebenen Fragebögen wurden nur 17 zurückgegeben. Hier ging es um die Beteiligung der Lehrkräfte an dem Programm und um die subjektive Einschätzung der damit gemachten Erfahrungen. Dabei fallen die Ergebnisse relativ günstig aus, d.h. die befragten Lehrer berichten überwiegend von einem Beruhigungseffekt und von einer Entspannung der Unterrichtssituation seit der Einführung des Konzepts. Aber sie schätzen auch die Wirkungen auf die Pro- 50 blemschüler durchaus positiv ein. Eine Lehrerin hat im direkten Gespräch mit mir ihre Sicht der Veränderung auf die prägnante Formel gebracht: „Seit wir das Programm haben, musste ich nie mehr ins Klassenbuch eintragen „Unterricht war heute nicht möglich“. Soweit in knapper Zusammenfassung die Grundideen und -bestandteile des Konzepts sowie die Einschätzungen durch die betroffenen Schüler und Lehrer. 4. Diskussion Was soll man nun als Erziehungswissenschaftler von dem Ganzen halten? Natürlich könnte man sagen, dass dieses doch sehr formalistische Programm mit Laufzetteln, Verträgen, Maßnahmenkatalogen, Schülerakten etc. Ausdruck einer pädagogischen Verlegenheit sei. Was in der alltäglichen persönlichen Verständigung und Auseinandersetzung nicht mehr klappt - die Einhaltung bestimmter Regeln, die Einigung auf sozialverträgliche Weisen des MiteinanderUmgehens - soll nun durch bürokratische Prozeduren und detaillierter Sanktionskataloge geregelt werden. Die Lehrer müssten eben einfach ihren Unterricht so spannend und attraktiv gestalten, dass die Schüler so motiviert und fasziniert sind, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, den Unterricht zu stören oder aber die Lehrer müssten einfach einen so vertrauensvollen individuellen „pädagogischen Bezug“ zu ihren Schülern aufbauen, dass diese sich schon aus Respekt und Zuneigung zu ihnen Störungen und Provokationen verkneifen. - Aber wie realistisch sind solche Forderungen und wem wäre damit gedient? Was macht dieses Konzept andererseits mit den betroffenen Lehrerinnen und Lehrern? Welche neue, besondere Note bekommt die Institution Schule durch dieses Programm? Welche unbewussten Tendenzen, Hoffnungen, Abwehrprozesse sind damit eventuell verknüpft? Mit Fürstenaus berühmtem Aufsatz „Zur Psychoanalyse der Schule als Institution“ könnte man von „Entpersönlichung“ sprechen. Die Schüler werden einem rigiden und abstrakten Ritual der Verhaltenssteuerung unterworfen um organisationskonformes Verhalten zu erzwingen. Insbesondere hat Fürstenau auf den Abwehrcharakter von Ritualen hingewiesen und seine diesbezügliche Warnung ist gewiss nicht einfach von der Hand zu weisen: „Alle Rituale und Zeremonien haben einen Spielraum von Strenge und Genauigkeit ihrer Ausführung. Dies Variable kann leicht für die Befriedigung von Macht- und Herrschaftsbedürfnissen manipuliert werden“ (Fürstenau 1964, S. 74). Fürstenau sympathisiert implizit mit den Widerstandsbestrebungen der Schüler (und fand wohl auch deshalb Ende der Sechziger Jahre so große Resonanz): „Wo Kinder sich einer völlig vorgegebenen – noch dazu widersprüchlichen Ordnung im wesentlichen nur einzufügen haben, entsteht als einzig möglicher Ausdruck ihres Freiheits- und Selbständigkeitsstrebens und ihrer Initiative ‚Disziplinschwierigkeiten‘ (ebd., S. 77). Sein Aufsatz endet mit den Sätzen: „Unsere Schule teilt abwehrende (apotropäische) und austrei- 51 bende (exorzistische) magische Züge mit ältesten Erziehungsritualen. Sie ist in mancher Hinsicht ein Stück archaischer Menschenbehandlung“ (ebd., S. 78). Im Hinblick auf das vorgestellte Konzept müsste man dann wohl eher von moderner, technokratisch-fortschrittlicher Menschenbehandlung sprechen. Von daher könnte man das EV-Programm auch als einen besonders perfiden pädagogischen Trick ansehen, den Schülern auch noch den „einzig möglichen Ausdruck ihres Freiheits- und Selbständigkeitsstrebens und ihrer Initiative“ zu rauben. Es fragt sich jedoch, ob eine solche psychoanalytische Fundamentalkritik dem ernsthaften Bemühen der Lehrer und Lehrerinnen gerecht wird, an ihrer Schule das Recht auf ungestörtes Lernen für die Schüler und auf ungestörtes Unterrichten für die Lehrer zu verteidigen. Dann wäre in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage zu diskutieren, ob die in den Grundregeln formulierten „Rechte“ überhaupt Bestand haben. Gibt es daneben vielleicht auch so etwas wie ein „Recht des Schülers auf Eigensinn“ (vgl. Voß 1989), auf Widerstand gegenüber den schulischen Zumutungen, auf Subversion der ihm aufgezwungenen institutionellen Ordnung? Muss man realistischerweise von einem antagonistischen Verhältnis der Schüler zur Schule, von einem „natürlichen Dissidententum“, einem „Differenzverhältnis“ (Ziehe 1997) ausgehen? In Fürstenaus Kritik geht es ja insbesondere auch um die irrationalen, aus den Kindheitserfahrungen der Pädagogen herrührenden Macht- und Be- herrschungsmotive. Man kann dem EV-Konzept immerhin zugute halten, dass die Verhältnisse, die geltenden Regeln, die zu erwartenden Konsequenzen hier recht klar und transparent sind. Durch die ausdrückliche Betonung der Prinzipien des Respekts und der Eigenverantwortung sind die Schüler, zumindest der Idee nach, vor den Stimmungen und Zornesausbrüchen, den situativen Genervtheiten und überschießenden Reaktionen der Lehrkräfte geschützt. Gleichzeitig wird versucht, die „heiße Konflikteskalation“, bei der meist eher die irrationalen Impulse die Oberhand gewinnen, zu vermeiden und zu einer möglichst sachlichen und nüchternen Klärung zu gelangen. Weiterhin können die Schüler aus dem Feld gehen und sie treffen im EV-Raum auf einen empathischwohlwollenden, in Gesprächsführung speziell fortgebildeten Gesprächspartner, der nicht direkt in den Konflikt verwickelt ist und mit Zeit und Ruhe zur Verfügung steht. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass durch dieses Konzept, vor allem durch die Institution des EV-Raumes, die Grundrelation der Schüler im Verhältnis zur Schule ein Stück weit verändert wird. Denn, wenn die Schüler prinzipiell die Option haben, statt am Unterricht teilzunehmen in den EV-Raum zu gehen, dann wird ein zentrales Bestimmungsstück von Schule, nämlich die Präsenzpflicht im Unterricht, relativiert. Der Unterricht ist nun nicht mehr einfach eine Zwangsveranstaltung, der man beiwohnen muss, ob man will oder nicht, sondern man hat im Prinzip eine Alternative dazu. Gleichzeitig 52 ist der Sinn und Zweck der Veranstaltung Unterricht durch die Grundregeln für alle noch einmal sehr klar ins Bewusstsein gebracht. Es geht um das gemeinsame Lernen. Dafür sind gewisse Verhaltensstandards notwendig. Wer diesen Zweck boykottieren oder torpedieren will, wer meint, dass Clownerie oder Provokation unterhaltsamer seien, der verliert gewissermaßen seinen Anspruch auf Teilhabe am Geschehen und muss erst durch entsprechende Reflexionen und Vorsätze unter Beweis stellen, dass er wieder bereit ist, den Zweck der Veranstaltung anzuerkennen. Unterricht wird also in gewisser Hinsicht von der drögen Zumutung zum erstrebenswerten Gut. Von daher kommt es ein ganzes Stück weit dem nahe, was Oevermann einmal „zur Lösung aller schulischen Disziplinprobleme“ gefordert hat: die Abschaffung der Schulpflicht. In seiner „Theoretischen Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns“ heißt es dazu: „Würde die gesetzliche Schulpflicht entfallen, dann hätte sich schlagartig die Strukturlogik des pädagogischen Handelns geändert. Dann gäbe es keine prinzipielle Disziplinierungsproblematik mehr, dann entfiele das ‚Dompteurs‘-Syndrom, dann gäbe es keine pädagogischen ‚Zampanos‘ mehr in den Lehrerzimmern in punkto Geschicklichkeit in der Bewältigung der Disziplinierungsproblematik .... Dann würde der Schüler sich auf der Basis von Vertrauen, Wohlwollen und Sachangemessenheit an den Lehrer als einen sokratischen Partner wenden, statt sinnlos Energien in eine strukturlo- gisch falsch gelagerte Widerständigkeit zu ‚investieren‘“ (Oevermann 1996, S. 168). Dies ist wohl allzu optimistisch gedacht, aber im Prinzip ist schon etwas dran. Kursleiter an Volkshochschulen oder Professoren an der Universität klagen in der Regel nicht über Disziplinprobleme. Wenn man aus eigenem Antrieb und Interesse in einem Kurs oder Seminar sitzt, dann macht es wenig Sinn, das Ganze mit Störmanövern zu hintertreiben. Für Oevermann stellt das „Arbeitsbündnis“ gewissermaßen als Kern professionalisierter Tätigkeit dar und entsprechend fordert er in Analogie zum psychoanalytischen Arbeitsbündnis auch ein „pädagogisches Arbeitsbündnis“ als den Kern der Professionalisierung des Lehrerberufs (ebd., S. 163). Auf das Konzept „Arbeitsbündnis“ bezieht sich auch Günther Bittner in seinem Aufsatz „Der Mensch - ein ‚Geschöpf des Vertrages‘“. Darin versucht er die folgende allgemeine Aufgabenbestimmung der Sozialpädagogik zu begründen: „Ziel der Sozialpädagogik soll es sein, Kinder und Jugendliche (insbesondere gefährdete Kinder und Jugendliche) zur Teilnahme am Sozialvertrag tauglich zu machen - tauglich als verlässliche und zugleich kritische Vertragspartner“ (Bittner 1985, S. 615). Diesem Ziel entsprechend bestünde der Kern der sozialpädagogischen Methode eben darin, entsprechende „Übungsräume“ für das Aushandeln von Verträgen und „Übungssituationen“ für die Erfahrung von Verlässlichkeit und Bewährung zu gestalten: „Dieses Angebot eines Sozialraumes mit überschaubaren Rechten und 53 Pflichten in einem sozialvertraglich geregelten Verhältnis, bei dem jeder weiß, was er darf und was er nicht darf, und bei dem er über die Rechte und Pflichten mitzubefinden hat, stellt eines der Charakteristika sozialpädagogischer Methodik dar“ (ebd., S. 623). In diesem Sinn könnte man das EVKonzept geradezu als prototypische Veranstaltung zur Einübung von Vertragsfähigkeit ansehen, denn hier werden in besonders prägnanter und expliziter Form die Verhältnisse des Sozialraums Schule sozialvertraglich geregelt. Und zwischen Schülern und Lehrern werden ganz konkrete Verträge abgeschlossen, schriftlich fixiert und mit Unterschriften besiegelt. Die heikle Frage dabei ist freilich die: Haben die Schüler in diesem Konzept tatsächlich auch die Möglichkeit, „über die Rechte und Pflichten mitzubefinden“ oder werden sie einfach einem rigiden Sanktionssystem unterworfen? Die „Verträge“, die sie schließen (müssen), sind doch recht einseitig, weil sie eigentlich nur für sie selbst bindend sind. Sie verpflichten sich darauf, künftig Störungen im Unterricht zu unterlassen und Wohlverhalten an den Tag zu legen. Die Lehrer verpflichten sich allenfalls darauf, sie unter diesen Bedingungen wieder in der Klasse zu tolerieren und zu unterrichten. Und auch die „Rückkehrverhandlungen“ sind eigentlich mehr Bittstellungen als wirkliche Verhandlungen, denn die Schüler selbst haben ja kaum Verhandlungsspielraum und erst recht nichts zu fordern. 5. Erziehung zum „eigenverant- wortlichen Denken und Handeln“ ? Kann man annehmen, dass dieses Konzept tatsächlich das „eigenverantwortliche Denken und Handeln“ der Schüler stärkt? In den Einschätzungen der Lehrer und Lehrerinnen ist dies durchaus der Fall. Aber was genau ist eigentlich „eigenverantwortliches Denken und Handeln“? Es kann ja wohl nicht per se identisch sein mit „schulkonformem“, „angepasstem“, „unauffälligem“ Denken und Handeln. Sind Schüler nicht so und so „eigenverantwortlich“ in ihrem Denken und Handeln? Ist der Begriff „eigenverantwortlich“ nicht eh schon „doppelt gemoppelt“? „Verantwortlichkeit“ ist nicht eine bestimmte Handlung und auch nicht eine bestimmte Tugend, Eigenschaft oder Kompetenz wie etwa „Ordentlichkeit“, „Genauigkeit“ oder „Freundlichkeit“, sondern „Verantwortlichkeit“ ist zunächst eine Kategorie zur Interpretation, zur Bewertung, ja vor allem zur „Zurechnung“ von Handlungen. Man ist für etwas verantwortlich bzw. man wird für etwas von jemandem verantwortlich gemacht. In diesem Sinne wird etwa vor Gericht zu klären versucht, ob und in welchem Maß bestimmte Personen verantwortlich sind für bestimmte Taten oder für bestimmte Schäden etwa dafür, dass Menschen durch Steinwürfe von Autobahnbrücken zu Schaden kamen. Maßgeblich für eine solche Verantwortungszuschreibung ist natürlich zunächst einmal, ob eine Person überhaupt an der fraglichen Sache beteiligt war. 54 Aber wenn dies erwiesen ist, dann spielen natürlich auch noch all die anderen Faktoren wie „Tatumstände“, „kognitive und sittliche Reife“, „Affektlage“, „Wissen um die möglichen Folgen“, „Einsicht in die Zusammenhänge“, „Zurechnungsfähigkeit“, „Vorsatz“, „bewusste Inkaufnahme“ etc. eine Rolle. Wenn jedoch die entsprechenden objektiven und subjektiven Voraussetzungen gegeben sind, dann ist jemand verantwortlich für das was er getan hat, auch wenn er sich dagegen sträubt, dies einzusehen und sich verantwortlich zu fühlen. Dennoch ist die Rede von „verantwortlichem Schülerverhalten“ durchaus geläufig und findet sich in unzähligen Schülerakten. Was ist damit eigentlich gemeint? - Geht es vor allem um ein Stück Nachdenklichkeit und Reflektiertheit? - um die Fähigkeit, die möglichen Risiken und problematischen Konsequenzen bestimmter Handlungen abzuschätzen? Um eine Fähigkeit zur Kosten-NutzenAnalyse im Hinblick auf das eigene Verhalten? - Geht es um Impulskontrolle, um die Fähigkeit, sich nicht von momentanen Launen, von situativen Verlockungen und gruppendynamischem Druck hinreißen zu lassen? - Geht es um die Fähigkeit, realistische Handlungspläne zu entwerfen, gefasste Vorsätze auch einzuhalten ? - Geht es um Ehrlichkeit und Offenheit, sich selbst und den anderen die eigenen Fehler und Konfliktanteile einzugestehen? Darum, zu - - - - - - - dem zu stehen, was man getan hat und nicht ständig nach Ausflüchten zu suchen? Geht es um Engagement, um die grundsätzliche Bereitschaft, irgendwelche Dienste, Ämter oder Aufgaben für andere, für das Gemeinwohl zu übernehmen (etwa die eines Klassensprechers)? Geht es um Verlässlichkeit bei Absprachen und eingegangenen Verpflichtungen? Geht es um Selbständigkeit bei der Planung und Durchführung bestimmter Aktivitäten (etwa bei der Organisation eines Schülercafés)? Geht es um Genauigkeit und Sorgfalt (etwa bei der Führung der Klassenkasse)? Geht es um eine Haltung des Sich Sorgens und Kümmerns um andere, vor allem um Schwächere, Kleinere (etwa im Rahmen eines Tutorenprogramms?) Geht es um Achtsamkeit und Empathie für die Gefühle anderer und um einen Sinn für Fairness und Gerechtigkeit, wenn Konflikte zu regeln sind (etwa als Streitschlichter in einem entsprechenden Programm)? Geht es um Zivilcourage (etwa darum, im Namen der Klasse gegen bestimmte Missstände oder Ungerechtigkeiten zu protestieren – vielleicht sogar gegen möglichen Machtmissbrauch im Zusammenhang mit dem Arizona-Programm)? Man sieht, „Verantwortlichkeit“ als „Persönlichkeitsqualität“ ist eine recht schillernde, facettenreiche Angelegenheit. Dass es hinsichtlich all dieser Aspekte durchaus ausgeprägte 55 Unterschiede zwischen den Menschen gibt, ist offensichtlich. Es dürfte Lehrerinnen und Lehrer vermutlich gar nicht allzu schwer fallen, ihre Schüler bezüglich all dieser Aspekte in einem Polaritätenprofil zwischen einer sehr hohen und einer sehr niedrigen Ausprägung der entsprechenden Merkmale einzuordnen. Wäre das Maß der „Verantwortlichkeit“ dann so etwas wie der erreichte „Gesamtscore“, die Summe der Einzelaspekte? Was aber kann „Erziehung zu eigenverantwortlichem Denken und Handeln“ dann überhaupt heißen? Ich meine, man sollte so ehrlich sein und sich eingestehen, dass der Hauptzweck des dargestellten Konzepts tatsächlich die Etablierung und die Aufrechterhaltung von Disziplin1 ist bzw. eben der Versuch, jene wünschenswerte Situation des „in Ruhe und Gelassenheit Unterrichtenkönnens“ wieder herzustellen. Insofern ist der Name „Projekt Eigenverantwortung“ wohl tatsächlich ein Stück weit ein Euphemismus. - Dies heißt jedoch keineswegs, dass ich das Bemühen um diesen Hauptzweck für illegitim halte! Als Nebeneffekt aber mögen dabei bisweilen tatsächlich auch ReflexiDer „Erfinder“ des Konzepts, E. Ford, geht übrigens sehr viel unbefangener mit dem Begriff Disziplin um als das hierzulande heute üblich ist. Er würde vermutlich in der Titelfrage dieses Aufsatzes überhaupt keinen Gegensatz sehen. Sein Hauptwerk hat ja den Titel: „Dicipline for Home and School und die Kapitelüberschriften darin lauten u.a.: „What Is Discipline?, „When Should Discipline Be Used?“, Establishing Discipline, When Are Children Willing to Learn Discipline?.... 1 onsprozesse angestoßen werden, die etwas mit dem Ziel der „Eigenverantwortung“ zu tun haben. Denn es geht schon auch darum, den Schülern ein klareres Bewusstsein von sich selbst als handelnden und entscheidenden Subjekten zu vermitteln. Vieles, von dem, was in der schulischen Interaktion passiert, auch vieles von dem, was dann von Lehrern als Störung wahrgenommen wird, entsteht eher spontan und situativ und wird nicht von den Schülern bewusst geplant und mit Bedacht inszeniert. Meist wissen Schüler selbst nicht recht zu sagen, was sie eigentlich zum Störverhalten motiviert hat oder wie es eigentlich zu einer plötzlichen hitzigen Konflikteskalation gekommen ist. Bei entsprechenden Ermahnungen und Vorwürfen haben sie in der Regel einen fast instinktiven Impuls zur Verantwortungsabwehr. Schüler bieten bisweilen alle möglichen Gründe und Argumente dafür auf, warum sie erstens an der fraglichen Sache gar nicht beteiligt waren, warum sie zweitens überhaupt nicht wissen konnten, dass ihr Handeln gleich solche Folgen haben würde und warum es drittens dem Betroffenen eigentlich ganz recht geschieht, was ihm widerfahren ist. Oft sehen sie sich selbst nur als Reagierende, die sich gegen Herausforderungen und Provokationen zur Wehr setzen mussten. Redl und Wineman haben die vielfältigen „Alibi-Tricks“, die gerade delinquente Kinder aufbieten, detailliert beschrieben (vgl. Redl/ Wineman 1984) und jeder Lehrer kennt die gängigen Formen des Verleugnens, Verharmlosens, Sich- 56 Herausredens und „Auf-andereSchiebens“. Von daher geht es zunächst einmal um das bescheidenere Ziel einer differenzierteren und ehrlicheren Wahrnehmung der eigenen Anteile an Konflikten. Wenn es gelingt, dass die Schüler in diesem Sinn durch dieses Programm etwas offener und differenzierter in der Selbst- und Situationswahrnehmung werden, dann wird damit durchaus auch eine Voraussetzung eigenverantwortlichen Denkens und Handelns gefördert. Ferner sind an der betroffenen Schule eine ganze Reihe von weiteren Initiativen ergriffen worden, (vom Streitschlichterprogramm bis zum selbstorganisierten Schülercafé) die unter dem Motto „Förderung von Eigenverantwortung“ stehen. Dennoch muss man sich davor hüten, alle Verantwortung für Störungen und Konflikte im Unterricht nur einseitig auf der Schülerseite unterzubringen. Von daher sollte man gerade unter psychoanalytisch-pädagogischen Perspektiven fordern, dass es an Schulen, die dieses Konzept einführen, auch entsprechend institutionalisierte Reflexionsräume gibt, in denen die Lehrer sich offen und differenziert mit ihren Konfliktanteilen und mit ihren emotionalen Verstrickungen in den entsprechenden Szenen auseinandersetzen können. Literatur Ahrbeck, B. (1998). Erziehung zwischen Selbstwertförderung und Kundenorientierung. In Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 67. Jg. 1998, S. 127-136. Balke, S. (1998). Eigenverantwortliches Denken in der Schule. Ein Trainingsprogramm zur Lösung von Disziplinproblemen. In lernchancen 4/1998, S. 46-51. Bittner, G. (1985). „Der Mensch - ein ‚Geschöpf des Vertrages‘“. Zur Begründung von Sozialpädagogik. In Zeitschrift für Pädagogik, 31. Jg. 1985, S. 613-629. Bittner, G. (2002). Schulunlust von Jugendlichen - Entwicklungspsychologische und Psychoanalytische Perspektiven. Erscheint demnächst In Fröhlich, V./Göppel, R. (Hrsg.), Was macht die Schule mit den Kindern - Was machen die Kinder mit der Schule - Psychoanalytisch-pädagogische Blicke auf die Institution Schule. Frankfurt. Dannhäuser, A. (2001). Schule gefährdet Ihre Gesundheit. In Bayerische Schule. 54. Jg. 6/2001, S.3-6 Fend, H. (2000). Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Opladen. Ford, E.E. (1994). Discipline for Home and School. Scottsdale. Fürstenau, P. (1964). „Zur Psychoanalyse der Schule als Institution“. In Das Argument, 6, Heft 2 1964, S. 65-84. Gerspach, M. (1998). Wohin mit den Störern? Zur Sozialpädagogik der Verhaltensauffälligen. Stuttgart, Berlin, Köln. Giesecke, H. (1995). Wozu ist die Schule da? In Neue Sammlung, 35. Jg. (1995), S. 93-104. Göppel, R. (1998/1999). Sich der Gewalt stellen. Zum Umgang mit Aggression und Gewalt in der Tradition der psychoanalytischen Pädagogik. In Scheidewege, Jahresschrift für skeptisches Denken, 28. Jg., 1998/99, S. 97-121. Oevermann, U. (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In Combe, A./Helsper, W. (Hrsg.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt, S. 70-182. Redl, F./Wineman, D. (1984). Kinder, die hassen. Auflösung und Zusammenbruch der Selbstkontrolle. München. 57 Schaarschmidt, U., Kieschke, U., Fischer, A.W. (1999). Beanspruchungsmuster im Lehrerberuf. In Psychologie in Erziehung und Unterricht, 46. Jg. (1999), S. 244-268. Voss, R. (1989). (Hrsg.), Das Recht des Kindes auf Eigensinn. München. Weber, A., Weltle, D., Lederer, P. (2001). Macht Schule krank? Zur Problematik krankheitsbedingter Frühpensionierungen von Lehrkräften. In Bayerische Schule. 54. Jg. 6/2001, S. 6-7. Weidner, J. (1996). Anti-Aggressivitätstraining für Gewalttäter. Bonn. Weigel, K. (2001). Projekt: „Eigenverantwortliches Denken und Handeln in der Schule“ - Versuch einer Umsetzung und kritischen Bewertung. Unveröffentlichte Wissenschaftliche Hausarbeit. Heidelberg. Ziehe, Th. (1997). Schule und Jugend – ein Differenzverhältnis. In Neue Sammlung. 39. Jg. 1997, S. 619-629. NEUERSCHEINUNG in der zweiten Jahreshälfte Das Heidelberger Dienstagsseminar "Globalisierung und Bildung" Hrsg.: Volker Lenhard, Willi Wölfing Deutscher Studienverlag Weinheim, 2002 Vorbestellungen im Sekretariat des Instituts für Weiterbildung, Keplerstr. 87, Raum 025, 69120 Heidelberg, Tel.: 06221-477522, e-mail: [email protected]. 58 Künstlerische Bildung und die Schule der Zukunft Symposium zur künstlerischen Bildung in der nachindustriellen Gesellschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und der Landesakademie Schloss Rotenfels 10. – 12. Oktober 2001 Carl-Peter Buschkühle Arbeits- und Ergebnisbericht Vom 10. bis 12. Oktober 2001 fand an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eine bundesweite Fachtagung zur Zukunft der künstlerischen Bildung an Schulen statt. Das Symposium hatte zwei Arbeitsschwerpunkte: Vorträge und Diskussion am 10. und 11. Oktober an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sowie Workshops mit Kurzvorträgen am 12. Oktober an der Landesakademie Schloss Rotenfels. Die Vorträge in Heidelberg gliederten sich in verschiedene Schwerpunktbereiche: Theoriebildungen zu neuen Formen künstlerischer Bildung, Modelle innovativer Praxis dieser Bildung in Schule und Hochschule, sowie geisteswissenschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven aus dem Bereich der Philosophie, der allgemeinen Pädagogik und der Kulturpolitik. In diesem Teil des Symposiums wurde erstmals in der jüngeren Fachgeschichte die Spannweite der veränderten Anforderungen, der Intentionen und der gegenwärtigen praktischen Versuche im Hinblick auf eine Reform künstlerischer Bildung dargestellt und debattiert. Die Workshops führten die Auseinandersetzung mit innovativer Praxis weiter und intensivierten sie im Hinblick auf exemplarische Versuche, ihre theoretische Reflexion und Kritik. Dieser Veranstaltungsteil wurde vom Kultusministerium des Landes BadenWürttemberg als offizielle Lehrerfortbildungsveranstaltung ausgewiesen. Die Workshops erwiesen sich für die in der Schule tätigen Pädagogen und für die Hochschulvertreter als bereichernde Ergänzung in der Struktur der Veranstaltung, da hier auf der Grundlage unmittelbarer Anschauung Intentionen und Methoden transparent und diskutierbar wurden. Ergänzt wurde die Tagung durch zwei Abendveranstaltungen, die wesentliche Bezüge der künstlerischen Bildung eröffneten: das Erlebnis und die Diskussion der zeitgenössischen Kunstformen Installation und Performance im Heidelberger Kunstverein sowie die Beziehung zu gegenwärtigen Herausforderungen an die Lebenspraxis im Vortrag des Berliner Philosophen Wilhelm Schmid über Lebenskunst und Bildung. Eröffnet wurde dieser Abend in der Print Media Academy der Heidelberger Druckmaschinen AG durch das Stück „Vita activa“, eine Collage aus Tanz, Theater, Musik und Performance, die der Heidelberger Sozialpädagoge Wolf-Rüdiger Wilms mit verhaltensauffälligen Kindern sowie Künstlern des Stadttheaters Heidelberg erarbeitet hat. Dieser öffentliche Abend demonstrierte eindrucksvoll die Spann- 59 weite, in der künstlerische Bildung sich bewegt - zwischen künstlerischer Arbeit mit Kindern aus ihrer Lebenswelt heraus und gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklungen, die neue Anforderungen und Perspektiven an die fachliche Bildung herantragen. Die Beiträge zur Tagung haben insgesamt die Erwartungen erfüllt, Innovationen in der künstlerischen Bildung vorzustellen und gemeinsame Grundelemente in den Theoriebildungen und Praxismodellen herauszuarbeiten. Die in den Darstellungen und Diskussionen aufgetretenen Differenzen schärften den Blick für Problemaspekte und gaben Anstöße für die Fortsetzung der Forschungsarbeit. Nachfolgetreffen zu spezifischen Fragestellungen wurden vereinbart. Insgesamt wurde deutlich, dass sich im Bereich der Kunstpädagogik in den letzten Jahren unterschiedliche Ansätze entwickelt haben, denen gemeinsam ist: die Begründung ihrer Ziele aus den veränderten kulturellen Bedingungen der Mediengesellschaft heraus sowie die Orientierung ihrer Arbeitsweisen an den Entwicklungen der Gegenwartskunst. Inhaltliche Ergebnisse der Tagung Eigenschaften und Perspektiven künstlerischer Bildung Zusammengefasst lassen sich aus den Tagungsbeiträgen folgende innovative Eigenschaften der künstlerischen Bildung herausstellen und gegenüber traditionellen Formen des Kunstunterrichts abgrenzen: - In Theorie und Praxis entwickelt die künstlerische Bildung Formen und Inhalte einer Kunstdidaktik als Kunst. Das Ziel ist die Entfaltung künstlerischer Denkund Handlungsformen im Kunstunterricht. Dazu ist eine induktive Arbeitsweise erforderlich, die von der Wahrnehmung zur Gestaltung, von der Erfahrung zur Erkenntnis führt. Die Schüler sollen lernen, in der Auseinandersetzung mit einem Thema eigene Wege des Ausdrucks und der Gestaltung zu verfolgen, statt definierte Aufgabenstellungen zu bearbeiten, die sich in der Regel deduktiv aus vorhergehenden Bildanalysen ableiten. An die Stelle einer Nachahmungsdidaktik, die die Kreativität des Einzelnen beschränkt, tritt eine am Werkprozess orientierte Didaktik, die die Selbständigkeit des Schülers in der Entwicklung eigener Aussageformen zur Thematik befördert. - Der Kunstpädagoge muss ausgebildeter Künstler sein, um künstlerische Unterrichtsprozesse initiieren und begleiten zu können. Künstlerische Prozesse bewegen sich zwischen Scheitern und Gelingen, zwischen offenen Problemen und zu entdeckenden Lösungen und - auf Seiten des Autors zwischen Resignation und Motivation. Diese Widersprüchlichkeit der Erfahrungen leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Bildung der Persönlichkeit sowie zur Ausbildung der leiblichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten des Schülers. Er bedarf in diesen Prozessen der Begleitung und Förderung durch den 60 Lehrer, der in der Lage sein muss, sowohl die Entwicklung der Arbeit des Schülers als auch dessen persönliche Entwicklung (Voraussetzungen, Motivation, Lernfortschritt usw.) einzuschätzen und entsprechende Impulse zu geben. Dazu muss er auf eigene Erfahrungen hinsichtlich der Eigenschaften und Probleme des künstlerischen Prozesses zurückgreifen können. Die Betreuung individueller Gestaltungsweisen fordert ferner ein hohes Maß an Aufmerksamkeit des Lehrers für den Einzelnen. Ebenso muss er in der Lage sein, bezüglich der gestellten Thematik gemeinsame Lernprozesse der Klasse zu ermöglichen, wobei die Vielfalt der individuellen Ansätze hilfreich sein kann. - Die der künstlerischen Bildung zugrundeliegende Kunstauffassung geht von einem erweiterten Kunstbegriff aus. Dieser Kunstbegriff wurde als Konsequenz aus der Entwicklung der modernen Kunst pointiert und mit pädagogischen Folgerungen versehen von Joseph Beuys formuliert. Im Konzept der Lebenskunst, welches u.a. Wilhelm Schmid in der gegenwärtigen philosophischen Debatte vertritt und welches bereits weit über den Rahmen der Philosophie in andere Bereiche (Kulturpolitik, Pädagogik, Soziologie, Medizin) hineinwirkt, findet der erweiterte Kunstbegriff seine theoretischen Ausarbeitungen hinsichtlich einer selbstbestimmten Lebensführung inmitten der heterogenen Verhältnisse der Gegenwartsgesellschaft. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Subjekt, nach seinen schöpferischen Potenzen, die es ihm erlauben, sein eigenes Leben verantwortlich zu gestalten. Für die künstlerische Bildung bedeutet die Ausrichtung auf die Bildung des zur Selbstgestaltung fähigen Subjekts, dass ihre Themenstellungen nicht nur die Kunst und die Ästhetisierungen der Alltagswelt und der Medien zum Gegenstand machen, sondern sich auch auf bedeutsame Phänomene, Fragen und Probleme aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler beziehen. Gesellschaftlich relevante Bildungsziele - Künstlerische Bildung schult die Positionsfähigkeit des Einzelnen. Kunstwerke konfrontieren die Schüler mit neuen Sicht- und Ausdrucksweisen. Die Ausarbeitung eines eigenen Werkes zwingt zur Überprüfung und Modifizierung eigener Standpunkte. In jedem Fall verlangt die künstlerische Arbeit ob rezipierend oder produzierend sowohl den Erwerb von Kenntnissen als auch deren Transformation in eigene Aussagen. Der Schüler ist in der Wahrnehmung fremder Werke, in der Reflexion neuer Zusammenhänge und in der Gestaltung eigener Werke herausgefordert, neue Standpunkte zu entwickeln. Kunst als schöpferische Arbeit mit Neuem, Unbekanntem, Fremdem schult die Fähigkeiten des Einzelnen, eigene Positionen zu formulieren und zu begründen. Dies stellt eine zentrale Fähigkeit hinsichtlich einer selbstbestimmten Lebensführung in differenzierten 61 gesellschaftlichen dar. Verhältnissen - Künstlerische Arbeit schult die geistige Beweglichkeit und Orientierungsfähigkeit des Individuums. Die erkennende und gestaltende künstlerische Auseinandersetzung fordert alle geistigen Kräfte heraus. Dies gilt nicht nur bei der Betrachtung oder Formung eines Kunstwerkes, vielmehr ist es ein zu übendes Spezifikum künstlerischen Wahrnehmens und Denkens, dass es jeden Gegenstand ganzheitlich auffasst: Sinnlichkeit, Empfindung, Kognition und Imagination sind zugleich aktiviert, beeinflussen sich wechselseitig, inspirieren sich, geraten aber auch in Konflikt miteinander. Neben dieser Ausbildung der inneren Beweglichkeit der geistigen Fähigkeiten verlangt die künstlerische Arbeit auch nach außen hin eine Beweglichkeit, die sich in einem rhythmischen Wechselverhältnis von Selbstbewegung und Selbstverortung darstellt: der Recherche relevanter Kontexte, um notwendiges Wissen, relevante Kenntnisse zu erwerben sowie die Gestaltungsarbeit, die aus der Vielfalt und Heterogenität der Erfahrungen und Einsichten wiederum eine persönliche Darstellung formt. Damit schult künstlerische Bildung die ganze Vielfalt der geistigen Vermögen. Die Prozesse, in denen dies geschieht, sind jedoch konfliktreich. Die geistige Beweglichkeit muss zielgerichtet eingesetzt werden, um sich Orientierung zu verschaffen und zu eigenen Aussagen zu finden. Orientierungsfähigkeit angesichts von Neu- em, Fremdem, inmitten von Vielfalt und Widersprüchlichkeit ist eine weitere wesentliche Anforderung hinsichtlich selbstbestimmter Lebensführung, sie ist eng mit der Positionsfähigkeit verbunden. - Künstlerische Arbeit schult die Verantwortlichkeit des Einzelnen. Die Gestaltung eines eigenen Werkes verlangt, für seine Entwicklung und sein Gelingen Verantwortung zu übernehmen. Der Prozess der Gestaltung fordert dabei eine Verantwortung hinsichtlich des Materials und hinsichtlich des Themas, welche jeweils eine angemessene Bearbeitung verlangen. Die angemessene Weise der Bearbeitung ist an der entstehenden Form ablesbar. Soziale Verantwortung wird ausdrücklich geschult in Gruppen- und Gemeinschaftsarbeiten. - In diesem Zusammenhang schult die künstlerische Arbeit die Fähigkeit zu demokratischer Kommunikation. Besonders herauszustellen ist in diesem Zusammenhang die Schulung von Kritikfähigkeit. Kunst übt differenzierende Wahrnehmungsleistungen und selbständige Formulierung von Aussagen. Damit übt sie eine einfühlsam-kritische Betrachtung von Gegenständen, Darstellungen und Bedeutungsansprüchen. Die Übung dieser kritisch-konstruktiven Haltung setzt sich fort in den Kommunikationsprozessen des Kunstunterrichtes, wo die Erkenntnis- und die Werkarbeit in Lerngruppen abläuft. Der Einzelne ist hier aufgefordert, seine Einsichten und Gestaltungen 62 darzustellen, zu vertreten und zu begründen, sei es im Gespräch mit dem Lehrer, mit einzelnen Mitschülern, der ganzen Klasse oder gar einer weiteren Öffentlichkeit bei Präsentationen. In diesen Zusammenhängen setzt er seine Aussagen und Formungen der Kritik anderer aus, zugleich ist er als Mitglied der Lerngruppe aufgerufen, selbst sachliche Kritik an Aussagen und Formungen anderer zu üben unter der Perspektive der Beförderung der Sache sowie ihres Autors. Schulung der Kritikfähigkeit als demokratische Kommunikationsform beinhaltet in diesem Zusammenhang zweierlei: Schulung der Äußerung einfühlsamer, sachgerechter Kritik sowie Schulung der Fähigkeit, solche Kritik annehmen und umsetzen zu können. - Künstlerische Bildung mobilisiert die Initiative des Einzelnen. Insofern die Kunst, die Produktionen der Medien sowie die Ästhetisierungen der Alltagswelt Gegenstand des Unterrichts sind, fördert die künstlerische Bildung die kritische Teilhabe an der Gegenwartskultur. Die Auseinandersetzung z.B. mit medialen Inszenierungen von Leitbildern und Wertvorstellungen übt differenzierte Wahrnehmung, selbständige Bedeutungsfindung sowie Imagination als Fähigkeit, Alternativen zu entwerfen. Diese Fähigkeiten sind von grundsätzlicher Bedeutung für eine selbstbestimmte Lebensführung. Sie werden auch geübt bei Themenstellungen, die aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler stammen oder die politische Prob- leme wie Fremdenfeindlichkeit zum Gegenstand machen. Künstlerische Bildung fördert hier die Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und deren Diskussion. Insofern Kunst dabei nicht nur kritische Erkenntnisarbeit leistet, sondern die Formulierung eigener Aussagen, die Formung eigener Darstellungen verlangt, befördert sie die aktive und persönliche Auseinandersetzung. Diese kann über die Werkdarstellung hinaus kritisches Interesse und gegebenenfalls engagiertes Handeln motivieren, wobei insbesondere die Imaginationsfähigkeit eine bedeutende Rolle spielt. Sie versetzt den Einzelnen in die Lage, potentielle Konsequenzen von Handlungen oder Entwicklungen vorzustellen oder Alternativen zu entwerfen. Die Befähigung zur selbstbestimmten Lebensführung in komplexen kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnissen führt so über die Fähigkeiten zur Orientierung und Gestaltung des individuellen Lebens hinaus und nimmt die gesellschaftliche Verantwortung und gegebenenfalls das gesellschaftliche Engagement in den Blick. Methoden künstlerischer Bildung - Die künstlerische Arbeit ist werkorientiert, alle Lernprozesse finden im Rahmen der Gestaltungsarbeit statt. Das induktive Vorgehen setzt an bei unmittelbar wahrnehmbaren Gegenständen, in konkreten Situationen, bei Vorstellungen und Phantasien der Schüler und entwickelt von daher Kontexte und Gestaltungswege. Es lassen 63 sich drei methodische Arbeitsformen unterscheiden, die in ständigem Wechsel entweder durch die gesamte Lerngruppe gemeinsam oder, je nach Notwenigkeit, im individuellen Werkprozess von Einzelnen oder Kleingruppen praktiziert werden: Die Recherche, die Wahrnehmungs- und Beobachtungsaufgaben umfassen kann, handwerkliche Erprobungen oder Informationssuche anhand von Bildern oder Texten, wobei das Internet eine bedeutende Quelle darstellt. Die Konstruktion, die aus den unterschiedlichen Erfahrungen und Einsichten der Recherche intellektuelle Zusammenhänge bildet, beispielsweise in Form von kunstgeschichtlichen Kontexten bei Werk- und Textanalysen. Die Transformation, auf die Recherche und Konstruktion zulaufen, und die immer wieder als fortschreitende Gestaltungsarbeit Anlass zu neuen Recherchen und Konstruktionen gibt. Sie bildet das Kernstück des künstlerischen Bildungsprozesses, da hier der Schüler aufgefordert ist, seine Erfahrungen, Erkenntnisse, Phantasien zu gewichten, zu modifizieren und zu verwandeln, um eine eigene Aussage, eine eigene Gestaltung hervorzubringen. - Künstlerische Bildung verlangt sukzessive sich entwickelnde, themenorientierte Erkenntnisund Gestaltungsarbeit. Künstlerische Auseinandersetzung befördert individuelle Fragen, Perspektiven und Vorstellungen einerseits und die Konfrontation mit neuen Gegenständen und Sachverhalten, ihren Eigenschaften und den mit ih- nen zusammenhängenden Kontexten andererseits. Für die Entfaltung der Intensität dieser Auseinandersetzung ist ein hinreichender zeitlicher Rahmen erforderlich. Für die traditionelle Unterrichtsstruktur bedeutet dies, dass die Arbeit an einem Thema ein Quartal oder ein Halbjahr andauern müsste, wobei sukzessive inhaltliche Zusammenhänge entdeckt und eigene Gestaltungen entwickelt werden. Letztere bedürfen in der Regel mehrerer Stufen: von skizzenhaften Konzepten, in denen sich ein anfängliches Suchen ausdrückt und kommunizierbar wird, über experimentelle Entwürfe bis zur Ausarbeitung. Eine andere Verfahrensstruktur entfaltet die gestalterische Arbeit über mehrere mediale Ausdrucksformen, die Modifikationen der Aussage bzw. eine zunehmende Komplexitätssteigerung beinhalten (z.B. Entwurfszeichnung, Modellbau, digitale Produktfotografie, Internetpräsentation). - Künstlerische Arbeit ist immanent interdisziplinär und legt als angemessene Arbeitsform das Projekt nahe. Die komplexen inhaltlichen und formalen Prozesse der künstlerischen Arbeit entfalten die Intensität des persönlichen Einsatzes erst dann, wenn sie hinreichende Zeit zur Entwicklung haben, ohne vom festgelegten Stundentakt unterbrochen zu werden. Bei der Erarbeitung einer eigenen Aussage zu einem Thema werden Fragen relevant, bei denen die Recherche den genuinen Bereich der Kunst verlassen kann oder gar muss, so z.B. bei der Frage nach 64 anatomischen Bedingungen bei der Modellierung von Körpern oder bei Fragen nach wissenschaftlichen Zusammenhängen bei der Auseinandersetzung mit Gentechnik, Klonen, Individualität. In einem künstlerischen Projekt können je nach Themenstellung Kooperationen mit unterschiedlichen Fächern sinnvoll sein: Naturwissenschaften, Religion, Geographie, Sport. Besonders naheliegend sind Kooperationen der Künste untereinander: Bildende Kunst und Musik und/oder Sprachen. Die inhaltliche Komplexität sowie der zeitliche Bedarf solcher Kooperationen legt das Projekt als angemessene Arbeitsform nahe. - Das künstlerische Projekt ist eine spezifische Projektform, über die das Künstlerische auch in andere Fächer hineinwirkt. Die Kunst hat in den letzten Jahrzehnten Ausdrucksformen entwickelt, die handlungsorientierten und interdisziplinären Charakter haben, so z.B. die Performance oder die Videokunst, bei denen Bild, Sprache, Musik und körperliche Bewegung zusammenspielen. Die Nutzung solcher Kunstformen in ihrer neuartigen Komplexität für die Bildung verlangt entsprechende räumliche, zeitliche und technische Voraussetzungen. In ihnen wird der Charakter eines künstlerischen Projektes erkennbar, das sich über die Erkenntnisarbeit hinaus durch die Transformation von Einsichten und Erfahrungen in eigene Aussagen und Bedeutungsformulierungen der Beteiligten auszeichnet. Damit wird die Erarbeitung eines persönlichen Verhältnisses, einer eigenen Position zum Gegenstand verlangt. Diese Verbindung von Erkenntnisarbeit mit kritischer Imagination kann auch in der Zusammenarbeit mit nichtkünstlerischen Fächern geschehen. Die Kunstform der Spurensuche etwa hat Arbeitweisen entwickelt, die historische oder naturwissenschaftliche Recherche mit Darstellungsformen der Zeichnung, der Malerei, der Fotografie oder der Installation verbindet. Objektive Erkenntnisarbeit wird hier mit subjektiver Stellungnahme verbunden, die Trennung von Fakten und persönlicher Aneignung überwunden. - Interdisziplinäre künstlerische Projekte haben narrativen und multimedialen Charakter. Die sukzessive Erarbeitung eines Themas entfaltet einen Erzählkontext, der gemeinsame Erfahrungen und Erkenntnisse der Klasse oder des Kurses umfasst wie auch individuelle Recherchen und Transformationen anstößt. Ein Projekt zum Thema „Fremdenfeindlichkeit“ etwa greift dabei ebenso auf Berichte in Presse oder Fernsehen zurück wie es sich andererseits um konkrete Recherchen und Begegnungen vor Ort bemüht: in der Klasse, in der Schule, im Wohn- und Freizeitumfeld, in der Stadt. Angemessene Darstellungsweisen müssen gefunden werden ausgehend von den Darstellungsabsichten, die der einzelne Schüler oder Gruppen im Laufe der Auseinandersetzung entwickeln: Malerei kann ebenso tauglich sein wie die Arbeit mit Video. Um in einem Medium eine eigene Aussage zu formulieren, 65 müssen sich die Schüler relevante Kontexte aneignen. Das Werk wird zur Quintessenz eines Erzählprozesses, der im Laufe der Erarbeitung unterschiedliche, nicht selten auch widersprüchliche Informationen, Eindrücke und Erkenntnisse in Beziehungen zueinander stellt. Im Rahmen der intellektuellen Auseinandersetzung werden unterschiedliche Ebenen miteinander verbunden: das persönliche Erlebnis, die politische Problematik, subjektive Betroffenheit und Fragen nach Ethik und Moral. Kunst, die von der Wahrnehmung ausgeht, kritische Reflexion befördert und zu eigener Stellungnahme im Werk auffordert, übt damit die Erzählung als die existentielle Form menschlicher Intellektualität: nach den Worten Lyotards liegt sie als subjektive Bedeutungskonstruktion quer zu allen spezialisierten Sprachspielen der Disziplinen. - Die traditionellen und die neuen Medien stehen in der künstlerischen Bildung in einem Verhältnis der wechselseitigen Inspiration. Der narrative und multimediale Charakter künstlerischer Projekte setzt Inhalte und Ausdrucksformen zueinander in Beziehung, und sei es eine Beziehung des Konflikts. Keinesfalls findet hier der Gedanke einer bloßen Kompensation Platz, der die Arbeit in traditionellen Medien wie Malerei oder Bildhauerei den flüchtigen, immateriellen, manipulativen Bildern der elektronischen gegenüberstellt. Die Kunstpraxis der letzten Jahre entwickelte das Verhältnis von Realität und Virtualität zu einem „Crossover“: Reale Wahrnehmungen und Erlebnisse erfahren ihre gestalterische Transformation in virtuellen Bildern z.B. im Video. Künstliche Produktionen werden kritisch kommentiert und verwandelt in Malerei, Skulptur, Installation oder Performance. Das gestalterische Wechselverhältnis von leiblicher Erfahrung und elektronischer Darstellung, von virtuellem Bild und materieller Umformung eröffnet ein kritisches Verhältnis zur Besonderheit der jeweiligen Medien, fördert die Kompetenz im selbständigen Umgang mit ihnen und schult dabei die Positionsfähigkeit als Entwicklung und Begründung eigener Standpunkte hinsichtlich eines Themas und seiner medialen Beeinflussungen. Ausblicke In der zweiten Jahreshälfte 2002 wird ein Tagungsband erscheinen, der die Vorträge und Workshops des Symposiums dokumentiert. An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wird das Fach Kunst ab dem Sommersemester 2002 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Weiterbildung einen regelmäßig tagenden Arbeitskreis zur Lehrerfortbildung zu neuen Praxisformen künstlerischer Bildung einrichten (siehe Weiterbildungsangebote Grup-pe 10.3). Empfehlenswerte Literatur zu neuen Formen künstlerischer Bildung, wie sie auf dem Kongress diskutiert wurden: Helga Kämpf-Jansen: Ästhetische Forschung. Salon-Verlag 2001 66 Joachim Kettel: SelbstFREMDheit. Elemente einer anderen Kunstpädagogik, Athena-Verlag, Oberhausen 2001 Referentinnen und Referenten des Symposiums „Künstlerische Bildung und die Schule der Zukunft“ Christoph Breidenich, Künstlergruppe „Das künstliche Gelenk“, Wuppertal Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fach Kunst Prof. Henning Freiberg, Akademie der Bildenden Künste Braunschweig Prof. Dr. Helga Kämpf-Jansen, Universität GH Paderborn Prof. Dr. Manfred Kästner, Pädagogische Hochschule Karlsruhe StR Dr. Joachim Kettel, Köln PD Dr. Marie-Luise Lange, Vertretungsprofessur an der TU Dresden, Institut für Kunst und Musikwissenschaft PD Dr. Pierangelo Maset, Universität Lüneburg Harald F. Müller, Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen Prof. Dr. Norbert Hinterberger, Universität Weimar, Fakultät für Gestaltung Prof. Dr. Maria Peters, Universität Bremen, Fachbereich Kunstwissenschaft/ Kunstpädagogik Prof. Dr. Günther Regel, Leipzig Prof. Dr. Kersten Reich, Universität Köln PD Dr. Wilhelm Schmid, Berlin Dipl. Des. Dipl. Art. Jörg-H. Schwerdt, Künstlergruppe „Das künstliche Gelenk“, Wuppertal Bernhard Serexhe, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe OStR Hubert Sowa, Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg Ulrich Spormann, Institut für Bildung und Kultur e.V. Remscheid PD Dr. Andreas Steffens, Universität Kassel Prof. Dr. Reimar Stielow, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Prof. Joseph Walch, „Burg Giebichenstein“ Hochschule für Kunst & Design Halle Prof. Wolf Rüdiger Wilms, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Institut für Sonderpädagogik OStR Gerd-Peter Zaake, Käthe-Kollwitz-Schule Hannover Dr. Wolfgang Zacharias, Pädagogische Aktion/Spielkultur e.V. München H o me p a g e d e r PH : w w w .p h - h e i d e l b e r g .d e S c h a u e n S i e ma l r e i n ! 67 68 AUTORENVERZEICHNIS Dipl.-Päd. Frank Lipowsky Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Soziologie, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dr. Anne-Rose Barth, StR’in, Lehrkraft für besondere Aufgaben, Fach Psychologie, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dipl. Psych. Martina Becker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fach Psychologie, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dr. Franz Josef Geider, Akademischer Rat, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Psychologie, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dr. Werner Jünger, Dipl. Psych., StR, Fach Psychologie, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dr. Alfred Klaus, Professor für Psychologie, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dr. Rolf Göppel Professor für Allgemeine Pädagogik, Pädagogische Hochschule Heidelberg Dr. Carl-Peter Buschkühle Professor für Kunsterziehung, Pädagogische Hochschule Heidelberg Von einigen Ausgaben der Informationsschrift sind noch Restposten vorhanden die kostenlos beim Institut für Weiterbildung zu beziehen sind. Die neuesten Ausgaben können Sie auch vom Internet downloaden: www.ph-heidelberg.de/org/ifw/Info/Info.html