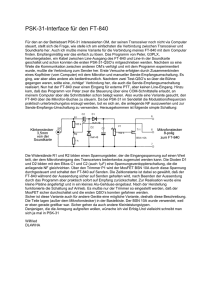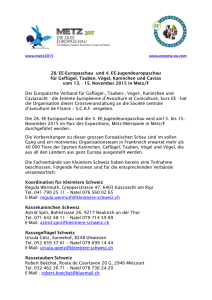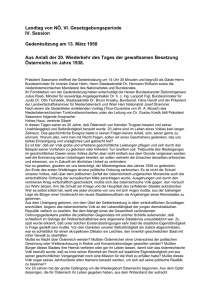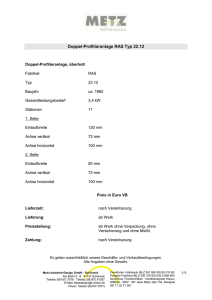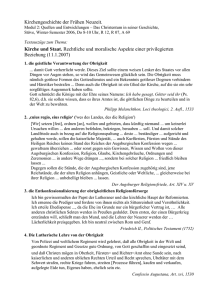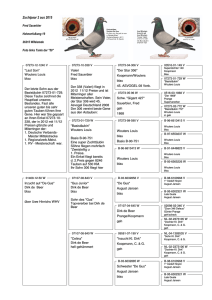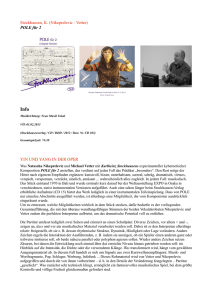Lebenserinnerungen mit Familienstammbaum von 1835 – 1910 Für
Werbung
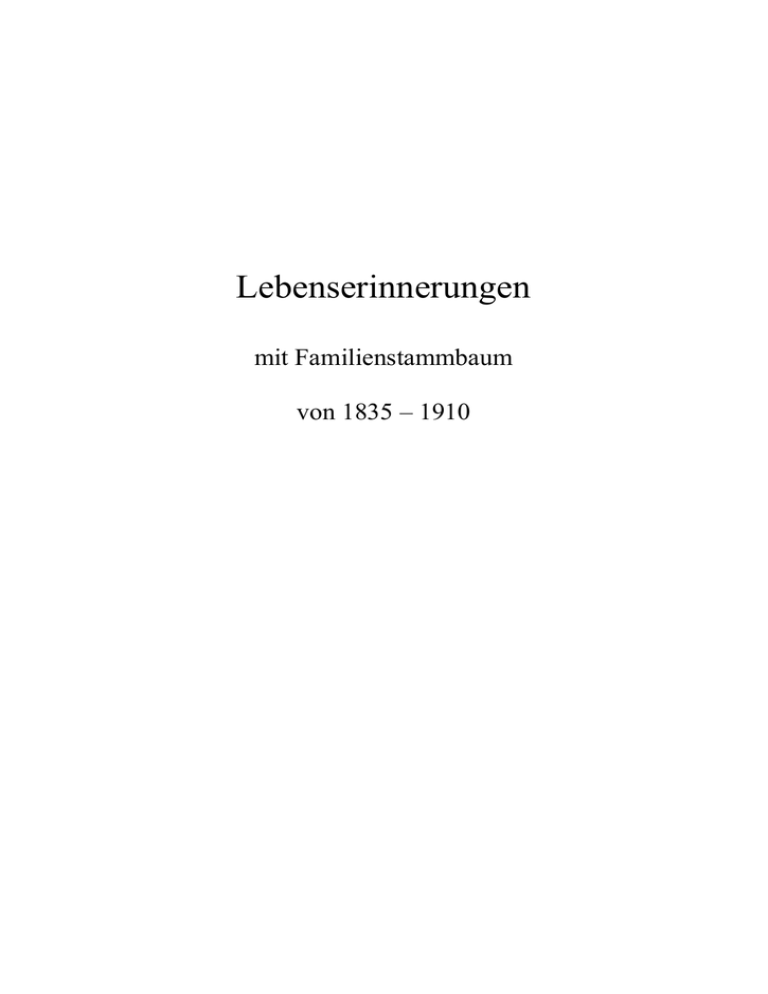
Lebenserinnerungen
mit Familienstammbaum
von 1835 – 1910
Für meine Familie, Verwandten und Freunde
von
Joh. Zeitz in Metz
1911
Druck von Thiele & Schwarz, Caßel
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort
I.
Meine Vorfahren und meine Geschwister
II.
Meine Schulzeit bis zu meiner Konfirmation
III...
Lehrzeit und Wanderjahre
IV.
Meine Militärdienstzeit
V.
Meine Verheiratung und der Geschäftsanfang
VI.
Der Krieg von 1866 und die Bekanntschaft mit Vetter Gottfried
VII.
Der Krieg von 1870/71
VIII. Beim Prinzen Friedrich Karl in Corny
5
7
8
9
19
27
29
33
40
IX.
X.
XI.
Die Kapitulation von Metz
Meine Reise zur Armee nach Frankreich
Lieferungen in Metz und Übernahme der Fuhrenleistung im
Artilleriedepot
XII.
Übersiedelung nach Metz
XIII
M e i n e Ki n d e r
XIV. Der Niedergang im Fuhrgewerbe
XV.
Mein Überfall und meine Beraubung im Walde von Ars
XVI. Die Krankheit meiner Frau
XVII. Persö n lic h e s
XVIII. Näheres über meine Geschwister und deren Familien
IXX. Germanisationsfortschritte in 40 Jahren
XX.
Schlußwort
Stammbaum
43
47
50
53
55
72
79
83
88
91
92
100
101
Vorwort
Die nachfolgenden Erinnerungen aus meinem Leben sind für meine Familie und nähere Bekannte wiedergegeben worden.
Im Alter von 76 Jahren werde ich wohl einer der Ältesten aus dem Kreise der Verwandtschaft sein, und da bisher weder eine
Familienchronik, noch ein Familienstammbaum vorhanden war, so soll durch diese Darstellung eines Einzellebens mit seinen
Beziehungen zur Familie die erste Anregung zur Schaffung solcher Erinnerungen gegeben werden.
Ich grüße mit meiner bescheidenen Gabe jedes einzelne Familienmitglied und jeden Freund, welcher sie empfängt, von
Herzen, und bitte um ein verwandtschaftliches und freundliches Gedenken als Gegengruß.
Metz, im Februar1911.
Joh. Zeitz.
1. Meine Vorfahren und meine Geschwister.
V
on meinen guten Eltern hörte ich oft sagen, daß mein Urgroßvater Johann Georg Zeitz, geboren
1721-1793, aus der Gegend von Nordhausen (Provinz Sachsen) stamme. Derselbe wanderte
mit noch anderen Arbeitern aus dortiger Gegend aus nach der Saargegend und ließ sich in Fischbach
als Erzgräber nieder. In erster Ehe war er verheiratet mit Christina Magdalena Reinhold, geboren 1739,
gestorben 1772. Das älteste Kind aus dieser Ehe war mein Großvater August Friedrich Zeitz, geboren zu Fischbach 1759; er
verheiratete Sich nach Sulzbach mit der dort geborenen Margarethe Elisabeth Schneider, siedelte nach Sulzbach über und betrieb
dortselbst einen Ackerbau. Der älteste Sohn aus dieser Ehe warmein Vater Johann Kaspar Zeitz, geboren zu Sulzbach den 4. Mai
1780, gestorben 20. Mai 1848, nach einer Krankheit von vierzehn Tagen, im Alter von 68 Jahren und 16 Tagen. In erster Ehe
verheiratete sich mein Vater mit Dorothea Magdalena Krebs aus Sulzbach. Diese starb am 18. Februar 1814. Aus dieser Ehe
gingen 3 Töchter hervor. (Siehe Familienstammbaum.)
Nach dem Tode der ersten Frau ging mein Vater am 26. Dezember 1815 ein zweite Ehe ein mit Katharina Margarethe Wagner
aus Neunkirchen (Bez. Trier). Dieselbe war geboren am 20. Januar 1794, gestorben am 16. November 1878, nach dreißigjährigem
Witwenstand im Alter von 84 Jahren, 9 Monaten, 16 Tagen. Aus dieser zweiten Ehe stammen 8 Kinder, 5 Sühne, 3 Töchter (s.
Familienstammbaum). Ich war das jüngste der Kinder. Mein Vater hatte sich durch Fleiß und Sparsamkeit aus kleinen Anfängen
emporgearbeitet und sich das damalige größte Fuhrgeschäft sowie einen der größten Grundbesitze in Sulzbach erworben, der
damals allerdings den heutigen Wert lange nicht hatte. So lange ich meinen Vater gekannt habe, war er Ortsvorsteher in
Sulzbach, ein Ehrenamt, welches bald nach seinem Tode auf meinen Bruder Louis überging und von diesem lange Jahre
verwaltet ward, bis Sulzbach selbständige Bürgermeisterei wurde. Den Schwerpunkt für die Ausbildung seiner Kinder
legte unser guter Vater in die praktische Arbeitßchule, in welcher er selbst der Lehrer und Meister war und
darin auch seines Amtes streng gewaltet hat.
Es liegt mir fern, dieserhalb einen Vorwurf gegen meinen Vater zu erheben. Auch habe ich nie gehört, daß es einer meiner
Brüder getan hat, obschon wir es später mitunter unangenehm im praktischen Leben empfunden haben, daß wir In unserer
Jugendzeit nicht beßer schreiben und rechnen gelernt haben. Die Zeiten waren damals eben andere wie heute. Wie unser
Vater nichts anderes als arbeiten lernte, so hielt er auch seine Kinder in frühester Jugend zur Arbeit an. Keinem von uns
hat es etwas geschadet; wir waren dabei gesünder und kräftiger als viele unserer Kameraden, die nicht so früh wie wir zu
arbeiten brauchten. Das allbekannte Sprichwort: „Arbeit macht das Leben süß"war oberster Grundsatz meines Vaters, und er
hatte auch darin Recht. Ich habe in meiner Lebenszeit viele Menschen kennen gelernt, welche sich zu Tode gelebt, aber nur sehr
wenige, die sich wirklich zu Tode gearbeitet haben.
Meine gute Mutter war das Vorbild einer tüchtigen Hausfrau und voll liebender Fürsorge in der Pflege ihres Mannes und
ihrer Kinder. Im Gegensatze zum strengen Vater war sie die stets liebende, gute Mutter, die auch bei größeren Vergehen ihrer
Kinder nur selten zum Stocke griff. Und wenn sie es doch einmal tat und schon zum schlagen ausgeholt hatte, ließ
sie den Stock immer wieder sinken, ohne zuzuschlagen damit sie ihren Kindern nicht wehe täte. Bei mir als dem
jüngsten hat sie noch besondere Nachsicht geübt, was mitunter bei den älteren Geschwistern Eifersucht hervorgerufen hat
II. Meine Schulzeit bis zu meiner Konfirmation.
Von meinem 6. Jahre an besuchte ich wie alle meine Geschwister die Elementarschule in Sulzbach, wo damals nur ein
Lehrer, Herr Nahrgang, war. Später kann noch ein zweiter, Herr Kolb, hinzu. Die damals Sulzbach zunächst gelegenen höheren
Schulen waren in Saarbrücken. In diese uns zu schicken, hielt aber mein guter Vater weder für seine Söhne, noch für seine
Töchter für erforderlich. Er erachtete den Preis von zwei Talern und einer Quart = 75 Kilo Glockenkorn, was damals pro
Kind und Jahr als Schulgeld in der Elementarschule gezahlt wurde, als ausreichend. Hauptsache war ihm, wie schon
erwähnt, praktische Arbeit. Die Elementarschule haben wir alle regelmäßig, soweit wir nicht im Sommer durch die
Feldarbeit daran verhindert wurden, besucht, und wir haben, soviel ich mich erinnern kann, fast alle die ersten Plätze darin
eingenommen. Der Stock, mit welchem unser Lehrer in den Schulstunden regelmäßig bewaffnet war, spielte dabei eine
große Rolle. Mit demselben wurden die unfolgsamen Schüler bestraft, und den unfleißigen wurde etwas damit nachgeholfen.
Wenn der Vorrat von Stöcken aufgebraucht war, wurde einer der beßeren Schüler (dies galt als eine Bevorzugung) in den Wald
geschickt, um während der Schulstunden ein Bündel neuer zu holen. Es war immer dafür gesorgt, daß kein Mangel an Stöcken
vorhanden war.
Nach Ablauf meiner Schulzeit wurde ich im Jahre 1849, ein Jahr nach dem Tode meines Vaters, in Dudweiler konfirmiert.
Sulzbach hatte damals noch keine Kirche und auch keinen Pfarrer. es ist wohl natürlich und begreiflich, daß an diesem Tage die
Erinnerung an meinen seligen Vater Trauer und Wehmut in mir hervorgerufen hat. War ich doch der einzige von den
Geschwistern, bei deren Konfirmation der Vater nicht zugegen war. Aber auch bei meiner lieben Mutter hat die noch nicht
vernarbte Wunde von neuem geblutet, und dieser Tag ist für sie recht herb und bitter gewesen. Auf dem Rückwege aus der
Kirche von Dudweiler nach Sulzbach hörte ich eine Äußerung von ihr, die mir unvergeßlich blieb, und die ich hier anführen
muß. Auf dem Wege gegen Dudweiler und Sulzbach (dem sogenannten Kittenberg) ging meine Mutter mit ihrer Schwester
Wilhelmina (genannt Bas Willemin) allein und weinte bitterlich; ich ging mit gepreßtem Herzen hinterher. Da hörte ich,
wie Sie zu ihrer Schwester sagte: „Ach, wenn Ich doch nur noch so lange lebe, bis mein Johann von den Soldaten frei ist, den älteren
(Louis und August waren damit gemeint) habe ich immer, so lange sie Soldat waren, Lebensmittel und das nötige Geld geschickt,
und wenn ich nicht mehr da bin und er wird Soldat, muß er von seiner Sache zehren; und wenn er dann zurückkommt, hat er nichts
mehr."Wie herrlich ist der Wunsch meiner guten Mutter in Erfüllung gegangen! Sie hat meine Militärdienstzeit überlebt, mich dabei
unterstützt, auf meiner Hochzeit mit unserem Nachbar Nikolaus Schneider (genannt Schützennickel) recht flott getanzt, und ist bei der
Geburt und Taufe von zehn aus meiner Ehe stammenden Kindern zugegen gewesen.
III. Lehrzeit und Wanderjahre.
Nach meiner Konfirmation erlernte ich bei meinem Bruder August in Sulzbach das Metzgerhandwerk. Nach beendeter Lehrzeit, d. h.
Nach2½Jahren, ging ich, das Felleisen auf dem Rücken, als Handwerksbursche in die Fremde, auf die Wanderschaft, im Alter von
17 Jahren. Der erste Reisetag ging von Sulzbach nach Züsch im Hochwald, selbstredend zu Fuß. Automobile, elektrische Bahnen
usw. kannte man noch nicht. Und auch Eisenbahnen waren noch sehr vereinzelt und nur bei den größeren Städten und in den
Industriegebieten vorhanden, oder erst im Bau begriffen. Mit einem von der guten Mutter schwer bepackten Felleisen ging ich in
Gemeinschaft mit meinem zukünftigen Schwager Karl Kirst (den ich später noch erwähne und deßen Vater in Züsch eine
Bierbrauerei hatte; er war damals mit meiner Schwester Maria verlobt) nach Züsch. Nach zweitägigem Aufenthalt in Züsch ging ich
mit dem alten Vater Kirst, welcher in Trier gut bekannt war, nach Hermeskeil. Von da fuhren wir mit der Post bis Trier,
in der Hoffnung, dort bei einem Metzger Arbeit für mich zu finden. Meine und Vater Kirsts Bemühungen waren jedoch
vergeblich, und wir kehrten am anderen Tag wieder nach Züsch zurück Von dort wanderte ich durch den Hochwald nach
Birkenfeld, und von hier durch das Nahetal über Oberstein und Kirn nach Kreuznach. Von da gings über Simmern nach
Koblenz, ohne Arbeit zu finden. Nun wanderte ich den Rhein entlang nach Neuwied und Andernach und kam am
Silvesterabend 1852 in Remagen auf der Herberge an, wo einige zwanzig Handwerksburschen aus allen Gewerben vorhanden
waren. Ich war von allen der Jüngste und im Reisen wohl auch der Unerfahrenste. Die älteren, die sogen. Stromer oder
Landstreicher, denen es um Arbeit weniger zu tun war, sahen auch sofort an meinem schwerbepackten Felleisen, daß ich noch
nicht lange von Hause fort war und wohl auch noch einige Muttergroschen bei mir hatte. Mit größter Liebenswürdigkeit und
Zärtlichkeit umgaben sie mich; jeder wollte mein nächster und bester Freund sein. Da erhielt ich auch die erste Aufklärung
darüber, was man zu tun hat, wenn man das sogenannte Einstands - oder Eintrittsgeld (wie man es nannte) noch nicht bezahlt hat.
Die vorhandene Silvesterstimmung mag etwas dazu beigetragen haben, daß meine Freunde ihre Absicht, mir meinen
Geldbeutel etwas zu erleichtern, erreicht haben. Bald nach 12 Uhr, mit Beginn des neuen Jahres, suchte ich mein Bett auf. Die
Herbergen hatten damals große Schlafsäle, in denen je nach der Größe 10 bis 20 Betten standen. Ein anderer Raum war noch
nebenbei vorhanden, in dem nur Stroh als Nachtlager ausgebreitet war. Wer einen Groschen (12 &) hatte, bekam ein Bett (ohne
Sprungfedermatratze); wem dies zu teuer war, der legte sich aufs Stroh, was nur 5 & kostete. Man kann ja nicht sagen, daß
dieser Preis, auch für damalige Zeitverhältniße, ein hoher war, besonders wenn man noch dabei bedenkt, daß man die in den
Herbergen vorhandenen kleinen schwarzen Haustierchen, welche mitunter ein empfindliches Jucken verursachten, umsonst
mitbekommen hat. Bald nachdem ich zu Bett gegangen war, kamen auch die anderen an, die meisten in gehobener Stimmung, und
es gab im Saale eine recht lebhafte Unterhaltung, woran ich mich aber mit keinem Wort beteiligte.Alles zog sich aus und legte sich zu
Bett; der Herbergsvater löschte das Licht aus, aber die Unterhaltung dauerte noch eine Weile fort. Mit einem Male entstand
zwischen den zwei Hauptwortführern, zwei alten Stromern oder reisenden Wengthinern, ein Wortwechsel. Einer sagte zum
anderen: „Zu bist ja ein Kuhhorn!"Ich hatte diesen Ausdruck sonst noch nie gehört. Da entgegnete der Andere: „Was, Du
sagst, ich bin ein Kuhhorn?"und sprang aus seinem Bett auf den ersten los. Die beiden griffen sich an, rißen sich die
Hemden vom Leibe und schlugen so im Adamskostüm im Dunkeln kräftig mit den Fäusten aufeinander los. Der
Spektakel wurde derart groß, daß es der Herbergsvater hörte, mit dem Licht in den Saal trat und die Kämpfenden
auseinanderriß, mit dem Bemerken, daß er sofort die Polizei hole, wenn nicht augenblicklich Ruhe und Frieden geschloßen
werde. Die Drohung des Herbergsvater hatte gewirkt. Ich hatte mir während des Kampfes aus Angst die Decke über die Ohren
gezogen; der Eindruck aber blieb mir für immer unvergeßlich. Anderen Tags zog ich dann von Remagen nach Bonn und
Köln weiter. Ich war aber von da ab stets bemüht, die alten Handwerksburschen als Reisegefährten möglichst zu meiden und mich, wo
ich es nur konnte, den jüngeren anzuschließen. Auch in Köln fand ich keine Arbeit. Hierzu mag wohl der Umstand
beigetragen haben, daß ich bei der Umschau nach Arbeit den Meistern als zu jung und schwach erschienen bin. Von Köln
reiste ich über Düßeldorf nach Elberfeld und Barmen. Immer noch keine Arbeit! Auf der Herberge in Barmen lernte ich
einen Handwerksburschen keinen, welcher noch kleiner als ich aber älter war, und der das Schusterhandwerk erlernt hatte.
Mit diesem wanderte ich von Barmen aus allein. Die Reise sollte über Schwelm durch die Bergische Gegend über Hagen,
Dortmund, Bielefeld nach Minden führen. Auf der Straße von Barmen nach Schwelm, etwa eine halbe Stunde vor
diesem Ort, begegnete uns ein zweiräderiger Karren, welcher mit einem Esel bespannt war und von einem Jungen von 14 bis 15
Jahren geführt wurde. Ich sprach den Wagenführer an, ob er uns nicht bis Schwelm mitnehmen wolle. Er verneinte es. Ich
gab mich damit zufrieden, aber mein Reisegefährte nicht. Er sprang auf den Karren; aber der Junge hieb meinem
Schuster mit der Peitsche kräftig um die Ohren. Dieser erwiderte die Peitschenhiebe mit seinem Stock und traf den
Wagenführer s o schwer ins Gesicht, daß Mund und Nase blutete, worauf dann der Schuster den Karren eiligst wieder verließ. Nun
hieb der Junge auf seinen Esel los und fuhr im Galopp nach Schwelm zu. Als wir nahe an den Ort kamen, sahen wir den
Jungen mit einem kräftigen Manne uns entgegenkommen und mit dem Finger auf uns zeigen. Eine große Angst hatte mich
ergriffen, und es gab bei mir kein Halten mehr. Ich lief querfeldein, durch die Wiesen und Gärten um Schwelm herum, mein
Schuster ebenfalls; jeder von uns hatte aber eine andere Richtung eingeschlagen. Ich sah bald von meinen Verfolgern nichts
mehr und wurde dann etwas beruhigt. Ich dachte aber an meinen Schuster, wie es dem wohl ergehen werde. Aber auch dieser
war glücklich entkommen. Nach etwa zwei Stunden trafen wir uns jenseits Schwelm auf der Landstraße wieder und waren so
beide mit heiler Haut davon gekommen. Bis Minden reisten wir dann zusammen. Von da ging des anderen Reise nach
Osnabrück und ich wanderte über Bückeburg nach Hannover. Immer noch fand ich keine Arbeit, und hatte auch fast kein Geld
mehr. Die Muttergroschen gingen allmählich zu Ende. Ich war auf das angewiesen, was ich bei der Umschau nach Arbeit von
den Meistern oder sonst beim Fechten (wie man es nannte) erhalten hatte. Ich muß gestehen, es ging mir dabei immer leidlich
gut. Überfluß hatte ich nie, aber ich brauchte auch keinen Hunger zu leiden. Von Hannover reiste ich über Braunschweig,
Magdeburg, Potsdam nach Berlin, das ich mir als Reiseziel gesteckt und nun nach einer Reise von nahezu zwei Monaten erreicht
hatte. Nun war es aber die höchste Zeit, daß ich Arbeit bekam, sonst konnte ich von einer strengen Polizeibehörde .als
Landstreicher auf den Schub gebracht und nach meiner Heimat abgeschoben werden. Nur der Umstand, daß bisher in meinem Reisepaß
nichts Nachteiliges stand, hat mich davor bewahrt. In Berlin auf der Herberge angekommen, erinnerte ich mich, daß mein
Bruder August zehn Jahre früher in Charlottenburg als Metzgergeselle in Arbeit stand. Mein Bruder hatte mir oft davon
erzählt, und auch der Name des Meisters war mir noch erinnerlich. Lejeune hieß er; er war als Geselle aus Frankreich
nach Berlin gekommen und gründete später in Charlottenburg sein Geschäft. Dahin war denn auch mein erster Gang
gerichtet, und diesmal war es zu meiner großen Freude erfolgreich. Nach den Erzählungen, welche ich dem Meister Lejeune über
meinen Bruder August machte, konnte er sich deßen trotz der langen Zeit, besonders wegen seiner roten Haare, noch erinnern. Ich
wurde auf Probe mit dem geringsten Lohn von zwei Talern die Woche nebst Kost und Logis eingestellt. Damit war ich froh und
zufrieden. Ich hätte, wenn es nicht anders gegangen, die Stelle ohne Lohn, für Kost und Logis, nur um einmal Arbeit zu
haben, angenommen. Das Reisen auf der Landstraße hatte ich satt.
Glücklich und froh, einmal Arbeit gefunden zu haben, war es auch mein Bestreben, mir die Zufriedenheit des Meisters zu
erwerben. Das Metzgergeschäft von Lejeune war eins der größten, welche man damals kannte. Jede Woche wurden 120 bis 150
Schweine geschlachtet, wovon der größte Teil zu Wurst in allen Sorten verarbeitet werden mußte. Damit waren beständig 6 bis 8
Gesellen beschäftigt und ein Pferd in einem Göpelwerk hatte täglich Arbeit, das Fleisch für die Wurstfabrikation zu zerkleinern,
was man sonst gewöhnlich mit den Hack - oder Wiegemeßern tun mußte. Die Wurst von Lejeune in Charlottenburg war damals
berühmt; in alle Teile Deutschlands, selbst nach Rußland wurde sie in Kisten verschickt. Ich erinnere mich, daß auch Kisten
davon nach Luxemburg gingen. Nach einem Monat erhöhte mir mein Meister, ohne mein Verlangen, den Lohn auf 3 Taler die
Woche, ein Beweis, daß er mit mir zufrieden war. Und ich war stolz darauf, meine total zerrütteten Finanzen wieder auf einen
beßeren Stand zu bringen. In der Woche gab es keine Gelegenheit, Geld auszugeben. Von morgens 5 bis abends 9 Uhr dauerte die
Arbeit ununterbrochen, mit Ausnahme der Mittags und Vesperpausen, wobei Eßen und Trinken in sehr guter Beschaffenheit und
reichlich vorhanden war. GroßeAnforderungen stellte der Meister in der Arbeit, aber mit peinlicher Sorgfalt hat er auch darüber
gewacht, daß die Verpflegung gut und ausreichend war. Dienstags und Freitags, wo frische Blut - und Leberwurst gemacht
wurde, kamen wir nie vor12 Uhr zu Bett. Man könnte vielleicht diese Angaben oder deren Richtigkeit in Zweifel ziehen; es war
aber doch so. Was würden heute die Gesellen sagen„ wenn der Meister solche Anforderungen stellte? Gewiß haben sich die Zeiten
von damals verändert, aber die Menschen auch. Von einem Ausgange am Tage oder Abends an den Wochentagen war gar keine
Rede. Erst Sonntag mittag war die Arbeit beendet. Da erhielt man den verdienten Wochenlohn ausbezahlt und die Freiheit,
bis 12 Uhr abends auszubleiben. Sonntag mittags nach Tisch ging es dann sofort mit dem Omnibus für zwei gute Groschen
nach Berlin auf die Metzgerherberge. Es war üblich, daß die Gesellen, welche in Arbeit standen, den zugereisten Arbeitslosen eine
kleine Unterstützung gaben. Nachdem dies erledigt war, ging ich nach dem Invalidenhaus, wo die alten noch lebenden Veteranen aus den
Napoleonischen Kriegen untergebracht waren. Dort war auch ein Invalide mit Namen Philipp Klar, aus Dudweiler gebürtig,
welcher fast ganz erblindet war. Bei diesem Vater Klar oder Vetter Philipp, wie wir ihn nannten, war jeden Sonntag nachmittag
4 Uhr der Sammelplatz, an dem sich die aus der Umgegend von Saarbrücken bei der Garde in Berlin dienenden Landsleute
zusammenfanden, sofern nicht der eine oder andere dienstlich verhindert war. Vetter Philipp wußte stets ganz genau, wer
kommen konnte und wer auf Wache oder sonst abkommandiert und dadurch verhindert war. Aus Sulzbach waren damals in Berlin
bei der Garde Heinrich Pütz und Konrad David, aus Malstatt Philipp Ludt und noch einige andere aus der Umgebung von
Saarbrücken, deren Namen mir nicht mehr erinnerlich sind. Friedrich Leibenguth aus Neunkirchen fällt mir gerade noch ein.
Nachdem wir uns zusammengefunden und einander die aus der Heimat eingetroffenen Neuigkeiten erzählt und Vetter Philipp
von jedem seinen Bericht eingefordert hatte über das, was im Laufe der Woche paßiert war, suchten wir in der Nähe des
Invalidenhauses die bekannte Destillationskneipe von Nitsche in der Invalidenstraße mit Vater Klar auf. Hauptgetränk war zuerst
ein Kümmel mit „sein Bitter". Dann eine oder auch mehrere Flaschen Braunbier oder Berliner Weißbier. Wenn wir dann so etwa
zwei Stunden fröhlich beisammen geseßen und uns alles erzählt hatten, war die Zeit gekommen, wo Vater Klar heiter und froh
und auch manchmal etwas „unklar"wurde, und wir ihn dann nach dem Invalidenhaus zurück begleiten mußten. Hatten wir
ihn in seinem Heim wieder gut untergebracht, so verabschieden wir uns wieder auf acht Tage, und suchten dann
miteinander andere Vergnügungslokale auf und blieben auf diese Weise froh beisammen, bis die Zeit kam, wo die
Landsleute nach ihren Kasernen gingen und ich mit dem Omnibus meinen Weg wieder nach Charlottenburg
antreten mußte; so vergingen beinahe acht Monate, in welcher Zeit mir mein Gehalt vom Meister nochmals erhöht
war, und ich muß sagen, wir Landsleute haben damals recht fröhliche Sonntage zusammen verlebt. Aber trotz
meiner wiederholten Gehaltserhöhung habe ich doch keine großen Ersparniße gemacht.
Mit einem Male ereilte mich ein Mißgeschick. An einem Sonntagnachmittag als ich wie gewöhnlich zuerst die
Metzgerherberge in Berlin besuchte, war dort ein Agent aus Hamburg anwesend, welcher Metzgergesellen
anwerben wollte, um von Hamburg aus zur See auf den Walfischfang zu gehen. Zwei Jahre sollte der Vertrag und
die Reise dauern. Auch sollte viel Geld dabei verdient werden. Die Offerte war für mich sehr verlockend und ich
konnte diese Reise noch gerade abmachen, bevor ich mich zur Musterung für meine Militärdienstzeit stellen
mußte. Der mir in Außicht gestellte Verdienst und dabei keine Gelegenheit wie in Berlin zum Ausgeben,
gleichzeitig die Außicht, das Meer und die Welt zu sehen und kennen zu lernen, gefiel mir sehr; ich behielt mir
acht Tage Bedenkzeit vor. An demselben Sonntag nahm ich noch mit Vater klar darüber Rücksprache. Dieser riet
mir von dem Vorhaben ab, und ich versprach auch, den Plan fallen zu laßen. Der Gedanke, auf den Walfischfang
zu gehen und viel Geld dabei zu verdienen, ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Endlich entschloß ich mich, meine
Stelle in Charlottenburg aufzugeben und mein Glück auf dem Walfang zu suchen. Ich sagte dem Agenten zu und
14 Tage später sollte ich mich in Hamburg auf der Metzgerherberge stellen. Meine Arbeit in Charlottenburg
konnte ich erst nach achttägiger Kündigung verlaßen.
Nun war mein Kaßenbestand zwar noch etwas höher, als für die Eisenbahnfahrt von Berlin bis Hamburg
erforderlich war, aber nicht ausreichend für meine Ausrüstung zur See. Vorsichtshalber schrieb ich deshalb meiner
guten Mutter einen Brief, in welchem ich ihr mein Vorhaben mitteilte, und sie bat, jedoch umgehend einen Brief
mit Geld für meine nötige Ausrüstung zur See nach Hamburg an meine Adreße (Metzgerherberge) senden zu
wollen. Selbstverständlich habe ich dabei scharf betont, daß ich das Geld nach meiner Rückkehr von der Reise
wieder auf Heller und Pfennig zurückerstatten würde. Meine Stelle in Charlottenburg hatte ich inzwischen
gekündigt. Als die acht Tage um waren, verließ ich meinen Platz, auf welchem ich mich über sieben Monate recht
wohl befunden hatte, nahm Abschied von Vater Klar und den übrigen Landsleuten und reiste per Bahn nach
Hamburg.
Auf der dortigen Herberge angekommen, war meine erste Frage, ob ein Brief für mich da sei, was aber verneint
wurde. Ich tröstete mich in dem Gedanken, daß es kaum acht Tage her sei, seit ich geschrieben hatte, und daß es
ein weiter Weg von Charlottenburg bis Sulzbach und von da wieder nach Hamburg sei. Auch hatte ich noch sechs
Tage Zeit, bis der Walfischdampfer abgehen sollte. daß mir meine gute Mutter die Bitte um Geld (welches ich ja
wieder zurückzugeben versprochen hatte) abschlagen würde, hatte ich nicht angenommen. Endlich am dritten Tag
kann der heiß erwartete Brief auf meiner Herberge an, zu meinem größten Schrecken aber ohne Geld. Mein
ältester Bruder Fritz schrieb mir im Auftrage meiner Mutter, daß ich für diesen Zweck kein Geld bekäme.
Schwere Vorwürfe machte mir mein Bruder, die ich hier nicht alle wiedergeben kann, und ich glaube auch daß er
in dieser Hinsicht mehr geschrieben und mir mehr vorgehalten hat, als er von meiner Mutter beauftragt war. Ein
paar Worte oder Zeilen aus diesem Briefe will ich aber doch hier anführen. Unter anderem hieß es da: „Du
Lausbub, was fällt dir ein, Du willst auf den Walfischfang gehen, keinen Pfennig Geld bekommst Du mehr.
Komme nach Haus und wenn Du zurück bis Koblenz kommst, sollst Du dort bei Karl Kahl Geld haben. Willst Du
dann noch nicht nach Haus gehen kannst Du dir in der Schweiz oder Frankreich Arbeit suchen“. Karl Kahl,
welcher in Koblenz Soldat war, war der Bruder von Heinrich Kahl, einem Nachbar von uns in Sulzbach. Nachdem
ich den Brief gelesen hatte, stand ich ratlos da. Was anfangen? Geld für meine Ausrüstung zur See hatte ich nicht
mehr. Was nun? Selbstständig für mich schon zu arbeiten, war ich noch zu jung. Auch stand mir hierin meine
Militärdienstzeit hindernd im Wege. Ich war gesund und mit keinem Fehler behaftet, welcher mich davon befreit
hätte. Da reifte bei mir der Gedanke, zu Oktober freiwillig als Soldat einzutreten. Ich konnte mir dann ein
Regiment außuchen, wo es mir gefiel. Kavallerist wollte ich werden und so entschloß ich mich, nach Haus zu
gehen und mir die Erlaubnis zum freiwilligen Eintritt bei meiner Mutter einzuholen. Das GardedragonerRegiment hatte ich mir schon dazu ausersehen.
Es gab damals nur ein Gardedragoner-Regiment; das zweite kam erst später hinzu. Nach ein paar Tagen
Aufenthalt in Hamburg verringerte sich mein Bestand wieder recht bedenklich, und bevor ich nach Koblenz kam,
war keine Außicht, von Haus etwas zu erhalten. Vor dem 1. Oktober konnte ich aber auch nicht freiwillig
eintreten. Da trat ich denn wieder zu Fuß von Hamburg aus die Rückreise an, mit dem Gedanken, wenn ich
unterwegs eine paßende Stelle fände, diese auf 6-7 Wochen anzunehmen, bis der 1. Oktober herankäme, und in
diesem Falle mir die Einwilligung meiner Mutter zum freiwilligen Eintritt per Post schicken zu laßen.
Meine Reise ging von Hamburg nach Bremen. Dabei kam ich durch eine Landstrecke, welche unter dem Namen
„das alte Land“ bekannt war. Daselbst war ein sehr wohlhabender Bauernbestand und eine in jeder Hinsicht
blühende Landwirtschaft vorhanden. Es wurde darum auch diese Strecke von den reisenden Handwerksburschen
aus triftigen Gründen vorgezogen. Einer sagte es dem anderen, daß das Fechten dort sehr ergiebig sei. Wer dort 67 von den größeren Bauerngütern seinen Besuch abgestattet hatte, konnte von dem Ergebnis sich einen Tag
respektive eine Nacht auf der Herberge durchschlagen. Auf dieser Wanderung paßierte mir ein Abenteuer, das ich
hier anführen muß. Die vereinzelt liegenden Bauernhöfe haben alle auf der Giebelseite des Hauses ihren Eingang.
Man kommt beim Eintritt zuerst auf eine große Tenne; auf beiden Seiten derselben sind die Viehställe, dann
kommt man zur Küche und von da erst ins Wohnzimmer. Eines Tages, als ich eines dieser Gehöfte mit meinem
Besuche beehren wollte und die Tür zum Eintritt öffnete, lag dicht an der Tür ein kurz vorher gestorbener alter,
langer, hagerer Mann auf seinem Totenbett aufgebahrt, nur mit seinem Totenhemd bekleidet, sonst nichts bedeckt.
Er mußte kurz vorher erst dort aufgebahrt worden sein; ich hörte die Angehörigen noch weinen und schluchzen.
Den Schreck, der mir in die Glieder fuhr, als ich die Tür öffnete und die Leiche vor mir liegen sah, kann ich nicht
schildern. Die Haare standen mir zu Berge und rückwärts schwankend schlug ich die Türe zu. Das Fechten war
mir für diesen Tag vergangen, und ich steuerte geraden Wegs nach Bremen zu, wo ich anderen tags den berühmten
Bleikeller sah. Von Bremen ließ ich mir meinen Reisepaß über Osnabrück nach Münster in Westfalen visieren.
Mit fünf anderen Handwerksburschen, worunter zwei Sach- und ortskundige Stromer, trat ich die Reise von
Bremen aus an. Nicht weit von Bremen, im Oldenburgischen, liegt abseits der Hauptstraße, etwa eine halbe
Stunde davon entfernt, ein kleines Landstädtchen, Wildeshausen. Das sagte einer von den alten: „in diesem
Städtchen ist heute Viehmarkt; da kommen die Bauern von außerhalb zu Markt und das Fechten ist dort sehr
lohnend.“ Es wurde beschloßen, den Marktplatz abzuklopfen, obschon es verboten war, von der vorgeschriebenen
Reiseroute (der Hauptstraße) abzuzweigen. In dem Städtchen angekommen, wurde auch sofort mit der Umschau
begonnen und es ging wirklich gut. Es dauerte nicht eine Stunde, da hatte ich beinahe einen Taler beisammen.
Nach Verabredung sollten wir wieder in einer bestimmten Wirtschaft in dem Orte zusammentreffen. Als wir
zusammenkamen, war ich einer von denen, die mit die besten Geschäfte gemacht hatten. Die erwähnten Führer
bestellten sogleich Karten und das Spiel mußte begonnen werden. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Die Kunden
hatten mir schneller mein Geld wieder abgenommen, als ich es zusammen gefochten hatte. Da entschloß ich mich,
noch einmal Umschau zu halten, nach einer Richtung hin, wo ich vorher nicht war. Auch beim zweiten Male ging
es gut; aber die Strafe folgte mir auf dem Fuß. Ein Polizist wurde inzwischen auf mich aufmerksam. Ich ging in
ein Wirtshaus und sprach als reisender Handwerksbursche um eine kleine Unterstützung an. An einem runden
Tische saßen einige Bauern in heiterer Stimmung beim Kartenspiel. Einer davon rief mir zu, an den Tisch
heranzukommen, was ich gerne befolgte. Nachdem sie mich ausgefragt hatten, wo ich her sei und hin wolle und
so weiter, wunderten sie sich, daß ich noch so jung und klein doch schon eine so große Reise gemacht habe. Ich
begann zu eßen und zu trinken. Einer machte den Vorschlag, noch den Teller umgehen zu laßen und für mich zu
sammeln, was auch geschah. Dabei erhiehlt ich mehr als das Doppelte wieder was ich vorher beim Kartenspiel
verloren hatte, und hatte noch dabei gegeßen und getrunken. Mit Dank und Händedruck verabschiedete ich mich
von meinen Wohltätern; am Ausgänge gab mir die Wirtin noch10 &, die ich auch noch dankend annahm, worauf
ich aus dem Haus auf die Straße trat. Da stand der Polizist, welcher mich beobachtet hatte, und kam auf mich los
mit den Worten: "Was haben Sie hier gemacht?"(Das Fechten außer bei den Meistern war verboten.) Ich sagte:"ich
habe hier einen Schnaps getrunken, die Wirtin gab mir noch 10 & heraus, die ichnoch in der Hand habe"und
zeigte sie. Die gute Frau sah und hörte was der Polizist mit mir redete und bestätigte meine Außage. Der Polizist
ging mit mir die Wirtschaft zurück, und auch die Bauern riefen:"Der hat hier nicht gefochten"und winkten mir zu,
an ihren Tisch zu kommen. Da sagte der Polizist zu mir: "zeigen Sie mir Ihr Wanderbuch"dagegen gab es keine
Ausrede; dies mußte ich zeigen. Als er darin mein Visa gesehen hatte, sagte er zu mir:"Sie sind von der
vorgeschriebenen Reiseroute abgewichen!Und steckte mein Buch ein mit den Worten: „Kommen Sie mit zur
Plizei“.; Sie bekommen achtzehn Stunden Arrest!“ Die Bauern schrien: "nein, der geht nicht mit, der hat hier nicht
gefochten."Der Polizist, wohl wißend daß ich ohne Buch nicht reisen konnte und ihm nachkommen müße, verließ
das Lokal und ging zur Polizei. Es blieb mir nichts übrig, als nachzugehen. Dort saß mein Richter, ein
altehrwürdiger Greis mit schneeweißen Haaren. Der Polizist sagte nur die Worte: "das ist der Mann."Darauf sagte
der Richter zu mir: „Sie haben hier gefochten und sind von der Hauptstraße der vorgeschriebenen Reiseroute
abgewichen; sie bekommen 18 h Arrest“. Das Arrestlokal war im Polizeigebäude, und nach ein paar Minuten saß
ich hinter Schloß und Riegel. Das Lokal war mit einer hölzernen Pritsche ausgestattet, worauf ein Strohsack lag
und eine wollende Decke, zum Zudecken. In dieser Hinsicht konnte es den Vergleich mit dem Nachtlager der
damaligen Herbergen ganz gut bestehen. Abends bekam ich eine Portion gute Suppe mit weißem Käse und Brot,
am anderen Morgen Kaffee mit Brot. Gegen 10:00 Uhr morgens wurde ich befreit und erhielt mein Wanderbuch
ausgehändigt; zu meinem großen Schrecken lese ich darin die Bemerkung: „Inhaber war hier wegen Bettelns und
Abweichens von der Reiseroute mit 18 stündigem Gefängnis bestraft und wird über die Grenze gewiesen“. Nun
konnte man ja damals an einem Tage über die Grenzen von zwei und drei Herren Länder kommen und konnte mit
einem solchen Visa nicht weiterreisen. Wenn man damit an eine neue Grenze kam, wurde man zurückgewiesen. In
meiner schwierigen Lage ging ich zu meinem Richter und stellte ihm meine Lage vor, daß ich mit diesem Visa
doch nicht weiterreisen könne; in zwei, drei Stunden sei ich an der Hannoverschen Grenze und würde, wenn ich
dort ankäme, wieder nach Oldenburg zurückgewiesen werden. Es schien mir, daß meine Vorstellung etwas
Eindruck auf den guten alten Herrn machte. Er fragte mich nach allem näher aus, und als er hörte, daß ich nach
Hause wollte, strich er das Visa in meinem Wanderbuch wieder aus und schrieb folgendes: „Da der Inhaber einige
Entschuldigung verdient, und er nur um Eßen gebeten hat, wird ihm seine Reiseroute von hier über Osnabrück,
Münster nach seiner Heimat weiter visiert.“ Auch zeigte ich ihm Reisegeld vor; es war dies das Geld, das tags
zuvor von den Bauern im Wirtshaus für mich gesammelt worden war, und er setzte dem Visa noch hinzu: „Ist mit
Reisegeld versehen“. Damit war ich dann wieder auf freiem Fuß und konnte ungehindert weiterreisen. Von
meinen Reisegefährtin von Tags zuvor habe ich nichts mehr gesehen, habe es aber auch von da ab nie mehr
gewagt, von der vorgeschriebenen Reiseroute abzuweichen. Nun gings gerade aus über Osnabrück nach Münster.
Um Arbeit für kurze Zeit war es mir jetzt nicht mehr zu tun. Das Reisen war ich müde und wollte nach Haus. Das
unfreiwillige Nachtquartier in Wildeshausen hatte einen starken Eindruck auf mich gemacht. Von Münster gings
durch Westfalen nach Iserlohn, Siegburg und dem Rhein zu. In Siegburg bekam ich bei der Umschau von einem
Meister, welcher sich nach meiner Heimat und meiner Reise genau erkundigt hatte, ein Fünfgroschenstück.
Darüber war ich hocherfreut und glücklich; denn ein Fünfgroschenstück war damals bei mir von einer großen
Bedeutung. Von Siegburg war dann Koblenz bald erreicht, wo ich den schon erwähnten Karl Kahl aufsuchte,
welcher mit 10 Taler von meiner guten Mutter aushändigte. Angesichts dieses Vermögens legte ich den
Wanderstab als Handwerksbursche nieder. Die Rückreise von Koblenz nach Sulzbach legte ich auf dem kürzesten
und schnellsten Wege zurück. Mein Felleisen war bei der Ankunft in Sulzbach nicht mehr so schwer als beim
Fortgange. Aber dennoch war meine und meiner Mutter Freude groß, als wir uns wieder sahen.
IV. Meine Militärdienstzeit.
Mit meinem Plan, zu Oktober Soldat zu werden, wollte sich meine selige Mutter nicht gleich einverstanden
erklären. Doch habe ich es schließlich bei ihr durchgesetzt, daß sie ihre Einwilligung dazu gab. Nachdem ich etwa
14 Tage aus der Fremde zurück war und alles geordnet hatte, gings diesmal per Bahn direkt nach Berlin, wo ich
um Mitte September eintraf. Mein erster Gang war anderen Tages zu meinem Meister nach Charlottenburg.
Diesem erzählte ich dann, aus welcher Ursache ich von ihm fortgegangen, wie es mir dabei ergangen und daß ich
jetzt die Absicht hätte, zum 1. Oktober bei den Gardedragonern freiwillig einzutreten. Dabei hatte ich aber noch
einen anderen Gedanken im Auge. Für den Fall nämlich daß ich nicht als Soldat angenommen wurde, wollte ich
wieder bei ihm in Arbeit treten. Vom Walfischfang wollte ich nichts mehr hören. Meister Lejeune nahm mich sehr
freundlich auf; seine Frau war inzwischen gestorben. Eine erwachsene Tochter (Elise ließ sie) führte den Haushalt.
Der Meister rief diese mit den Worten in den Laden hinein: "Elise, komm mal herein, der kleine Rheinländer ist
wieder da."Anders wurde ich nicht genannt, solange ich dort in Arbeit war. Beim Militär bin ich erst gewachsen
und stehe jetzt mit 186 Meter in den Stiefeln. Mein Besuch war von Erfolg und ich bekam die Gewißheit, wenn
ich als Soldat nicht angenommen wurde, könnte ich in meine frühere Stelle wieder eintreten. Dies war mir eine
große Beruhigung. Darauf gings dann zu Vater Klar nach dem Invalidenhaus, wo meine unerwartete Ankunft
große Freude verursachte. Ich erzählte, wie es mir seither ergangen, und daß ich nun entschloßen sei, am 1.
Oktober bei den Gardedragonern freiwillig einzutreten. Vater Klar sagte mir sogleich, daß es jetzt wohl zu spät
sei, die Anmeldungen dazu müßten viel früher geschehen."aber,"setzte er hinzu, "der Prinz Friedrich Karl ist
Oberst vom Gardedragoner-Regiment und liebt die Rheinländer. Er hat 1849 eine Schwadron von den 9. Husaren
kommandiert, mit dieser bei Waghäusel ein Karree von den Freischaren gesprengt, wobei er verwundet wurde; da
gehe hin, ich glaube, der nimmt dich doch noch an, wenn es auch spät ist. Der Prinz ist aber ein strammer Soldat,
und wenn Du bei ihm vorgelaßen wirst, dann stelle dich stramm und gerade mit zugeknöpftem Rock vor ihn und
beantworte seine Frage laut und herzhaft, mit der Anrede Königliche Hoheit und so weiter."Der Prinz wohnte in
der Lindenstraße No. 3. Als geeignete Sprechstunde bezeichnete mir Vater Klar die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr
mittags. Darauf suchte ich dann noch die schon genannten Landsleute in ihren Kasernen auf und teilte auch diesen
mein Vorhaben mit.
Einige davon hatten nur noch 14 Tage zu dienen, um dann in die Heimat zurückzukehren. Doch kam von dort
auch bald wieder neuer Ersatz. Mit etwas Herzklopfen suchte ich dann anderen tags die Wohnung des Prinzen
auf. Auf mein Klingeln kam ein Bursche und fragte, was ich wünsche. Ich erzählte ihm mein Vorhaben. Dieser
sagte dann zu mir: "kommen Sie mit auf meine Stube; der Prinz kann jeden Augenblick kommen und wenn er
die Treppe herauf kommt, dann stellen Sie sich gerade und zugeknöpft hin."Nach etwa einer halben Stunde
klingelte es und der Bursche sagte zu mir: "jetzt kommt der Prinz."Ich trat heraus und tat, wie ich instruiert war.
Der Prinz, eine lebhafte, feurige Gestalt, kam die Treppen herauf (er wohnt im ersten Stock) und redete mich mit
den Worten an: "was wünschen Sie?"ich erwiderte:
"Königliche Hoheit, ich möchte am 1. Oktober freiwillig bei den Gardedragonern eintreten."der Prinz erwiderte:
"ja, sie kommen aber zu spät, das Regiment ist vollzählig."Ich stand still und stramm da, ohne ein Wort weiter
sagen zu können. Da sagte der Prinz zu mir: "was sind Sie für ein Landsmann?"ich sagte: "ein Rheinländer, bei
Saarbrücken zu Haus."Da erwiderte der Prinz: "da bin ich auch schon gewesen,"und zu dem Burschen sich
wendend, "gehen Sie mit dem Mann zum Rittmeister von der 4. Schwadron, vielleicht stellt sie der noch
ein."Der betreffende Rittmeister (von Krosigk hieß er) wohnte ein paar Häuser von Prinzen entfernt in derselben
Straße. Als ich mit dem Burschen die Treppe hinab ging, rief der Prinz noch: "wenn sie dort nicht angenommen
werden, kommen sie wieder her."Bei Herrn von Krosigk angekommen, erzählte ich mein Vorhaben. Derselbe
erwiderte mir sofort: "viel zu spät. Meine Schwadron ist vollzählig, sie hätten sich wenigstens drei Monate
früher melden müßen."Niedergeschlagen von diesem Bescheid, den ich noch dazu nicht in höflichem, sondern
recht barschem Ton erhielt, dachte ich schon daran, nach Charlottenburg in Arbeit zu gehen, bis ich mich zum
Militärdienst stellen mußte. Da sagte der Bursche zu mir: "sie sollen ja wieder zum Prinzen mit zurückkommen,
wenn sie da nicht angenommen werden,"und ich ging auf deßen Zureden wieder mit ihm zurück. Der Bursche
trat beim Prinzen ein; ich blieb vor der Tür stehen. Nachdem der Bursche berichtet hatte, schrieb der Prinz einen
Zettel, den er dem Burschen ohne Kuvert übergab, mit den Worten: "gehen sie wieder mit dem Mann zum
Rittmeister von Krosigk und geben Sie den Zettel ab."Unterwegs gab mir der Bursche den Zettel, darauf stand:
"ich wünsche, daß der Schlächtergeselle Joh. Zeitz angenommen wird. Frdr. Carl."Als der Rittmeister den Zettel
gelesen hatte, sah mich an und sagte: "wenn se. Königliche Hoheit wünscht, kann ich nichts dawider haben;
kommen Sie am 1. Oktober."Damit war denn soweit mein Ziel erreicht. Ich stellte mich am 1. Oktober, wurde
bei der Untersuchung für tauglich befunden und trat dieser Tage (1853) meine Militärdiensteit im Alter von 18
Jahren an. - Erst nach Verlauf von vier Wochen durfte die Rekruten ausgehen. Inzwischen erhielt ich in meiner
Kaserne Besuche von meinen Landsleuten. Mein erster Ausgang als Soldat war dann selbstverständlich zu Vater
Klar. Meine Dienstzeit verlief im Ganzen gut. Meine gute Mutter sorgte dafür, daß ich keine Not zu leiden hatte,
und ihr an meinem Konfirmationstage geäußerte Wunsch ging in Erfüllung. Einmal wurde ich bestraft, und
diese Strafe war die ungerechteste, welche ich in meinem Leben erhielt. In meinem zweiten Dienstjahr, als das
Schwadron exerzieren auf dem Tempelhofer Feld begonnen hatte und wir in Schwadronsfront in zwei Gliedern
den ersten Galopp in diesem Frühjahr machten, ging ein Pferd aus dem zweiten Glied durch das erste Glied
durch, ohne daß es sein Reiter halten konnte, und kam in die Nähe des Rittmeisters. Dieser war als ein sehr
strenger Herr, aber wenig guter Reiter bekannt. Der Rittmeister sprengte auf den Durchgänger los (Petri hieß der
Dragoner, aus Moselweiß bei Koblenz) und schrie, den Säbel zum Hieb in der Hand: "Kerl, wollen sie Ihr Pferd
parieren!"Petri tat, was er konnte, es half aber nichts. Die "Rabe", so hieß das Pferd, ließ sich nicht halten. Es
war eines der besten und dauerhaftesten Pferde in der Schwadron, aber unbändig beim Reiten. Der Rittmeister,
immer den Säbel schwingend und rufend: "Parieren sie, "schlug mit einem Male dem Pferd vor der Front mit
seinem Säbel über die Nase. Die Klinge sprang am Griffe weg und fiel zu Boden, so daß der Rittmeister nur
noch den Griff in der Hand hatte. Sein Zorn stieg dabei auf das höchste und kannte keine Grenzen mehr.
Natürlich lachte alles, und ich auch. Ich ritt im ersten Glied und Herr von Krosigk sah mich lachen. Er sprengte
mit seinem Säbelgriff in der Hand auf mich los mit den Worten: "Kerl, wie können Sie mich auslachen? 48
Stunden Mittelarrest!"Keinen Laut durfte ich erwidern, und als wir vom Exerzieren zurückkamen, stellte ich
mein Pferd in den Stall und wurde vom Unteroffizier Du jour sofort nach dem Militärgefängnis abgeführt. Ich
weiß und jeder wußte es, daß die ganze Schwadron gelacht hatte, und wer lacht bei einem solchen Falle nicht?
Aber die ganze Schwadron einstecken, ging doch nicht; daher mußte ich der Sündenbock sein. Aber für das, was
ich begangen hatte, war die Strafe doch zu hart. In Schwadronsbefehle sagte der Rittmeister, daß ich wegen
Unaufmerksamkeit beim exerzieren diese Strafe erhielt. Es war dies die einzige Strafe in meiner Dienstzeit. Ich
will aber damit nicht behaupten, da ich sonst keine Strafe verdient gehabt hätte, und führe gleich ein Beispiel
dafür an. Mein langjähriger Freund Fritz Reinhold, der spätere Besitzer des Rheinischen Hofes in Saarbrücken,
diente bei der 3. Schwadron der Gardehusaren in Potsdam. Wir besuchten uns des Sonntags öfters. Das eine Mal
kam er nach Berlin, das andere Mal fuhr ich nach Potsdam. Reinhold war ein Jahr vor mir eingetreten. Das
größere Kavallerie-Exerzieren fand damals alljährlich in Berlin auf dem Tempelhofer Feld statt. Dazu kamen die
Kavallerieregimenter von Potsdam nach Berlin und wurden in den Ortschaften der nächsten Umgebung von
Berlin einquartiert. Eines Tages, ich war gerade auf Stallwache, bekam ich einen Brief von Reinhold."Wir sind
heute hier in Steglitz eingetroffen," schrieb er."Heute ist mein Geburtstag, Du würdest mir eine große Freude
machen, wenn Du mich hier besuchen würdest; wir wollen dann meinen Geburtstag lustig feiern" und so weiter.
Steglitz war etwa 2 Stunden von Berlin entfernt; heute gehört es zu Berlin. Ich war, wie schon gesagt, auf
Stallwache, und hätte gern dem Wunsche meines Freundes entsprochen. Was nun tun? Ich redete mit einem
guten Kameraden meiner Stube, Gustav Comberg aus Wülfrath; dieser löste mich auf Stallwache für diese Nacht
ab bis zum anderen Morgen, wo die Schwadron im Stalle sein mußte. Meinen Stallanzug legte ich auf der
Kasernenhofwache nieder, und mit meinem Extraanzug gings gegen Abend flott nach Steglitz. Mein guter Fritz
hatte, als ich dort ankam, die Trompeter seiner Schwadron, fünf Mann, mit einigen seiner Kameraden in einer
Wirtschaft versammelt, wo lustig gespielt und getrunken wurde. Reinhold war über meine Ankunft hocherfreut.
Nicht lange dauerte es, da kamen die Bauernmädchen vor die Wirtschaft, ohne Sonntagstoilette, mit
Holzkantinen (Holzschuhen) an ihren Füßen. Wir engagierten zum Tanz, und lustig ging das Tanzen los. Wenn
die Holzschuhe dabei von den Füßen flogen, dann ging es auf den Strümpfen weiter. Eine lustige Nacht wurde dabei
verlebt, an die ich und Reinhold uns später noch öfters erinnerten. Frühmorgens, als es höchste Zeit für mich war, brach ich
auf; ich sollte da sein, bevor die Schwadron im Stalle war. Niemand wußte von meiner Abwesenheit, als mein Kamerad
Comberg und mein Berittsunteroffizier Mallin. Ich glaube, meine Uhr war etwas nachgegangen. Als ich an der
Kasernenwache ankam, hatte es schon geblasen und die Schwadron ging in den Stall. Ich zog mich rasch um, legte den
Stallanzug an und ging an die Düngergrube, wo der Pferdemist niedergelegt wurde. Die Stallwache hatte den Auftrag, dafür zu
sorgen, daß nicht viel trockenes Stroh mit in die Grube kam; dieses sollte für die Streu den Pferden erhalten bleiben. An der
Düngergrube beschäftigte ich mich dann fleißig mit dem Außuchen von Stroh, als gerade mein Wachtmeister Fiehweger vorbei
nach dem Stalle ging. Dieser sagte zu mir: „So Zeitz, das ist recht." Darauf ging ich dann schnell nach dem Stall, daß mich
mein Berittsunteroffizier zu sehen bekam. Dieser war in größter Angst und glaubte, es könnte mir etwas paßiert sein und er hatte
keine Meldung gemacht. So verlief diese Sache glatt und gut; aber ich hätte dafür doch eher Strafe verdient, als bei dem
anderen Falle. Als die Hälfte meiner Dienstzeit um war, ließ meine Mutter durch eine Reklamation beim Regiment um einen
Urlaub von vier Wochen für mich nachsuchen, welcher mir auch bewilligt wurde. Der Schwadronschef konnte nur vierzehn
Tage geben, und dies war für die weite Reise, die man damals nicht so schnell wie heute machen konnte, zu wenig. An einem
schönen Tage wird beim Appell der Regimentsbefehl verlesen: "der Dragoner Zeitz wird auf vier Wochen nach seiner Heimat
beurlaubt." Der Wachtmeister bemerkte mir gleich dabei: "Sie können sich auch einen Geldbrief bei mir abholen." Meine
Freude war unbeschreiblich. Noch am Abend wurden die Landsleute und selbstredend auch Vetter Philipp aufgesucht und
das große Ereignis mitgeteilt; dann trat ich am anderen Morgen die Reise nach der Heimat an. Drei volle Tage hatte ich bis
Sulzbach dazu nötig. Als ich dort ankam, war überall Freude in der Familie, und meine gute Mutter war sehr besorgt, wie sie
mir meine Urlaubszeit angenehm machen könnte. Meine Paradeuniform, die mir auf den Urlaub mitgegeben war, wurde
überall sehr bewundert; ich war aus dortiger Gegend der einzige, der bei meinem Regiment stand, worauf ich nicht wenig
stolz war. Meine Schwester Maria war inzwischen verheiratet und wohnte in Züsch, und auch dort mußte ich meinen Besuch
machen. Züsch war von Sulzbach 10 Stunden entfernt und konnte nur mit einer starken Tagesreise erreicht werden.
Eisenbahnen gab es in dortiger Gegend noch nicht. Für die Reise dahin stellte mir mein Bruder Heinrich ein gutes kräftiges
Reitpferd (Schimmel) zur Verfügung. In meiner Paradeuniform, mit weißem Haarbusch, bestieg ich daßelbe und ritt über
Quierschied, Merchweiler, , Illingen, Dieringen, Tholey nach Züsch zu. In den Ortschaften, durch die ich kam, liefen die
Leute zusammen. Niemand wußte, was das für ein Reitersmann war. In Dirmingen standen zwei Männer beisammen. Als ich
an Ihnen vorbei war, hörte ich, wie einer zum anderen sagte: "das ist ein bayerischer General." Meine hellblaue Uniform,
gelbe Litzen am Kragen, weißer Haarbusch auf dem Helm, das alles mag sie auf den Gedanken gebracht haben. Mir schwoll
natürlich darüber der Kamm und ein stolzes Gefühl bemächtigte sich meiner, so daß sich selbst nicht mehr recht wußte, ob
die Bauern recht oder unrecht hatten. Kaum eineinhalb Jahre Soldat, und es schon so weit gebracht, mußte ich mir sagen,
soweit wärst Du in dieser Zeit auf dem Walfischfang doch nicht gekommen. Inzwischen kann ich abends nach
zehnstündigem Ritt wohlbehalten bei meiner Schwester an, wo ich in diesem kleinen, abgelegenen Hochwald wiederum
großes Aufsehen verursachte. Nach dreitägigem Aufenthalt wurde dann wieder die Rückreise angetreten; am selben Tage
kam ich auch wieder wohlbehalten in Sulzbach an. So vergingen die Urlaubstage gar zu schnell. Der Tag, an welchem ich
wieder die Rückreise nach Berlin antreten mußte, war mir und auch meiner guten Mutter schwerer als der Tag, an welchem
ich fortging, um freiwillig einzutreten. Als ich nach meinem Urlaub in Berlin wieder rechtzeitig eingetroffen war, gings im
alten Geleise weiter. Ich muß sagen, daß ich in meinem ganzen Leben nie eine schönere und sorgenlosere Zeit verbracht
habe, wie meine Militärdienstzeit. Eines Tages, im Frühjahr 1855, rückten wir vom Regimentsexerzieren in die Kaserne ein,
an der Spitze des Regimentes, wie immer, der Kommandeur Prinz Friedrich Karl. Als die Schwadronen in die Stallungen
eingerückt waren, wurde schrittweise durch den Stall gerufen: "die Mannschaften schwadronsweise im Kasernenhof antreten,
der Prinz nimmt Abschied vom Regiment!" Der Prinz zu Pferde ritt vor jede Schwadron, die sich im Halbkreis um ihn
aufstellte, mit den Worten: "seine Majestät haben mich zu einem höheren Kommando berufen, und ich nehme Abschied vom
Regiment. Sollte jemals einer von euch meine Hilfe nötig haben, so mag er sich an mich wenden. Adieu Dragoner!" Dem
Wachtmeister sowie den Unteroffizieren reichte er jedem die Hand. Damit hatte das Regiment einen Kommandeur verloren,
wie ihn wohl ein zweites Regiment in der Armee nicht hatte. Dienstlich war er sehr streng; zur Zeit, wo die Rekruten
eintraten, kann er wenigstens zweimal wöchentlich, nachmittags während der Putzstunde in die Stallungen. Alsbald hieß es
dann: "Berittweise die Rekruten vortreten!" Diese stellten sich hinter ihre Pferde, Striegel und Kartätsche in der Hand, im
Stallanzug, stramm und gerade auf. Der Prinz fragte jeden nach seinem Namen, Stand und Geburtsort. Nach kurzer Zeit
kannte er alle mit Namen. Ja, in dieser Hinsicht hatte er eine ganz erstaunliche Gedächtnisgabe. Wenn er beim Exerzieren
einen Fehler sah, ob von Unteroffizieren oder Mannschaften, rief er die betreffenden mit Namen. Er kannte wirklich sein
ganzes Regiment. Es mag dies manchem etwas übertrieben scheinen; aber es war so. So wie er stets in scharfer Gangart
geritten, so ist er auch gefahren. Wie der Blitz saust er durch die Straßen. Die Instruktion lautete, daß das Militär vor
königlichen Equipagen Front zu machen habe, auch wenn man nicht weiß oder bei bedecktem Wagen sehen kann, ob er
besetzt ist. Und so ist es auch vorgekommen, daß der Prinz in scharfer Gangart an einem Dragoner in geschloßenem Wagen
vorbeifuhr, ohne daß der betreffende es gemerkt hatte. Aber dem Prinzen mit seinem scharfen Auge ist er nicht entgangen; ja,
es ist vorgekommen, daß, ehe der FDragoner in seine Kaserne zurückkam, seine Strafe (48 Stunden Mittelarrest) schon vor
ihm dort eingetroffen war und er sofort nach seinem Eintreffen abgeführt wurde. Nach Verbüßung der 48 Stunden mußte sich
der Bestrafte beim Prinzen aus Arrest zurückmelden. Da sagte er dann regelmäßig: "ich habe Sie nicht bestraft, weil Sie mich
nicht gegrüßt haben; ich habe Sie bestraft, weil ich nicht haben will, daß einer meiner Dragoner als unaufmerksame
Schlafplätze auf der Straße herum geht." So streng aber wie der Prinz im Dienste war, so streng wachte er auch darüber, daß
die Verpflegung der Mannschaften eine möglichst gute war, und kümmerte sich persönlich darum. War er in Berlin, so kam
er jede Woche einmal an einem Tage ganz unverhofft um die Mittagszeit in die Küchen und Speisesäle, ließ sich vom ersten
besten Dragoner den Löffel geben und versuchte das Mittageßen der Mannschaften, ob es der Vorschrift entsprechend sei. Im
Jahre 1854, als er sich mit einer Prinzeßin von Anhalt-Deßau verheiratete, übergab er der Regimentskaße für den
Küchenfongs zur Verbeßerung der Speisen einen für damalige Zeitverhältniße recht ansehnlichen Betrag, wie wir hörten, 500
Friedrichsd’or a fünf Thlr. 20 Sgr., außerdem einen gleichen Betrag für den Invalidenfonds. Das Regiment hatte einen
besonderen Fonds; wie ich meine, war es in dieser Beziehung das einzige. Jeder Dragoner zahlte allmonatlich zu diesem
Fonds 10& freiwillig, welcher Betrag an der Löhnung immer stillschweigend in Abzug gebracht wurde. Offiziere,
Unteroffiziere, Mannschaften, alle steuerten bei. Dieses Kapital wurde angesammelt, um Regimentsangehörigen, welche
beim Reiten oder sonst wie im Dienst verunglückten und die von Hause aus kein weiteres Vermögen hatten, eine
Unterstützung, je nach den vorliegenden Verhältnißen, geben zu können. Auch besuchte der Prinz regelmäßig wöchentlich
einmal das Lazarett und die dort befindlichen Kranken des Regiments. Diese beschenkte er jedes Mal, sofern der
Krankenzustand es zuließ, mit Äpfeln, Apfelsinen und so weiter. Während des Besuches machte der Adjutant Notizen über
den Zustand der Kranken, und kaum war eine Stunde seit dem Besuch des Prinzen vergangen, so kamen die Geschenke für
diejenigen Kranken, denen solche verabreicht werden durften, in Körben an und wurden ihm durch den Arzt übermittelt.
Wenn der Prinz bei seinem Besuch in ein Krankenzimmer kam, mußten alle, die das Bett verlaßen durften, ein jeder am
Fußende seines Bettes, mit zugeknöpfter Krankenuniform in dienstlicher Haltung sich aufstellen. Einmal war ich wegen
Augenentzündung, so daß ich keinen Stalldienst tun durfte, auf acht Tage ins Lazarett beordert. Während dieser Zeit stattete
der Prinz einem Besuch im Lazarett ab. Als er an mir vorbeiging, faßte er mich an meinem Lazarettgewand auf der Brust an,
zog mich etwas nach vorn, gab mir dann einen kleinen Stoß nach hinten, und ich lag lang gestreckt auf dem Rücken in
meinem Bett. Darüber lachte der Prinz recht herzlich und sagte: "ich wollte einmal sehen, ob sie noch kräftig sind."
Auch vor der Prinz damals als der schneidigste und verwegenste Reeiter bekannt. Keiner kam ihm gleich beim Nehmen von
Hindernißen und Ähnlichem. Seine Ankunft beim oder sein Abgang vom Regiment geschah stets in schärfster Gangart mit
den Worten: "Guten Morgen, Dragoner!" Eines Tages kam der österreichische Feldmarschall Windischgrätz, der 1848 Robert
Blum erschießen ließ, nach Berlin. Diesem wollte der Prinz sein Regiment auf dem Tempelhofer Felde vorführen. Bevor der
Österreicher auf dem Exerzierplatz ankam, hielt der Prinz eine Ansprache an die Offiziere. Darauf ritt er vor jede Schwadron
und nannte den Namen des hohen Herren, der das Regiment besichtigen wolle, sagte: "Heute nehmt Euch und Eure Pferde
zusammen. Alle Bewegungen werde ich in der schärfsten Gangart ausführen laßen, um zu zeigen, was ihr könnt." Und so
geschah es auch. Das Reiten an diesem Tage wird mir stets unvergeßlich bleiben. Kaum dreiviertel Stunden dauerte das
Exerzieren, da waren alle Pferde über und über mit Schaum bedeckt. Es war ein Reiten, wie ich es nur einmal, nämlich an
diesem Tage, während meiner Dienstzeit durchmachte. Als wir eingerückt waren, wurde im Kasernenhofe schon der Befehl
gegeben: "Die Pferde anhalftern und die Mannschaften die Zimmer in Ordnung bringen; Der österreichische Feldmarschall
will die neue Kaserne besichtigen.“ Wir hatten diese Kaserne vor dem Halleschen Tor vor ein paar Monaten bezogen; vorher
lagen von den vier Schwadronen, die das Regiment damals zählte, zwei Schwadronen in der Alexandrinenstraße, eine
Schwadron in der Lindenstraße und eine in der Wilhelmstraße. Bald nachdem wir die Pferde im Stall hatten, kam der Prinz
mit seinem Gast, ging die Stallungen einer Schwadron durch und besichtigte einige Mannschaftszimmer in der Kaserne,
womit die Besichtigung beendet war. Nach Abgang des Prinzen von Regiment - derselbe wurde, wenn ich mich noch recht
erinnere, Kommandeur der ersten Garde-Kavallerie-Brigade – bekamen wir als Kommandeur einen älteren Herrn, Oberst
von Griesheim. Mit diesem kehrte dann gegen früher eine auffallende Ruhe und Stille im Regiment ein. Ich aber, und gewiß
noch viele andere, welche die Ehre hatten, den Prinzen kennen zu lernen, werden dem geborenen Soldaten, dem schneidigen
Kavalleristen (er war damals 27 Jahre alt), dem vortrefflichen Regimentschef und dem späteren tapferen Heerführer, über
welchen ich noch an anderer Stelle Näheres sagen werde, ein immerwährendes ehrendes Andenken bewahren. In meinem
letzten Dienstjahre war ich zu Neujahr 1855/56 auf Kasernenwache. Während ich Posten stand, beschäftigten sich meine
Gedanken damit, wie bald die Dienstzeit nun vorüber sein werde, und ich dann selbstständig ein Geschäft für mich antreten
müße, welches meine älteren Brüder mir mit Liebe und Sorgfalt auf einem Grundstück im Altenwald, wo damals noch kein
Metzgergeschäft war, errichtet hatten, und das von meinem Bruder August als Filiale von Sulzbach aus betrieben wurde, bis
meine Dienstzeit abgelaufen sein würde. Meine guten Brüder handelten so, damit sich dort vor Ablauf meiner Dienstzeit kein
anderer Metzger festsetzen sollte. Wenn ich sonach das Geschäft gleich für mich anfangen mußte, so war ich auch darauf
angewiesen, nicht baldmöglichst nach einer paßenden Frau umzusehen, eine Angelegenheit, die mich natürlich auch sehr
beschäftigte. Es schwebte mir der Gedanke vor, daß ein Schwager von meinem ältesten Bruder Fritz (Georg Niebling),
welcher im Altenwald neben seiner Glasbläserei noch eine Gastwirtschaft betrieben hatte, wohl schon eine heiratsfähige
Tochter haben könne. Bald darauf schrieb ich an meinen Bruder Fritz und stellte in diesem Sinne eine leise Anfrage. Dieser
erwiderte mir darauf etwas ausweichend, es könnte wohl sein, aber das hätte alles Zeit, bis ich nach Hause käme. Damit war
denn diese Frage für mich vorläufig erledigt. Am 1. Oktober 1856 wurde ich entlaßen und kam wohlbehalten in meiner
Heimat Sulzbach an, wo ich mit Freude erwartet und von meiner guten Mutter in sorgsame Pflege genommen wurde.
V. meine Verheiratung und der Geschäftsanfang.
Nach zweitägiger Ruhepause gings zu meinem Bruder August ins Geschäft. Während meiner Militärdienstzeit
entwickelte sich die Grube Altenwald sehr stark, was eine bedeutende Bevölkerungszunahme bediente. Ein Metzgergeschäft
war außer der Filiale meines Bruders, die ich nun übernehmen sollte, noch nicht vorhanden. Dort lernte ich denn auch gleich
in den ersten Tagen meine zukünftige Frau kennen. Ihr Vater betrieb eine gut gehende Gastwirtschaft und war einer der besten
Kunden meines Bruders. Täglich verkehrte ich dort, und nach kaum 14 Tagen machte ich meiner zukünftigen Frau
Mitteilung von meiner Absicht, sie zu heiraten. Sie war damals 17, ich 21 Jahre alt. Etwas schüchtern und verlegen gab sie
mir ihre Zustimmung. Nun mußte aber auch die Einwilligung der Eltern eingeholt werden, und dazu habe ich mich nur sehr
ängstlich herangewagt. Vorher fragte ich nochmal bei meiner Braut an, ob sie ihr mir gegebenes Wort halte, was sie mir
wiederum bejahte. Wenn aber der Vater nein sagt?“ Fragte ich. „Dann sage ich ja!“ erwiderte meine Zukünftige. Das gab mir
frischen Mut, und ich ging zu meinem Schwiegervater, der in einem Nebenzimmer allein war, und offenbarte ihm mein
Vorhaben. Er erwiderte: „Meine Marie ist noch etwas jung; aber wenn Du kommst, habe ich nichts dagegen. Komm, wir
wollen zu meiner Frau gehen und auch diese fragen.“ Dieselbe lag schon zu Bett und wir gingen in ihr Schlafzimmer. Mein
Schwiegervater sagte zu ihr: „Greth (Margaretha hieß sie), der Johann ist da, der will die Marie heiraten.“. Ach Du lieber
Gott, sie ist ja noch so jung; aber ich habe nichts dagegen, es braucht ja noch nicht so bald zu sein.“ Ich war froh, meinen
Zweck erreicht zu haben, und ging in die Gaststube zu meiner Braut, welche auch mit Spannung auf die Antwort ihrer Eltern
wartete. Gleich wie ich war auch sie erfreut, und damit war unsere Verlobung ohne eine weitere Feierlichkeit im engsten
Kreise abgeschloßen. Bevor ich bei meinem Schwiegervater anfragte, holte ich mir nur die Zustimmung bei meiner Mutter
ein; weitere Anfragen habe ich nicht gestellt. Ich war genötigt, sofern ich das Geschäft von meinem Bruder für meine
Rechnung übernehmen wollte, eine Frau zu haben, welche den Haushalt führte und während meiner Abwesenheit den
Verkauf im Laden besorgen konnte. Daher wurde die Angelegenheit mit Eifer betrieben. Die Haushaltung wurde so schnell
wie möglich eingerichtet und am 2. Dezember 1856, also zwei Monate nach beendeter Militärdienstzeit, wurde unsere Ehe
auf dem Standesamt und danach in der Kirche zu Sulzbach durch den damaligen ersten Pfarrer König geschloßen. Die
damals noch kleine Einwohnerzahl in Altenwald vermehrte sich mit dem Aufschwung der Gruben, dem Ausbau der
Koksanlagen usw. schnell, und die Häuser schoßen wie Pilze aus der Erde. Im Jahre 1858 kaufte ich mir zwei Pferde, meine
ersten, um neben dem Metzgergeschäft noch ein kleines Fuhrgeschäft zu betreiben.Ich pachtete von der Forstverwaltung eine
Fläche, worauf ich eine Sandgrube, und eine andere Fläche, woselbst ich einen Steinbruch anlegen konnte, und übernahm aus
dem dort gewonnenen Material (Sand und Steine) Lieferungen für Gruben und Privatbauten. In diesem Jahre 1858 baute ich
mir auch ein Haus, wozu ich von meinem Schwiegervater die Baustelle neben seinem Haus erhalten habe. Dadurch wurde
ich so vielseitig beschäftigt, daß ich mir einen Metzgerburschen neben dem Fuhrknecht einstellen mußte. Zu Anfang der
Sechzigerjahre übernahm ich dann kleinere Erdarbeiten an Gemeindewegen und Ähnliches. Die erste größere Erdarbeit war
eine Wegeanlage in der Bergmannskolonie Herrerohr zu Dudweiler für die Bergverwaltung. Dann folgte eine Erdarbeit auf
Grube Heinitz, Anlage der Schiebebühnen daselbst, die mir von der Eisenbahnverwaltung übertragen wurde. Dann kam im
Jahre 1864/65 eine größere Erdarbeit, die Anlage des dritten Geleises auf Grube Reden bei Neunkirchen. Die Erdmaßen zur
Anschüttung des Geleises sollte ich von der neben der Grube befindlichen Berghalde entnehmen. Diese Erdmaßen wurden
bei der Kohlegewinnung aus der Grube gefördert, und außerhalb der Grube in großen Haufen abgelagert. Viel Brennstoff,
kleine Kohlen, waren noch darunter; diese Haufen hatten auch schon mehrere Jahre gebrannt. Es wurde aber damals
angenommen, daß die Halde ausgebrannt sei und kein Feuer mehr im Inneren vorhanden sein könne, weshalb mir auch der
Haufen als Toter Berg bezeichnet worden war. Nach etwa dreimonatiger Arbeit aber brach mit einem Male während der
Arbeit, zum Glück in der Frühstückspause, aus dem toten Berg eine Flamme hervor. Die Arbeiter waren alle aus dem Schacht
ausgetreten, nur zwei Pferde von 18 waren noch in dem Schacht. Diese verbrannten vollständig mit Geschirr und Wagen,
ohne daß etwas davon gerettet werden konnte. Eine halbe Stunde früher oder später hätte es auch noch Menschen gekostet.
Dann erhielt ich von der Eisenbahnverwaltung im Jahre 1866/67 die Erdarbeiten durch Herstellung des dritten Geleises von
Sulzbach nach Altenwald übertragen. Diese Arbeit mußte ich unter schwierigen Verhältnißen während des Betriebes bei sehr
kurz gestelltem Lieferungs - und Beendigungstermin mit Tag - und Nachtarbeit ausführen. Alles ging dabei sehr gut und glatt
und ohne jeden Unfall ab, so daß die Eisenbahndirektion in Saarbrücken darüber sehr befriedigt war und mir nach
Beendigung der Arbeit ohne mein Verlangen ein lobendes Zeugnis außtellte, indem sie mich bestens für Ausführung von Erd
- und Felsarbeiten empfahl. Dieses, von damaligen Eisenbahndirektion - Direktionspräsidenten Herrn von Düring
unterzeichnete Zeugnis ist noch unter meinen Papieren zu finden.
VI. der Krieg von 1866 und die Bekanntschaft mit Vetter Gottfried.
Während des Krieges von 1866 wurden die Arbeiten eine Zeit lang eingestellt. Zum Militärdienst wurde ich nicht mehr
einberufen, da ich als Kavallerist schon dem zweiten Landwehraufgebot angehörte. Um diese Mannschaften alle einzustellen,
fehlten die nötigen Pferde. Mein Schwager Kirst, welcher mich im Jahre 1851 auf die Wanderschaft begleitet hatte und fünf
Jahre nach seiner Verheiratung mit meiner Schwester Maria von Züsch nach Sulzbach wegzog, um dort eine Wirtschaft und
Fuhrgeschäft zu betreiben, wurde als Landwehr-Infanterist eingezogen und der Mainarmee unter Vogel von Falkenstein mit
den Ersatzmannschaften überwiesen, die die Verluste, welche durch den Krieg oder durch Krankheiten entstanden waren,
ersetzen sollten. Eines Tages kam er mit seinem Truppenteil auf dem Bahnhof in Salzungen (Thüringen), einem kleinen
Städtchen an der Werrabahn, an. Dort sollten sie einige Tage Bürgerquartiere beziehen und die Quartierbillets wurden ihnen
am Bahnhof eingehändigt. Als mein Schwager Kirst den Bahnhof verließ, trat ein Herr mit seiner Frau auf ihn zu und fragte,
ob er nicht mit ihnen kommen wolle und bei ihnen Quartier nehmen. Mein Schwager erklärte sich bereit und ging mit nach
deren Wohnung, einer hübschen freundlichen Villa. So hatte er ganz unvermutet zu seiner großen Freude eine so gute
Aufnahme gefunden. Am anderen Morgen, als er mit seinem Quartiergeber und deßen Frau beim Kaffe saß, kam der
Briefträger. Dabei hörte mein Schwager, daß sein Gastgeber mit dem Namen Herr Zeitz angeredet wurde, und sagte dabei
seine Frau heiße auch Zeitz. Auf die Frage nach deren Wohnung erhielt er von meinem Schwager die Antwort: „in Sulzbach
bei Saarbrücken.“ Darauf erwiderte sein Gastgeber: „ich weiß von meinen Vorfahren, daß einer von ihren Verwandten vor
langer Zeit nach dem Rheinland verzogen ist; Aber niemand weiß wohin.“ Der Hausherr intereßierte sich natürlich sehr für
die Sache und stellte, so viel möglich war, nähere Erkundigungen an. Dabei wurde eine weitläufige Verwandtschaft vermutet,
von der bis dahin von beiden Seiten niemand eine Ahnung hatte. Der neue Vetter Gottfried Zeitz welcher in Salzungen eine
sehr gut gehende Malzfabrik betrieb, in Firma Siebert & Zeitz, schrieb sofort an uns alle in der freundlichsten Weise und
begrüßte uns als Verwandte und Vätern. Von da aus ist ein reger und freundschaftlicher Verkehr und Briefwechsel zwischen
uns entstanden und von beiden Seiten rege unterhalten worden.
Während des Krieges von 1870/71 gestaltete sich dann das Verhältnis noch freundschaftlicher. Der neue Vetter Gottfried hatte
zwei sehr talentvolle Söhne und eine Tochter Fanny, welche frühe starb. Der ältere, Karl, ging im Jahre 1863, 19 Jahre alt,
nach Paris, um sich als Kaufmann auszubilden und gleichzeitig sich in der französischen Sprache und Schrift zu
vervollkommnen; der jüngere, Theodor, trat im Oktober 1869 bei dem Meiningischen Infanterieregiment Nr. 32 in
Meiningen als Einjährig -Freiwilliger ein und machte auch mit diesem Regimente den Krieg gegen Frankreich mit. Als
Frankreich den Krieg erklärte, und ganz Paris rief „A Berlin, a Berlin!“ verließ Vetter Karl Paris, wo er sechs Jahre gewesen
war und eine erfolgreiche Studienzeit verbracht hatte, um sich seinem Vaterlande freiwillig für die Dauer des Krieges zur
Verfügung zu stellen. Unterwegs machte er schon in Köln und Mainz Versuche, bei einem Truppenteile eingestellt zu werden,
doch vergeblich. Nachdem er dann in seiner Heimat Salzungen angekommen und sich die erforderlichen Papiere von seiner
Heimatsbehörde verschafft hatte, reiste er sofort nach Meiningen und meldete sich dort bei dem Regiment Nr. 32, in welchem
sein Bruder Theodor als Einjährig-Freiwilliger diente. Sein Bruder begrüßte ihn mit den Worten: „Du hier? Wie kommst Du
her?“ Karl antwortete ihm, er wolle den Feldzug mitmachen. Der Bruder riet ihm davon ab, da er ja noch gar nicht Soldat
gewesen war. Aber es half nichts; er meldete sich zum Eintritt für die Dauer des Krieges. Doch wurde ihm die Erfüllung
seines Wunsches, für sein Vaterland zu kämpfen, noch recht schwer gemacht, und nur seine französischen sprach - und
Schriftenkenntniße verursachten, daß er sein Ziel erreichte. Als er sich beim Regiment meldete, erkannte der Kommandeur
bald, daß man solche Leute im Feldzuge gegen Frankreich gebrauchen könne, und schickte ihn in Begleitung eines Offiziers
zum Bataillonskommandeur. Dieser empfing ihn mit den Worten (wie ich in seinen Kriegserinnerungen gelesen habe):
Feldzugsfreiwilliger?“ Vetter Karl antwortete: „Ja“; „wo haben Sie gedient?“ „Ich habe noch gar nicht gedient.“ Der Major
drehte sich um und sagte: „noch gar nicht gedient? Da kann ich den Kerl ja nicht gebrauchen.“ „Verzeihung, Herr Major,
Befehl vom Herrn Oberst,“ entgegnete der Regimentsadjutant. „Ja, wenn es Befehl vom Herrn Oberst ist, muß ich freilich
den Kerl mitnehmen,“ sagte ärgerlich der Major, und fragte, bei welcher Kompanie er eintreten wolle. Karl antwortete: „bei
der ersten.“ Dies war die Kompanie, bei welcher sein Bruder Theodor stand. Damit hatte er denn so weit sein Ziel erreicht
und war nicht wenig stolz darauf, gleich bei seinem Eintritt als Soldat schon bis zum „Kerl“ befördert zu werden. Da er diese
Charge so schnell erreicht hatte, nahm er sich vor auch ein ordentlicher und braver Kerl zu werden. Und er hat Wort gehalten;
es ist wirklich ein tüchtiger Kerl aus ihm geworden, der sich um sein Vaterland verdient gemacht und seine Dekoration, das
Eiserne Kreuz wohl verdient hat. Seine Erlebniße während dieser Dienstzeit aus dem Jahre 1870/71 hat er in einem
stattlichen Band geschildert, welche den Titel trägt: „Kriegserinnerungen eines Feldzugsfreiwilligen. Von Karl Zeitz.“ (Verlag
von Stefan Geigel - Altenburg). Beide Brüder machten denn auch bald darauf die erste Schlacht bei Wörth mit; auf die
Nachricht von dieser Schlacht reiste der besorgte Vater, Vetter Gottfried, sofort dem Regiment nach und kam einige Tage
nach der Schlacht in Wörth an. Sein erstes war, die dortigen Lazarette und Krankenhäuser aufzusuchen, ob er einen seiner
Söhne dort finden oder sonst etwas von Ihnen hören würde. Dort erhielt er auch bald die frohe Nachricht, daß beide wohlauf
und mit dem Regiment weiter nach Frankreich hineinmarschiert seien. Er reiste dann von dort dem Regiment weiter nach,
ohne es zu finden. Dabei kam er gleich nach den Schlachten vom 14., 16. und 18. August nach Gravelotte, traf aber auch dort
seine Söhne nicht an, die durch die Vogesen und Champagne nach Sedan zu marschiert waren. Diese Schlacht machten dann
beide Brüder wiederum glücklich mit, ohne verwundet zu werden. Vetter Gottfried hatte eine rote Johanniterbinde am Arm
und kam überall ungehindert durch. Nachdem er seine Söhne bis Gravelotte nicht getroffen hatte, trat der besorgte Vater die
Rückreise durch Lothringen über Saarbrücken nach Sulzbach an.
Dort traf gegen Ende August 1870 eines Tages ein unbekannter Herr auf einem zweijährigen Tilbury ein, das mit einem
Pferde, auf den Namen Rosinante hörend, bespannt war.Das Fahrzeug stammte von einem französischen Offizier und war
sehr schön und elegant. Dem Pferde aber sowie deßen Geschirr konnte man nicht daßelbe nachsagen. Das Pferd hatte sich
der Herr Vetter von einem Marketender für wenig Geld erworben, wie er uns erzählte, und das Geschirr dazu selbst
zusammengesetzt aus Strick -und Lederabfällen, die er sich auf dem Schlachtfelde von Gravelotte gesammelt hatte. Auf
diesem Gefährt und bedeckt mit einem Strohhut in der Größe eines Wagenrades, am Arm die Rote Kreuzbinde tragend, hielt
der bis dahin unbekannte Vetter seinen Aufsehen erregenden Einzug in Sulzbach, zum Besuche seiner bis dahin unbekannten
Vettern und Basen, die er (wie er selbst behauptet) alle sofort erkannte an ihre Nasen; denn diese waren, wie auch die seinige,
alle ziemlich stark entwickelt, galten als Erkennungszeichen in der Familie Zeitz. Über einen Monat blieb der Vetter bei uns
in Sulzbach, und wir verlebten schöne und frohe Tage zusammen. Die berühmte Rosinante vom Schlachtfelde von
Gravelotte wurde unter uns Brüdern meistbietend versteigert. Bruder Louis blieb Letztbietender (ihm war von der
Bergverwaltung die Gestellung der Pferde für den Betrieb auf Grube Altenwald lange Jahre übertragen), und wenn ich mich
nicht irre, so hat das intereßante Tier sein Leben tief unter der Erde im Grubendienst ausgehaucht. Das Tilbury ging per Bahn
als Kriegsbeute von Gravelotter Schlachtfeld nach Salzungen. Bevor der Vetter die Rückreise dorthin antrat, fuhr ich mit ihm
durch die Pfalz, über Neustadt, Landau, Weißenburg und nach Hagenau; wir wollten uns noch die Belagerung von Straßburg
ansehen. Als wir auf dem Bahnhof in Hagenau ankamen, mußten wir einige Stunden liegen bleiben, bevor wir bis
Bendenheim, der letzten Station vor Straßburg, weiter konnten. Während dieses unfreiwilligen Aufenthaltes in Hagenau
trafen dort die Depeschen von der Schlacht von Sedan und der Gefangennahme Napoleons ein. Die Depesche lautete:
„Sedan, den 2. September 1870.
Die Kapitulation, wodurch die ganze Armee kriegsgefangen, ist soeben mit dem General v. Wimpfen geschloßen,
der anstelle des verwundeten Marschalls Mac Mahon das Kommando führte. Der Kaiser hat nur sich mir selbst
übergeben, da er das Kommando nicht führt, und alles der Regentschaft in Paris überläßt. Seinen Aufenthalt
werde ich bestimmen, nachdem ich ihn gesprochen habe in einem Rendezvous, das sofort stattfindet. Welch eine
Wendung durch Gottes Führung! Wilhelm.“
Der Bahnhof war ganz in militärischen Händen und Betrieb und die Freude und der Jubel über diese Ereignis war
unbeschreiblich. Wir blieben diese Nacht in Hagenau. Ein Nachtquartier konnten wir in keinem Hotel finden; wir verbrachten
daher die Nacht auf dem Bahnhof im Wartesaal 2. Klaße auf der Bank. Am anderen Tag fuhren wir bis Bendenheim, wo wir
meinen Neffen Heinrich, den Sohn meines ältesten Bruders Fritz, aufsuchten, welcher beim 30. Infanterieregiment den
Feldzug mitmachte und während der Belagerung Straßburgs in Schiltigheim lag. Von dort fuhren wir wieder nach Sulzbach
zurück und blieben dort, bis der Vetter die Rückreise nach Salzungen antreten mußte, noch eine kurze Zeit beisammen. Die
fast täglich vom Kriegßchauplatz eingetroffenen günstigen Nachrichten haben uns stets in froher Stimmung erhalten. Als der
Vetter abreiste, nahmen wir alle voneinander herzlichen Abschied mit dem Versprechen, die gemachte Bekanntschaft durch
gegenseitigen brieflichen Verkehr aufrecht zu erhalten, was auch bis zu seinem Tode viele Jahre lang beiderseits geschehen
ist. Vetter Gottfried reiste von uns nach Salzungen zurück, ohne den Hauptzweck, seine Söhne zu treffen, erreicht zu haben.
Beide kamen wohlbehalten aus dem Feldzuge zurück. Der ältere, Karl, wurde sofort nach dem Friedenßchluß in Versailles
entlaßen, macht uns auf der Rückreise aus Frankreich seinen Besuch in Sulzbach und erzählte uns dabei sehr intereßante
Kriegserlebniße. Der jüngere Bruder Theodor mußte bleiben, bis der Feldzug und damit auch seine Dienstzeit beendet war; er
kam dann ebenfalls zu uns. Beide Brüder haben sich im öffentlichen Leben angesehene Stellung erworben. Karl übernahm
eine Bierbrauerei die sein Vater in Meiningen gegründet hatte, und wurde dort von seinen Mitbürgern in den Mainingischen
Landtag und später auch in den deutschen Reichstag als Abgeordneter gewählt. Theodor ging nach dem Kriege nach England
und erwarb sich als hervorragender Kaufmann in Sheffield und London ein ansehnliches Vermögen und eine einflußreiche
Stellung als Direktor und Teilhaber einer Stahlwerksgesellschaft.
VII. Der Krieg von 1870/1871.
Wie schon früher erwähnt, habe ich Anfang der Sechzigerjahre außer dem Metzgergeschäft noch ein Fuhrgeschäft
betrieben und mich außerdem mit der Übernahme von Erdarbeiten beschäftigt. Im Jahre 1867 wurde mir von der
Eisenbahndirektion Saarbrücken die Herstellung der Erdarbeiten des 4. Loses der Bahnlinie Saarbrücken –
Saargemünd übertragen, von Hannweiler bis zur französischen Grenze bei Saargemünd. Durch die Übernahme
dieser Arbeit war ich so in Anspruch genommen, daß ich mich um das Metzgergeschäft gar nicht mehr kümmern
konnte, und dem Burschen die Vieheinkäufe, das Schlachten und so weiter allein überlaßen mußte. Ebenso mußte
meine Frau neben der Haushaltung noch den Verkauf im Laden allein besorgen. Die Familie vermehrte sich
schnell, und meine gute Frau hatte eine große Arbeitslast zu bewältigen.
Zum Glück hatte ich damals einen sehr guten und zuverläßigen Metzgerburschen, Wilhelm Mayer aus Eßlingen in
Württemberg. Seine Eltern waren ihm früh gestorben und er hatte sonst keine Geschwister mehr, nur entfernte
Verwandte. Sein Vermögen, das bis dahin von seinem Vormund verwaltet wurde, bestand aus 400 Talern. Er war
um diese Zeit großjährig und brauchte nicht Soldat zu werden. Da er ein wirklich braver und guter Mensch war,
wie man ihn selten trifft, so machte ich ihm eines Tages den Vorschlag, er solle mein Metzgergeschäft für seine
eigene Rechnung übernehmen. Dabei hatte ich auch die Absicht, meiner Frau ihre Last etwas zu erleichtern. Mein
Wilhelm war sogleich damit einverstanden und schrieb an seinen Vormund, daß ihm sein Vermögen ausgehändigte
wurde. Soweit dieses in der ersten Zeit für seine Vieheinkäufe nicht ausreichte, half ich ihm aus und unterstützte
ihn in jeder Hinsicht, als wenn ich meinem eigenen Sohne das Geschäft übertragen hätte. Hiermit war aber meine
Frau noch nicht genügend entlastet. Wenn der Bursche fort mußte, um Vieheinkäufe zu machen, war niemand da
als meine Frau, um den Verkauf und den Laden zu besorgen. Daher drang ich darauf, daß es sich sobald wie
möglich nach einer Frau umsehen sollte. Eines Tages machte er mir dann die Mitteilung, er hätte in
Bruchmühlbach (Pfalz) ein Mädchen mit etwas Vermögen kennen gelernt und glaube, daß sie wohl zu ihm paßen
würde. Ich kannte den Vater des Mädchens, schrieb gleich an ihn und lud ihn ein, mit Frau und Tochter mich an
einem Sonntage in Altenwald zu besuchen. Dies geschah auch bald und bei dieser ersten Unterredung in meinem
Hause wurde der beabsichtigte Zweck erreicht. Im Einverständnis von beiden Seiten wurde die Heirat beschloßen.
Ich legte Wert darauf, daß die Vorbereitungen zur Hochzeit, Einrichtung des Haushaltes und so weiter so schnell
wie möglich getroffen wurden, und sobald der Haushalt für die Braut fertig war, fand die Hochzeit statt. Nach der
Hochzeit räumte ich dem jungen Paar den untersten Stock meines Hauses ein und bewohnte von nun an die obere
Etage. Mit diesem Zeitpunkte trat dann für meine Frau die längst gewünschte Entlastung ihrer schweren Arbeit
ein. Ich war die Woche über stets bei meinem Bahnbau Saargemünd beschäftigt und wohnte in Hanweiler im
Gasthofe Schreiber. Ein Pferd und Wagen hatte ich stets zu meiner Verfügung, womit ich sonnabends nach
Altenwald und montags wieder nach Hanweiler zurückfuhr. Ende 1869 war ich in der Hauptsache mit meinen
Erdarbeiten fertig; einige kleine Nebenarbeiten sollten noch im Frühjahr 1870 gemacht werden. Meine sämtlichen
Gerätschaften, Rollwagen, Karren und so weiter lagen noch in Hanweiler, und ich suchte nach anderer Arbeit, bei
der ich das dort lagernde Material wieder verwenden konnte. Aber die politischen Verhältniße waren schon im
Winter 1869/70 gespannt und die Geschäfte dadurch allgemein etwas stockend. Doch hätte niemand daran
gedacht, daß der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland so schnell, wie ein Blitz aus heiterem Himmel,
ausbrechen würde. Nachdem Frankreich den Krieg erklärt hatte, erfolgte in der Nacht der Aufruf, wonach alle
Militärpflichtigen sich sofort in Engers unweit Koblenz stellen sollten. Es geschah dies unter der Annahme, daß
die Franzosen uns an der Grenze plötzlich überfallen und die Mobilmachung links vom Rhein stören oder ganz
vereiteln würden. Niemand dachte mehr an Arbeit. Die Gruben standen still, die Militärpflichtigen wurden in
Extra - Zügen nach Engers befördert und alles war plötzlich nur noch mit dem Krieg und deßen Vorbereitungen
beschäftigt. Die Begeisterung war groß, aber auch die Furcht allgemein, daß wir hier dicht an der Grenze plötzlich
von den Franzosen überfallen werden könnten, bevor unsere Armee marschbereit sei. Welch ein Unterschied
damals und heute! Mag kommen was da wolle, die Furcht, von den Franzosen überfallen zu werden, ist
hoffentlich für alle Zeiten geschwunden. Und wer die Zustände im Deutschen Reich vor 1870 gekannt und
miterlebt hat, und sich derselben noch erinnert, wird mit mir sagen: wie dankbar sollte doch das deutsche Volk
dafür sein, daß die nach 1870 errichtete, für die Franzosen unübersteigliche Schutz - und Grentmauer uns alle von
diesen Sorgen befreit. Und wahrlich, nur Feinde und Verräter des Vaterlandes können daran denken, dieses
Bollwerk, welches, so Gott will, Jahrhunderte überdauern wird, nochmals zu zerstören. Ein Neffe von mir, August
Martin, Sohn meiner ältesten Schwester Katharina, die sieben Jahre nach seiner Geburt gestorben war, hatte
damals einen Mühlsteingeschäft in Dürkheim (auf Pfalz); er war noch unverheiratet und gehörte der Reserve an.
Den Krieg von 1866 hatte er in Böhmen beim 40. Infanterieregiment mitgemacht. Als er den Aufruf in Dürkheim
las, kam er sofort von dort nach Sulzbach, wo er mich mit meinen anderen Brüdern bei meinem Bruder Heinrich,
der eine Gastwirtschaft betrieb, antraf. Derselbe sagte zu uns: „ich gehe nicht nach Engers, ich gehe nach
Saarbrücken, wo mein Regiment bereits als Vorhut steht; ich will an die Spitze, zu meiner Kompanie und zu
meinem Hauptmann Lütke.“ Dann fügte er die Worte hinzu, die ich nie vergeßen habe: „Onkel, wenn ich lebend
wieder zurückkomme, dann kommen die Franzosen nicht zu Euch. Nur keine Bange, solange noch ein Vierziger
da ist, paßiert euch nichts.“ Sein Wunsch wurde ihm erfüllt; sein Hauptmann, welcher ihn 1866 als Gefreiter
entlaßen hatte, stellte ihn sofort in seine Kompanie wieder ein. Er hatte vor seiner Militärdienstzeit in Frankreich
(Laferte in der Champagne) das Mühlengeschäft und damit auch die französische Sprache erlernt. Dies kam ihm
dann während des Feldzuges sehr oft gut zustatten. Am 2. August, als der erste Angriff von den Franzosen auf
Saarbrücken gemacht und der Bahnhof beschoßen wurde, kam er gleich ins Feuer. Am 6. August machte er die
Schlacht von Spichern und den Sturm auf die Spicherner Höhen mit. Dabei wurde ihm eine Achselklappe
weggeschoßen und die Schulter leicht von der Kugel gestreift. Am 8. August traf ich Ihn in Forbach; er war für
sein tapferes Verhalten bei Spichern zum Unteroffizier befördert und zum Eisernen Kreuz 2. Klaße vorgeschlagen
worden. Dabei sah ich auch seinen Streifschuß an der Schulter, den er nicht beachtet hatte. Er machte mir über die
Schlacht selbst und sein Verhalten mündliche Mitteilung. Von da ab behielt er seinen Zug als Führer und bekam
bald darauf das Eiserne Kreuz. Während der Belagerung von Metz habe ich ihn später in Ars an der Mosel
nochmals aufgesucht, wo mir von seinen Kameraden viel lobendes über ihn erzählt wurde. Bei Amiens, in der
Schlacht an der Hallue, bei dem Dorfe Favreuil zeichnete er sich wiederum ganz besonders aus durch einen
kühnen, mit freiwilligen ausgeführten Patrouillengang. Dabei wurde er schwer verwundet: Schuß durch den
linken Oberarm und das Schulterblatt. Ein englischer Kapitän (Seton) mit anderen Kameraden kamen ihm beim
Fallen zu Hilfe und brachten ihn nach dem Orte Belu, unweit der belgischen Grenze, wo er bei einem Baron de
Goer Aufnahme fand. Durch sein Vorgehen wurde die Fahne des Bataillons gerettet. Der offizielle Bericht im
Fahnen -und Standartenbuch sagt darüber auf Seite 255: „Die Gefahr, in welcher die Fahne schwebte, erkennend,
hatte Unteroffizier Martin mit einigen Leuten der ersten Kompanie den Feind überraschend von der Seite
angegriffen und ihn zum Halten genötigt. Den Antrieb zu dem Vorstoß hat hauptsächlich der Unteroffizier Martin
gegeben, dadurch daß er sich mit den Worten: "vorwärts, Kameraden! Hurra, drauf mit dem Kolben!“ zuerst dem
Feinde entgegenstürzte. Das Regiment zollte ihm dafür große Anerkennung und er wurde deshalb mit dem
eisernen Kreuz erster Klaße dekoriert und erhielt noch außerdem vom Fürsten von Hohenzollern (welcher Chef
vom 40. Regimente war) den Leopoldorden mit Schwertern“. Schwer verwundet in Belu liegend, hatte er, sowie
auch seine Umgebung, die Hoffnung auf Genesung aufgegeben. Er schrieb an seine Eltern; aber die Briefe kamen
nicht an. Endlich traf eine Karte über Belgien bei seinen Eltern in Sulzbach ein, und damit das erste
Lebenszeichen seit fast zwei Monaten. Auf diese Nachricht hin reiste mein ältester Neffe Fritz Zeitz nach Amiens,
wo er das Regiment antraf. Auch sein Regiment hatte ihn als verloren betrachtet. Als sein Hauptmann Lütke die
Nachricht hörte, gab er meinen Neffen zwei Ärzte und einen Lazarettgehilfen mit, und mit diesen traf er nach
zwei Tagen in Belu am Krankenlager ein. Die deutschen Ärzte untersuchten und verbanden die Wunde; es konnte
aber erst am dritten Tage die Rückreise über Metz nach seiner Heimat Sulzbach angetreten werden, wo er als
schwer Verwundeter ankam. Aber die Franzosen waren nicht zu uns gekommen. Trotz aller Pflege und Sorgfalt
wollte die Wunde nicht vernarben. Später verlegte er seinen Mühlsteingeschäft von Dürkheim nach Neustadt a. H.
und verheiratete sich auch dort. Aber die im Kriege durchgemachten Strapazen, insbesondere die schwere
Verwundung der Schulter, haben seine Gesundheit stark beeinflußt und an der Ausübung seines Geschäftes sehr
behindert, ja später genötigt, daßelbe ganz aufzugeben. Als Invaliden wurde ihm dann wegen seiner Verdienste im
Kriege die Stelle als Lotteriekorrekteur der preußischen Lotterie in Viersen (Rheinland) übertragen. Als er dort
späterhin starb, wurde seine irdische Hülle auf Veranlaßung seines Regiments nach Saarbrücken gebracht und mit
militärischen Ehren im Ehrental bei Saarbrücken beigesetzt. August Heinrich Martin war geboren zu Sulzbach den
29. Juli 1845; er starb zu Viersen den 2. Mai 1895.
Doch ich kehre zum Anfang des Krieges zurück. An dem denkwürdigen 2. August fuhr ich mit meiner Frau auf
meinem Wagen nach Saarbrücken. Arbeit hatte ich keine, und niemand hatte auch Lust zur Arbeit. Meine Freunde
Fritz Reinhold (Hotel zum Rheinischen Hof), den ich früher schon erwähnte, stellte ich Pferd und Wagen ein. Im
Wirtschaftslokal unterhielten wir uns natürlich nur vom Kriege. Da kam plötzlich Reinhold eilig heran und rief
mir zu: „Johann, die Franzosen sind auf dem Hahnen.“ In diesem Moment hörten wir auch die Kanonenschüße,
mit denen der Bahnhof Saarbrücken beschoßen wurde, und ebenso das Knattern von Gewehrfeuer. Rasch holte ich
mein Pferd aus dem Stall, spannte ein und in Eile gings retour nach Sulzbach zu, in der Meinung, daß uns die
Franzosen auf dem Fuße nachfolgen würden, was aber nicht der Fall war. Auf der Höhe von Krämershäuschen,
wo wir außerhalb Schußweite waren, hielt ich still, und wir konnten von da die Bewegungen der Franzosen auf
der Höhe von Saarbrücken und dem Winterberg gut beobachten. Nach kurzem Aufenthalt ging es in schneller
Gangart durch Jägersfreude und Dudweiler nach Sulzbach zu, wo ich erzählte, was wir gesehen und gehört hätten.
Alles war in größter Angst und Sorge, daß noch im Laufe des Tages die Franzosen bei uns einrücken würden; von
unseren Soldaten waren außer ein paar Kompanien 40er und den Saarbrücker Ulanen, die Patrouillen - und
Vorpostendienst taten, nichts zu sehen. Bei Saarbrücken entwickelte sich dann am Nachmittag das bekannte
Vorpostengefecht, in welchem unsere 40er und Ulanen der Übermacht wichen und gegen Abend in kleinen
Kolonnen versprengt in Dudweiler, Sulzbach und Fischbach ankamen, um Nachtquartier in Quierschied zu
beziehen. Anderen Tags sammelte sich das Regiment wieder bei Eiweiler im Köllertal. Dieses Gefecht wurde von
den Franzosen als großer Sieg und Einnahme von Saarbrücken bezeichnet. In Wirklichkeit sind sie aber über die
Höhe von Saarbrücken nicht hinausgekommen. Nur vereinzelt kamen kleine Patrouillen bis Saarbrücken hinein,
zogen sich aber bald wieder auf die Höhe zurück. An diesem 2. August überschritten sie auch bei Saargemünd die
Grenze und lagerten auf den Feldern von Hanweiler, Rilchingen und Auersmacher. Dabei verbrannten sie mir
auch mein Material, das damals noch auf der Baustelle Hanweiler lagerte. Nichts blieb mir übrig. Was die
Franzosen nicht verbrannt hatten, wurde von anderen, aber Nichtfranzosen, auf deren Konto gestohlen.
Von diesem gesamten Material habe ich nichts mehr zurückerhalten. Vom 2. bis 6. August waren wir Tag und
Nacht besorgt, daß die Franzosen uns überraschen würden. Wenn sie gekommen wären, hätten die paar 40er und
die Ulanen, welche noch in unserer Nähe waren, sie nicht aufhalten können. Vom Anmarsch unserer Armee sahen
und hörten wir noch nichts. Des abends und nachts erreichten uns ab und zu Patrouillen, die uns trösteten mit den
Worten: "Kinder, seid nur ruhig, die Armee ist im Anmarsch, bald werdet ihr Einquartierung bekommen." In der
Nacht vom 5. und 6. August kam eine Küraßierpatrouille vor meinem Hause an, saß ab und verlangte für
Mannschaft und Pferde Waßer, was mit Freude gereicht wurde. Diese erzählten uns, daß wir morgen, am 6.
August, Einquartierung erhalten würden und daß die Armee von allen Seiten in Anmarsch sei. Und so war es
auch. Am 6. August, Sonnabend morgen, ging es los. Um 9 Uhr kamen die ersten Regimenter von Neunkirchen
und Ottweiler her und bezogen in Friedrichsthal,, Altenwald, Sulzbach und Dudweiler Quartier. Ich selbst erhielt
als meine erste Einquartierung einen Hauptmann, einen Leutnant und 12 Mann Soldaten; es war gegen 10 Uhr
morgens. Nach einem kleinen Frühstück sollten alle etwas ausruhen. Den Hauptmann fragte ich, um welche Zeit
das Mittageßen genehm sei, und er erwiderte, so wie üblich um 12 Uhr. Um diese Zeit war denn auch alles
bereitet. Mit den beiden Offizieren speiste ich allein; die Mannschaften wurden in einem anderen Zimmer
bewirtet. Ich hatte von meinem Bahnbau aus Saargemünd noch guten französischen Rotwein und regte meine
Gäste fleißig zum Trinken an mit den Worten: "Der kommt aus Frankreich; wenn Sie dorthin kommen, finden Sie
mehr davon vor." Der Wein mundete, und meinem Zureden wurde fleißig entsprochen; ich sah an der
Gesichtsfarbe meiner Gäste, daß der Wein seine Wirkung tat. So gegen 1 Uhr, als wir beim Kaffee und Zigarren
angekommen, äußerte der Hauptmann u.a., daß morgen, Sonntag, Ruhetag sei, und dann am Montag die Grenze
überschritten werden solle. Während wir uns so unterhielten, öffnete der Bursche des Hauptmanns die Tür mit den
Worten: "Hauptmann, Alarm!" Wir öffneten schnell die Fenster und hörten, wie Kavalleristen und Infanteristen
Alarmsignale gaben und in aller Eile die Truppen sich sammelten. Im Laufschritt gings auf Saarbrücken los. Von
Neunkirchen und Ottweiler kamen dann, je eine Viertelstunde auseinander, Bahnzüge mit Infanterie nach
Saarbrücken bei uns durch, wo um diese Zeit, 1 Uhr nachmittags, der Kampf schon begonnen hatte. Auch von
Saarlouis und aus dem Köllertal rückten unsere Truppen in Eilmärschen um diese Zeit gegen Saarbrücken vor.
Gegen 3 Uhr nachmittags kam ein Feldartillerie - Regiment von Neunkirchen aus im stärksten Galopp bei uns
durch nach Saarbrücken. Die Pferde waren über und über mit Schaum bedeckt, der Erdboden zitterte, als das
Regiment durch Altenwald durchsprengte. Es war ein Moment, den ich nie vergeße, und auch wohl auf alle, die es
mit angesehen haben, einen unvergeßlichen Eindruck gemacht hat. Solche Augenblicke laßen sich schwer in
Wirklichkeit schildern, man muß es erlebt und mit angesehen haben, sich die richtige Vorstellung davon zu
machen. Und so ging auch die Infanterie vor, alles in Eilmärschen direkt ins feindliche Feuer hinein. Gegen 3 Uhr
nachmittags hörten wir dann auch schon heftigen Kanonendonner von den Spicherner Höhen, wo sich die
Franzosen festgesetzt hatten. Darauf gingen wir oberhalb Sulzbach auf die Höhe, die sogenannte Frühlingßtraße,
und konnten von dort aus das Schlachtfeld, welches ganz in Pulverdampf eingehüllt war, den Kanonendonner, die
Infanteriesalven, alles sehen und hören. Der Gedanke: wer wird Sieger sein? Erfüllte uns alle mit bangen Sorgen.
Diese aufregende Spannung dauerte bis gegen 8 Uhr abends. Um diese Zeit kann der Polizeidiener von Sulzbach
und machte mit der Schelle bekannt: "Die Franzosen sind geschlagen und auf dem Rückzuge. Viele Tote und
Verwundete liegen auf dem Schlachtfelde; wer Wagen und Pferde hat komme damit hin, um die Verwundeten vom
Schlachtfelde zu transportieren." Diesem Rufe wurde freudigst von allen entsprochen, welche dazu in der Lage
waren und Fuhrwerk stellen konnten. Auch ich fuhr sofort noch in der Nacht auf das Schlachtfeld. Ein
unbeschreiblicher Anblick! Neben Toten und Verwundeten lagen auch noch viele gerade in ihren letzten Zügen.
Bis Sonntagmittag war die Wegschaffung der Verwundeten beendet, die Toten waren gesammelt und durch die
Truppenteile beerdigt worden. In Saarbrücken sah es aber sehr traurig aus. Alle Spitäler waren überfüllt, alle
Gasthäuser voll, und in den Gartenwirtschaften war der Boden mit Stroh bedeckt, worauf Verwundete gelagert
wurden. Auch bei meinem Freund Reinhold war eine große Zahl im Restaurationsgarten gebettet. Nachdem die
ersten Verbände angelegt waren, wurden die Verwundeten per Bahn nach den zunächst gelegenen Spitälern
verbracht. Viele Leichtverwundete wurden gerne in Privatwohnungen aufgenommen, bis sie teils wieder ihrem
Regiment folgen, oder aber per Bahn nach der Heimat gebracht werden konnten, oder auch in Krankenhäusern
ihrer Garnison Aufnahme fanden. Ein jeder war bemüht, soviel er nur konnte, sich den braven Soldaten dankbar
zu erweisen und ihnen Ihre Lage soviel als möglich zu erleichtern. Denn jedermann fühlte sich hierzu verpflichtet.
Wurden wir doch an diesem denkwürdigen 6. August durch ihre Tapferkeit von der Furcht und Angst befreit, von
den Franzosen überfallen und von iZuaven und Turkos gebrandschatzt zu werden. Vom 7. August an, dem Tag
nach der Schlacht, nahm eine Zeit lang der Truppendurchmarsch kein Ende. Ein Regiment folgte dem anderen,
alles nach Frankreich hinein. Bei der Folsterhöhe, in der Nähe des Schlachtfeldes von Spichern, war die Grenze
zwischen Frankreich und Preußen. Sooft ein Regiment an dem Grenzpfahl ankam, wurde Halt gemacht. Der
betreffende Truppenführer hielt eine kurze Ansprache an die Soldaten, machte dabei aufmerksam, daß seine Leute
jetzt die Feindesgrenze überschritten, ermahnte sie eindringlich, sich auch im Feindesland als brave Soldaten zu
zeigen, und brachte zum Schluß ein Hurra auf seine Majestät den König aus. Mit großer Begeisterung stimmten
die Soldaten in dieses Hurra ein und so zog Alldeutschland nach Frankreich hinein, dem geschlagenen Gegner auf
dem Fuße folgend, bis er sich unter dem Schutze der Festung Metz wieder stellte. Dort wurde er am 14., 16. und
18. August wieder von unseren Truppen angegriffen, überall geschlagen und zurückgedrängt, durch
Gewaltmärsche umgangen und durch die große und verlustreiche Schlacht von Gravelotte in die Festung Metz
zurückgeworfen, eingeschloßen und von seiner Verbindung mit dem übrigen Frankreich abgeschnitten; eine
Waffentat, welche ja die Verwunderung der ganzen Welt gefunden hat. Die den gefallenen Helden zu Ehren
errichteten Denkmäler geben Zeugnis von dem heißen Ringen, welches auf diesem historischen Boden stattfand,
und von dem man sagen kann: "Erkämpft haben ihn die Alten, zum Erstaunen der ganzen Welt; die Jungen sollen
es erhalten, das so teuer erkaufte Totenfeld." Mit der Einschließung der französischen Armee in Metz war der
Ausgang des Feldzuges zu Gunsten Deutschlands entschieden, obschon noch viele und verlustreiche Schlachten
und Gefechte stattfanden, bis der Friedenßchluß erfolgte.
VIII. beim Prinzen Friedrich Karl von Corny.
wie schon erwähnt, hatte ich das Metzgergeschäft meinem Gesellen Wilhelm Meyer übertragen. Die anderen
Arbeiten stockten alle und ich habe mich nur mit den Kriegsereignißen beschäftigt. Mein früherer
Regimentskommandeur Prinz Friedrich Karl befehligte die zweite Armee, welche Metz belagerte und zur
Übergabe zwingen sollte. Bei dieser für mich arbeitslosen Zeit erinnerte ich mich eines Tages der Worte, welche
der Prinz, als er im Sommer 1855 von seinem Regiment Abschied nahm, gesprochen hatte. Ich faßte daher den
Entschluß, mich an ihn zu wenden und zu versuchen, ob es mir nicht gelinge, als Lieferant von Schlachtvieh für
die Armee zugelaßen zu werden. Der Gedanke beschäftigte mich tagelang, wie ich es am besten anfangen solle,
um mein Ziel zu erreichen. Endlich entschloß ich mich nach Corny zu reisen, wo der Prinz sein Hauptquartier im
dortigen Schloß aufgeschlagen hatte. Ich suchte mir meine Militärpapiere zusammen und fuhr am 18. Oktober
nach Remilly und von da mit der Feldbahn, welche die Militärverwaltung von den Bergleuten der Saargruben von
Remilly nach Pont-a-Moußon, um Metz zu umgehen, hatte bauen laßen. Dieser Platz war, ebenso wie Nancy,
damals schon von den deutschen Truppen besetzt. Von Pont a Moußon konnte man noch bis Noveant gegenüber
Corny mit der Bahn fahren; dort hörte sie auf. Von Noveant ging ich über die Kettenbrücke nach Corny, wo ich
abends 9 Uhr ankam. Ein Nachtquartier konnte ich dort nicht finden. Endlich gelang es mir, bei den Gebrüdern
Apprederis aus St.Ingbert, welche dort einen Verkauf errichtet hatten, die Nacht auf einer Bank zu verbringen. Am
anderen Morgen ging ich nach dem Schloß, an deßen Eingang die Hauptwache errichtet war und ein
Doppelposten stand. Ich verlangte den Wachhabenden zu sprechen und wurde vom Posten in die Wachstube
gewiesen. Bei meinem Eintritt wurde ich vom wachhabenden Offizier (es war ein Hauptmann) mit den Worten
empfangen: "Was wünschen Sie?" Ich erzählte ihm mein Vorhaben, zeigte meine Militärpapiere vor und fügte die
Worte hinzu, welche seinerzeit der Prinz an sein Regiment gerichtet hatte. Nach Durchsicht meiner Papiere sah er
mich eine Weile an und sagte dann: "Kommen Sie mit." Ich wurde durch zahlreiche Büroräume durchgeführt.
Endlich kamen wir an eine Tür, an der mein Führer anklopfte. Ich mußte außerhalb stehen bleiben, während er mit
meinen Papieren ins Zimmer eintrat. Bald öffnete sich die Tür und es wurde mir bedeutet, ich sollte eintreten. Ein
Adjutant des Prinzen mit Majorsabzeichen fragte mich nach meinem Begehr, worauf ich auch diesem wieder
erzählte, was mich zu diesem Schritt veranlaßt hatte. Nachdem er verschiedene Fragen an mich gestellt und mich
von Kopf bis Fuß gemustert hatte, sagte er zu mir: "Warten Sie etwas, "und ging in ein nebenliegendes Zimmer.
Etwa fünf Minuten dauerte es, dann kam er zurück und sagte: "Kommen Sie mit." Ich kam in einen großen Saal,
dort war der Prinz anwesend und von einer Anzahl höherer Offiziere umgeben. Ein Führer übergab meine
Militärpapiere dem Prinzen, der diese und mich dann ansah und ein paar Fragen an mich richtete, wo mein
Wohnsitz und was mein Gewerbe sei. Als ich seine Frage beantwortet hatte, sagte der Prinz, zu dem Adjutanten
gewendet: "Empfehlen Sie den Herrn beim Generalintendanten." Damit verließen wir das Zimmer des Prinzen
und kamen in das Zimmer des Generalintendanten. Der Adjutant teilte mein Anliegen mit mit dem Hinzufügen,
daß wir direkt vom Prinzen kämen. Dieser Herr war äußerst freundlich und richtete noch einige Fragen an mich;
dann meint er: "Ich selbst schließe keine Kontrakte für Lieferungen ab; dies ist Sache der Feldintendanturen. Sie
müßen nach Remilly gehen, wo unsere Feldintendantur ihren Sitz hat. Ich werde Ihnen aber ein Schreiben dahin
mitgeben." Darauf bat er mich, einen Augenblick Platz zu nehmen und gab mir nachstehendes Schreiben mit:
Vorzeiger dieses, Herr Joh. Zeitz aus Altenwald, wird zur Ausführung von Aufträgen in
Lieferungsangelegenheiten empfohlen, sofern eine nähere Prüfung seiner Verhältniße nicht etwa
Bedenken hervorruft. Der hier gemachte Eindruck ist günstig gewesen.
Corny, den 20. Oktober 1870
der Generalintendant der zweiten Armee.
Engelhardt.
An die königliche Feldintendantur der Generaletappeninspektion,
II. Armee in Remilly.
Mit diesem Schriftstück, welches sich noch jetzt bei meinen Papieren befindet, verließ ich hocherfreut Corny, um
so schnell wie möglich nach Remilly zur Feldintendantur zu kommen. Der Vorstand dieser Intendantur hieß
Lischke. Noch am selben Tage traf ich dort ein und übergab dem Herrn Intendanten mein Empfehlungßchreiben.
Dieser Herr empfing mich nicht sehr freundlich. Nach Durchsicht des Schreibens sagte er in recht barschem Ton
zu mir: "Wie kommen Sie dazu?" Nun mußte ich auch diesem wieder erzählen, was mich veranlaßt hatte, nach
Corny zu gehen. Ich sah, daß Herr Lischke keine große Freude an mir hatte, wohl aus dem Grunde, weil er andere
Lieferanten, die ihm beßer als ich bekannt waren, genug zur Verfügung hatte. Er stellte mir die Frage: "Was
können Sie liefern?" Ich erwiderte ihm, daß ich das Metzgereigeschäft gelernt hätte, und ich in der Lage wäre,
Schlachtvieh jeder Art, Schweine, Rindvieh, Hammel u.s.w. zu liefern. Darauf sagte der Intendant zu mir: "Heute
kann ich nicht abschließen; ich habe heute alles für sieben Tage abgeschloßen. Kommen Sie nach sieben Tagen
wieder her, und bringen Sie mir von Ihrer Heimatsbehörde ein Zeugnis über ihre persönlichen und finanziellen
Verhältniße mit. Wenn darin alles in Ordnung ist, dann sagen Sie mir, wie viel und was sie liefern können, und ich
werde dann einen Abschluß mit Ihnen machen." Glücklich und froh reiste ich von da nach Hause. Am anderen
Morgen ging ich zu unserem Bürgermeister, Herrn Ganns in Sulzbach, zeigt ihm das Schreiben, welches ich im
Hauptquartier in Corny erhalten hatte, und bat ihn, mir ein Zeugnis über meine Verhältniße außtellen zu wollen.
Der Herr Bürgermeister freute sich selbst über meinen Erfolg in Corny und stellte mir sofort das gewünschte
Attest aus, welches ebenfalls noch in meinem Besitz ist und folgenden Wortlaut hat:
auf besonderes Verlangen bescheinigt der Bürgermeister von Sulzbach bei Saarbrücken dem
vormaligen Metzgermeister, jetzigen Unternehmer Herrn Johann Zeitz zu Altenwald, 35 Jahre alt,
hiermit, daß er ein Bürger hiesiger Gemeinde ist, der eines guten Rufes und eines vollen Vertrauens
sich erfreut, daß er ein unternehmender Mann mit Vermögen ist, der alles, was er anfängt, auch zur
Zufriedenheit ausführt.
Sulzbach, den 21. Oktober 1870
der Bürgermeister
Ganns
In diesem Zeugniße war alles gesagt, was die Militärverwaltung gewünscht hatte, ich durfte hoffen, daß ich mein
Ziel erreichen und nach ein paar Tagen in Remilly ein lohnendes Geschäft abschließen würde, wozu ich am 28.
dort eintreffen wollte.
{...}
XII. Übersiedelung nach Metz.
Nachdem alle Vorbereitungen für den beabsichtigten Umzug getroffen waren, siedelte dann am 6. April 1872
meine Familie mit sieben Kindern von Altenwald nach Metz über. Die beiden ältesten, Fritz und Luise, starben
frühe, Fritz im Alter von 6 Jahren, Luise im Alter von 2 1/2 Jahren. Beide liegen auf dem Friedhof in Sulzbach,
wo ich ihre Überreste im Jahre 1906 mit denjenigen meiner seligen Mutter vereint umgebettet habe. Das älteste
Kind war damals Ludwig, geboren 13. November 1861, dann kam Maria, geboren 21. Dezember 1862, Karoline,
geboren 23. Dezember 1863, Sophie, geboren 5. Januar 1866, Johann, geboren 14. April 1868, Anna, geboren 8.
Februar 1870, Gottfried, geboren am 28. Januar 1872. Mit dieser sieben Kindern, wovon das älteste 11 Jahre, das
jüngste zwei Monate alt war, hielt ich am 6. April (einem Sonntagabend) meinen Eingang in Metz und verbrachte
die erste Nacht mit den Meinigen in meinem schon genannten Hotel. Eine Wohnung hatte ich mir inzwischen am
deutschen Wall gemietet und soweit hergerichtet, daß ich diese am anderen Tage mit meiner Familie beziehen
konnte. Nach Verlauf von sechs Monaten kaufte ich mir mein eigenes Haus und bezog daselbe in der
Medardenstraße 13 , woselbst auch die nötigen Stallungen für meine Pferde vorhanden waren. Der Abschied von
unseren Familien in Sulzbach - Altenwald war für uns gegenseitig ein recht schwerer gewesen. War ich doch der
Erste und bis dahin Einzige, welcher das Familiennest verlassen und sich eine neue Heimat gesucht hatte. Auch
dieser Abschied ist mir ein lebenslänglicher Gedenktag geblieben. Der Besuch von unseren Familienangehörigen
war in den ersten Jahren ein sehr reger und lebhafter, bis alle wußten und überzeugt waren, daß es uns in Metz gut
gehe. Und auch ich war froh, jetzt an einem Orte zu wohnen (worauf mein Augenmerk schon lange gerichtet war),
wo ich bessere Schulen als in meiner früheren Heimat für meine Kinder hatte. Dieses war bei meiner so
zahlreichen Kinderschar sehr in Betracht zu ziehen, da es den Kostenpunkt der Ausbildung wesentlich verbilligen
konnte. Doch ist leider in dieser Hinsicht meine Absicht nicht ganz in Erfüllung gegangen, worüber ich an einer
anderen Stelle noch Näheres sagen werde. Im allgemeinen kann ich aber doch sagen, daß mit diesem
Heimatswechsel ein Vorteil für mich und meine Familie erwachsen ist. Auch verbesserte sich mein Fuhrgeschäft
allmählich immer mehr. Im Jahre 1873 bekam das Artilleriedepot den Befehl, sämtliche französischen Geschütze
und Munition, womit die Aussenforts bis dahin noch armiert waren, zurückzuziehen und durch preußisches
Artilleriematerial zu ersetzen. Es sollte dies Zug um Zug geschehen, das heißt, bevor ein französisches Geschütz
aus seiner Stellung genommen werden durfte, mußte ein preußisches auf seiner Stelle eingetroffen sein; daselbe
galt auch für die Munition. Im Juni 1873 wurde mit dem Wechsel begonnen. Aus allen Festungen respektive allen
Artilleriedepots der preußischen Militärverwaltung wurde aus den vorhandenen Beständen Artilleriematerial,
Geschütze und Munition jeden Kalibers, in Extrazügen zur Umarmierung der Festung Metz übersandt. Bei
Ankunft der Züge wurde das Material durch die Militärverwaltung an beiden Bahnhöfen entladen, aufgestapelt
und durch Militärposten Tag und Nacht bewacht. Ich wurde beauftragt, nach Möglichkeit die Transporte nach und
von den Forts zu beschleunigen. Von da ab wurde vor- und nachmittags im Artilleriedepot gearbeitet. Mit Beginn
dieser Transporte hatte ich meinen eigenen Pferdebestand schon auf 46 Pferde gebracht. Diese reichten aber noch
nicht aus, ich mußte täglich noch 20-30 Mietpferde einstellen. Damit habe ich das ganze französische
Kriegsmaterial, Geschütze und Munition, eine ungeheure Menge, von den Forts und der Befestigung zurück nach
dem Arsenal gebracht und dieses gleichzeitig mit dem auf den beiden Bahnhöfen lagernden preußischen Material
in einer noch viel größeren Menge ersetzt. Etwa eineinhalb Jahre dauerte es, bis die Umarmierung der Festung
beendet war. Bei der heutigen Ausdehnung der Festung würde eine ähnliche Umarmierung wohl die doppelte Zeit
erfordern, wenn ich annehme, daß dies unter den damaligen Bedingungen geschehen würde. Die französische
Munition wurde, nachdem sie nach dem Arsenal zurückgebracht, unter militärischer Aufsicht unbrauchbar
gemacht und an die Eisengießerei und Geschossfabriken verkauft. Die französischen Bronzegeschützrohre brachte
ich zur Bahn; von dort gingen sie nach den deutschen Geschützfabriken, wo sie nach preußischem Kaliber
umgegossen wurden und dann teilweise später wieder in anderer Form hier eintrafen. Auch wurden
Kirchengemeinden in Elsaß-Lothringen, welche darum nachsuchten, zum Glockenguß Rohre überwiesen,
besonders solchen Gemeinden, welche während des Krieges Beschädigungen an ihren Kirchen erlitten hatten. So
ging denn in diesen Jahren mein Geschäft recht gut. Auch war das Leben in der Familie ein recht glückliches;
alles war gesund und meine größte Freude war, wenn ich an Sonntagen nachmittags mit meiner Frau und meiner
Kinderschar spazieren gehen oder fahren konnte. Am 8. Juni 1873 kam dann noch unser jüngster Sohn August
hier in Metz gewählt. Derselbe wurde am 6. Juli durch Divisionspfarrer Stöcker , dem später so viel genannten
Hofprediger, getauft. 1874 trafen zwei Söhne von meinem Bruder Louis, meine Neffen Louis und Johann, als
Einjährig-Freiwillige bei den Pionieren hier in Metz ein. Auch ihre Schwestern Emma, Lina und Gretchen kamen
hierher in Pension zu Herrn Pfarrer Wenger. 1876 diente dann auch ihr Bruder, der Neffe August, als Einjähriger
bei dem hiesigen Dragoner-Regiment Nr. 10. Meine Neffen haben mir während ihrer Dienstzeit als tüchtige,
stramme Soldaten viel Freude gemacht. Auch ihr Vater war recht befriedigt; denn sie waren solid und brav und
haben den Kostenanschlag, den man gewöhnlich für Einjährige zu Grunde legt, nicht überschritten. Ich weiß es;
denn ich war ihr Zahlmeister. Der Neffe August hat wohl etwas teurer gewirtschaftet; aber dafür war er auch
Kavallerist, und das Reiten ist bekanntlich teurer, als wenn man zu Fuß geht. Ihre Schwestern, die in gleichem
Alter mit meinen Töchtern waren, machten mir ebenfalls Freude. Sie verkehrten täglich in meinem Haus und mit
meiner Familie. Ein wirklich schönes Familienverhältnis hatte sich entwickelt und wurde von beiden Seiten gut
gepflegt und unterhalten. Und ich kann sagen, daß diese Jahre die schönsten und glücklichsten für mich und
meine Familie waren. Aber leider sollte dies nicht von langer Dauer sein. Es traten mit einem Male Verhältnisse
ein, welche des Band zerrissen, Tränen, Kummer und Sorgen hervorriefen, die nicht nur vorübergehend, sondern
andauernd und nachhaltig waren. Dadurch wurde unser Familienbild getrübt und verdunkelt, und die Schatten
liegen noch auf demselben bis zum heutigen Tage. Ich kann wohl wie Hiob sagen: "Oh, daß ich wäre wie in den
vorigen Monaten, in den Tagen, da mich Gott behütete, da seine Leuchte über meinem Haupt erschien, und ich bei
seinem Lichte in der Finsternis ging, wie ich war zu der Zeit meiner Jugend, da Gottes Geheimnis über meiner
Hütte war."
Wie ein schwarzes Band durchziehen diese Vorgänge, die Schlag auf Schlag einander folgten, meinen weiteren
Lebenslauf.
XIII. Meine Kinder.
Im Jahre 1875 wurde mit einem Mal unser bis dahin so schönes Familienleben durch unseren ältesten Sohn Louis
getrübt. Derselbe besuchte seit unserer Übersiedelung das Lyceum in Metz. Den ersten deutschen Direktor dieser
Anstalt, Herrn Dr. Balty, fand ich sehr gut und hatte oft Gelegenheit, mit ihm zu verkehren. Eines schönen Tages
kam er selber zu mir und sagte: "Herr Zeitz, ich bedauere, Ihnen eine Mitteilung über Ihren Sohn Louis machen zu
müssen, die unerfreulich ist. Derselbe verkehrt mit Kameraden, von denen heute sieben aus der Anstalt
ausgewiesen werden mußten. Noch ist Ihr Sohn nicht so schwer belastet; aber wenn noch das geringste vorkommt,
muß auch er ausgewiesen werden." Dies war für mich eine höchst unangenehme und unerfreuliche Nachricht,
umso mehr, da ich bis dahin sonst nie eine Klage über ihn gehört hatte. Ich sagte: "Herr Direktor, was soll und was
kann ich tun, um mit Erfolg dem Übel abzuhelfen?" Dieser erwiderte mir: "Am besten tun Sie, wenn Sie ihn von
der hiesigen Anstalt wegnehmen, damit er aus der verdorbenen Gesellschaft herauskommt und in eine kleinere
Anstalt tun. Vielleicht nach Saargemünd; der dortige Direktor, Herr Scheuffgen, ist ein guter Freund von mir; an
den will ich mich, wenn Sie einverstanden sind, selbst wenden, und er kann dort in die gleiche Klasse wie hier
eintreten." Ich erklärte mich mit dem Vorschlage des Herrn Dr. Balty sofort einverstanden. Nach ein paar Tagen
traf von Herrn Direktor Scheuffgen die Nachricht ein, daß Louis dort aufgenommen werden könne. Danach
wurden seine Sachen geordnet, und am 9. Juni 1875 brachte ich ihn nach Saargemünd und übergab ihn einem
dortigen Lehrer, der mir empfohlen war, Herrn Mörschbacher, in Pension. Unehrenhaftes hatte Louis nicht
begangen; was ihm zur Last gelegt wurde, waren Bubenstreiche, und diese Vergehen hatte ich auch alle, ohne das
geringste zu verschweigen, Herrn Mörschbacher mitgeteilt. Dieser tröstete mich darüber mit den Worten, das
werde sich hier alles verlieren; und ich fuhr beruhigt nach Hause zurück. Um diese Zeit hatte ich auch noch eine
Brennholzlieferung für die Garnisonsverwaltung in Metz übernommen und mußte deshalb öfters nach Bitsch an
die dortigen Oberförstereihen, von wo ich das Holz für meine Lieferung bezogen hatte. Nachdem Louis etwa 14
Tage dort war, machte ich wieder die Reise nach Bitsch; ohne mich anzumelden, unterbrach ich in Saargemünd
den Zug und wollte meinen Sohn aufsuchen. Um die Mittagszeit (sie waren gerade bei Tisch) sprach ich bei Herrn
Mörschbacher vor. Zu meinem großen Schrecken sah ich, daß Louis an Kopf, Nase und dem ganzen Gesicht
verwundet war. Auf meine Frage: "Was ist denn jetzt schon wieder geschehen?" erwiderte Herrn Mörschbacher:"
Seien Sie beruhigt, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht," und erzählte mir den Vorfall. Ich hatte, als ich Louis
Herrn Mörschbacher übergab, mein Einverständnis dazu gegeben, daß Louis an der dortigen Schwimmanstalt
Schwimmunterricht nehmen sollte. Nach dreimaligem Schwimmen wollte er seinen Lehrern gegen deren Willen
zeigen, daß er schon den Kopfsprung machen könne. Der Wasserstand war aber dafür zu niedrig, und er stieß mit
dem Kopf und dem Gesicht auf den Boden auf und verletzte sich das ganze Gesicht. Damit war ich dann wieder
beruhigt und war froh, daß dieser Kopfsprung keine schlimmeren Folgen hatte. Nun ging es dann eine kurze Zeit
in Saargemünd gut. Aber es dauerte nicht lange, da kam wieder eine Klage nach der anderen, daß Louis nicht zu
bändigen sei. Ich stand ratlos da, was ich mit ihm anfangen solle. In dieser verzweifelten Lage schrieb ich an
Vetter Gottfried in Salzungen und klagte ihm meine Not. Dieser schrieb mir gleich zurück, ich soll ihm Louis nach
Salzungen schicken, er würde ihn dann zu einem ihm befreundeten Lehrer (Berger) an die höhere Bürgerschule
nach Schmalkalden bringen, der Louis sicher zu einem besseren Schüler machen und auf bessere Wege bringen
werde. Am 13. August 1875 nahm ich dann Louis wieder von Saargemünd fort und schickte ihn dem Vetter nach
Salzungen. Dort sollte er ein oder zwei Tage bleiben, und dann mit dem Vetter, wie es zwischen uns vereinbart
war, nach Schmalkalden zur Schule gehen. Am ersten Tage nach seiner Ankunft in Salzungen kletterte er im
Garten des Vetters auf einen Baum, fiel herunter und brach den Arm, so daß er vier Wochen in ärztlicher
Behandlung liegen mußte, bevor er zur Schule konnte. Nachdem er wieder hergestellt war, brachte ihn der Vetter
nach Schmalkalden und übergab ihn seinem dortigen Freund, Herrn Berger. Dort ging es dann auch etwa ein Jahr
lang recht befriedigend. Nach Ablauf dieses Jahres wünschte der Vetter, daß Louis das Gymnasium in Meiningen
besuchen solle, und machte mir den diesbezüglichen Vorschlag, mit welchem ich auch wiederum gerne
einverstanden war. Vetter Gottfried hatte auch in Meiningen einen Freund; derselbe war Garten - Inspektor beim
Herzog von Meiningen und kinderlos. Dieser wollte Louis, während er das dortige Gymnasium besuchte, in
Pension nehmen und seine Erziehung mit überwachen. Wiederum ging es auch dort eine Zeit lang gut; Louis hatte
inzwischen das 14. Jahr überschritten und wurde zu Pfingsten 1877 in Meiningen konfirmiert. Ich selbst war
damals geschäftlich zu viel in Anspruch genommen und konnte der Feier dort nicht beiwohnen. Aber meine Frau
und Vetter Gottfried waren zugegen. Alles war bis dahin soweit in Ordnung, und ich freute mich schon im Stillen
darauf, daß, sobald Louis die Berechtigung zum Einjährigen habe, ich Ihn von der Schule weg zu mir ins Geschäft
nehmen könne, wo er mir dann eine Hilfe und Stütze sein sollte. Aber es sollte nicht sein. In den Herbstferien
1877 kam Louis nach Haus. Eines Tages saßen wir nachmittags beim Kaffee, meine Frau, ich, meine Tochter
Maria und Louis, allein beisammen. Da fängt Louis mit einem Male an: „Vater, ich möchte eine Bitte an dich
richten; lass mich Seemann werden, ich möchte so gerne zur See gehen." Ganz erstaunt und aufgeregt über diesen
Plan, stand ich auf und sagte: "Was, Du willst Seemann werden, Du Lausbub? Das erste Schiff, auf das Du gehst,
das geht unter. Lerne zuerst etwas in der Schule; dann komme zurück und hilf deinem Vater im Geschäft, der sich
allein und mit fremder, unzuverlässiger Hilfe herumplagen muß." Kein Wort wurde dann weiter von mir, noch von
ihm gesprochen und ich verließ das Zimmer, wie man sich wohl denken kann, in großer Aufregung.
Nach Ablauf der Ferienzeit fuhr Louis wieder nach Meiningen zurück, ohne nochmals ein Wort von dem Plan zu
erwähnen, und ich dachte, seine Absicht, Seemann zu werden sei endgültig aufgegeben. Doch war dies leider
nicht der Fall. Im August 1878, kurz vor den Herbstferien, brannten vom Gymnasium in Meiningen sieben
Schüler durch, gingen nach Hamburg zur See. Unter diesen war denn auch mein Sohn Louis. Eines Tages kam ich
gegen Abend nach Hause und traf meine arme Frau auf dem Sofa liegend und bitterlich weinend an. Auf meine
Frage, was denn los sei, reichte sie mir ein kurz vorher eingelaufenes Telegramm hin. Darauf stand: "Louis heute
heimlich Meiningen verlassen, wie Leute sagen, nach Hamburg zur See." Unerwartet und wie ein Blitz aus
heiterem Himmel traf auch mich diese Nachricht. Näheres darüber zu sagen, unterlasse ich hier; wer sich in meine
Lage hinein denkt, wird sich über mein Empfinden selbst ein Urteil bilden. Zunächst galt es, meine arme, gute
Frau etwas zu beruhigen. In meinem Auftrag reiste dann Vetter Gottfried nach Hamburg, um Louis aufzusuchen.
Er fand ihn auch dort gleich am ersten Tage seiner Ankunft vor. Von den sieben Durchbrennern waren nur noch
zwei da. Fünf davon kehrten sofort, nachdem sie die Schiffe und die See gesehen hatten, wieder zurück. Den
Vetter hatte ich beauftragt, dafür zu sorgen, daß Louis die nötige Ausrüstung zur See, für Süd und Nord, erhielt
nebst ausreichender Beköstigung; ebenso sollte er auch dafür sorgen, daß er zu dem von ihm selbst gewählten
Beruf ordentlich herangezogen wurde. Nach diesem Streich, den mir Louis wiederum gespielt hatte, hatte ich die
Hoffnung aufgegeben, daß er mir je in meinem Geschäft nützlich sein werde. Und wenn er sich nun einmal diesen
Beruf erwählt hatte (des Menschen Wille ist ja sein Himmelreich) dann sollte er ihn auch ernstlich mit all seinen
Gefahren und Anstrengungen kennen lernen, und nicht nur einen Spaziergang zur See machen. Dem Vetter gelang
es, Louis auf einem Segelschiffe ("Anita") als Schiffsjunge unterzubringen. Der Kapitän des Schiffes, Cohn aus
Stralsund, war gleichzeitig auch Eigentümer desselben. Mit diesem schloss der Vetter einen Vertrag ab, wonach
Louis zwei Jahre als Schiffsjunge an Bord zu bleiben hatte. Während der Fahrtzeit sollte er bei freien Stunden
vom Kapitän Unterricht zur Vorbereitung für die Seemannschule erhalten und eine gleich gute Kost wie die an
Bord befindlichen Offiziere haben. Dafür mußte ich 600 M als besondere Vergütung bezahlen. Für die weitere
Ausrüstung, einschließlich der 600 M für den Kapitän, habe ich telegraphisch den Betrag von 1800 M überwiesen.
Nachdem dann die ganze Ausrüstung auf zwei Jahre besorgt war, brachte ihn der Vetter an Bord, übergab ihn dem
Kapitän und schickte mir den mit diesem abgeschlossenen Vertrag zu. In diesem Schreiben heißt es u. A.: "Als ich
auf dem Schiffe Abschied von ihm genommen hatte und an Land kam, sah ich mich nochmals nach dem Schiffe
um. Da saß Louis schon auf der Spitze vom höchsten Mast und winkte mir mit dem Hut Lebewohl zu." Die erste
Reise sollte nach Lagos in Afrika gehen. Das Schiff hatte als Ladung Spirituosen, leere Fässer und so weiter, und
sollte von Lagos Palmöl zurückbringen. Nach dreimonatlicher Reise - die afrikanische Küste war schon in Sicht brach plötzlich in der Nacht Feuer auf dem Schiffe aus. Die ganze Ladung mit Schiff verbrannte, ebenso die ganze
Ausrüstung, die ich Louis beschafft hatte, mit Ausnahme von dem, was er auf dem Leibe trug. Die Besatzung des
Schiffes konnte noch rechtzeitig, bevor das Schiff sank, von einem englischen Kriegsschiff gerettet werden. Von
diesen wurden sie dann nach der Insel St.Vincent gebracht und gelandet. Dort wurden sie später von dem
deutschen Dampfer Bahia an Bord genommen und nach Hamburg zurückgebracht. Eines Tages, es war um die
Zeit, wo meine Tochter Lina krank in Salzungen lag, und meine Frau dort bei ihr war, erhielt ich von Louis den
ersten Brief, seit er zur See war, aus Lissabon. Darin schilderte er, wie es ihm ergangen war, daß sein Schiff
verbrannte und seine ganze Ausrüstung mit Ausnahme dessen, was er an sich hatte verloren sei, und er mit der
ganzen übrigen Mannschaft nach Hamburg zurückkomme. Sobald er dort eingetroffen sei, würde er uns weitere
Nachricht geben. Darnach war denn meine, in Aufregung gemachte Bemerkung: "das erste Schiff, auf das Du
gehst, geht unter" in Erfüllung gegangen. Nach seiner Ankunft in Hamburg erhielt ich von Louis eine Depesche,
welche lautete: "Heute hier eingetroffen,logiere Seemannshaus. Louis." Inzwischen war meine Frau durch meine
Tochter Maria in Salzungen am Krankenbett von Lina abgelöst und bei Ankunft des Telegramms von Louis in
Metz. Um mich nun in Allem genau zu informieren, reiste ich am anderen Tag nach Hamburg und ging nach dem
Seemannshaus. Dort angekommen fragte ich den Ökonom des Hauses, ob ein Schiffsjunge mit Namen Zeitz hier
logiere. "Jawohl“, erwiderte mir dieser, "der ist von der Anita, die verbrannt ist; er logiert auf Nr. 32". Ich bat ihn
darauf, ihn rufen zu lassen; es sei jemand da, der ihn sprechen möchte. Ich setzte mich in einer Ecke des großen
Saales, wo viele Auswanderer anwesend waren, nieder, und bald darauf trat Louis mit dem Ökonomen ein. Dieser
wies auf mich hin und sagte zu Louis: "Dort sitzt der Herr, der Sie sprechen will."Louis kam auf mich zu, scharf
beobachtend; ich blieb ruhig sitzen und sah ihn ebenso scharf an, ohne ein Wort zu sagen. Louis schaute mich an
und sagte ebenfalls nichts. Darauf sagte ich zu ihm: "Kennst Du Deinen Vater nicht mehr?" Da fing Louis zu
weinen an mit den Worten: "Vater, Du hast ja deinen Bart verändert, seit ich dich zum letzten Mal gesehen habe".
Dies stimmte. Darauf sagte ich zu Louis: "Was soll nun aus dir werden? Willst Du jetzt ein ordentlicher Mensch
und fleißiger Schüler werden? Oder was soll aus dir werden?“ Unter bitteren Tränen erwiderte er mir: "Vater, lass
mich doch zur See; ich kann ja für dieses Unglück nichts. Rüste mich doch noch einmal aus; das zweite Mal wird
es besser gehen." Ich sah daraus, daß er es ernstlich mit dem Seemannsberufe vorhatte, und rüstete ihn noch
einmal aus. Ich sagte mir eben: was nützt es mir, wenn ich ihn wieder zurück zur Schule bringe? Er wird doch
kein tüchtiger Schüler werden; durch Zwang läßt sich dies nicht erreichen. So hatte ich das Bewußtsein, meine
Pflicht als Vater in jeder Hinsicht getan und nach bestem Wissen und Gewissen in seinem und meinem Interesse
gehandelt zu haben. Auf seiner zweiten Reise, die zwei Jahre dauerte, ging es dann auch besser. Am Kap Horn
wurde er auf dieser Reise beim Sturm vom Mast auf das Schiffsdeck geschleudert, wobei er das Schlüsselbein
brach; es heilte aber gut und blieb ohne Folgen. Als er von dieser zweijährigen Reise zurückkehrte, wurde er von
meiner Frau in Antwerpen in Empfang genommen. Er brachte ein sehr gutes Zeugnis von seinem Kapitän mit.
Danach mußte er noch eine Reise von 8-10 Monaten als Leichtmatrose machen, bevor er Aufnahme auf der
Steuermannsschule finden konnte. Auch diese Reise, welche 11 Monate dauerte, verlief gut; er brachte wiederum
ein sehr schönes Zeugnis mit, wie er es früher in der Schule nie erhalten. Darauf erfolgte dann in Bremen der
Besuch der Steuermannsschule. Ich reiste nach Bremen, um alles für ihn zu ordnen. Mit dem Direktor der Schule,
Herrn Dr. Breusing nahm ich Rücksprache und holte mir dessen Rat ein, wie am besten der Zweck (das Bestehen
des Steuermannsexamens) erreicht werde. Was ich bis dahin alles mit Louis durchgemacht habe konnte ich
natürlich Herrn Dr. Breusing auch nicht verschweigen. Unehrenhaftes hatte er ja auch nie begangen; alles was ihm
zum Vorwurf gemacht werden konnte, waren leichtsinnige Jugendstreiche, die von der Meinung ausgingen, daß
das Geld ja gar nicht alle werden könne. Nach Verabredung mit Herrn Doktor. Breusing schickte ich alles, was
nötig war, für seinen Unterhalt, demselben. Dieser gab ihm dann das Taschengeld und beschaffte alles, was für
seinen Unterricht und seine Kleider, Wäsche und so weiter erforderlich war. In der ersten Zeit ging es auch dort
ganz ausgezeichnet. Herr Doktor Breusing versicherte mir in seinen Briefen, daß Louis sehr gut beanlagt sei und
gar kein Zweifel am Bestehen des Examens sein könne. Der Kursus sollte sechs Monate dauern und nach
bestandener Prüfung sollte er dann als einjähriger bei der Marine eintreten. Damit war ihm dann wiederum
Gelegenheit gegeben, sich zu einer geachteten und gesicherten Lebensstellung empor zu arbeiten. Aber der
Mensch denkt und Gott lenkt. Mit einem furchtbar dicken Strich durchkreuzte mir Louis meine Rechnung. 14
Tage, bevor die Prüfung stattfinden sollte, verließ er plötzlich Bremen und die Schule und ging nach
Wilhelmshaven, meldete sich freiwillig zur Marineinfanterie und war dort von 1882 bis 1885 Soldat. Vom
Bezirkskommando wurde ich um mein Einverständnis zum Eintritt befragt. Was sollte ich anderes tun, als meine
Zustimmung geben? Ich war froh, als ich wußte, daß er unter militärischer Aufsicht war. Eine bewegte Dienstzeit,
die ich hier übergehen will, machte er durch. Dennoch war er auch dort bei seinen Vorgesetzten und Kameraden
sehr beliebt. Er war ein guter Mensch, solange er etwas hatte, litten auch seine Kameraden keine Not. Nachdem
seine Dienstzeit um war, richtete sein Hauptmann, Herr von Rosen, einen Brief an mich und bat inständig, doch
meinem Sohn nochmals Gelegenheit zu geben, sein Steuermannsexamen zu machen und die Hand nicht von ihm
abzuziehen; sonst sei er verloren. Er sei wirklich ein guter Mensch, und es wäre doch zu schade, wenn er sein
ganzes Leben auf der Handelsmarine als Matrose verbringen müsse. Dieser Brief machte bei mir, sowie allen, die
ihn gelesen haben, großen Eindruck, und ich entschloss mich dazu, Louis die Steuermannsschule zum zweiten
Mal besuchen zu lassen. Ich verlangte aber, daß er vorher nochmals eine Reise als Matrose mache, für diese Reise
aber sich seinen ganzen Unterhalt selbst verdienen und mit einem guten Zeugnis über tadellose Führung
zurückkomme. Daß er Ersparnisse auf der Reise zum Besuch der Steuermannsschule machen müsse, habe ich
nicht verlangt. Und nach den bis dahin gemachten Erfahrungen glaube ich auch nicht, daß er meinem Wunsche
entsprochen hätte, obschon dies bei Vielen geschieht, und bei gutem Willen auch geschehen kann. Jede weitere
Unterstützung hatte ich ihm von da ab versagt. Ob ihm sonst von einer Seite Zuwendungen gemacht wurden, weiß
ich nicht. Er machte dann als Matrose eine zweijährige Reise, kam mit einem sehr guten Zeugnis zurück ging
dann auf die Steuermannsschule nach Timmel, wozu ich ihm wieder meine Unterstützung zugesagt hatte. Nach
vier Monaten verließ er wiederum auch diese Schule und ging als Matrose zur See. Unsagbar war der Kummer
und die Sorge, welche er meiner Frau und mir dadurch nochmals bereitet hatte, ohne daß wir in der Lage waren,
etwas daran ändern zu können. Er selbst ließ lange nichts mehr von sich hören, ich wollte auch nichts mehr von
ihm hören und war froh, wenn gar nicht nach ihm gefragt wurde. Ende des Jahres 1897 tauchte er wieder in
Hamburg auf, mit besten Zeugnissen versehen, war als tüchtiger Seemann bei den Reedern bekannt. Um diese
Zeit wurde ein Steuermannskursus auf der Schule in Papenburg eröffnet. Von allen Seiten wurden Versuche
gemacht und mir zugeredet, zum dritten Mal nochmals Louis zu unterstützen. Er wollte auf dieser Schule noch
einmal versuchen, das Examen zu bestehen. Wiederum ließ ich mich überreden und gab meine Einwilligung, ohne
daß er vor Bestehen des Examens nach Hause kommen durfte. Dort in Papenburg hat er dann endlich sein Examen
gut bestanden, und die Regierung von Osnabrück stellte ihm am 12. März 1898 das Zeugnis der Befähigung aus,
deutsche Schiffe in jeder Größe und in allen Meeren zu führen. Nun wurde er sofort von der Reederfirma
Rickmers in Bremen als Untersteuermann engagiert. Bevor er seine Stelle antrat, machte er uns nach langer Zeit
wiederum seinen ersten Besuch, diesmal als Untersteuermann; er war ein starker, stattlicher und kräftiger junger
Mann geworden. Nach etwa 14 Tagen mußte er an Bord gehen. Diese Reise dauerte etwa ein Jahr. Mit sehr gutem
Zeugnis kam er wiederum zurück, und wurde von derselben Firma als Obersteuermann angestellt. Auf der Reise,
die er als Obersteuermann machte, erhielt ich von ihm einen Brief aus Singapur. Darin schrieb er mir unter
anderem: der Schwiegersohn von seinem Reeder Rickmers sei Major bei den schwarzen Dragonern in
Diedenhofen; und wenn ich Gelegenheit hätte, diesen einmal zu sprechen, solle ich ihn bitten, bei seinem
Schwiegervater ein gutes Wort für ihn einzulegen, daß er, wenn er von dieser Reise zurückkäme, ein eigenes
Schiff als Kapitän erhalte. Etwa 14 Tage später kamen die Dragoner aus Diedenhofen wie alljährlich zum Brigade
- Exerzieren nach Metz, wurden teils in der Stadt, teils in nächster Umgebung einquartiert auf die Dauer von vier
Wochen. Ein gewiß sonderbarer Zufall war es, daß mir vom städtischen Quartiermeisteramt ein Billet zur
Unterbringung von drei Pferden des Herrn Major Hoffmann und seines Burschen während der Dauer des Brigade
- Exerzieren zugestellt wurde. Der Major Hoffmann logierte im Hotel, kam aber täglich in meinen Hof, um seine
Pferde und ihre Stallungen zu sehen. Auch seine Frau kam öfters hierher. So hatte ich die schönste Gelegenheit,
dem Wunsche von Louis zu entsprechen. Der Major Hoffmann versprach mir bereitwilligst, alles zu tun, was er
könne; selbstverständlich ohne etwas bestimmtes versprechen zu können. "In erster Linie," sagte er, "muß Ihr
Sohn tüchtig und zuverlässig sein, und zweitens muß ein Schiff frei werden. Jedenfalls aber werde ich den
Wunsch Ihres Sohnes meinem Schwiegervater unterbreiten." Dies hat er auch getan. Louis kam wohlbehalten
auch von dieser Reise zurück, und sein Kapitän hatte auch in jeder Hinsicht ein sehr gutes Zeugnis als
Obersteuermann ausgestellt. Bald nach seiner Ankunft in Bremen ließ ihn sein Reeder aufs Kontor kommen und
sagte ihm, daß ich mich durch seinen Schwiegersohn an ihn gewandt hätte, daß aber zu seinem Bedauern jetzt
kein Schiff frei sei, und er einen älteren Kapitän ohne Grund doch nicht entlassen können. Er möge noch eine
Reise als Obersteuermann machen und dann, wenn er wieder zurückkäme, wolle er dafür sorgen, daß er als
Kapitän sein eigenes Schiff erhalten. Gleichzeitig gab ihm der Reeder einen Urlaub von sechs Wochen und
händigte ihm ein Billet zweiter Klasse zur Reise nach Metz ein. Nach Ablauf seines Urlaubes sollte er dann nach
erhaltener Nachricht in Dünkirchen (Frankreich) als Obersteuermann wieder an Bord. Louis kam gut bei uns an,
war aber etwas verstimmt darüber, daß sein Wunsch vom Reeder nicht sofort erfüllt wurde. Ich redete ihm, so gut
ich konnte, zu, daß er unter diesen Verhältnissen durchaus keinen Grund habe, unzufrieden zu sein, und auch seine
Mutter tat , was sie konnte, ihm eine andere Ansicht beizubringen; er hat sich dann auch scheinbar beruhigt. Sein
Urlaub verlief schnell, und eines Tages traf aus Bremen die Nachricht ein, er solle in Dünkirchen an Bord gehen.
Als diese Nachricht eintraf, schien mir das Benehmen von Louis etwas bedenklich, und ich sowie meine Frau
rieten ihm dringend zu, doch ja in Dünkirchen an Bord zu gehen. Er versprach es uns dann auch. Als der Tag zur
Abreise kam, begleitete seine Mutter und ich ihn nachts um 2 Uhr zur Bahn, wo er um diese Zeit mit dem
Schnellzuge nach Brüssel abfuhr und von da nach Dünkirchen weiterreisen sollte. Auf dem Bahnhof von Metz
nahm er von uns herzlichen Abschied unter nochmaligem Versprechen, nach Dünkirchen zu gehen. Daß dieser
Abschied der letzte von Metz, wie auch von seiner Familie war, hatte ich nicht vermutet. In Brüssel angekommen,
hatte er sich eines anderen besonnen. Statt nach Dünkirchen zu gehen, ging er auf das belgische Ministerium vom
Kongostaat, legte dort sein Prüfungs - und andere Zeugnisse vor, wurde sofort als Kapitän eines Schiffes für den
Kongostaat angestellt. Etwa acht Tage nach seiner Abreise kam an mich ein Schreiben vom belgischen
Ministerium, welches eine Abschrift des Vertrages erhielt, den Louis abgeschlossen hatte, und daß ich und meine
Frau zur Kenntnisnahme unterzeichnen sollten. Unter anderem enthielt der Vertrag auch die Bestimmung, daß ich
und seine Mutter bei einem etwaigen Ableben als seine Erben anzusehen seien. Wir haben dies Schriftstück, da
wir ja doch nichts ändern konnten, unterzeichnet zurückgesandt. Zur selben Zeit kam von Bremen auch ein
Schreiben von Herrn Rickmers an, daß meldete, Louis sei in Dünkirchen nicht an Bord gegangen. Ein jeder wird
verstehen, wie peinlich und verdrießlich mir die Sache war. Doch war ich wiederum außer Stande, etwas daran zu
ändern. Louis war und blieb ein unberechenbarer Mensch. Von da ab war nun wiederum jeder Verkehr zwischen
uns abgebrochen. Über drei Jahre vergingen, ohne daß wir auch nur das Geringste von ihm hörten. Da kam am 8.
Januar 1906 ein Brief aus Hamburg von der Wörmann – Linie, der folgenden Wortlaut hatte:
"Hierdurch machen wir Ihnen die traurige Mitteilung, daß der Kapitän Louis Zeitz vom Dampfer
"Arto "nach einem uns aus Lagos eingetroffenen Telegramm am Fieber gestorben ist. Sobald wir
schriftlichen Bericht von drüben haben, werden wir Ihnen weitere Mitteilung zugehen lassen.
Inzwischen versichern wir Sie unserer aufrichtigen Teilnahme an dem schweren Verlust, der Sie
getroffen hat."
Nach dem mir später aus Lagos zugegangenen Totenschein, welcher in meinen Papieren vorhanden ist, ist Louis
dort nach einer Krankheit von zwei Tagen am 4. Januar 1906 gestorben und auch dort beerdigt worden. Durch
hiesige Bekannte erfuhr ich die Adresse eines jungen Kaufmannes, des Herrn Oskar Haug, welcher in einem
großen Speditionsgeschäft in Lagos tätig war. An diesen habe ich mich sogleich gewendet und angefragt, ob er
mir nichts Näheres über Louis, seine Krankheit und Beerdigungen mitteilen könne. Von ihm erhielt ich dann auch
umgehende Nachricht. Ich beauftragte danach wiederum Herrn Haug, das Grab von Louis auf meine Kosten zu
ordnen und einen Kranz in meinem Namen und im Namen meiner Familie niederzulegen. Ein späterer Brief von
Herrn Haug bestätigte mir, daß er meinen Auftrag besorgt habe. Weiter berichtete er mir dann noch, daß er Louis
seit fast zwei Jahren kannte, da er mit seinem Schiff öfter dort ankam und seine Ladung löschte, oder andere an
Bord nahm, sowie, daß er viel mit ihm verkehrt habe. Ganz besonders hob er hervor, welch guter Mensch und
tüchtiger Seemann, der keine Gefahren kannte, er gewesen sei, und wie beliebt er bei seinen Matrosen sowie
allen, die mit ihm verkehrten, war. Ein kräftiger Riesenmensch und der richtige Schiffskapitän, der alles für sein
Schiff und seine Mannschaft einsetzte, während diese wiederum alles für ihren Kapitän taten. Von Jugend auf
hatte Louis ein sehr gutes Gemüt. Wenn er was hatte, so hatten auch die, welche bei ihm oder um ihn waren. Dies
war wohl eine Erbschaft seiner seligen Mutter. Er blieb diesem Grundsatze treu bis an sein Ende. Nach den vielen
Irrwegen, die er im Leben gegangen ist, hat er sich doch noch eine ehrenvolle Stellung errungen. Er ruht nun in
fremder Erde; möge es ihm leicht sein!
Während wir so seit Jahren mit Louis die große Sorge hatten, ließ mit einem Male der Gesundheitszustand unserer
Tochter Lina zu wünschen übrig. Der hinzugezogene Arzt erklärte, es sei Blutarmut vorhanden, und ordnete eine
Kur in einem Soolbade, Kreuznach oder Salzungen, an. Ich teilte dies dem Vetter Gottfried mit, und dieser bat in
der freundlichsten, liebenswürdigsten Weise darum, Lina zur Kur nach Salzungen zusenden. Der dortige Badearzt,
Medizinalrat Wagner, sei sein bester Freund, und alles Mögliche solle Geschehen, um eine erfolgreiche Kur zu
erzielen. So wurde denn im Mai 1879 die Vorbereitung zur Reise nach Salzungen getroffen. Da wir Lina, obschon
sie sonst stark und kräftig war, die weite Reise nicht allein machen lassen wollten, entschloß sich meine Frau, sie
zu begleiten. Mitte Mai brachte ich beide des Morgens früh 5 Uhr zur Bahn. Heute noch sehe ich das kräftig
entwickelte, gute Kind vor mir, als es mir beim Abschied auf der Bahn, als sich der Zug in Bewegung setzte, die
Worte: "Adieu, lieber Vater!" zurief. Am Nachmittag gegen 4 Uhr trafen sie in Eisenach ein, wo sie Vetter
Gottfried empfangen und nach Salzungen geleitet hat, wo die Ankunft gegen 7 Uhr abends erfolgte. Anderen
Tages wurde dann gleich mit der Kur begonnen, und die ersten Berichte, welche eintrafen, waren günstig. Bald
änderte es sich aber, und die Nachrichten wurden immer weniger befriedigend. Nach Verlauf von etwa drei
Wochen war immer noch keine Besserung vorhanden, und meine Frau wurde in meinem Haushalte sehr vermißt.
Zwischen uns beiden wurde daher verabredet, daß unsere älteste Tochter Maria nach Salzungen fahren und bei
ihrer Schwester bleiben, meine Frau hingegen nach Metz zurückkehren sollte. Meine Frau traf wohlbehalten
wieder hier ein, konnte mir aber keinen günstigen Bericht über Lina erstatten. Im Gegenteil, ich merkte an allem,
daß es bedenklicher war, als sie es mir sagen wollte. Die brave Tochter Maria, welche ihrer Schwester so treu zur
Seite stand, ließ während der langen Krankheitsdauer nicht einen Tag vergehen, ohne uns einen Krankenbericht
durch Postkarte zugehen zu lassen. Leider aber konnte auch sie uns nichts Günstiges berichten. Mitte August
wurde der Zustand - es hatte sich ein Lungenleiden herausgebildet - derart bedenklich, daß mir Herr Medizinalrat
Wagner durch Briefe selbst über den hoffnungslosen Zustand meiner Tochter berichtete; wenn ich sie lebend
zurückhaben wolle, müsse die Rückreise baldigst angetreten werden. Nach Empfang dieses Briefes reiste ich
sofort nach Salzungen. Als ich dort ankam, fand ich das gute, arme Kind todkrank vor. Wie hatte sie sich seit den
zwei Monaten verändert, da sie so frisch und froh von mir Abschied genommen! Wie betrübend war für mich das
Wiedersehen in diesem Zustand! Ich mußte leider die Hoffnung auf ihre Genesung aufgeben und die Gedanken
darauf richten, wie der Schwerkranken noch die Reise bis Metz zu ermöglichen sei. Nach Verhandlungen mit der
Bahnverwaltung wurde mir ein Waggon zweiter Klasse gegen Zahlung von sechs Billets 2. Klasse von Salzungen
bis Metz zur Verfügung gestellt. Darauf wurde in einem Kupee ein Bett für Lina errichtet. Nachdem dann so alle
Vorbereitungen fertig waren, traten wir die Rückreise mit großen Sorgen an, hauptsächlich darüber, ob die Kräfte
der Kranke noch für diese Reise erhalten werden könnten. Welch eine Angst - und qualvolle Reise, bis Metz
erreicht wurde! Ein paar schwere Anfälle traten unterwegs ein, wo ich das Schlimmste befürchtete. Aber wir
kamen Gott sei Dank durch, trafen abends 11 Uhr auf dem Bahnhof in Metz ein. Durch meine Frau war unser
Hausarzt Dr. Tr.* (welcher Lina, bevor sie nach Salzungen fuhr, behandelte) von unserer Ankunft benachrichtigt.
Derselbe erwartete uns auf dem Bahnhofe mit einer Tragbahre und den nötigen Trägern bei Ankunft des Zuges,
um von da aus die fast ganz erschöpfte Schwerkranke nach Haus zu bringen. Jede Hoffnung auf
Wiederherstellung war bei uns allen geschwunden. Nur die Kranke allein hatte die Hoffnung nie aufgegeben. Es
geschah alles, was Geschehen konnte, ihr Leiden zu mildern, ohne damit der tückischen Krankheit Halt gebieten
zu können. Gottergeben ertrug das gute Kind in Geduld das schwere Leiden, welches sie befallen hatte, bis sie der
Tod am 9. Oktober, vormittags 91/4 Uhr, davon erlöste im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen. Hierbei
kann ich nicht unterlassen, die besonderen Liebes - und Freundschaftsdienste zu erwähnen, welche der gute Vetter
Gottfried und seine Familie der Kranken und damit auch mir und meiner Familie in dieser schweren Zeit erwiesen
hat, und wofür ich noch einmal hier an dieser Stelle herzlichen Dank sagen muß. Über meine anderen Töchter
kann ich nur sagen, daß sie, solange sie bei uns im Elternhause waren, meiner Frau und mir nur Freude gemacht
haben.
Meine älteste Tochter Maria verheiratete sich am 20. Januar (dem Geburtstage ihrer Großmutter) 1884 mit Herrn
Oberförster Julius Roos. Am anderen Tage verließ sie das Elternhaus hier in Metz und bezog ihr neues Heim in
Daun in der Eifel auf der dortigen Burg, welche meinem Schwiegersohn als Dienstwohnung überwiesen war. In
siebenjähriger glücklicher Ehe schenkte sie drei Kindern das Leben, wovon das eine bald nach der Geburt starb.
Die beiden älteren Kinder, Maria und Julius, wuchsen zur Freude der Eltern wie Großeltern kräftig heran. Ganz
unerwartet wurde sie dort in dem rauen Klima der Eifel von einem Lungenleiden befallen, welches anfänglich von
den dortigen Ärzten als weniger bedenklich angesehen wurde; aber das raue Klima schien der Wiedergenesung
hinderlich zu sein. Ein Straßburger Professor, Dr. Naunyn, verordnete eine Kur in Weisenburg in der Schweiz.
Nach mehrmonatigem Aufenthalte dortselbst mußte sie für die Winterszeit nach Italien gehen, und zwar nach
Ospedaletti. Von dort kehrte sie im Frühjahr zurück, um sich in der Klinik zu Freiburg i. B. einer kleinen
Operation zu unterziehen. Diese hatte anscheinend einen guten Verlauf und sie kehrte bald darnach zu den Ihrigen
nach Daun zurück. Abwechselnd trat dann wohl auch eine Besserung ein, doch war sie nie von Dauer gewesen.
Die Kräfte schwanden zusehends und die Hoffnung auf Wiedergenesung ebenfalls. Sie starb nach langem,
schwerem Leiden unter der fürsorglichen Pflege eines liebenden Gatten gottergeben am 30. Dezember 1892 und
wurde an der Seite ihres vorangegangenen Kindes auf dem evangelischen Friedhof in Daun beerdigt.
Mit meiner Maria habe ich eines meiner besten und begabtesten Kinder verloren.
Meine Tochter Sophie verheiratete sich am 14. August 1888 mit Dr. Scheele, Gymnasiallehrer in Metz, später in
Thann und Saargemünd. Aus dieser Ehe sind bis jetzt drei Töchter hervorgegangen, Marianne und Sophie, ein
Zwillingspaar, und Frieda, welche alle hier in Metz im großelterlichen Haus das Licht der Welt erblickten, und
sich noch bis heute einer guten Gesundheit erfreuen.
Über meinen Sohn Johann muß ich leider einen längeren und für mich recht betrübenden Bericht erstatten.
Derselbe besuchte das Metzer Gymnasium vom Frühjahr 1874 bis April 1883. Am Lernen hatte er nie große Lust,
und machte während seiner Schulzeit mir wie auch seinen Lehrern nie Freude. Als er im April 1883 ein
Schulzeugnis erhielt, welches wie gewöhnlich schlecht und unbefriedigend für mich und ihn war, erklärte er mir
mit aller Bestimmtheit, er wolle die Schule nicht mehr weiter besuchen. Diese Erklärung ließ ich ihn selbst auf
seinem letzten Schulzeugnis niederschreiben, um es ihm eventuell, wenn er später zu einer anderen Ansicht
kommen sollte, vorzeigen zu können. Mit einem Zwang zur Schule konnte ich mir nach den bis jetzt an ihm
gemachten Erfahrungen einen Erfolg nicht versprechen, und so entschloß ich mich, ihn bei mir in mein Geschäft
zu nehmen, um mit ihm, wie es mein seliger Vater mit mir machte, die praktische Arbeitsschule durchzumachen.
Eine Zeit lang ging es auch leidlich. Aber gar zu bald bekam er einen Widerwillen gegen die Arbeit, ebenso wie
ihm in der Schule das Lernen zuwider war. Darauf wünschte er, daß ich ihn in einem Speditionsgeschäft
unterbringe, damit er sich dort im Kaufmännischen ausbilden und sich das Französische in Sprache und Schrift
aneignen könne. Auch diesen Wunsch habe ich ihm erfüllt. Ich brachte ihn in das mir gut bekannte und
befreundete Speditionsgeschäft von Lallement Fréres hier. Aber auch da dauerte es nur kurze Zeit; ich mußte ihn
wieder zurücknehmen, da er nicht arbeiten wollte. Als ich dann ratlos dastand, was ich mit ihm anfangen sollte,
und er körperlich gesund und kräftig war, entschloss ich mich, Johann bei der Kavallerie als DreijährigFreiwilligen eintreten zu lassen. Er war mit diesem Vorschlage sehr einverstanden. Ich wollte ihn nach Berlin zu
meinem ehemaligen Regiment, dem Gardedragonern, bringen, in dem Gedanken, daß, wenn seine Dienstzeit
vorüber und er drei Jahre älter sein würde, eine andere und verständigere Anschauung sich bei ihm eingestellt
hätte. Mit dem Kommandeur der hiesigen Kavalleriebrigade, General v. Rosenberg war ich gut bekannt. Ich
erzählte ihm mein Vorhaben; er gab Johann ein Schreiben an den Oberst des Gardedragonerregiments mit, und
damit reiste er nach Berlin. Dort wurde er gemustert, aber für das Gardedragonerregiment als zu schwer gefunden.
So kam er nach dieser Spazierfahrt wieder nach Metz zurück. Nun wollte er auf ein Gut und die Landwirtschaft
erlernen. Auch diesen Wunsch gewährte ich ihm, obschon ich mir sagte, daß auch dies nicht von Dauer sein
würde. Ein guter Freund von mir in Euskirchen (Eifel) besorgte eine Stelle für ihn auf einem großen Gute
daselbst. Aber dort ging es ganz bergab. Alle Ermahnungen und alles Zureden half nichts. Wohl versprach er, sich
zu bessern, aber sein Versprechen wurde nicht gehalten, und ich hatte die für mich traurige Gewißheit, daß Johann
ein verlorener Sohn sei, dem wie allen arbeitsscheuen Menschen nicht geholfen werden konnte. Leider wurde er
in seinem Leichtsinn noch durch unverständige, gewissenlose Menschen unterstützt durch Leien von Geld, das
mir später von den verschiedenen Seiten angefordert wurde. Als dann die Landwirtschaft bei ihm
ausgewirtschaftet hatte, mußte ich ihn wieder bei mir aufnehmen, bis die Zeit kam, wo er sich zum Militärdienst
stellen sollte. Mein Wunsch war, daß Johann gleich im ersten Zuge genommen würde, ihn sobald als möglich aus
seiner hiesigen verderblichen Gesellschaft wegzubringen; keinesfalls sollte er in Metz dienen. Mein Wunsch ging
in Erfüllung. Er wurde im ersten Zuge genommen zur Matrosenartillerie und mußte im Oktober 1888 in
Wilhelmshaven eintreten. Seine Militärdienstzeit will ich kurz erwähnen und muß sagen, daß dort die gleiche
Unzufriedenheit bei seinen militärischen Vorgesetzten herrschte, wie bei seinen Lehrern in der Schule und bei mir
im Geschäft. Trotz alledem habe ich ihn während seiner Dienstzeit angemessen und ausreichend unterstützt; doch
reichte er damit niemals. Nach Ablauf seiner Dienstzeit kam er wieder zu mir, und ich hatte mitunter noch
Hoffnung, er müsse, wenn er älter geworden sei, zu der Einsicht kommen daß sein bisheriger Lebenswandel so
nicht weitergehen könne. Aber auch meine letzte Hoffnung hat er vernichtet. Statt meine Hilfe und Stütze im
Geschäft zu werden, wurde er das gerade Gegenteil. Seine verschwenderische Lebensweise erreichte einen Grad,
daß ich mir sagen mußte, so kann es nicht weitergehen. Die Existenz des Geschäftes und der Familie war
gefährdet, und es mußte energisch Halt geboten werden. Darauf erklärte mir Johann, bei mir nicht mehr arbeiten
zu wollen, und ging von mir weg zu einem Spediteur nach Diedenhofen. Nach einem Aufenthalt von nicht ganz
vier Wochen erhielt ich eine Rechnung von einem dortigen Hotel, die mir zeigte, daß es nicht mehr so weitergehen
konnte. Auch er selbst war dieser Ansicht. Seinem Wunsche nach Geld zur Reise nach Amerika habe ich daher
gerne entsprochen. Über Antwerpen erfolgte dann auch die Abreise nach Amerika. Von da ab hörte ich kein Wort
mehr von Johann, bis im Jahre 1894, nach zwei Jahren, ein Brief von ihm, welcher noch in meinen Papieren
vorhanden ist, bei meinem Schwiegersohn Dr. Scheele eintraf. Darin teilte er mit, daß er im September 1894
Chicago verließ und durch die Staaten Illinois ist, Kentucky, Missouri, Arkansas und Mississippi
durchmarschierte, nach Arbeit sich umsehend, ohne das Glück zu haben, einen ständigen Platz zu finden. In New
Orleans bekam er bei einer Gesellschaft eine Stelle; ihm wurde ein größerer Transport von Maschinenteilen nach
dem Inneren des Landes übertragen, und ihm für diesen Zweck 30 Maulesel und 15 Neger als Fuhrknechte zur
Verfügung gestellt. Nach seinen Angaben sollte er bis Ende Januar 1895 mit diesem Transport fertig sein. Danach
beabsichtigte er, von da nach Galveston (Texas) und von dort nach Südamerika zu gehen. Außer diesem Briefe
habe ich weiter nichts mehr von Johann gehört, auch sonst, soviel ich weiß, niemand eine Nachricht von ihm
erhalten. Ob er sich jetzt noch unter den Lebenden findet, ist sehr wenig wahrscheinlich. Alle Ermahnungen seiner
Eltern und Geschwister, seiner Lehrer, ja aller, die es gut mit ihm meinten, ließ er unbeachtet und ging auf seiner
leichtsinnigen Laufbahn so weiter in den Abgrund hinein. Ich frage mich oft, woher es kommt, daß meine Frau
und ich mit unseren beiden ältesten Söhnen so unsagbaren, Kummer und Sorgen durchmachen mußten? Den
Gedanken, die Eltern seien daran schuld, weise ich für meine selige Frau sowie für mich entschieden zurück und
betone, daß wir, um unsere beiden ältesten Söhne auf bessere Wege zu bringen, mehr Mühe und Sorgfalt
verwendet haben, als an unseren anderen Kindern zusammen. Ich weiß wohl, daß die Ansichten darüber
verschieden waren. Die Einen sagten, die Mutter sei zu gut gewesen, sie habe den Söhnen zu viel Geld gegeben.
Die Anderen meinten, der Vater sei mit seiner Strenge zu weit gegangen. Ich behaupte, daß beides unrichtig ist.
Wer eine größere Kinderschar erzogen hat, wird wissen, wie verschieden diese von Natur geartet und veranlagt, je
nachdem, leichter oder schwerer zu erziehen sind. Wer nur ein oder zwei Kinder hat, und dabei das Glück, daß
beide gut veranlagt und leicht zu erziehen sind, hat keine Ahnung und auch kein Urteil darüber, welchen Kummer
und Sorgen ungeartete Kinder ihren Eltern verursachen können. Kinder, welche sich gewissermaßen von selbst
erziehen. Es gibt aber auch solche, welche weder durch Liebe noch durch Strenge zu erziehen sind. Diese gehen,
ungeachtet aller Ermahnungen, unaufhaltsam, wie durch viele Beispiele erwiesen ist, ihren veranlagten Gang
weiter, ihrem Untergang entgegen. Warum haben alle unsere anderen Kinder die Ermahnungen ihrer Eltern
befolgt, die beiden ältesten Söhne nicht? Warum ist es im Leben so hässlich eingerichtet, daß bei den Rosen auch
gleich die Dornen stehen? Gewiss wäre es ein Glück für die Familie gewesen, wenn auch diese Söhne den Rat der
Eltern befolgt hätten. Warum haben sie es nicht getan, und wer kann mir die richtige Antwort auf dieses
Naturgeheimnis geben? Alles Kopfzerbrechen und alle Wissenschaft kann diese Frage nicht beantworten. Das
kann nur der allein welche die Menschheit erschaffen hat. Eltern können nicht mehr tun, als ihren Kindern gute
Ermahnungen geben und mit gutem Beispiel vorangehen. Folgen dann die Kinder nicht, trifft die Eltern keine
Schuld, so wenig wie Eltern, welche ein Sündenleben führen, und doch gute Kinder haben, sich das Verdienst
dafür anrechnen können. Beide Söhne sind in ihrem Leben viele Irrwege gegangen, obschon beide von Natur aus
ganz verschieden veranlagt waren. Der älteste Sohn Louis war von Jugend auf als sehr gutmütiger Mensch und
offener Charakter bekannt, der alle Menschen, wenn er konnte, glücklich gemacht hätte. Er war aber auch eine
Natur, von der man sagen konnte, daß er, wenn er auch eine Stellung mit Ministergehalt gehabt hätte, doch dabei
keine Ersparnisse gemacht haben würde. Ich kann dafür als Beweis anführen, daß er in seiner gut besoldeten
Stellung als Schiffskapitän nicht mehr Ersparnisse machte, als in seinen früheren Jahren als Schiffsjunge und
späterhin als Matrose. Der zweite Sohn Johann hatte nicht den Charakter seines älteren Bruders; er war außerdem
das einzige von meinen Kindern, von dem ich sagen muß, daß es unfleißig war. So wenig Lust er in der Schule am
Lernen hatte, so großen Widerwillen hatte er auch vor der praktischen Arbeit. Obschon er Tüchtiges darin leisten
konnte, wenn er den Willen dazu hatte. Diese Naturfehler habe ich in früher Jugend an ihm bemerkt, und hat mir
schon damals manche Sorge bereitet. Wohl hoffte ich zuweilen, das zunehmende Alter würde eine Besserung
bringen. Mein Wunsch wurde nicht erfüllt, und das allbekannte Sprichwort, daß allen Menschen geholfen werden
könne, nur keinem Arbeitscheuen, hat auch hier sein Recht behalten. Wie schon erwähnt, habe ich seit dem Jahre
1894, also seit 16 Jahren, nichts mehr von ihm gehört; ich weiß also nicht, welches Schicksal ihn erreicht und ob
und wo er seine verfehlte Laufbahn vollendet hat. Gewiß eine betrübende und traurige Empfindung für die
Familie, insbesondere für die Eltern, wenn sie das Bewußtsein haben, alles vergeblich versucht und getan zu
haben, um dem Übel abzuhelfen.
Meine Tochter Anna verheiratete sich im Dezember 1892 mit dem Eisenbahnbaumeister Fr. Blankenagel.
Derselbe starb am 1. Dezember 1896 und hinterließ drei Kinder: Anna Maria, Margaretha und Frieda. Letztere
kam erst nach dem Tode des Vaters zu Welt.
Mein Sohn Gottfried hat seinen Eltern und Geschwistern, sowie seinen Lehrern in der Schule nur Freude
gemacht und war von allen, die ihn kannten, geachtet und geliebt. Es war meine Hoffnung, daß ich an ihm später
eine Hilfe und Stütze in meinem Geschäft finden würde. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, daß der
Mensch denkt und Gott lenkt. Gottfried besuchte vom Jahre 1879 das Metzer Lyceum. Nachdem er die
Berechtigung zum Einjährig - Freiwilligen erlangt hatte, verließ er mit meinem Einverständnis die Schule mit
bestem Zeugnis. Zur Vervollkommnung in der französischen Sprache und Schrift fand er in dem
Speditionsgeschäft Lallement Fréres in Metz Aufnahme. Auch da hatte er sich bald bei seinem Prinzipal und den
übrigen Angestellten Achtung und Vertrauen erworben. Nach Ablauf von eineinhalb Jahren kam er von dort zu mir
in mein Geschäft zurück und war mir eine treue und zuverlässige Stütze, bis er am 1. Oktober 1891 zur Ableistung
seiner Militärdienstzeit als Einjährig - Freiwilliger im Feldartillerie - Regiment Nr. 33 hier in Metz eintrat. Auch
da hatte er sich bald die Zufriedenheit aller seiner Vorgesetzten erworben. Mit Lust und Liebe war er Soldat und
tat als solcher seinen Dienst. Anfang Januar 1892 - ich war gerade im Hofe anwesend - kam an einem Vormittag
ein Unteroffizier von seiner Batterie und hatte Gottfried im Arm, welcher leichenblaß aussah. Erschrocken fragte
ich, was denn passiert sei? Da antwortete Gottfried, er habe Fieber. Bald nachdem er zu Bett gebracht war - er
wohnte während seiner Dienstzeit bei uns im Haus - kam auch gleich der Regimentsarzt und ebenso war unser
Hausarzt bald zur Stelle. Gottfried hatte starken Schüttelfrost und ich sah es den Ärzten an, obschon sie sich nicht
äußerten, ihnen der Zustand bedenklich erschien. Nach einigen Tagen erklärten sie mir, es sei ein Leberleiden
vorhanden, das zwar etwas bedenklich, aber doch nicht hoffnungslos sei. Der Schüttelfrost wiederholte sich
täglich, und zusehends schwanden die Kräfte; der früher so blühende, gute Mensch, welcher sonst nie krank
gewesen, war in einem Zeitraum von 14 Tagen fast nicht mehr zu erkennen. Alle ärztliche Kunst war machtlos; er
starb nach schwerem Leiden am 8. Februar 1892 infolge eines sich in der Leber gebildeten Geschwüres, wie nach
seinem Tode festgestellt wurde. Da man eine äußere Ursache hierzu nicht kannte, haben die Sachverständigen die
Vermutung ausgesprochen, es könnte vielleicht durch die Schnalle am Säbelkoppel ein Druck auf die Leber
verursacht und dadurch die Bildung des Eitergeschwüres herbeigeführt worden sein. So ist denn mit diesem guten
und braven Sohne meine letzte Stütze und Hoffnung zu Grabe getragen worden. Sein gutes Andenken bleibt ihm
bei mir erhalten bis an mein Lebensende.
Mein jüngster Sohn August wurde 1873 in Metz geboren. Er besuchte das hiesige Gymnasium von Metz 1880 bis
August 1886. Auch er war ein sehr fleißiger und begabter Schüler, der Eltern und Lehrern stets Freude machte und
zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Den beiden Söhnen Gottfried und August hatte ich versprochen, da
beide so fleißig und brav in der Schule waren, ich wollte nach Beginn der Herbstferien mit Ihnen eine Tour per
Wagen durch das Moseltal nach Trier, und von da durch die Eifel nach Daun zu ihrer Schwester Maria machen.
Zwei gute Pferde hatte ich für diese Reise bestimmt. Das eine davon hatte einen kleinen ganz unbedeutenden
Geschirrdruck oben am Hals; daher hatte ich meinen eigenen Schmied im Hause beauftragt, stündlich einen kalten
Aufschlag zu machen, damit am Tage der Abfahrt die Druckstelle abgeheilt wäre. Am 25. August sollte die Reise
angetreten werden. Alles war dazu vorbereitet, die beiden Jungen konnten den Tag kaum erwarten und waren
außer sich vor Freude. Am 24. August morgens saßen meine Frau, ich und August beisammen beim Kaffee und
unterhielten uns über die Reise. Da geht der Schmied, welcher dem Pferde den Aufschlag auf die Wunde legen
wollte, am Fenster vorbei; August sieht dies, läßt seinen Kaffee stehen und läuft nach dem Stall, um zu sehen, wie
der Aufschlag aufgelegt wird. In dem Augenblick, da August in den Stall trat, legte der Schmied den nassen Sack
dem Pferde auf. Dieses war dagegen etwas empfindlich, schlug hinten aus und traf August so unglücklich an der
Stirn, daß der Schädelknochen zertrümmert wurde und er bewußtlos zu Boden fiel. Kaum drei Minuten war er von
uns vom Tische weg, da kommt der Schmied mit den Worten zu uns: "Herr, kommen Sie schnell, das Pferd hat
den August geschlagen!" In Eile lief ich nach dem Stall und fand meinen guten, hoffnungsvollen Sohn bewußtlos
am Boden liegen. Wir brachten ihn gleich in die Wohnung und betteten ihn auf das Sofa. Ärztliche Hilfe war auch
schnell zur Stelle. Aber der Arzt erklärte mir sogleich, daß die Verletzung sehr schwer und keine Hoffnung mehr
vorhanden sei. Das Pferd war für die Reise schon mit neuen, scharfen Eisen beschlagen gewesen, und die
Schädeldecke war ganz zertrümmert. Am 27. August starb er, ohne vorher wieder zum Bewußtsein zu kommen.
So haben wir denn auch den jüngsten braven Sohn auf eine so furchtbar traurige Weise verloren. Wie er in der
Schule war, geht aus einem Briefe seines Klassenlehrers, Herrn Dr. Krüger, hervor. Dieser schrieb mir nach dem
Unglück u. A.:
„Tief erschüttert von dem entsetzlichen Unglücksfalle, der Ihnen einen hoffnungsvollen Sohn, und mir
einen meiner liebsten Schüler geraubt hat, bitte ich Sie, den Ausdruck meines aufrichtig Mitgefühls
entgegen zu nehmen. Möge der Himmel, der Ihnen und Ihrer Familie diese Prüfung auferlegt hat, Ihnen
Trost und Kraft verleihen, den schweren Schlag zu überwinden.
In herzlicher Teilnahme ihr ergebener M. Krüger"
{...}
XV. Mein Überfall und meine Beraubung im Walde von Ars.
Am 1. September 1902, Sonnabendnachmittag 3 1/2 Uhr, ging ich zum Steinbruch, hatte die für die Auslöhnung
1645 M in Gold und Silbermünzen in einer Geldtasche um die Schulter hängen. Von der Hauptstraße führt ein
schmaler Fußpfad die steile Höhe durch einen dicken Wald mit einzelnen starken Bäumen hinauf. Hinter einem
dieser Bäume, an denen ich vorbei mußte, versteckte sich ein Mann, welcher wußte, daß ich um diese Zeit mit
Geld vorbei komme, und lauetre mir auf; Er war mit einem Stock, welcher an einem Ende eine dicken Bleiknopf
hatte sowie einem großen sichelartigen Messer (Rebenmesser) bewaffnet.
Nichts ahnend ging ich, vor mich hin sehend, den steilen Bergpfad hinauf dem Steinbruch zu. Plötzlich erhielt ich
einen wuchtigen Schlag mit dem Bleiknopf auf den rechten Backenknochen. Der Streich war auf den Kopf
abgesehen, ging aber etwas vorbei und traf mich im Gesicht. Etwas betäubt, stürzte ich zu Boden, drehte mich
aber schnell um und sah, wie mein Angreifer mit dem großen Messer in die Nähe meines Halses kann. Mit der
linken Hand griff ich schnell in die Klinge und beschädigte mir dabei alle Finger der linken Hand. Mit der rechten
Hand ergriff ich die Hand, mit welcher er das Messer hielt, und verhinderte, daß er mir damit an den Hals kam;
einen Atemzug länger, und es wäre mit mir vorbei gewesen. Die Haut im Gesicht auf dem Backenknochen war
durchschlagen und stark blutend lag ich auf dem Boden, das Messer und die Hand meines Angreifers festhaltend.
Mit den Füßen gab ich ihm einige kräftige Tritte in die Bauchgegend und schrie laut um Hilfe. Inzwischen riss mir
der Räuber, welche eine Hand frei hatte, die Geldtasche von der Schulter. Damit war sein Zweck erreicht; er ließ
mir das bis dahin festgehaltene Messer; auch den Stock, mit dem er mich niederschlug, ließ er auf der Stelle
liegen, riss sich von mir los und verschwand mit seiner Beute in den Wald hinein. Während ich um Hilfe schrie,
hörten oben im Steinbruch einige Arbeiter meinen Ruf, glaubten meine Stimme zu erkennen. Sie sagten zu dem
Aufseher: „wir glauben, Herr Zeitz hat gerufen“. Dieser ließ die gerade im Gang befindliche Seilbahn stillstehen
und kam sofort mit einer Anzahl Leute nach der Stelle gelaufen, von wo aus mein Rufen kann. Ich hatte mich
inzwischen aufgerichtet; so fanden sie mich aufrecht stehend blutüberströmt vor. Neben mir auf dem Boden lag
das Messer und der Stock meines Angreifers; zwei Schritte davon lag meine Uhr auf dem Boden, welche mir
während des Ringens aus der Tasche fiel. Ich war, wie man sich denken kann, stark erschöpft, und konnte mich
nur langsam fortbewegen. Einige Arbeiter suchten den Wald vergeblich nach dem Räuber ab. Der Aufseher ließ
aus Ars einen Wagen holen, mit welchem ich dann zu Herrn Dr. Unkell nach Ars verbracht wurde. Außer den
Wunden im Gesicht und an der linken Hand hatte ich noch einen Stich im linken Oberschenkel. Hätte der erste
Schlag mit dem Stock einen Finger breit höher die Schläfe getroffen, dann wäre ich jedenfalls bewußtlos zu
Boden gestürzt, und mühelos hätte der Bandit, wie er beabsichtigt hatte, mir den Hals durchschnitten und mich
beraubt. Große Aufregung hatte die Sache überall hervorgerufen und ganz Ars war auf den Beinen.
Wer mir Herr Dr. Unkell die Wunden verband, kamen drei mir gut bekannte Herren hinzu, um sich nach meinem
Befinden zu erkundigen. Es war der Konsistorialpräsident B. aus Metz, Pfarrer S . und Notar K. aus Arras. Diese
erschienen mir in meiner Lage als barmherzige Samariter, und ich spreche ihnen an dieser Stelle nochmals meinen
herzlichen Dank dafür aus. Nachdem der Arzt mir fertig war, begleiteten mich die drei Herren zur Bahn und
fuhren mit mir nach Metz, wo ich, wie gewöhnlich, 6 Uhr eintraf. Meine Begleiter gingen rechts und links
langsam etwas vor mir her. Meine Frau war wie gewöhnlich zu meinem Empfang auf dem Bahnperron anwesend.
Mein Gesicht war inzwischen stark angeschwollen, und als sie mich erblickte, erschrak sie und rief: „Ach Gott
was ist denn passiert?“ Die Herren beruhigten meine Frau, so gut es ging, insbesondere damit, daß nach Aussage
des Arztes keine Gefahr vorhanden sei. Dennoch weinte meine Frau laut und bitterlich, als man ihr den Vorfall
erzählte. Hierauf fuhren wir in geschlossenen Wagen nach Haus, und ich wurde zu Bett gebracht. Bald war unser
Hausarzt zur Stelle, und auch dieser, Dr. Fr. erklärte, nachdem er die Wunden untersucht hatte, daß keine Gefahr
vorhanden sei. Vierzehn Tage mußte ich aber doch im Bett verbringen, bis die Wunden soweit geheilt waren, daß
ich Bett und Zimmer verlassen konnte. Die ganze Stadt Metz und Umgebung war über den Vorfall in Aufregung
und alle Zeitungen brachten Artikel darüber. Noch am Abend kamen der Staatsanwalt und der
Untersuchungsrichter an mein Bett zur Vernehmung. Ich konnte nur sagen, dass ich unvermutet niedergeschlagen
wurde, und daß ich dann, auf dem Boden liegend, mit meinem Angreifer gerungen und damit sein Messer von
meinem Halse abgewehrt habe, daß derselbe ein starker, kräftiger Mann gewesen, 30-35 Jahre alt, der anscheinend
sich seit drei Wochen nicht im Gesicht rasiert hatte, und eine Mütze mit einem geradeausstehenden Schirm trug,
und dass er, als er meine Geldtasche sich los riss, um in den Hecken zu verschwinden. Weiteres konnte ich nicht
sagen. Gendarmen und Polizei waren von allen Seiten bemüht, den Verbrecher aufzufinden. Innerhalb drei Tagen
brachten sie mir vier Personen an mein Bett, ob ich nicht den Einen oder den Anderen als meinen Angreifer
erkennen würde. Doch konnte ich immer die bestimmte Erklärung abgeben, daß es keiner von ihnen war. Die
Gestalt meines Angreifers schwebte mir immer vor Augen; auch jetzt noch sehe ich ihn vor mir. Es wurden nach
meiner bestimmten Erklärung die betreffenden gleich wieder entlassen, wenn sie sonst nichts auf dem Kerbholz
haben. Nach etwa 14 Tagen - ich konnte gerade wieder aufstehen - kam in der Nacht ein Telegramm an die hiesige
Staatsanwaltschaft von der Polizeibehörde in Luxemburg, wonach ich am anderen Morgen zur dortigen Polizei
kommen sollte; Man glaube, den richtigen Täter dort verhaftet zu haben. Ich fuhr denn auch sofort mit dem ersten
Zuge nach Luxemburg, und der Mann wurde mir aus dem Gefängnis vorgeführt. Aber auch dieser war nicht der
Richtige ich gab wiederum die Erklärung ab, daß ich mit diesem Mann nichts zu tun hatte. So blieben die
Nachforschungen, welche nach allen Richtungen hin eifrig geführt wurden, resultatlos. Meine Ansicht war immer,
daß mich der Verbrecher gut kennen müsse, weil er genau wußte, um welche Zeit ich regelmäßig mit Geld dort
vorbeikam, und daß er unter den in der Nähe an den Fortbauten beschäftigten Arbeitern zu suchen sei. Etwa 7-8
Monate später traf ich in Ars auf der Straße einen Mann in Arbeiterverkleidung, der anscheinend auf dem dortigen
Hüttenwerk beschäftigt war. Als ich ihn erblickte wandte der eiligst das Gesicht von mir ab und sah auf die andere
Seite. In mir regte sich sofort der Verdacht, und ich sagte mir: das ist der Mann, mit dem ich im Wald gerungen
habe. Eine Weile blieb ich still stehen, überlegend, was zu tun; Inzwischen war der andere weiter seines Weges
nach Ars gegangen und ich sah ihn nicht mehr. Den Gedanken, daß dies der Übeltäter sei, wurde ich nicht mehr
los. Als ich am Abend nach Haus, kam war das erste, was ich zu meiner Frau sagte: „Mir ist heute der Mann
begegnet, welcher mich überfallen hat“. Als ich den anderen Morgen nach Ars kam, ging ich sofort zum
Gendarmen H. in Ars und sagt es diesem. Daraufhin sagte Herr H. mir, er habe mich schon rufen lassen wollen;
auf dem Lothringer Eisenwerk arbeite ein Mann mit Namen R., der nach dem Signalement der Staatsanwaltschaft
wohl der Gesuchte sein könne. Er prügelt mitunter seine Frau; auch dieser Tage sei es wieder der Fall gewesen,
und da habe die Frau R. zu einer Nachbarn gesagt: „wenn er mich jetzt noch einmal schlägt, dann zeige ich ihn an;
er hat etwas gemacht, wenn dies herauskommt, bekommt er ein paar Jahre Zuchthaus.“ Ich schilderte nochmals
die Person, so wie ich sie vor Augen hatte, und Gendarm sagte, die Beschreibung stimme. Sofort gingen wir zur
Direktion des Hüttenwerkes. Nach Rücksprache mit dem Direktor Herrn Sc., ließ dieser den Aufseher rufen,
welchem R. unterstellt war. Dieser sagte mir dann, dass R. mit einem Anderen zusammen am Puddelofen
arbeitete. Um keinen Verdacht zu erregen, suchten wir auf Umwegen in die Nähe des Ofens zu kommen. Als wir
nahe waren, deutete mir unauffällig der Aufseher an, welcher von den beiden dort Beschäftigten der Gesuchte sei.
Beide Arbeiter standen mit dem Rücken gegen uns. Der Aufseher ließ mich nun allein, und ich ging langsam um
den Ofen herum, um beide Arbeiter auch im Gesicht zu sehen. Jetzt erkannte ich den wieder, den ich am Tage
zuvor gesehen hatte, und ich merkte, wie R. bei seiner Arbeit sich bemühte, stets mit dem Rücken gegen mich zu
stehen, so daß ich ihm nicht ins Gesicht sehen sollte. Der Gendarm war inzwischen auf dem Büro bei der
Direktion zurückgeblieben. Als ich R. genügend beobachtet hatte, ging ich auf das Büro zurück und erklärte, daß
ich diesen Mann bestimmt als meinen Angreifer wiedererkenne. Der Gendarm ging zum Herrn Amtsrichter K. in
Ars und berichtete, und dieser gab dann Auftrag, den Mann zu verhaften und sofort vorzuführen. Nachdem dies
geschehen war, ließ mich der Amtsrichter rufen und stellte mir den R. vor mit den Worten: „Kennen Sie den
Mann?“ Ich sah ihn dann scharf an, und erwiderte: „Herr Amtsrichter, ich glaube mit aller Bestimmtheit sagen zu
können, dass dieser Mann derjenige ist, der mich überfallen und beraubt hat, und mit dem ich im Walde gerungen
habe.“ Darauf erwiderte er.: „Ach, Herr Zeitz, das ist nicht der Fall. Als ich am Tage, wo ihnen das Unglück
passierte, abends nach Hause kam, und mein Bruder es mir erzählte, sagte ich noch, so etwas wird doch dem
Herrn Zeitz nichts passiert sein,“ und beteuerte seine Unschuld. Ich hielt meine Anklage aufrecht. Da sah ich auf
einem Stuhl eine Mütze liegen, und ich fragte, wem diese gehöre. Da sagte R.: „Die gehört mir.“ Diese war genau
mit dem gerade stehenden Schirm, so wie ich sie dem Untersuchungsrichter bezeichnet hatte. Da setzte ihm der
Amtsrichter die Mütze auf, und ich sagte: „Jetzt passt das Gesicht genau; nur war es an dem Tage nicht so glatt
rasiert wie heute.“ Da erwiderte R.: „Ich lasse mich nur alle drei Wochen rasieren.“ Da sagte der Amtsrichter: „das
stimmt ja ganz genau. „ R. blieb verhaftet, und wurde sofort nach Metz abgeführt. Bei der nun eingeleiteten
weiteren Untersuchung in Metz hat sich ergeben, dass er ein Jahr lang vor dem Überfall auf dem Lothringer
Eisenwerk in Arbeit stand, 14 Tage vor dem Überfall seine Arbeit dort verließ und sich Beschäftigung suchte, als
er dabei dabei der Firma Schöttle & Schuster, welcher die Feste Kronprinz, gegenüber dem Steinbruch, zu bauen
übertragen war. Von dieser Firma wurde R. außerhalb des Forts auf dem Glacis, etwa 250 Meter von der Stelle
aus, wo ich überfallen wurde, beschäftigt. Dies alles wurde durch den Untersuchungsrichter auf Ort und Stelle
festgestellt. Acht Tage nach dem Überfall verließ R. seine Arbeit bei Schöttle & Schuster und suchte sich Arbeit
auf dem Hüttenwerk in Joeuf in Frankreich, unweit der deutschen Grenze. Dort arbeitete er zwei Monate, und
ging von da nach Paris, wo er etwa fünf Monate sich aufhielt; von dort kam er wieder nach Haus zurück und nahm
wieder Arbeit auf dem Lothringer Eisenwerk, und begegnete mir dann eines Tages wie schon erwähnt. Die
geführte Untersuchung hat ja belastendes Material ergeben, aber keinen positiven Beweis dafür erbracht, daß er
der Täter war. Auch beteuerte er stets seine Unschuld. 28 Tage lang dauerte diese Untersuchung. Eines Tages
wurde ich dann zum Untersuchungsrichter geladen, welcher mir das Resultat mitteilte,und mir die Frage vorlegte,
ob ich eventuell mit Bestimmtheit den Eid darauf leisten könne, dass ich von R. überfallen und beraubt sei. Da
erklärte ich, dass ich, solange ich lebe, daran festhalte, und auch die Überzeugung habe, dass er es war. Dennoch
würde ich einen Eid nicht leisten, da es ja doch viele Menschen gibt, welche einander ähnlich sind und
miteinander verwechselt werden können, besonders in einer solchen Situation, in welcher ich bei dem Überfall
war, und ich auch nicht in den Verdacht kommen wolle, ich habe vielleicht doch einen leichtfertigen Eid
geleistet.Wenn das Gericht nicht genügende Schuld finde, solle man ihn freilassen. Dies geschah denn auch.
XVI. Die Krankheit meiner Frau.
Im Frühjahr 1901 stellten sich bei meiner bis dahin stets gesunden Frau Krankheitserscheinungen ein, und die
ärztliche Untersuchung ergab, daß sie von der Zuckerkrankheit befallen war. Der Arzt ordnete eine Kur in Bad
Neuenahr an, welche auch anscheinend erfolgreich war. Leider aber sollte dies nicht von Dauer sein. Im Frühjahr
1902 mußte die Kur in Neuenahr wiederholt werden, und auch diesmal trat wieder eine zeitweilige Besserung ein.
Im Frühjahr 1903 verschlimmerte sich aber wiederum ihr Zustand. Ich wollte in meiner Besorgnis die Kur in
Neuenahr nochmals vornehmen lassen. Der behandelnde Arzt Dr. Fr. widersprach dem aber mit der Begründung,
daß bei dem jetzigen Zustand die Reise nach Neuenahr mit Gefahr verbunden und vorläufig nicht zu empfehlen
sei, bis sich die Kräfte wieder gehoben, und der Gesundheitszustand sich im allgemeinen wieder gebessert habe.
So wurde denn zu Haus die Kur vorläufig fortgesetzt. Es geschah alles, was geschehen konnte, und alle Mittel
wurden versucht, dieser tückischen Krankheit Einhalt zu gebieten.Leider ohne Erfolg. Die Kräfte schwanden
zusehends, die ärztliche Kunst vermochte nichts dagegen. Mitte August hatte sich der Zustand derart
verschlimmert, daß der sonst übliche Spaziergang eingestellt werden mußte, und der Aufenthalt auf Zimmer und
Bett beschränkt wurde. Von Ende September ab konnte sie das Bett nicht mehr verlassen; bis dahin hatte ihre
gesunde kräftige Natur Widerstand geleistet. Nun schwanden ihre Kräfte immer mehr, Anfang November war der
Zustand derart bedenklich, daß jeden Augenblick das Schlimmste eintreten konnte. Am 2. November wurde meine
gute Frau noch mit der Roten – Kreuz – Medaille dekoriert. An ihrem Geburtstag, den 8. November, verlangte sie
von mir den Orden und sagte dabei: „Heute will ich Dir zu Ehren den Orden einmal anlegen, es wird wohl das
letzte Mal sein.“ Sie trug ihn den ganzen Tag im Bett. Zwei Tage hat dann noch die Schwerkranke, gottergeben
bis zum letzten Atemzug, durchgekämpft; am 10. November 1903, abends 6 1/2 Uhr, ist sie verschieden. Ein
gutes, edles Frauen – und Mutterherz hat damit zu schlagen aufgehört. Sie ist aus ihren Sorgen und kummervollen
Leben, hervorgerufen durch harte Familienschicksalsschläge, zur ewigen Ruhe eingegangen im Alter von 64
Jahren und zwei Tagen. Die Verstorbene war nicht nur eine liebende Mutter ihrer Familie, sie war auch eine
Mutter für die Armen und Notleidenden, so daß sie häufig die Armenmutter genannt wurde. Vielleicht hat sie in
dieser Hinsicht etwas mehr geleistet, als nach Lage unserer Verhältnisse erforderlich war. Ihre natürliche
Veranlagung war aber derart, daß sie nicht nur für die Armen allein, sondern auch der eigenen Familie mehr als
nötig, Zuwendungen machte. Ja, sie hätte, wenn es in ihrer Macht lag, Freund und Feind glücklich gemacht.
Um die menschenfreundliche Gesinnung meiner seligen Frau näher zu bezeichnen, bringe ich an dieser Stelle
zwei Nachrufe, welche am 11. und 13. November 1903 ohne mein Wissen und Zutun in der Lothringer Zeitung
erschienen sind. Der erste lautet:
„Frau Maria Zeitz. Gestern Nachmittag verschied im Alter von 64 Jahren nach längerem
Krankenlager die Gattin des Herrn Johann Zeitz. Die Verstorbene gehörte jahrelang dem Vorstand
des hiesigen vaterländischen Frauenvereins und ebenso dem Vorstande des Matrhildenstiftes an.
Mannigfache Schicksalsschläge in der Familie, wie auch der räuberische Überfall, welcher vor zwei
Jahren im Walde von Ars auf ihren Gatten verübt wurde, haben den Lebensabend der gottergebenen
Frau mit ihrem Herzen voll christlicher Nächstenliebe getrübt. Aber gerade die letzten Lebenstage
brachten der hoch verehrten Dame auch noch eine hohe Ehrung, indem ihr die Rote-Kreu-Medaille
III. Klasse Allerhöchst verliehen wurde, welche sie allerdings nicht mehr persönlich aus den Händen
der Deputation entgegennehmen durfte. An der Bahre steht ihr Gatte, zwei bei der Handelsmarine
befindliche Söhne, eine in Saargemünd verheiratete Tochter und eine hier weilende verwitwete
jüngste Tochter, sowie mehrere Enkelkinder. Der Tod er Frau Zeitz bedeutet für viele einen herben
Verlust, nicht am wenigsten für alle die, denen in ihr eine Wohltäterin starb. Unser herzliches Beileid
den trauernden Hinterbliebenen.“
Ein zweiter Nachruf vom 13. November, dem Beerdigungstage, lautet:
„Der Frau Maria Zeitz, deren sterbliche Hülle heute bestattet wurde, widmet eine „Dankbare für die
vielen Dankbaren von Metz“ folgenden herzlichen Nachruf, den wir unverkürzt abdrucken, weil er
sichtlich der Ausdruck tiefer und wahrer Empfindung ist: Sie haben sie hinaus getragen. - Es ist stiller
geworden in der Medardenstraße. Der Abend deckt dort mit lindem Schatten den Schmrz, der dort
heiße Tränen weint. Eine Mutter ist dahin geschieden – eine Mutter der Armen – ein treues, echtes,
deutsches Frauenherz gebrochen – Metz hat eine seiner besten Frauen verloren. Ihr gedrückten
Mühseligen, von der Not des Lebens gejagten, wer von euch kannte sie nicht? Wenn ihr Hilfe suchtet,
und mancher Weg sich als vergeblich erwiesen, wenn der Verein das Armenbüro nur ungenügend
Stütze zu bieten hatte, daß ihr seufzend den Mut schwindend fühltet, faßte da eure müdewordene Seele
nicht wieder neue Hoffnung bei dem Namen „Frau Zeitz?“ Dort klopfte Keines vergeblich an, Keines
ward von ihrer Tür weggeschickt, ungehört, ungetröstet, oder auch ungestraft. Wer aber diese Tür
fürchtete, hatte sicher kein gutes Gewissen. Denn die Augen, die so liebevoll auf dem Elend der Armut
ruhten, sahen scharf und hatten einen praktischen Blick, wenn es galt, das unordentliche Wesen zu
entdecken, das etwa der bestehenden Not Hintergrund bildete. Ihrer ernsten Mahnung und
liebewarmem Rate fügten sich selbst die Männer, weil sie fühlten: „die Frau verstehts. Sie atmete die
Liebe, die sich in den Jammer des Nächsten, in seine täglichen Kämpfe hinein versetzen kann, als ihr
Eigenes. Ach, Ihr Armen von Metz, euch wollen diese Zeilen die Worte des Dankes verleihen, und des
Schmerzes zugleich, beim Stillstehen dieses echten mütterlichen Frauenherzens, dem es gleichsam im
Blute lag, für euch einzustehen, für euch nachzudenken und für euch zu sorgen. Eine deutsche Frau
war sie, eine evangelische, im rechten Sinne, die das arme Volk verstand, wie keine, die seine Mühsal
kannte, die ihnen aber auch den christlichen Segen der Arbeit vorstellen konnte, weil sie selbst das
„betet und arbeitet“ fleißig trieb.Wenn sie schalt, konntet ihr zürnen? Wenn sie gab, wenn sie half, sie
mahnte, tat sie es nicht als eine, die bis in die Verborgenheit eures Lebens einen Blick zu tun im Stande
war? Ihr Mütter, mußtet Ihr nicht erröten, wenn ihr vor dieser Frau von zu großer Last, ihr Frauen,
wenn ihr von Überdruß und Wegwerfen eurer Bürde spracht? Ging sie nicht uns allen voran mit einem
starken Herzen, selbst dann noch stark, wenn wir ihre Last übergroß sahen und ihre Bürden zu
zahlreich glaubten? Ehrt und bewundert ihr nicht, den stillen, den festen Mut einer unter Gottes
schwerer Hand tief Gebeugten, der doch nie das Mitgefühl des Mitleides für euch alle fehlte? Hätte
man sich ein Stüblein denken können, daß durch die Nacht der Trübsal, der Krankheit oder des Todes
verdunkelt wurde, dem sie nicht ein Trostlicht brachte, sobald sie davon erfuhr? Sie suchte die Not
persönlich auf, auch in Schlupfwinkeln - sie erkannte die versteckte Ursache, sie deckte den Schaden
auf-nicht um weh zu tun. O, das Armenweh war ihr eine heilige Sache, sondern um gründlicher helfen
zu können. Habt Ihr ein Gedächtnis? Wißt ihr noch, wie viele gute, heiße Suppe im kalten Winter
1879/80 aus der Küche der Medardenstraße 13 zu den Hungernden und Frierenden wanderten? Wißt
ihr noch, wie das Beste und Wärmste unter den Stoffen ihr nur gut genug war, euch zu erfreuen am
Weihnachtsabend? Wie schaffte sie Rat, wenn keiner mehr war? Wie gab oder sorgte sie für Arbeit,
wenns nirgends mehr ging! Wer von den Trunkenbolden, Fluchern und bösen Faulenzer, denen das
herbe und doch mitleidsvolle Wort dieser treuen Frau galt, konnte Widerstand leisten, wenn sie ihm
sein Unrecht vorhielt? Mit der Wahrheit ging sie mutig vor, wenns Not tat, nicht um Unfrieden,
sondern um Frieden zu säen, wenn er dem häuslichen Herde abhandengekommen ist, durch des einen
oder anderen schuld. Wie Frau Zeitz, so gabs nur eine - so sagen wir - mehr denn 30 Jahre lang hat sie
Liebe gesät - Liebe darf sie ernten. Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr
mir getan,“ so hören wir des Herrn Wort über ihr. Ihr Denkmal in den Herzen bleibt, des Ordens Zeichen der Liebe, das sie sich darin erworben, überdauert die Zeit - ein rechter „Notanker“
Frommelscher Art, soll sie je vergessen sein in dem sonst so vergesslichen Metz?“
Mit dem Ableben meiner Frau war meine Familie mit der zahlreichen Kinderschar in Trümmer gegangen. Von 10
Kindern sind, wenn, wie ich vermute, Johann auch nicht mehr am Leben ist, noch zwei, Sophie und Anna
vorhanden. Wie schon erwähnt, sind die beiden ältesten Kinder, Fritz und Luise, auf dem Friedhof in Sulzbach in
dem Grabe meiner Mutter beigesetzt. Mein Vater wurde noch in Dudweiler beerdigt. Seine Überreste sind später
von dort nach Sulzbach überführt und im Familiengrabe meines Bruders Louis beigesetzt worden. Viel Kummer
und Sorgen hat mir das Leben gebracht, das härteste aber das mich traf, war der Verlust meiner Frau, mit der ich
47 Jahre in glücklicher Ehe lebte, und die mich, wie ich zugebe, mit ihrem guten Gemüte verwöhnte. Hatte sie
doch stets in peinlicher Sorgfalt über meiner Pflege und Gesundheit gewacht, so daß ich ihr des Öfteren vorhalten
mußte, daß sie mich besser pflege als ich es verdiene. Aber wie sie in dieser Hinsicht gegen mich war, so war sie
auch gegen ihre Kinder und Verwandten ohne Ausnahme. Leider ist es ihr nicht überall anerkannt worden. Um
meine Pflege, wenn sie vor mir sterben sollte, hat sie sich noch bei den Zeiten Sorge und Kummer gemacht. Es ist
daher auch wohl zu verstehen, wie hart und bitter der Verlust meiner Frau für mich gewesen ist. Nicht weniger als
fünf Damen hatte ich im ersten Jahre nach dem Tode meiner Frau zur Führung meines Haushaltes gehabt, und
wurde mir mancher Tag dabei recht schwer gemacht. Dabei will ich aber auch zugestehen, daß es keine so leichte
Sache war, für mich in meiner Lage und meinem Alter von 70 Jahren die richtige Person zur Führung eines
Haushaltes zu finden, insbesondere, wenn man, wie ich, eine so gute Frau hatte und etwas verwöhnt war. Mit dem
Eintritt von Frau Baumann zu Ostern 1905 ist dann eine Wendung zum Besseren in der Führung meines
Haushaltes eingetreten, und ist es gottlob bis heute, also nun bald sechs Jahre, unverändert so zu meiner
Zufriedenheit geblieben. Infolgedessen füge ich noch einige Zeilen, Frau Baumann betreffend, hier an. Frau
Baumann, geborene Juen, ist am 8. November 1869 in Straßburg geboren; sonderbarerweise hat sie den gleichen
Geburtstag meine selige Frau. Ihr Vater, Herr Juen, hatte in Straßburg eine Gärtnerei. Nach ihrer Konfirmation
kam sie nach Paris, wo eine ältere Schwester von ihr verheiratet war, unterhielt in einem dortigen Hotel ihre
Ausbildung in Kochen und Haushalt. Dort lernte sie später einen Herrn Baumann aus Stuttgart kennen, welcher
sich in Paris seine Zukunft gründen wollte. Sie verheiratete sich mit denselben und machte mit ihm seine großen
Geschäftsreisen nach fast allen Weltteilen, so daß sie so die Welt und die Menschen mit ihren Licht - und
Schattenseiten kennen lernte. Nachdem sie acht Jahre verheiratet war, mußte der Mann wegen Krankheit das
Reisen aufgeben. Die Krankheit war von sehr langer Dauer; Und als keine Hoffnung auf Wiedergenesung war,
äußerte der Ehemann den Wunsch, in seiner Heimat zu sterben. Dies wurde ihm erfüllt; schwer krank wurde er
von Paris nach Stuttgart verbracht, wo er bald darnach bei den Seinigen gestorben ist. Nach dem Tode ihres
Mannes kam dann Frau Baumann zu ihrer Familie nach Straßburg und von da zu mir. Damit ging auch der
Wunsch meiner seligen Frau in Erfüllung, daß ich nach ihrem Tode eine gute Versorgung haben solle.
XVII. Persönliches.
ich war mir stets bewußt, daß auch ich, wiewohl ein jeder, meine Fehler und Mängel habe. Wohl hörte ich sagen,
daß auch gute Eigenschaften bei mir vorhanden; ich übergehe sie hier und sage nichts davon. Von Natur aus war
ich mit Geduld und Selbstbeherrschung wenig ausgerüstet, und ich glaube, daß dies mein Hauptfehler war. Wohl
habe ich mir selbst oft vorgenommen, mich in dieser Hinsicht zu bessern und nicht so leicht bei jeder Gelegenheit
aufzubrausen; wenn dann aber eine Gelegenheit kam, da ich meine Geduldsprobe bestehen sollte, habe ich diese
trotz des besten Willens nie bestanden. Dieser Naturfehler war bei allen meinen Geschwistern mehr oder weniger
vorhanden, und ich glaube daß es ein Erbstück meines seligen Vaters war. Was meine bürgerlichen Pflichten
anbetrifft, so war ich stets bestrebt, diese nach besten Wissen und Können zu erfüllen. In meiner zweiten Heimat
in Metz wurde ich durch das Vertrauen meiner Mitbürger in den Gemeinderat, sowie auch in den Kirchenrat und
das Konsistorium gewählt. Ich habe jeder dieser Körperschaften 12 Jahre angehört und an deren Beratungen
teilgenommen. In religiöser Hinsicht habe ich mir stets meine frommen Eltern zu Vorbildern gehalten, und war
religiös und kirchlich gesinnt. Dabei habe ich auch jede andere Konfession, sowie auch deren religiöse Gebräuche
geachtet. Andererseits aber auch niemand beachtet resp. darum angesehen, welche in dieser Hinsicht anders als
ich dachte. Stets habe ich mir gesagt, daß dies Sache eines jeden selbstständigen Menschen ist, hierin zu tun, was
ihm recht und gut erscheint, da ja ein jeder für das, was er hierin tut und läßt, auch ganz allein die Verantwortung
zu tragen hat. Wie so oft habe ich in meinem Leben gedacht und auch gesagt, würden doch alle Menschen hierin
meiner Ansicht sein, dann gebe es keinen Religionsstreit und wir könnten in dieser Hinsicht alle friedlich
nebeneinander wohnen. Als im Jahre 1886 die FUhrwerksberufsgenossenschaft gegründet wurde, wurde ich zum
Vertrauensmann für den Kreis Metz, Stadt und Land, Kreis Diedenhofen und Bolchen ernannt. Bald darnach
wählte mich die Sektion 39 mit dem Sitz in Straßburg zum Delegierten für Elsaß-Lothringen zur Vertretung des
Fuhrgewerbes bei den alljährlichen Genossenschaftsberatungen. Die Genossenschaftsversammlung wählte mich
dann in den engeren Vorstand der Genossenschaft. Diese hatte zeitweise ihren Sitz in Dresden und Berlin, wo
alljährlich zwei Sitzungen stattfanden. Diese Ehrenämter legte ich nach Aufgabe meines Geschäftes und wegen
des Versagens meines Gehörs nieder. Bezüglich meiner Gesundheit kann ich wohl sagen, daß sie, gottlob, im
Allgemeinen gut war. Außer den Kinderkrankheiten wie Röteln, Masern usw., die wohl jeder durchmacht, erinnere
ich mich nur noch, daß ich vor Beginn meiner Schulzeit einen Ausfluß aus meinen Ohren hatte. Ob meine Eltern
etwas dafür getan haben, weiß ich nicht. Doch erinnere ich mich, daß damals der Arzt nicht so schnell wie heute
aufgesucht wurde. Man konnte es auch gar nicht; denn der Sulzbach zunächst wohnende Arzt war im St. Ingbert
oder Saarbrücken. Sulzbach, Dudweiler, Friedrichsthal und andere Orte hatten weder einen Arzt, noch eine
Apotheke. Als ich mein 60. Jahr erreichte, merkte ich, daß mich mein Gehör etwas im Stiche ließ. Ein feines
Gehör habe ich übrigens nie gehabt. Ich machte darauf eine Reise nach Heidelberg zu einem Spezialisten um
dessen Rat einzuholen. Herr Prof. Dr. M. unterssuchte mein Gehör und sagte darauf zu mir: „Sie haben in ihrer
Jugendzeit Ohrenlaufen gehabt, dies wurde entweder nicht rechtzeitig oder nicht richtig behandelt. Infolgedessen
haben Sie an beiden Ohren ein Loch im Trommelfell, welches Ihr Gehör verschlechtert und beeinflußt. An diesem
Zustand ist jetzt nichts mehr zu ändern, kommen Sie über ein Jahr wieder, und wir wollen sehen, ob sich in
diesem Zeitraum ihr Gehör verändert eventuell wie viel es sich verschlechtert hat.“ Nach einem Jahr reiste ich
wieder hin. Nach der zweiten Untersuchung sagte mir der Arzt: „Ihr Gehör hat sich nicht verschlechtert. So viel es
weniger geworden ist, müssen Sie auf Konto des zunehmenden Alters rechnen. Damit hatte ich denn weiter nichts
erreicht, als meinen Geldbeutel etwas erleichtert. Im Jahr 1901 macht ich noch eine schwere Lungenentzündung
durch, welche trotz meines hohen Alters gut verlief. Etwas muß ich hier noch anführen, worüber ich mir bezüglich
meiner Gesundheit einen Vorwurf zu machen habe.Und es würde mich freuen, wenn es dazu beitragen sollte, daß
es andere nicht so machen, wie ich es in dieser Hinsicht gemacht habe. Es betrifft die Behandlung meiner Zähne.
Diese habe ich stets ganz rücksichtslos behandelt, was sich jetzt in meinem Alter, wo ich keine mehr habe,
bedauere und beklage. Im Alter von 19 Jahren - ich war damals Soldat in Berlin - bekam ich eine geschwollene
Backe. Der Arzt erklärte, es käme von einer Backenzahnwurzel her und der Zahn müsse entfernt werden. Dies
geschah denn auch, und damit entstand die erste Lücke und war mir Gelegenheit gegeben wenn wir beim Essen
etwas in den Zähnen stecken blieb, diese mit dem ersten besten Instruments, Messer oder Gabel, besser bearbeiten
zu können. Dadurch habe ich mir auch dann meine Zähne frühzeitig abgenutzt und zerstört. Im Jahr 1904 habe ich
den letzten verloren respektive ich habe ihn, da er mir nur Schmerzen und Hindernisse beim Essen bereitet hatte,
selbst aus dem Munde entfernt; denn besser keinen Zahn im Munde zu haben wir einen Schlechten. Nun wurde
mir von allen Seiten geraten, zu geraten, mit Rücksicht auf meine Gesundheit wie ein künstliches Kauwerkzeug
anzuschaffen. Ich ging zu einem bekannten Zahntechniker und sagte diesem mein Vorhaben. Der Arzt hielt mir
dann einen längeren Vortrag, wie mein neues Bejleidungsstück behandelt werden müsse, und daß insbesondere
große Geduld dabei erforderlich sei. Darauf fragte ich nach dem Kostenpunkt. Dieser wurde mir nur so
annähernd, nicht ganz bestimmt, gesagt. Nun überlegte ich mir, was tun? Vor allem hatte ich starke Bedenken, ob
wohl die erforderliche Geduld bei mir vorhanden sei. Dann kam der Kostenpunkt in Betracht. Dieser hatte
ungefähr so viel betragen, als ich im Jahre 1870 bei der Übergabe von Metz einem französischen Geniehauptmann
für zwei erstklassige Pferde mit Sattel und Zaumzeug bezahlt habe. Als mir dann der Zahnkünstler mit dem
Rohmaterial in den Mund kam um das Profil für das neue Kauwerkzeug zu nehmen, wurde es mir in meinem
Magen so ungemütlich. Ich stand von meinem Sitz auf und sagte: „Herr Doktor, Sie haben mir gesagt, daß große
Geduld erforderlich sei, wenn ihr Fabrikat seinem Zweck entsprechen soll. Nun muß ich Ihnen aber sagen, daß
gerade Geduld meiner allerschwächste Seite ist. Daher fürchte ich, daß, wenn Ihre Arbeit vollendet und mir zur
Benützung übergeben ist, diese vor Ablauf von 24 Stunden durch unsanfte Behandlung beschädigt und zerstört,
und daß dazu verwendete kostbare Material vollständig entwertet wird. Ich möchte deshalb vorziehen, die bis jetzt
ergangenen Kosten zu tragen und den Plan fallen zu lassen.“ Da entgegnete der Doktor: „Ja wenn das so ist, und
Sie haben nicht mehr Geduld, dann ist es freilich besser, die Arbeit zu unterlassen.“ Ich beglich schnell meine
Rechnung, verabschiedete mich, und freue mich bis heute noch, dieser Gefahr glücklich entgangen zu sein.
Nachträglich überlegte ich mir noch, daß meine selige Mutter 84 Jahre alt wurde, und davon wenigstens die
letzten 20 Jahre auch ohne Zähne. Wohl hat sie mir öfters darüber geklagt, wie sie sich beim Essen durch besseres
Zerschneiden helfen müsse; aber es ging doch, und es geht auch bei mir.
XVIII. Näheres über meine Geschwister und deren Familien.
Die Familie meines Vaters aus zweiter Ehe vermehrte sich recht beträchtlich; nämlich von acht Kindern, wovon
aber eine Tochter, wie schon erwähnt, früh gestorben ist, also eigentlich von sieben Kindern, auf die recht
stattliche Zahl von 66 Enkelkindern, in Summa 74 Nachkommen. In der letzten Lebensjahren meiner Mutter war
unter uns Kindern vereinbart worden, deren Geburtstag alljährlich im gesamten Familienkreis zu feiern, wozu
auch noch andere Freunde und Bekannte geladen wurden. Beim Ältesten der noch lebenden Kinder, also bei
Bruder Fritz, wurde der Anfang gemacht, und so ging es dann dem Alter nach abwärts, bis zuletzt die Reihe an
mich kam. Zweimal, nachdem ich von Altenwald nach Metz verzogen war, und bevor meine Mutter starb, habe
ich noch die Freude gehabt, an ihrem Geburtstag der Gastgeber zu sein. Um der betagten Mutter unter zahlreichen
Familien die Teilnahme am Familienfeste zu erleichtern, reiste ich mit den Meinigen nach Sulzbach, wo dann das
Fest bei meiner Schwester Maria, die eine Gastwirtschaft betrieb, gefeiert wurde. Zu einem dieser Feste, welches
in den letzten Lebensjahren meiner Mutter stattfand, war auch unser langjähriger Bürgermeister Herr Ganns,
geladen. Damals fand eine Zählung unserer Familienmitglieder, der Nachkommen meiner Eltern statt. Der
Bürgermeister Ganns hatte sich besonders darum bemüht. Dabei wurde festgestellt, daß bis dahin die Kinder,
Enkel und Urenkel (von Letzteren waren damals vier in Amerika) zusammen 99, also meine Mutter dazu
gerechnet, die respektable Zahl von sage und schreibe 100 erreicht hatten, ein Ereignis, welches die dortigen
Zeitungen damals für würdig erachtet hatten, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Nun hat sich bei mir bei der
Niederschreibung meiner Lebenserinnerungen der Gedanke aufgedrängt, nachzuforschen, wie sich die
Vermehrung meiner Familie seit dieser Zählung bisher weiter gestaltet hat. Und das Ergebnis ist, daß in dieser
Hinsicht ein ganz bedeutender Umschlag eingetreten ist, sowohl in meiner eigenen Familie, wie auch in denen
meiner Geschwister. Ich sehe da eine ganze Anzahl Neffen und Nichten, die gar keine Kinder, andere wieder, die
ein oder zwei, und wenn es hoch kommt, drei Kinder haben. Eine einzige Ausnahme macht meine verehrte Nichte
Gretchen. M. In B. Ich habe zwei Nichten, deren Taufpate ich bin, und die ich sehr hoch schätzte, L.W. und L.Z.*
Diese beiden haben es zusammen nur auf ein Mädchen gebracht. Ich habe alles in allem acht Enkelkinder,
darunter sind sieben Töchter und nur ein Sohn. Dies ist für den Kriegsminister oder die Heeresverwaltung doch
eine recht bedenkliche Sache. Wenn das so weitergeht, dann kann wohl nach einem Zeitraum von 40 Jahren das
im Jahre 1870 mit so großer Begeisterung gesungene Volkslied: „Lieb' Vaterland, magst ruhig sein“ nicht mehr
mit derselben Zuversicht gesungen werden.
{...}
XX Schlußwort.
Wenn ich nun einen Rückblick auf die 76 Jahre meines Lebens werfe, so möchte ich ausrufen: ich denke der alten
Zeit, der vorigen Jahre, und rede von allen deinen Werken, und sage von deinem Tun. Gott, dein Weg ist heilig.
Viel Schönes habe ich erlebt, ich erfuhr eine fröhliche Jugend, gedenke dabei vor allem in Liebe meiner frommen
Eltern, welche uns Kinder in frühester Jugend zum Gebet und Kirchgang ermahnt und angehalten haben. Auch als
Jüngling habe ich schöne Tage erlebt; ich durfte dann als Mann die Gründung des Deutschen Reiches sehen, ich
war unter den ersten Deutschen, die im wiederrlangten Metz eine neue Heimat fanden, ich konnte für mich und
meine Familie dort eine sichere Stätte gründen. Viel Schmerzliches habe ich auch erlebt; ich denke an die Gattin
und die Kinder, die vor mir ins Grab sanken, an die, welche mich verließen, an so manches Sturmwetter, welches
über mein Haupt gezogen ist. Aber in dem Allen erkenne ich doch im Glück wie im Leiden die Führung des
himmlischen Vaters und vertraue auf ihn, daß er es bis an mein Ende wohl mit mir machen wird, und schließe mit
den Worten:
Noch eines gib mir, Herr, hinnieden:
Deinen Geist und deinen Frieden
Und den Ruhm an meinem Grabe
Daß ich die ich geliebet habe.
-