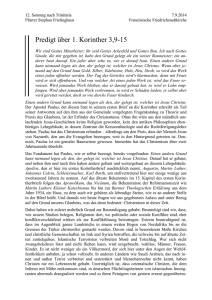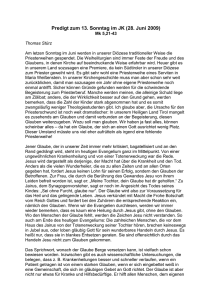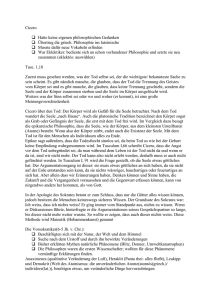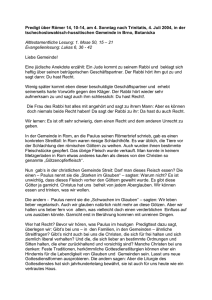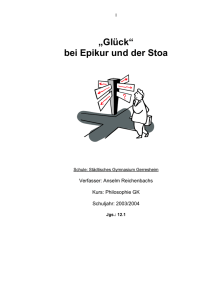klaas huizing - Institut für evangelische Theologie
Werbung
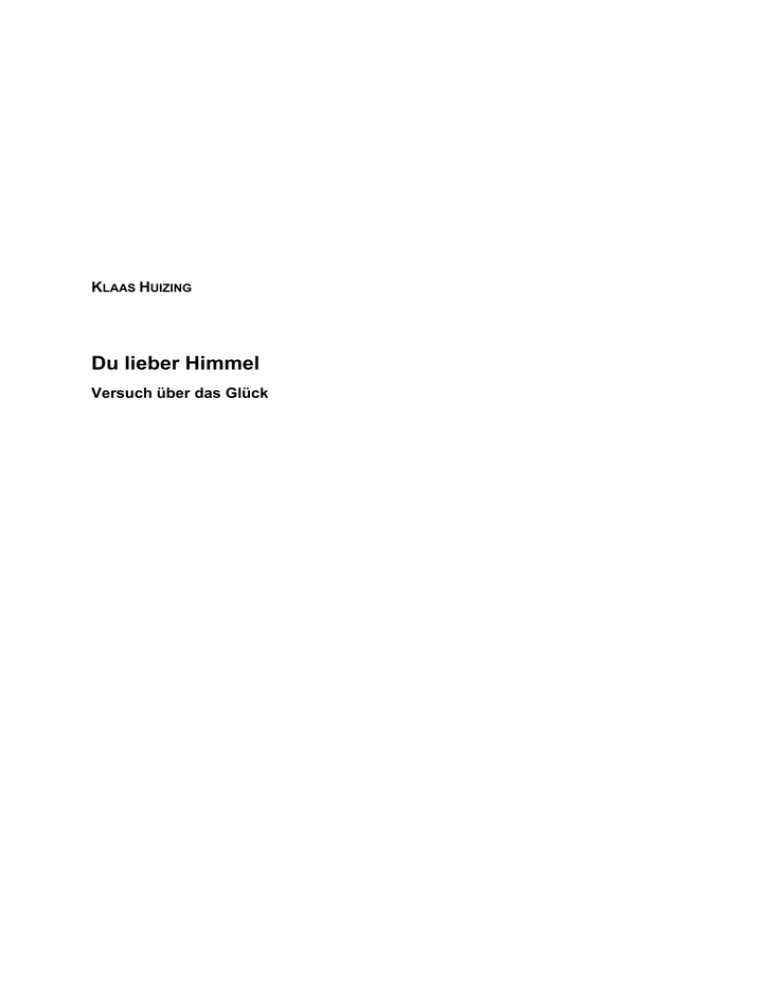
KLAAS HUIZING Du lieber Himmel Versuch über das Glück Mit dem Glück ist es nicht anders als mit der Wahrheit: Man hat es nicht, sondern ist darin, Ja, Glück ist nichts anderes als das Umfangensein, Nachbild der Geborgenheit in der Mutter. Darum aber kann kein Glücklicher je wissen, daß er es ist. Um das Glück zu verstehen, müßte er aus ihm heraustreten: er wäre wie ein Geborener. Wer sagt, er sei glücklich, lügt, indem er es beschwört, und sündigt so an dem Glück. Treue hält ihm bloß, der spricht, ich war glücklich. Das einzige Verhältnis des Bewußtseins zum Glück ist der Dank: das macht dessen unvergleichliche Würde aus. Theodor W. Adorno, Minima Moralia, 124. 6 Inhalt Vorspiel Himmel - Placebo oder Medizin 1. Das Glück der Euphorie 1.1 Göttergespräche 1.2 Sweet Alkibiades 1.3 Schöner Leben 1.4 Bin ich schön? 1.5 Hetärengespräche 2. Das Glück der Coolness 2.1 Götter- und Heroengespräche 2.2 Ertrage und Entsage? 2.3 Ungefährliche Leidenschaft 2.4 Bin ich cool? 2.5 Hetärengespräche 3. Das Glück der Resignation 3.1 Götter- und Heroengespräche 3.2 Der skeptische Blick 3.3 Die Kunst der Genügsamkeit 3.4 Bin ich genügsam? 3.5 Hetärengespräche 7 4. Das Glück der Harmonie 4.1 Heroengespräche 4.2 Zeugen im Hässlichen ? 4.3 Die Kunst der Nähe 4.4 Bin ich empfindsam? 4.5 Hetärengespräche Nachspiel Himmlische Medizin - Frei von Nebenwirkungen 8 Vorspiel Himmel - Placebo oder Medizin Himmel? Himmel. Zunächst das gehauchte H, dezente und vornehme Erinnerung an den Windstoß des Heiligen Geistes - Ruach, dann das aufsteigende I, dann die doppelte Brücke des abschmeckenden mm (mit verschlucktem h), am Ende schließlich, welch herrliche Intrige der Sprache!, der hebräische Gottesnamen el: Himmel. Wer dieser spekulativen Etymologie keinen Glauben schenkt, dem empfehle ich einen Gebrauchstest. Auch Wörter haben ein Verfallsdatum, werden ranzig oder setzen Schimmel an. Wenn ich Wörter auf ihre Haltbarkeit hin testen will, dann sage ich sie mir immer wieder laut vor, zwanzig, dreißig, vierzig Mal: Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, so lange, bis das Wort nur noch ein reiner Klangkörper ist. Zuweilen wird das Wort mir dann ganz fremd, als würde ich es zum ersten Mal vernehmen, betörend zumeist, faszinierend und immer lässt mich dieses neu entdeckte Wort erschaudern. Himmel ist so ein Wort. Himmel, das ist alles und noch viel mehr, was die Phantasie sich erträumt. Das sind Märchenszenarien, Idyllen der Gehirnkammer, Gegenwelten zum fatalen Einerlei des Hier und Jetzt, ein vielstimmiger Abgesang auf das schäbige Establishment, zuweilen ein giftiges Attentat auf den Status quo, Schaufenster der Seele, Sedativ und Stimulans, vorneuzeitliche Netzkarte und Kursbuch, irdische Vorfreude 9 auf eine Erlösung vom Dax und dem verschriebenen Wellnessterror, griechisches Gelage und christliche Schau (Show) des Höchsten. Ohne Himmel geht’s nicht. Offensichtlich. Das Internet bietet zum Stichwort Himmel 725 Titel. Hier die Top ten nach Amazon: 1. JEANNIE BREWER: Ein Riss im Himmel. 2. UTE EHRHARDT: Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Warum bravsein uns nicht weiterbringt. 3. RAINER MARIA RILKE: Gegenüber dem Himmel. Gedichte. 4. PETRA HAMMESFAHR: Der gläserne Himmel. 5. NORA ROBERTS: So hoch wie der Himmel. 6. ERICH KARKOSCHKA: Atlas für Himmelbeobachter. 7. ELIZABETH FULLER: Wenn du den Emu am Himmel siehst. Eine Reise in die Welt der Aborigines. 8. FRANCESCA MARIANO: Himmel über Afrika. 9. JAMES VANPRAAGH: Und der Himmel tat sich auf. Jenseitsbotschaften. 10. MICHAEL SCHOPHAUS: Im Himmel warten Bäume auf dich. Die Bandbreite reicht von verkaufsträchtigen Fibeln der Lebensberatung über Esoterik bis zum satten Roman und luziden Gedicht. Nicht mitgerechnet werden alle Titel, die mit den Redewendungen zum Stichwort Himmel kickern. Man würde aber, verließe man sich auf die Stichwortsuche, den schönen Roman der sich früh geouteten und jetzt fleißig bekennenden Melancholikerin BIRGIT VANDERBEKE übersehen: „Abgehängt“ (2001) – der Himmel hängt offensichtlich nicht mehr voller Geigen, wenn die Liebe schwächelt. Unter der Rubrik Video werden 44 Filme aufgelistet, darunter der noch immer inspirierende Film ‚Der Himmel über Berlin‘ (mit BRUNO GANZ, OTTO SANDER), Dem Himmel so nah (KEANU REEVES, AINTANA SANCHEZ-GIJON) und Der Himmel soll warten (W ARREN BEATTY, JULIE CHRISTIE). 10 Obwohl die Gebildeten unter den Verächtern der Theologie die metaphysischen Geigen abgehängt haben, obwohl das party-adrette Stichwort von der ‚Gesellschaft ohne Baldachin‘ (SOEFFNER) die Runde macht, obwohl es als ausgemacht gilt, dass der Himmel wüst und leer und weltraumkalt ist, kommen die sogenannten Headliner, deren eines Ohr immer am Volksmund klebt, ohne den Begriff Himmel nicht aus. Bis auf weiteres ist der Himmel Synonym für (über)irdisches Glück. Wenn aber die Intellektuellen Recht haben und der Himmel trostlos, wenn die Götter ihren Rücktritt eingereicht, dann wird die semantische Liaison von Himmel und Glück fraglich. Die Rede vom Himmel ist dann nur noch metaphorischer Flitter. PASCAL BRUCKNER, Romancier und Essayist, hat die Verlegung des Glücks vom religiösen Jenseits ins irdische Diesseits auf eine sprechende Formel gebracht: „Verdammt zum Glück“ (2001). Das ist der „Fluch der Moderne“. Glück ist nicht mehr himmlische Sehnsucht sondern, spätestens seit den 60er Jahren, irdisches Programm. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dieses Programm zu ratifizieren – es sei denn, wir pfeifen auf das Glück der Zurichtung durch gepredigte desertieren Glücksstrategien zugunsten der der Glücksdresseure letzten Freiheit und des Unglücklichseins. Bei BRUCKNER wird mit dem Himmel das Glück zugleich vertrieben. Offensichtlich ist das eine ohne das andere nicht zu haben. Zu fragen ist, ob es nicht Glück jenseits der kulturindustriellen Zurüstung und Banalisierung gibt und ob nicht auch die Rede vom Himmel durchaus noch Sinn macht. Und ob, wie BRUCKNER meint, ein Christ ein Mensch aus der anderen Welt sei (17ff), ist stramm formuliert aber entbehrt nicht ganz der Überlegenheitsunterstellung: Nach BRUCKNER dürften Christen in der Moderne niemals angekommen sein. (Einige sind es fraglich nicht und 11 tummeln sich vergnügt weiter im Mittelalter. Einige im Mittelalter UMBERTO ECOS.) Widerspruch erzeugt BRUCKNER bei mir vor allem, weil er nicht sieht, dass es differente Modelle glücklicher Lebensführung gibt, die von der Antike her bekannt sind und modern oder postmodern reformuliert worden sind. Die christliche Lebensdeutung ist ein Angebot unter vielen. Und das von BRUCKNER sehr zu recht denunzierte Modell der Glücksvergötterung ist auch nur ein Relaunch alter Texte. Ganz anders nähert sich ANNEMARIE PIEPER dem Thema. In ihrem Buch „Glückssache“ arbeitet sie sich versiert durch die Geschichte der Glückstheorien. Das ist durchweg gediegen, obwohl ich den Zuordnungen wie Ästhetische Lebensform: sinnliches Glück; religiöse Lebensform: kontemplatives Glück nicht traue. (Mal abgesehen von der prima facie nicht einsichtigen Scheidung zwischen sittlicher und ethischer Lebensform.) Unterschwellig favorisiert PIEPER einen ethischen Ansatz, der dem ewig ungezogenen Leib Mores lehrt. Diese tour de force bleibt aber extrem unverbindlich und akademisch distanziert. Man blättert ratlos zurück Und wie bei BRUCKNER werden unbesehen Klischees über das Christentum tradiert. Den Neuplatonismus als Sohn des Christentums anzugeben ist – mit Verlaub – genetisch bedenklich. Diesen Vaterschaftstest zweifle ich an. Prompt verkommt das Christentum bei PIEPER zum leibfeindlichen Vertröstungsinstitut. Wie selbstverständlich unterstellt sie dem Christentum - wie dem Platonismus - eine intendierte Aufstiegsbewegung, im Christentum eine Anabasis zur letztgültigen Einheit mit Gott, übersieht dabei aber, dass am Anfang ein Abstieg, eine Katabasis Gottes ins Fleisch stand. Positionen zu treffen ist Glückssache. Ich möchte in diesem Essay vier Lebensstile unterscheiden, die sich in exemplarischen Grundstimmungen (und Gesten) ausdrücken. Zunächst die Euphorie. Euphoriker sind 12 Menschen, die Erfahrungen machen, die sie unter Strom versetzen, zumeist Erfahrungen von betörender Schönheit, Levitationserfahrungen mit dem Hang zum Höheren. (Wer als Euphoriker sich sofort an der Schönheit ergötzt, ruiniert den Zauber, erstickt ihn in den Kissen, hält beim Morgenkaffee Leichenbeschau – eine schöne Leich! - und macht sich anschließend auf die Suche nach dem neuesten Zauber. Ein Ahasverus in eroticis. KIERKEGAARD hat diesem schlechten Euphoriker in ‚Entweder – Oder‘ die Leviten gelesen. Das wahre Euphoriker liebt immer – natürlich nicht nur - platonisch.) Auf der mentalen Richterskala nimmt die genügsame Resignation die Gegenposition ein. Der Resignierte weiß um die unsicheren Fundamente, kennt die Abgründe und flaniert deshalb bedächtig. Er ist Minimalist und redet gerne im Adorno- oder Odo Marquard-Jargon. Minima erotica. Genügsam eben. Bleiben die Mittelwerte. Der Coole ist dem Schönen durchaus nicht abgeneigt. Der antike Coole orientiert sich mit Vorliebe am ewig Schönen und bleibt dem Irdischen gegenüber gelassen. Auch der postmoderne Coole liebt die Gelassenheit. Sein Deo hält. Historisch rangiert er – geht man von der Blüteperiode aus - vor den Skeptikern. Es gibt also eine mentale Verfallsgeschichte. Die wird nur vom Christentum aufgehalten. Schließlich der Harmoniesucher. Er ist durchaus nicht weltflüchtig sondern (auch) Agent des Unfertigen und Hässlichen. Er weiß um die Dialektik des Schönen. Seine Gestalt ist alternd, schön ist er nicht. Er integriert Weihnachtsfreude und Karfreitagschmerz. Ich beginne die einzelnen Abschnitte mit Göttergesprächen. Sie finden über den Wolken des Olymp statt oder im Garten Eden. (Die Himmelsvorstellungen sind bekanntlich umfangreich, wie JEFFREY BURTON RUSSEL in dem hübschen 13 Buch „Geschichte des Himmels“ 1999 zeigt.) Die Agenten sind natürlich nicht ganz auf der Höhe des Begriffs. Dann folgen Miniaturen aus Geschichte und Gegenwart. Gesucht werden Helden der Philosophie und Theologie, die antike Muster neu designern. Die ausgesuchten Agenten haben alle einen Hang zur guten alten Ataraxie, zur Seelenruhe, ihre Ausgangserfahrungen sind aber durchaus verschieden und verweisen unterschwellig auf PLATONS Erfahrung des Schönen, der stoischen und epikureischen Gelassenheit oder der skeptischen Genügsamkeit. Weil die Literatur und der Film besonders geeignet sind, Situationen des Glücks und der Verletzungen einzufangen und mit Vokabularien auszustatten (vielleicht gelingt ihr das sogar besser als der Ethik), kommt dem Blick auf die Kunst ein eigener Punkt zu. (Selbstredend: Literaten und Filmemacher lassen sich nicht immer eindeutig Lebensgefühlen und Lebensmodellen zuordnen, aber oft finden sich doch Teile von Vokabularien, die auf traditionelle Muster reagieren. Ist etwa der häufig genannte gallische Apokalyptiker HOUELLEBECQ ein Zyniker, ein neocooler Stoiker oder resignierender Skeptiker? Ist der THOMAS BERNHARD der „Auslöschung“ ein Kyniker oder ein Neoplatoniker?) Abgerundet werden die Kapitel mit Hetärengesprächen. Freundinnen sind in Glücksdingen am besten bewandert. Konsens ist dort allerdings nicht zu erwarten. Aber wer sagt denn, dass Gezänk nicht auch Glück verbreitet? Ist Ataraxie vielleicht nur ein müder Männertraum? Sind aber vier Angebote nicht drei zuviel? Eine naiv sich gebende, aber nicht unberechtigte Frage, haben wir doch alle Stichworte wie ‚Orientierungskrise‘ und ‚neue Unübersichtlichkeit‘ (Habermas) im Ohr. Moden, auch philosophische und religiöse Moden, altern immer schneller. Bereits die nächste Buchmesse zelebriert oft Rituale der Erinnerung an Moden des Zeitgeistes, die eine scheinbar 14 imperiale Stellung einnahmen, aber in der Zwischenzeit einen atemberaubenden Entwertungsschub durchgemacht haben. Wir leben in einer Optionsgesellschaft (Kunstmann 1997), das ja, aber die Optionen haben häufig allenfalls den zwielichtigen Wert Bananenpassagen von Optionscheinen auf moderne in rostbäuchigen Schiffen vor Madagaskar. Die berufsmäßigen Etikettierer behelfen sich, eine Mischung aus Vorsicht und Erfindungsnot, mit der Aufschrift ‚post‘: Poststrukturalismus, Postmoderne, Postmarxismus. Die Verschnellung des Geistes ist nicht zuletzt eine Folge der agilen Kreuzung der Methoden. Gäbe es einen verbindlichen Theoriedarwinismus, dann müssten Vertreter einer Richtung Hand an sich anlegen, sobald jemand diese Richtung mit einem ‚post‘ denunziert. Das Glück eines Theoretikers bestünde dann in der Entlastung vom Tempo des Alterns. Ich habe mich deshalb auf antike Gründungsdokumente zurück gezogen, die eine offensichtliche Attraktivität auf für die Gegenwart besitzen. (Vollständigkeit kann nicht intendiert sein, aber vielleicht ist das vorgeschlagene Geviert in der Tat die Quadratur des Kreises.) Ich halte jedes der Modelle für lebenstauglich und lebensdienlich. Welches Modell ein Leser wählt, hängt nicht zuletzt auch von der charakterlichen Disposition und der eigenen intellektuellen Biographie und Physiognomie ab. Aber natürlich habe ich eine Vorliebe und die Aufgipfelung des Diskurses ist auch nicht ganz zufällig. Ich habe einen Standpunkt außerhalb des Christentums eingenommen, um Stärken und Schwächen der Modelle (halbwegs) nüchtern sondieren zu können. Plakativ formuliert: In einem ganz basalen Sinn meint Glück Entlastung. Das religiöse Theoriesetting des Christentums ist in dieser Hinsicht ein sehr attraktives Angebot. Offen bleibt zunächst die Frage, ob der Himmel, wie die Religionskritik meinte, nur ein Placebo ist. Noch KANT wollte 15 auf die Vorstellung bekanntlich nicht verzichten. Und die Dichter, mögen sie auch als Lügner von PLATON denunziert worden sein, hätscheln diese Vorstellung mit gleicher Inbrunst wie die volksreligiös Frommen. Und die Theologie? Die Theologie gehört seit ehedem und auch noch nach der Aufklärung zu den Theoriesettings, die Vorstellungen glaubund lebenswürdig machen wollen, wo andere Theoriesettings betreten schweigen oder lauthals lachen. Geht die Geschichte des Himmels also doch weiter? Zumindest literarisch. 16 1. Das Glück der Euphorie 1.1 Göttergespräche Ein ehelicher Wortwechsel zwischen ZEUS und seiner Gemahlin H e r a. Seitdem du den phrygischen Knaben da vom Ida geraubt und hierher gebracht hast, finde ich dich sehr kalt gegen mich, Zeus. Z e u s. Du bist also auf den unschuldigen, harmlosen Jungen eifersüchtig? Ich dachte, nur die Weiber und Mädchen, die gut mit mir stehen, machten dich so übellaunig. H e r a. Es ist in Wahrheit gar nicht schön, wie du es so treibst, und es schickt sich sehr übel für dich, daß du, der Herrscher aller Götter, deine rechtmäßig angetraute Ehegattin sitzenläßt und da unten auf der Erde in Gestalt eines goldenen Regens oder eines Stiers oder eines Satyrs überall herumbuhlst. Indessen bleiben jene Weibsstücke doch wenigstens dort, wo sie hingehören, nämlich auf der Erde; aber diesen Hirtenjungen da hast du, deiner göttlichen Majestät zur Schmach, sogar in den Himmel heraufgeholt und mir vor die Nase hingesetzt unter dem Vorwande, daß er dir den Nektar einschenken solle; als ob du so verlegen um einen Mundschenken wärest und Hebe und Hephaistos einem so schweren Amt nicht länger vorstehen vermöchten. Aber freilich nimmst du den Becher nie aus seiner Hand, ohne ihm vor unser aller Augen einen Kuß zu geben, der dir besser als der Nektar schmeckt, so daß du alle Augenblicke zu trinken verlangst, wenn du gleich keinen Durst hast; ja du treibst es so weit, daß du den Becher, wenn du ihn nur ein wenig abgetrunken hast, dem Jungen hinreichst und ihn 17 daraus trinken läßt, um das, was er übriggelassen hat, als etwas gar Köstliches aufzuschlürfen; und zwar auf der Seite, die er mit seinen Lippen berührt hat, damit du zugleich das Vergnügen zu trinken und zu küssen habest. Und legtest du, der König und Allvater, nicht neulich Ägis und Donnerkeil auf die Seite und hocktest dich trotz deinem langen Bart auf den blanken Boden hin, um mit ihm Schusser zu spielen? Bilde dir ja nicht ein, daß du deine Sachen so heimlich triebest; ich sehe das alles recht gut. Z e u s. Und was ist denn das so entsetzliches, o Hera, wenn man, um sich ein doppeltes Vergnügen zu machen, einem so schönen Knaben unterm Trinken einmal einen Kuß gibt? Wenn ich ihm erlaubte, dich ein einziges Mal zu küssen, du würdest mir gewiß keinen Vorwurf daraus machen, daß ich seine Küsse dem Nektar vorziehe. H e r a. Das sind doch höchst unanständige Reden, wie sie nur eine gewisse Sorte von Männern führt! Ich meinesteils werde hoffentlich niemals so wahnsinnig sein, so einem phrygischen Weichling mit meinen Lippen auch nur in die Nähe zu kommen. Z e u s (hitzig). Schmäh mir bloß nicht, du Erlauchte, die Knabenliebe! Dieser weibische Junge, dieser Halbwilde, dieser Weichling, ist mir lieber und begehrenswerter als – ach, ich will lieber gar nichts sagen, sonst läuft dir die Galle noch vollends über... (LUKIAN 1998, 12f.) 18 1.2 Sweet Alkibiades Viele tradierte Begriffe haben ein sehr eigenwilliges Flair. Platonische Liebe ist so ein Begriff. Verklausuliert ausgedrückt handelt es sich um die Penetrationsscheu. Oder um die eine geschickte Sublimierung des Begehrens. Das Bildgedächtnis denkt ans pubertäre Anhimmeln. Oder erinnert das virile Urteil über einen kleinen Feigling in eroticis. Kaum jemand kennt den eigentlichen Sitz im Leben. Ein fiktiver Lexikonartikel kann eine erste Orientierung bieten. Platon, Sohn des Ariston und der Periktione, mutmaßlich 428/7 v. Chr. in Athen geboren, gest. ebd. 347. Platon gilt als der berühmteste Schüler des -> Sokrates (470-399); 387 gründet Platon die phil. Akademie, die bis 529 n. Chr. Bestand hat. Sein an Sokrates geschultes phil. Konzept pflegt den Dialog als Medium, um die Seele der potentiellen Gesprächspartner durch prüfendes Nachfragen (Elenktik) von bloß eingebildetem Wissen zu reinigen (katharsis) und das Wissen, das die Seele immer schon in sich trägt, gesprächsweise, in Rede und Gegenrede, zu entbinden (Mäeutik, Hebammenkunst). Philosophie versteht Platon im Kern als paideia (Erziehung), als eine Umwandlung, die in einer Lebensform mündet, die sich am Schönen, Guten und Wahren orientiert. Das Erziehungsprogramm, in seinem Hauptwerk "Der Staat" ausgeschrieben, soll den Menschen umwenden von seiner natürlichen Fixierung auf die sinnlichen Einzeldinge, um die vollkommenen Urbilder oder Ideen anzuschauen. Nach Platon erinnert sich der Mensch angesichts der euphorischen Erfahrung eines schönen Antlitzes an die Urbilder, die nicht der Erfahrung entstammen sondern der Seele immer schon einwohnen -> Anamnesis-Lehre. 19 (Wiedererinnerungslehre). Ziel ist die Ablösung eines triebgesteuerten Lebens, das sich um äußere Güter sorgt, durch ein Leben, das sich ganz an der vernünftigen Einsicht (Logos, Vernunft) orientiert und darin Sorge um die eigene Seele (epimeleia) trägt. Glückseligkeit oder Eudämonie besteht in der schönen Ordnung der Seele – und damit des ganzen Lebens. Von den ca. 25 als echt geltenden Dialogen sind die wichtigsten: Gorgias, Menon, Phaidros, Symposion, Staat, Parmenides, Theaitet, Timaios. Die erste beinahe vollständige Übersetzung der Werke Platons ins Deutsche legte -> F.D.E. SCHLEIERMACHER vor. Die platonische Liebe verbirgt sich in der Lexikon-Zeile über das schöne Antlitz. Seit JOSTEIN GAARDERS philosophische Hintertreppe „Sophies Welt“ ist es kein Geheimnis, dass die Philosophie mit dem Staunen beginnt. In PLATONS Dialog ‚Theaitetos‘ steht unmissverständlich: „Gar sehr nämlich ist die Leidenschaft (Pathos) des Philosophen das Staunen. Es gibt nämlich keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen." (155d) Für PLATON eigentümlich ist, dass er das anfängliche Staunen an einem konkretisiert, damit der schönen Mensch sich Angesicht an das „staunenderregende wesenhafte Schöne“ (Symposion 210e) erinnert. PLATON inszeniert das Drama der Wiedererinnerung im nach meiner Einschätzung – neben dem „Symposion“ schönsten Dialog "Phaidros". Gegenstand des Gesprächs ist Wesen und Ziel der Liebe. Liebe, genauer: die philosophische Liebe, ist für den platonischen SOKRATES eine rationale Form göttlicher Euphorie. Um in das Thema einzustimmen, erzählt SOKRATES zunächst einen Mythos über die Seele: Die menschliche Seele sei eine gefallene Seele, die vor Urzeiten das außerhalb des Kosmos befindliche wahrhaft Seiende geschaut habe: die Ideen. 20 Wenn nun ein Mensch auf etwas äußerst Schönes hier im Kosmos treffe, so erinnere er sich an die Idee, die er vor dem Fall geschaut habe, und die Seele erhebe sich aus ihrem leiblichen Grab oder Kerker. (Im Griechischen verbirgt sich hier ein Wortspiel: soma = sema, Leib = Grab. Die Vorstellung einer Unsterblichkeit der Seele, verknüpft mit einer Prä- und pythagoreischen Postexistenz, und ophischen dürfte Quellen Platon aus übernommen haben.) "Wer aber noch frische Weihung an sich hat und das Damalige vielfältig geschaut, wenn der ein gottähnliches Angesicht erblickt oder eine Gestalt des Körpers, welche die Schönheit vollkommen darstellen: so schaudert er zuerst, und es wandelt ihn etwas an von den damaligen Ängsten, hernach aber betet er sie anschauend an wie einen Gott, und fürchtete er nicht den Ruf eines übertriebenen Wahnsinns, so opferte er auch, wie einem heiligen Bilde oder einem Gotte, dem Liebling. Und hat er ihn gesehen, so überfällt ihn, wie nach dem Schauder des Fiebers, Umwandlung und Schweiß und ungewohnte Hitze." (251 a f.) Offensichtlich weiß SOKRATES, wovon er, der zeitlebens vom Beau Charmides (ist es eine List der Sprache, wenn im Namen der Charme verborgen liegt?) begeistert war und der vom Jünglingswunder sweet Alkibiades eine Nacht lang unter der Decke umworben wurde, redet. Eine in jeder Hinsicht Sinne erhebende Erfahrung, die den Ausgangspunkt bildet für eine durchgehend philosophisch geführte Lebensform: "Denn der Mensch muss gemäß dem, was man Idee nennt, Einsicht gewinnen, indem er von den zahlreichen Wahrnehmungen zu dem kommt, das durch die Überlegung zu einer Einheit zusammengefasst wird. Das aber ist nichts anderes als die Wiedererinnerung an das, was unsere Seele einst gesehen hat, als sie gemeinsam mit 21 dem Gott dahinfuhr, als sie auf das herabsah, von dem wir nun sagen, dass es sei, und als sie ihren Blick zu dem wahrhaft Seienden emporhob. Deshalb ist es auch gerecht, dass einzig das Denken der Philosophen beflügelt wird; denn mit seiner Erinnerung ist er stets nach Kräften bei jenen Dingen, dank denen ein Gott eben göttlich ist, dadurch, dass er sich mit ihnen beschäftigt. Der Mensch allein, der nun von solchen Erinnerungen auf richtige Weise Gebrauch macht und immer in vollkommenen Weihen geweiht ist, wird wahrhaft vollkommen. Indem er aber die menschlichen Bestrebungen aufgibt und mit den göttlichen umgeht, wird er von der Menge zurechtgewiesen, weil er verdreht sei; dass er aber gottbegeistert ist, das hat die Menge nicht gemerkt." (249cf.) Beschrieben wird vom platonischen SOKRATES eine erhebende Geschichte, die dem Anblick einer schönen Gestalt entspringt. Das ausgezeichnete Schöne nennt PLATON das "ekphanestaton" (250d), das Unverborgenste, das Hervorleuchtendste, und das "erasmiótaton", das Liebreizendste. Was ist damit gemeint? Um die Pointe zu verstehen, muss man kurz auf die platonische Grundüberzeugung eingehen, Philosophie nach dem Modell der "Techne" zu konzipieren. Der Ausdruck Techne (in dem Wort schwingt noch das deutsche Wort Technik mit) wird zunächst bezogen auf die Erstellung eines Werkes, eines Ergon. Ein Technit muss genau wissen, wie er etwas zu der geordneten Gestalt eines Ergon zusammenfügt. Er muss seine Arbeit immer wiederholen können und darüber Rechenschaft ablegen. Nun bezeichnet PLATON als Ergon nicht nur ein zu verfertigendes Ding, sondern ebenso die Gesundheit und die Ordnung der Seele, also alle Bestandsmomente der Wirklichkeit. Nennt Platon nun das schöne Gesicht das Hervorleuchtendste, dann deshalb, weil es in seiner Geordnetheit und Lebendigkeit 22 sofort verstehbar ist. Es ist das auf einen Blick Verständliche, weil es die geordnete und in ihrer Ordnung sichtbare Zusammenfügung von Momenten darstellt. Diese Gestalt entspricht also dem platonischen Modell eines ergons, von dem der Technit, hier: der philosophische Technit, Rechenschaft ablegen kann. "Ekphanestaton" ist die Gestalt, weil in ihr die Idee des Guten, die idea tou agaqou, als Grund der Geordnetheit und Verstehbarkeit alles Seins, zur Darstellung kommt. In dem Augenblick, in dem der frisch Geweihte, und das heisst hier: derjenige, der mit dem Mythos vom Seelenleben vertraut ist, auf eine schöne Gestalt trifft, erinnert er sich an die Ordnungsprinzipien als Garanten des Verstehens selbst und versteht das Gesicht als dessen Darstellung. Das nennt PLATON die Anamnesis, die Wieder-Erinnerung. Ausgelöst wird in dem Anblick einer schönen Gestalt ein Begehren selbst zur Darstellung der Idee des Guten zu werden, plakativ gesagt, ein schön geordnetes Leben zu führen. Die Philosophie will dann auch nichts anderes, als die Griechen zu einem entsprechend gestalteten Leben zu erziehen, d.h. jeder soll sein "Leben schlechthin nach der Liebe richten" (257b). Für PLATON ist entscheidend: Nur der Philosoph hat Einsicht in den Charakter von Ordnung. Jedes Ergon, auch das eigene Leben, ist eine Darstellung von Ordnung und damit der Idee, die Grund allen Seins und der Geordnetheit: der idea tou agathou. Deshalb weiß der Philosoph, dass ein schönes Gesicht eine Darstellung der Idee ist. Freilich: Auch der Philosoph kann dieses Wissen beim Gesprächspartner nicht einfach erzeugen, wohl aber den Gesprächspartner dazu veranlassen, diese Einsicht selbst zu gebären (Mäeutik). Der Eros ist jener zentrale Antrieb, der zwischen der Welt des Sinnlichen und Geistigen vermittelt. Der Gesprächspartner kann diese Einsicht im Anschluss an 23 diese nachvollziehbare Erfahrung ausführen, oder aber durch die Teilhabe am Dialog, der im Idealfall eine Darstellung der der schönen Ordnung ist. Die philosophische Kunst ist eine Kunst, die poietische Regeln angeben kann, wie denn ein philosophisches Gespräch gebaut sein muss. Ich gehe dazu von der Bestimmung der Philosophie als dialektischer Kunst aus: Die dialektische Kunst besteht nämlich in der Wechselwirtschaft, das "vielfach Zerstreute zusammenzuschauen zu einer Gestalt" und eine Gestalt "nach den Gliedern, wie sie von Natur gewachsen sind" auseinanderlegen zu können. (265 df.) Entsprechendes gilt auch für das Gespräch. Auch das Gespräch muss hervorleuchtend, d.h. als geordnete Gestalt präsentiert werden. Diese dialektische Geordnetheit der platonischen Dialoge ist gleichsam der Ausweis für die Inspiriertheit philosophischer Texte platonischer Provenienz. Als philosophische Rede setzt PLATON dabei auf eine literarische Form der Darstellung, die der menschlichen Gestalt entsprechend aufgebaut wird, mithin Kopf, Hand und Fuß hat (264c). PLATON sagt im Menon, dass die mythische Rede "regsam und lebendig" mache, die eristische Rede dagegen träge und faul. (Men 81ef.) Und im Phaidros heisst es: "Aber das wirst du doch zugeben, denke ich: dass jede Rede wie ein Lebewesen organisch aufgebaut sein und ihren eigenen Leib haben muss, so dass sie weder ohne Kopf noch ohne Füße ist, sondern Mitte und Enden hat, die so geschrieben sind, dass sie zueinander und zu dem Ganzen in einem passenden Verhältnis stehen." (Phaidros 264c) Der platonische SOKRATES, sagt zwar von sich, er könne nicht gebären (Theaitetos 1150bf), sondern nur wie eine männliche Hebamme die Zuhörer zur Wiedererinnerung des pränatal Geschauten animieren. Er ist in einer Hinsicht aber durchaus ein potenter Erzeuger, weil er im Schönen 24 zeugt, indem er wohlgeordnete Dialoge verfasst, die die Zuhörer befruchten. Nirgends verwandelt sich bei Platon die Euphorie in Hysterie. Nirgends auch dient die Befiederung durch den Eros als Levitationskraft für eine für eine esoterische Flucht aus der Welt. Platon bleibt ein Meister der Besonnenheit, Hüter und Wächter der schönen Ordnung. Erhebende Erfahrungen kanalisieren die Begierde - nach Platon neben Vernunft und Mut ein Teil der Seele -, mäßigen sie, lenken sie ab vom Ephemeren, damit alle Seelenteile die ihr eigene Aufgabe erfüllen: die Vernunft erfüllt sich in der Weisheit, die Tapferkeit in der Standhaftigkeit und die Begierde eben in der Mäßigung. Wenn die Seelenteile diese schöne Odrnung aufweisen, dann herrscht die Gerechtigkeit (Dikaiosune). Ein gutes und glückliches Leben ist also ein geordnetes, harmonisches Leben. Und deshalb erwartet die Toten, wie der Gorgias erzählt, auf einer Wiese ein Gericht und eine erneute Wiedergeburt. Viele Leben der Reinigung sind nötig, um schließlich den Wohnsitz der Götter zu erreichen. (Philosophen, so die nicht undemütige Einschätzung, benötigen weniger Zeit als die anderen.) Für PLATON könnte der Himmel freilich eine böse Überraschung bieten. Wenn LUKIAN Recht hat, ist der göttliche ZEUS jemand, der die platonische Sublimierung nicht mitmacht und ungeniert küsst und penetriert. 25 1.3 Schöner leben Schöner wohnen? Ja. Schöner leben? Auch. Die alte Frage nach dem glücklichen Leben wird in der Gegenwart vollmundig zur Frage nach dem schönen Leben. „Schönes Leben? Einführung in die Lebenskunst“ lautet ein Bestseller von W ILHELM SCHMID (2001). Er ist (wie jeder Philosoph) Nachmieter im Denken PLATONS und legt einen ambitionierten Versuch vor, die platonische Lebenskunst in vielfacher Brechung in die Gegenwart hinüber zu retten. SCHMID rubriziert seinen Ansatz unter dem Stichwort „schön zu leben“ (kalos zen), das erlaubt, zunächst die ganze antike Philosophie von PLATON über DIOGENES bis hin zu den STOIKERN und EPIKUR darunter zu versammeln. Und in der Tat: Die Lebenskunst nach SCHMID ist ein fröhlicher Eklektizismus, der klug aus allen klassischen Konzeptionen Skepsis (Negativdenken als nötige Korrektur auf das Gewäsch vom positive thinking, 109) und Christentum (wiederholt ist von der Fülle des Lebens, 1. Joh***, die Rede) eingeschlossen – das Beste herausfiltert. Der Held seiner Urszene, dem Bild „Exkursion in die Philosophie“ von EDWARD HOPPER abgelesen, ist aber eindeutig ein ernüchterter, postkoitaler Platoniker, der eine zwiespältige Erfahrung mit dem Eros gemacht hat. „Ein Ausschnitt aus dem Alltag zweier Menschen: Ein grübelnder Mann, die Stirn in Falten gelegt und mit strengen Bügelfalten in den Hosenbeinen, sinnt angestrengt über etwas nach. Er ist nicht allein, nicht zu übersehen ist die halb entblößte Frau hinter ihm, hingestreckt auf eine Liege, an deren Rand er sitzt, und abgewandt von ihm, ihr Gesicht ist nicht sichtbar. Die quer übers Kopfkissen hingegossenen Haare könnten verraten, dass sie sich abrupt von ihm weggedreht hat, und 26 sie macht nicht die geringsten Anstalten, sich ihm wieder zuzuwenden. Auch er schenkt ihr keinen Blick, er bleibt am Rand der Liege sitzen, in sich zusammengesunken und etwas verkrampft, eine Gestalt der Ratlosigkeit. Unklar bleibt das Verhältnis zwischen beiden, unklar, ob es um dieses Verhältnis geht, unklar, ob es noch ein Verhältnis gibt.“ (2001, 11) Es ist der Augenblick danach. Post coitum animal triste, sagen die Alten. Von Euphorie keine Spur mehr. Der himmlischen Vereinigung folgt der jähe Sturz in die solipsistische Existenz. Der sprichwörtlich platonisch Liebende belässt es deshalb, erfahrungsgesättigt, beim Anblick der schönen Gestalt, um sich dem ewig Schönen zuzuwenden. In HOPPERS Bild geschieht das gleichsam zu spät. Der Mann, der das Buch aus der Hand gelegt hat, laut Auskunft von HOPPER soll es PLATONS Symposion-Dialog sein, starrt auf das Licht, das durch das Fenster fällt, nach PLATONS Sonnengleichnis ein Bild für die Idee des Guten. „Das grelle Sonnenlicht, das durchs geöffnete Fenster hereinbricht, um sich wie ein Teppich vor die Füße des Mannes zu legen, wirkt wie ein Hohn angesichts der düsteren Atmosphäre im Inneren. Hoppers bittere Ironie: Der Mann stiert auf diesen Lichtteppich, dieses Abbild der ‚wahren Schönheit‘, als säße er nach dem mühsamen Aufstieg zu ihr am obersten Ende der Stufenleiter, wie dies Diotima in PLATONS ‚Symposion‘ schildert. Aber dieser Flecken aus Licht ist nicht das Licht selbst. So bleibt er der Wahrheit fremd genau in dem Moment, in dem er sie am nötigsten hätte, dem Moment nämlich, in dem das Gelage zu Ende ist. Es herrscht Ruhe, tödliche Ruhe, wie in den meisten Bildern von Hopper.“ (14) Dieser Augenblick ist die Geburt der Philosophie. Ein auf den Kopf gestellter PLATON. Beginnt bei PLATON die Philosophie mit dem Anblick des schönen Gesichts, dann 27 bei HOPPER mit der Erfahrung des abgewandten Gesichts. Die Euphorie droht in Melancholie umzukippen. Extremes meet. Die Moderne im Schatten PLATONS hat das Begehren nach Lust, so SCHMIDS Gegenwartsdeutung, mit dem Leben und dem Glück identifiziert, ohne vorher eine „Kunst des Umgangs mit den Lüsten auszubilden“ (19). Der Traum der Moderne ist der lustvolle Traum von Wohlstand und Zufriedenheit, der sich als Albtraum eingestellt hat. In einer hektischen, kalten und mußelosen Gesellschaft vereinsamt der Einzelne und scheitert am schönen Leben. SCHMID plädiert deshalb für eine Lebenskunst, die Übungen und Techniken präsentiert, damit das Leben eine Form bekommt und – so das horizontbildende Stichwort – „Intensität“ erhält. Intensität ist (neben Heiterkeit) eine glückliche Umwidmung der platonischen Euphorie: Gemeint ist die Verspannung des Lebens im Horizontalen, ein Annehmen und sich Sorgen um die leibliche Endlichkeit, die sich im Schmerz (51ff.) und im Tod (62ff.) der Anderen aufdrängt. Ein intensives Leben verlangt das sich Einrichten (Netz der Gewohnheiten knüpfen, 32ff.) in der Welt, aber so, dass die Macht der Gewohnheiten die Flexibilität und Spontaneität nicht überfremden. In diesem Prospekt überwintert eine Asketik und Diatetik, die nicht nur der Stoa, sondern auch der platonischen Lebenskunst eigen ist. Dies gilt – in gewissen Grenzen - auch für die nötigen Momente einer Aufhebung der Sorge in der Lust. SCHMID – und hier ist er ARISTOTELES und MONTAIGNE besonders nahe – plädiert für einen reflexiven Gebrauch der Lüste in einem „schönen Verhältnis“: „(D)ie Kunst der Erotik gibt dem Selbst Gelegenheit, das Gedächtnis des Fleisches zu bestärken, statt es ‚danach‘ beschämt wieder auszulöschen. Ideal ist die erotische Begegnung, die den Geist (mit dem Anderen zu denken), die Seele (mit ihm zu fühlen) und den Körper 28 (ihn zu spüren) umfasst, und bei der die Sorge des Selbst nicht ausschließlich der eigenen Lust, sondern ebenso der des Anderen gilt; eine Begegnung, die ausgekostet werden kann im vollen Bewusstsein, nicht den Traum vom immerwährenden Einssein erfüllen zu können, vielmehr den Rhythmus des Einsseins und Getrenntseins, des Verstehens und des Missverstehens zu unterliegen – und selbst dies kann als bejahenswert an einem ‚schönen Verhältnis‘ erfahren werden.“ (47f.) Wenn denn als Ziel der Lebenskunst definiert wird, sich ein schönes Leben zu machen (173ff.), dann ist dieses Projekt die Antwort auf das „Ende der großen Entwürfe zur Beglückung der Menschheit: Die Rückkehr zum Selbst, zum einzelnen Individuum, das neu damit beginnt, sich selbst zu gestalten, das Leben zu gestalten und nicht die alten Illusionen zu hegen. Lebenskunst, das ist die Renaissance des Individuums, das einst, zu Zeiten der großen Utopien, in der Apotheose der Gesellschaft unterzugehen drohte, und das nun gezwungen ist, in der Zeit der Abwesenheit großer Hoffnungen, sein Leben selbst zu führen.“ (173) Techniken, die dazu führen, der eigenen Existenz das „Profil einer sichtbaren Schönheit“ (176) zu verschaffen, sind der rechte Umgang mit der Zeit, eine essayistische Lebensform, eine angemessene Umgangsweise mit den Affekten, den Widersprüchen, der Melancholie und das Durchhalten einer (poststoischen und postepikureischen) Gleichmütigkeit, die sich in der Grundstimmung der Heiterkeit (euthymia) ausdrückt. Aufgabe muss es sein, das Glück wie ein vortreffliches Werk (ergon) auszuführen. Dabei beinhaltet das Glück nicht nur seelische und äußerliche Güter, sondern, wie SCHMID sagt, auch körperliche: „Ein Gut ist ferner, ganz vorsichtig formuliert (man scheut sich darüber zu sprechen, und doch kennt auch das gesellschaftliche Leben der Moderne 29 faktisch ein solches Kriterium), möglichst keine ganz und gar hässliche äußerem Erscheinung zu haben, die die höchste Gestalt des Glücks beeinträchtigen könnte, während ‚Schönheit‘ ihr förderlich ist.“ (166) Damit ist nun doch der Anschluss an PLATON erreicht: Der schöne Körper ist nicht nur Medium für eine euphorische Erfahrung und damit für den Aufstieg zur Schönheit der Idee, sondern ideale Matrix für das eigene schöne Leben. (Dem hätte der notorisch hässliche Sokrates wahrscheinlich durchaus zugestimmt.) Als plage ihn ein schlechtes Gewissen beeilt sich SCHMID hinzuzufügen, schön sei, was bejahenswert ist. „Bejahenswert kann keineswegs nur das Angenehme, Lustvolle oder, wie es im ausgehenden 20. Jahrhundert gerne genannt wurde, das ‚Positive‘ sein, sondern ebenso das Unangenehme, Schmerzliche, Hässliche, ‚Negative‘. Die Ästhetik der Existenz umfasst auch Misslingen, entscheidend ist, ob das Leben insgesamt als bejahenswert erscheint.“ (177) Der ‚existentielle Imperativ‘ lautet: „Gestalte dein Leben so, dass es bejahenswert ist.“ (178) Ob es bejahenswert ist, hängt dabei von der Interpretation des eigenen Lebens ab, die Interpretation des eigenen Lebens muss dabei durchaus die Interpretation durch die Freunde eingeschließen, so der aristotelische Schlenker. „Ein Leben zu führen, das nicht bejaht werden kann“ (179) ist dagegen eine ‚Sünde wider den heiligen Geist.‘ (ebd.) Durchaus elegant summiert SCHMID die abendländischen Modelle der Lebenskunst. Es bleibt als platonische Urüberzeugung die Idee der auch körperlichen Schönheit. Die Ur-Erfahrung, mit der die Philosophie anhebt, startet mit der Schönheit, davor oder eben danach. Theologische Lebenskunst – ich greife vor – kennt (neben der Schönheit des Weinhachtschristentums, nicht zufällig vom theologischen Platoniker SCHLEIERMACHER favorisiert) auch 30 als Ursituation die Erfahrung des Hässlichen, des Fauligen, des Ekels. Und im Gegenzug zur Vernunft des Schönen outen sich neuerdings Schriftsteller als Euphoriker körperlicher Materialermüdungen. KUNDERA findet die Zellulitis nicht nur bejahenswert, sondern gerät in ein wunderbar ekstatisches Schwärmen. 31 1.3 Bin ich schön? Obwohl „die Literatur immer wieder der Rechtfertigung der gesellschaftlichen Verhältnisse dient, hält sie trotzdem immer jenes Sehnen der Menschen lebendig, das im allgemeinen in der bestehenden Gesellschaft keine Erfüllung finden kann. Kummer und Trauer sind wesentliche Elemente der bürgerlichen Literatur.“ (LEO LÖWENTHAL 1966, 14f.) Das hört sich nach bestem Retro-Sound an, etwas verschmockt, aber immer noch aufklärend. LÖWENTHALS symphilosophierender Freund, der die Gattungsunterschiede zwischen Philosophie und Literatur bekanntlich eingeebnet hat, THEODOR W. ADORNO, hat in den Minima Moralia ein herrliche Vignette über ‚L’inutile beauté‘ verfasst: „Frauen von besonderer Schönheit sind zum Unglück verurteilt. Auch solche, denen alle Bedingungen günstig sind, denen Geburt, Reichtum, Talent beistehen, scheinen wie verfolgt oder besessen vom Drange zur Zerstörung ihrer selbst und aller menschlichen Verhältnisse, in die sie eintreten. Ein Orakel stellt sie vor die Wahl zwischen Verhängnissen. Entweder sie tauschen klug die Schönheit um den Erfolg. Dann zahlen sie mit dem Glück für dessen Bedingung; wie sie nicht mehr lieben können, vergiften sie die Liebe zu ihnen und bleiben mit leeren Händen zurück. Oder das Privileg der Schönheit gibt ihnen Mut und Sicherheit, den Tauschvertrag aufzusagen. Sie nehmen das Glück ernst, das ihnen sich verheißt, und geizen nicht mit sich, so bestätigt von der Neigung aller, daß sie ihren Wert nicht erst sich dartun müssen. In ihrer Jugend haben sie die Wahl. Das macht sie wahllos: nichts ist definitiv, alles läßt sich sogleich ersetzen. Ganz früh, ohne viel Überlegung, heiraten sie und verpflichten damit sich auf pedestre 32 Bedingungen, entäußern in gewissem Sinn sich des Privilegs der unendlichen Möglichkeit, erniedrigen sich zu Menschen. Zugleich aber halten sie an dem Kindertraum der Allmacht fest, den ihnen ihr Leben vorgaukelte, und lassen nicht ab – darin unbürgerlich – wegzuwerfen, wofür morgen eine Besseres dasein kann. Das ist ihr Typus des destruktiven Charakters. Gerade daß sie einmal hors de concours waren, bringt sie ins Hintertreffen der Konkurrenz, die sie nun manisch betreiben. Der Gestus der Unwiderstehlichkeit bleibt übrig, während diese schon zerging. Zauber zerfällt, sobals er, anstatt bloß Hoffnung darzustellen, sich häuslich niederläßt. Die Widerstehliche aber ist sogleich das Opfer: sie gerät unter die Ordnung, die sie einmal überflog. Ihrer Generosität wird die Strafe bereitet. Die Verkommene wie die Besessene sind Märtyrinnen des Glücks. Eingegliederte Schönheit ward mitllerweile zum kalkulabeln Element des Daseins, bloßer Ersatz fürs nicht existente Leben, ohne darüber im mindesten noch hinauszureichen. Sie hat sich und den anderen ihr Glücksversprechen gebrochen. Die jedoch, welche dazu steht, nimmt die Aura des Unheils an und wird selber vom Unheil ereilt. Darin hat die aufgeklärte Welt den Mythos ganz und gar aufgesogen. Der Neid der Götter hat diese überlebt.“ (1980, 192f.) Ihm tritt an die Seite der Altmeister des Leichten und niemals Seichten, MILAN KUNDERA, der in seinem jüngsten Roman „Die Unwissenheit“ die Zellulitis feiert, dass einem nicht nur warm ums Herz wird. Nach dem Beischlaf mit der Mutter seiner Freundin macht der Protagonist Gustaf eine Entdeckung: „Er sieht den Körper seiner neuen Geliebten, die sich vom Sofa erhebt; sie steht, zeigt ihm ihren Körper von hinten, die von Zellulitis ummantelten mächtigen Schenkel; diese Zellulitis entzückt ihn, als drücke sie die Vitalität einer sich 33 wellenden, bebenden Haut aus, die spricht, die singt, die zappelt, die sich zur Schau stellt; als sie sich bückt, um ihren auf den Boden geworfenen Morgenrock aufzuheben, kann er sich nicht mehr beherrschen und streichelt, nackt auf dem Sofa liegend, diese herrlich gewölbten Hinterbacken, er befühlt dieses monumentale, überfüllige Fleisch, dessen verschwenderische Großzügigkeit ihn tröstet und beruhigt. Ein Gefühl des Friedens hüllt ihn ein: zum ersten Mal in seinem Leben findet die Sexualität jenseits jeder Gefahr, jenseits von Konflikten und Dramen, jenseits jeder Verfolgung, jenseits von Schuldgefühlen, jenseits von Sorgen statt; er braucht sich um nichts zu kümmern, die Liebe kümmert sich um ihn, die Liebe, so wie er sie sich gewünscht hat und nie hatte: Liebe als Ruhe; Liebe als Vergessen; Liebe als Fahnenflucht; Liebe als Leichtsinn; Liebe als Belanglosigkeit.“ (2001, 173f.) Hinterrücks spielt KUNDERA mit einem anderen Motiv der Antike, jetzt spätrömisch gefärbt. Abundantia ist die Göttin der gesegneten Fülle, der Überfülle, des Überangebots, der nie versiegenden Quelle, eine Idee, die Schülergenerationen anhand des Gedichts von CONRAD FERDINAND MEYER ‚Der römische Brunnen‘ eingebleut wurde. Wenn in den Büchern und Filmen von DORIS DÖRRIE, sie pflegt eine doppelte Haushaltung, die nie zu einer Mehrfachverwertung verkommt, die bange Frage gestellt wird: Bin ich schön?, dann schwingt darin jener Kummer und jener Trauer mit, dem Wellness-Terror und den gemakelten Gesichtsstereotypen nicht genügen zu können, und genau das macht, zumindest in den Augenblicken, wenn sie die Missionarsattitüde des Frauenbuchs oder -films ablegt, den Charme dieser Filme und Bücher aus. Man ist hingerissen und profitiert, um es unflätig ökonomisch auszudrücken, von den Emotionen. Man wünscht der Mutter in DÖRIES 34 Erzählung ‚Bin ich schön‘ das Selbstbewusstsein der Schwiegermutter aus KUNDERAS Roman: „Mein Vater hat meiner Mutter verboten zu fragen. Aber jedesmal, wenn eine Frau im Bikini an uns vorbeigeht, sehe ich, wie die Wörter sich in den Mund meiner Mutter drängen, mit aller Macht herauswollen und wie sie versucht, sie herunterzuschlucken, die Zähne zusammenbeißt und die Lippen aufeinanderpreßt. Ich brauche dann nur noch bis zehn zählen, und schon höre ich meine Mutter sagen: Sagt mir die Wahrheit: ist mein Hintern so fett wie bei der da? Sind meine Beine auch so voller Dellen? Sehe ich aus wie die da? Bin ich hübscher? Oder häßlicher? Genauso? Ich will es nur wissen. Sagt es mir. Ich bin nicht beleidigt. Ich will nur wissen, woran ich bin. (...) Ich bin alt, sagt meine Mutter. Mein Vater seufzt. Versprecht mir, daß ihr mir sagt, wenn ich anfange, im Bikini unmöglich auszusehen. Der Körper meiner Mutter ist seltsam. Sie hat schlanke Arme und Beine, aber einen dicken Bauch, der wie ein Polster auf ihr draufsitzt und nie richtig braun wird, weiße Streifen durchziehen ihn wie Flüsse. Er ist häßlich, aber manchmal würde ich ihn gern berühren, er wirkt so weich und empfindlich. Ich hasse meinen Bauch, sagt meine Mutter. Ich kann machen, was ich will, er geht nicht weg, das hat man nun vom Kinderkriegen.“ (1995, 311f.) Und dann kam 1999 ‚American Beauty‘ in die Kinos, das Geschenk eines englischen Theaterregisseurs (SAM MENDES) an Hollywood, das sich ihrerseits nicht lumpen ließ und fünf Oscars rausrückte. Es ist die Geschichte von Lester, der im Schatten junger Mädchenblüte von einer Schulfreundin seiner Tochter verzaubert wird - gegen Ende des Films, und damit kurz vor seinem Tod, teilt er ihr mit, sie 35 sei das „Wunderschönste, was er je gesehen habe“ - , eine ihn in jeder Hinsicht beflügelnde Erfahrung, die bei ihm – gut platonisch - zur Frage nach dem schönen Leben führt. Er entdeckt die Schönheit, gut amerikanisch, während einer Cheerleader-Aufführung, ein Anstoß zum Reflexivwerden der eigenen Biographie. (Hinterrücks erinnert die Szene an eine alttestamentliche Textstelle, die davon zählt, wie die Weisheit – sophia – zur täglichen Lust Gottes auf dem Erdenrund tanzt, - einige Übersetzer haben zu Unrecht verniedlichend davon gesprochen, sie spiele vor ihm, Sprüche 8, 30.) Die Bilanz seines eigenen schalen Alltags ist trostlos: Er prostituiert sich seit vierzehn Jahren in der Werbebranche, holt sich morgens in der Dusche einen runter und nennt das den Höhepunkt des Tages; seine Frau ist das Klischee einer perfekten berufstätigen Amerikanerin im säkular protestantischen Milieu, die ihr Leben durchstylt, wo der Griff der Rosenschere zu den Rosen und den roten Cloggs und der roten Haustür passt, die sich wie ein Flaggelant selbst schlägt, wenn der Verkauf einer Immobilie scheitert (sie heult allenfalls hinter einem Vorhang oder im Auto, wenn eine Stimme vom Cassettenrekorder ihr Gehirn wäscht mit der Botschaft, nicht länger die Opferrolle zu übernehmen); seine unauffällige Tochter spart heimlich für eine Brustvergrößerung und lebte offensichtlich die letzten Jahre nebenher – nach außen hin eine Familie wie ein Werbespot. Lester erpresst bei seinem Abgang aus der Werbebranche (‚haben Sie mir nicht angeboten, ich könnte meinen Job behalten, wenn ich ihnen einen blase?‘) ein Jahresgehalt, kauft sich endlich den Sportwagen, den er vor vielen Jahren bei seinem Cousin bewunderte, geht joggen, nimmt einen Job als Verkäufer bei einer Burgerfirma an, weil er partout keine Verantwortung übernehmen will und fängt wieder an 36 zu kiffen, weil der erwachsene Sohn der neuen Nachbarn ihn auf den Geschmack bringt. Seine Frau Carolyn erbettelt sich ein Verhältnis mit dem Immobilienkönig Buddy Kane (Der Kane war ihr Schicksal; No Buddy knows, the trubble I’ve seen), schreit hysterisch im Bett: „Fick mich Euer Majestät“, wird prompt von ihrem Mann an der Essensausgabe der Burgerfiliale erwischt („Ich möchte, dass ihr glücklich seid, darfs noch Smily-Soße für den Burger sein“?) und wird daraufhin vom Immobilienking aus dem Bett entlassen – Gerüchte erwischt worden zu sein, kratzen am Image. Nur einmal noch kommen sich beide näher, aber Carolyn zerstört die Situation, weil sie Angst hat, ihr Mann würde mit Bier die Couch versauen („Das ist ein viertausend Dollar Sofa!“ „Das ist dir also wichtiger als zu leben!“). Die Tochter Jane verliebt sich in den Nachbarjungen Ricky, obwohl der sich anzieht wie ein Bibelverkäufer und ihr zunächst gewaltig auf die Nerven geht, weil er alles mit seiner Kamera dokumentiert. Ricky wurde von seinem Vater vor Jahren beim Dope-Rauchen erwischt und zwei Jahre in einer Klinik weggeschlossen. Er steht unter ständiger (Urin)Kontrolle, trotzdem gelingt es ihm, einen florierenden Handel aufzuziehen. Dieser Ricky entdeckt die Schönheit durch das transzendentale Auge der Kamera: das Lächeln auf einem toten Gesicht („es ist, als ob Gott dich direkt anschaut“), eine tote Taube, eine tanzende Tüte. Ricky und Jane beschließen mit dem Drogengeld ein neues Leben in New York zu starten. Im Zimmer nebenan ist Lester im Begriff, das platonische Verhältnis zu Janes Schulfreundin zu transzendieren, als sie Lester aber gesteht, dass sie noch Jungfrau ist, nimmt er sie schützend in den Arm. Lester stirbt durch ein Missverständnis. Rickys Vater, nach außen hin ein harten Militär, Waffennarr und Schwulenhasser, deutet einige Situationen falsch, nähert 37 sich Lester, wird aber abgewiesen. Als er am Küchentisch sitzt und ein Foto seiner Familie mustert, wird er von hinten erschossen. Der herbeieilende Ricky lächelt über die Schönheit des toten Gesichts. Carolyn schreit hysterisch, reißt den Kleiderschrank auf, umfasst die dort hängenden ‚leeren‘ Hemden ihres Mannes – eine wunderbare Einstellung - und sackt zusammen. Der Schluss gehört dem himmlischen Lester, der von oben auf seine Strasse schaut und darüber aufklärt, dass jeder in der Schlusssekunde seines Lebens die ganze Schönheit des verflossenen Lebens noch einmal präsentiert bekommt: der Blick auf die Sternschnuppen im Zeltlager, die alten Hände der Großmutter, das fallende Laub, der Sportwagen seines Cousins, Jane mit einer Wunderkerze, die damals noch glückliche Carolyn. Diese Schönheit „durchflutet mich wie Regen und ich kann nichts empfinden als tiefe Dankbarkeit.“ American Beauty – er könnte auch „Die Farbe Rot“ heißen – singt das hohe Lied der Schönheit, die nicht machbar ist und die man nicht festhalten kann, an die man sich aber erinnern kann, um im Alltag das Schöne – und in diesem Sinne auch Bejahenswerte zu entdecken. 38 1.4 Hetärengespräche Ein Wortwechsel zwischen XANTHIPPE, CAROL und MAGDALENA X a n t h i p p e: Als Sokrates damals dauernd am Marktplatz herum hing, sah er aus, als würde er seine Klamotten in einem Second-Hand-Laden kaufen, wahllos herumwühlen und irgend etwas vom Bügel zerren und sich überwerfen. Er prahlte sogar damit, dass wildfremde junge Männer ihm getragene Schuhe schenkten. Heute gilt er als Erfinder des Pennerdesigns und als Vorläufer von Gucci, aber ihr wisst, wie sehr das fuchst, wenn man an seinem eigenen Mann immer fremde Gerüche schnuppert. Er ließ sich öffentlich mit Absicht gehen, aber sobald der Herr Gatte hier zum Essen und Schlafen vorbeischaute, schwärmte und faselte er mir mit hungrigen Augen etwas vor von: Muskeln wie gemeißelt, von unnachahmlichen Faunslippen, vom federnden Gang wie bei jungen Hirschen, von süßen Schweißperlen auf der Oberlippe. Perlen vor die Säue kann ich da nur sagen. C a r o l: Krieg dich wieder ein. Dein Liebster hat mehr verbrochen als du glaubst. Du bist nicht das einzige Opfer. Dass die Schönheit die transzendentale Schwester des Guten und Wahren sei haben wir ihm liebend gerne geglaubt, als wir Frauen wieder hoch im Kurs standen und als Modell der Schönheit galten. Ich habe mir Montags die Achselhaare mit Wachs entfernt, täglich meine Beine rasiert, wöchentlich ein Peeling gemacht, weil ich mit der Haut unzufrieden war, ich habe an mir rumgeschmiergelt und 39 gecremt, als müsste ich mich neu erfinden. Dazu joggen. Dazu Fango. Übrigens nicht ohne Erfolg. Wie gut hat mir das getan, mich von einem irre erfolgreichen Kollegen anhimmeln und dann vögeln zu lassen. Mein Mann zog mich nur herunter, wie der immer auftrat, wie ein stellvertretender Vorsitzender der Handwerkskammer aus den 50ern. Und was macht mein Wasserscheitel, Liebster? schrubbt sich Verzichtet die auf den kupfergelben Nikotinfinger, schmeißt alles hin und schwärmt pubertär für einen Backfisch, eine Schulfreundin meiner Tochter. Jämmerlich. Und dann lässt er sich abknallen von einem verdrucksten Schwulen in Militärfummel, der heimlich Nazigeschirr sammelt. Und wer durfte die Schweinerei sauber machen? Ich natürlich. M a g d a l e n a: Die Angst der Frauen vor der zweiten Ehe. So redet ihr. Und ihr habt gar nichts verstanden. Seid doch mal ehrlich! Männer müssen den Charme eines alten Bugatti ausstrahlen, nicht tot poliert, sondern etwas marode. Und der Typ darf durchaus noch Motorschmiere an den Händen haben. Diese mit Nandrolon vollgepumpten Muckiberge und die ewig lächelnden Verkaufstypen sind doch auf die Dauer abtörnend. Und warum sind viele Männer heimlich scharf auf die Schwiegermütter? Na? Weil sie es gar nicht abwarten können, dass ihre Frauen endlich auch den angestaubten Glamour ihrer Mütter haben. Glaubt mir. Für Fritz etwa waren meine Reiterhosen, also diese knollenartigen Wülste an den Oberschenkeln, das riesige Tor zur Erlösung. Und meine Zellulitis war für ihn das goldene Vlies. Echt. Für die Anbeter des Makellosen muss sein euphorischen Flüstern wie eine kaputte CD geklungen haben. Aber mein alter Schwede war so strong. Really strong. Und niemals glücklicher. 40 Und ich auch nicht. Das war der Himmel auf Erden. 41 2. Das Glück der Coolness 2.1 Götter- und Heroengespräche Kleiner Streit zwischen ZEUS, HERA und ZENON Z e n o n: Ich muss gestehen, Hera hat am Ende recht mit ihren Vorhaltungen. Wie wehe es ihr in den Augen tut, wenn du sie heimlich sitzen lässt und als Stier oder Schwan zu den Irdischen kommst und dich dort wollüstig ergehst. Dann glaubt man dir, dass Dionysos dein Sohn ist, der den unnützen Weinstock und den Wein erfunden hat, der die Menschen von Sinnen bringt, sie torkeln lässt und lallen und Unzucht treiben. Mir kommt es wie Hohn vor, wenn wir Euch preisen, jüngst noch der liebe Marc Aurel, der allen Menschen nicht müde wird zu sagen, man müsse die Götter verehren, obwohl man sie nicht sieht, wie man ja auch die Seele verehrt, obgleich keiner ihrer ansichtig wird. Das ist ungereimt, so über uns zu spotten! Schlussendlich wird die Sache noch einen üblen Ausgang nehmen und euch keiner mehr verehren, wenn das Gerücht von Gezänk, von der ewigen Eifersucht und der Buhlerei die Runde macht. Es sind deren bereits viele, darunter Kluge und zuweilen Besonnene, die böse Reden schwingen und Gehör beim gemeinen Volk erlangen. H e r a: Ich kann so schön betteln wie ich will, Er gibt dem feurigen Temperament seiner Gäule immer wieder nach. Mir will es nicht gelingen. Was auch immer ich tue, ob ich auch vergehe vor Liebe, obgleich ich drohe und zürne, er lässt mich eifersüchtig zurück und treibt hernach noch seinen Spott mit mir. 42 Z e u s: Du lernst es einfach nicht, mit mir richtig umzugehen. Was wundert es dich, wenn mir dann die Galle überläuft? Und vergiss nicht: Das Wechselt-das-BäumchenSpiel hat uns hernach doch zärtliche Stunden der Versöhnung geschenkt. H e r a: Du spottest erneut über mich! Ich habe keine rechte Freude mehr an dir! Z e n o n: Ertrage und entsage, Zeus! Veredle dein Sperma zu den Keimkräften der Vernunft, den spermatikoi logoi. Andernfalls werden dich noch die Hetären verlachen. Und deren Lachen gällt auch dir in den Ohren. Nimm dich in acht, Zeus! Du bist ein Tunichtgut. Mir will es scheinen, du würdest den epikureischen Schweinen nacheifern. Man sollte dir mit dem Pantoffel den Hintern ausklopfen. Z e u s: Hast du es heute auf mich abgesehen, Zenon? Willst du mich aufreizen? Lachhaft. Bist du bei deinem philosophischen Freund Kleanthes in die Boxschule gegangen und willst mich herausfordern? Schweig lieber stille, sonst trägst du deinen Kopf noch gebeugter als gewöhnlich. Fasse deine lose Zunge im Zaum und unterlass diese Reden, denn sie betreffen mich nicht. Erkenne dich selbst und sei ganz vernünftig. Du bist mir zu lau, auch jetzt, da du unter uns weilst. Du bildest dir ein in Übereinstimmung mit der Natur zu leben? Wer nie erhitzt ist, kann wahrlich nicht glücklich sein. 43 2.2 Ertrage und Entsage? Wird einer Person das Etikett ‚stoisch‘ angeheftet, dann darf man nicht sicher sein, ob es als Orden oder als Kainsmal gemeint ist. Mit dem Ausdruck ‚stoisch‘ vernetzt das Kleinhirn die Ruhe, aber in einer Kontaktanzeige kann stoische Ruhe – übrigens meistens als Charakterdesign eines Mannes eingesetzt - bedeuten: ein Mann, schlechterdings schicksalsresistent, ihn wirft nichts aus der Ruhe; ‚stoisch‘ kann aber auch als Umschreibung für einen apathischen Langweiler und erotischen Stoffel eingesetzt werden. Vorsicht also! Oft ist nicht einmal klar, ob stoisch als Umschreibung von Seelenruhe nicht eigentlich einen epikureischen Lebensstil intendiert. Das moderne Gedächtnis trennt oft nicht scharf zwischen diesen beiden Schulen der Antike – zum Teil mit gutem Grund. Auf den ersten Blick aber sind der 341 geborene Athener EPIKUR und der Zypriote ZENON (geb. 333) als Begründer der Stoa feindliche ‚Brüder‘. Beide bieten vor dem Hintergrund der schwindenden Macht der griechischen Kleinstaaten den verunsicherten Menschen eine neue Orientierung. Vor allem bei EPIKUR wird die Individualisierung der Glücksthematik offensichtlich. EPIKUR ist Entstressungstheoretiker in jeder Hinsicht. LAERTIOS berichtet, dass die Körperkonstitution EPIKURS erbärmlich gewesen sei, so dass er sich viele Jahre nicht von seiner Sänfte erheben konnte. EPIKUR dürfte zudem der erste Hellene gewesen sein, der die Politikverdrossenheit erfunden hat. „Meide die Politik! Lebe im Verborgenen!“, lautet der Wahlspruch. Eine altruistische Anlage gibt es seiner Einschätzung nach nicht, und damit auch keine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft. Die Freundschaft dagegen, die aus Freiheit entsteht, ist die ideale Form des Zusammenlebens und wurde entsprechend 44 im berühmten Garten EPIKURS fröhlich ausgelebt. Von den zahlreichen Freunden, die nur Gutes über ihn berichteten, ist nur einer zum Skeptiker KARNEADES, dem damaligen Kopf der Akademie, konvertiert. Eine überzeugende Bilanz. In seiner Jugend hat er offensichtlich unter starker Furcht vor den Göttern und dem Tod gelitten und hat deshalb die Atomistik des DEMOKRIT, die weder strafende Götter noch ein Leben nach dem Tode lehrt, mit Freuden als Enstressungsangebot aufgenommen. Philosophie dient hier als Angstbewältigungspraxis: Tricky gelingt es EPIKUR, seine Jugendängste durch eine philosophische Anverwandlung der Atomistik zu therapieren: Die Welt als kontingente Verbindung der Atome bleibt von strafenden Göttern unbehelligt. Sie fristen eine glückliche, aber die Menschen nicht weiter zu interessierende Randexistenz. Unsterblichkeit kann es nicht geben, weil nach dem Tode die Seele sich in Atome auflöst. Und eine Angst vor dem Tod ist unberechtigt, denn, so der berühmte Ausspruch: „Wenn wir sind, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, sind wir nicht.“ Oder in etwas anderer Formulierung: „Der Tod hat keine Bedeutung für uns; denn was aufgelöst ist, ist ohne Empfindung; was aber ohne Empfindung ist, das hat keine Bedeutung für uns.“ (115) (Übrigens: Urheberrechte kannte EPIKUR nicht an. DIOGENES LAERTIOS berichtet: „Mit der Atomlehre des DEMOKRIT und der Lustlehre des ARISTIPP springe er ganz wie mit seinem Eigentum um.“ (1968, 5) Der Mensch, so EPIKUR, ist zunächst und zumeist von der Sorge um das eigene Dasein geleitet. Wie bei allen Lebewesen richtet sich der Urtrieb auf die Lust, allerdings nicht, wie immer wieder behauptet, primär auf die fleischliche Lust (obwohl EPIKUR mit der Hetäre LEONTION mehr oder minder lsutvoll zusammen lebte), sondern auf die Lust, die der Vernunft entspringt und sich dann einstellt, 45 wenn der Mensch von Schmerzen und seelischer Unruhe befreit wird. Glück bedeutet Ataraxie, Seelenruhe oder Unerschütterlichkeit. Ganz anders – zumindest auf den ersten Blick - ZENON aus Kition auf Zypern. Er ist ein Heros der Pflicht. (Und genetischer Ahnherr von IMMANUEL KANT.) Vergnügte sich EPIKUR mit seinen Freunden im Garten, so wählte ZENON für seine öffentlichen Auftritte ab 301 die mit POLYGNOTS Gemälden ausgestattete Halle am Markt, die ‚Stoa Poikile‘, die im Volksmund „Die Bunte“ genannt wurde. (Unter den Hochglanzmagazinen habe ich für „Die Bunte“ deshalb immer eine besondere Schwäche gehabt.) Berichtet wird, er, hochaufgeschossen, habe ein eher herbes und ernstes Aussehen gehabt, dabei den Kopf oft schief gehalten und mit zusammen gezogenen Gesprächspartnern zugehört. Augenbrauen Knauserigkeit seinen wird ihm nachgesagt, Anspruchslosigkeit, unbändiger Fleiß, eine aufbrausende Art, die durch den Genuss von Wein abgemildert wurde. „(N)ach der Ursache der Wandlung gefragt, sagte er, es gehe ihm wie den Lupinen, die, ehe sie übergossen werden, bitter schmecken, angefeuchtet aber süß und angenehm. (...) Zu essen pflegte er ein wenig Brot und Honig und trank dazu etwas blumigen Wein. Geschlechtlichen Verkehr mit Knaben hatte er selten, ein oder das andere Mahl wohl auch mit einem Mädchen, um nicht den Eindruck eines Weiberfeindes zu machen.“ (Stoa und Stoiker, 6) Einer Legende zufolge sollen die Athener ihm die Schlüsselgewalt über die Stadt gegeben und ihn mit einem goldenen Kranz, mit einem Bronzebild und einem Grabmahl geehrt haben. ZENONS Urintention richtet sich gegen eine Grund- überzeugung EPIKURS. ZENON ist von der Schönheit und Zweckmäßigkeit der Welt ergriffen und weigert sich, diese als Zufall zu deuten, weil andernfalls man auch glauben 46 könne, die Illias sei „durch ein zufälliges Ausschütten von Buchstaben entstanden.“ (83) Der Kosmos sei das Werk einer schöpferischen Urkraft, eines Logos, der, untrennbar mit dem feinsten Element, dem (Herd)Feuer, verbunden, die ‚vernünftigen Keimkräfte‘ jedes Dinges in sich trage und den auch der Mensch als Stimme Gottes in seiner Brust spüre. Die Zweckmäßigkeit schließt durchaus die Freude an Schönheit und Buntheit ein, wie man, so die Auskunft, nicht nur am Schweif des Faus, sondern auch an den Brustwarzen und am Bart des Mannes ablesen könne. Dieser Logos, der in der Seele sein Organ hat, unterscheidet, so ZENON, den Menschen vom Tier und deshalb ist die epikureische Rede vom Urtrieb des Menschen auf die Lust abzulehnen. (Die Denunzierung der Epikureer als ‚Schweine‘ hat hier ihre Wurzel.) Mit Gott ist der Mensch durch die Vernunft, den Logos, verwandt. Der Urtrieb des Menschen richtet sich nach ZENON auf die Entfaltung und Erhaltung des eigenen Wesens, also der Entwicklung des Logos. Das impliziert eine Beherrschung der nur sinnlichen Übereinstimmung mit Triebe. Ziel dem Logos, ist ein der Leben nicht in durch Leidenschaften in seinem Wählen des Guten gestört werden darf (Apathie). Gewöhnlich wird tradiert, Ziel sei das ‚Leben in der Übereinstimmung mit der Natur‘ (homologumenós tä fusei zän). Da die menschliche Natur und die allgemeine Natur allerdings vom Logos durchseelt sind, meint ein vernunftgemäßes Leben ein Leben, das diesem All-Logos entspricht. Das Leben im Einklang mit dem Logos der Natur (der menschlichen und der allgemeinen) konkretisiert sich als sittliches, gutes Verhalten in der Gemeinschaft, denn der Mensch ist von Natur aus, weil alle Menschen den Logos in sich spüren, gesellig. Darin besteht die eigentliche Tugend und Glück des Menschen. Auch die eigene Freiheit findet in 47 diesem Ordnungsdenken einen angemessenen Ort. „Die sittliche Autonomie des Menschen wurde damit aber keineswegs aufgehoben; denn das allgemeine Gesetz befahl ihm nur, was ihm der eigene Logos, wenn er gesund war, als richtig zeigte.“ (Stoa und Stoiker, XVI) Wahrhaft gut ist dabei alles, was zur Glückseligkeit beiträgt wie Einsicht, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Selbstbeherrschung. Lust, Schönheit, Stärke, Gesundheit zählen dagegen zu den indifferenten Dingen (Adiaphora), die sowohl schaden als auch nützen können. Auch das Leben ist streng genommen etwas Indifferentes, bildet aber die Voraussetzung für die Entfaltung des Logos. Es entspricht also durchaus der Natur, das Leben zu erhalten. Allerdings kann es vernünftig sein, aus dem Leben zu scheiden. Die Stoa der Folgezeit unter PANAITIOS und POSEIDONIOS – vor allem aber in der römischen Variante – zählt vier Fälle auf, in denen der Freitod der eigenen Natur entspricht: „erstens eine dringende sittliche Notwendigkeit, etwa Aufopferung für das Vaterland; zweitens Tyrannengewalt, die zum Unsittlichen zwingen will, drittens langwierige Krankheit, die den Leib verhindert, der Seele als Werkzeug zu dienen, viertens Armut, endlich Geisteskrankheit.“ (146) Nochmals: Die stoische Ethik betont die Einfügung des Menschen in dem vom Logos, dem Naturgesetz durchwalteten Welt. Nur dann stellt sich Glück ein, die sich als Freiheit von den Leidenschaften (Apathie) erreichte Ataraxie (Unerschütterlichkeit) einstellt. Nur wenn die schlechten Affekte wie Wut oder Trauer durch die Vernufnt beherrscht werden, stellt sich dieses Glück ein. Die sogenannten Kardinaltugendebn (Gerechtigkeit, Eiinscht, Tapferkeit Selbstbehrrschung oder Mäßigung) dienen der Affektkontrolle. (stoische Theorie: acht Seelenteile: fünf Sinne, Sprache, Zeugungskraft, Hegemonikon) 48 (Dagegen später Christentum in der Gestalt von Augustin. Wenn die Kardinaltugenden nur zur Affektkontrolle dienen, dann verfehlen sie den eigentlichen Zielpunkt: die Grundverderbtheit des Menschen als Sünder. Tugendlehre ist Arbeit an den Symptomen: wahres Glück ist 1. nicht in diesem Leben erreichbar und 2. nicht durch eigene Macht. Wichtiger sind die theologischen Tugenden wie Glaube, Hoffnung und Liebe, die sich vollständig auf Gott konzentrieren.) Die Stoa bot über viele Jahrhunderte hinweg eine sehr wirksame Lebenskunstschulung. In ihrer Nüchternheit, dem rigiden Pflichtbegriff, der Unterordnung des Einzelnen unter das Sittengesetz, war die Stoa namentlich für das römische Staatswesen attraktiv. LUCIUS ANNAEUS SENECA etwa (4 –65 n.Chr.) war Erzieher NEROS und später graue Eminenz in der Staatsführung. In seiner Programmschrift ‚De vita beata‘ (Vom glückseligen Leben) hat er noch einmal gegen EPIKUR (allerdings sehr milde und eher vereinnahmend) die Ansicht hinterfragt, das höchste Gut sei im Genuss zu suchen, fügt aber ergänzend hinzu, dass für denjenigen, der die höchste sittliche Vollkommenheit (virtus) erlange, sich durchaus eine spezifische Freude (gaudium) einstelle. Aber: „Auch die Freude, die aus der sittlichen Vollkommenheit entsteht – obwohl sie gut ist -, ist dennoch nicht ein Teil des vollkommen Guten, ebensowenig wie Fröhlichkeit und Ruhe, obwohl sie aus den erfreulichsten Anlässen hervorgehen; denn das sind Güter, aber dem höchsten Gut folgend, nicht sein Wesen ausmachend.“ (1999, 37) Nicht ganz frei von Eigeninteresse hat SENECA den Reichtum verteidigt, sofern man ihn sinnvoll gebrauche: „Reichtum nämlich befindet sich bei einem weisen Mann in der Stellung eines Sklaven, bei einem törichten in der eines Herrn.“ (67) Überhaupt ist SENECA in seiner vereinnahmenden Art nicht ganz unschuldig für eine latente Annäherung zwischen Stoikern 49 und Epikureern, weil SENECA die Seelenruhe auch als Übersetzung der Leidenschaftslosigkeit, stoischen Apathie, also der verwendet. So lautet einer seiner berühmtesten philosophischen Schriften: De tranquillitate animi; berühmt ist auch der Entstressungsdialog über die Muße; stilbildend im besten Sinne des Wortes waren die Schriften über den Trost. (Sehr spannend zu lesen, aber leider apokryph ist der Briefwechsel zwischen SENECA und PAULUS, vgl. SCHNEEMELCHER 1989, 44-50.) In MARC AUREL, dem ‚Philosophen auf dem Kaiserthron‘, der mit dem Traktat ‚Wege zu sich selbst‘ einen echten Bestseller schrieb, reifte die Stoa noch einmal zur späten Blüte. (Noch FRIEDRICH DER GROßE lebte in dieser Gedankenwelt, wie ein überliefertes Gedicht ‚Le Stoicien‘ 1761, geschrieben in aussichtsloser Lage im Lager von Strehlen, bezeugt.) AUREL rückte die Stoa noch näher an den Epikureismus heran, weil auch er Glück als Freiheit von Schmerz und Angst charakterisierte, über EPIKUR aber ging er hinaus, wenn er auch das Unglück als Chance oder Bewährung für das Glück bestimmte: „Ich Glücklicher, daß ich, obwohl mir dies passiert ist, keine Schmerzen habe, von dem gegenwärtigen Unglück nicht zerbrochen werde und zukünftiges Leid nicht fürchte.“ (1992, 47) Und trotzdem blieben Stoa und Epikureismus nicht die prägenden Lebenskunstschulen. Es gab eine mehr oder weniger freundliche Übernahme durch das Christentum, das den Hunger nach Spiritualität mit einem persönlichen Gottesverhältnis verband und zugleich in der Lebenkunst der Nächstenliebe ein ganz neues Verhältnis zu Schmerz, Alter und Leiden pflegte. Der zumindest erneut von den späteren Stoikern gepredigte Unsterblichkeitsglaube, der von den Stoikern favorisierte Monotheismus (bereits ZENON interpretierte die Volksgötter als Elemente, etwa HERA als Luft und ZEUS als den Himmel), der Vorsehungsglaube, die 50 sittlichen Anschauungen und die Logosspekulationen boten Möglichkeiten der Umwidmung. Eine berühmte Übernahmethese lautete etwa: Die Offenbarung des Logos kulminiert in der Inkarnation, der Fleischwerdung Christi auf Erden. Damit wurde nicht nur der stoische Pantheismus in die Schranken gewiesen, sondern auch durch die Rede von der Inkarnation, der nicht nur scheinbaren Fleischwerdung des Logos in Jesus Christus, die Leiblichkeit mit einer nie gekannten Würde ausgezeichnet. Eine tätige Diakonie den Armen, Kranken und Alten gegenüber kam zum Durchbruch, weil niemand sich länger auf die theoretische Überzeugung zurückziehen konnte, das Glück des Menschen sei von den Außendingen letztlich unabhängig. Der große Gelehrte der Stoa, MAX POHLENZ, schreibt: „Als die stärkste religiöse Macht erwies sich das Christentum. Es war die Offenbarungsreligion, in die sich die des unfruchtbaren Philosophenstreites müde gewordenen Geister flüchteten; es verkündigte den Glauben an den persönlichen Gott, den gütigen Vater, und machte allen Kompromissen mit dem längst zur leeren Form erstarrten Polytheismus ein Ende; es befreite durch die Aussicht auf Sündenvergebung und Gnade die Menschen von ihrem seelischen Druck und tröstete die Mühseligen und Beladenen mit der Hoffnung auf die Vergeltung im Jenseits. Es erwies vor allem durch die Tat, daß es eine viel wirksamere ‚Lebenskunst‘ war als die alte Philosophie.“ (XXIV, vergleiche ders. 1948.) Nur in einer Überzeugung blieb die Differenz gewaltig. Lehrten Stoa und Epikureismus, der Mensch könne sein Glück aus eigener Kraft erreichen, so teilt das Christentum diesen anthropologischen Optimismus nicht, sondern prägt den Gedanken der sündigen Existenz. Auch die Geistesgeschichte ist eine Börse. Eine Totalinsolvenz ist selten. Mit niedrigem Wert notiert, wurden die Aktien der Stoiker und Epikureer, die sich den 51 Übernahmeavancen verweigerten, immer wieder gezeichnet. Momentan sind erneut sehr hoch im Kurs. Der NeoStoizismus firmiert unter dem Label: Cool. 2.3 Ungefährliche Leidenschaft Wer mit schwerstpubertierenden Kindern zusammenlebt ahnt, was Coolness ist. Endlich gibt es das Buch zum Thema, das die alten, noch mit einer warmen Pädagogik ausstaffierten Eltern, die sich mental zu erkälten drohen, aufklärt. „Das Adjektiv ‚cool‘ begann seine Karriere als Bezeichnung Eingang popkultureller in die Phänomene, Umgangssprache fand schnell besonders von Jugendlichen und gilt heute von der Werbung bis zur Politik als vage Umschreibung für etwas positiv Lässiges. Gegen Ende der neunziger Jahre war Kohl ‚cool‘, ebenso wie die PDS oder die jungen Liberalen. Auch für Sondermodelle beliebter Automarken und sogar bei Finanzierungsmodellen von Banken wurde mit der Bezeichnung ‚cool‘ die Aura einer selbstbewußten Modernität und Stilisiertheit herauf- beschworen.“ (2000, 9) So ULF POSCHARDT, ehemaliger Herausgeber des Freitagsmagazins der Süddeutschen Zeitung. POSCHARDT deutet die Haltung des ‚Cool‘ als einen Lebensstil, der in der Kälte der modernen Massen- und Mediengesellschaft Leben überlebenswert macht. „‘Coolness‘ ermöglicht den Menschen mit der Kälte zu leben, statt in ihr zu erfrieren. Die Ästhetik des ‚Cool‘ macht die Kälte der Entfremdung stilisierbar und gibt Methoden an die Hand, die Pracht einer Welt, die zum ‚Eispalast‘ (Jean Paul) geworden ist, zu genießen. (...) Als individuelle Praxis dient die Haltung des ‚Cool‘ wie eine Rüstung der Abwendung von Unheil auf psychischer und körperlicher Ebene. (...) ‚Cool‘ sein heißt, nicht verführt werden können, wenn man es nicht 52 will. Es heißt, nicht verletzt werden können, wenn man es nicht will. Es heißt, Kontrolle als Schutz und Schutz als Kontrolle zu verstehen – analog zu Alpinisten und Polarforschern die sich mit Schutzbekleidung die tödliche Kälte vom Leib halten, um sich in ihr zu bewegen.“ (11) In geübt archäologischer Manier sucht ULF POSCHARDT die Ahnherren des neuen Cool auf, im Cool Jazz, bei Jimmi Hendrix, bei Tom und Jerry, den Futuristen, eigentlich so ziemlich überall. (Intellektuelle Trennschärfe ist nicht unbedingt die Stärke von POSCHARDT. Der Text hat manchmal den Charme eines Tante-Emma-Ladens mit Neonröhren.) Spannend ist aber die Ahnherrforschung hinsichtlich der Stoa. „Als Individualisten waren die antiken Dissidenz-Philosophen die Avantgarde des Polis- Bürgertums. Die Praxis der Stoa muß als eine der Kühlquellen der westlichen Zivilisation gelten; über ihre moderne Neuinterpretation wird sie zu einer Lebenstechnik, mit der die Kälte ausgehalten und souverän behandelt werden kann. Die Stoa ist in gewisser Weise die Ursache der Kälte und kann doch auch Rettung von ihr bedeuten, wenn sich aus der Abwehr der Kälte eine offensive, affirmative und souveräne Lebenspraxis und Ästhetik entwickelt. Eine neue Radikalität des stoischen, skeptischen und kynischen transzendentalen Denkens entfaltet Obdachlosigkeit der sich in Moderne. der Unter einem leeren Himmel greift die antike Auffasssung von der Philosophie als Wegweiser zum glücklichen Leben nicht mehr. Sah die Stoa die Welt von Gott und damit durch Vernunft geordnet, erscheint Gott heute selbst in seiner säkularisierten, rationalisierten Form als Weltvernunft nur mehr in der Imagination. Die Lebenstechniken der Stoa dennoch aufzugreifen, heißt, sie bewußt ad absurdum zu führen. Die Ästhetik des ‚Cool‘ hat eine ihrer Wurzeln in einer Form von Individualismus, die in der antiken Sorge um 53 das Selbst beginnt und sich bis in die aktuellen Spielarten der Selbststilisierung abwandelt.“ (41f.) Coole Strategien sind solche der Verweigerung, eine Entsolidarisierung mit dem ausgegebenen ‚Gemeinwohl‘, aber nicht mehr in der Gestalt der hitzigen Attacken des Kynikers DIOGENES VON SINOPE. „Die Strategen und Praktiker des ‚Cool‘ sind Stoiker ohne die Gewißheit, ein gutes und wahres Leben zu führen.“ (47) Recyclet wird das Modell der Ataraxie, und um die zu erreichen sind Hilfsmittel wie Sonnenbrillen, Walkmen, oder Kapuzenpullis hilfreich – eine Abschottung, die „eine extrovertierte Sensibilität“ (299) verhindert. Die Ataraxie wird extrem radikalisiert, denn der „neuen Stoa“ – zumindest in der „futuristischen Codierung des Coolen“ (166) - geht es „um eine finale Abkehr von der Humanität als Leitbild. Das Abtöten der Leidenschaften dient nicht mehr einer humanen Apathie oder Anästhesie, es bereitet den Übergang der Leidenschaft in ein digitales Reiz-Reaktionsschema vor.“ (156) Das in der SF-Literatur – etwa bei WILLIAM GIBSON vorbereitete Inszenario der Implantierung von Chips im Menschen, die einen digitalen Kurzschluss ermöglicht, wird hier als coole Technik gefeiert. „Der Prometheus des 21. Jahrhunderts ruht in einem Zustand fortwährender Neuheit, in dem er einem konstanten Prozeß von Programmierungen und Reprogrammierungen ausgesetzt bleibt. Die aktuellsten Formen der romantischen Liebe finden ihren Höhepunkt im Eindringen in eine fremde Software. Das Hacken im psychischen Netz des Anderen ermöglicht als Zerstörung eine Form der Nähe, die im wechselseitigen Konsumieren der Images abhanden gekommen ist. (...) Je tiefer die Strukturen des Technologischen in die menschlichen Körper eindringen, je vollständiger die Schnittstellen Kompatibilität anbieten, um so vielschichtiger kann der Austausch zwischen dem Subjekt und dem Anderen werden. Der 54 Verlust des Selbst als Erfüllung der Liebe im Rausch erscheint wieder möglich in einer Diffusion, die eher die Form eines Netzes oder Rhizoms annimmt als sie einer überschaubaren Synthese zweier Einheiten.“ (156f.) Und dann (endlich) wird die maue (nicht wirklich coole) Schreibe des ULF POSCHARDT wärmer: Es gibt doch einen Gegner: Hollywood als böse Marketinganstalt eines humanistischen Leitbildes und als Predigerseminar für die Liebe. Hollywood steht für eine Kitschindustrie, für die „Coolness“ letztlich eine Metastase ist, die sich, nach deren Überzeugung, allerdings mit der chemischen Droge Liebe therapieren lässt. Zu studieren etwa am Film Harry und Sally - das ist der Film, in dem die Frau im Restaurant einen veritablen Orgasmus mimt. Zunächst wird Sally, eine etwas verklemmte und konservative Journalistin, von Harry, dessen Coolness sich in einem sehr trockenen Humor äußert, denunziert, sie besitze die ‚Sensibilität eines Kühlschrankes‘, aber am Ende des Films werden Verklemmtheit und Zynismus durch die Wärme echter Liebe aufgetaut. POSCHARDT verweigert sich der Strategie, die thermische Grundbefindlichkeit der Welt durch einen übermäßigen Auswurf von Glückshormonen zu verbessern. Hollywood – ein Auslaufmodell. „Die Bewährungsprobe für jede Haltung des ‚Cool‘ ist das Maß an Freiheit, das benötigt wird, um Distanz auszuleben. Die alte Schule des ‚Cool‘ war geprägt vom klassischen Begriff der Freiheit als Ungebundenheit und Souveränität. Die futuristische Schule des ‚Cool‘ erfährt Freiheit paradoxal in der Affirmation der Entfremdung und Selbstzüchtigung. Sie labt sich an den Erfahrungen von Fragmentierungen und Beschneidung. Ihre Souveränität hat sich das Schema des Masochismus übergestreift.“ (330) Bindungslosigkeit, ein Kampf gegen die Nähe, wird zu einem Kennzeichen der kulturellen Avantgarde. Liebe gilt hier als schlechte Einstimmung in eine 55 von Funktionalität Gesellschaft“ geprägte Welt. Dem „Druck der (379) zur Anpassung verweigert sich die „postmoderne Stoa“ (ebd.) durch Prozesse von Selbststigmatisierungen: „Gerade dieses Realisieren des Versehrtwerdens ist ein Grundmotiv der aktiven Praxis des ‚Cool‘, die sich zu kleinen, gezielten Selbstmorden entscheidet, um nicht von anderen oder der Macht versehrt zu werden.“ (380f.) Nur en passant spricht POSCHARDT in den letzten Seiten von einer nicht ausgeführten Technik der ‚aiskese‘, die dem „übermächtigen Kapitalismus“ (391) die Stirn bietet. „Das Ideal des ‚Cool‘ bleibt die Unantastbarkeit. Dies wäre auch dann erreicht, wenn nichts mehr das Subjekt berührt. Die Unantastbarkeit erscheint - so wird sie auch von der Stoa bereits konzipiert – als Mischung aus Gottähnlichkeit und dem Zustand als Toter. In der Praxis des übermächtigen Kapitalismus bleibt sie Schutzschild wie Waffe all jener, die sich den Aggressionen, die zumeist verführerisch und bequem als Vereinnahmungen auftauchen, wehrhaft (!) entgegen stellen.“ (390f.) Sympathisch an dem nur ansatzweise skizzierten Lebensstil des ‚Cool‘ ist das Aufbegehren gegen die Zurichtung des Menschen als Verfügungsmasse in einem globalisierten Kapitalismus. (Die Generalkritik gibt sich allerdings keine große Mühe, diese zu belegen. POSCHARDT beschränkt sich darauf ‚ADORNO‘ zu hauchen und zu hüsteln.) Asketisches Verhalten ist mehr als angemessen. (Man findet den Vorschlag auch bei SCHMID, bei W ETZ und im Kontext christlicher Lebenskunst.) Problematisch aber scheint mir die Verabschiedung eines alten humanistischen Menschenbildes und damit zugleich die Denunzierung der Liebe. Bei POSCHARDT überwintert die – eigentlich epikureische - Strategie der Schmerzvermeidung, die notfalls mit einer Selbstversehrung erkauft wird. Am Horizont 56 taucht die Idee eines Menschenprojektes auf, das mit dem Romancier HOUELLEBECQ, der am Ende seines Romans ‚Elemenarteilchen‘ alle Hoffnungen auf eine genetische Verbesserung stellt, „die Apotheose eines neuen Menschen, der nur wenig mehr mit der ‚schmerzbeladenen, nichtswürdigen Spezies zu tun, die sich kaum vom Affen unterschied“ (386), feiert. Aber ob man diese schockgefrorene Stoa leben kann, ist sehr die Frage. Ich beginne in meinen Streifzügen durch die Literatur mit hochgelobten Agenten einer postmodernen Stoa und zitiere ein sehr eindrucksvolles Dokument, das diese Haltung offensichtlich glücklich kultiviert hat. Meistens aber, wie am Film ‚Intimacy‘ zu studieren, überwiegt das unglückliche, durchaus nicht schmerzfreie Bewusstsein. Was zum Schluss noch übrig bleibt – ist nichts. 57 2.4 Bin ich cool? BRET EASTON ELLIS ist der Quarterback unter den amerikanischen Coolen. Sein Roman „Unter Null“ hat die coole Genusssucht der amerikanischen Kids luzide eingefangen. Ich wähle eine Szene, in der der Junge cool, das Mädchen etwas uncool reagiert. „Ich liege im Bett von Blair. Der Boden und das Fußende des Bettes sind übersät mit Stofftieren, und als ich mich auf den Rücken drehe, spüre ich etwas Hartes und Dickes unter mir, und ich greife danach und ziehe eine schwarze Stoffkatze hervor. Ich werfe sie auf den Boden und steige aus dem Bett und gehe unter die Dusche. Nachdem ich mir die Haare trockengerieben habe, wickle ich das Handtuch um meine Hüften und gehe in ihr Zimmer zurück, um mich anzuziehen. Blair raucht eine Zigarette und sieht sich MTV an, aber mit ganz niedriger Lautstärke. „Rufst du mich vor Weihnachten noch einmal an?“ fragt sie. „Mal sehen.“ Ich ziehe meine Weste über und frage mich, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. „Hast du denn eigentlich noch meine Telefonnummer?“ Sie langt nach einem Notizblock und beginnt, etwas draufzuschreiben. „Ja doch. Ich hab deine Nummer. Ich meld mich auch.“ Ich knöpfe mir die Jeans zu und wende mich zum Gehen. „Clay?“ „Ja?“ „Falls ich dich vor Weihnachten nicht mehr sehen sollte -!“ Sie unterbricht sich. „Schönes Fest jedenfalls.“ Ich sehe sie einen Moment lang an. „Danke, gleichfalls.“ Sie hebt die schwarze Stoffkatze auf und streichelt ihr über den Kopf. Ich gehe zur Tür raus und will sie hinter mir zumachen. 58 „Clay?“ flüstert sie laut. Ich bleibe stehen, drehe mich aber nicht um. „Ja?“ „Ach nichts.“ (1999, 54.) Den Ball aufgenommen haben die Franzosen. MICHEL HOUELLEBECQ zeigt in den oft zitierten Romanen „Ausweitung der Kampfzone“ (1999a) und „Elementarteilchen“ (1999b), dass die Generation der Postrevolutionäre (nicht nur Skeptiker und Einzelkämpfer Depressive, sind, die s.u.), eine sondern ziemlich sedierte feuchte Spur hinterlassen. Es gibt bei HOUELLEBECQ sogar eine frappante Verteidigung des Selbstmords, die an stoische Szenarien erinnert. „Noch nie, zu keiner Zeit und in keiner anderen Zivilisation hat man so lange und so beständig an sein Alter gedacht; jeder hat eine einfache Zukunftsperspektive im Auge: Es wird einen Zeitpunkt geben, zu dem die Summe der Sinnenfreuden, die man noch vom Leben zu erwarten hat, geringer ist als die Summe der Schmerzen. (...) Diese rationale Bilanz der Sinnenfreuden und Schmerzen, die jeder früher oder später zu ziehen gezwungen ist, führt ab einem gewissen Alter unweigerlich zum Selbstmord. In dieser Hinsicht ist die Feststellung amüsant, daß sowohl Deleuze wie auch Debord, zwei hochangesehene Intellektuelle des ausgehenden Jahrhunderts, ohne triftigen Grund Selbstmord begangen haben, ganz einfach, weil sie die Aussicht ihres körperlichen Verfalls nicht ertragen haben.“ (1999b, 280f.) Diese Überlegung treibt dann auch eine Protagonistin des Romans, eine Spezialistin für Saunen, Massensex und Dark rooms, in den Selbstmord. Die autobiographische Lebensgeschichte der CATHERINE MILLET könnte für die eher coolen (nicht für die depressiven) Figuren von HOUELLEBECQ Pate gestanden haben. Gelassen und schonungslos erzählt die Protagonistin von ihren erotischen Streifzügen, Lieblingsstellungen (häufig beschreibt mit minutiös mehreren ihre Partnern 59 gleichzeitig) und beobachtet dabei unprätentiös ihre Geliebten. „Schon jahrelang leite ich die Redaktion der Art press. Ich habe die Zeitschrift mitgegründet und mich dieser Arbeit verschrieben, damit eine Identifikation entsteht zwischen ihr und mir, doch ich fühle mich eher wie ein Lokführer, dessen Zug nicht entgleisen darf, denn wie ein Kapitän, der den Hafen kennt. So habe ich auch gevögelt. Ich war völlig verfügbar. In der Liebe wie im Berufsleben hatte ich kein Ideal, das ich erreichen wollte, man definierte mich als eine Person ohne Tabus, ohne jegliche Hemmungen, und ich hatte keinerlei Grund, diese Rolle nicht anzunehmen. Meine Erinnerungen an die Partys, an die Abende im Bois oder in der Gesellschaft meiner Freunde und Liebhaber sind mit den Räumen eines japanischen Palastes vergleichbar. Man glaubt sich in einem geschlossenen Raum, dann aber verschiebt sich eine Wand, offenbart eine weitere Zimmerflucht, und geht man weiter, öffnen und schließen sich immer wieder die Wände. Wenn es viele Räume gibt, kann man auf unzählige Art und Weise von einem zum anderen gehen.“ (34f.) „Ich sagte schon, dass ich Angst hatte vor zwischenmenschlichen Beziehungen und dass Sex ein Refugium war, wohin ich mich gerne flüchtete, um mich den Blicken, die mich verlegen machten, und dem verbalen Austausch, indem ich noch unerfahren war, zu entziehen. Dass ich nicht die Initiative ergriff, stand außer Frage, ich habe nie Männer aufgerissen. Doch ich war in jeder Situation ohne Zögern und ohne Hintergedanken durch alle meine Körperöffnungen und in all meinem Sein verfügbar. Wenn ich meine Persönlichkeit nach dem proustischen Ansatz als ein Bild betrachte, das andere von mir malten, dann dominiert dieser Wesenszug. „Du sagst nie nein, du lehnst nie etwas ab. Du machst nie Zicken.“ (...) Folgender 60 Eintrag im intimen Tagebuch eines Freundes schmeichelt meiner Selbstliebe immer noch: „Catherines Gelassenheit und Gefügigkeit in jeder Situation verdienen größtes Lob.“ (50f.) Etwa gleichzeitig haben Filme den Lebensstil eingefangen, zunächst der mit Prostituierten gedrehte Streifen „Baise moi“ (1999) und dann „Intimacy“ (2000) von P. CERÉAU, ausgezeichnet mit dem silbernen Bären – eine geni(t)ale Meisterleistung. Es klingelt, ein Mann, um die Vierzig, ziemlich abgerissen, unrasiert, ungewaschen, in einer versiphten, schäbigen Wohnung, öffnet, fragt: „War das abgemacht?“, lässt eine Enddreißigerin ein, londontypisch mit dicker Jacke und Schal vermummt, ein Gesicht, das in der U-Bahn nie auffällt. „Also wohnst du hier richtig?“ „Haben wir letztes Mal nicht schon darüber gesprochen?“ Vokabelreduziert treten beide in den sexuellen Nahkampf, ein schnelles, stellungsarmes Ringen mit kurzem Höhepunkt. „Entschuldige.“ Wie eine Diebin in der Nacht verlässt sie die Wohnung. Die nächsten Szenen zeigen den Protagonisten Jay bei der Arbeit – rasiert, mit gebügeltem weißem Hemd, so hell und rein wie der Name seiner Spontangeliebten Claire. Er ist Barmann, seit sechs Jahren, davor war er Musiker, vor einem Jahr hat er seine Familie verlassen, ist einfach gegangen, hat Individualist in nichts der gesagt. Londoner Ein bindungsunfähiger Spaßgesellschaft. (Eine hübsche Szene: Jay mokiert sich mit viel schlechter Laune darüber, dass alle Kellnerinnen den Kunden spüren und wissen lassen, sie seien eigentlich Schauspielerinnen – eine Klage, die vor Jahren in Deutschland BOTHO STRAUß angestimmt hat.) Jay, der Mittwochmann. Der zweite Fick, ohne viele Worte – „Kalt?“ „Es ist kalt, aber es macht nichts.“ - ohne Rituale der Verführung. Diesmal wenig politisch korrekt ohne Kondom. 61 Schnell, hungrig, akrobatikfrei verkanten sie sich ineinander. „Bis nächsten Mittwoch? Ist es auch wieder ein Mittwoch?“ Es ist ein Mittwoch. Kreisverkehr. Sie ziehen sich aus. Jay sitzt im Sessel und bestaunt Claire. Im wahrsten Sinne zwischen Tür und Angel – eine Schwellensituation in jeder Hinsicht – bedient sie Jay. Eine „Kiss him, Monika“-Szene. Nach dem Blow-Job folgt der Handverkehr. Der schnelle Abschied. Jay geht ihr nach. Bricht die Verfolgung aber ab. Dann plötzlich erschreckt man im Kinosessel über Sätze wie in einem Leitartikel. Sein Freund Viktor – alles andere als ein Siegertyp, eher ein schlecht gesicherter Bungee-Springer, nun gut, man kann mit Namen auch weniger dick auftragen – sagt mit schnarrender Stimme: „Sklaven unserer Lust sind wir“. Da steht er dann und nuschelt nur einen Kameraschnitt später wie nach einem mentalen Schlaganfall: „Mein Sohn hat mir erzählt, er will auf die Kunsthochschule.“ Oder der Besuch Jays in der Wohnung seiner Frau. Er wird beim Wichsen auf dem Klo von seinem jüngsten Sohn gestört, der sich in die Hose gemacht hat. Als er ihn umzieht, kommt wieder so ein Satz wie aus dem transzendentalen Off: „Vielleicht machst du das eines Tages auch für mich.“ Das hört sich nach Endstadium der Vereinsamung und präseniler Angst an. Diese leisen Schreie nehmen langsam die Oberhand, obwohl Jay in einem Gespräch mit einem Kollegen noch einmal den Coolen mimmt und darüber räsoniert, wie er die Beziehung beenden kann: „Ich treff mich mit ihr, wir ficken, dann geht sie wieder. (...) Ich glaube, ich finde es eine Belastung. Als wenn wir uns es schuldig wären.“ Aber am nächsten Mittwoch sitzt er schweigend und leise verzweifelnd in der Wohnung und wartet vergebens. Der Regisseur findet dafür ein eindrückliches Bild: Jay lässt Bläschen einer Verpackungsfolie platzen. Er ist nicht länger in der sedierten Gefühlswelt eingeschweißt. 62 Jay versucht in Claire’s Welt einzubrechen. Sie spielt in einem dreckigen Kellertheater unter einem Pub. Auch sie eine Schauspielerin wie die Kellnerinnen seiner Arbeitswelt. (Der Regisseur lässt wenig Raum, um ihr Alltagsleben zwischen Castings, Leitung einer Amateurschauspieltruppe und Familie auszuleuchten.) zahnspangenunkorrigierten Ihr Gebiss, Mann, sein mit einem Körper der inkarnierte Protest gegen den Schlankheitswahn, hört sich die Kommentare der Zuschauer an und souffliert sie ihr abends. Jay sucht den Kontakt und erzählt ihm die Geschichte von einer Ehefrau, die sich mittwochs spontan zum ficken mit einem Mann trifft und danach Ehemann und Kind den Haushalt macht, als sei er selbst dieser betrogene Ehemann. Jay spielt Geisterfahrer im Verkehrskrieg und wird prompt erwischt: „Ehe ist Krieg, aber ein Grund zum Leben“, sagt der Ehemann. Noch einmal flieht Jay, man sieht ihn als Teilnehmer einer verkoksten Party, er verbringt die Nacht mit einem jungen Frau, die den Sex so cool nimmt, wie Jay es gerne tun würde. Und noch einmal verkündigt er sein cooles Evangelium: „Nur ein Verrückter will seine Wunden zeigen und so was", dann hält er es nicht mehr aus, sucht sie im Theater auf, stellt sie zur Rede, es kommt zum Bruch. Der Ehemann enträtselt das Verhältnis, schreit seiner Frau ihre mangelnde Begabung ins Gesicht. Ein letzter Mittwoch. Die finale Auswertung der Kampfzone. Die coolen Hüllen fallen: „Dass du jemandem so nahe bist, das zerreist mir das Herz.“ Im Zentrum der eigenen Leere keimt die Eifersucht auf Mann und Kind. „Bleib! Komm zurück.“ Die Antwort lautet: Nein. Ein letzter Fick im Stehen. Eine letzte Umarmung. Das war’s. Wie HOUELLEBECQ, so ist auch der Regisseur CHERÉAU ein cooler Moralist. Unter der verschweißten Oberfläche brodelt es. Der Individualist der Spaßgesellschaft, ortlos – nichts ist 63 heimatlich und heimelig – und vereinsamt, hat die Intimität verlernt und leidet daran wie ein Hund. Er ist komatös, eine Art Wachkoma, Stillstand trotz aller Hektik. Das Leben, das glückliche Leben ist anderswo. Als Ausweg bleibt die Kunst der Resignation oder die Rückeroberung der verlorenen Nähe. 64 2.5 Hetärengespräche Ein Wortwechsel zwischen Epikurs Hetäre Leontion, Catherina und Clarissa. L e o n t i o n: Zenon sah immer pseudo aus. Wie ein Wichtelmann. Ab und zu tauchte er mit einem Boyfriend auf, aber man hatte immer den Eindruck, er habe ihn bei einer zweitklassigen Agentur gemietet. Ätzend. Dessen Libido ging immer auf dem Zahnfleisch. Er war dauernd so verbissen, nicht wirklich professionell. Und seine philosophischen Kids, die ihn immer covern wollten, sahen nach billigem Label aus. Alle Model-untauglich. Ziemlich abgefuckt. Mein lieber Epikur flüsterte, wenn er Zenon herumschleichen sah: „Ich sollte ihm mal meine Visa-Card leihen.“ Bei uns wurde wenigstens gelacht. Zenon zeigte sich von uns total schockiert, dabei hatte Epikur doch auch immer alles unter Kontrolle. Nach meinem Geschmack hätte er seine Kontrolle durchaus etwas lockern können. Er wolle mir keinen Schmerz zufügen, nuschelte er häufig, aber ich hätte es schon gerne gehabt, wenn er seine semi-betuliche Art wenigstens ab und zu abgelegt hätte. Manchmal erinnerte mich der ganze Haufen bei uns im Garten an einen fröhlichen Altherrenverein, die sich nur mit ihrer Prostata beschäftigen. Aber unterm Strich war’s wirklich ganz o.k. Irgendwie. C a t h e r i n a: Ich bin ja so erleichtert, dass du das sagst. Eigentlich verrückt und irgendwie auch gespenstisch, dass ich mich auch wahnsinnig gerne im Garten und Wald bewege, oder? (Lieber als in den Saunen übrigens.) Alle nennen mich, wie meine Freundin im Geiste, diese Millet, ihr wisst schon, eine Boi bitch, BB, na und? Was ist daran 65 schlimm? Gar nichts. Ich war verfügbar. Ich war willig. Ich habe mir die Lust geholt. Ich brauche keine Sonnenbrillen, Walkmen, Kapuzenpullis. Albern. Ich war nackt, ich habe alle in mich überall reingelassen und ich war trotzdem abgeschottet. Ich war auch nicht süchtig, wie dauernd irgendwelche Spießer geschrieben haben. Überhaupt nicht. Ich konnte mich wochenlang enthalten. Einfach so. Ich bin total gelassen an die Sachen rangegangen. Ich war nie zynisch. Nie verklemmt. Kein Grund zur Klage. Ich war wirklich frei. Total frei. Nähe kann ich nicht dauernd ertragen. Nähe frisst mich nach kurzer Zeit auf. Dann kommt die Eifersucht. Dann verliere ich meine Gelassenheit. C l a r i s s a: Damit ihr mich nicht missversteht: Ich bin nicht die heilige Johanna der Schlachthöfe. Weißgottnicht. Ich bin Mittwochs bei einem Typen aufgekreuzt, habe mit ihm geschlafen ohne großen Firlefanz, ohne viel Zinnober, ich habe mich ausgezogen, ich habe mich hingelegt, fertig. Ich fühlte mich tot. Mein Mann ist ein Sitzsack. Meine Karriere war ein Trauerspiel. Mein Kind, ja, o.k. Ich hatte gedacht, Jack wüsste irgendwie mehr als ich. Er lebte anders. Ich wollte wissen, was er weiß. Er verlangte nichts. Sex machte mir wieder Spaß. Aber dann hat er die Regeln gebrochen. Und dann merkte ich: Er war nicht weiter. Er wusste nicht mehr. Er suchte Nähe und wusste nicht, wie damit umgehen. Er wusste vielleicht noch weniger als ich. Er redete plötzlich wie jemand, der zum Tode verurteilt wurde. Ja. Ich bin zurück geschlichen. Ich brauche die Wärme. Ich gebe es zu. Macht euch ruhig lustig über mich. 66 3. Das Glück der Resignation 3.1 Götter- und Heroengespräche Ein etwas einseitiges Gespräch zwischen SEXTUS EMPIRICUS, ZEUS und HERA S e x t u s: Wenn man mich flugs fragte, ob es euch gebe und obendrein von mir verlangte, ich solle es beweisen, so fürchte ich, ich würde meinen Partner arg lange warten lassen, denn eine kluge Antwort will mir nicht auf die Zunge und wohlmöglich bekäme ich ob der Saumseligkeit meiner Antwort Nackenschläge. Vielleicht gibt es euch, aber es zu beweisen will mir nicht gelingen. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich es fertig brächte. Es ist möglich, dass ihr seid, aber ich will ein Tölpel heißen, wenn es anderen gelänge, Euer Sein zu beweisen. H e r a: Hör auf so weibisch zu jammern, Zeus. Du bekommst, was du verdienst. Und das soll erst der Anfang sein. Du hast zu lange gefaselt, die Sterblichen bräuchten uns um glücklich zu sein. Wie hast du früher getönt: Eine goldene Kette befestigt ihr oben am Himmel, hängt euch nur alle daran, ihr Götter und Göttinnen, und ihr Sterblichen allzumal; dennoch zieht ihr niemals Zeus, den Ordner der Welt, vom Himmel herab, wie sehr ihr auch danach trachtet. Und jetzt zeterst du, sobald wir alleine sind. S e x t u s: Ich plage mich schon lange mit der Frage, komme aber an kein Ende. All überall regiert das Übel. Es kann sein, dass Zeus die Übel nicht verhindern kann. Oder aber er will es nicht und beides scheint mir mit der Vorstellung von Gott gar unvereinbar. 67 H e r a: Wenn ich so fragte, Zeus, hast du immer gesagt, ich würde irre reden und ob ich vorhabe einen Prozess gegen uns selbst anhängig zu machen. Du tätest nicht übel, das Wort zu ergreifen. S e x t u s: Ich enthalte mich also des Urteils. Aber weil mich deine Tränen rühren, könnten wir die Menschen fragen und versuchen zu einer Übereinkunft zu kommen. H e r a: Hast du denn gar nichts zu deiner Rechtfertigung zu sagen? Wollen wir in einen Wettbewerb treten und uns von den Irdischen abhängig machen? Von all den Triefaugen, den Kahlköpfigen, den lendenschwachen Greisen? Ich kann dir versichern, es gibt deren viele Spröde, Dumpfe, Schlingel und Nichtsnutze, die nicht einmal durch Schmeicheln und Gütigtun zu bewegen sind. Viele lauern auf unseren Tod und sinnen auf die himmlische Erbschaft, die sie dann auf Erden verprassen können. So ist es doch, wenn ich nicht irre, Sextus? S e x t u s: Ich enthalte mich des Urteils, ihr Lieben. H e r a: Wäre es nicht an der Zeit, endlich das Maul aufzusperren? Ermann dich! Z e u s: Ich bin so traurig, so unsagbar traurig. 68 3.2 Der skeptische Blick Die Physiognomie eines Skeptikers: Er ist ein feinmotorischer Meister der Augenbraue, jetzt wird eine Braue hochgezogen, bildet mit der anderen Braue ein veritables Fragezeichen, der Kopf wird leicht schief gehalten, etwas nach hinten geschoben, um den Abstand zum Gesprächspartner zu vergrößern, Uneinigkeit demon- strierend, die Augen suchen die Ferne, oft werden die Lippen vorgeschoben, manchmal wie ein Fischmaul geöffnet, als würde er verzweifelt nach Luft schnappen, die Stirn legt sich in Falten, nur kurz zeigt sich ein Zornesgrübchen, wird aber durch die Facialmuskulatur wieder zugeschüttet, die Gesichtszüge glätten sich, es folgt ein konzentriertes Gespräch, die Augenbrauen schieben sich zusammen und fahren auseinander als würden Gewichte bewegt in einem Kraftstudio, manchmal wirken die Augenbrauen wie Baldachine, weil sie schützend über die lichtempfindlichen Augen geschoben werden, einen Hauch von Melancholie verströmend, halb mitleidig, halb resigniert. Der Skeptiker. Überzeugungstäter arbeiten sich gerne an ihm ab. In Bundestagsfraktionen ist er gefürchtet, ob seiner immer zu erwartenden Stimmenthaltung. In religiösen Fragen heißt er Agnostiker, nicht Atheist, ein feiner Unterschied: Atheisten verneinen Gott, Agnostiker enthalten sich der Frage. Sie sind schlechterdings missionsresistent und anti-dogmatisch. Historisch gilt PYRRHON VON ELIS (ca. 360-270) als der eigentliche – es gab vorsokratische Ansätze - Begründer dieser Lebensform. Nach den Philosophenviten des DIOGENES LAERTIUS (IX) war PYRRHON zunächst ein mäßig begabter Maler, dann zog er mit dem Philosophen ANAXARCH 69 (aus dem Schülerkreis DEMOKRITS) nach Indien, knüpfte Kontakte mit Asketen und Magiern und bewegte sich zumindest kurzzeitig im Umkreis Alexanders des Großen. Alle Biographen loben überschwänglich seinen Gleichmut, die innere Ruhe und Unerschütterlichkeit. In der Tat: PYRRHON lebte heroisch mit seiner Schwester zusammen, putzte klaglos den Haushalt und wusch eigenhändig die Ferkel, die er auf dem Markt verkaufte. Die Apathie der Stoiker glaubte er überbieten zu können, weil er sich von außersittlichen Gütern oder Übeln nicht einmal mehr angezogen fühlte. Diese Lebenshaltung vollkommener Gleichgültigkeit den Außendingen gegenüber führte, so berichtet eine Anekdote, dazu, dass er seinen Lehrer ANAXARCH nicht half, als der in einem Sumpf versank. Weil er selbst erschrak, als ihn ein Hund ansprang, entschuldigte er sich mit dem Satz, es sei sehr schwer den Menschen vollständig auszuziehen. (Vgl. RICKEN 1994, 15; HOSSENFELDER 1985.) Die antike Skepsis profiliert ihre Grundüberzeugungen durch eine kritische Relektüre der stoischen Erkenntnistheorie, zumeist im sokratischen Gestus des wissenden Nichtwissens vorgetragen. Nur Ansätze finden sich bei PYRRHON, ausgearbeitet akademischen Skepsis wird die (ARKESILAOS, Position in KARNEADES), der bei AINESIDEMOS und vor allem in der Spätphase bei SEXTUS EMPIRICUS (um 200 n. Chr.), dem (wahrscheinlich) gebürtigen Griechen, der in Rom als Arzt erfolgreich war. Nach ärztlichem Ethos hat er auch seine skeptische Kunst verstanden, nämlich die Menschen von der Krankheit des voreiligen Schlusses zu heilen. Die akademischen Skeptiker hinterfragen den stoischen Versuch, die Erkenntnistheorie auf einen Sensualismus aufzubauen, also vom Eindruck, den eine Sache hinterlässt. Aber erst wenn der Verstand seine Zustimmung gibt, ist eine 70 Sache nach stoischer Lehre tatsächlich erfasst. Hier setzt der Skeptiker an: Es gibt keinen Zugang zu den Sachen an sich, weil wir immer nur sagen können, wie die Dinge uns jeweils erscheinen. Wenn es aber keine Erkenntnis der Wirklichkeit an sich und somit kein Wissen gibt, weil wir nicht hinter dem Eindruck das Wesen der Dinge erkennen können, dann bleibt nur der Weg der Urteilsenthaltung. Der Preis für die eigene Seelenruhe ist der grundsätzliche Verzicht auf Urteile, die aussagen, wie die Dinge an sich sind. Mit dem Namen AINESIDEMOS – über ihn selbst gibt es nur widersprüchliche Nachrichten – ist die Methode der Tropen (wörtlich: Art und Weise, philosophisch: Formen des logischen Schlusses) verbunden, jenen Argumentationsformen, die deutlich machen sollen, dass die Wahrnehmung und das Denken in Relativität münden, weil man, wie vor allem SEXTUS gezeigt hat, jedem Gedanken oder Eindruck einen Eindruck oder Gedanken von gleichem Gewicht gegenüberstellen kann - ein Turm etwa sieht aus der Ferne rund, aus der Nähe aber viereckig aus. Zehn Tropen führt AINESIDEMOS auf (bei SEXTUS referiert), darunter der aus der Verschiedenheit der Lebewesen überhaupt, der Menschen, der verschiedenen Beschaffenheit der Sinnesorgane, oder der der Lebensformen, der Sitten, der Gesetze, des mythischen Glaubens, der dogmatischen Annahmen (102f.). SEXTUS führt in seinem ‚Grundriss‘ vier Listen von Tropen auf, berühmt geworden ist eine Argumentation im Anschluss an die fünf Tropen des AGRIPPA, die HANS ALBERT (1968) das Münchhaussen-Trilemma genannt hat: Wer alles begründen will, gerät entweder in einen infiniten Regress, einen Zirkel oder muss das Verfahren abbrechen. Skeptische Schlagworte sind deshalb: ‚Vielleicht‘, ‚Es ist möglich‘, ‚Es kann sein‘. 71 In der Forschung ist umstritten, ob man, wie SEXTUS EMPIRICUS in seinem ‚Grundriß der pyrrhonischen Skepsis‘ nahelegte, vom stoischen Erkenntnisproblem ausging und dann die Konsequenzen für die Ethik formulierte, oder ob eine „verwandelte ethische Haltung sich des Erkenntnisproblems (bediente), weil sie ein Interesse an der Unerkennbarkeit der Dinge hatte“, wie HOSSENFELDER in seiner Einleitung zu SEXTUS vermutet. (31999, 30) „Die Pyrrhoneer erblickten die Glückseligkeit in der Ataraxie, der ‚Seelenruhe‘, und die Art, wie sie diese verstanden, ist der eigentliche auslösende und bestimmende Faktor ihrer Skepsis.“ (31) Lag die Seelenruhe für EPIKUR in der Überwindung der Beunruhigungen, die durch Begierde und Furcht entstehen, so für die Pyrrhoneer in der Überwindung des Eifers. Eifer ist aber der Begriff zur Denunzierung der sogenannten Dogmatiker (stellvertretend sind hier die Stoiker gemeint), denn Eifer entsteht, „wenn man etwas für ein ‚Gut von Natur‘, einen objektiven Wert, hält.“ (35) Die Suche nach Wahrheit ist für das Glück des Menschen eher schädlich – so die Pointe. Das Heil des Menschen bleibt unabhängig von der Erkenntnis der wahren Güter und der wahren Übel. Das Glück stellt sich von selber ein – irgendwann, freilich erst, wenn man resigniert die Ausweglosigkeit der Glücksbestrebungen eingesehen hat. ‚Gründe‘ darf es für das Eintreten des Glücks keine geben, nicht einmal der alte kosmologische Gedanke, der Kosmos sei so geordnet, dass das Glück sich zwangsläufig irgendwann einstellen müsse. Häufig wird übersehen, dass die Skeptiker entschieden radikaler als die Epikureer und die Stoiker Theoretiker der Unabhängigkeit waren: Sowohl die Epikureer als auch die Stoiker entbanden das Glück von den äußeren Gütern und verlegten das Glück in die inneren Güter, sprich: die Unerschütterlichkeit der eigenen Seelenverfassung. Diesen 72 letzten anthropologischen Optimismus verabschiedeten die Skeptiker. Keine Seelenverfassung, so die nüchterne ‚Erkenntnis‘, garantiert Lebenslagen und eine deshalb Unversehrtheit bleibt nur der in Weg allen der Urteilsenthaltung und der Gleichgültigkeit den inneren Gütern gegenüber. Letztlich dürfen die Skeptiker auch nicht die Ataraxie dogmatisch als objektiven Wert benennen, sie proklamieren deshalb als Grundziel des Lebens die Epoché, die Urteilsenthaltung, aber mit dieser Epoché sei, so die frühen Vertreter, die Ataraxie wie „ein Schatten verbunden“ (DIOGENES LAERTIUS IX, 107). Im Gedächtnis überlebt hat der bereits bei DIOGENES LAERTIUS belegte Vorwurf, die Skeptiker würden „das Leben aufheben, indem sie alles verwerfen, worin das Leben besteht“ (IX, 104). Positiv gewendet: Aufgabe der Skeptiker musste es sein eine Lebensform zu finden, „die vorzeichnet, wie es möglich ist, daß man recht zu leben scheine (das ‚recht‘ hier nicht nur in Bezug auf Tugend genommen, sondern schlichter), und die sich auf die Möglichkeit zur Zurückhaltung erstreckt.“ (97) Wie aber ist ein Handeln möglich, das über Gut und Übel nichts philosophisches oder dogmatisches aussagen kann? Antwort: Die Pyrrhoneer ließen sich die Entscheidungen, wie zu handeln sei, von der alltäglichen Lebenserfahrung abnehmen. „(W)ir folgen einer bestimmten Lehre, die uns gemäß dem Erscheinenden ein Leben nach den väterlichen Sitten, den Gesetzen, den Lebensformen und den eigenen Erlebnissen vorzeichnet. (...) Wir halten uns an die Erscheinungen und leben undogmatisch nach der alltäglichen Lebenserfahrung, da wir gänzlich untätig nicht sein können.“ (97,99) Werte beziehen sich auf die Welt, in die der Skeptiker hineingeboren wurde. Wäre er in eine andere Welt hineingeboren, wären seine Werte andere Werte, insofern sind sie ganz zufällig. Zum Revolutionär ist er nicht geboren, weil er keine Kenntnis 73 objektiver Werte besitzt (besser: besitzen kann), die besser sind als diejenigen, die er lebensweltlich vorfindet. Er folgt den vorgefundenen Werten nicht aus philosophischer Überzeugung, sondern er folgt den vorgegebenen Sitten, die ihm Entscheidungen, die er nicht fällen kann, abnehmen. Die ganz unterschiedlichen Sitten der Völker wiederum demonstrieren, dass es nicht etwas gibt, was an sich gut oder schlecht ist. Und damit ergibt sich auch die Schlussthese, dass es keine Lebenstechnik (287) im strikten Sinne des Wortes gibt. Diese atemberaubende Entmachtung der Philosophie blieb nicht ohne Folgen. Von dieser Lebensdeutung in der späten Antike war es nur noch ein kleiner Schritt, sich einer Lebensdeutung zu überlassen, die die Unsicherheit und die Überforderung, die die Skepsis hinterließ, aufzuheben in eine neue Heilsgewissheit. Unterschwellig ging der Streit zwischen Dogmatikern und Skeptikern weiter (RICKEN inventarisiert die antiskeptischen Strategien antiker Denker, 1989, 1994) und lebte vor allem in der Neuzeit wieder auf. MONTAIGNES ‚Apologie‘ (vgl. RICKEN 1994) verdankt sich der 1569 erschienenen lateinischen Gesamtausgabe des Sextus Empiricus – ein skeptische Antwort auf die drei Fragen seiner Zeit: das christliche Schisma, die Krise des mittelalterlichen Aristotelismus und die heraufkommende kulturelle Vielfalt der neuen und wiederentdeckten antiken Welt. Typisch skeptisch wählt MONTAIGNE, weil die Wahrheit in Fragen der Religion nicht entscheidbar ist, die katholische Religion, in die er hineingeboren wurde. DESCARTES glaubte bekanntlich der skeptischen Herausforderung durch ein zweifelsfreies fundamentum inconcussum im ‚cogito ergo sum‘ begegnen zu können. Der skeptische Widerspruch in Gestalt von DAVID HUME blieb nicht lange aus. Ihm versuchte KANT Paroli zu bieten – 74 später HEGEL, HUSSERL (der den Begriff der Urteilsenthaltung, der Epoché gleichsam gegen die Erfinder zum Einsatz bringt), HEIDEGGER, W ITTGENSTEIN und LEVINAS. Und so weiter. Aber auch in der Zeitgenossenschaft gibt es veritable skeptische Ansätze, bei E.M. CIORAN, bei HANS BLUMENBERG und ODO MARQUARD. Einer seiner Schüler, FRANZ JOSEF W ETZ, hat jüngst den Versuch unterbommen, eine skeptische Lebenskunst, nach SEXTUS ein hölzernes Eisen, zu formen: Die Kunst der Resignation. 75 3.3 Die Kunst der Genügsamkeit FRANZ JOSEF W ETZ, mein Jahrgang, die gleichen Studienfächer, andere Lehrer, andere Ergebnisse. Glück oder nicht – offensichtlich waren die Lehrer so, dass es guten Sinn macht, weiter zu philosophieren wie bisher. WETZ ist Schüler des rhetorisch begabtesten Skeptikers in Deutschland: ODO MARQUARD. Die blütenstaubgelben Reclambändchen ‚Abschied vom Prinzipiellen‘ (1981) und ‚Apologie des Stilbildungsfibeln Zufälligen‘ (1986) im Sinne besten „Transzendentalbelletrist“ MARQUARD sind des skeptische Wortes. (MARQUARD Der über MARQUARD, 1986, 9) hat in einer Dankesrede für den Sigmund-Freud-Preis den Skeptizismus konzise durch drei Kennzeichen bestimmt: „Erstens: Skepsis ist der Sinn für Gewaltenteilung. Der skeptische Zweifel ist (...) jenes (schulmäßig ‚isosthenes diaphonia‘ genannte) Verfahren, zwei gegensätzliche Überzeugungen aufeinanderprallen und dadurch beide so sehr an Kraft einbüßen zu lassen, daß der Einzelne – divide et fuge! – als lachender oder weinender Dritter von ihnen freikommt in die Distanz, die je eigene Individualität. (...) Zweitens: Skepsis ist Usualismus, der Sinn fürs Usuelle, für die Unvermeidlichkeit der Üblichkeiten. (...) Drittens: Skepsis ist (...) die Bereitschaft zur eigenen Kontingenz.“ (7f.) Das ist der geschichtliche und lebensgeschichtliche Horizont von FRANZ JOSEF W ETZ, eine gewisse Zufälligkeit, in die er fröhlich einstimmt (und dabei, nicht ganz zufällig, HANS BLUMENBERG mit ins Boot nimmt). In seinem Essay ‚Die Kunst der Resignation‘ ringt er mit der Frage, wie die Existenz glücken kann in einer Welt, in der der „Sinnbecher“ 76 leer ist. Spricht MARQUARD noch von „Sinndiätetik“ (33ff.), dann gibt W ETZ ein schönes Beispiel für seine Überbietungskompetenz, wenn er die „Sinnverluste der Moderne“ in ein hübsches Sprachspiel packt: „Große Versprechen – die Versprecher des Lebens“ (7ff.): „Ohne Sinn - und trotzdem glücklich: Das ist die Kunst der Resignation. Aber wie kann man diese erlernen, da sich doch Sinnlosigkeit und Glück auszuschließen scheinen?“ Gute und süffisante Frage. In vielen Anläufen verabschiedet W ETZ das Christentum als Sinnstiftungslieferant. Mit OVERBECK prolongiert er die Kritik am Christentum: Die frohe Botschaft des Christentums gerät durch die Parusieverzögerung in eine Krise und ist mit dem wissenschaftlichen Weltbild schlechterdings nicht mehr kompatibel. Rang OVERBECK aber noch mit dem Abschiedsschmerz, so ist bei W ETZ die Trauerarbeit abgeschlossen: W ETZ akzeptiert den Verlust des Sinnanbahnungsinstituts Christentum ohne wenn und aber, ein Meister der Verlustunempfindlichkeit: „Der Mensch ist ein vergängliches Stück um sich selbst bekümmerte Natur in einer um ihn unbekümmerten Welt.“ (27) (Bereits an dieser Stelle ein kleiner Einwurf: Könnte es nicht sein, dass das Christentum in keiner Konkurrenz zur Naturwissenschaft steht, sondern eine literar-ästhetische Sehschule des durchaus real im Text anwesenden – und nicht parusieverzögerten – Christus bietet? OVERBECK hatte Phantomschmerzen, WETZ zwickt nichts mehr.) Für W ETZ ist die Kultur „Sorgenbrecher“ (38) und „Notwehr“: „Näher betrachtet ist alle Kultur eine Art Notwehr – eine Antwort auf die prekäre Lage des Menschen, der auch nach dem proklamierten Ende von Mythos, Metaphysik und Religion für Symbole, Bilder und Geschichten empfänglich bleibt, um seine archaischen Ängste, Verlorenheits- und Überforderungsgefühle in der befremdlichen Welt 77 überwinden zu können. Der Mensch befindet sich von Natur aus in einem schlimmen Zustand, gewissermaßen in einem Notstand, aus dem ihm die Kultur durch Erfindung von Sinnbildern und Sinngeschichten mit herauszuhelfen vermag.“ (41f.) ). Im Hintergrund dieser Thesen steht die alte GEHLENSCHE Einsicht vom Mensch als Mängelwesen. Wer Metaphysik und Religion emeritiert, berentet freilich auch die traditionellen Agenturen des Trostes. Das jedenfalls ist unbestritten: Der Mensch ist als sterbliches ein trostbedürftiges Wesen, strittig aber ist seit alters her, ob die Philosophie wirklich trösten kann oder ob sie, wenn sie es anbietet, nicht über ihre Verhältnisse lebt. „Deswegen wird die Frage dringlich, ob die Kompetenz zum Trösten allein dem Göttlichen vorbehalten ist oder ob es nicht auch einen Trost des Menschenmöglichen gibt (...): den schwachen Trost des Menschenmöglichen.“ (65) Schlafen, Lachen und Weinen gehören nach WETZ zum Kanon der schwachen Trostmittel oder „Existenzbewältigungsmittel“ (69), schwach, weil sie nicht wie die Religion Sinn oder sogar Glück in der Schicksals- oder Kontingenzbewältigung anbieten, aber immerhin „Abstand zu dem, was den einzelnen bedrängt: Distanzgewinn als Milderung der bitteren Härten des Lebens.“ (67) MARQUARD nennt sie die „leisen Formen der Anerkennung zuvor Schicksalszufälle. Weinbereitschaft Konkretionen menschlich, unbemerkter (...) – von So also sind Humor Toleranz sondern auch und und verdrängter Lachbereitschaft und und Melancholie Mitleid: allzumenschlich nicht – nur leistbare Respektierungen von Freiheit und Würde des Menschen.“ (1986, 135) Schlafen, Lachen und Weinen (bei W OODY ALLEN bestens zu studieren) sind also jene menschenmögliche Existenzbewältigungen, die übrig bleiben, wenn die Wissenschaften die Hoffnungen auf ein Transzendieren der Endlichkeit 78 kassieren. Die Frage, ob Wissen Glück bringt, ist damit vorentschieden. Sowohl der alttestamentliche Prediger Kohelet (1, 18), als auch Sextus Empriricus waren sich einig in ihrem Unbehagen, dass Erkenntnis das Leiden vermehrt und keine beglückende Energie verbreite. Die Kränkungen, die die Wissenschaften, nach KOPERNIKUS, DARWIN und FREUD neuerdings die Genetik, die Neuro- und Computerwissenschaften, dem Menschen zugefügt haben, stimmen in einem Punkt überein: „Sie markieren einen ungeheuren Wertverlust des Menschen durch seine erbarmungslose Einordnung in den Naturzusammenhang. (...) So hat das Wissen allen menschlichen Illusionen ein Ende gesetzt: Seine Glückswürdigkeit ist in Glückswidrigkeit umgeschlagen.“ (101) Allerdings erlaubt die Einsicht in diese Zusammenhänge auch eine „Zustimmung durch Selbstbescheidung“: „Sicherlich fällt der Abschied von den großen Sinnversprechen schwer, soll aber die Frustration über die Enttäuschung ihrer Uneinlösbarkeit ausbleiben, so setzt das die Bereitschaft zu mehr Bescheidenheit voraus. Nur durch freiwilligen Verzicht lassen sich Verluste, Versagungen und Entbehrungen wirksam ausgleichen. Erst wo wir nicht mehr den Anspruch auf die Krone der Schöpfung erheben, weicht das Gefühl der Kränkung durch Wissenschaft, und es schmerzt nicht mehr, bloß ein vergängliches Stück um sich selbst besorgter Natur zu sein.“ (106f.) Metaphernkreativ sprich W ETZ davon: „Man sollte versuchen, den großen alten Sinnbecher loszuwerden.“ (147) Der Becher des Sinns ist leer und die Mundschenke bei Madame Tussot untergestellt. Der kosmologische, teleologische und ontologische Anthropologismus (vgl. 123) sind wissenschaftlich offensichtlich entsockelt. Kränkungen bilden diese Erkenntnisse aber bei genauerem Hinsehen nur, weil vor allem das Christentum den Menschen 79 vorgegaukelt hat, etwas Besonderes zu sein. Christliche Metaphysik, Ersatzmetyphysiken und auch noch der Nihilismus und Existentialismus unternehmen den sinnlosen Versuch, den Sinnbecher neu zu füllen. Anders als NIETZSCHE etwa plädiert WETZ für eine Überwindung des Nihilismus. Als Therapie empfiehlt W ETZ eine „Überwindung des Christentums“, die „nur durch entsprechende Einschränkung und Mäßigung der von ihm hervorgebrachten Sinnerwartungen möglich“ ist. (148) Die kosmologische Dezentrierung der Erde ist freilich so eindeutig nicht, wie W ETZ zugeben muss. Die beim Kultverlag 2001 erschienene ‚Raumfahrerlyrik‘ der Astronauten beschwört die Schönheit der Erde, eine Art dialektische Repatriierung, die sich ästhetischer Anmutungswerte verdankt - alternativlos bis auf weiteres. (Vgl. auch W ETZ 1994, 1998.) Aber auch wenn Menschen kosmologisch nicht wichtig (173) sind (Außenperspektive), müssen sie dennoch ihr Leben wichtig nehmen (Innenperspektive). WETZ plädiert abschließend dafür, mit diesen Widersprüchen aktiv fertig zu werden, ohne der Vergänglichkeit auf Wellnessfarmen feige zu entfliehen. Das setzt „Kunstgriffe der Not“ (180) voraus, um mit sinnwidrigen Kontingenzen aktiv fertig zu werden in „milder Resignation.“ (182). „Aufs Ganze gesehen ergibt sich somit folgendes Bild: Menschliches Dasein, wie es leibt und lebt, ist vornehmlich Mängelbewirtschaftung, auf die sich wohl derjenige noch am besten versteht, der, um seine Not wissend, sich im Leben trotzdem eine nachdenkliche Heiterkeit bewahrt. Denn obwohl es manchmal schwer fällt, tut man gut daran, ernste Dinge und sogar sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Zugegeben, das Leben ist häufig nicht zum Lachen, aber im Grunde ist doch nichts Lächerlicher als das Leben. Auch wenn verschiedene Ansichten darüber bestehen, welche Existenzformen am 80 meisten erstrebenswert sind, ja, was ein schönes, erfülltes, freudvolles Dasein überhaupt ausmacht, uns ein solches als gelungen, angenehm, sogar sittlich lobenswert erscheinen läßt, bleiben Zufriedenheit und Glück dennoch möglich: Ohne Sinn – und trotzdem glücklich! Das ist kein logischer Widerspruch, nein, es ist die wahre Kunst der Resignation.“ (184) 81 3.4 Bin ich genügsam? Vielleicht ist das möglich. Ich habe mich bisher für den Skeptizismus nicht besonders erwärmen können, vielleicht, weil Theologen mit Politikern eine bisher uneingestandene Verwandtschaft verbindet: Der Skeptiker ist kein, auch kein religiöser Wechselwähler. Aber in Zeiten, da fanatisierte Menschheitsbeglücker die Welt mit Selbstmordanschlägen überziehen und Schrecken und Entsetzen verbreiten, gewinnt eine Lebensdeutung, die auf Mission in jeder Couleur verzichtet, eine neue Anziehungskraft. Das steife Gewohnheitstier, der klebrige Sesselhocker, Prädikate, die den Skeptikern gerne anhaften, zeugen jetzt von einer Überlegenheitsunterstellung, die urplötzlich aus der Mode ist. Alt. Ganz alt. Skeptiker sind keine gröhlende Maschierer, sondern beobachtende Flaneure. Ihre Schreibe sucht die kleine Form, das Detail, das Sujet, den Aphorismus, das leichte Parlando, in den glücklichsten Fällen den hintergründigen, von Melancholie gespeisten Humor. Zunächst das Ergebnis einer Leseerfahrung, zwei Wahlverwandte, FRANZ HESSEL (1929) und W ILHELM GENAZINO (2001). Dann eine komische skeptische Sehschule in W OODY ALLENS Film ‚Deconstructing Harry‘. „Flanieren ist eine Art der Lektüre der Straße, wobei Menschengesichter, Terrassen, Bahnen, Auslagen, Autos, Schaufenster, Café- Bäume lauter zu gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches ergeben“, schreibt HESSEL und streift durch Berlin, an den 82 großen, wichtigtuerischen Bauwerken herzlich uninteressiert. Aber in der betriebsamen Welt sind Flaneure zunächst und zumeist verdächtig: „Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspielt von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung. Aber meine lieben Berliner Mitbürger machen mir das nicht leicht, wenn man ihnen auch noch so geschickt ausbiegt. Ich bekomme immer mißtrauische Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den Geschäftigen zu flanieren. Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb. Die hurtigen, straffen Großstadtmädchen mit den unersättlich offenen Mündern werden ungehalten, wenn meine Blicke sich des längeren auf ihren (...) schwebenden Wangen niederlassen. Nicht als ob sie überhaupt etwas dagegen hätten, angesehen zu werden. Aber dieser Zeitlupenblick des harmlosen Zuschauers enerviert sie. Sie merken, daß bei mir nichts ‚dahinter‘ steckt.“ (1984, 97, 7) Ein Bruder im Geiste ist W ILHELM GENAZINO. In seinem neuesten Roman „Ein Regenschirm für diesen Tag“ (2001, vgl. auch „Die Kassiererinnen“ 1998) - schickt GENAZINO seinen Helden, der sein Geld als Probeläufer für Luxusschuhe verdient, flanierend durch die Stadt. Hier ist er wieder, dieser von HESSEL her vertraute Sound: „Rechter Hand liegt das große Autohaus Schmoller & Co. Jeden Freitag um die Mittagszeit werden die großen Schau- und Verkaufsräume des Autohauses gereinigt. Ein junger Mann und eine junge Frau, vermutlich ein Ehepaar, ziehen große, eimerförmige Staubsauger hinter sich her. Der Lärm der beiden Staubsauger dringt bis auf die Straße hinaus. Ich bleibe vor einem Schaufenster stehen und tue so, als würde ich mich für neue Autos interessieren. Tatsächlich schaue ich das Kind an, das die beiden Putzleute jedesmal mitbringen. Es ist ein etwa siebenjähriges Mädchen, das zwischen den Autos herumsteht und mit den Blicken nach 83 seiner Mutter sucht, die ganz in der Nähe und doch unerreichbar ist. Eine staubsaugende Mutter ist so abwesend wie der Tod. Die Mutter stößt das Saugrohr mit der Bürste vorne dran immer wieder unter die Autos und vermeidet dabei mit dem Kind zusammenzutreffen. Wahrscheinlich liebt den Staubsauger, weil das Gerät ihr vortrefflich dabei hilft, unerreichbar zu sein.“ (26) Das Flanieren gelingt dem Erzähler nicht mehr so unbeschwert wie bisher, weil seine Freundin Lisa seine Ungenügsamkeit („Ich besitze nur ein Sakko, einen Anzug, zwei Hosen, vier Hemden und zwei Paar Schuhe“, 41) nicht für ganz freiwillig hält und auszieht. Empfindlich gestört wird sein Lebensstil zudem, weil die Gutachten, die er als Schuhtester erstellt, nicht mehr mit 200 sondern nur noch mit schnöden 50 DM vergütet werden. In jeder Hinsicht absichtslos erfindet er ein Institut für Gedächtniskunst und hat damit bei Frauen Erfolg, ebenso absichtslos findet er einen Job als freiberuflicher Kulturredakteur, und ebenso absichtslos geht er ein Verhältnis mit einer alten Bekannten Susanne ein. (Auch die Sexszenen, die er mit der Friseuse Margot und dann mit Susanne, einer gescheiterten Schauspielerin hat, erinnern in ihrer absichtslosen Hilflosigkeit und selbstgenügsamen Komik an W OODY ALLEN.) Eine Passage, in der der Held für eine vergleichende Schuldwissenschaft plädiert, liest sich wie ein ironisches Bekenntnis zum reflexiv gebrochenen Skeptizismus: „(W)ir alle leben in Ordnungen, die wir nicht erfunden haben, wir können nichts für diese Ordnungen, sie befremden uns. Sie befremden uns deswegen, weil wir merken, daß wir mit der Zeit die Schuld dieser Ordnungen übernehmen. Die faschistische Ordnung bringt faschistische Schuld hervor, die kommunistische Ordnung bringt kommunistische Schuld hervor, die kapitalistische Ordnung bringt kapitalistische 84 Schuld hervor. – Ahh so! ruft Herr Auheimer, jetzt verstehe ich Sie! Sie meinen, Schuld entsteht, wenn Menschen die Systeme wechseln?! – Soweit kommt es bei den meisten ja gar nicht, sage ich mit sinnloser Genauigkeit, es ist wie mit der Liebe! Ich meine die gewöhnliche Schuld der Systeme, die langsam in uns einwandert, indem wir schuldlos in diesen Ordnungen zu leben meinen. Alle politische Ordnungen wollen dasselbe, nämlich die Abschaffung des Leids. Eben deswegen sind sie gar keine politischen sondern phantastischen Bewegungen, verstehen Sie? Weil man die Abschaffung des Leids nicht wirklich wollen kann! Und wo ist jetzt wieder die Schuld? fragt Herr Auheimer. – Die Schuld entsteht, sage ich, weil wir das im Prinzip alle wissen, aber trotzdem auf Leute hereinfallen, die uns ein Leben ohne Leid vorgaukeln. – Ach so! ruft Frau Dornseif! So meinen sie das! – Plötzlich reden alle am Tisch davon, was sie einmal geglaubt haben und wie sie deswegen schuldig geworden sind.“ (103) Mit diesen Debatten gewinnt er, ohne es wirklich zu wollen, das Herz von Susanne, die im Kern so melancholisch ist wie er, ohne es allerdings zu wissen: „Die Materialkulte um sie herum (zuviel Sinnsuche, Klamotten, zuviel zuviel Dekoration) Unterhaltung, deuten eher zuviel auf ein Nichtwissen hin. – Du mußt dich trauen, langweilig zu sein, sage ich. – Warum? – Es ist nicht möglich, die Langeweile der Liebe auf Dauer zu leugnen. – Das kann ich mir nicht leisten, sagt Susanne. – Was hindert dich? – Ich kämpfe sowieso schon mein halbes Leben lang gegen die Vorstellung, daß ich gar nicht da bin. – Die langweiligsten Frauen bringen es am weitesten; ihre Liebe ist dauerhaft und tief, sage ich." (140) Unterschwellig mit KUNDERA kommunizierend, feiert GENAZINO – allerdings entschieden leiser - nicht die Zellulitis, sondern das Doppelknie. „Siehst du nicht, sagt Susanne, daß mir unterhalb der Knie noch ein 85 paar weitere Knie nachgewachsen sind? – Ich schweige und betrachte Susannes Knie. – Am Anfang waren es nur undeutliche, knollenartige Erhebungen, sagt Susanne, ich habe geglaubt, die gehen nach einiger Zeit wieder weg. Von wegen! Sie wurden größer und runden sich immer mehr, und jetzt sieht es aus, als hätte ich an jedem Bein zwei Knie. Ich habe Beine wie eine alte Frau! Susanne drückt an ihren Beinen herum wie an kranken Körperteilen. Ich lege Hemd und Hose ab und sage: Es gibt nur zwei wirkliche Veränderungen beim Älterwerden; bei Männern werden die Ohren länger, bei Frauen die Nasen. – Susanne lacht und vergißt ihr Doppelknie, jedenfalls für den Augenblick.“ (141) Dieser Roman ist der gültige Versuch zu erzählen, wie man mit skeptischen Kunstgriffen das Leben halbwegs in den Griff bekommen kann. Halbwegs. So wie bei WOODY ALLEN. „Wir wissen nicht, ob es Gott gibt, aber es gibt Frauen“, erläutert Harry Block, der – nomen est omen - unter einer Schreibblockade leidet – seinem Sohn. Er ist, wie er später selbst zu Papier bringt, „eine Figur, die zu neurotisch ist, um im Leben zu funktionieren, die nur in der Kunst funktioniert.“ Wie häufig in ALLENS Filmen, so glaubt man auch in dem Streifen ‚Harry ausser sich‘, englisch sehr viel treffender ‚Deconstructing Harry‘ (1997) getauft, einer öffentlichen Beichte beizuwohnen, die letztlich in dem Geständnis mündet, „Panik vor Nähe“ zu haben. Der Film beginnt mit einer Idylle. Eine Barbecue-Party. Und man ahnt: Diese Idylle kann, allein wegen des hysterischen Geschnatters, nicht lange halten. Also geht eine der zwei jungen Frauen nach innen um Martinis zu mixen (oder zu schütteln), trifft dort auf ihren Schwager, der noch schnell einen Homerun – guter Gag – im Fernsehen verfolgen will, man küsst sich, er öffnet die Hose, sie hockt sich hin, er schreit etwas nach draußen, seine Schwägerin erschrickt sich, der Schwager hat jetzt wirklich Grund zum Schreien, 86 sie wird ermahnt, technisch sauberer zu arbeiten, offensichtlich erfolgreich, denn sie treiben es vor dem Fenster, werden von der blinden Oma überrascht, kommen aber zum glücklichen Finale. Ein müder komischer Auftakt. (Vgl. zur Komik bei ALLEN den Essay von VITTORIO HÖSLE, 2001) In der zweiten Szene rauscht eine Frau in die Wohnung von Harry Block (W OODY ALLEN) und macht eine riesige Szene. „Ich werde dir die Kehle durchschneiden“, schreit sie mit wie von Strom aufgeschreckten Haaren. „Du bist, glaube ich, erregt“, antwortet Harry sehr gelassen. Der Grund für den Auftritt: Harry hat in seinem jüngsten Roman genüsslich seine Liebesbeziehungen ausgebreitet, dabei die Namen der beteiligten Damen nur mühsam kaschiert: Lucy zu Leslie oder Jane zu Janette verfremdet, und auch die Fellatio beim Barbecue sehr plastisch beschrieben. Als Zuschauer ist man irritiert: Die Szene, die hier lautstark diskutiert wird, war im Film mit anderen Schauspielern besetzt. Dann dämmert einem langsam das Prinzip. ALLEN setzt in einer Art Zweitverwertung den göttlichen Einfall aus ‚A Purple Rose of Cairo‘ ein. Dort war ein Filmschauspieler real geworden und aus der Leinwand geklettert, hier führen die Figuren des Roman ein Eigenleben und wenden sich sogar gegen den Autor. Filmtechnisch arbeitet ALLEN mit Iterationen und mit dem hübschen Einfall, dass die Figuren unscharf werden: Identitäten verschwimmen, sind nicht länger randscharf – so die ironische Aufnahme einer These aus der in philosophischen den späten Bewegung Neunzigern des gefeierten Dekonstruktivismus. (Zunächst ist es Mel, ein Schauspieler, und einer von mehreren alter egos von Harry im Film, der unscharf wird – erste Anamnese der Ehefrau: Hast du etwas gegessen, worauf du allergisch reagierst? - und damit zunehmend für seine Familie eine Belastung, bis die bei einem 87 Ophtalmologen Brillen verschrieben bekommen, um Gatte und Vater wieder ungetrübt sehen zu können. Später im Film ist es Harry selbst, dessen Identität mächtig verschwimmt.) Harry gelingt es, seine Exschwägerin, er hat Frau und Schwägerin verlassen, vor zu Jahren beruhigen, wegen einer indem er jüngeren ihr erzählt, Frau wie unglücklich er sei. Eingeblendet werden Szenen aus den ersten zwei Ehen. (Ein schöner Gag. Harry betrügt seine erste Ehefrau mit einer chinesischen Hure in der Wohnung eines Freundes, gibt sich als dieser Freund aus und kommt in Erklärungsnöte, als der Tod klingelt und den Freund abholen will.) In der zweiter Ehe ist er mit seiner Analytikerin verheiratet, die urplötzlich zu orthodox-jüdischen Ritualen zurück findet und diese in jeder Situation anwendet, auch dann, wenn sie sich nächtens seiner erbarmt. Zum Ende hin nimmt der Film noch einmal Fahrt auf. Gegen den Willen seiner Exehefrau überredet Harry seinen Sohn, ihn - zusammen mit einer Prostituierten und einem Freund zu einer Universitätsfeier zu seinen Ehren zu begleiten. Auf dem Weg dort hin stirbt sein Freund im Auto - ein Zitat aus dem JIM-JARMUSCH-Film ‚Night on Eath‘ – Harry wird wegen Kindesentführung verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, vom Ehemann seiner letzten Geliebten auf Kaution hin entlassen, dann das Finale mit allen Figuren seiner Bücher. Harrys (ALLENS) Lebenskunst kommt – gleichsam deconstruiert – im antiliberalen Furor seines orthodox gesinnten Schwagers zum Durchbruch, Harry ist ein AntiEiferer und Werteverweigerer („Nihilismus, Zynismus, Sarkasmus, Orgasmus“), hübsch in einen Weisheitssatz für Hollywood gepackt: „Wäre es nicht eine bessere Welt, wenn nicht jede Gruppe glauben würde, sie hätte einen direkten Draht zu Gott?“ Nirgends ein helles Glücksversprechen (der tote Freund sagt einmal ironisch: „Wenn man lebt, ist man schon glücklich!“), 88 allenfalls der milde Imperativ, sein eigenes Leben zu leben und eine Epoché den Glücksversprechen der Spaßgesellschaft mit ihren teueren Hobbys, den lauten Maschinen (vgl. Celebrity – Schön, reich und berühmt, 1999) und den überreizten Hormonen gegenüber einzulegen – etwa, indem man Bücher schreibt. In einer nur kurzen Sequenz behauptet eine Studentin, sie deconstruiere die traurigen Charaktere der Bücher, die dann fröhlich erscheinen. Das ist die ALLENSCHE Kunst der Resignation: Die ewige postkoitale Melancholie wird aufgehellt von einem somatischen Weißmacher, dem Lachen, das sich Bahn bricht gegen die Übersexualisierung des eigenen Lebens und Oeuvres. 89 3.5 Hetärengespräche Ein Gespräch am Pool zwischen Lisbeth, Susanna und Jackie L i s b e t h: Sonnenbrillentester. Das ist keine Berufsbezeichnung. Das ist ein Psychogramm. Ich fand ihn zunächst ganz witzig. Aber eigentlich war er praktisch immer in Pension. Ein Frührentner ohne sichtbare Gebrechen. Leider krankenschein- und rentenuntauglich. Er war eigentlich stinkefaul und hatte immer Angst, er könnte sich verheben. Früher hat er unbedeutendes Geschreibsel bei unserer mickrigen Heimatzeitung abgeliefert. Aber das war ihm dann plötzlich auch zu anstrengend. Er wollte sich mit Geld in keiner Weise kontaminieren. Ich hob das Geld ab und er bediente sich dann. Sponsering fürs Nichtstun. Heute wundere ich mich, wie ich das so lange durchgehalten habe, aber ich war eben selbst mit den Nerven fertig und habe mich einfach nicht aufgerafft. Nett war er ja. Und, wie gesagt, ganz witzig. Aber so ohne Mumm. Ich brauchte jemanden, an dem ich mich aufrichten konnte. J a c k i e: Aufrichten konnte man sich an Harvey weißgott auch nicht. Harvey war nie ausser sich. Nervös, ja. Neurotisch, ja. Aber nie hysterisch. Selbst als ich mit einem Messer bei ihm aufgekreuzt bin und dem Hurensohn die Hölle heiß gemacht habe, schaffte er es, dass man mit ihm schließlich Mitleid hatte. Dabei fühlte ich mich wie eine verschlissene zweite Garnitur. Gut. Unsere Beziehung hatte längst das Verfallsdatum überschritten, aber dass er mit einer billigen Studententussi durchgebrannt war und dann 90 alles in einer peinlichen Beichte in Romanform ausbreitete, hat mich innerlich total getroffen. Eine Treuemedaille wollte ich mir wirklich nicht verdienen. Aber. Nur zwei Dinge beschäftigten Harvey: Wie überwinde ich meine postkoitale Melancholie und wie finde ich schnell wieder hinein. Rein. Raus. Rein. Raus. Fertig. S u s a n n a: Also, ihr werdet mich wahrscheinlich steinigen, aber – ich finde meinen neuen Mann wirklich entstressend. Lisbeth, vielleicht lag es bei dir daran, dass du wegen deiner Frühberentung – mit schwerstpubertierenden Kindern arbeiten zu müssen, stelle ich mir in der Tat wahnsinnig nervend vor – eine andere Ablenkung gebraucht hast. Das musste zu Konflikten führen. Ich aber finde das Leben mit ihm sehr leicht. Unerhört leicht. Er akzeptiert sogar meine materialermüdeten Brüste. Alles bleibt bei ihm in einer so herrlichen Schwebe. Er ist das Gegenteil eines Bornierten. Revolutionen kann man mit ihm nicht machen. Das nicht. Der wäre wie Godot. Auf ihn würde man warten, bis man schwarz ist. Er sagt auch nie ‚Ich liebe dich‘, sondern ‚Es ist gut so‘. J a c k i e: Und ihr langweilt euch nie? Sprichst du vom Glück oder vom Koma? S u s a n n a: Macht euch nur lustig. Bei uns gibt es keinen Kampf um die Fernbedienung. J a c k i e: Klingt wirklich aufregend. S u s a n n a: Ein mentaler Pazifist kann durchaus witzig sein. Ehrlich. 91 4. Das Glück der Harmonie 4.1 Heroengespräche Kleines Werbegespräch des PAULUS mit dem Stoiker KLEANTHES VON ATHEN, dem Skeptiker KARNEADOS DEM KLEINEN und dem Epikureer HERMACH VON PITANE. K l e a n t e s: (leise zu Karneados) Was für ein Lotterbube. Wie ungepflegt sein Bart ist. Und dann diese hitzige Art der Rede. Er hat Schaum vor dem Mund, als wolle er Polygnot für ein Reiterbild Modell stehen. H e r m a c h: (lacht) Er wird noch die Jugend verführen wie weiland Sokrates. K a r n e a d o s: Ich hätte nicht wenig Lust, diesen mürrischen Kerl an seinem Bart hinaus zu schleifen. K l e a n t e s: Mich wundert, dass die Vielen ihm nachlaufen. Lasst uns hören, womit er sich und uns so abquält. Vielleicht will er uns neue Götter verkündigen. H e r m a c h: Neuigkeiten, ich bin ganz versessen auf Neuigkeiten. (Sie gehen zu Paulus). Hör guter Mann, den die Vielen Paulus von Tarsus nennen, sag uns doch dies: Was lehrst du die Vielen? P a u l u s: Ihr Männer von Athen. Ich sehe, dass ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet. Ich bin herdurchgegangen und habe gesehen eure Gottesdienste und fand einen Altar, darauf stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch diesen, dem ihr unwissend Gottesdienst tut. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht; sein wird auch nicht von Menschenhänden gepflegt, als der jemands bedürfe, so er selber jedermann Leben und Odem 92 allenthalben gibt. Und er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen; dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten; und führwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch etliche Poeten bei gesagt haben: „Wir sind seines Geschlechts.“ K a r n e a d o s: (leise zu Kleanthes) Sieh an! Er hat deinen Namenspatron studiert. Er schmeichelt dir als Stoiker. Von seiner äußeren Erscheinung her, hätte ich ihn eher zu Hermach gerechnet. P a u l u s: So wir denn göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen; nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden, Buße zu tun, darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den ich euch als Gekreuzigten vor Augen male, und in welchem er’s beschlossen hat und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn von den Toten auferweckt. H e r m a c h: Was soll man nun dazu sagen. Er hat wohl nicht Demokrit studiert, andernfalls wüsste er, wie unsinnig es ist, von einer Auferstehung der Atome zu schwätzen. K a r n e a d o s: Vielleicht irrt Demokrit, vielleicht irrt er nicht. Aber sein Griechisch ist wahrlich schauderhaft. Komm, lieber Kleanthes, wir gehen. K l e a n t h e s: Geht nur voran, ich will noch kurz verweilen. 93 4.1 Zeugen im Hässlichen ? PAULUS, Beruf: Zeltmacher, Eigenschaften: frauenfeindlich, leibfeindlich, weltverachtend – die Liste der Vorurteile ist lang. Seine ikonographischen Merkmale: langes, kahles Gesicht mit langem Bart wie ein leibhaftiges Ausrufezeichen haben die Sympathiewerte stets auf niedrigem Niveau belassen. Bevor ich ihn als Theologe näher kennen lernte, erinnerte ich ihn nur als miserablen Reiter auf dem Bild von CARAVAGGIO. Inzwischen schätze ich ihn als klugen Kritiker der Philosophie seiner Umwelt, getreu seinem eklektischen Leitsatz: „Prüfet alles und behaltet das Gute.“ (Thess 5,21) Die Areopagrede des PAULUS, die die Apostelgeschichte tradiert, verrät eine gründliche Kenntnis der pharisäischen (ob PAULUS bei dem führenden Pharisäer GAMALIEL I studierte, ist ungewiss) und vor allem der hellenistischen Tradition, denn PAULUS zitiert an entscheidender Stelle den Stoiker KLEANTHES: „Wir sind seines Geschlechts“. Die Vereinnahmung der Stoa geht mit einer Denunzierung des Epikureeismus einher: Auferstehung und Gericht sind Vorstellungen, Aufnahme die der DEMOKRITS) Gründervater früh und für EPIKUR ihn (in der entlastend verabschiedet hat. Ebenso eindeutig ist das Verhältnis zu den Skeptikern zu beschreiben: PAULUS beruft sich auf eine Offenbarung, die Gewissheit verleiht. Besonders markant aber positioniert er sich in ein Gegenüber zur platonischen Tradition: „Im Häßlichen will er niemals zeugen“, heißt es im Symposion bei PLATON. Und genau das tut PAULUS, wenn er in den Briefen den Gekreuzigten, also den geschundenen und dreckigen Körper vor Augen malt (prosegrafein, Gal 3,1). Zwar spricht PAULUS vom auferweckten Gekreuzigten, aber namentlich gegen die korinthische Gemeinde (1 Kor 2,2) korrigiert er die einseitige Spekulation über die 94 Herrlichkeit des Auferstandenen durch den Nachdruck auf das Kreuz und auf seine eigene, machtlose Erscheinung: „Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch“ (2,3). PAULUS beansprucht in seinen Briefen, was der platonische SOKRATES glaubte nicht leisten zu können, nämlich Einsicht zu zeugen: „Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis daß Christus in Euch Gestalt gewinne“ (Gal 4,19), oder 1 Kor 4,15: „denn ich habe Euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium.“ Die oft gemutmaßte Leibfeindlichkeit des PAULUS hängt mit diesem Paradigmenwechsel vom Schönen zum Hässlichen zusammen, ein Paradigmenwechsel, der zu einer ganz anderen Wahrnehmung der Leiblichkeit und tätiger Diakonie führte, die, glaubt man POHLENZ, für den Untergang der Stoa und der Akademie nicht unerheblich war. Und die eifrig vorgetragene und denunzierte Weltflüchtigkeit des PAULUS ist nicht (nur), wie immer wieder behauptet wird, eine Konsequenz der Naherwartung (diese Lesart trifft weit eher auf die Frage der latenten Frauenfeindlichkeit zu, das sogenannte Schweigegebot der Frau in der Gemeinde ist übrigens ein nachpaulinischer Einschub), sondern rekurriert auf das asketische Selbstverständnis des JESUS VON NAZARET, der die Autarkie der Kyniker durch die Idee der Gottesherrschaft umcodierte. Antiplatonisch ist auch die Hochschätzung Augenzeugen der (zu Schriftlichkeit, denen PAULUS Präsenzerfahrung des JESUS VON die selbst den zählt) Nichteine NAZARET erlaubt. Das geschieht durch die lese-strategische Einsetzung einer semantischen Anagnorisis Doppelbedeutung als ‚lesen‘ und der griechischen ‚wiedererkennen‘. (Dazu ausführlich meine Ästhetische Theologie, Bd 1., 2000.) Schwieriger ist das Verhältnis zur Lebenskunst und Glücksfrage zu bestimmen, die für (beinahe) alle antiken 95 Schulen in der Ataraxie (Apathie) kulminierte. Am markantesten ist der Abstand zu den Skeptikern. Skeptiker sind (wie gesagt: das macht sie extrem sympathisch) AntiEiferer. SEXTUS sagt in seiner Schrift ‚Adversus Mathematicos‘ unzweideutig: „Alle Unglückseligkeit entsteht durch irgendeine Beunruhigung. Alle Beunruhigung aber begeleitet die Menschen entweder durch das eifrige (suntonos) Verfolgen bestimmter Dinge oder durch das eifrige Meiden bestimmter Dinge. Alle Menschen nun verfolgen mit Eifer das von ihnen vermeinte Gute und meiden das angebliche Übel. Also entsteht alle Unglückseligkeit durch das Verfolgen des Guten als Guten und das Meiden des Übels als Übel.“ (31999, 34) Nach eigenem Bekunden war SAULUS-PAULUS zunächst ein Eiferer (zélotés) in der Verfolgung der Christen (Gal 1,14), bis er in der Berufungsszene vor Damaskus (ca. 33) vom Pferd fiel - nach Apg 22 ist es ein gleißendes Licht gewesen, das ihm die Offenbarung ermöglichte, in 1 Kor 9,1 behauptet er, der Auferstandene sei ihm selbst begegnet. Nach dieser für ihn be-stürzenden Krise, macht er in den Diasporagemeinden in Damaskus und Antiochia Erfahrungen mit einem gesetzesfreien Christentum und brachte ab ca. 50 mit dem 1 Thessalonicher-Brief eine reiche Briefliteratur – zumeist Gelegenheitsschriften - auf den Weg. In (allerdings spärlichen Belegen) wird von PAULUS der Eifer für das Gesetz dem Eifer für die geistigen Gaben entgegengesetzt (1 Kor 14,1). Häufiger positiv besetzt ist ‚Eifer‘ bei den Stoikern, etwa bei EPIKTET. Hier bietet die Logoslehre Anschlüsse. Auch der apokryphe Briefwechsel zwischen SENECA und PAULUS deutet die Mission als vom Logos verliehene Kraft. (1964, 87) Und doch täuscht der fingierte Briefwechsel, der die sittlichen Ermahnungen der Briefe lobt, über einen gravierenden Unterschied hinweg. Nirgends bei PAULUS 96 tauchen die zentralen Begriffe der Apathie oder Ataraxie auf. Um es plakativ zu formulieren: Das Christentum kennt keine Lebenskunst, weil das gerechtfertigte Leben ‚in Christus‘ (Gal 5,17), das eine grundsätzliche Entlastung von sittlichen Überforderungen einschließt, sich der geschenkten Liebe, als der Gnade verdankt und sich in Geistgaben, etwa der Diakonie oder vielleicht allgemeiner: in nicht selbstsüchtigem Handlungen bewährt. Die mentale Verfassung liest sich so: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung (Gal 5, 22f.). Der Katalog der sogenannten ‚Werke des Fleisches‘ (unter Fleisch versteht PAULUS verzeichnet: immer Feindschaft, die natürliche Streit, Lebensform) Eifersucht, Eigennutz, Spaltungen, Neid, Zorn, Mißgunst (vgl. Gal 5, 19f.), ein Katalog, der durchaus den Tugendkatalogen seiner Umwelt entspricht. Wirklich neu ist die Begründungsleistung: Zunächst wird das Sein in Christus thematisiert, dann folgt die sittliche Ermahnung. Diese Zuordnung von Indikativ und Imperativ ist unvergleichlich: Der Christ ist erlöst, muss aber den Spielraum dieser Erlösung im konkreten Alltag durchaus eigenverantwortlich umsetzen. (Zu PAULUS vgl. SANDERS, Stuttgart 1995; eine ausgezeichnete „Kleine Theologie des Neuen Testaments“ bietet PORSCH 1995.) Wären nur die Briefe des PAULUS überliefert, dann bliebe rätselhaft, wie die ‚Neuschöpfung in Christus‘ geschieht, die sich in einer lebendigen Erfahrungswirklichkeit doch auch irgendwie zeigen und ausweisen muss. Durchaus konsequent, wenn die Bibel die vier Evangelien, die späteren Datums als die Briefe sind, an den Anfang platzierte. Nur so ist es nämlich möglich, dass auch spätere Leser Erfahrungen mit der Gestalt des Zimmermanns JESUS VON NAZARET (THEIßEN, MERZ 1996, THEIßEN 141999) machen können. Die literarischen Porträts der Urschriftsteller bieten zugleich einen sehr viel größeren – auch theologischen 97 Focus als die Briefe des PAULUS. Namentlich LUKAS ergänzt das paulinische Zeugen im Hässlichen durch die Freude und Schönheit des Weihnachtsevangeliums. Das Christentum hat also beides: Ein Zeugen im Schönen und im Hässlichen. Nochmals: Theologische Sympathisanten PLATONS wie SCHLEIERMACHER legen gerne den Nachdruck auf das Weihnachtsgeschehen, weniger stark auf das Kreuzigungsgeschehen. Das geschieht unterschwellig aus einer Abwehrhaltung einer hoch problematischen Sühnetodchristologie gegenüber, die mit dem Namen PAULUS verbunden ist. Nun ist es durchaus möglich, den Gedanken des Zeugen im Hässlichen, der mir zunehmend wichtiger wird, aufzunehmen, ohne eine alte Sühnetodtheologie mit einzukaufen. (Allerdings: Es gibt nachdenkenswerte Versuche, im Anschluss an die Überlegungen des Literaturwissenschaftlers RENÉ GIRARD das Sündenbockritual 1988 auf seine gewalteindämmende Macht hin zu thematisieren. Ein religiöser Opfertod für die Gegenwart ist, wenn der Sündenbockmechanismus mit Jesus ein- für allemal umcodiert worden ist, nicht mehr möglich, eine für die aktuelle Situation mehr als interessante Lesart.) Im Rekurs auf die Miniaturdramen des JESUS VON NAZARET, vulgo: seine Gleichnisse, lässt sich verständlich machen, wie die Neuschöpfung real erfahrbar wird. JESUS selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen und nur einmal – exakt wie SOKRATES – etwas in den Sand geschrieben oder gezeichnet, aber seine Gleichnisse, deren Urgestalten neutestamentliche Forschung bravourös herausgeschält hat, sind gleichsam Selbstporträt ein seiner Selbstabdruck, Lebensform. ein Sie literarisches kreisen im semantischen Spiel von Nähe (als Nähe des Himmelreichs) und Nächster. 98 Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, das mir das wichtigste zu sein scheint, zeigt, wie die Nächstenliebe als Imperativ sich einem Indikativ verdankt. Dazu bedarf es einer textlich inszenierten Offenbarung, genauer: einer Wahrnehmung oder einem Verstehen des Anderen als jemandem, dem ich immer schon verbunden bin, also: dem Nächsten. Das Gleichnis zeigt an einem verdreckten, mit Verlaub: verschissenen und halbtot geschlagenen Menschen – wiederum ein Zeugen im Hässlichen - , wie dieses Verstehen geschieht: Im Unterschied zu den Kultvertretern des Leviten und Priesters erbarmt sich der ‚unreine‘ Samariter über den Halbtoten. Aber erst als der Pharisäer, der die Frage nach dem Nächsten Jesus gestellt hat und als Antwort die Geschichte vom Barmherzigen Samariter hört, genötigt wird, sich mit dem Sterbenden spielerisch zu identifizieren, also: sich selbst zu entsockeln, weiß er, wer wem zum Nächsten geworden ist. Unzweideutig. Die Pointe ist eine doppelte: Die Vertreter der Kultklassen nehmen den Menschen durch eine kultische, von Reinheitsgeboten verdunkelte Optik wahr und verfehlen damit die Erfahrung einer ursprünglichen Verbundenheit zwischen den Menschen. Erst als der Pharisäer sich mit dem Sterbenden identifiziert, erfährt er sich als vom Samariter, den die Juden mit mehr als Argwohn begegneten, geliebt. Zweitens spielt das Miniaturdrama mit einer Doppelbedeutung von Barmherzigkeit: Barmherzigkeit meint 1. Eingeweide (zumeist eines Opfertieres); Mutterschoß; 2. übertragen: Blutverwandte, das eigene Fleisch und Blut; das Innere, Herz, Gemüt. Zwar ist die Bedeutungskraft dieses Wortes arg verschlissen, es dürfte aber die Urmetapher des Christentums sein. Das Glück ist also die Heilung der Zerrissenheit zwischen den Menschen. 99 RUDOLF BULTMANN hat in seinem Aufsatz „Das christliche Gebot der Nächstenliebe“ (1966, 229f) sehr scharfsinnig Griechentum und Christentum voneinander abgegrenzt. (Leider aber eine Konkretion unterlassen.) „Das Griechentum faßt (...) das Verhältnis von Mensch zu Mensch, sofern es unter einem Sollen steht, unter dem Gesichtspunkt der paideia, der Bildung und Erziehung auf. Der andere ist nicht mein ‚Nächster‘, sondern er steht wie ich unter der Forderung der Idee.“ (232f.) Ganz anders die Liebe im Christentum. „Die Liebe ist nicht und enthält nicht einen zu realisierenden Wert; sie ist vielmehr ein ganz bestimmtes Verstehen der Verbundenheit von Ich und Du und zwar nicht ein theoretisches, sondern ein praktisch-geschichtliches Verstehen, und so entdeckt sie das Was des Handelns, leitet so entdeckend den Vollzug der Handlung. (...) Liebe ist also, formal charakterisiert, ein von einem bestimmten (nämlich liebenden) Verstehen der Verbundenheit von Ich und Du geleitetes Tun.“ (235) Liebe ist also nicht ein ethisches Prinzip, das im Sinne eines humanistischen Ideals Anleitungen zur Lebensführung bietet. Als „Umkehrung der Lebensrichtung des natürlichen Menschen“ (238), der auf eine Durchsetzung seiner Ziele dem anderen Menschen gegenüber beharrt, macht der Mensch die Erfahrung, dass Liebe eine Wirklichkeit ist, in der er sich als Geliebter immer schon vorfindet. Sagt BULTMANN, diese Liebe sei nur dem Glauben sichtbar (241), dann darf man dekonstruierend sagen, dass dieser ‚Glaube‘ nichts anderes meint als eine Erfahrung, die der Text inszeniert. Leben in Christus meint, den anderen Menschen als Blutsverwandten zu erkennen. Das ist der Indikativ. Der Imperativ folgt zugleich. Die dem Indikativ sich verdankende Lebensform drückt sich in spezifischen Gesten aus, die in unserer Kultur sehr wesentlich durch die Passionsgestik bestimmt ist, 100 gleichberechtigt aber gehören die Gesten der Fröhlichkeit zum Kanon dazu. 101 4.3 Die Kunst der Nähe Eine Cover-Version dieser ursprünglichen jesuanisch- paulinischen Einsicht ist auf den ersten Blick mit besonders gewichtigen Problemen beschwert. Man muss nur zwei Stichworte abrufen, um die Schwerkraft zu benennen, die zu stemmen ist: Spaß- oder Erlebnisgesellschaft und Ende der Gutenberg-Galaxie. Anders gefragt: Lassen sich überhaupt Symbolisierungen des Glücks als Erfahrungen einer tiefen Verbundenheit zwischen den Menschen und damit, da wir göttlichen Geschlechts sind, zwischen Menschen und Gott in der Gegenwart machen? Sind wir nicht erfolgsorientierte Glücksritter und Glücksoptimierer in der ökonomisch und medial gesteuerten Erlebnisindustrie? Wird eine Lebensstilbildung, die, wie im Christentum, im Medium der Schrift und der schriftvermittelten Erfahrung verortet ist, nach der Ablösung des Leitmediums Schrift und Lektüre durch audiovisuelle Medien nicht letztlich atopisch? Zunächst zum Aufwärmen: Die soziokulturelle Signatur der Gegenwart ist mit den traditionalen Gesellschaften in der Tat nicht mehr zu vergleichen. Unbestritten ist, dass es dank der Enttraditionalisierung und funktionalen Differenzierung der Gesellschaft größere Freiheitsspielräume gibt. Durch die Mobilität und Flexibilität alltäglicher Lebensvollzüge, durch die Entstandardisierung der eigenen Biographie, ist der Einzelne freigesetzt, Arbeit, Lebensform und Religion freier zu wählen, als das anderen Generationen möglich war. Glaubt man dem Soziologen GERHARD SCHULZE, dann ist der horizontbildende Spielraum für die eigene Lebens- orientierung die Erlebnisgesellschaft (31993). Weil die Bindungswirkung von bisher kollektiv verbindlichen Sinndeutungsangeboten abnimmt, muss das Individuum dem kategorischen Imperativ des ‚Erlebe dein Leben‘ gemäß alles auf die sogenannte ‚Innenorientierung‘ umstellen: 102 Glück verspricht, was eine innere Wirkung, also Erlebnis und damit Spaß verspricht. Mit dieser Innenorientierung ist durchaus kein reiner Autismus verbunden, vielmehr wählt das Individuum ganz nach Gusto temporäre Erlebnisgemeinschaften aus, die entsprechende Events verstärken, etwa die Love-Parade oder das Formel 1-Rennen oder Straßen-Happenings. Aufgabe der Gesellschaft ist es, Wahlmöglichkeiten anzubieten, die die Glücksversprechen einlösen. Allerdings sind die Angebote, wie SCHULZE in seinem neuen Buch ‚Kulissen des Glücks‘ Orientierungsleistungen, (1999) weil die zeigt, ohne Angebote gültige Erlebnisse schematisieren, also vereinheitlichen, die der Rezipient nur aufgrund der bereits vertrauten Erlebnisse auswählt. Dieser ‚Kreislauf des Subjektiven‘ wird exemplarisch an der Lachkultur der neunziger Jahre aufgezeigt: Die Comedy setzt dem Zuschauer vor, was er komisch findet, um möglichst schnell entsprechende Erlebnisse auszulösen. (Die große Bedeutung, die der Skeptiker, wie gesehen, noch dem Lachen zuspricht, wird von SCHULZE kulturkritisch hinterfragt.) In seinen ‚Streifzügen durch die Eventkultur‘ untersucht SCHULZE die Routinen folkloristischer Schemata, die die Medien den Zuschauern aufnötigen. Das Ergebnis ist eine bombastische Selbstbefriedigungsmaschinerie: Das Individuum ist Definitionsinstanz für den eigenen Lebenssinn und die medial vermittelte Kultur macht ihm Angebote, seine Vorlieben möglichst umstandslos zu befriedigen – die freilich auf die Dauer (postcoital) ermüden. SCHULZE unterlegt seinen soziologischen Befund mit einem sehr kritischen Unterton, klagt gegen den ‚Kreislauf des Subjektiven‘ Momente des Objektiven ein und plädiert für ein ‚eigensinniges‘ Subjekt. Diese Analysen drängen eine theologische Interpretation förmlich auf. 103 Religiöse Glückserfahrungen orientieren sich, wie gesehen, im Gegenentwurf zur Innenorientierung. Gesucht werden also Erlebnisse, die nicht den schnellen Erlebniskick versprechen, sondern entlastend ein Geliebt-werden von Außen erfahrbar machen. Das Eigensinnige des Christentums besteht nun darin, diese Glückserfahrungen auch am Hässlichen inszenieren zu können, am Leiden, am Tod, an der Krankheit. Wie aber soll diese Erfahrung heute gemacht werden, wenn das Christentum diese Erfahrung am Leseakt festmacht, Lesekultur aber nur noch eine Kultur der Eliten ist? Ich verschreibe an dieser Stelle eine antiapokalyptische Wundsalbe – bitte dick auftragen! (Siehe Beilagenzettel!) Zwar ist das Buch nicht mehr Leitmedium – das Buch ist in der Tat durch die audiovisuellen Medien vom ersten Platz verdrängt worden -, aber es verschwindet nicht. Zudem ist eine zunächst buchschriftlich vermittelte Erfahrung durchaus in andere Medien übersetzbar. Vielleicht sind die Miniaturdramen der jesuanischen Gleichnisse und die darin gespeicherten Stoffe im audiovisuellen Medium sogar besser zu inszenieren als im Medium der Schriftlichkeit. Gegen SCHULZES Generalverdikt den Medien gegenüber, ist durchaus etwas mehr Gnädigkeit angemessen. Der folkloristische Verblendungszusammenhang ist nicht ganz so eng, wie SCHULZE argwöhnt. Es gibt, sogar in Hollywood, ganz ausgezeichnete Verdichtungen von Erfahrungen, die diese liebende Verbundenheit der Menschen erfahrbar machen. Nicht nur im europäischen Autorenfilm, auch in Hollywood, produziert man Filme, die ein Nachdenken über den eigenen Lebensentwurf in Gang setzen, sofern man sich spielerisch mit den Helden der Filme (oder auch der VideoHelden) identifiziert. Mir ist dieser Gedanke sehr wichtig. Die durch die neue Signatur der Gesellschaft geschaffenen Spielräume werden, 104 so darf man vermuten, oft (auch) als Bedrohung erfahren und bleiben häufig ungenutzt. Die Überforderung, die die Innenorientierung hervorruft, ist immens. Nur eine kleine kulturelle Elite wird in der Lage sein, eine PatchworkIdentität glücklich zu leben. Die Vielen werden auf personale Orientierungen angewiesen sein. Ich schlage deshalb vor, diese personalen Orientierungen mit einem alten Wort zu benennen: Legenden. Vereinfachend gesagt sind Legenden das Gegenmodell zur folkloristischen Schematisierung: Legenden produzieren durch ihr – traditionell ‚heilig‘ genanntes - Auftreten eine Distanz zum Alltagshandeln und stehen immer im Konflikt mit den gesellschaftlichen Routinen. Relevant wird das Handeln dieser Legenden für die Zuschauer, wenn es gelingt, deren Biographie zu unterstützen. (Vgl. zum Thema Legende ECKER 1993.) Mich interessieren selbstredend Legenden, die die besprochene entlastende Erfahrung transportieren, also charismatische Nachbildungen der Legende sind, die das Neue Testament tradiert. (Es gibt auch andere legendarische Angebote, die Strenge und Kälte verkörpern und das Fragmentarische und Unvollkommene des Menschen nicht als Eigenwert wahrnehmen.) Die gesuchten Legenden können Marius Müller-Westernhagen oder Madonna, Forrest Gump (Tom Hanks) oder Truman Burbank (Jim Carrey) heißen, reichen von ‚Schlaflos in Seattle‘ über ‚Dancer in the Dark‘ bis ‚Das Leben ist schön‘. Diese legendarischen Figuren erlauben eine Erfahrung der Präsenz des Heiligen, die eine Neuorientierung möglich macht. (Dass Theologie im Kino die inszenierte Religion aufsuchen muss, wird Theologen alter Schule vielleicht etwas ratlos machen. Das aber ist der Preis, den derjenigen zahlen muss, der akzeptiert, dass Religion sich aus der Vormundschaft der Theologie befreit hat.) 105 Kulturkritiker mögen argwöhnen, dass die Popikonen von MTV oder Hollywood Inhalte annektieren und schnöde ausbeuten, um letztlich doch nur dem Gott des Geldes zu opfern. Gemach. Es gibt eine Intrige medialer Inszenierung, die im ökonomischen Kalkül nicht eindimensional aufgeht. Natürlich. Von Jesus von Nazaret durfte man erwarten, dass er die Geschichten, die er erzählt hatte, auch wirklich lebte. Vergleichbares von den Stars zu fordern, die die Legenden verkörpern, käme einer sehr unchristlichen Überforderung gleich. Es gibt aber auch keinen Grund, den Stars eine zumindest partielle Indentifizierung mit der Rolle zu unterstellen. Aber dieser Vorbehalt ist zweitrangig. Auch die Figuren der Gleichnisse sind fiktive Gestalten, die zu einer spielerischen Identifikation mit der Figur einladen. Aufgabe der Theologie ist es, diese legendarischen Angebote als immer noch wirkungsmächtiges Element der Überlieferungsgeschichte des Christentums zu entdecken und im Kontext der konkreten Kultur auszulegen. Diese Theologie ist als Kunst der Wahrnehmung (Wahrnehmung in der griechischen Bedeutung als aisthesis) eine ästhetische Theologie, die die Aufmerksamkeit auf jene Gesten und Szenen lenkt, in denen sich ausdrückt, was der Innenorientierung eher unangenehm ist. Damit ist aber gerade jene kritische wie auch konstruktive Distanz zur folkloristischen Welt bezeichnet, die für das christliche Glücksverständnis eigentümlich ist. Glück meint eine eigentümliche, durchaus gelassene Form der Freiheit, die eine ursprüngliche Verbundenheit mit den Menschen und Gott voraussetzt und als Geliebt-werden eine Entlastung schafft, die die Energie liefert, jene Gesten und Symbolisierungen im Alltag zu wählen, in denen die Güte Gestalt gewinnt. Eine ästhetische Theologie legt allen Nachdruck auf die Wahrnehmungen und Inszenierungen 106 dieser Glückserfahrungen, um entsprechend die eigene Lebensführung zu konkretisieren. Nochmals: Damit ist nicht behauptet, dass es Freiheit und Glück in anderen Lebensdeutungen nicht gibt. Aber die Eigensinnigkeit des Christentums liegt in einer doppelten Entlastung, zunächst in der Entlastung vom Wellness- und Schönheitsterror, in der Akzeptanz der Fragmentarität und Hässlichkeit menschlichen Lebens, sodann in der Entlastung von Anstrengungen, das Glück aus eigener Kraft auf den Weg zu bringen. Und das ist auch gut so. 107 4.4 Bin ich empfindsam? Der Chronist Landvermesser der der Mittelgewichts-Ehen zerklüfteten religiösen und der Landschaft Amerikas, JOHN UPDIKE, beginnt seine Familiensaga „Gott und die Wilmots“ mit der Geschichte eines Pfarrers, der zu Beginn unseres Jahrhunderts plötzlich fühlt, wie sein Glaube endgültig und deutlich hörbar entweicht: „Reverend Clarence Arthur Wilmot im Pfarrhaus der Vierten Presbyterianischen Kirche unten an der Ecke Straight Street und Broadway (spürte), wie die letzten Reste seines Glaubens ihn verließen. Es war eine sehr deutliche Empfindung - ein Kapitulieren in den Eingeweiden, eine Hand voll dunkler funkelnder Luftbläschen, die nach oben entwichen. Er war ein großer schmalbrüstiger Mann von vierundvierzig Jahren, mit herabhängendem sandfarbenen Schnurrbart und einem gewissen Nachglühen maskuliner Schönheit, trotz des vagen Ausdrucks eines schleichenden Unwohlseins. Er stand im Augenblick, da er den vernichtenden Stich empfing, im Erdgeschoss des Pfarrhauses und überlegte, ob er in Anbetracht der Hitze den Rock aus schwarzem Serge ablegen sollte. (...) Clarences Geist war ein vielbeiniges, flügelloses Insekt, das lange und mühselig versucht hatte, an den glatten Wänden eines Porzellanbeckens hinaufzuklettern, und jetzt spülte ein jäher unwirscher Wasserstrahl es in den Abfluss hinunter. Es gibt keinen Gott.“ (15f.) Clarences Bücher erweisen sich in seinem Glaubenskampf nur als papierene Schilder gegen die glühend heißen Wahrheiten der harten Wissenschaften und als trostloser Pergament-Haufen am Bett eines sterbenden Seidenwebers, der wissen will, ob er sich zu den Erwählten rechnen darf. (Stichwort: Calvins Lehre von der doppelten 108 Prädestination, Gottes Vorherbestimmung eines Menschen zum Erwählten oder Verworfenen). Wilmot argumentiert in etwa wie heute FRANZ JOSEF W ETZ. Zu den schönsten Passagen des Romans gehört, wie Wilmot - klug, milde und auch sympathisch konsequent - beim Moderator des Presbyteriums um seine Entlassung bittet und dort auf einen ungeduldigen und theoretischen alerten Menschen Kurzeinsätzen trifft, die der in geschmeidigen Diskussionen skizziert, die in den nächsten Jahrzehnten die theologischen Debatten beherrschen werden. Clarence Wilmot legt nach einjähriger Bedenkzeit sein Amt nieder, missioniert Volksenzyklopädie verhungert dann für den in den Straßen schließlich an Verkauf einer seiner Stadt und Folgen einer den Speiseröhrentuberkulose. Sein jüngster Sohn Teddy wird Briefträger von Basinkstoke, heiratet Emily, zeugt mit ihr die aufregend schöne Essie, die sich in Hollywood durchbeißt und durchschläft und wenig Zeit für ihren Sohn Clark findet. Clark schließt sich frustriert und vereinsamt einer adventistisch-fundamentalistischen Kommune an und wird während der Stürmung ihrer „Festung“ durch die Polizei erschossen, stirbt aber immerhin als Held, weil im letzten Moment jener „Schwarm funkelnder dunkler Luftbläschen“ (722) - der nach dem Austritt aus seinem Großvater offensichtlich in der Atmosphäre überwintert hat - in Clark Eingang findet und ihn bewegt, den falschen Propheten, der die Kinder opfern möchte, zu erschießen. Updikes Jahrhundertbilanz verzeichnet seismographisch die Krisen des Religiösen: das wissenschaftliche Weltbild, die Vereinsamung in der Medienwelt, die Entlastung durch die Anlehnung an fundamentalistische Modelle. Glücklich – das Ideal von Liebe verkörpernd - ist nur der einfache BriefträgerTeddy. 109 In dem Roman ‚Das Buch Ruth‘ habe ich die Geschichte eines Ehepaares im protestantischen Milieu erzählt, dass friedensbewegt und aktionsmilitant die eigene Liebe aus den Augen verloren habt, bis Ruth schließlich zuschlägt und im Krankenhaus, am Bett ihres komatösen Mannes, Rückschau hält: „Georg war kein Kuscheltyp. Leider. Manchmal fühlte ich mich in seiner Gegenwart so verlassen wie ein Strandkorb im Schnee. Er konnte keine Nähe ertragen. Vielleicht sind wir deshalb immer voreinander geflohen. Wir führten weißgott keine Spießerehe. (Ich glaube, ich habe während unserer gemeinsamen Zeit nicht ein einziges Mal Erdnüsse oder Chips eingekauft. Wenn einer Cracker kaufte, dann Maike!) An Langeweile ist unsere Beziehung nicht gescheitert. Vielleicht wäre Langeweile manchmal sogar entlastend gewesen. Wir waren immer ruhelos mit unseren Aktionen und Plänen beschäftigt. Aber nur sehr selten mit unseren ganz privaten Gefühlen. Wenn Georg mich tief verletzte, dann stürzte ich mich kopfüber in die nächste Aktion. Georg meinte, unser Aktionismus nähre sich aus Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber den 68ern. Weil wir mehr als zehn Jahre zu spät gekommen seien, wären wir und er meinte vor allem mich - Aktions-Streber geworden. „Dein Vater war zu alt für die Revolution, du zu jung. Wenn das kein Familienschicksal ist!“ Vielleicht lag Georg mit seiner Meinung gar nicht falsch. Mein Vater. Wie oft habe ich mir gewünscht, man könne die Verletzungen, die Georg mir zufügte, behandeln, so wie früher mein Vater einmal einen Holzspeil, der beim Spielen tief in die Handfläche gedrungen war, mit der Pinzette zog; sofort ließ der Schmerz nach. Aber es gab nirgendwo diese Pinzette. Und ich konnte mich nicht selbst therapieren. Natürlich habe ich immer die Risse in unserer Beziehung 110 gesehen, aber wie bei einem Haarriss in der Lieblingstasse, der langsam braun wird, glaubt man nicht daran, dass die Tasse wirklich kaputt geht. Und dann gibt sie eines Tages doch den Geist auf. Ja. Vielleicht habe ich Georg überfordert. Vielleicht waren meine Erwartungen an die Liebe zu hoch. Ich habe sogar einmal eine Predigt missbraucht, um Georg zu verletzen. Als ich hörte, dass er - das geschah eher selten - einen Gottesdienst von mir besuchen wollte, habe ich als Textstelle einen Hiobvers gewählt: „Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, daß ich nicht achtete auf eine Jungfrau.“ Er hat tagelang mit mir kein Wort gewechselt. Zu Recht.“ (2000, 250f.) In dem jüngsten Roman ‚Zweiter Aufschlag‘ habe ich eine Pietá-Szene beschrieben, Augenblicke einer überraschenden Nähe zwischen dem Sohn Fritz, der seine Mutter um eine Lebensversicherung erleichtert hat, und der inzwischen unter Altersdemenz leidenden Mutter. „Und dann ist sie weg. Plötzlich und nicht ganz unerwartet. Hinterher ist man klüger. Fritz sucht das ganze Haus ab, den Keller auch, den Speicher zuletzt. Nichts. Er ruft Bekannte an. Ihre Freundinnen. Ärzte. Das Krankenhaus. Die Polizei. Er sucht alle Lieblingsplätze ab, den Stadtpark, das Café am Rathaus, den Vechtesee. Nichts. Er bittet Philip, ihm zu helfen. „Kette sie doch nachts einfach an. Es gibt fette Halsbänder. Echt.“ Er steigt in die Turnschuhe und bleibt demonstrativ zehn Schritte hinter Fritz, ruft im Stadtpark: „Put, put, put. Fressen. Put, put. Put.“ Nichts. Es wird neun Uhr. Es wird zehn Uhr. Fritz sucht mit einer Stange den Teich ab. Endlich kommt Elke von der Spätschicht. „Deine Lieblingsfeindin hat sich vom Acker gemacht“, empfängt Philip seine Mutter. 111 „Erika? Seit wann ist sie weg?“ „Seit zehn Uhr heute morgen. Beim Zahnarzt ist sie nicht angekommen.“ Fritz Stimme klingt angestrengt. „Freundinnen angerufen? Cafés abgesucht? Krankenhäuser gecheckt?“ „Alles“, sagt Fritz müde. Sie sitzen im Wohnzimmer, mit geöffneter Terrassentür, starren in die Dunkelheit. Fritz hält die ganze Zeit das Telefon in der rechten Hand. „Weckt mich, wenn Erika von ihrem Liebhaber zurück ist“, verabschiedet sich Philip. Sie sitzen und warten. „Wir können nur warten.“ Gegen zwei Uhr holt sich Elke eine Decke und legt sich auf die Couch. Fritz bleibt sitzen. Um sieben Uhr ruft die Polizei an. Man habe die Mutter gefunden. Auf einer Parkbank an der Vechte in der Nähe des Wehrs. „Ich gehe allein“, sagt Fritz. Er steigt ins Auto, fährt zur Vechte, parkt seinen Wagen in der Nähe des Stadtparks, bedankt sich bei den Polizisten. Nachdem er sich neben seine Mutter gesetzt hat, schwenkt sie die Beine auf die Sitzfläche, in einer einzigen anmutigen Geste als wäre sie eine Frau von fünfundzwanzig, und legt den Kopf auf Fritz Schoß. Fritz sitzt für Sekunden erstarrt, legt dann eine Hand unter ihren Kopf, die andere auf ihre Schulter. „Du machst aber Sachen“, sagt er leise, eher bewundernd als vorwurfsvoll. „Das war doch eine gute Idee von mir, den Polizisten zu sagen, sie sollten dich anrufen und herzitieren, damit du auch diesen herrlichen Sommermorgen genießen kannst, oder?“ Seine Mutter blinzelt kurz zu ihm hoch. „Weißt du, mit meinem ersten Bräutigam habe ich nämlich auch hier gesessen, bevor er zurück musste in den Krieg. 112 Wir haben hier die ganze Nacht verbracht. Natürlich nicht auf solch einer Bank, aber auf einer Decke. Die Vechte war damals noch nicht reguliert. Bänke und Fahrradwege gabs nicht. Nein. Nein. Es war ein herrlicher Sonnenaufgang. So friedlich. Danach war die Sonne nie wieder so honiggelb. Ich habe dort so gelegen wie jetzt hier. Es war traurig und schön zugleich.“ Sie macht eine kleine Pause. „Später dann habe ich oft mit deinem Vater hier gesessen. Ich habe ihm natürlich nie erzählt, dass ich bereits eine Nacht mit einem anderen hier verbracht habe. Wo denkst du hin! Dein Vater hatte dickere Beine als mein erster Bräutigam. Es war etwas bequemer.“ Sie lacht. „So wie bei dir. Du bist ja überhaupt ganz wie dein Vater. Und ich bin so stolz auf dich.“ Fritz streichelt ihr über die Schulter. „Wir machen das jetzt öfter Fritz. Aber nächstes Mal musst du gleich abends mitkommen. Dieses Mal hast du noch gemogelt. Nächstes Mal lasse ich dir das nicht mehr durchgehen.“ Sie schauen eine ganze Zeit auf das Wehr, dann sagt seine Mutter: „Fritz, ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Ich kann mir keine Namen mehr merken. Kürzlich habe ich sogar deinen Namen nicht mehr erinnert. Stell dir vor, Fritz, mein Junge. Ich habe deinen Namen vergessen, als hätte ich dich bereits vor Jahren verlassen.“ Fritz spürt, wie Tränen sein Hosenbein durchnässen. Er kneift die Augen zusammen, räuspert sich, sagt: „Mein Gott, Mama. Du hast mich nicht verlassen. Ich bin ganz nahe bei dir.““ Und dann gibt es seit 1999 Magnolia. Der Film von PAUL THOMAS ANDERSON ist, nach dem Genital-Drama ‚Boogie Nights‘, eine Art biblische Cover-Version (keine LightVersion!) von ROBERT ALTMANS ‚Short Cuts‘. Beschränkte 113 sich ALTMAN darauf, die Schicksale seiner Charaktere aus sicherer Kameradistanz aufeinanderprallen zu zynisch lassen, und malt bissig ALTMAN nur ein Sittenfresko vor Augen, ringt ANDERSON mit dem ungleich komplizierteren Projekt, dreistündigen Empfindung am Inszenierung zu Ende seiner Sekunden präsentieren. ANDERSON mehr als der wahren ist ungleich protestantischer (er ist gebürtiger Katholik) als ALTMAN, wenn er die Archetypen der spätmodernen amerikanischen Gesellschaft, hübsch aufgereiht am Magnolia Boulevard, den unnahbaren Fernsehmoderator, Prostituierte, den menschelnden Filmproduzenten, das TV-Wunderkind, barmherzigen Cop, den den die alerten koksende Gutmenschen, den TV-Macho-Guru, die Ehegewinnlerin und den notorischen Versager mit biblischen Archetypen überblendet: Vom verlorenen Sohn über den barmherzigen Samariter bis zu Maria Magdalena ist alles vertreten. Etwas dick!, wird man argwöhnen. Aber mit einem herrlich ironischen, gleichsam proleptischen Einspruch gegen diesen Vorbehalt beginnt der Film mit drei Episoden, die sich tatsächlich so ereignet haben: 1911 wurden drei Männer hingerichtet, Green, Berry und Hill, die einen Apotheker in Greenberryhill ermordet hatten; ein Taucher wird von einem Löschflugzeug bei der Wasseraufnahme erfasst und stirbt in voller Montur in einem Baum. Der Pilot hatte am Vortag mit dem Mann, von Beruf Croupier, im Casino einen Streit. Als der Pilot vom Tod des Croupiers erfährt, bringt er sich um; ein potentieller Selbstmörder wird beim Fall vom Hochhaus durch einen Schuss getötet, der sich beim Streit zwischen seinen Eltern just in dem Augenblick löst, als er am Fenster vorbeifällt. Weil Fassadenarbeiter am Vortag ein Netz gespannt haben, Selbstmordversuch wird ein aus geglückter einem missglückten Totschlag. „Solche 114 eigenartige Dinge passieren andauernd‘, sagt eine Stimme aus dem Off und senkt damit die Vorbehalte gegen den am Ende des Films einsetzenden Froschregen deutlich ab. Erst dann beginnen die episodisch verschränkten Lebensfragmente von neun Personen. Da ist zunächst der Filmtycoon Earl Partridge, der, von Krebs zerfressen, noch einmal seinen Sohn sehen möchte, der mit ihm gebrochen hat, weil er ihn mit der sterbenden Mutter alleine ließ. Seine bisher coole und Markenverwöhnte Ehefrau Linda wird durch den Krebstod zu einem emotionalen und höchst skrupolösen, von Schuldkomplexen aufgeschreckten Wrack. Kontakt mit dem Sohn nimmt der Pfleger Phil (ein, wie der Name sagt, wahrer Menschenfreund) auf. Der Sohn Frank Mackey coacht in Seminaren, Radio- und Fernsehsendungen Männer, wie man aus Frauen gefügige Sex-Maschinen macht: Sein Bestseller und heimliches Credo, das er seinen Schützlingen einimpft, heißt: Verführe und zerstöre. „Respektiere den Schwanz!“, verkündigt der Sexpriester den Gläubigen. Sein Vater macht(e) sein Geld mit der seit dreißig Jahren quotenträchtigen Show ‚What do kids know?‘ Der ehemalige Kinderstar Donnie Smith ist heute ein verklemmter und überschuldeter kleiner Angestellter, der von einer teuren Zahnspange träumt, um damit seinem Dreamboy näher zu kommen. Aktuelles Opfer dieser Sendung ist Stanley Spectator, der von seinem Vater gedrillt wird, um den Preis von einer halben Million Dollar zu gewinnen. Moderiert wird die Sendung von Jimmy Gator, der wie sein Produktionschef an Krebs erkrankt und ebenfalls versucht, sich mit seiner inzwischen koksenden Tochter Claudia zu versöhnen, die er offensichtlich vor Jahren sexuell missbraucht hat. In Claudia verliebt sich der Cop Jim Kurring, eine Art liebender Engel, der ungern straft. 115 In bester Patchwork-Manier werden die Vater-Kind- Geschichten als Geschichten vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Vater verschränkt. „Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns“, heißt es leitmotivisch im Film. Die von Geld, Drogen und Einsamkeit metastasierte Gesellschaft wird in eindringlichen Kamerafahrten verfolgt. Als emotionalen Verstärker dienen Lieder von Aimee Mann. Am Anfang heißt es: „One is the loneliest number“, auf dem Höhepunkt der Verzweiflung singen alle Protagonisten ‚Wise up‘ (eine filmische Wiederentdeckung des griechischen Chors in der Tragödie, die auch LARS VON TRIER in ‚Dancer in the Dark‘ probiert hat.) Diese Liedzeile korrespondiert mit der Eintrübung des Wetters. Zwar ist die Parallelisierung von Meterologie und Charakterologie nicht neu, aber ANDERSON gewinnt dem Einfall eine Pointe ab, wenn er drei Mal Wetterberichte szenisch einfügt und damit den dramaturgischen Hitze- bzw. Nässegrad ablesbar macht, bis die sintflutartigen Regenfälle in einem reinigenden Gewitter münden. Etwas holzschnittartig wird das ganze Sündenregister abgearbeitet um den – nahezu wörtlichen – paulinischen Tugendkatalog zu reinszenieren. Schließlich kehrt der verlorene Sohn (von TOM CRUISE großartig gespielt), der Sex-Maniac Jack (the Ripper?), der sich zwischenzeitlich umbenannt hatte, an das Bett des Filmmagnaten, des verlorenen Vaters, zurück und liegt in der Schlusseinstellung in embryonaler Haltung auf dem väterlichen Sofa. Der Cop Jim hilft dem ungeschehen alternden Wunderkind zu machen und liebt einen Einbruch Claudia ohne Moralapostelei, eine Entlastung, die ihr hilft, die Sucht zu überwinden. Und das neue Wunderkind lehnt sich zum ersten Mal gegen den eigenen Vater auf: „Du musst netter zu mir sein!“ 116 Der eigentliche filmische Geniestreich von ANDERSON besteht aber zusammenhang darin, den sündhaften Verdunklungs- ein reinigendes Froschgewitter durch aufzuhellen. Der geldige Pharao, so die alttestamentarische Szene, wird von zehn Plagen heimgesucht, um die Israeliten ziehen zu lassen. Die zweite Plage ist die Froschplage: „Und Aaron reckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten, und es kamen Frösche herauf, so daß Ägyptenland bedeckt wurde“, heißt es in Exodus 8,2. (Mit dieser Zahl spielt der Film an zumindest elf Stellen. Wörtlich zitiert werden die Stellen in der Quizshow und auf einem Plakat in einem Bushäuschen. Der zum Tode verurteile Verbrecher in der erste Szene trägt auf seinem Pullover eine 82, das Flugzeug, das den Taucher aufnimmt, ist ebenfalls mit der Zahl 82 beschriftet, im Casino sieht man Karten mit einer Acht und einer Zwei, die Gerichtsmedizinveranstaltung der dritten Episode beginnt um 8.20 Uhr, Taue auf einem Dach sind in der Form einer Acht und einer Zwei drapiert, der Selbstmörder springt von einem achtstöckigen Hochhaus mit zwei Türmen; die Chiffre für die Bekanntschaftsanzeige des Cops Jim Kurring ist die 82; die Regenwahrscheinlichkeit zu Anfang des Films beträgt 82%, in Donny’s Stammkneipe vermeldet das Dart-Brett einen 8:2 Stand.) Die neue Welt ist eine von Geld, Macht und Drogen regierte Welt. Die Froschplage ist das Menetekel für den Pharao des Geldes und der Medienmacht, das Volk ziehen zu lassen. Ein wirklich grandioser Einfall. Und um das Neue Testament nicht sträflich zu vernachläsigen, wird in der Story zwischen Claudia und Cop Jim auf Lukas 8,2 angespielt. Dort wird berichtet, dass böse Geister aus Maria Magdalena ausfahren. Entsprechend sitzt der Cop am Bett von Claudia, sagt ihr, dass sie ein guter Mensch sei und endlich, zum ersten Mal im Film, beginnt sie zu lächeln. 117 Die von GERHARD SCHULZE gemutmasste folkloritische Schematisierung unserer Wahrnehmung durch die Medien wird von dem Film ‚Magnolia‘ hübsch unterlaufen. Man muss den Film nicht mögen, man darf das zuweilen hohe Pathos mit mentaler Gänsehaut quittieren, aber eins kann man dem Film nicht absprechen, er bietet einen Strauss von Identifizierungsmöglichkeiten, um Erfahrungen mit der eigenen Biographie zu machen und damit, was es heißt, von Samaritern oder Heiligen wie dem Cop Jim und dem Pfleger Phil geliebt zu werden. 118 4.5 Hetärengespräche Go(o)d Cuts zwischen Ruth, Mutter und Clara R u t h: Ich habe einen protestantischen Defekt. Genetisch, versteht ihr? Fit for fun? Eher nicht. Ich war immer hundertfünfzigprozentig und spaßunfähig. Ergaben Umfragen, dass Kuhmilch belastet sei, verbannte ich sie aus dem Kühlschrank. Grüner Tee verhinderte Krebs? Ich kaufte eine ganze Schiffsladung. Lautete das Vorurteil, Pastoren seien faule Säcke, versuchte ich stellvertretend das Vorurteil abzubauen. Hieß es, zwanzig Sit ups täglich straffen die Bauchmuskulatur, machte ich morgens im Schlafzimmer dreißig. Begleitet von Georgs zynischen Kommentaren. Las ich, dass der Widerstand in Gorleben erlahmte, rangierte ich Termine und fuhr selbst hin. Georg las immer nur das, was ihn bestätigte. Rotwein sei gut für das Herz? Georg müsste also mindestens hundert Jahre alt werden. Belegte eine Professorin in den Fortbildungsseminaren zur Familientherapie mit empirischen Daten (aber Professoren können immer alles belegen!), schuld an der Langeweile im Schlafzimmer und den kleinen Fluchten der Männer seien auch die lustmüden Ehefrauen, dann lieh ich in Oldenburg entsprechende Bücher mit Tipps aus. Leider fehlen mir offensichtlich einige Gelenke. Meine Patientinnen winkten auch nur müde ab. M u t t e r: Mein Gott, armes Kind! Ich weiß nur zu gut, was Sie durchgemacht haben. Wir scheitern immer an der Nähe. Immer. Im Norden sind wir zudem noch taktile Analphabeten, nicht? Wenn plötzlich die Enkel in der Pubertät sind und der Mann tot, dann hat man niemanden mehr, den man in den Arm nehmen kann. Selbst wenn ich meinem Enkel einen Fünfziger in die Hand drückte und ihn dann kurz in den Arm nahm, ließ er es über sich ergehen als 119 hätte ich Aussatz. Er versteinerte augenblicklich in meinen Armen. Aber meinen Sohn, den habe ich kürzlich überlistet. Ich habe auf einer Bank gesessen und als er dann kam, habe ich, ohne ihn vorzuwarnen, meinen Kopf auf seinen Schoß gelegt, und Sie werden es nicht für möglich halten, er hat mich sogar sehr zärtlich gestreichelt – zum ersten Mal vielleicht sogar ohne Hintergedanken, denn meine Lebensversicherung hatte er längst kassiert. Er konnte mich sogar trösten, weil ich doch so vergesslich geworden bin, so wie ich ihn damals getröstet habe, wenn er von seinen Freunden aufgezogen wurde. C l a r a: Ich weiß gar nicht, ob ich dass ertragen kann, wenn mich einer gerne hat. Ich bin eine Zicke. Ich kokse. Ich nehme schon mal einen mit aufs Zimmer, wenn ich dringend Geld brauche. Und der spielt den barmherzigen Samariter! Sitzt an meinem Krankenbett und säuselt, wie gerne er mich hat. R u t h: Aber was ist daran nicht ok? C l a r a: Schon, wenn man ganz unten ist, hört man das gerne. Und so übel sieht er auch gar nicht aus. Ich mache einfach eine Probe. Wenn er sich vier Wochen Mühe gibt und mir nicht sofort an die Wäsche will, glaube ich ihm. Dann ist er ein Heiliger. Oder impotent. 120 Nachspiel Himmlische Medizin - Frei von Nebenwirkungen Vier Modelle also – das scheint mir noch übersichtlich genug zu sein. Will ich mir nicht selbst ins Wort fallen und mich zum Eiferer aufschwingen, muss ich Ihnen, den Lesern, die Entscheidung überlassen, welches Modell Sie wählen. Und um Sie sogleich zu beruhigen: Letzte Wahrheiten sind in Glücksfragen, gleich gültig, ob religiöse oder philosophische Deutungspraktiken angewendet werden, nicht zu haben. Allerdings: Als empirischer Autor, durchaus nicht unabhängig vom sozial-religiösen Apriori meiner Selbst- und Weltdeutung, habe ich eine bestimmte Vorliebe. Eine, hoffentlich ironisch gebrochene, harmoniesüchtige Euphorie durchzieht, wie ich bei der nochmaligen Lektüre festgestellt habe, den Text. Sie ist Ausdruck für eine milde Verliebtheit, die alten Ehepaaren nach vielen Stürmen eigen ist. Wie gesagt: Zellulitis. Ein Ehemann oder auch Liebhaber kann Zellulitis als beglückend (und entlastend erfahren), eine subjektive Erfahrung, die durchaus nachvollziehbar ist. Zu einer lächerlichen Missionstätigkeit würde allerdings der Versuch, Zellulitis als Kriterium auf Schönheitswettbewerben durchsetzen zu wollen. So verhält es sich auch mit meinem Angebot. Ich habe viel Sympathie für die christliche Lebensform. Die entlastende Erfahrung geliebt zu werden, Glück qua Heil also als, theologisch gesprochen, Gnade zu erfahren, die von den Anstrengungen Glück in der Ich-AG (TOM PETERS) zu erlangen befreit; und die entlastende Erfahrung, dass Hässlichkeit und Leiden keine Defizite für persönliches Glück darstellen, halte ich für ausgesprochen lebenstüchtig. Und die Probe auf die Lebenstüchtigkeit ist eine strenge aber gerechte Prüfung für Lebens- deutungsmodelle. 121 Nochmals – aber diese Rhetorik streift schon wieder den Eifer -: Ich verschreibe auch meiner Zunft eine gehörige Portion Skepsis. Wir haben es mit Deutungen zu tun, die sich als lebensfähig (oder als lebensuntauglich) erweisen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann mir durchaus andere religiöse oder philosophische Deutungen vorstellen. (Das schließt meine grundsätzliche Skepsis Modellen gegenüber ein, die ein Weltethos auf den Weg bringen wollen. Selbst konsensualen Modellen gegenüber traue ich nur soweit, wie sie regionalen Deutungshemisphären entsprechen.) Vier Modelle also. Alle vier singen das hohe Lied der Gelassenheit in Geschichte und Gegenwart. Ob allerdings eine gegenwärtige Gelassenheit in unserer westlichen Kultur den Manipulation und Zurichtungen durch Märkte (STRASSER 2001) und globale Finten des Kapitalismus ohne religiöse Deutungen auskommen kann, ist eine bis auf weiteres offene Frage. Die religiöse Deutungsoption ist dabei eine lebensfähige Option. Darin ist dem eingangs zitierten PASCAL BRUCKNER zustimmen: Ohne Himmel wird das Glück zur überfordernden Zumutung. Für das Christentum gehören Glück als Heil und Himmel zusammen. Nur soviel lässt sich sagen: Der Himmel ist nahe im unverdienten Glück der Nähe. Aussichten in die Ewigkeit sind dort zu erlangen. Oder, gleichsam stellvertretend, im Medium der Literatur und des Films, sofern denn Literaten und Filmemacher mit Hingabe den Nöten und Verletzungen der Menschen nachspüren. Das war die gültige Pointe der jesuanischen Meistererzählungen: Die Gleichnisse heilen die Menschen, indem sie Deutungen abbauen, die die (religiöse) Bestimmung des Menschen als Verbundenheit mit anderen Menschen verhindern. In dieser Hinsicht gehören Erzählen und Heil oder Glück zusammen. Das ist zugleich das christliche Movens von Literatur und Filmkunst. 122 Konsequenz: In der Bibliothek und im Kinosaal (siehe ANDERSON; siehe VON TRIER) kann man dem Himmel sehr nahe kommen. Und damit dem Glück. Buch und Film – im Idealfall eine himmlische Medizin ohne gesundheitsschädigende Nebenwirkungen. Literatur Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften 4, Minima Moralia, Frankfurt am Main 1980. Albert, Hans, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 1968. American Beauty, Regie: Sam Mendes, Film, (1999), 2000. Allen, Woody, Purple Rose of Cairo, Film, (1985), 1994. Allen, Woody, Harry ausser sich (Deconstructing Harry), Film, (1997), 1998. Allen, Woody, Celebrity – Schön, reich und berühmt, Film, 1999. Aurel, Marc, Wege zu sich selbst. Herausgegeben und übersetzt von Rainer Nickel, München und Zürich 1992. Bruckner, Pascal, Verdammt zum Glück. Der Fluch der Moderne. Ein Essay, Berlin 2001. Bultmann, Rudolf, Das christliche Gebot der Nächstenliebe, in Glauben und Verstehen, Bd 1. Tübingen 1966, 229 – 244. Der Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus, in: Wilhelm Schneemelcher (Hg.), Neutestamentliche Apokryphen. Bd. II. Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen 1964, 84-89. 123 Dörrie, Doris, Bin ich schön?, Zürich 1995. Ecker, Hans-Peter, Die Legende: kulturanthropologische Annäherung an eine literarische Gattung, Stuttgart, Weimar 1993. Ellis, Bret Easton, Unter Null. Roman. Deutsch von Sabine Hedinger, Köln 21999. Diogenes Laertius (!), X. Buch, Epikur, Hamburg 1968. Diogenes Laertios, Leben und Lehre der Philosophen. Aus dem Griechischen übersetzt und herausgegeben von Fritz Jürß, Stuttgart 1998. Genazino, Wilhelm, Die Kassiererinnen, Roman, München 1998. Genazino, Wilhelm, Ein Regenschirm für diesen Tag, Roman, München 2001. Girard, René, Der Sündenbock, Düsseldorf 1988. Hessel, Franz, Ein Flaneur in Berlin. Mit Fotografien von Friedrich Seidenstücker, Walter Benjamin’s Skizze ‚Die Wiederkehr des Flaneurs‘ und einem ‚Waschzettel‘ von Heinz Knobloch, Berlin 1984. Hösle, Vittorio, Versuch über das Komische, München 2001. Hossenfelder, Malte, Philosophie der Antike 3: Stoa, Epikureismus und Skepsis, Geschichte der Philosophie, hg. von W. Röd, Bd. III, München 1985. Houellebecq, Michel, Ausweitung der Kampfzone. Aus dem Französischen von Leopold Federmair, Berlin 1999. Houellebecq, Michel, Elementarteilchen. Aus dem Französischen von Uli Wittmann, Köln 1999. Huizing, Klaas, Ästhetische Theologie, Bd. 1, Das erlesene Gesicht. Eine literarische Anthropologie, Stuttgart 2000. Huizing, Klaas, Ästhetische Theologie, Bd. 2, Der inszenierte Mensch. Eine Medien-Anthropologie, Stuttgart 2002. Huizing, Klaas, Das Buch Ruth, Roman, München 2000. Huizing, Klaas, Zweiter Aufschlag, Roman, München 2002. Intimacy, ******************************************************** 124 Kundera, Milan, Die Unwissenheit, Roman. Aus dem Französischen von Uli Aumiller, München 2001. Löwenthal, Leo, Das Bild des Menschen in der Literatur, Neuwied 1966. Lukian, Gespräche der Götter und Meergötter, der Toten und der Hetären, Stuttgart 1998. Magnolia, Film, ************************************************* Marquard, Odo, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981. Marquard, Odo, Apologie des Zufälligen, Stuttgart 1986. Millet, Catherine, Das sexuelle Leben der Catherine M.. Aus dem Französischen von Gaby Wurster, München 2001. Pieper, Annemarie, Glückssache. Die Kunst gut zu leben, Hamburg 2001. Pohlenz, Max, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, 2 Bände, Göttingen 1948. Porsch, Felix, Kleine Theologie des Neuen Testaments, Stuttgart 1995. Poschardt, Ulf, Cool, Hamburg 2000. Ricken, Friedo, Antike Skeptiker, Beck’sche Reihe Denker, München 1994. Ricken, Friedo, Ontologie und Erkenntnistheorie in Platons Theaitetos, in: Muck, O. (Hg.), Sinngestalten, Innsbruck 1989, 212-230. Russel, Jeffrey Burton, Geschichte des Himmels, Wien Köln, Weimar 1999. Sanders, E.P, Paulus. Eine Einführung, Stuttgart 1995. Schmid, Wilhelm, Schönes Leben? Einführung in die Lebenskunst, Frankfurt am Main 1995. Schulze, Gerhard, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main, New York 31993. Schulze, Gerhard, Kulissen des Glücks, Streifzüge durch die Eventkultur, Frankfurt am Main, New York 1993. Seneca, Lucius Annaeus, Philosophische Schriften, Zweiter Band, Darmstadt 1999. 125 Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis. Eingeleitet und übersetzt von Malte Hossenfelder, Frankfurt am Main 31999. Stoa und Stoiker. Die Gründer. Panaitios. Poseidonios. Eingeleitet und übertragen von Max Pohlenz, Zürich, Stuttgart 1950. Soeffner, Hans-Georg, Gesellschaft ohne Baldachin. Über die Labilität von Ordnungskonstruktionen,******* Theissen, Gerd, Der Schatten des Galiläers. Historische Jesusforschung in erzählender Form, Gütersloh 141999. Theissen, Gerd, Merz, Annette, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch. Göttingen 1996. Wetz, Franz Josef, Lebenswelt und Weltall, Stuttgart 1994. Wetz, Franz Josef, Die Würde des Menschen ist antastbar. Eine Provokation, Stuttgart 1998. Wetz, Franz Josef, Die Kunst der Resignation, Stuttgart 2000. 126