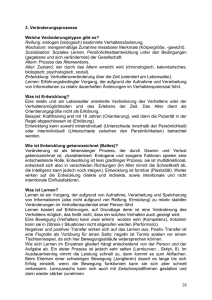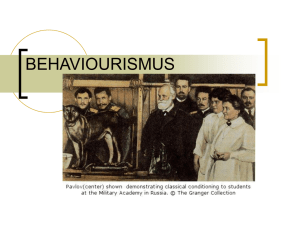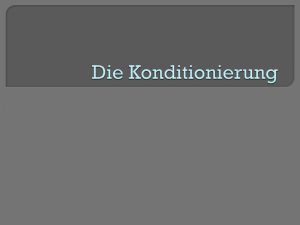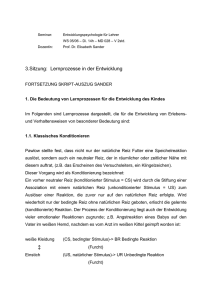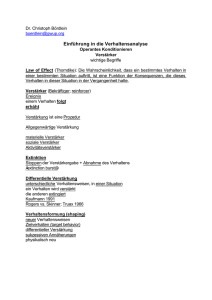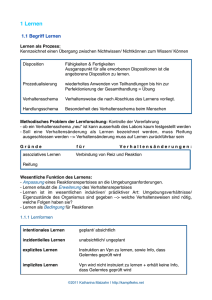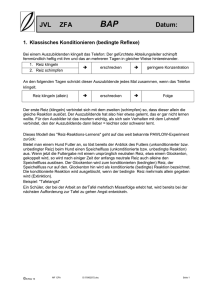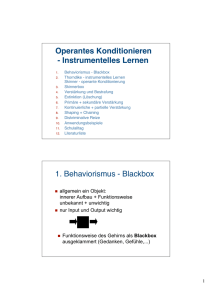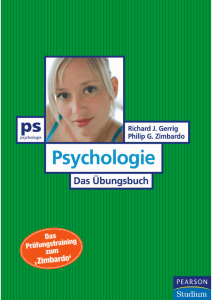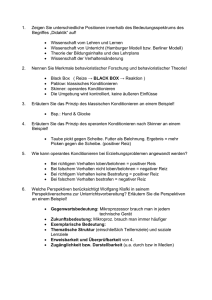Klassisches Konditionieren
Werbung
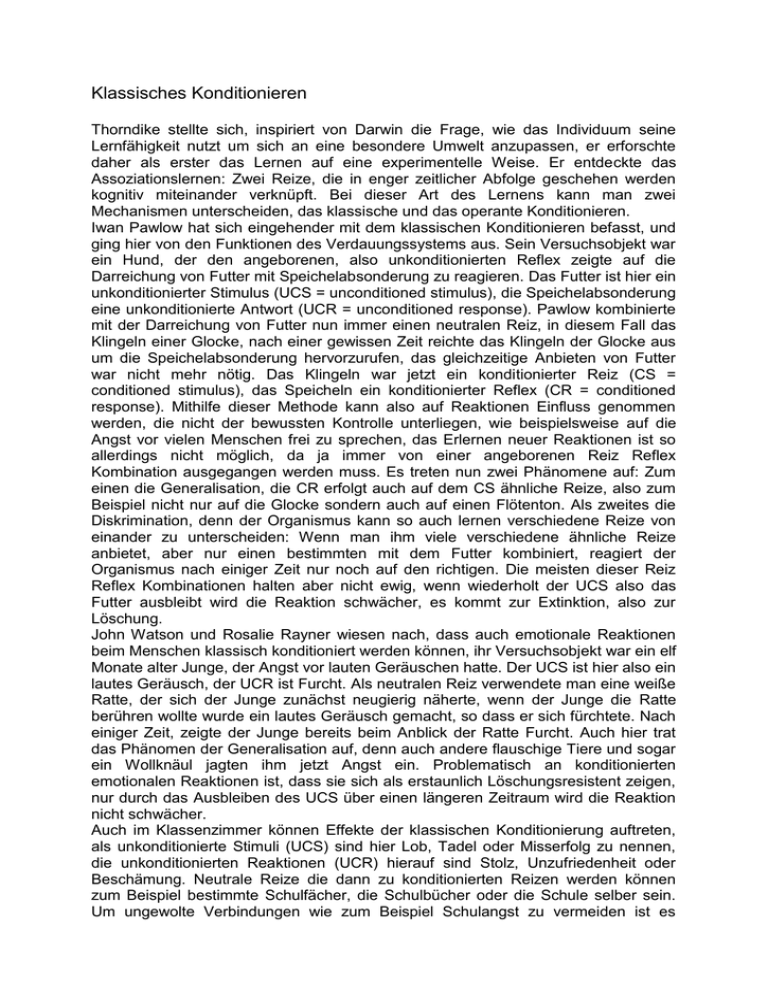
Klassisches Konditionieren Thorndike stellte sich, inspiriert von Darwin die Frage, wie das Individuum seine Lernfähigkeit nutzt um sich an eine besondere Umwelt anzupassen, er erforschte daher als erster das Lernen auf eine experimentelle Weise. Er entdeckte das Assoziationslernen: Zwei Reize, die in enger zeitlicher Abfolge geschehen werden kognitiv miteinander verknüpft. Bei dieser Art des Lernens kann man zwei Mechanismen unterscheiden, das klassische und das operante Konditionieren. Iwan Pawlow hat sich eingehender mit dem klassischen Konditionieren befasst, und ging hier von den Funktionen des Verdauungssystems aus. Sein Versuchsobjekt war ein Hund, der den angeborenen, also unkonditionierten Reflex zeigte auf die Darreichung von Futter mit Speichelabsonderung zu reagieren. Das Futter ist hier ein unkonditionierter Stimulus (UCS = unconditioned stimulus), die Speichelabsonderung eine unkonditionierte Antwort (UCR = unconditioned response). Pawlow kombinierte mit der Darreichung von Futter nun immer einen neutralen Reiz, in diesem Fall das Klingeln einer Glocke, nach einer gewissen Zeit reichte das Klingeln der Glocke aus um die Speichelabsonderung hervorzurufen, das gleichzeitige Anbieten von Futter war nicht mehr nötig. Das Klingeln war jetzt ein konditionierter Reiz (CS = conditioned stimulus), das Speicheln ein konditionierter Reflex (CR = conditioned response). Mithilfe dieser Methode kann also auf Reaktionen Einfluss genommen werden, die nicht der bewussten Kontrolle unterliegen, wie beispielsweise auf die Angst vor vielen Menschen frei zu sprechen, das Erlernen neuer Reaktionen ist so allerdings nicht möglich, da ja immer von einer angeborenen Reiz Reflex Kombination ausgegangen werden muss. Es treten nun zwei Phänomene auf: Zum einen die Generalisation, die CR erfolgt auch auf dem CS ähnliche Reize, also zum Beispiel nicht nur auf die Glocke sondern auch auf einen Flötenton. Als zweites die Diskrimination, denn der Organismus kann so auch lernen verschiedene Reize von einander zu unterscheiden: Wenn man ihm viele verschiedene ähnliche Reize anbietet, aber nur einen bestimmten mit dem Futter kombiniert, reagiert der Organismus nach einiger Zeit nur noch auf den richtigen. Die meisten dieser Reiz Reflex Kombinationen halten aber nicht ewig, wenn wiederholt der UCS also das Futter ausbleibt wird die Reaktion schwächer, es kommt zur Extinktion, also zur Löschung. John Watson und Rosalie Rayner wiesen nach, dass auch emotionale Reaktionen beim Menschen klassisch konditioniert werden können, ihr Versuchsobjekt war ein elf Monate alter Junge, der Angst vor lauten Geräuschen hatte. Der UCS ist hier also ein lautes Geräusch, der UCR ist Furcht. Als neutralen Reiz verwendete man eine weiße Ratte, der sich der Junge zunächst neugierig näherte, wenn der Junge die Ratte berühren wollte wurde ein lautes Geräusch gemacht, so dass er sich fürchtete. Nach einiger Zeit, zeigte der Junge bereits beim Anblick der Ratte Furcht. Auch hier trat das Phänomen der Generalisation auf, denn auch andere flauschige Tiere und sogar ein Wollknäul jagten ihm jetzt Angst ein. Problematisch an konditionierten emotionalen Reaktionen ist, dass sie sich als erstaunlich Löschungsresistent zeigen, nur durch das Ausbleiben des UCS über einen längeren Zeitraum wird die Reaktion nicht schwächer. Auch im Klassenzimmer können Effekte der klassischen Konditionierung auftreten, als unkonditionierte Stimuli (UCS) sind hier Lob, Tadel oder Misserfolg zu nennen, die unkonditionierten Reaktionen (UCR) hierauf sind Stolz, Unzufriedenheit oder Beschämung. Neutrale Reize die dann zu konditionierten Reizen werden können zum Beispiel bestimmte Schulfächer, die Schulbücher oder die Schule selber sein. Um ungewolte Verbindungen wie zum Beispiel Schulangst zu vermeiden ist es deshalb wichtig auf ein angenehmes Klassenklima zu achten, Tadel immer nur auf bestimmte Aufgabenstellungen zu beziehen und ein Klima der generellen Wertschätzung zu schaffen. Die Extinktion vorangegangener Konditionierungen ist wie oben erwähnt recht schwierig, wenn es sich um emotionale Reaktionen handelt, eine Möglichkeit hierzu ist die systematische Desensibilisierung, bzw. die Gegenkonditionierung: An dem Beispiel des oben erwähnten kleinen Jungens kann man sich hier seine Freude zu nutze machen, die er zeigt wenn er einen Keks oder sonst etwas Süßes bekommt. Man geht also von der Kombination aus unkonditioniertem Reiz (UCS = Keks) und unkonditionierter Reaktion (UCR = Freude) aus und bietet immer gemeinsam mit dem konditioniertem Reiz (CS = Kaninchen) den unkonditionierten Reiz (Keks) an, langsam wird dann das Kaninchen wieder zu einem neutralen Reiz. Bei den meisten konditionierten Verknüpfungen reicht jedoch ein einfacher Keks nicht aus, hier wird meistens mit Entspannungstechniken gearbeitet, da eine Entspannung eine mit Angst unvereinbare Reaktion darstellt. Der Patient wird behutsam und Schritt für Schritt an den Furchtreiz herangeführt, bis er die Furcht verliert. Zu Anfang der Behandlung muss er zu diesem Zweck eine Furchthierarchie aufstellen, bei Prüfungsangst wäre das z.B.: Ankündigung der Prüfung,.., Betreten der Schule am Prüfungstag,.., Lesen der Aufgaben. Der erste Reiz wird dann solange in Kombination mit Entspannungsübungen dargeboten bis er keine Furcht mehr hervorruft, dann wird zum nächsten Reiz fortgeschritten. Der Erfolg stellt sich vor allem durch den Extinktionsprozess ein, da bei der ständigen Reizdarbietung der UCS also die Prüfung ausbleibt. Operantes Konditionieren, instrumentelles Lernen Wie das klassische Konditionieren ist auch das instrumentelle Lernen eine behavioristische Theorie, sie geht also davon aus, dass die Umwelt das Verhalten kontrolliert. Thorndike geht davon aus, dass das Verhalten durch seine Konsequenzen geregelt wird, Lernen erfolgt also durch Versuch und Irrtum, Verhaltensweisen werden in einer zufälligen Abfolge gezeigt, ihre Konsequenzen überprüft und Verhaltensweisen dann ausgewählt oder verändert. Die Auftretenshäufigkeit einer Verhaltensweise erhöht sich bei einer positiven Konsequenz (satisfier) und erniedrigt sich bei einer negativen Konsequenz (anoyer). Das Verhalten wird so zu einem Instrument um angenehme Konsequenzen zu erreichen und unangenehme zu vermeiden. Der Unterschied zum klassischen Konditionieren besteht im Zeitpunkt wann der verhaltensbestimmende Reiz auftritt: beim klassischen Konditionieren vor der Verhaltensweise, beim instrumentellen danach. Skinner hat sich eingehender damit beschäftigt, wie man die Kontrolle über das Verhalten der Versuchstiere erlangen kann, er entwickelte dazu die sogenannte Skinnerbox, eine Vorrichtung in der Ratten durch Betätigen eines Hebels an Futter kommen konnten. Er entdeckte, dass nicht nur die Konsequenz das Verhalten bestimmt, sondern auch ein diskriminativer Reiz den Zeitpunkt, wann das Verhalten gezeigt wird festlegt. Diese vorausgehende Reizbedingung signalisiert dem Versuchstier ob zu diesem Zeitpunkt auch mit der entsprechenden Konsequenz für das Verhalten zu rechnen ist, z.B. wird man in der Schule gelobt wenn man still und brav an seinem Tisch sitzt und nicht schwätzt, wenn man sich dagegen mit Freunden trifft ist das kein erwünschtes Verhalten, die Schule ist hier also ein diskriminativer Reiz. Die Verhaltensweise wird zu einer Operation damit ein bestimmter Effekt eintritt, man nennt sie daher operantes Verhalten. Skinner spricht bei den Konsequenzen jedoch nicht von angenehm oder unangenehm, da er das Versuchstier als black-box betrachtet und daher nicht weiß was es fühlt, er definiert Verstärker als Reize, die die Auftretenswahrscheinlichkeit erhöhen und unterscheidet hier positive und negative Verstärker. Positiv bedeutet, dass ein bestimmter Stimulus hinzukommt, also z.B. Futter, Lob etc., negativ bedeutet, dass ein Stimulus beseitigt wird z.B. Schmerz. In der Schule wird viel mit der Vermeidung von aversiven Reizen gearbeitet, also z.B. einer drohenden Bestrafung wenn man die Hausaufgaben nicht macht, jedoch kann diese Methode zu vielen unerwünschten und unberechenbaren Nebeneffekten führen, z.B. zum Auftreten von Fluchtverhalten oder zu Trotzreaktionen. Zudem sind primäre und sekundäre Verstärker zu unterscheiden, primäre befriedigen den biologischen Bedarf des Körpers, sekundäre werden mit primären assoziiert, wie beispielsweise die Glocke beim Pawlowschen Hund, aber auch Geld ist ein sekundärer Verstärker, In der Schule sind hier meist Lob und Noten zu nennen. Sekundäre Verstärker müssen aber nicht immer wirksam sein, denn die assoziative Verknüpfung mit einem primären Verstärker muss vorhanden sein. Unter partieller Verstärkung versteht Skinner, dass der Reiz nicht immer auf das Verhalten folgen muss, dies geschieht auch im Alltag eher zufällig, mal wird man gelobt weil man etwas gut gemacht hat und mal nicht. Es ist daher auch nicht sinnvoll das Auftreten eines Verhaltens jedes Mal sofort zu loben, vielmehr eignen sich Intervallprogramme, d.h. die Verstärkung setzt erst ein wenn das Verhalten über einen bestimmten Zeitraum hinweg gezeigt wurde, oder Quotenprogramme, d.h. der Verstärker tritt erst dann auf wenn eine bestimmte Auftretensanzahl erreicht ist. Mithilfe dieses Lernmodells können im Gegensatz zum klassischen Konditionieren auch neue Verhaltensweisen gelernt werden, die nicht bereits im Repertoire sind, die Methode hierzu nennt man Verhaltensformung (shaping): Bereits ähnliches Verhalten wird verstärkt, wodurch sich die Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht und auch ähnliche Verhaltensweisen auftreten, von denen jeweils wieder die, die dem gewünschten am nähesten ist verstärkt wird, solange bis das gewünschte Endverhalten erreicht ist. Das Endziel wird also in verschiedene Teilziele zerlegt, so nähert man sich langsam dem Ziel an, auf diese Weise war Skinner in der Lage seinen Versuchstieren die komplexesten Kunststücke beizubringen. Eine Verminderung der Auftretenswahrscheinlichkeit erfolgt durch unterlassen der Verstärkung, das Auftreten sinkt bis es das Maß vor der Konditionierung erreicht, eine Löschung des Verhaltens ist so allerdings nicht möglich. Kurz nach Beginn der Extinktionsprozedur kann sich die Auftretenswahrscheinlichkeit noch erhöhen, aus Frustration des Objekts oder weil es versucht die Verstärkung zu erzwingen. Skinner spricht sich klar gegen das Unterdrücken eines Verhaltens durch Bestrafung aus. Wie bei der Verstärkung kann die Bestrafung positiv also durch Darbieten eines aversiven Reizes geschehen, oder negativ durch Wegnahme eines positiven Reizes. Problem dieser Methode ist vor allem, dass das Objekt zwar lernt was nicht erwünscht ist, aber nicht welches Verhalten es stattdessen zeigen soll. Außerdem lößt die Bestrafung negative Gefühle aus, die unter Umständen mit der Umgebung assoziiert werden. Sollte man dennoch auf diese Methode zurückgreifen muss sie zumindest konsequent erfolgen, da das Ausbleiben einer erwarteten Strafe Freude hervorruft und somit ein Verstärker ist. In der Schule fordert Skinner, dass unerwünschtes Verhalten ignoriert und dadurch gelöscht wird, während man gleichzeitig erwünschtes Verhalten durch Verstärkung aufbaut, Probleme ergeben sich hier allerdings dadurch, dass in der Klasse der Lehrer nicht der einzige ist der verstärken kann, sollte der Schüler von seinen Klassenkameraden für sein unerwünschtes Verhalten z.B. durch Aufmerksamkeit belohnt werden, hat das Ignorieren durch den Lehrer eher negative Folgen, da der Schüler als Modell für die anderen fungieren kann. Die oben erwähnten diskriminativen Reize geben Auskunft wann ein bestimmtes Verhalten zu zeigen ist, wann also mit einer Verstärkung gerechnet werden kann, damit wird über die Reize das Verhalten kontrolliert. Unter einer differentiellen Verstärkung versteht man nur dann zu verstärken wenn der diskriminative Reiz vorausgegangen ist. Behavioristische Lerntheorien hatten auf die schulische Arbeit einen großen Einfluss, sie forderten, dass man sich auf das beobachtete Verhalten konzentrierte und das gemäß der Theorien veränderte und keine Spekulationen über innere Vorgänge des Lernens anstellte. Auch begann man jetzt bei der Formulierung von Lernzielen, konkrete Begriffe zu verwenden, die sich auf beobachtbares verhalten beziehen, also nicht länger verstehen, wissen, sondern beschreiben, erklären, nennen können. Auch waren die Behavioristen der Auffassung, dass Leistungsunterschiede nicht auf Begabung zurückzuführen wären, sondern auf mehr Zeit, die einzelne zum Lernen benötigten. Auch mit der Funktion des Lobes haben sich die Behavioristen auseinandergesetzt, wenn das Lob eine informative Funktion hat dann hat es positive Konsequenzen, dann ist aber auch Kritik möglich. Kritisch wird das Lob wenn schwache Schüler für ihre Anstrengung gelobt werden, das bedeutet für sie eine negative Bewertung der Fähigkeiten. Deswegen sollten Lob und Kritik sich immer auf eine bestimmte Leistung beziehen. Sozial-kognitive Lerntheorie, Modelllernen Bandura gilt als Begründer des sozial-kognitiven Ansatzes, der seine Wurzeln im Behaviorismus hat, Skinners instrumentelles Lernen bot ihm keine ausreichende Erklärung für menschliches Verhalten, da es die Kognitionen zu wenig mit einbezog. Lernen geschieht für ihn nicht nur durch das Auswerten eigenen Verhaltens sondern auch durch das Beobachten anderer, so genannter Modelle. Während für Skinner die Umwelt das verhalten bedingt, interagieren für Bandura Umwelt und Verhalten, es liegt ein wechselseitiger Determinismus vor. Vier Prozesse bestimmen den Umfang des Modelllernens: Aufmerksamkeit, Erinnerung, Wiedergabe und Motivation. Erlernt werden neue Verhaltensweisen, veränderte Hemmschwellen, erregte Emotionen etc.. Bedingungen ob Verhaltensweisen auch gezeigt werden sind die Attraktivität zur Nachahmung und die beobachteten Konsequenzen des wahrgenommenen Verhaltens. Zwischen dem Lernen eines Verhaltens und seiner Ausführung ist also ein großer Unterschied: Das Lernen ist der Erwerb einer symbolischen Repräsentation in sprachlicher oder bildlicher Form, das Erlernte wird nur eventuell zu einer Leitlinie für späteres Verhalten. Ein wichtiger Mechanismus ist hierfür die stellvertretende Verstärkung: Wenn ein Verhalten bei einem anderen belohnt (oder bestraft) wird, übernimmt man es mit höherer (oder geringerer) Wahrscheinlichkeit, die Verstärkung informiert über den Wert des Verhaltens. Es gibt zwei Arten des Modelllernens: Das Imitieren und das Modellieren, letzteres ist keine exakte Kopie, eher ein Verhaltensstil, bzw. das Schema eines Verhaltens, z.B. generelle Aggression ohne bestimmte Form. Aus dem Beobachten gewinnt man Informationen, dies wird im Unterricht beispielsweise durch Vorrechnen erreicht, wobei andere Schüler ein besseres Modell abgeben als der Lehrer, da gleichaltrige als Modelle attraktiver sind. Beim Lösen von Aufgaben eignet sich hier zum Beispiel die Methode des kognitiven Modellierens: Der Lehrer als Modell erklärt und verbalisiert zusätzlich seine Gedanken zur Vorgehensweise, Denken wird also als inneres Sprechen dargestellt, durch das Vormachen werden die Schüler dazu angeregt Selbstgespräche zur Problemlösung zu nutzen. Beobachtungslernen baut wie oben erwähnt auf vier Komponenten auf: Zunächst muss die Aufmerksamkeit auf das Modell gelenkt werden, inwieweit diese Reizselektion gelingt hängt auch von den Merkmalen des Modells ab, beim Lehrer z.B. sein Fachwissen, sein Umgang mit Schülern etc.. Das Verhalten muss dann im Gedächtnis fixiert werden, das kann bildlich oder sprachlich geschehen, Wiederholungen können dabei helfen. Dann muss das Verhalten reproduziert werden um die Informationen im Gedächtnis zu vervollkommnen und Fehler zu bemerken. Mit diesen drei Phasen ist das Lernen des Verhaltens abgeschlossen, ob es dann auch übernommen und angewendet wird entscheidet die Motivation, diese ist von Verstärkern abhängig, bei denen man drei Arten unterscheiden kann: Direkte Verstärkung bei Nachahmung, stellvertretende Verstärkung am Modell, dies wird viel in der Werbung eingesetzt, und Selbstverstärkung: Diese ist wichtig, da die Verstärkung durch Außenstehende nicht immer möglich ist, darum sollte die Kontrolle an den Schüler abgegeben werden, er lernt Selbstkontrolle und selbstgesteuertes Lernen. Hier unterscheidet sich Bandura sehr von den Behavioristen, die den Schüler als passiven Empfänger von Informationen sehen, er spricht ihnen einen aktiven Beitrag zur Erreichung von Lernzielen zu. Die Motivation zur Selbstkontrolle hängt jedoch davon ab, ob der Schüler weiß wie er das tun soll, also von seinem instrumentellen Wissen und davon ob er glaubt das tun zu können, also von seiner Selbstwirksamkeitserwartung. Diese ergibt sich durch Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Selbstreaktion, sie ist aber nicht mit dem Selbstwertgefühl gleichzusetzen, da sie viel aufgabenspezifischer ist. Manchmal erweist sich die Selbstwirksamkeitserwartung als wichtiger als die tatsächlichen Fähigkeiten. Auf die wahrgenommene Selbstwirksamkeit nimmt sowohl die bisherige Erfolgsgeschichte Einfluss, als auch stellvertretende Erfahrungen von Leuten, die einem ähneln, außerdem sind ermunterndes Zureden und der physiologische Erlebniszustand (Nervosität, Herzklopfen...) relevant. Bei selbstgesteuertem Lernen ist die Festlegung der Lernziele von großer Bedeutung, dabei ist es manchmal sogar gut sich leicht zu überschätzen. Optimismus ist zwar günstig aber die Erwartungen sollten nicht zu unrealistisch werden. Das Erreichen von naheliegenden Zielen gibt schnelle Erfolge und wirkt sich so günstig auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus. Zu leichte oder zu schwere Ziele werden selten gewählt, die ersteren bieten kein Erleben der eigenen Wirksamkeit, die zweiten bieten keine Aussicht auf Erfolg. Kinder die sehr wenig selbstständig lernen durften führen häufig ihre Leistungen auf äußere Faktoren z.B. Glück zurück, statt auf die eigenen Fähigkeiten. Um sich selbst beurteilen zu können müssen die eigenen Aktivitäten beobachtet werden, damit man gegebenenfalls sein Verhalten ändern kann. Eine Bewertung setzt einen Maßstab voraus, dieser kann absolut sein, sich also zum Beispiel an der Anzahl der geschriebenen Seiten orientieren, man überprüft also ob ein festgelegtes Ziel erreicht wurde. Ein sozial-bezogener Gütemaßstab zieht den Vergleich der eigenen Leistungen mit denen relevanter anderer heran, ein individual bezogener Maßstab dagegen vergleicht mit eigenen Leistungen bei der Bewältigung von ähnlichen Aufgaben in der Vergangenheit. Welche Maßstäbe man anwendet wird meist durch Beobachtungslernen entschieden, was die meist sozialen Bezugsnormen der Schule als noch problematischer erscheinen lässt. Selbstverstärkung ist die eigene Belohnung nach Erfüllen des Solls, z.B. durch eine Pause oder ein Stück Schokolade, der Sollwert wird nach dem eigenen Selbstwirksamkeitsmaßstab definiert, hier ergibt sich eine Wechselwirkung zwischen der eingeschätzten Selbstwirksamkeit, den formulierten Zielvorstellungen und den Verstärkungskonsequenzen. Gedächtnismodelle, Multispeichermodell, Teilprozesse der Informationsverarbeitung Im Gegensatz zu den behavioristischen Theorien, konzentrieren sich die Informationsverarbeitungstheorien nicht auf von außen beobachtbare Prozesse sondern auf innere Vorgänge. Der Mensch wird mit einem Computer verglichen, der Informationen aufnimmt, verarbeitet, speichert und zu gegebenem Zeitpunkt wieder abruft, das bedeutet auch hier ist der Mensch eher passiv. Eine konstruktivistische Sichtweise des Lernens sieht den Lernenden aktiv, er verarbeitet neue Informationen vor dem Hintergrund der alten, auf seine besondere Weise. Er wählt Informationen individuell aus, verarbeitet sie individuell und wendet je nach Vorwissen bestimmte Lernstrategien an. Das Gedächtnis kann mit einer Bibliothek verglichen werden, Informationen werden katalogisiert, gespeichert und zur Benutzung ausgeliehen, also abgerufen. Man kann automatische Verarbeitung von anstrengungsabhängiger unterscheiden, manche Informationen werden ohne aktives Zutun im Gedächtnis gespeichert, zum Beispiel was man gestern gegessen hat, andere Informationen benötigen für die Übertragung ins Gedächtnis einen erhöhten Aufwand, z.B. das Auswendiglernen eines Gedichtes. Das Multispeichermodell nimmt im Gedächtnis drei Komponenten an: Das sensorische Register, das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Im sensorischen Register erfolgt eine kurzzeitige Speicherung von Nervenimpulsen ohne das diese verarbeitet werden, hier wird z.B. Sprache noch nicht als solche erkannt, nur das akustische Signal wird gespeichert. Von dieser Fülle an Informationen, denn alles was die Sinnesorgane melden gelangt hierher, wird nur ein geringer Teil ins Arbeitsgedächtnis transferiert um dort weiterverarbeitet zu werden, ansonsten wäre es mit der Vielzahl an Informationen völlig überfordert. Die Auswahl erledigt die Aufmerksamkeit, um diese zu erregen sollte der Unterricht abwechslungsreich gestaltet werden. Sinnvolle Einheiten werden von Wahrnehmungsprozessen zusammengefügt, hierzu erfolgt ein Vergleich mit dem Langzeitgedächtnis, dies geschieht durch Automatisierungsprozesse um die enge Aufmerksamkeit nicht zu überfordern. Das Lesen ist ein Beispiel hierfür, Wortbilder werden mithilfe des Langzeitgedächtnisses wiedererkannt, so kann man die Aufmerksamkeit auf den Inhalt des Textes lenken. Auch Erwartungen spielen bei der Interpretation von Sinnesreizen und deren Zusammenfassung zu sinnvollen Einheiten eine Rolle, Beispiel hierfür sind die Wahrnehmungsprozesse bei Kippbildern. Die Kapazität des sensorischen Registers ist ernorm, die Speicherzeiten dagegen sind sehr gering, da ständig neue Informationen eindringen werden die alten sofort gelöscht und ersetzt. Das Kurzzeitgedächtnis stellt sozusagen den Arbeitsplatz dar, sinnvolle Einheiten aus dem sensorischen Register werden hier aktiv verarbeitet, und die Umweltinformationen mit den Einträgen des Langzeitgedächtnisses in Beziehung gesetzt, bewusstes Denken geschieht hier. Die Speicherkapazität ist vergleichsweise gering, etwa fünf bis neun, meist aber sieben Items, die Speicherzeit beträgt etwa 2030 Sekunden, kann aber durch lautes oder leises Wiederholen der Information erhöht werden. Hieran sieht man auch wie wichtig das Automatisieren des Lesens ist, da der gesamte Satz im Kurzzeitgedächtnis vorhanden sein muss, damit man den Sinn erkennt. Die engen Grenzen der Speicherkapazität können beispielsweise durch das Zusammenfassen mehrerer Einzelitems zu größeren Items überwunden werden, statt sich einzelne Buchstaben zu merken, merkt man sich besser das Wort das sie bilden. Um die Behaltensdauer zu erhöhen müssen die neuen Informationen mit alten aus dem Langzeitgedächtnis in Beziehung gesetzt werden, dies ist der Prozess des Verstehens. Hieran sieht man wie wichtig das Vorwissen für das Erlernen von neuem ist. Die Verarbeitung kann auf verschiedenen Ebenen geschehen, oberflächlich ist beispielsweise das Erlernen von Reihen aus Buchstaben, phonologisch ist das Erlernen von Ketten aus Reimen, etwas semantisch zu Lernen bedeutet seine Bedeutung zu erschließen. Die beste Behaltensleistung ergibt sich bei einer semantischen Verarbeitung, noch besser allerdings merkt man sich Dinge bei denen der Selbstbezugseffekt dazu kommt, wenn man also Informationen mit sich selbst, z.B. den eigenen Erfahrungen in Verbindung setzen kann. In das Langzeitgedächtnis können so gut wie keine sinnlosen Informationen transferiert werden, Silbenketten beispielsweise werden ohne ständiges Üben bald wieder vergessen. Im Langzeitgedächtnis finden sich verschiedene Repräsentationsformen, Informationen können verbal, bildlich oder mit einem Handlungsbezug gespeichert werden. Es ist aber nicht nur Aufgabe des Langzeitgedächtnisses Informationen zu speichern sondern sie auch abrufbereit zu halten, und durch logische Schlüsse Antworten zu geben. Bei dem gespeicherten Wissen, kann man deklaratives Wissen von prozeduralem unterscheiden, ersteres enthält Fakten, Tatsachen und Theorien, letzteres bezieht sich auf Handlungsabläufe und Strategien, das eine enthält also das was, das andere das wie. Repräsentationsformen Begriffsbildung von Wissen (Schema, Netzwerke, Propositionen) + Das Schema ist nach Bartlett eine geordnete Wissensstruktur, also das Wissen über ein Ereignis oder einen Gegenstand, das auf der Grundlage vorangegangener Erfahrungen entstanden ist, bedeutsame Reizgegebenheiten sind hier in abstrakter Form zusammengefasst. Schemata sind kontextspezifisch, es gibt zum Beispiel Alltagsschemata die in wissenschaftlichen Betrachtungen eher unzureichend sind, außerdem können Schemata auch Gefühle enthalten. Propositionen sind Zusammenhänge innerhalb von Schemata, wenn man beispielsweise behauptet Vögel können fliegen, hat man das Schema Vogel mit dem Schema fliegen verbunden. Das Schema ist eine kognitive Repräsentation von Begriffen, da es im Alltag unmöglich ist Einzelheiten zu beachten, werden diese vernachlässigt, es wird also z.B. festgestellt etwas ist rot, der genaue Farbton jedoch wird vernachlässigt, es genügt eine Einordnung in eine bestimmte Kategorie. Begriffe sind also nichts anderes als Kategorien, durch diese Einordnung verringert sich die Komplexität, die Informationsfülle wird überschaubar. In den Schemata liegen vorausgegangene Informationen in geordneter Form vor, Beobachtungen kann so eine Bedeutung zugeordnet werden. In die Begriffskategorien lassen sich Vorstellungen und Ereignisse einordnen die bestimmte Gemeinsamkeiten haben, es gibt aber zwei verschiedene Methoden wie man die Kategorien bilden kann: nach relevanten oder charakteristischen Merkmalen. Bei der Kategorisierung nach einer bestimmten Anzahl von relevanten Merkmalen werden festliegende Regeln herangezogen welche Objekte oder Ereignisse in den Begriff eingeordnet werden können. Das Erlernen eines Begriffs bedeutet also das Erlernen der Definition des Begriffs also der Regeln zur Einordnung. Eine Kategorie ist definiert durch eine kleine Anzahl relevanter Merkmale, um zu der Kategorie zu gehören müssen alle Merkmale erfüllt sein, innerhalb einer Abstraktionsebene lassen sich alle Begriffe klar voneinander unterscheiden. Beispielsweise ist ein Viereck kein Kreis, beides sind aber geometrische Figuren. Alle Merkmale sind gleichgewichtig. Ein Beispiel für eine derartige Kategorisierung ist der Begriff Vogel: Ein Vogel ist ein Tier das hartschalige Eier legt, das Fliegen dagegen ist kein relevantes Merkmal, da Pinguine Vögel sind ohne zu fliegen. Viele natürliche Begriffe sind jedoch nur schwer so zu kategorisieren, da die Grenzen nicht genau festgelegt werden können, z.B. ist es schwer zu sagen wann man eine Tasse und wann einen Becher vor sich hat. Die zweite Möglichkeit der Kategorisierung ist nach charakteristischen Merkmalen, dies ist dann eher unscharf (fuzzy), trifft auf die Umwelt also eher zu. Die einzelnen Inhalte eines Begriffs weisen sehr wohl Ähnlichkeiten und Beziehungen untereinander auf, es gibt aber keine Merkmale, die allen gemein sind. Die Ordnung erfolgt nach Prototypen, also besten Beispielen, sie sind quasi ein Mittelwert über alle Inhalte des Begriffs, die Einordnung erfolgt über einen Vergleich mit diesem Prototyp, wenn sich die Ähnlichkeit innerhalb tolerierbarer Grenzen bewegt. Für den Begriff Vogel würde das bedeuten: Er hat Federn, Flügel, einen Schnabel, fliegt und ist nicht allzu groß. Ein Pinguin kann nicht fliegen ist aber trotzdem ähnlich genug, auch der Vogel Strauß kann nicht fliegen, und ist zudem zu groß fällt aber immer noch in die Kategorie, ein Schnabeltier hat zwar einen Schnabel, ist aber der Kategorie Vogel doch zu unähnlich. Welcher Prototyp aktiviert wird ist auch situationsabhängig, man kann für eine Kategorie mehrere Prototypen haben, für Vögel sind sowohl Spatzen als auch Adler charakteristische Vertreter. Die unterschiedlichen Merkmale können bei der Prototypentheorie auch unterschiedlich gewichtet sein. Bei allen Begriffen werden wohl beide Repräsentationsformen vorliegen, die erste Kategorisierung ist eher wissenschaftlich, die andere eher alltagstauglich. In der Schule wäre es wohl dennoch ungeschickt bei der Behandlung von Vögeln über die Definition als Tiere die hartschalige Eier legen einzusteigen, damit das neue Wissen an das alte angeknüpft werden kann, erst später kann auf diese formale Definition eingegangen werden. Begriffe sind kognitive Werkzeuge, die in alltäglichen Situationen angewandt werden, sie enthalten also nicht nur die Merkmale sondern auch Informationen über den Umgang damit, also Erfahrungen die damit gemacht wurden. Für die Schule ist es deshalb wichtig nicht nur Begriffe gegeneinander abzugrenzen sondern authentische Lernsituationen zu schaffen, die also Ähnlichkeit mit außerschulischen Erfahrungswelten haben, um Erfahrungen im Umgang mit dem Gelernten zu ermöglichen. Außerdem beinhalten Begriffe Vorgehensweisen zur Klassifikation und Identifikation, Beziehungen zu ähnlichem Wissen, affektive Assoziationen und Regeln zur Anwendung in bestimmten situativen Feldern. Auch all diese zusätzlichen Elemente müssen in der Schule mit dem Begriff gelernt werden. Wissen ist aber nicht nur eine Sammlung von Begriffen, sondern eine Ordnung dieser Begriffe durch Verknüpfungen untereinander, diese Verknüpfungen werden Propositionen genannt. Nach Anderson sind alle sprachlichen wie visuellen Gedächtnisinhalte solche Verknüpfungen, eine Proposition ist dabei die kleinste Bedeutung, Sinn oder Eigenschaft zuweisende Informationseinheit, die ein Urteil zulässt, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Aus Begriffen und Propositionen geben sich große propositionale Netzwerke, sie beschreiben Beziehungen von Informationseinheiten zueinander. Das Abspeichern erfolgt also nicht in Form von ganzen Sätzen, nur die Bedeutung wird in einem derartigen Netzwerk erfasst, deshalb ist auch eine Formulierung in eigenen Worten ein Zeichen von tiefer Verarbeitung. Propositionen sind aber nicht die einzigen sinnvollen Einheiten im deklarativen Gedächtnis, auch bildhafte Vorstellungen erfüllen diese Funktion. Diese werden meist besser behalten als sprachliche Informationen, sie geben auch Aufschluss über Größen und Größenverhältnisse, man kann sie sich aber nicht wie kleine Fotos vorstellen. Es gibt nicht nur Schemata über einzelne Informationszusammenhänge sondern auch über typische Ereignisabläufe, diese werden als Skripts (Drehbücher) bezeichnet, sie beziehen sich auf das eigene Verhalten in bestimmten Situationen, wie man z.B. in einem Restaurant essen geht, aber auch auf Vorgänge in der Umwelt, wie mentale Modelle, diese müssen aber nicht zwangsläufig mit der Realität oder physikalischen Gesetzmäßigkeiten übereinstimmen. Schemata sparen Speicherplatz indem sie Bekanntes aktivieren, zu sehen ist dies im folgenden Versuch: Setzt man Personen in ein Arbeitszimmer und fordert sie danach auf aufzuzählen was darin enthalten war erinnern sie sich an typische Gegenstände (Schreibtisch, Bücher..) von denen einige gar nicht vorhanden waren, nicht aber an die untypischen Gegenstände (Picknickkorb, Weinflasche..). Erklären kann man sich das dadurch, dass keine aktive Wahrnehmung der Umgebung stattgefunden hat, stattdessen wurde das Schema Arbeitszimmer aktiviert. Ein Schema enthält aber auch freie Plätze, in die man bestimmte Merkmale der augenblicklichen Situation einsetzen kann, z.B. die Größe des Arbeitszimmers oder die Anzahl der Fenster oder andere Besonderheiten. Diese Schemaaktivierung führt zu der bekannten Tatsache, dass man meist nur sieht was man sehen will, in drastischen Fällen liegt hier die Ursache für Vorurteile. Nach Anderson ist das deklarative Gedächtnis in Netzwerken organisiert, durch die alle Gedächtnisinhalte miteinander verbunden sind, die Knoten sind Propositionen, Skripts, bildhafte Vorstellungen oder Schemata, die Verbindungen, also Beziehungen dazwischen können unterschiedlich stark sein und sind meist inaktiv, wenn man sich nicht grade mit diesem Inhalt beschäftigt. Nach Anderson ist das Kurzzeitgedächtnis nichts weiter als der aktivierte Teil des Langzeitgedächtnisses, diese Aktivierung breitet sich auf benachbarte Knoten aus, woraus sich weitere Gedanken ergeben, beim Lernprozess werden die neuen Informationen so mit den alten verknüpft. Wenn eine neue Information dargestellt wird übersetzt man sie zunächst in Propositionen, aktiviert dann relevante Erinnerungen an Zusammenhänge, diese Aktivierung breitet sich aus, und durch schlussfolgernde Prozesse können neue Propositionen geschaffen werden, das neue Wissen wurde aufgearbeitet und fügt sich jetzt in das vorhandene Netz ein. Gedächtnis- und Lernstrategien, Theorien des Vergessens Da Informationen durch Elaboration, also Erarbeitung vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis transferiert werden ist es sinnvoll Lernmaterial mit hohem Ordnungs- bzw. Organisationsgrad anzubieten, damit Sinnzusammenhänge leichter erkannt werden. Der Verarbeitungsprozess hängt von der Aufmerksamkeit und der Länge und Intensivität der Beschäftigung mit dem Lernmaterial ab, ein schneller und treffsicherer Abruf aus dem Gedächtnis kann nur durch aktive, also übende Auseinandersetzung gewährleistet werden. Die Konstruktion von eigenem Wissen ist abhängig davon ob einem das Lernmaterial sinnvoll erscheint, ist es potentiell sinnvoll kann das Lernen durch das Interpretieren von eigenen Erfahrungen geschehen. Die Lehrerdarstellung muss also klar sein, d.h. durch Abbildungen und Beispiele unterstützt werden, einer logischen Ordnung folgen etc.. Durch viele Vergleiche erreicht man eine Aktivierung von bereits vorhandenen Kenntnissen an die Neues aktiv assimiliert werden kann, außerdem werden die neuen Informationen leichter vorstellbar und konkreter, sie erhalten eine Ordnung. Die Aufarbeitung des Lernmaterials kann auch durch präinstruktionale Maßnahmen unterstützt werden: Durch aufarbeitende (elaborierende) Wiederholung kann eine Verknüpfung des neuen Lernmaterials mit bereits im Langzeitgedächtnis vorhandenem erreicht werden, eine Erhöhung der Anzahl der Assoziationen bewirkt eine festere und vielfältigere Verknüpfung und erhöht damit die Chancen für einen erfolgreichen Abruf. Vor dem Unterricht müssen die Schüler auf das neue Material eingestellt werden, beispielsweise durch Vortests, Lernziele, Überblicke oder vorangestellte Einordnungshilfen. Ein Vortest lenkt die Aufmerksamkeit auf nachfolgende Informationen, insbesondere bei komplexeren Texten ist es wichtig durch konkrete Fragestellungen die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Stellen zu lenken, da sie sonst überlesen werden könnten. Zentrale Aussagen können durch vorausgehende Übersichten vorweggenommen werden, die nachfolgende Lerneinheit wird also auch mithilfe von Fotos oder Zeichnungen zusammengefasst, die zentralen Begriffe werden so zu Abrufreizen. Wenn der Kontext durch vorangegangene Einordnungshilfen dargestellt wird erhalten die Schüler ein geistiges Gerüst, in dem neues verankert werden kann. Analogien öffnen z.B. ein vorhandenes Schema, so das neue Informationen in der selben Organisation eingeordnet werden können. Auch der Lernende kann Strategien nutzen um die dargestellten Informationen tiefer zu verarbeiten: Statt der passiven Aufnahme von Lerninhalten muss er sie aktiv elaborieren. Das gängige Markieren von Textteilen ist jedoch nicht immer sehr wirkungsvoll, das einzig verarbeitende daran ist der Entscheidungsprozess welcher Textteil wichtig ist, da meist zuviel markiert wird sollte man sich auf einen Satz pro Absatz beschränken, dennoch bleibt die Verarbeitung so eher oberflächlich. Das Anfertigen von eigenen Notizen ist geeigneter, es wird eine bessere Behaltensleistung erreicht, da die Aufmerksamkeit für einen längeren Zeitraum gehalten wird. Das Ergänzen von Abrufreizen ist hier besonders wirksam, dies sind Etiketten, quasi Adressen unter denen die Informationen abgelegt werden, sie werden erst nach Erstellen der Notizen hinzugefügt. Die Qualität der Notizen ist jedoch sehr vom Lehrenden abhängig, von der Zeit die er aufwendet, ob er eine Tafelanschrift macht, ob er die Abrufreize nennt und Wichtiges öfter wiederholt, ob er Schlüsselbegriffe anschreibt und ob sein Vortrag klar gegliedert ist. Eine Zusammenfassung des Lernmaterials zu erstellen ist ebenfalls eine wirksame Strategie, denn das Ausdrücken mit eigenen Worten setzt ein tieferes Verständnis voraus. Zunächst muss das Wichtige vom Unwichtigen getrennt werden, dann müssen die Einzelinformationen zu allgemeineren Gedanken verdichtet werden und zuletzt müssen zwischen diesen die Zusammenhänge gefunden werden. Je kürzer die Zusammenfassung desto stärker das Lösen vom Vorgegebenen. Gelenktes kooperatives Fragen hilft auch bei der Verarbeitung des Lernmaterials, nicht nur bei der Beantwortung der Fragen sondern auch beim Entwerfen geeigneter Fragen wird das Verständnis gefördert, dies hängt jedoch vom Niveau der Fragen ab. Mapping, also die graphische Zusammenfassung des Gelernten in einem Beziehungsgeflecht, ähnlich einer Landkarte setzt ebenfalls tiefe Verarbeitung voraus. Um die eigenen kognitiven Prozesse optimieren zu können muss man sie kontrollieren und steuern können, Kenntnisse über das eigene Denken nennt man Metakognition, diese Fähigkeit erwerben Kinder erst recht spät. Das Wissen über eigene Aufmerksamkeitsprozesse nennt man analog Metaaufmerksamkeit, wenn man dieses Wissen hat kann man sie kontrollieren und sich so zu längerer Aufmerksamkeit zwingen. Hilfsreize, wie eine besondere Betonung der Schlüsselbegriffe durch den Lehrer, können helfen Wichtiges zu erkennen und so die Aufmerksamkeitssteuerung erleichtern. Unter Metagedächtnis versteht man das Wissen über eigene Gedächtnisprozesse und wie man diese kontrollieren kann. Dieses Wissen findet seine Anwendung in Gedächtnisstrategien. Bei jüngeren Kindern ist die Einschätzung der eigenen Gedächtnisleistung meist viel zu optimistisch. Strategien zum Erreichen einer größeren Behaltensleistung sind z.B. erhaltendes Wiederholen, eine Information wird solange reproduziert bis sie gemerkt wurde, Ordnen des Lernmaterials nach Oberbegriffen oder Erfinden einer Rahmenhandlung. Die Strategiewahl hängt vom Alter ab, und auch der Schulbesuch hat hier einen Einfluss, der Lehrer kann Gedächtnisstrategien vermitteln, wobei er jedoch darauf achten sollte, dass die Strategien altersgemäß sind. Aber nur die Kenntnis der Strategie bedeutet nicht, dass sie genutzt wird, entweder weil sie einem im entsprechenden Moment nicht einfällt, der Lehrer sollte also ab und zu daran erinnern, oder weil man sie für nutzlos hält, der Lehrer muss also Überzeugungsarbeit leisten. Am besten ist das Lernen in Bereichen möglich in denen bereits Vorkenntnisse vorhanden sind, für das mechanische Auswendiglernen kann man sich Mnemotechniken zu Nutze machen, beispielsweise das Umwandeln des Lernmaterials in bildhafte Vorstellungen: Exemplarisch hierfür ist die Schlüsselwortmethode, die sich besonders für das Erlernen von Vokabeln eignet. Zunächst sucht man sich ein deutsches Wort, das der Vokabel ähnelt (book – Bug), dann bildet man zwischen dem Wort und der Übersetzung der Vokabel eine Assoziation (das Buch ist im Bug), dann entwirft man hierzu eine bildhafte Vorstellung (wie das Buch auf einem Schiff im Bug liegt). Die Kontextmethode bietet eine Einbettung in einen Text an, die Kombination beider Methoden ist am sinnvollsten, jedoch können sich jüngere Kinder besser akustische Eselsbrücken, wie Reime merken. Ein beachtlicher Teil dessen, was man lernt wird wieder vergessen, doch bevor man von wirklichem Vergessen sprechen kann, muss erst geprüft werden wieweit die Information gelangt ist, beim Löschen aus dem sensorischen Register oder aus dem Kurzzeitgedächtnis ist nicht von Vergessen zu sprechen, dies ist erst im Langzeitgedächtnis möglich. Die Theorie des Spurenzerfalls sieht die Ursachen des Vergessens nicht in der Zeit, sondern in Kräften, die während dieser Zeit wirken. Die Interferenztheorie greift beim Lernen von sinnlosen Silben, je mehr davon bereits gelernt wurden desto schlechter wird die Behaltensleistung. Unter einer proaktiven Hemmung versteht man das frühere Lernarbeit spätere beeinträchtigt, andersherum beeinträchtigt bei einer retroaktiven Hemmung späteres Lernen das vorher Gelernte. Beides geschieht hauptsächlich wenn sich die Lernmaterialien sehr ähneln, dies ist aber nicht nur bei Sinnlosem der Fall sondern auch z.B. bei Sprachen oder Geschichte. Eine weitere Theorie nimmt das Fehlen geeigneter Abrufreize an, die Information ist dabei gar nicht wirklich gelöscht, nur der Abruf gelingt nicht mehr, bekannt ist das durch das es-liegt-mir-auf-der-Zunge Gefühl. Manche behaupten sogar, dass nichts jemals aus dem Langzeitgedächtnis gelöscht wird, und das alles Vergessen auf solche Prozesse zurückzuführen ist. Gestützt wird diese Theorie durch die Tatsache, dass man sich am besten erinnert wenn bei der Abrufsituation die selbe Reizgegebenheit vorliegt wie bei dessen erlernen. Man sieht darin ein Problem wenn Prüfungen in fremden Klassenzimmern abgehalten werden, es besteht hier eine erhöhte Gefahr des Blackouts. Problemlösen, Intelligenz Wenn man das Problemlösen behandelt muss man sich zunächst über die Intelligenz Gedanken machen, die ja die Fähigkeit darstellt Probleme zu lösen. Intelligenz wird erworben, zwei sich streitende Interessenlagen beschäftigen sich mit diesem Gebiet, die einen zur Selektion, die anderen zur Förderung. Seit dem 19ten Jahrhundert bemüht man sich Methoden zur Messung zu finden, bei denen es eher nebensächlich war was genau gemessen wurde, der Zweck der Messungen war Selektion. Orientiert an Darwins Evolutionstheorie galt Intelligenz als angeborene Fähigkeit, was folgen für die Behandlung von Geistesschwachen in vielen Ländern hatte, diese durften sich zum Beispiel nicht fortpflanzen. Intelligenz ist aber keine stabile sondern eine veränderbare Größe, zudem messen die meisten Intelligenztests nicht die allgemeine Anpassung, sondern die Anpassung an die jeweilige Kultur. Statt eine Form der Intelligenz findet man sieben Formen der multiplen Intelligenz: sprachlich, logisch-mathematisch, räumlich, musikalisch, körperlich-kinästhetisch, interpersonal und intrapersonal. In der Schule sind meist die mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten überbetont. Die einzelnen Felder sind voneinander unabhängig, in einem nicht begabt zu sein bedeutet nicht, dass man in allen Bereichen Probleme hat, normalerweise liegt bei jedem Menschen eine Stärke in zumindest einem dieser Bereiche vor. Intelligenz ist zudem eine veränderbare Fähigkeit, da jedes Kind im Prinzip die selbe Entwicklung durchmacht und sich nur das Tempo unterscheidet werden alterstypische Intelligenztests angesetzt, das Ziel ist fördern und nicht selektieren. Die Veränderung der Intelligenz führen Informationsverarbeitungstheoretiker auf Veränderungen in verschiedenen Bereichen zurück: eine Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung, und der Speicherkapazitäten durch Automatisierungsprozesse zum Beispiel. Intelligenztestergebnisse können nur selten auf das Verhalten im Alltag angewandt werden, da Problemlösungsfähigkeiten in hohem Maße kontextbezogen sind. Problemlösen ist nach Dewey die Auseinandersetzung mit verschiedenartigen Lebensbedingungen, in der modernen Industriegesellschaft setzt das Lösen von Problemen meist Vorkenntnisse voraus (Lesen, Mathematik, etc.), diese werden in der Schule erworben, müssen aber so verarbeitet sein, dass eine Anwendung möglich wird. Problemlösen kann durch Versuch und Irrtum geschehen, oder aber durch Einsicht in die Problemsituation, im einen Fall finden äußere Aktivitäten statt, im anderen innere. Ein Problem ist gekennzeichnet durch eine Diskrepanz zwischen Ausgangszustand und erstrebtem Ergebnis, also zwischen Ist und Soll, diese Diskrepanz wird durch die Lösung behoben. Je nach Komplexität des Problems ist die Lösung nicht unbedingt nur eine einzelne Maßnahme, es können Teilziele bestehen mit deren Hilfe man sich an das Hauptziel annähert. Die Lösung erfordert die Identifikation und Anwendung von relevanten Regeln, Kenntnissen und kognitiven Strategien. Man kann zwei Arten von Problemen unterscheiden: Well defined problems und ill defined problems, erstere werden meist in der Schule behandelt, das Ziel ist klar, die benötigten Informationen liegen vor und es gibt klare Kriterien wann die Antwort richtig ist. Bei letzteren ist das zu erreichende Ziel unbestimmt, das führt zu einer Unsicherheit beim Lösungsweg, und eine angemessene Lösung kann nicht mithilfe fester Kriterien von einer unangemessenen unterschieden werden. Die zweite Art von Problemen trifft man im Alltag öfter an als die erste Art. Lösungsverfahren können algorithmisch oder heuristisch sein ersteres ist geeigneter für well defined problems, zweites für ill defined problems. Ein Algorithmus ist eine Strategie, die einem die Lösung garantiert, wenn man die Regeln beachtet, ein Rezept zum Kuchenbacken ist ein Beispiel dafür, jedoch liegt nicht für jedes Problem ein Algorithmus vor, und unter bestimmten Umständen, wenn zum Beispiel der Algorithmus vorschreibt, dass alle Möglichkeiten durchprobiert werden, kann das Verfahren recht langwierig sein. Heuristische Verfahren greifen auf Faustregeln oder intelligente Abkürzungen zurück, es werden also eher allgemeine Strategien angewandt, eine Lösung kann so nicht garantiert werden, eine Mittel Ziel Analyse kann die Wahrscheinlichkeit aber erhöhen: Nacheinander werden Maßnahmen angewandt die einen dem Ziel schrittweise näher bringen. Kreatives Problemlösen, das oft wie eine spontane Eingebung erscheint ist dagegen nur schwer zu erklären, nur wenige sind dazu in der Lage. Nach einer ausführlichen Beschäftigung mit dem Problem, lassen sich diese um einige kognitive Stufen zurückfallen und sehen so Lösungswege, die anderen unmöglich scheinen. Wie kontextabhängig Problemlösen ist, sieht man am Vergleich von Experten und Novizen bei der Auseinandersetzung mit Problemen. Ein Experte weist einen großen Erfahrungshintergrund in einem bestimmten Gebiet auf, zum Beispiel können sich sehr gute Schachspieler Figurenkombinationen auf einem Schachbrett deutlich besser merken als Nicht Schachspieler (also Novizen), da sie die Anordnung nicht als zufällig betrachten, sondern sie aus dem Spiel heraus verstehen. Experten haben also umfangreiche bereichsgebundene Kenntnisse, sowohl deklarativer als auch prozeduraler Natur, sie erkennen die bedeutsamen Gegebenheiten schnell und nehmen sie durch Anwendung von Schemata als sinnvolle Einheiten war. Auch können sie mithilfe der Schemata größere Mengen im Kurzzeitgedächtnis speichern, die Anpassung und die Auswahl von Verfahrensweisen geschieht schneller, da diese Prozesse automatisiert sind. Im Gegensatz zu Novizen bereitet es Experten keine Probleme relevante Merkmale von irrelevanten zu unterscheiden, für die Problemanalyse wird mehr Zeit aufgewendet, deswegen geschieht die eigentliche Lösung danach schneller. Für die Auswahl der Lösungsstrategien steht ihnen ein größerer Erfahrungsschatz zur Verfügung, die eigenen kognitiven Prozesse können besser kontrolliert werden. Aber diesen Vorteil besitzen die Experten nur in diesem einen Bereich, in anderen Kontexten sind sie von den Novizen nicht zu unterscheiden. Für den Unterricht kann man daraus folgende Schlussfolgerungen ziehen: Ein großer Vorteil der Experten ist ihre ausführliche Problem-Ziel-Analyse, es ist deswegen wichtiger das Problemverständnis zu fördern als konkrete Lösungswege zu bieten. Fragen sollten sich immer auf einen Kontext beziehen, nicht nur aus motivationalen Gründen sondern auch weil dies erst den Alltagstransfer ermöglicht. Das Lernen muss in wirklichkeitsgetreuen Situationen geschehen, damit der Schüler in Alltagsbereichen zum Experten wird. Transfer Man erwartet, dass das in der Schule Gelernte ohne Probleme auf außerschulische Bereiche übertragen werden kann, aber die Anwendung von Wissen auf neue Situationen ist nicht ohne weiteres möglich, da Schemata eng mit dem Kontext verknüpft sind, in dem sie entstanden sind. Schul- und Alltagsschemata entwickeln sich also unabhängig voneinander, statt konditionalem Wissen entsteht träges Wissen, also solches, das nicht angewandt werden kann. Ob sich früheres Lernen auf nachfolgendes auswirkt hängt von den Unterschieden in den Lernbedingungen ab. Lernbedingungen sind Merkmale des Lernenden und der vorgefundenen Aufgabe, sowie des Kontextes in die die Aufgabe eingebunden ist. Die Merkmale des Lernenden sind deklaratives und prozedurales Wissen, die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, welche von vorhandenem Wissen, Strategien und Verarbeitungsgeschwindigkeit abhängt, ob das Wissen genutzt werden kann, also nicht träge ist, und die Motivation. Die Aufgabe muss mit dem Gelernten Ähnlichkeit aufweisen, der Kontext muss sich ähneln, auch die räumlichen Gegebenheiten sollten die gleichen sein. In der Schule findet man zumeist eine Trennung von Wissen und Tun, Begriffe sind meist abstrakt, also völlig vom Kontext gelöst. Um der Entstehung von trägem Wissen vorzubeugen müssen Anwendungsmöglichkeiten geschaffen werden. Grundfertigkeiten müssen in ausgewählten Themengebieten intensiv geübt werden, dieses Überlernen führt dazu, dass die Fertigkeiten automatisiert werden und der Transfer ohne langes Nachdenken erfolgt, so besteht die Möglichkeit die Aufmerksamkeit auf Bereiche zu lenken bei denen Anpassung nötig ist. Es sollten also weniger Themen behandelt werden, die dafür ausführlich. Durch dieses Automatisieren wird jedoch die Flexibilität eingeschränkt, die durch ähnliche Aufgabenstellungen oftmals erfolgreichen Lösungsstrategien werden nicht mehr in Frage gestellt und auch dann angewandt wenn es bessere und einfachere Wege gäbe. Es muss also die Gelegenheit bestehen verschiedene Strategien auf ähnliche Aufgaben anzuwenden. Lernen muss dann systematisch entkontextualisiert werden, der Wissensinhalt wird also von den irrelevanten Aspekten des Kontextes gelöst, um die Anwendung auf verschiedene Kontexte zu übertragen. Konditionales Wissen, also nicht nur das Sachwissen sondern auch das Wissen wann und wie es angewandt wird, entsteht beim Unterricht an Fallbeispielen, Rollenspielen und Aktivitäten in jeder Form, bei denen Rückmeldungen gegeben werden.