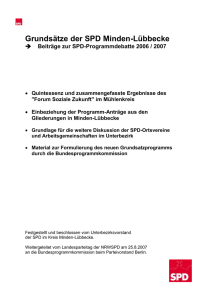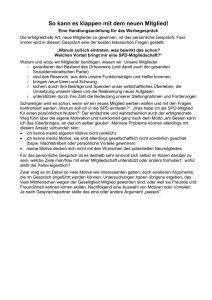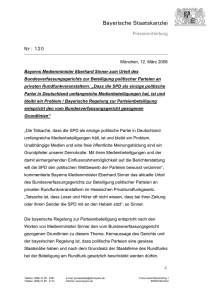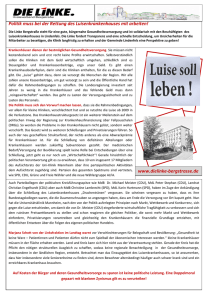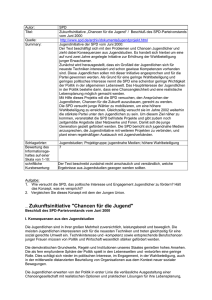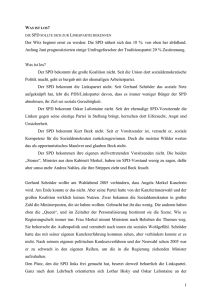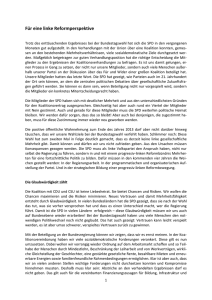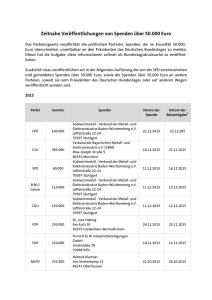Inhaltsverzeichnis - Universität Potsdam
Werbung

Universität Potsdam Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie – Politische, programmatische und organisatorische Bedingungen für die Entwicklung der SPD Diplomarbeit im Studiengang Politikwissenschaften Eingereicht am Lehrstuhl „Politisches System der Bundesrepublik Deutschland“ Erstgutachter: Prof. Dr. Jürgen Dittberner Zweitgutachter: Prof. Dr. Uwe Jun Wintersemester 2004/05 Abgabedatum: 10.01.2005 Verfasser: Dominique Sévin Alice-Berend-Straße 5, 10557 Berlin Tel.: 030/22488399 E-Mail: [email protected] Matrikelnummer 70 70 55 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 2 Inhaltsverzeichnis ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 5 1. EINLEITUNG 6 1.1 FRAGESTELLUNG UND AUFBAU 7 1.2 STAND DER FORSCHUNG 8 2. ORGANISATIONSSTRUKTUR DER SPD 10 2.1 AUFBAU 10 2.1.1 GLIEDERUNG 10 2.1.2 DIE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 11 2.1.3 BESCHLUSSORGANE, GREMIEN UND INNERPARTEILICHE WILLENSBILDUNG 12 2.2 DIE MITGLIEDER 14 2.2.1 MITGLIEDERZAHL UND -ENTWICKLUNG 14 2.2.2 AKTIVITÄT DER MITGLIEDER 14 2.3 DIE DEUTSCHE DRUCK- UND VERLAGSGESELLSCHAFT 16 2.3.1 BETEILIGUNGEN AN MEDIEN 16 2.3.2 NUTZEN DER BETEILIGUNGEN 19 2.3.3 BEURTEILUNG DES SOZIALDEMOKRATISCHEN ENGAGEMENTS AUF DEM ZEITUNGSMARKT 21 3. DIE LETZTEN WAHLEN – HOCHBURGEN, DIASPOREN, SIEGE UND NIEDERLAGEN 25 3.1 DIE BUNDESTAGSWAHL 2002 25 3.1.1 BADEN-WÜRTTEMBERG 26 3.1.2 BAYERN 27 3.1.3 BERLIN 28 3.1.4 BREMEN UND HAMBURG 30 3.1.5 HESSEN 31 3.1.6 NIEDERSACHSEN 32 3.1.7 NORDRHEIN-WESTFALEN 33 3.1.8 RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND 34 3.1.9 SCHLESWIG-HOLSTEIN 36 3.1.10 DIE NEUEN BUNDESLÄNDER 37 3.2 LANDTAGSWAHLEN IN DER ÄRA SCHRÖDER – VIELE NIEDERLAGEN, WENIG SIEGE 39 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 3 4. DIE PROGRAMMATISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE STELLUNG DER SPD 41 4.1 PARTEIEN IN DER PARTEI – DIE FLÜGEL DER SPD 41 4.2 DIE STELLUNG DER SPD IM BUNDESDEUTSCHEN PARTEIENSYSTEM 44 4.2.1 VON DEN „DACHLATTEN“ ZUM WUNSCHKOALITIONSPARTNER – DAS VERHÄLTNIS ZU BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 44 4.2.2 MAL FREUND, MAL FEIND – DAS VERHÄLTNIS ZUR FDP 48 4.2.3 ERWÜRGEN DURCH UMARMEN? – DAS VERHÄLTNIS ZUR PDS 51 4.3 „NACHKRIEGS-HASSLIEBE“ – DAS VERHÄLTNIS ZUM DGB 58 4.3.1 HISTORISCHER ABRISS SEIT 1945 59 4.3.2 AKTUELLE SITUATION UND PERSPEKTIVEN 63 4.3.3 FAZIT 65 5. PERSPEKTIVEN DER SPD – EINE PROGNOSE 67 5.1 LANDTAGSWAHLEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 2005 – MÖGLICHE SZENARIEN BEI EINER NIEDERLAGE 68 5.1.1 DIE WAHRSCHEINLICHSTEN SZENARIEN 68 5.1.2 KRITISCHE BEWERTUNG 69 5.2 MITGLIEDERPARTEI OHNE MITGLIEDER – DER GENOSSENSCHWUND EINE BEDROHUNG? 74 5.2.1 AUSMAß UND GRÜNDE FÜR DEN MITGLIEDERSCHWUND 74 5.2.2 MÖGLICHE GEGENMAßNAHMEN 75 5.2.3 FAZIT 76 5.3 WASG – EINE ERNSTE GEFAHR FÜR DIE SPD? 79 5.4 MÖGLICHER MACHTVERLUST 2006 – EIN VERGLEICH MIT 1982 83 5.4.1 DER INNERPARTEILICHE ZUSTAND DER SPD VOR DEM 17. SEPTEMBER 1982 83 5.4.2 DIE SOZIALDEMOKRATEN NACH DEM KOALITIONSBRUCH 86 5.4.3 VERGLEICH UND FAZIT 88 5.5 UNTERGANGSSZENARIEN – ENDE DER SOZIALDEMOKRATIE? 91 5.5.1 ÖKONOMISCHE END-PROGNOSEN 91 5.5.2 SOZIOLOGISCHE END-PROGNOSEN 94 5.5.3 POLITISCHE END-PROGNOSEN 96 5.5.4 FAZIT 97 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 102 7. ANHANG 107 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 4 8. DANKSAGUNG 109 9. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 110 10. EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 121 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie Abkürzungsverzeichnis ADAV AfA AFB AfB AG AGS AL APO AsF AsJ AvS BHE CDU CSU DDR DDVG DGB DP DVU EU FDP FDGB FTD GAL IG Jusos KKW KPD KPF NRW NRZ NATO OB OV ÖVP PDS PRO SDAP SDS SED SPD SPE SSW SHB UdSSR WASG WAZ ZDF Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen Arbeit für Bremen und Bremerhaven Arbeitsgemeinschaft für Bildung Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgemeinschaft Selbständige Alternative Liste Außerparlamentarische Opposition Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten Bund der Heimatlosen und Vertriebenen Christlich Demokratische Union Deutschlands Christlich Soziale Union in Bayern Deutsche Demokratische Republik Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft Deutscher Gewerkschaftsbund Deutsche Partei Deutsche Volksunion Europäische Union Freie Demokratische Partei Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Financial Times Deutschland Grün-Alternative Liste Industriegewerkschaft Jungsozialisten in der SPD Kernkraftwerk Kommunistische Partei Deutschlands Kommunistische Plattform Nordrhein-Westfalen Neue Ruhr Zeitung North Atlantic Treaty Organization Oberbürgermeister Ortsverein Österreichische Volkspartei Partei des Demokratischen Sozialismus Partei Rechtsstaatliche Offensive Sozialdemokratische Arbeiterpartei Sozialistischer Studentenbund Deutschlands Sozialistische Einheitspartei Deutschlands Sozialdemokratische Partei Deutschlands Sozialdemokratische Parteien Europas im Europäischen Parlament Südschleswigscher Wählerverband Sozialdemokratischer Hochschulbund Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zweites Deutsches Fernsehen 5 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 6 1. Einleitung Desaströse Wahlniederlagen, das am stärksten und längsten ausgeprägte Umfragetief für eine Volkspartei in der Geschichte der bundesdeutschen Demoskopie, der größte Mitgliederschwund seit Kriegsende, Proteste gegen die Regierungspolitik in weiten Teilen der Bevölkerung und der eigenen Partei sowie unübersehbarer Dissens mit den jahrzehntelang verbündeten Gewerkschaften in zahlreichen Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik – seit der knapp gewonnenen Bundestagswahl 2002 befindet sich die SPD offenkundig in einer der größten Krisen ihrer beinahe 130-jährigen Geschichte. Das Bild der Partei in den Medien ist seit Oktober 2002 ein denkbar schlechtes. Schlagworte wie Wahlbetrug, Null-Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit, als unsozial empfundene Reformvorhaben wie die Agenda 2010 oder „Hartz IV“ sowie das mittlerweile zur Inkarnation rot-grüner Regierungspolitik gewordene Prinzip des so genannten „Nachbesserns“ bewirkten einen dramatischen und nach wie vor anhaltenden Ansehensverlust der rot-grünen Bundesregierung in der Bevölkerung.1 Erstaunlicherweise war hiervon ausschließlich die SPD betroffen.2 Zu allem Überfluss gründeten unzufriedene Gewerkschafter und SPD-Linke die „Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit“, die beabsichtigt, als so genannte soziale Alternative zur SPD zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 und Bundestagswahl 2006 anzutreten und enttäuschte sozialdemokratische Wähler für sich zu gewinnen. Hierdurch drohen den Sozialdemokraten weitere Stimmenverluste. Im Dezember 2004 lag die SPD in bundesweiten Umfragen durchschnittlich bei etwa 32 %.3 Dies entspricht zwar einer Steigerung gegenüber ihrem absoluten Stimmungstief im Sommer 2004, als sie lediglich auf einen durchschnittlichen Zustimmungswert von etwa 25 % kam, allerdings würde ein solches Resultat das schlechteste Ergebnis bei Bundestagswahlen seit 1957 bedeuten. Bei regionalen Wahlen erlitt die Partei auf allen Ebenen schwere Niederlagen. Bei Gerhard Schröders Amtsantritt als Bundeskanzler verfügte das rot-grüne Lager im Bundesrat noch über 36 von 69 Stimmen, mittlerweile sind es u. a. infolge der Machtverluste in Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Saarland und Hamburg nur noch zehn Stimmen. Bei den anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2005 ist nach Umfragen von Ende 2004 nicht vollständig auszuschließen, dass die SPD in der Länderkammer weiter an Boden verliert. Auf kommunaler Ebene haben die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung vollständig eingebüßt. Im Herbst 1998 1 Laut ZDF-Politbarometer vom 29.10.2004 waren einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge im Oktober 2004 rund 53 % der Befragten mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, wenngleich auch nur eine Minderheit von 20 % glaubte, eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung könnte die Probleme besser lösen. 2 Lediglich die SPD befindet sich in einem Stimmungstief, während sich ihr kleiner Koalitionspartner – Bündnis 90/Die Grünen – hoher Umfragewerte und zahlreicher Wahlerfolge erfreuen konnte und kann. 3 Hierfür wurde der Durchschnitt der Werte der fünf größten Umfrageinstitute (Forschungsgruppe Wahlen, TNS Emnid, Forsa, Infratest-Dimap und Institut für Demoskopie Allensbach) im Dezember 2004 errechnet. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 7 war die SPD noch in neun von 16 Bundesländern stärkste kommunale Kraft, mittlerweile kann sie dies nur noch in einem Flächenland (Hessen) für sich in Anspruch nehmen. Die teilweise dramatischen Stimmenverluste bei Kommunal- und Landtagswahlen haben bei der Mitgliederbasis in zunehmendem Maße großen Unmut erzeugt. Im Frühjahr 2004 gab Schröder den Parteivorsitz an Franz Müntefering ab, da er sich nicht mehr in der Lage sah, die Gräben zwischen Parteiführung und Parteibasis zu schließen. Doch auch nach dem Führungswechsel an der SPD-Spitze ist das Verhältnis von Parteibasis zu Parteiführung nach wie vor angespannt, und auch der Abwärtstrend der Sozialdemokraten bei Wahlen, in Umfragen und bei der Mitgliederentwicklung konnte noch nicht entscheidend umgekehrt werden. Obwohl es so scheint, als habe die SPD im letzten Quartal 2004 stimmungsmäßig die „Talsohle“ durchschritten4, wobei sie insbesondere von der Schwäche des politischen Gegners im bürgerlichen Lager profitierte5, bleibt die Partei unverändert im Stimmungstief. Die Mitgliederverluste sind immer noch beträchtlich und die Kritik an der von ihr zu verantwortenden Regierungspolitik, nicht nur von Seiten des politischen Gegners, sondern auch der Lobbyverbände, unvermindert stark. Einmal mehr erhalten Untergangsszenarien der Sozialdemokratie Nahrung, die Zukunftsfähigkeit ihrer Politik wird darüber hinaus zunehmend in Frage gestellt. 1.1 Fragestellung und Aufbau Handelt es sich bei der zuvor beschriebenen Krise der SPD nur um ein temporäres Phänomen oder sind es bereits erste Anzeichen eines schleichenden Niedergangs? Die vorliegende Arbeit mit dem Thema „Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie“ soll in erster Linie dieser Frage nachgehen und entsprechende Prognosen für die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung der SPD herausarbeiten. Es soll ebenso hinterfragt werden, ob es sich bei den geschilderten Problemen auch tatsächlich um SPD-immanente Themen handelt oder ob gegebenenfalls das gesamte deutsche Parteiensystem von dieser Krise erfasst ist. Schwerpunkt der Untersuchungen bilden die Ereignisse seit der Bundestagswahl 2002, da sich die Negativtendenzen für die SPD seit diesem Urnengang drastisch verschärft haben. Das Prognostizieren künftiger Entwicklungen bewegt sich erfahrungsgemäß im spekulativen Bereich. Gerade deshalb müssen die gegenwärtigen Rahmenbedingungen auf möglichst allen Ebenen veranschaulicht werden, um die erarbeiteten Ergebnisse auf eine solide Grundlage zu stellen. Im Folgenden wird eine Gliederung der Arbeit in vier Teile vorgenommen. Der darstellende Teil (Kapitel 2) wird die organisatorischen Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung der SPD durch eine knappe Illustration der Parteigliederung, der aktuellen Mitgliederentwicklung sowie der Medienbeteiligungen der parteieigenen Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft 4 Vgl. Blome, Nikolaus; Schröder geht´s zu gut; in: DIE WELT vom 20.09.2004 Vgl. Schöppner, Klaus-Peter; Stimmungshoch der CDU war nur Stimmungstief der SPD; in: DIE WELT vom 25.09.2004 5 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 8 erläutern. Kapitel 3 wiederum bildet den empirischen Teil, welcher auf der Basis der letzten SPD-Wahlergebnisse auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene die politischen Rahmenbedingungen benennen wird. Im historisch-analytischen Teil (Kapitel 4) sollen die inhaltliche Ausrichtung und die Stellung der SPD in Gesellschaft und Parteiensystem unter politisch-programmatischen Bedingungen beleuchtet werden.6 Der Schlussteil beinhaltet die Quintessenz der drei vorangehenden Abschnitte. Anhand von fünf aktuellen Problemen bzw. Herausforderungen sollen Prognosen für die Entwicklung der SPD erarbeitet werden. Neben der Darstellung von Perspektiven werden aber auch Wege beschrieben, wie die SPD die aktuellen Negativentwicklungen in den unterschiedlichen Bereichen (Umfragetief, Wahlniederlagen, Mitgliederverluste, innerparteiliche Konflikte) umkehren kann. Ferner soll auch thematisiert werden, ob überhaupt hinreichende Lösungsmöglichkeiten für die Partei existieren, um den gegenwärtigen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. 1.2 Stand der Forschung Die Parteienforschung befindet sich ebenso wie das politische Leben in der Bundesrepublik Deutschland in einem fortwährenden Prozess der Weiterentwicklung. Dies führt dazu, dass die Forschungsergebnisse relativ schnell an Aktualität verlieren können. Angesichts der Vielzahl an Literatur zum hier behandelten Thema sollen nur die wichtigsten und aktuellsten ihrer Art kurz dargestellt werden. Im 2002 erschienenen, wohl umfangreichsten Werk über die SPD – Franz Walter, Die SPD: Vom Proletariat zur Neuen Mitte – wird die ereignisreiche und bewegte Geschichte der fast 130 Jahre alten Partei in einer bisher kaum gekannten Präzision skizziert. Dabei wird jede zeitliche Epoche, wie beispielsweise die der sozial-liberalen Koalition, auf allen Ebenen kritisch bewertet. Im aktuellsten Werk – Jürgen Dittberner, Sind die Parteien noch zu retten? – aus dem Jahr 2004 werden die Entwicklungen und Defizite der deutschen Parteien in aller Ausführlichkeit dargestellt. Darüber hinaus zeigt Dittberner Möglichkeiten auf, wie die Parteien verloren gegangenes Vertrauen in der Bevölkerung wieder zurückgewinnen können. Neueste Entwicklungen, wie die der SPD nach der Bundestagswahl 2002, fließen hier mit ein, wenngleich sie nur einen kleinen Teil der Gesamtanalyse darstellen. Zumeist ist die vorliegende Literatur über die SPD themengebunden und spezifisch organisatorischer, programmatischer oder insbesondere perspektivischer Natur. Einzelne Aspekte werden somit sehr eingehend behandelt, andere dagegen ausgespart. So wird beispielsweise das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und Gewerkschaften von der Parteienforschung mit anhaltend großem Interesse verfolgt. Das Werk mit dem wohl größten Tiefgang stellt der zweiteilige Band Jochem Langkau u. a., SPD und Gewerkschaften dar, welcher 6 Auf einen umfassenden historischen Abriss des Werdegangs der SPD wie auf eine detaillierte Analyse des Grundsatzund Wahlprogramms der Sozialdemokraten wird aufgrund fehlender Zielführung verzichtet. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 9 sich mit der geschichtlichen Entwicklung des Bündnisses befasst und eine sehr detaillierte Darstellung der programmatischen Gemeinsamkeiten und Differenzen von SPD und DGB in sämtlichen politischen Bereichen beinhaltet. Die Entwicklung der SPD in bestimmten Zeiträumen wird in der Parteienforschung ebenfalls vielfach beleuchtet. In Joachim Piehl, Machtwechsel 1982 findet sich ein äußerst ausführliches Werk aus dem Jahr 2002 über den Zustand der Sozialdemokraten zu Beginn der 1980er Jahre kurz vor und unmittelbar nach dem Machtverlust, einschließlich einer Chronologie der Ereignisse in den letzten Tagen der Regierung Schmidt. Uwe Jun analysiert in seinem Buch Der Wandel von Parteien in der Mediendemokratie in komparativer Arbeitsweise die Entwicklung der SPD und der britischen Labour Party im Zuge der zunehmenden Mediatisierung der Politik. Hieraus ergeben sich beispielsweise zuvorderst Erkenntnisse, inwieweit die Partei aufgrund ihrer innerparteilichen Struktur und ihres Zustands in der Lage war und ist, erfolgreiche Wahlkämpfe zu führen. Eine Beurteilung der Sozialdemokraten in programmatischer Hinsicht wurde außerordentlich häufig vorgenommen. André Kavai, Wie neoliberal ist die SPD? beispielsweise beinhaltet einen historischen Abriss der Austragung innerparteilicher Konflikte programmatischer Art. Im Großen und Ganzen besteht in der Parteienforschung Konsens über die Notwendigkeit einer inhaltlichen Neuausrichtung der SPD. Beim Betrachten der zu diesem Thema verfügbaren Literatur ragt die vielfach auftretende Frage hinsichtlich eines möglichen Untergangs der Sozialdemokratie heraus. Überraschend viele Parteienforscher äußern die Vermutung, dass es sich sowohl bei der SPD als Partei, als auch bei der Sozialdemokratie als politischer Richtung um ein Auslaufmodell handeln könnte. Stellvertretend hierfür sei Thomas Meyer, Die Transformation der Sozialdemokratie erwähnt, der die verschiedenen bekannten Untergangsszenarien diverser bekannter Politologen und Parteienforscher, die Sozialdemokratie betreffend, vorstellt und kritisch bewertet. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 10 2. Organisationsstruktur der SPD Innerparteilicher Aufbau, Mitgliederstruktur und wirtschaftliche Lage einer Volkspartei stellen eine wichtige Grundlage bei der Beantwortung der Frage nach den Perspektiven dar, weswegen sich das folgende Kapitel mit dieser Thematik befassen wird. Dabei werden der Aufbau und die Mitgliederstruktur nur knapp beleuchtet, vielmehr sollen die Medienbeteiligungen der Sozialdemokraten, die der Partei vor allem in finanzieller Hinsicht eine gewisse Sonderstellung im bundesdeutschen Parteiensystem sichern, den Schwerpunkt bilden. 2.1 Aufbau 2.1.1 Gliederung 7 Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gliedert sich unterhalb der Ebene Bundespartei in 20 Bezirke bzw. Landesverbände. Diese ungewöhnliche Zahl ergibt sich aus der Sonderstellung der Landesverbände Hessen und Niedersachsen. In diesen beiden Ländern sind zwischen den Ebenen des Landesverbandes und der Unterbezirke nochmals Bezirke geschaltet, die innerhalb der jeweiligen Landesverbände eine wichtige Rolle spielen. So hat beispielsweise jeder Bezirk einen eigenen Parteitag, den Bezirksparteitag. Der Landesverband Hessen besteht aus zwei Bezirken (Hessen-Nord und Hessen-Süd), Niedersachsen aus vier (Weser-Ems, Nord-Niedersachsen, Braunschweig, Hannover). Im Landesverband Bayern existieren zwar auch Bezirke, jedoch stellen diese lediglich einen losen Zusammenschluss von mehreren Unterbezirken in einer Region dar und sind in ihrer Stellung und Bedeutung somit bei weitem nicht mit denen in Hessen und Niedersachsen vergleichbar. Die Bezirksebenen existierten bei der Wiederbegründung der Partei nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Bundesländern, wurden jedoch aus Gründen der effizienteren Arbeitsweise im Laufe der Jahrzehnte abgeschafft, bis zur Parteireform 2000/2001 zuletzt in Nordrhein-Westfalen. Es ist somit auch in Hessen und Niedersachsen in absehbarer Zeit mit einer Streichung der mächtigen Bezirke zu rechnen. In den restlichen 14 SPD-Landesverbänden folgen als nächste Gliederungsebene direkt die Unterbezirke bzw. Kreisverbände, von denen es bundesweit ungefähr 350 gibt. Diese können sowohl eine Gemeinde, Stadt (jeweils i. d. R. Unterbezirke) als auch einen Landkreis (i. d. R. Kreisverband) umfassen. Innerhalb eines Landkreises können auch Stadtverbände gebildet werden, um die Wirkkraft der Arbeit vor Ort in der jeweiligen Stadt zu verbessern. Die unterste Gliederungsebene und damit die Mitgliederbasis der Partei bilden die rund 12.500 Ortsvereine. Diese können sowohl Stadtteile, Dörfer als auch kleine Gemeinden einschließen. Die 7 Die Daten sind zum überwiegenden Teil den folgenden Quellen entnommen: - SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Machen Sie sich ein Bild von uns – Geschichte, Ziele und Organisation; Berlin, 2004 - http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1009388/index.html; aufgerufen am 28.10.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 11 Bezeichnung „Verein“ ist ein historisch gewachsener Begriff, der seinen Ursprung in den Arbeitervereinen des 19. Jahrhunderts hat. 2.1.2 Die Arbeitsgemeinschaften Zur stärker ergebnisorientierten Bearbeitung politischer Themen haben sich im Laufe der Nachkriegsjahre Arbeitsgemeinschaften gebildet, in denen auch Personen die Möglichkeit zur Mitarbeit eröffnet wird, die nicht SPD-Mitglied sind. Diese AGs dienen weniger der politischen Kommunikation nach außen, vielmehr leisten sie durch Diskussionen und Initiativen einen Beitrag zur innerparteilichen Willensbildung und vertreten die Interessen wichtiger Personengruppen innerhalb der SPD. Im Folgenden werden die insgesamt neun Arbeitsgemeinschaften kurz vorgestellt.8 Jungsozialisten (Jusos) – Die Jusos sind die Jugendorganisation der SPD. Sie richten sich an Personen im Alter zwischen 14 und 35 Jahren. SPD-Mitglieder im entsprechenden Alter erhalten automatisch die Juso-Mitgliedschaft. Die Jusos beschäftigen sich insbesondere mit Fragen der Sozial- und Bildungspolitik und gelten innerhalb der Partei als zum linken Parteiflügel gehörend. Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) – Mit rund 250.000 Mitgliedern Ende 2000 ist die AfA die größte Arbeitsgruppe innerhalb der SPD. Die Organisation sieht sich als Vertreterin der Arbeitnehmerrechte, somit sind ihre Mitglieder zum überwiegenden Teil dem traditionalistischen Flügel der Partei zuzurechnen. Der AfA kommt nicht selten eine Vermittlerfunktion bei Streitfragen zwischen Parteivorstand und Gewerkschaften zu, zumal zahlreiche Gewerkschafter dort Mitglied sind. Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) – Wie der Name bereits erkennen lässt, beschäftigt sich die AsF mit Fragen der gleichen Partizipation am öffentlichen Leben von Mann und Frau. Dabei wird vor allem die Zusammenarbeit mit international tätigen Frauenbewegungen gesucht und gepflegt. Arbeitsgemeinschaft 60plus – Die jüngste aller Arbeitsgemeinschaften (1994 gegründet) entstand im Zuge der zunehmenden Überalterung der SPD-Mitgliedschaft und ist stärker zielgruppenorientiert als jede andere Arbeitsgemeinschaft. Sie ist gleichzeitig die Aktivste. Gesundheitspolitische Arbeitsgemeinschaft (ASG) – Diese AG thematisiert die Gesundheitspolitik innerhalb der SPD und besteht hauptsächlich aus Mitgliedern aus den Bereichen Wohlfahrt, Pflege und Medizin. In den letzten Jahren war die ASG hauptsächlich mit der Erarbeitung eines Entwurfs zu einer Gesundheitsreform beschäftigt. 8 Vgl. http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1009383/index.html; aufgerufen am 29.10.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 12 Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) – Die Bildungspolitik steht hier im Vordergrund. Es werden Konzepte zu Reformen im Bildungswesen entwickelt; die Partei soll zur Umsetzung dieser bewegt werden. Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (AsJ) – Die Verteidigung von Menschen- und Bürgerrechten vor allem in der Dritten Welt stellt das Hauptbetätigungsfeld der AsJ dar. Sie richtet sich an rechtspolitisch interessierte Personen und „lässt sich bei ihrer Arbeit von einer rechtsstaatlichen, demokratischen und sozialen Idee der Gerechtigkeit im Sinne des demokratischen Sozialismus leiten.“9 Arbeitsgemeinschaft Selbständige (AGS) – Als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Mittelstand und folgerichtig hauptsächlich dem pragmatischen Flügel der SPD zuzurechnen, sieht sie sich als Sprachrohr mittelständischer Unternehmen in die Partei hinein. Gleichzeitig ist die AGS als Gegenpol zur AfA bestrebt, den Wirtschaftsverbänden sozialdemokratische Wirtschaftspolitik zu vermitteln. Der AGS kommt in Regierungszeiten der SPD eine wesentlich größere Bedeutung zu als in Oppositionszeiten. Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten (AvS) – Diese im Vergleich zu den Nachkriegsjahren zunehmend bedeutungslos gewordene AG vertritt die Interessen der Sozialdemokraten, die in den Zeiten des Nationalsozialismus und Kommunismus aufgrund ihrer politischen Gesinnung verfolgt wurden. Sie versucht durch Veranstaltungen, die Erinnerung an die beiden Diktaturen auf deutschem Boden im 20. Jahrhundert wach zu halten. Die AvS trat als entschiedener Gegner der ersten Koalition aus SPD und PDS in Mecklenburg-Vorpommern auf. 2.1.3 Beschlussorgane, Gremien und innerparteiliche Willensbildung Zahlreiche Organe und Gremien innerhalb der SPD ermöglichen eine demokratische Willensbildung, die von unten nach oben verlaufen soll. Die rund 12.500 Ortsvereine bilden die Basis der Entscheidungsfindung, sie pflegen vor Ort den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und berufen regelmäßig Mitgliederversammlungen ein, an denen jedes SPD-Mitglied teilnehmen kann. Hier werden die Delegierten für den jeweiligen Unterbezirks- bzw. Kreisparteitag gewählt. Der Unterbezirksparteitag wählt seinerseits wiederum die Delegierten für den Landes- und Bundesparteitag. Die einzelnen Landesverbände haben jedoch die Möglichkeit, in dieser Angelegenheit Sonderregelungen zu beschließen.10 In Hessen und Niedersachsen fällt den Unterbezirksparteitagen beispielsweise die Aufgabe der Wahl der Delegierten zum zwischengeschalteten Bezirksparteitag zu, wo die Landesparteitagsdelegierten gewählt werden. Gemeinsam mit den Unterbezirks- und Bezirksparteitagen bestimmt der Landesparteitag die Delegierten für den Bundesparteitag, dem obersten Gremium der Partei. Er 9 Vgl. http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1009383/index.html; aufgerufen am 29.10.2004 Vgl. SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Organisationsstatut der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands; Berlin, 2004; S. 22 10 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 13 besteht seit 2002 aus 400 Delegierten (zuvor 480) und den 45 Mitgliedern des Parteivorstands. Zu den Aufgaben des alle zwei Jahre stattfindenden ordentlichen Parteitags gehört die Neuwahl des Parteivorstands. Der Parteivorsitzende, die Stellvertreter, der Schatzmeister und der Generalsekretär werden in Einzelwahlgängen, die weiteren Mitglieder im Listenwahlverfahren gewählt. Frauen und Männer müssen mindestens zu je 40 % im höchsten Gremium der SPD vertreten sein. Ebenfalls anwesend auf dem Bundesparteitag mit beratender Stimme sind die Mitglieder der Kontrollkommission, des Parteirats, ein Zehntel der Bundestagsfraktion, sowie ein Zehntel der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament, die vom Parteivorstand bestellten Parteitagsreferenten und die Vertreter von Parteiinstitutionen. Gleichzeitig entsenden die Landesparteitagsdelegierten noch 110 Vertreter in den Parteirat. Dieser muss bei wichtigen Beschlüssen des Parteivorstands gehört werden und berät den Vorstand. Der Bundesparteitag wählt den Parteivorstand, die Bundesschiedskommission (die sieben Mitglieder sind zuständig für Streitfragen zum Parteistatut, sowie Parteiordnungsverfahren und Wahlanfechtungen) und die Kontrollkommission. Letztere hat die Aufgabe, den Parteivorstand zu kontrollieren und Beschwerden über diesen von Seiten der Parteimitglieder entgegen zu nehmen – sie besteht aus neun Mitgliedern. Das vom Parteivorstand gewählte Präsidium besteht aus 13 Mitgliedern, es führt die Beschlüsse des Parteivorstands aus. Die Person des Generalsekretärs leitet die Bundesparteizentrale und ist u. a. für die Durchführung der Bundestagswahlkämpfe zuständig. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 14 2.2 Die Mitglieder 2.2.1 Mitgliederzahl und -entwicklung Mit 650.798 Mitgliedern war die SPD am 31.12.2003 trotz eines überaus hohen Mitgliederrückgangs von 6,2 % in relativen und 43.096 in absoluten Zahlen die größte Partei Deutschlands (CDU: 587.244; CSU 176.950; FDP: 65.192; Bündnis 90/Die Grünen: 44.091; PDS: 70.80511). Allerdings mussten die Sozialdemokraten von den genannten sechs Parteien absolut die mit Abstand höchsten Mitgliederverluste hinnehmen. Im Jahr 1991 nannten noch 919.871 Menschen ein SPD-Parteibuch ihr Eigen, was bis zum heutigen Tage einem Rückgang von 269.073 Mitgliedern oder gut 29 % entspricht (die CDU verlor in diesem Zeitraum 163.919 Mitglieder [21 %], die CSU 7.563 [4 %], die FDP 72.661 [52 %], die PDS 101.774 [58 %], während die Grünen 5.218 Mitglieder hinzugewinnen konnten).12 Angesichts des zuletzt beschleunigten Mitgliederrückgangs bei den Sozialdemokraten und dem sinkenden Abstand zur zweitstärksten Mitgliederpartei Deutschlands CDU13 ist nicht auszuschließen, dass die Christdemokraten mittelfristig zur mitgliederstärksten Partei werden. In den Anfangsmonaten 2004 hat sich der Mitgliederrückgang bei der SPD insbesondere in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt, während die CDU sogar in geringfügigem Maße Mitglieder hinzugewinnen konnte. Nordrhein-Westfalen stellt mit etwa 180.000 Mitgliedern den größten SPD-Landesverband, gefolgt von Bayern (85.000) und Niedersachsen (83.000). Mecklenburg-Vorpommern bildet mit circa 3.000 Mitgliedern das Schlusslicht in dieser Statistik. Es fällt auf, dass die Mitgliederrückgänge im Jahr 2003 in den Landesverbänden mit hohem Rekrutierungsgrad (Parteimitglieder in Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren) prozentual höher ausfielen als in „schwächeren“ Landesverbänden. So musste beispielsweise der rekrutierungsstärkste Landesverband Saarland (3,53) den Verlust von 7,0 % seiner Mitglieder beklagen, während er in Mecklenburg-Vorpommern (0,22) mit 3,6 % erheblich geringer ausfiel. 2.2.2 Aktivität der Mitglieder Erfahrungsgemäß ist gerade bei Parteien mit hoher Mitgliederzahl nur ein kleiner Teil augenscheinlich aktiv. Gut die Hälfte der SPD-Mitglieder „wollen die Partei (…) durch den 11 Stand der PDS-Mitgliederzahlen: 31.12.2002 Vgl. Ergänzung zu: Niedermayer, Oskar/Gabriel, Oscar W.; Parteimitgliedschaften: Entwicklung und Sozialstruktur; in: Niedermayer, Oskar/Gabriel, Oscar W./Stöss, Richard (Hrsg.); Parteiendemokratie in Deutschland, 2. Auflage; Bundeszentrale für politische Bildung; Wiesbaden 2002; S. 274-296 13 Vgl. Grabow, Carsten; Abschied von der Massenpartei – Die Entwicklung der Organisationsmuster von SPD und CDU seit der deutschen Wiedervereinigung; Deutscher Universitätsverlag; Wiesbaden, 2000; S. 33 und 46: Demnach hatte die SPD 1975 noch gut 400.000 mehr Mitglieder als die CDU, Ende 2003 betrug dieser Abstand nur noch gut 60.000. 12 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 15 Mitgliedsbeitrag unterstützen (…), nicht jedoch durch eigene Aktivität.“14 Am Beispiel des mitgliederstärksten Landesverbands Nordrhein-Westfalen wurde von Horst Becker u. a. eine Studie über den Aktivitätsgrad der Mitglieder in den Ortsvereinen angefertigt. Dabei wurde ein Vergleich zwischen den Werten der Jahre 1981/82 und 1996 hergestellt. Im Landesdurchschnitt konnten 1996 etwa 12 % aller Parteimitglieder zum so genannten aktiven Kern gezählt werden (ebenso viel wie zu Beginn der 1980er Jahre), d. h. sie arbeiten in ehrenamtlicher Funktion intensiv und regelmäßig in der Partei mit. Dieser Wert schwankt jedoch innerhalb des Bundeslandes, im ländlichen Raum ist der Anteil Aktiver höher als in Großstädten. Neben dem aktiven Kern sind für die Parteiarbeit auch die gelegentlich aktiven Mitglieder wichtig. Temporär Aktive arbeiten vornehmlich zu Wahlkampfzeiten, bei Parteiaktionen und aktuellen Arbeitskreisen mit und spielen somit für die Kampagnenfähigkeit der SPD eine bedeutende Rolle. Ihr Anteil betrug 1996 durchschnittlich 6 % – ein deutlich rückläufiger Wert, denn noch 1981/82 konnten 13 % der Mitglieder zu dieser Gruppe gezählt werden. „Im Alltag der Ortsvereinsarbeit bedeutet dies, dass sich die Last der Aktivitäten auf weniger Schultern verteilt.“15 Dies hat auch Auswirkungen auf das Stattfinden von Parteiveranstaltungen wie Vorstandssitzungen und OVVersammlungen. Die Vorstände tagen zumeist einmal im Monat, in manchen Ortsvereinen gar seltener – der Anteil Letzterer ist seit Beginn der 1980er Jahre angestiegen. Noch wesentlich drastischer gestaltet sich die Entwicklung bei den Mitgliederversammlungen, die noch in den 1980er Jahren gewöhnlich einmal im Monat zusammentraten, mittlerweile finden sie meistens vierteljährlich, in einigen wenigen Ortsvereinen sogar nur halbjährlich statt. Die schwindenden Mitgliederzahlen und die rückläufige Aktivität der Parteimitglieder hatten letztendlich eine Ausdünnung der Parteiveranstaltungen vor Ort zur Folge, wenngleich der Anteil derer, die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptversammlungen mit Vorstandswahlen besuchen (16 bzw. 23 % aller Mitglieder) seit 1981/82 nahezu stabil geblieben ist. Im Landesdurchschnitt erscheinen pro Ortsverein 24 Mitglieder zu Mitgliederversammlungen, zu den Jahreshauptversammlungen kommen durchschnittlich 36,5 Mitglieder. Die Ortsvereine reagieren auf diese negative Entwicklung, die die Kampagnenfähigkeit der Mitgliederpartei SPD auf Dauer beeinträchtigen könnte, mit einer zunehmenden medialen Aktivität. Während zu Beginn der 1980er Jahre lediglich 37 % aller nordrhein-westfälischen Ortsvereine eigene Zeitungen herausgaben, waren es 1996 bereits 49 %, Tendenz weiter steigend. Der nach wie vor stabile aktive Kern der Basis zeigt folglich ein noch intensiveres Engagement als früher, um den sinkenden Aktivitätsgrad der restlichen Parteimitglieder zu kompensieren. Vgl. Becker, Horst u. a.; NRW-SPD von innen – die wichtigsten Ergebnisse; in: Walsken, ErnstMartin/Wehrhöfer, Ulrich (Hrsg.); Mitgliederpartei im Wandel – Veränderungen am Beispiel der NRW-SPD; Waxmann-Verlag; Münster, 1998; S. 70 15 Vgl. Becker u. a., a. a. O., S. 56 14 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 16 2.3 Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft Als einzige deutsche Partei ist die SPD durch ihr 100%iges Tochterunternehmen, die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, an diversen Zeitungsverlagen beteiligt und hält somit Anteile an zahlreichen Tageszeitungen, auf die sie direkt oder indirekt Einfluss nehmen kann. Neben den Beteiligungen an den Verlagen arbeitet die DDVG mit verschiedenen weiteren Verlagshäusern zusammen, wodurch sich zusätzliche Möglichkeiten der Einflussnahme ergeben. Diese sehr starke Medienaktivität hat bei den Sozialdemokraten eine lange Tradition und reicht sogar bis an ihre Anfänge im 19. Jahrhundert zurück. Die Partei war nach ihrer Gründung im Jahr 1875 stärker als die bürgerlich-konservativen Parteien im Kaiserreich auf eigene Presseorgane angewiesen, da sie sich Repressionen ausgesetzt sah und von der bürgerlichen Presse angefeindet wurde. Somit hatte sie nicht die Möglichkeit, ihre Ideen, Aufrufe, Einladungen oder Broschüren, über den gleichen Weg zu verbreiten wie die nicht-sozialistischen Kräfte. Die Gründung von sozialdemokratischen Zeitungen war die logische Konsequenz. Anders als die Partei selbst und die mit ihr verbündeten Gewerkschaften, die nur über nebenamtliche Tätigkeiten geführt wurden, schuf die Parteipresse Vollzeitarbeitsplätze und „sicherte einem Stamm von politisch führenden Sozialdemokraten Arbeit und Brot. (…) In der Frühzeit kann von einer weitgehenden Einheit zwischen Mitgliedschaft und Leserschaft ausgegangen werden“16, doch im Laufe der Jahre und des Aufbaus dieser Organe übertraf die Zahl der Leser die der Mitglieder deutlich. 1908 beispielsweise konnten sich die Parteiblätter einer Abonnentenzahl von ca. 1,1 Millionen erfreuen, während die SPD lediglich rund 587.000 Mitglieder zählte. Kurz vor der Währungsreform im Jahr 1948 errangen die neu gegründeten Blätter eine Rekordauflage von 2,66 Millionen Exemplaren, während lediglich gut 700.000 Personen ein SPD-Parteibuch besaßen. Die Parteipresse war „von Beginn an auch in finanzieller Hinsicht integraler Bestandteil der deutschen Sozialdemokratie.“17 In den 1960er Jahren kam es schließlich zum Untergang der SPDPresse. Die hohe Verschuldung der parteieigenen Wirtschaftsunternehmen machte eine Veräußerung diverser Druckereien und Zeitungen notwendig. Mittlerweile ist man verstärkt dazu übergegangen, Beteiligungen an regional und überregional arbeitenden Verlagshäusern zu erwerben. Neben der Auflistung sämtlicher Beteiligungen der DDVG und einer kritischen Bewertung derselben wird dieses Kapitel auch die stärkere wirtschaftliche Effizienz dieser Beteiligungen aufzeigen und sie in einen Gegensatz zur klassischen Parteipresse stellen. 2.3.1 Beteiligungen an Medien Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mit Sitz in Hamburg hat in den letzten Jahrzehnten ein beachtliches Netzwerk an Medienbeteiligungen aufgebaut, durch die der SPD die Möglichkeit Vgl. Boll, Friedhelm; Die deutsche Sozialdemokratie und ihre Medien – Wirtschaftliche Dynamik und rechtliche Formen; Verlag J.H.W. Dietz; Bonn, 2002; S. 15 17 Vgl. Boll, a. a. O., S. 21 16 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 17 eröffnet wurde, Einfluss auf weite Teile des regionalen und überregionalen deutschen Zeitungsmarktes zu nehmen. Dabei stehen nicht nur die vordergründigen Beteiligungen der DDVG an Verlagen im Mittelpunkt des Interesses, vielmehr müssen auch strategische Partnerschaften sowie informelle Beziehungen zu Verlagen, an denen die DDVG keine Anteile hält, Beachtung finden. Nachstehende Liste informiert über die Höhe der Anteilseignung und der wichtigsten Produkte:18 "Westfälische Verlagsgesellschaft mbH" mit 100%: ist mit 13,1% an dem "Zeitungsverlag Westfalen GmbH & Co. KG" in Dortmund beteiligt (Westfälische Rundschau) "Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH" mit 100%: ist mit 49,5% an der "Verlagsgesellschaft Cuxhaven mbH & Co. Cuxhavener Nachrichten KG" beteiligt (Cuxhavener Nachrichten) "Frankenpost Verlag GmbH" in Hof mit 100% (Frankenpost, Vogtlandanzeiger) Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH mit 90% (Frankfurter Rundschau) Nest Verlag GmbH, Frankfurt am Man mit 100% "Presse-Druck GmbH" mit 87,5%: ist mit 57,5% an der "Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG" in Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische) "Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH" mit 47,5%: ist mit 62,5% an der "Nordbayerischen Kurier GmbH & Co. Zeitungsverlag KG" beteiligt (Nordbayerischer Kurier) Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG" mit 40% (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen) "Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG" mit 30% (Freies Wort, Südthüringer Zeitung) "Druck- und Verlagsanstalt 'Neue Presse' GmbH" mit 30% (Neue Presse Coburg) "Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co." mit rund 20,4% (u. a. Hannoversche Allgemeine, Neue Presse Hannover, Göttinger Tageblatt) "Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG" mit rund 9% (RPR1, RPR2) "HSI Hamburger Stadtillustrierten Verlagsgesellschaft mbH" mit 75% (SZENE HAMBURG) Tivola Verlag GmbH mit 75,25% (Edutainment, Lernsoftware und Kinderbücher) ÖKO-TEST Holding AG mit 50% plus 10 Aktien (Öko-Test) Darüber hinaus besitzt die DDVG Mehrheitsanteile an vier in Norddeutschland beheimateten Druckereien. Weitere sechs Unternehmen aus dem Bereich Handel, Service und Tourismus sind zu 100 % Tochterunternehmen. 18 Vgl. Flegelskamp, Gert; Die SPD und die Medien; in: http://www.flegel-g.de/spd-verlagswesen.html aufgerufen am 15.10.2004 Ein Organigramm der DDVG ist unter http://www.flegel-g.de/spd-verlagswesen-ornanigramm.html abrufbar. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 18 Eine zentrale Rolle innerhalb des DDVG-Netzwerks spielt die in Hannover ansässige Verlagsgruppe Madsack, an der die DDVG mit 20,4 % an der Hauptgesellschaft und mit 26 % an der geschäftsführenden Gesellschaft beteiligt ist. Die Madsack-Gruppe hält zumeist Mehrheitsbeteiligungen, teilweise ist sie auch Alleingesellschafterin folgender Tageszeitungen.19 Göttinger Tageblatt GmbH & Co. KG, Göttingen (99 %) Adolf Enke GmbH & Co. KG, Gifhorn (100 %) (Wolfsburger Allgemeine) Schaumburger Nachrichten Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Stadthagen (80 %) Peiner Allgemeine Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Peine (100 %) HITZEROTH Druck + Medien GmbH & Co. KG, Marburg (51 %) Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig (50 %) Verlag Dresdner Neueste Nachrichten GmbH & Co. KG, Dresden (50 %) Wurzener Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, Wurzen (50 %) Zeitungsverlag Naumburg-Nebra GmbH & Co. KG, Naumburg (37,6 %) Hüpke & Sohn Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Holzminden (30%) Cellesche Zeitung Schweiger & Pick Verlag Pfingsten GmbH & Co. KG, Celle (24,8%) AZ Alfelder Zeitung und Niedersächsische Volkszeitung Dobler GmbH & Co. KG, Alfeld (24,5%) Gandersheimer Kreisblatt GmbH & Co. KG, Bad Gandersheim (24,2%) Druckerei und Verlag H. Hofmann GmbH & Co. KG, Seesen (15%) J. Hoffmann GmbH & Co. KG, Nienburg/Weser (10%) C. Bösendahl GmbH & Co. KG, Rinteln (8 %) Deister- und Weserzeitung Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG, Hameln (5,3 %) Die Madsack-Gruppe sichert der DDVG und damit der Mutterpartei besonders großen Einfluss auf den niedersächsischen Zeitungsmarkt, aber auch an unzähligen Anzeigenblättern, Vertrieben, Hörfunk- und Fernsehgesellschaften, Online-Diensten und Abrechnungsbetrieben im nord- und ostdeutschen Raum. Andreas Feser berechnet in seinem sehr kritischen Buch „Der Genossenkonzern“, dass die SPD über ihre Holding DDVG direkt circa 2 Millionen bzw. 10 % der Gesamtauflage des deutschen Tageszeitungsmarktes beeinflusst. „Die SPD läge damit hinter dem Branchenführer, der Axel Springer AG mit einem Marktanteil von 23,6 %, auf Platz zwei – weit vor dem Nächstplatzierten, der WAZ-Verlagsgruppe, die einen Marktanteil von 6 % erreicht.“20 Zwar ist die DDVG abgesehen von der „Neuen Westfälischen“ in Bielefeld an keiner Tageszeitung Mehrheitseignerin, allerdings wird angemerkt, dass auch Minderheitsgesellschafterinnen über die Zusammensetzung des Personals beispielsweise in der Redaktion mitbestimmen können. 19 Vgl. http://www.flegel-g.de/spd-verlagswesen.html Vgl. Feser, Andreas; Der Genossen-Konzern – Parteivermögen und Pressebeteiligungen der SPD; OlzogVerlag; München, 2002; S. 99 20 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 19 Neben den direkten und indirekten Beteiligungen unterhält die DDVG auch sehr intensive Kooperationen zu großen Verlagshäusern, u. a. der größten deutschen Regionalzeitung, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, sowie der „Gruner + Jahr AG“ und der „Süddeutschen Zeitung“. Hans-Matthias Kleppinger spricht von für den Leser nicht erkennbaren „publizistischen Koalitionen“21. Die Verquickungen der SPD-Presseholding mit anderen Verlagen sind dabei mittlerweile derart verzweigt, dass aus Platzgründen lediglich beispielhaft eine solche Kooperation mit der WAZ genannt wird. „Drei der vier [aktuellen, Anm. des Verfassers] Geschäftsführer des Essener Presse-Konzerns haben sich politisch für die SPD engagiert oder waren beruflich für Unternehmen mit mehrheitlicher SPD-Beteiligung tätig.“22 Prominentestes Mitglied ist sicher Bodo Hombach, der bereits die Wahlkämpfe von Johannes Rau und Gerhard Schröder gemanagt hat, darüber hinaus war er Wirtschafts- und Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen und Kanzleramtsminister. Über die WAZ knüpft die DDVG zudem weitere Kontakte zu Zeitungen, an denen die Essener beteiligt sind bzw. mit denen sie kooperieren, wie beispielsweise die „Westfälische Rundschau“ oder die „Neue Ruhr Zeitung“. Dies vergrößert das Gewicht der Sozialdemokraten auf dem Zeitungsmarkt nochmals erheblich. Durch die zunehmenden Verbindungen auf dem Printmediensektor zwischen den Verlagen ist das tatsächliche Ausmaß der Einflussnahme der DDVG bzw. SPD kaum zu beziffern; eine Transparenz für den Leser ist somit nicht mehr gegeben. Durch ihre Beteiligungen können die Sozialdemokraten insbesondere auf regionale Zeitungsmärkte Einfluss nehmen, teilweise haben sie sogar regionale Monopolstellungen. In Niedersachsen ist die DDVG an 41 % aller täglich verkauften Tageszeitungen entweder beteiligt oder in einer strategischen Partnerschaft verbündet, in Sachsen sind es 55 %, im Regierungsbezirk Oberfranken gut 70 %. Im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist das Engagement mit Beteiligungen und Partnerschaften an 12 % aller Tageszeitungen anteilsmäßig zwar deutlich geringer, jedoch hat sie im dicht besiedelten Ruhrgebiet durch die Verbindungen zu den Verlagshäusern der WAZ und NRZ eine zentrale Stellung auf dem dortigen Zeitungsmarkt erworben. Die SPD sichert sich durch ihre Medienbeteiligungen regionale Vormachtstellungen auf ausgewählten Zeitungsmärkten. 2.3.2 Nutzen der Beteiligungen Der komplette Strategiewechsel der SPD im Medienbereich seit dem Niedergang der klassischen Parteipresse war zwar aufgrund der hohen Kreditbelastung der parteieigenen Wirtschaftsunternehmen aus der Not heraus geboren23, jedoch nicht zufällig gewählt. Nachdem die bis Ende der 1960er Jahre existierenden sozialdemokratischen Zeitungen noch als eine 21 Vgl. Kleppinger, Hans-Matthias; in: Genossen unter Druck, Focus, Nr. 13/2000 vom 27.3.2000; S. 279 f. Vgl. Feser, a. a. O., S. 111 23 Vgl. Boll, a. a. O., S. 19 22 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 20 Stimme unter vielen bezeichnet werden konnten, setzte man seitdem auf zunehmende Unauffälligkeit. Durch die Minderheitsbeteiligungen an einer immer höheren Zahl an Verlagen und Zeitungen gewann die SPD über ihre Holding DDVG an Einfluss bei Entscheidungsfindungsprozessen innerhalb des jeweiligen Verlags, dieses war bzw. ist allerdings für den Durchschnittsleser des Mediums nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Ein Blick ins Impressum der Zeitung ist hierfür notwendig, und selbst dort taucht der Begriff SPD nicht auf. Dies hat zur Folge, dass der geneigte Leser häufig Recherchearbeiten anstellen muss, denn die DDVG ist durch ihre Tochtergesellschaften und Kooperationsunternehmen häufig auch nur indirekt an einer Zeitung beteiligt und somit im Impressum dieser nicht zwangsläufig namentlich auffindbar. Auch wenn die DDVG zumeist Minderheitsbeteiligungen an Zeitungen hält, so ist ihr Machtpotenzial erheblich. „Die SPD nimmt in den Gesellschaften, an denen [sie] beteiligt ist, selbstverständlich Einfluss. (…) In den betroffenen Verlagen tritt folglich niemand an die Spitze der Hierarchie, der nicht die ausdrückliche Genehmigung des Miteigentümers SPD hat.“24 So ist die Partei beispielsweise bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ direkt bei der Besetzung des Postens des Chefredakteurs beteiligt. Daher liegt der Schluss nahe, dass der Partei nahe stehende Kandidaten bessere Chancen haben dürften, diese Position auszufüllen, als solche mit gegenläufiger oder ohne jegliche parteipolitische Präferenz. Diese überaus wichtige Stellung der DDVG als Minderheitseignerin wird auch von der SPD nicht bestritten, so äußert sich Inge Wettig-Danielmeier, SPD-Schatzmeisterin und Generaltreuhändlerin der DDVG folgendermaßen: „Auch dort, wo wir nur 30 oder 40 Prozent haben, kann in der Regel nichts ohne uns passieren“25. Es hat sich daher für die Partei bzw. DDVG als wesentlich effizienter erwiesen, an zahlreichen Zeitungsverlagen Minderheitsanteile zu erwerben, anstatt bei wenigen Mehrheitseignerin zu sein. Wenig überraschend ist dabei der von den Sozialdemokraten erhoffte wirtschaftliche Nutzen der Beteiligungen an Verlagen. Die parteieigenen Unternehmen waren zum Ende der 1990er Jahre auf dem Höhepunkt ihrer Ertragsstärke, zwischen 1996 und 2000 hat die SPD insgesamt rund 55 Millionen DM (ungefähr 28 Millionen Euro) von der DDVG erhalten. Fesers Ausführungen zur unternehmerischen Philosophie der Partei erscheinen einleuchtend: „Im Verbund der Holding DDVG sind die Minderheitsbeteiligungen der Partei weit ertragreicher als die Firmen, die im Alleineigentum der SPD stehen. […] Parteizeitung, Reisebüros, Antiquariat oder Buchführungsfirma können im Preiswettbewerb gut mithalten – was auch der Partei als Großkundin zugute kommt – wenn deren eventuelle Verluste sich in der Holding mit den Erträgen der Beteiligungen Steuer sparend verrechnen lassen. Auf diesem Wege können sowohl die Kosten 24 25 Vgl. Feser, a. a. O., S. 121 Vgl. Medien-Tenor; Forschungsbericht Nr. 119 vom 15.4.2002; S. 68 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 21 für die Parteiorganisation wie auch die Abgabenbelastung der Beteiligungserträge zurückgeführt werden.“26 Die Intention, die Partei wirtschaftlich unabhängiger von Mitgliedsbeiträgen und Großspenden zu machen27, ist deshalb ebenso hoch zu bewerten, wie die, „medienpolitischen Einfluss“28 zu gewinnen. 2.3.3 Beurteilung des sozialdemokratischen Engagements auf dem Zeitungsmarkt Die Medienbeteiligungen der SPD-Tochter DDVG und deren moralische Korrektheit waren nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb der SPD, seit den 1970er Jahren immer wieder Gegenstand lebhafter und kontroverser Diskussionen. In der wissenschaftlichen Literatur, und den Medien überwiegt eine negative Einschätzung des sozialdemokratischen Engagements im Printmedien-Bereich. Jedoch liefern sowohl die SPD selbst, als auch Medienwissenschaftler und Parteienforscher Argumente für ein Beibehalten der Anteilseignung der SPD an den genannten Verlagshäusern. Friedhelm Boll bezieht in seinem Buch „Die deutsche Sozialdemokratie und ihre Medien“ eindeutig Stellung zugunsten eines Engagements der Sozialdemokraten auf dem Zeitungsmarkt, wobei er der parteieigenen Presse bis in die 1960er Jahre hinein mehr Aufmerksamkeit schenkt, als den aktuellen Medienbeteiligungen. Boll betont sogar die Notwendigkeit von SPDBeteiligungen an zahlreichen Zeitungen, „konnte doch auf diese Weise dem rasanten Konzentrationsprozess im Medienbereich, wie er während der 1960er und 1970er Jahre insbesondere von Axel C. Springer betrieben wurde, ein gewisser Widerstand entgegengebracht werden und (…) ein Stück publizistische Vielfalt erhalten bleiben.“29 Die SPD-Beteiligungen bilden demnach einen wichtigen Gegenpart zum bürgerlich-konservativen Axel-Springer-Verlag in der deutschen Presselandschaft. Damit übernimmt der Autor praktisch Wettig-Danielmeiers Argumentation: „Die Meinungssteuerung durch Springer, Bauer und Kirch bedroht die Meinungsfreiheit stärker als unsere wenigen Beteiligungen“.30 An anderer Stelle wird sie folgendermaßen zitiert: „…unser Anteilspaket trägt dazu bei, mittelständische Strukturen im Zeitungsbereich zu erhalten.“31 Allerdings bleibt Boll eine Antwort auf die berechtigte Frage schuldig, weswegen große Verlage wie „Gruner + Jahr“, „Süddeutsche Zeitung“ oder „WAZ“, nicht auch ohne die SPD in der Lage sein sollen, dem Springer-Konzern Paroli bieten zu können. 26 Vgl. Feser, a. a. O., S. 135 Vgl. Boll, a. a. O., S. 107 28 Vgl. SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1979-1981; Bonn, 1981; S. 345 29 Vgl. Boll, a. a. O., S. 98 30 Vgl. Ich hätte schwören können… – Interview mit Inge Wettig-Danielmeier; in: Focus Nr. 52/2000 vom 22.12.2000; S. 30f. 31 Vgl. SPD-Finanzchefin: „Die SPD ist eine mittelgroße Verlegerin“ – Interview mit Inge Wettig-Danielmeier; in: Rheinische Post vom 13.12.2000 27 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 22 Zudem würde eine Veräußerung der SPD-Medienanteile an unterschiedliche Medienkonzerne und Verlagshäuser einer Konzentration entgegenwirken. Die bereits im vorherigen Kapitel angesprochene wirtschaftliche Unabhängigkeit hat nach Bolls Worten auch Auswirkungen auf die Politik der Partei: „Die damit errungene Unabhängigkeit hat über Jahrzehnte hinweg die wirtschaftliche wie geistige Unabhängigkeit ihrer Führungskräfte (…) gesichert (…), in der Zeit nach 1945 immer wieder vor korrumpierenden Einflüssen von Großspendern [bewahrt]“.32 Gleichzeitig vermeidet der Autor die Nennung konkreter Beispiele, wie die Politik der bürgerlich-konservativen Parteien durch Großspenden beeinflusst wird. Die Spendenskandale der SPD in Köln und Wuppertal 2002 lassen darüber hinaus keine größere finanzielle Unabhängigkeit im Vergleich zu den Unionsparteien erkennen. Das Engagement von Parteien im Printmedienbereich ist laut Boll ein hohes Gut der Demokratie, das, zudem eine lange Tradition hat. „Wer den politischen Parteien die eigene Betätigung auf dem Medienmarkt versagt, übersieht, dass alle politischen Parteien es (…) für richtig halten (…) mit eigenen Medienangeboten präsent zu sein.“33 Doch auch hier zeigen sich Argumentationsschwächen von Seiten des Verfassers. Die Minderheitsbeteiligungen der DDVG an diversen Verlagshäusern sind sicherlich nicht mit parteieigenen Zeitungen wie dem sozialdemokratischen „Vorwärts“ oder dem „Bayernkurier“ der CSU zu vergleichen. Bei einer Parteizeitung wie der „Liberalen Depesche“ ist eindeutig erkennbar, dass es sich um ein FDPeigenes Organ handelt, ebenso wie bei der SPD-Parteipresse bis in die 1960er Jahre. Bei einer Tageszeitung wie der „Sächsischen Zeitung“ bedarf es aufgrund fehlender Transparenz einer recht aufwändigen Recherche, um eine Verbindung zur SPD nachzuweisen. Die parteieigene Presse bis zum Ende der 1960er Jahre wird und wurde von den politischen Gegnern nicht in nennenswertem Maße desavouiert, wohl aber die aktuellen Medienbeteiligungen der Sozialdemokraten. Feser hingegen sieht das sozialdemokratische Engagement auf dem Medienmarkt erheblich kritischer, da die Partei seiner Meinung nach über die zahlreichen Zeitungen, an denen sie beteiligt ist, zusätzlich Macht und Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen ausübt. „Das inhaltliche Profil einer Zeitung beeinflusst erkennbar das Meinungsbild ihrer Leser.“34 Dabei bemängelt er am Beispiel der „Sächsischen Zeitung“ die politisch sehr einseitige Berichterstattung der Tageszeitungen mit DDVG-Beteiligung während des Bundestagswahlkampfs 1998. Dabei zitiert er die Ergebnisse einer Studie der „Medien-Analyse Medien-Tenor GmbH“35 und hebt u. a. im Zusammenhang mit den Parteispendenskandalen der CDU im Jahr 2000 und der SPD im Frühjahr 2002 die objektivere Berichterstattung bürgerlich-konservativer Zeitungen wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, DIE WELT oder Focus hervor. Hier ist allerdings festzustellen, 32 Vgl. Boll, a. a. O., S. 107 Vgl. Boll, a. a. O., S. 108 34 Vgl. Feser, a. a. O., S. 134 35 Vgl. Feser, a. a. O., S. 128 33 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 23 dass auch bei der Springer-Presse eine Parteinahme zugunsten der Unionsparteien, wie beispielsweise im Bundestagswahlkampf 2002, zu beobachten war. Jedoch muss die Frage erlaubt sein, ob eine Tageszeitung ihre Leserschaft tatsächlich in dem von Feser dargestellten Ausmaß beeinflusst. Eine Studie über den Zeitungsmarkt in Hilden aus dem Jahr 1999 kommt vielmehr zu dem Ergebnis, dass der Leser eher die Zeitung liest bzw. abonniert, die ohnehin seiner politischen Einstellung entspricht.36 Ebenso wenig „legt Feser Belege oder wenigstens Beispiele für die angebliche redaktionelle Beeinflussung durch die SPD vor.“37 Feser sieht ferner ein Glaubwürdigkeitsdefizit der Demokratie. Er stellt indirekt einen Vergleich mit dem italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi her, da hierzulande die einhellige Meinung vorherrsche, dass „die Verbindung von publizistischem Einfluss und politischer Macht […] eine Gefahr für die Demokratie“38 darstelle.39 Die Medienbedeutung Berlusconis in Italien ist mit der der SPD in Deutschland jedoch nicht vergleichbar. Ihre Tochter DDVG hält lediglich Minderheitsbeteiligungen an etwa 10 % der täglich erscheinenden deutschen Zeitungen. Eine derart machtvolle Stellung der Partei, vergleichbar mit der von Berlusconi, ist definitiv nicht gegeben, wenngleich in einigen Regionen Deutschlands, wie beispielsweise Oberfranken, fast ausschließlich Regionalzeitungen mit SPD-Beteiligung auf dem Markt vorzufinden sind. Eine objektive Beurteilung der sozialdemokratischen Beteiligungen an Zeitungsverlagen ist somit schwierig, da eine Bewertung tendenziell einer parteipolitischen Neigung entspringt. Das SPDMedienengagement wird vorwiegend kritisch gesehen, unisono fast durchweg von der bürgerlichkonservativen Presse thematisiert, jedoch weniger mit dem Ziel, die Partei zur Aufgabe ihrer Beteiligungen zu bewegen, als vielmehr, die konkurrierenden Zeitungen mit DDVGBeteiligungen in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Gerade die Tatsache der fehlenden Objektivität führt letztlich dazu, dass die Behandlung des Themas SPD-Medienbeteiligungen nur sehr selten zu neuen tiefgründigen politischen Erkenntnissen führt, wobei die Argumentation, wie hier am Beispiel von Boll und Feser skizziert, zudem häufig nicht stichhaltig ist. Auch die politische Debatte brachte in den letzten Jahren wenig Fortschritte in der Frage, ob die Medienbeteiligungen moralisch vertretbar sind. Die Unionsparteien sehen darin eine Gefährdung der Gewaltenteilung, betrachtet man die Medien als vierte Gewalt neben Exekutive, Legislative und Judikative. Die SPD ihrerseits verweist auf das Grundrecht auf Eigentum, weswegen eine Partei nicht zwangsverpflichtet werden könne, ihren Besitz zu veräußern.40 Jedoch ist die Frage durchaus erlaubt, ob eine politische Partei durch Minderheitsbeteiligungen in der Presselandschaft Vgl. Marcinkowski, Frank: Kommunales Wahlverhalten zwischen Eigengesetzlichkeit und Bundestrend – Eine Fallstudie aus Nordrhein-Westfalen; in: Polis Nr. 51/2001, Hagen 2001, S. 62 37 Vgl. Grose, Bert; Genossenkonzern oder Bonsai-Imperium – Rezension „Andreas Feser, Der Genossenkonzern“; Berlin, 2004; in: www.viewmag.de/kultur/04/16/feser.html; aufgerufen am 21.10.2004 38 Vgl. Feser, a. a. O., S. 113 39 Berlusconi ist seit Mai 2001 italienischer Ministerpräsident, wodurch er Kontrolle über das Staatsfernsehen im Land erlangte. Gleichzeitig hält seine Holding „Fininvest“ Beteiligungen an zahlreichen Privatsendern. Vgl. hierzu auch: Der unheimliche Milliardär; in: Der Spiegel 21/2001 vom 21.5.2001; S. 156ff. 40 Vgl. Merz will SPD-Besitz an Medien verbieten; in: Berliner Morgenpost vom 04.09.2002; http://morgenpost.berlin1.de/archiv2002/020904/politik/story546380.html; aufgerufen am 22.10.2004 36 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 24 eines demokratischen Staates tätig werden sollte. Allerdings hatten die Unionsparteien während ihrer mehrjährigen Regierungszeit die Möglichkeit, das Parteiengesetz in dieser Hinsicht zu ändern, versäumten dies jedoch. Somit haben Ankündigungen, dem Presseengagement der Sozialdemokraten ein Ende zu bereiten, eindeutig populistische Züge und sind nicht zwangsläufig ernst zu nehmen. Andererseits ist auch das Argument der SPD, die Parteipresse habe eine lange Tradition, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreiche und daher erhalten werden müsse, kaum nachvollziehbar. Die Sozialdemokraten litten in der Zeit bis 1918 im Kaiserreich unter Repressionen und schweren Benachteiligungen innerhalb der damaligen Gesellschaft und waren auf ihre parteieigenen Medien in höchstem Maße angewiesen. Davon kann heute sicherlich nicht mehr die Rede sein; die SPD ist eine in allen Bevölkerungsschichten akzeptierte Volkspartei, deren Konzepte auch von politischen Gegnern nicht zwangsläufig befürwortet, jedoch ernst genommen werden. In einem demokratischen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik ist eine Partei höchstens wirtschaftlich, nicht jedoch politisch, auf Pressebeteiligungen angewiesen. Diverse Debatten innerhalb in der SPD der letzten Jahre, die Forderungen nach einer Aufgabe der Medienbeteiligungen zum Gegenstand hatten, zeigen, dass dieses Engagement moralisch zumindest fragwürdig ist.41 Hierbei muss dennoch hinterfragt werden, ob es sich dabei in Zeiten schärferer Kritik an den DDVG-Beteiligungen um ernsthafte Debatten oder nur um Scheindiskussionen handelt.42 41 Vgl. hierzu beispielhaft: Clement, Wolfgang; Gesprächsbericht in: SPD-Spitze streitet über ihre Medien; in: Rheinische Post vom 13.06.2002 42 Vgl. hierzu beispielhaft: Lieber gestern als heute – Gerhard Schröder will angeblich die profitablen SPD-Medien-Beteiligungen an die WAZ verkaufen; in: DIE WELT vom 10.01.2002 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 25 3. Die letzten Wahlen – Hochburgen, Diasporen, Siege und Niederlagen Urnengänge gelten allgemein als die genauesten Stimmungsbarometer. Während Parteifunktionäre im Falle von mäßigen Umfragewerten, gleichgültig ob auf Bundes- oder Landesebene, besagte Erhebungen häufig als Momentaufnahmen bezeichnen und auf die hohe Anzahl unentschlossener Wähler verweisen, sind es bei Wahlen real abgegebene Stimmen, die ernst genommen werden müssen. Insbesondere die Ergebnisse von Landtagswahlen im Vorfeld einer Bundestagswahl beschäftigen Parteistrategen in höchstem Maße. In diesem Kapitel soll die Partei auf ihre regionalen Potenziale und ihre aktuelle Situation hin untersucht werden. Es wird der Frage nachgegangen, wo sich Hochburgen und wo Diasporen der SPD befinden. Für diese Untersuchung wird nur auf die Bundestagswahl 2002 zurückgegriffen, da aufgrund der höchsten Wahlbeteiligung im Vergleich zu anderen Urnengängen die elektorale Stärke bzw. Schwäche in einer bestimmten Region wesentlich genauer ermittelt werden kann. Darüber hinaus sollen Gründe genannt werden, warum die Sozialdemokraten in bestimmten Regionen im September 2002 elektoral besonders stark oder besonders schwach bzw. traditionell abschnitten. Im darauf folgenden Unterkapitel über Landtagswahlen in der Ära Schröder erfolgt lediglich eine Darstellung der Ergebnisse des jeweiligen Urnengangs und der Veränderungen bezogen auf die jeweils vorangegangene Wahl und eine Bewertung der Resultate und Verschiebungen. 3.1 Die Bundestagswahl 2002 Zur Organisation eines Bundestagswahlkampfes gehört u. a. die möglichst genaue Kenntnis der Stimmenpotenziale der Partei in den einzelnen Ländern, Wahlkreisen, Städten oder Dörfern. Die Organisatoren des Wahlkampfes müssen zudem u. a. folgende wichtige Kriterien beachten: Wie hoch ist die Mitgliederzahl, wie dick die Personaldecke im jeweiligen Bundesland, wie waren die Ergebnisse der letzten Wahlen, wie ist die Stimmungslage in der Region zu bewerten (Gibt es lokale Ereignisse? Regiert man im jeweiligen Bundesland?) und wie setzt sich die regionale Wählerstruktur zusammen? Hieraus kann schließlich das Potenzial in den einzelnen Wahlkreisen annähernd errechnet werden, um die Wahlkampfmittel gezielter und sinnvoller einzusetzen. Bundesweit erhielt die SPD bei obiger Bundestagswahl 18.488.668 Zweitstimmen, was einem Stimmenanteil von 38,5 % entspricht. Gegenüber der Bundestagswahl 1998 büßte sie damit 2,4 % der Stimmen ein, konnte sich jedoch gegenüber CDU/CSU knapp als stärkste Partei behaupten, die lediglich 6.027 Stimmen weniger erhielten. In den alten Bundesländern einschließlich BerlinWest erzielte sie 38,1 %, gegenüber 1998 entspricht dies einem Verlust von 4,2 %. Dagegen konnte sie in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost mit 39,7 % nicht nur mit deutlichem Abstand stärkste Partei werden, sondern auch einen erheblichen Hinzugewinn von 4,6 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 26 % verbuchen, was ihr schließlich gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen bundesweit die Mehrheit sicherte.43 3.1.1 Baden-Württemberg Im Südwesten errang die SPD 33,5 % der Stimmen, 2,1 % weniger als 1998. Baden-Württemberg ist traditionell ein schwieriges Terrain für die Sozialdemokraten. Hierfür gibt es zwei gewichtige Gründe: 1) Ein mehrheitlich katholisch geprägtes Bundesland44 wie Baden-Württemberg birgt erfahrungsgemäß eine strukturelle Mehrheit für die CDU. Dies schlägt sich insbesondere in den ländlichen Regionen nieder, wo die SPD 2002 unterdurchschnittlich abschnitt. So erzielte sie ihre schlechtesten Ergebnisse in den Wahlkreisen Biberach (24,3 %), Zollernalb/Sigmaringen (27,7 %) und Calw (29,3 %), allesamt ländliche Wahlkreise. 2) Gleichzeitig müssen die Sozialdemokraten gegen die im Südwesten starken Bündnisgrünen antreten, was auf die zahlreichen Universitätsstädte mit hohem Studentenanteil im Land (Freiburg, Heidelberg, Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen, Konstanz) zurückzuführen ist. Da der Grünen-Wähleranteil unter Studenten traditionell sehr hoch ist, schafften es die Sozialdemokraten in keiner dieser Städte, mit Ausnahme von Karlsruhe, über 35 % der Stimmen zu kommen, während die Grünen durchweg zweistellige Ergebnisse erzielen konnten. Im „Ländle“ findet sich praktisch kein Wahlkreis mit guten Voraussetzungen für die Sozialdemokraten, d. h. einem hohen Anteil an Angestellten und Arbeitern. Lediglich Mannheim, eine von viel Industrie und daher auch hohem Arbeiteranteil geprägte Stadt, bietet hinreichend Bedingungen für gute SPD-Ergebnisse. Folgerichtig erhielt die Partei dort mit 41,3 % auch den höchsten Stimmenanteil im Land. Bis auf die Bundestagswahlen zwischen 1969 und 1980 und die Landtagswahlen 1964 und 1972 gewann die SPD in Baden-Württemberg nie über 35 % der Stimmen. Es lässt sich jedoch feststellen, dass die Bundestagswahlergebnisse für die SPD im Südwesten stets besser waren als die bei zeitnahen Landtagswahlen, was auf eine Schwäche des Landesverbandes hinweist.45 „Enttäuscht über die geringen Gestaltungsmöglichkeiten in der Landespolitik“46 wechselten zahlreiche SPD-Landespolitiker von Stuttgart nach Bonn bzw. Berlin, da sich die SPD seit 1972, abgesehen von der großen Koalition 1992-1996, ununterbrochen in der Opposition befindet. Es finden sich aktuell in der baden-württembergischen Landespolitik praktisch keine bundesweit bekannten Sozialdemokraten. Auf kommunaler Ebene war die SPD bis Mitte der 1990er Jahre wesentlich erfolgreicher. „So gelang es (…) SPD-Mitgliedern, die auch landespolitisch wichtigen Oberbürgermeistersessel von 43 In den alten Bundesländern hatten CDU/CSU und FDP eine knappe Mehrheit. 41 % der Einwohner Baden-Württembergs sind katholisch, nur 34 % evangelisch. 45 Vgl. Schneider, Herbert; Baden-Württemberg; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S.70f. 46 Vgl. Schneider, a. a. O., S. 73 44 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 27 Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Pforzheim und Ulm zu erobern.“47 Inzwischen mussten die Sozialdemokraten die OB-Posten in Freiburg und Pforzheim abgeben. In den Orts- und Gemeinderäten ist die SPD mittlerweile landesweit hinter die Freien Wähler zurückgefallen, wodurch sie ihre einst große kommunale Gestaltungskraft eingebüßt hat. 3.1.2 Bayern Mit 26,1 % erzielte die SPD im flächenmäßig größten Bundesland nicht nur das schwächste Ergebnis bundesweit, sie erlitt mit einem Minus von 8,3 % auch noch die höchsten Verluste aller Landesverbände. Die starken Stimmenverluste im Freistaat sind eindeutig auf die Kanzlerkandidatur von Edmund Stoiber (CSU) zurückzuführen, der in seinem Heimatland, ähnlich wie Gerhard Schröder 1998 in Niedersachsen, in starkem Maße Wähler für die Unionsparteien mobilisieren konnte. Die allgemeine relative Schwäche der Sozialdemokraten zwischen Hof und GarmischPartenkirchen hat allerdings andere und viel gravierendere Gründe, die nicht in der Wahl von Personen zu suchen sind. 1) „Bayern weicht in seiner Konfessionsstruktur deutlich vom Bundesdurchschnitt ab.“48 67 % der bayerischen Bevölkerung waren Ende der 1990er Jahre katholischen Glaubens, lediglich 25 % waren Protestanten. Es ist daher nicht überraschend, dass es der SPD, deren Wählerschaft mehrheitlich aus Protestanten besteht (siehe Tabelle 4), nicht gelingt, strukturell mehrheitsfähig zu sein. 2) Ein ebenfalls nicht wettzumachender Nachteil ist das Auftreten des politischen Gegners im Freistaat. Die seit Jahren dominierende CSU ist anders als die bayerische SPD kein Landesverband einer in Bonn bzw. Berlin ansässigen Bundespartei, sondern eine primär bayerische Partei, die über Landtagswahlergebnisse in Bayern ihren bundesweiten Mitgestaltungsanspruch erhält. Die CSU ist bei Bundestagswahlen seit 1949 und bei Landtagswahlen seit 1954 stets stärkste politische Kraft geworden – seit 1966 regiert sie mit absoluter Mehrheit. Die bayerischen Wähler trauen den Christsozialen eher zu, die Interessen des konservativen Freistaats zu vertreten. Diesen strukturellen und strategischen Nachteil vermochte die SPD zu keinem Zeitpunkt auszugleichen. Zwar gelangen ihr in den 1960er Jahren Achtungserfolge bei Landtagswahlen, wo sie über 35 % der Stimmen gewann, – bei Bundestagswahlen war sie 1969 und 1972 relativ erfolgreich (34,6 bzw. 37,8 %) – jedoch ist der Abstand zur CSU zunehmend größer geworden. Seit 2003 regiert die CSU in Bayern sogar mit einer Zweidrittel-Mehrheit der Mandate.49 47 Vgl. Ismayr, Wolfgang/Kral Gerhard; Bayern; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S. 87 48 Vgl. Ismayr/Kral, a. a. O., S. 88 49 Bei der Landtagswahl 1954 betrug der Abstand zwischen CSU und SPD lediglich 9,9 %, bei der letzten Landtagswahl 2003 waren es 41,1 % (!). vgl. www.wahlrecht.de/ergebnisse/bayern.htm; aufgerufen am 29.08.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 28 Die SPD-Ergebnisse sind regional sehr unterschiedlich, was auf die besondere Sozial- und Konfessionsstruktur in Bayern zurückzuführen ist. Während beispielsweise in Niederbayern und der Oberpfalz der Anteil der Katholiken in der Bevölkerung bei annähernd 90 % liegt, stellen in Franken die Protestanten die Mehrheit.50 Außerdem haben die bayerischen Sozialdemokraten, anders als in Baden-Württemberg, in Ballungsgebieten nicht so stark mit der Konkurrenz der Bündnisgrünen zu kämpfen. Somit lassen sich in Bayern ausgeprägte Hochburgen und Diasporen für die SPD ausmachen. Ihre besten Ergebnisse erzielte die Partei in Nürnberg-Süd (37,6 %), Nürnberg-Nord (37,2 %) und Coburg (36,0 %), allesamt Wahlkreise im Raum Franken. Bei der Bundestagswahl 1998 konnte die SPD in Franken sogar über 40 % der Stimmen erzielen und die Mehrheit der Direktmandate für sich entscheiden. Im Norden des flächenmäßig größten Bundeslandes sind die Sozialdemokraten also durchaus auf Augenhöhe mit der CSU. Die SPDVerluste waren in ihren Hochburgen allerdings besonders hoch, während sie in der Diaspora Niederbayern vergleichsweise gering ausfielen. Traditionell überdurchschnittliche Ergebnisse außerhalb Frankens verbuchte die Partei nur in den Ballungszentren München und Augsburg. Ihre schlechtesten Ergebnisse erzielten die Sozialdemokraten ausschließlich im katholisch geprägten Süden des Freistaates, in Rottal-Inn (17,9 %), Traunstein (18,9%) und Straubing (19,0 %). Die Bundestagswahlergebnisse in Bayern unterscheiden sich nicht allzu sehr von zeitnahen Landtagswahlergebnissen. Die Chancenlosigkeit, Regierungsverantwortung auf Landesebene zu tragen, hat bei der bayerischen SPD, immerhin der Landesverband mit der zweithöchsten Mitgliederzahl nach Nordrhein-Westfalen bundesweit, zu einer personellen Auszehrung in der Landespolitik geführt. Prominente, bundesweit bekannte bayerische Sozialdemokraten suchen entweder den Weg in die Bundespolitik (Ludwig Stiegler, Renate Schmidt) oder verbleiben in der Kommunalpolitik (Christian Ude). Damit dürfte der innerparteilich eher linksgerichtete Landesverband Bayern auf nicht absehbare Zeit Oppositionspartei im Land bleiben. Auf kommunaler Ebene musste die SPD ebenfalls einen Niedergang beklagen. Dieser bezog sich jedoch nur auf den ländlichen Raum, wo die Sozialdemokraten mittlerweile mit den Freien Wählervereinigungen um den zweiten Platz im Parteiensystem kämpfen müssen. Umso überraschender erscheint hingegen die Tatsache, dass die SPD seit der Kommunalwahl 2002 die landespolitisch durchaus wichtigen Oberbürgermeisterposten in München, Nürnberg, Augsburg und Fürth stellt. Darüber hinaus ist sie auch in vielen Stadträten in Großstädten Mehrheitsfraktion, so wird München schon seit einigen Jahren von einer rot-grünen Koalition regiert. 3.1.3 Berlin Die Bundeshauptstadt ist politisch zwar wiedervereinigt, die Wahlergebnisse spiegeln jedoch nach wie vor die frühere Teilung der Stadt in Ost und West wider. Stadtweit konnte die SPD 36,6 % erzielen und war damit mit deutlichem Abstand stärkste Partei, wenn auch mit Einbußen von 50 vgl. Ismayr/Kral, a. a. O., S. 88 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 29 1,2 %. Allerdings erlitten die Sozialdemokraten diese Verluste ausschließlich im Westteil der Stadt, und zwar vor allem zugunsten der Grünen. Dagegen profitierte die SPD in Berlin-Ost in starkem Umfang von der Schwäche der PDS und konnte hier zulegen, am stärksten in der PDSHochburg Marzahn/Hellersdorf. Obwohl die einzelnen Wahlkreise teilweise erheblich unterschiedliche Sozialstrukturen aufweisen, können die Sozialdemokraten sehr gleichmäßige Ergebnisse innerhalb der Stadt erzielen. Lediglich 9,6 % Unterschied liegen zwischen dem stärksten (Treptow/Köpenick; 41,2 %) und dem schwächsten Wahlkreis (Steglitz/Zehlendorf; 31,6 %). Dagegen ist die Schwankungsbreite der anderen Parteien deutlich höher, bei der CDU beträgt sie 25,2 %, bei der PDS 27,4 % und selbst bei Bündnis 90/Die Grünen noch 18,5 %. Während bei den anderen Parteien eine deutliche Hochburgen- und Diasporenbildung zu beobachten ist, unterscheiden sich die SPD-Resultate auch zwischen konservativen geprägten Wahlkreisen wie Reinickendorf (35,1 %) oder alternativ geprägten Wahlkreisen wie Friedrichshain/Kreuzberg/Prenzlauer Berg-Ost (39,2 %) nur geringfügig. Diese für eine kontrastreiche Stadt wie Berlin bemerkenswerte Erscheinung trifft auch bei Abgeordnetenhauswahlen auf die Sozialdemokraten zu, allerdings seit Mitte der 1970er Jahre auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die Berliner SPD erfuhr einen in der deutschen Nachkriegsgeschichte beispiellosen Niedergang einer Volkspartei. Es ist zwar „ein bundesweiter Trend festzustellen, der Stimmenverluste für die SPD in Stadtstaaten und (…) Ballungsgebieten (…) anzeigt“51, allerdings ist er an keinem Ort in dieser Schärfe zu beobachten. Nachdem die Partei unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt bei der West-Berliner Abgeordnetenhauswahl 1963 noch 61,9 % der Stimmen erzielen konnte und die weithin dominierende politische Kraft der geteilten Stadt war, errang man bei der dritten Abgeordnetenhauswahl nach der Wiedervereinigung im Jahr 1999, nur noch 22,4 % der Stimmen und konnte keinen Wahlkreis gewinnen. Die Wahl 2001 zeigte nochmals das schwache Erscheinungsbild der Sozialdemokraten, die trotz eines populären Spitzenkandidaten und eines äußerst unpopulären Gegenkandidaten der CDU52 sowie einer für sie günstigen Stimmungslage infolge des hauptsächlich von der CDU verschuldeten Banken- und Spendenskandals, lediglich 29,7 % der Stimmen erringen konnten und damit sogar noch unter dem schwachen Ergebnis von 1990 (30,4 %) blieben.53 Die Gründe für diesen Niedergang liegen insbesondere im nach dem Wechsel Brandts in das Amt des Bundeskanzlers unattraktiven Parteipersonal und dem Erstarken der politischen Gegner. Ihre früheren Hochburgen hat sie seit den 1970er Jahren nach und nach abgeben müssen. Die äußeren und Arbeiterbezirke gingen an die in Berlin sozialpolitisch orientierte CDU verloren, in den 51 Vgl. Massing, Peter/Petratis, Mechthild; Berlin; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S. 149 52 Klaus Wowereit (seit Juni 2001 Regierender Bürgermeister von Berlin) war nach sämtlichen Umfragen im Vorfeld der Wahl der mit Abstand beliebteste Politiker in Berlin, während der CDU-Spitzenkandidat Frank Steffel stets Schlusslicht in dieser Rangliste war. 53 Vgl. www.election.de/hist/hist_be.html; aufgerufen am 02.09.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 30 innerstädtischen Bezirken verlor sie Stimmen an die „fundamentalistisch auftretende“54 Grüne/AL, im Ostteil der Stadt konnte sie den Vormarsch der PDS zur mit Abstand stärksten Partei nach anfänglichen Wahlerfolgen nicht verhindern. 3.1.4 Bremen und Hamburg Bei den norddeutschen Stadtstaaten bietet sich eine gemeinsame Betrachtung der Bundestagswahlergebnisse an, da diese zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen. Zum einen gelang es der SPD in beiden Bundesländern trotz Verlusten die eindeutig stärkste Partei zu bleiben (Bremen: 48,6 %; minus 1,6 %, Hamburg: 42,0 %; minus 3,7 %), zum anderen konnte man hier sämtliche Wahlkreise gewinnen. Sowohl in Bremen als auch in Hamburg gelang es den Sozialdemokraten seit 1949 bei allen Bundestagswahlen stärkste politische Kraft zu werden.55 Die beiden Stadtstaaten können vorbehaltlos als langjährige Hochburgen der Sozialdemokratie bezeichnet werden, allerdings sind sie nicht mehr so ausgeprägt wie noch in den 1970er Jahren, was auf das Erstarken der Bündnisgrünen (in Hamburg GAL) zurückzuführen ist. Die Gründe für die allgemeine Stärke der SPD liegen zum einen im bundesweit überdurchschnittlich hohen Arbeiteranteil (z.B. hoher Anteil an Werftenarbeitern in Bremen), sowie dem hohen Anteil an Protestanten, die in beiden Ländern aktuell über 60 % der Bevölkerung ausmachen. Zum anderen konnte die SPD insbesondere in Hamburg auch das bürgerliche Milieu für sich gewinnen, wie beispielsweise die große Gruppe der Kaufleute. Ähnlich wie in Berlin unterscheiden sich die Ergebnisse in den Wahlkreisen nur unerheblich. Auch bei Bürgerschaftswahlen waren die Sozialdemokraten in der Regel die dominierende politische Kraft, dabei in Bremen in stärkerem Maße. Im Zweistädtestaat oszillierte die SPD zwischen 1955 und 1987 stets um 50 %. Nach einem Tief bei den Wahlen 1991 und 1995, wo sie Stimmenverluste infolge des Erstarkens von DVU bzw. AFB erlitt, gelang es ihr seit 1999 wieder, die wichtige 40 %-Marke zu überspringen, was ihr die strukturelle Mehrheitsposition in der Stadt sichert. Mit Wilhelm Kaisen (1946 – 1965), Hans Koschnick (1967 – 1985) und Henning Scherf (seit 1995) hatten die Bremer Genossen über die Parteigrenzen hinweg anerkannte und beliebte Erste Bürgermeister, denen die anderen Parteien nichts entgegenzusetzen hatten bzw. haben. In Hamburg war bei Abgeordnetenhauswahlen bis 2001 eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Auch hier war die SPD in den 1960er und 1970er Jahren die dominierende Kraft und stellte seit 1957 den Ersten Bürgermeister. Wie in anderen Großstädten büßten die Vgl. Hoffmann, Hansjoachim; Berlin; in: Wehling, Hans-Georg (Hrsg.); Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 2000; S. 77 55 Die Bundestagswahlergebnisse für die SPD schwankten in Bremen zwischen 39,0 % (1953) und 58,1 % (1972), in Hamburg lagen die Ergebnisse zwischen 38,1 % (1953) und 54,6 % (1969). Vgl. Roth; Reinhold; Bremen; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; CampusVerlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S. 224 und: Decker, Frank; Hamburg; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; CampusVerlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S. 254 54 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 31 Sozialdemokraten auch hier an Dominanz ein, jedoch blieben sie die strukturelle Mehrheitspartei. Bei der Bürgerschaftswahl 2001 wurde die SPD zwar erneut mit klarem Abstand stärkste Partei, jedoch verlor sie erstmals nach 44 Jahren die Regierungsmehrheit an den so genannten Bürgerblock aus CDU, FDP und PRO. Bei den nach dem Koalitionsbruch notwendig gewordenen vorgezogenen Neuwahlen 2004 errang die CDU erstmals die absolute Mehrheit der Stimmen, die SPD folgte mit deutlichem Abstand auf Platz zwei. Durch die personelle Auszehrung im Laufe der 1990er Jahre und Überheblichkeit im Umgang mit wichtigen Wahlkampfthemen wie Innere Sicherheit hat die Partei vorerst den Status der Mehrheitspartei eingebüßt. Es dürfte vorerst zumindest fraglich sein, ob der Hamburger Landesverband mit seiner derzeit recht dünnen Personaldecke gegen den populären christdemokratischen Ersten Bürgermeister Ole von Beust eine realistische Chance erhält, an die Regierung zurückzukehren. Mit der GAL steht den Sozialdemokraten in der Opposition allerdings ein recht starker potenzieller Koalitionspartner zur Seite. 3.1.5 Hessen Mit 39,7 % konnte sich die SPD trotz eines Verlustes von 1,9 % knapp als stärkste Partei behaupten. Wie bundesweit, fällt auch in Hessen beim Betrachten der Wahlresultate ein starkes Nord-Süd-Gefälle auf. So befinden sich die stärksten Wahlkreise wie Werra-Meißner/Hersfeld (49,7 %), Schwalm-Eder (49,3 %) und Waldeck (48,4 %) allesamt im eher protestantisch geprägten Norden des Landes. Das mehrheitlich katholische Südhessen bietet den Sozialdemokraten ein deutlich ungünstigeres Terrain, weswegen mit Main-Taunus (31,3 %), Fulda (32,0 %) und Frankfurt/Main II (33,9 %) zwei der drei schwächsten Wahlkreise dort liegen. In Hessen fällt, verglichen mit anderen Bundesländern, eine untypische Ergebnisstruktur im StadtLand-Vergleich auf. Anders als in Bayern oder Nordrhein-Westfalen fallen die SPDStimmenanteile in hessischen Städten und Ballungsräumen (Frankfurt/Main, Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt) mit Ausnahme von Kassel (47,9 %) nur durchschnittlich bis schwach aus. Die in Hessen realpolitisch orientierten Grünen haben der SPD zunehmend Stimmen abgenommen. Anders als in Baden-Württemberg ist ihnen dies nicht nur in Städten mit hohem Studentenanteil wie Darmstadt oder Marburg gelungen, sondern auch in ländlichen Wahlkreisen. Die hessische SPD hat ihre Vormachtstellung bei Landtagswahlen im „Geburtsland von RotGrün“56 vollständig eingebüßt. Nachdem sie bereits 1975 erstmals nicht stärkste Partei wurde, verlor sie 1987 zum ersten Mal die Regierungsmehrheit. Auch wenn sie diese 1991 wieder zurückgewinnen konnte, fiel sie 1995 hinter die CDU zurück und ist seit 1999 wieder in der Opposition. Bei der letzten Landtagswahl 2003 unterschritt sie sogar die 30%-Marke und dürfte sich auch mittelfristig mit der Oppositionsrolle im Landtag abfinden müssen. Seit dem Wechsel 56 In Hessen wurde 1985 die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene gebildet. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 32 der Führungsfigur Hans Eichel in die Bundesregierung leidet der Landesverband unter einer starken Personalschwäche. Auf kommunaler Ebene zeigt sich ebenso wie bei Bundestagswahlen beim Betrachten der SPDErgebnisse alles andere als ein klassisches Bild. Bei der letzten Kommunalwahl 2001 gelang es den Sozialdemokraten zwar, in der Mehrzahl der ländlichen Bezirke, Mehrheiten in den Gemeinderäten zu gewinnen, in den Großstädten fielen die Resultate jedoch mäßig aus, in den beiden größten Städten Frankfurt und Wiesbaden konnte die CDU deutlich besser abschneiden. Die Christdemokraten stellen auch mittlerweile die Mehrheit der Oberbürgermeisterposten im Land. Der hessische Landesverband ist wie kaum ein anderer in Deutschland durch eine starke programmatische Zweiteilung geprägt. „Während die nordhessischen Sozialdemokraten eher als pragmatisch orientiert gelten, ordnet man die SPD Südhessen und insbesondere Frankfurts dem linken Spektrum der Partei zu.“57 Der Bezirk Hessen-Nord ist mit etwa 35.000 Mitgliedern nur etwa halb so stark wie Hessen-Süd, allerdings konnten die Nordhessen durch die programmatische Nähe zu SPD-Ministerpräsidenten, wie Holger Börner oder Hans Eichel, stets erfolgreicher und effektiver agieren. So kam es erst nach Zustimmung der Nordhessen zu einer Zusammenarbeit mit den Grünen, die Hessen-Süd schon länger gefordert hatte. Insgesamt kann man die hessische SPD in ihrer Programmatik als eindeutig stärker arbeitnehmerorientiert als die Bundespartei bezeichnen. 3.1.6 Niedersachsen Das Bundesland zwischen Harz und Emsland brachte den Sozialdemokraten bei Bundestagswahlen traditionell überdurchschnittliche Ergebnisse. Bei den Wahlen 1998 und 2002 profitierten die niedersächsischen Genossen zusätzlich von der Kanzlerkandidatur des Niedersachsen Gerhard Schröder. Somit konnten sie 2002 mit 47,8 % trotz leichter Verluste von 1,6 % ein herausragendes Resultat erzielen und 25 der 29 Wahlkreise gewinnen. In Niedersachsen befindet sich mit dem Wahlkreis Aurich/Emden (61,7 %) die bundesweite Hochburg der Sozialdemokraten. Weitere starke Ergebnisse erzielte die SPD primär im Südosten (Salzgitter/Wolfenbüttel; 53,1 % und Helmstedt/Wolfsburg; 52,5 %) sowie Nordwesten des Bundeslandes (Friesland/Wilhelmshaven; 52,0 %; Delmenhorst/Wesermarsch/Oldenburg-Land; 51,4 %). Dagegen fallen die Resultate im Südwesten (Cloppenburg/Vechta; 28,1 % und Mittelems; 38,0 %) traditionell schwach aus. Die Protestanten stellen mit 62 % den größten Anteil aller Konfessionsgruppen in Niedersachsen. Der hohe Anteil an Arbeitern im Ostteil des Landes (Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter) begünstigt ebenfalls ein gutes Abschneiden der Sozialdemokraten. Die Katholiken stellen 57 Vgl. Schiller, Theo/Winter, Thomas von; Hessen; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S. 286 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 33 lediglich im südlichen und mittleren Emsland die Mehrheit, wo mit dem Wahlkreis CloppenburgVechta die am stärksten ausgeprägte Hochburg von CDU/CSU außerhalb Bayerns liegt. Die Landtagswahlergebnisse unterschieden sich relativ unerheblich von Bundestagswahlergebnissen, allerdings war die SPD bei Landtagswahlen zumeist etwas erfolgreicher. Sie war von 1947 bis 1970 stets stärkste politische Kraft im Land und stellte bis 1976, bis auf die Zeit zwischen 1955 und 1959, den Ministerpräsidenten. Im Jahr 1976 musste sie den Gang in die Opposition antreten, in der sie bis 1990 verblieb. Mit Gerhard Schröder als Spitzenkandidaten gelang ihr 1990 die Rückkehr an die Regierung und 1998 erzielte sie mit 47,9 % sogar das beste Resultat bei einer niedersächsischen Landtagswahl überhaupt. Doch nur fünf Jahre später stürzte die SPD infolge der ungünstigen bundespolitischen Großwetterlage auf das schlechteste Ergebnis in Niedersachsen – auf 33,4 % – ab. Seitdem befindet sich die Partei wieder in der Opposition. Der eher pragmatisch orientierte Landesverband war personell stets stark an SPD-geführten Bundesregierungen beteiligt, sowohl in der sozial-liberalen Ära als auch unter Gerhard Schröder. Die durch den Wechsel Schröders in das Amt des Bundeskanzlers im Herbst 1998 entstandene „Lücke“ wurde durch als charismatisch geltende Sozialdemokraten wie Gerhard Glogowski und nach dessen Rücktritt Ende 1999 Siegmar Gabriel geschlossen. Letzterer wurde nach seiner Abwahl im Februar 2003 Oppositionsführer und dürfte bei der Landtagswahl 2008 gegen den christdemokratischen Ministerpräsidenten Christian Wulff wieder als SPD-Spitzenkandidat antreten. Bei einer besseren bundespolitischen Stimmung für die Partei ist ihr mittelfristig eine Rückkehr an die Regierung im Bundesland zuzutrauen. Die niedersächsische SPD ist kommunal nach wie vor stark verankert. Sie lag bei den letzten Wahlen landesweit zwar knapp hinter der CDU, jedoch stellt sie die Oberbürgermeister von wichtigen Städten wie Göttingen, Oldenburg oder der Landeshauptstadt Hannover. 3.1.7 Nordrhein-Westfalen Im auch als „rotes Kernland“ bezeichneten Bundesland an Rhein und Ruhr vermochte die SPD ebenso wie in Niedersachsen überdurchschnittliche Resultate zu erzielen, wenn auch in schwächerem Maße. Landesweit erreichte sie 43,0 %, gegenüber 1998 verlor sie 3,9 %, bleibt aber mit klarem Abstand stärkste Partei im Land. Ihre besten Ergebnisse erzielte sie im nach wie vor industriell geprägten Ruhrgebiet. So gelangen ihr in den Wahlkreisen Duisburg II (59,1 %), Herne/Bochum II (57,8 %), Oberhausen/Wesel III (57,0 %), sowie Gelsenkirchen (56,5 %) herausragende Resultate. Der größte deutsche Wirtschaftsraum sicherte der SPD in den vergangenen Jahrzehnten bei Landtagswahlen stets eine Regierungsmehrheit, denn außerhalb des Kommunalverbands Ruhrgebiet finden sich im einwohnerstärksten Bundesland keine ausgesprochenen SPD-Hochburgen. Im Ruhrgebiet „hat sie seit den 60er Jahren ihre [bundesweit; Anm. des Verfassers] stärkste Bastion, gemessen sowohl am wahlpolitischen Erfolg Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 34 als auch der Anzahl der Parteimitglieder.“58 Lediglich im protestantischen Ostwestfalen kann die Partei noch relativ starke Ergebnisse erzielen. Ansonsten stellt Nordrhein-Westfalen kein überaus einfaches Terrain für die Sozialdemokraten dar. Die mehrheitlich katholische Bevölkerung59 sichert der CDU in den ländlichen Räumen außerhalb Ostwestfalens die strukturelle Mehrheit. In den zahlreichen Universitätsstädten des Landes (Aachen, Köln, Bonn, Münster, Bielefeld) muss sich die NRW-SPD, ähnlich wie in Baden-Württemberg, mit starken Bündnisgrünen auseinandersetzen, die wiederum in diesen Städten flächendeckend klar zweistellige Ergebnisse erreichen. Die Diasporen der SPD liegen folgerichtig in Paderborn (29,1 %), Rhein-Sieg-Kreis II (32,2 %) und Bonn (32,6 %). Während in Nordrhein-Westfalen bis in die 1960er Jahre hinein die CDU bei Landtagswahlen dominierte, konnte sich die SPD stetig verbessern, so dass ihr 1966 der Machtwechsel gelang. Seither sind die Sozialdemokraten Regierungspartei an Rhein und Ruhr, wobei sie zunächst mit der FDP (1966-1980), dann alleine (1980-1995) und seit 1995 mit den Grünen regierte. Prozentual waren die Ergebnisse bei Landtagswahlen den Bundestagswahlergebnissen bis Ende der 1970er Jahre recht ähnlich. Doch mit der Übernahme des Ministerpräsidentenamtes durch Johannes Rau im Jahr 1978 konnte sich die SPD in diesem Bundesland zur dominierenden politischen Kraft entwickeln. Sie errang in den 1980er Jahren nicht nur klare absolute Mehrheiten, sondern übertraf auch eindeutig ihre Bundestagswahlresultate. Seit dem Rücktritt Raus 1998 haben sich die Ergebnisse wieder angeglichen. Unter Wolfgang Clement konnte die rot-grüne Koalition ihre Mehrheit bei der letzten Landtagswahl knapp behaupten, ihre klar dominierende Stellung im Parteiensystem indes hat die SPD wieder verloren. Auf kommunaler Ebene hat die NRW-SPD ihre einst starke Gestaltungskraft fast komplett eingebüßt. Bei den Kommunalwahlen von 1999 und 2004 musste sie dramatische Verluste hinnehmen. Darüber hinaus verlor sie zahlreiche wichtige Oberbürgermeisterposten, wie die von Köln, Düsseldorf, Essen, Duisburg und Bielefeld, an die CDU. Seit dem Wechsel von Wolfgang Clement in das Amt des Bundeswirtschaftsministers nach der Bundestagswahl 2002 offenbart sich nun ein personelles Defizit für die Sozialdemokraten im Land. Da der Landesvorsitzende Harald Schartau aufgrund der nicht vorhandenen Mitgliedschaft im Landtag Clement nicht beerben konnte, musste mit Peer Steinbrück ein nicht aus NordrheinWestfalen stammender SPD-Politiker als Ministerpräsident inthronisiert werden. Ein Machtverlust nach der Landtagswahl im Mai 2005 ist derzeit nicht unwahrscheinlich. 3.1.8 Rheinland-Pfalz/Saarland Die beiden südwestlichsten deutschen Bundesländer sind strukturell relativ verschieden, was in den Wahlergebnissen der SPD grundsätzlich Niederschlag fand. Rheinland-Pfalz ist ein stark 58 Vgl. Biegler, Dagmar/Frey, Birgit/Kleinfeld, Ralf; Nordrhein-Westfalen; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997; S. 414 59 46 % der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens ist katholisch, lediglich 30 % evangelisch. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 35 katholisch und von Landwirtschaft geprägtes Land mit lediglich zwei Ballungsräumen (Mainz und Ludwigshafen), während im Saarland der Kohlebergbau nach wie vor im Landschaftsbild vorherrschend ist und einen hohen Anteil an Arbeitern zur Folge hat. Im Saarland mussten die traditionell starken Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl 2002 deutliche Verluste in Höhe von 6,4 % hinnehmen, konnten mit 46,0 % jedoch mit Abstand stärkste Partei bleiben. Dabei weisen die Wahlkreisergebnisse kaum Unterschiede auf, in sämtlichen Wahlbezirken oszilliert die Partei um einen Stimmenanteil von 46 %. Nachdem man im Saarland nach der Rückgabe durch Frankreich an Deutschland bis Mitte der 1960er Jahre bei Bundestagswahlen zunächst nur schwache Resultate erzielen konnte, errang man seit 1972 durchweg über 40 % der Stimmen und war zumeist stärkste Partei. In Rheinland-Pfalz mussten sich die Sozialdemokraten, nachdem es ihnen 1998 gelungen war, erstmals überhaupt bei einer Bundestagswahl stärkste Partei im Land zu werden, nach einem Stimmenanteil von 38,2 % und einem Verlust von 3,1 % wieder mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Die Wahlkreisergebnisse sind auch hier relativ ausgewogen, es gibt nur vergleichsweise geringe Unterschiede zwischen Stadt und Land. Das beste Ergebnis erzielte sie in Kaiserslautern (44,7 %), das schlechteste in Bitburg mit 32,5 %. Generell fallen die Resultate im Nordwesten des Landes etwas schwächer aus. Die eher pragmatische Ausrichtung des Landesverbandes unter Ministerpräsident Kurt Beck, hat sich in einem konservativen Bundesland wie Rheinland-Pfalz als durchaus hilfreich erwiesen. Die saarländische SPD tritt erst seit 1955 bei Landtagswahlen an und blieb zunächst auf schwachem Niveau (14,3 %), konnte sich bis 1990 allerdings steigern und stellte 1985 mit Oskar Lafontaine erstmals den Ministerpräsidenten. 1999 verlor sie die Regierungsmehrheit wieder an die CDU, bei der letzten Landtagswahl 2004 sank sie mit 30,8 % wieder auf das Niveau von 1960. Den wichtigen Oberbürgermeisterposten von Saarbrücken konnte die Partei jedoch verteidigen. Mittelfristig ist mit einem Rückgewinn der Regierungsmacht durch den linksgerichteten Landesverband nicht zu rechnen, da den Sozialdemokraten im Saarland mit den vergleichsweise schwachen Grünen ein recht unsicherer Partner zur Seite steht, der fortwährend um den Einzug in den Landtag bangen muss. Darüber hinaus kann man nach dem Ende der politischen Karrieren von Lafontaine und Reinhard Klimmt derzeit kein für die Wähler attraktives Personal anbieten. Der rheinland-pfälzische Landesverband hingegen gehört zu den wenigen SPD-Landesverbänden, in denen eine eindeutig positive Entwicklung in den vergangenen Jahren zu beobachten ist. 1991 gelang es der Partei unter Rudolf Scharping erstmals, die Regierungsmehrheit zu gewinnen, die sie in den Folgewahlen verteidigen konnte. Dabei haben die Sozialdemokraten im Land mittlerweile eine Art Hegemonialstellung im Parteiensystem erworben, weswegen es schwer wird, sie aus der Regierung zu verdrängen. Die oppositionelle und personell ausgezehrte CDU hat Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 36 keinen potenziellen Koalitionspartner – das Verhältnis zu den Grünen ist unterkühlt, und die FDP stellt mit der SPD die Regierung und möchte nach Möglichkeit diese Koalition fortsetzen. Auf kommunaler Ebene gelang es den Sozialdemokraten zwar in den 1980er Jahren ebenfalls, Boden gut zu machen gegenüber der lange dominierenden CDU, jedoch musste sie bei den letzten beiden Kommunalwahlen 1999 und 2004 wieder starke Einbußen hinnehmen. Sie stellt zwar weiterhin die Oberbürgermeister von Mainz und Koblenz, allerdings büßte sie die lange Zeit sicheren OB-Posten in Ludwigshafen und Kaiserslautern ein. Sie stellt derzeit nur in wenigen kommunalen Vertretungen die Mehrheit, die CDU hat nicht zuletzt wegen der bundesweiten politischen Großwetterlage ihre kommunale Vormachtstellung wieder zurück gewonnen. 3.1.9 Schleswig-Holstein Im nördlichsten Bundesland wurde die SPD trotz Verlusten von 2,5 % erneut stärkste Partei und erreichte 42,9 %. Ähnlich wie in Rheinland-Pfalz und Hessen waren die Schwankungen innerhalb der Wahlkreise recht gering. Mit 47,7 % konnte sie in Lübeck, der zweitgrößten Stadt des Landes, zwar das beste Ergebnis erzielen, allerdings liegt dieser Wert nur 7,7 % über dem des schlechtesten Wahlkreises (Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd). Darüber hinaus konnten die Sozialdemokraten bis auf Nordfriesland/Dithmarschen-Nord sämtliche Direktmandate gewinnen. Die ungewöhnliche Stärke der SPD in den ländlichen Räumen liegt vor allem, ähnlich wie in Niedersachsen, an der mehrheitlich protestantischen Bevölkerung.60 Es überrascht daher nicht, dass die Partei seit 1957 bei Bundestagswahlen in Schleswig-Holstein stets überdurchschnittlich abschnitt. Als eine SPD-Hochburg kann man das Bundesland indes nicht bezeichnen, da sich CDU und SPD als stärkste Partei „abwechselten“, wobei die Christdemokraten etwas häufiger vorn lagen. Obwohl von 1950 bis 1988 in der Opposition, konnten die Sozialdemokraten bei Landtagswahlen seit 1958 grundsätzlich Ergebnisse von knapp 40 % und darüber erzielen. Infolge der BarschelAffäre 1987 gelang der SPD mit Björn Engholm 1988 der Regierungswechsel, zunächst regierte sie allein, seit 1996 gemeinsam mit den Bündnisgrünen. Mit Heide Simonis stellt die Nord-SPD seit 1993 die erste und bis heute einzige Ministerpräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik. Auf kommunaler Ebene ist der traditionell eher dogmatisch orientierte Landesverband nach langjähriger Dominanz bei der Kommunalwahl 2003 deutlich hinter die CDU zurückgefallen. Seitdem ist die SPD in keinem Gemeinderat oder Kreistag Mehrheitsfraktion, darüber hinaus verlor sie erstmals den wichtigen Oberbürgermeisterposten der Landeshauptstadt Kiel. Im Falle eines nicht gänzlich unwahrscheinlichen Machtverlustes 2005 wäre der Landesverband infolge des Abgangs von Heide Simonis personell ausgehöhlt, ein ebenbürtiger Nachfolger der populären Ministerpräsidentin ist derzeit nicht in Sicht. 60 Lediglich 6 % der Bevölkerung Schleswig-Holsteins sind katholisch, 63 % sind evangelisch. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 37 3.1.10 Die neuen Bundesländer Die Wähler im Osten der Republik haben der rot-grünen Koalition die Mehrheit gesichert, die in den alten Bundesländern verloren ging. Mit 39,7 % gelang es erstmals seit der deutschen Einheit einer Bundestagspartei, mit Ausnahme der PDS, in den neuen Ländern einen höheren Stimmenanteil als in den alten Ländern (38,1 %) zu erringen. Dabei gab es vor allem ein Wahl entscheidende Thema, mit dem die Sozialdemokraten in Ostdeutschland punkten konnten: Das konsequente „Nein“ der Bundesregierung zu einem möglichen Irak-Krieg. Hiermit konnten insbesondere der PDS pazifistisch orientierte Wähler abspenstig gemacht werden. Der Wählerstrom von der PDS zur SPD in den neuen Ländern gehörte zu den bedeutendsten Trends dieser Bundestagswahl.61 Mit 46,4 % erzielt sie dabei in Brandenburg ihr bestes Ergebnis, gefolgt von Sachsen-Anhalt (43,2 %), Mecklenburg-Vorpommern (41,7 %), Thüringen (39,9 %) und Sachsen (33,3 %). Abgesehen von Sachsen liegen die Sozialdemokraten in sämtlichen Ländern deutlich vor der CDU, in lediglich vier Wahlkreisen – die sich wiederum ausschließlich in Sachsen befinden – rutschte sie unter 30 % der Stimmen. Ihr bestes Resultat in den neuen Ländern erzielten die Sozialdemokraten in Prignitz/Ostprignitz-Ruppin/Havelland I mit 49,5 %, am schwächsten schnitt sie in Sächsische Schweiz/Weißeritzkreis (27,5 %) ab. Damit ist der Unterschied zwischen dem stärksten und schwächsten Wahlkreis in der gesamten ehemaligen DDR geringer als in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Diese bisher nicht gekannte elektorale Stärke der SPD in Ostdeutschland wurde durch die deutlich schwächeren Bindungen der Wähler an die Parteien ermöglicht. So gibt es hier weder ein ausgeprägtes Arbeiter-, noch Alternativen- oder katholisches Milieu, welches einen gewissen Grad an Stammwählern ermöglichen würde. Der Anteil an Wechselwählern ist in den neuen Ländern folgerichtig wesentlich höher als in Westdeutschland. Die SPD hat bei den Bundestagswahlen 1998 und 2002 davon profitiert, bei den letzten Landtagswahlen hingegen hat sich Ostdeutschland zu einer Diaspora für die Partei entwickelt. So ist sie in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt jeweils unter 20 % der Stimmen und hinter CDU und PDS zurückgefallen, lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg konnte sie mehr als 30 % erzielen. Da sich die SPD anders als CDU und PDS nach der Wende 1989/90 neu gründen musste, sind auch die Mitgliederbasis sowie das Stammwählerpotenzial zusätzlich geringer als bei zuvor genannten Parteien. Bei einer bundesweit ungünstigen Stimmung läuft die SPD daher stets Gefahr, ins Bodenlose abzustürzen. Die Sozialdemokraten werden in Landtagswahlkämpfen zwischen einer sich betont als ostdeutsche Partei artikulierenden PDS und einer nicht selten mit attraktivem Spitzenpersonal antretenden CDU (z.B. Kurt Biedenkopf, Eberhard Vogel) nicht mehr ausreichend wahrgenommen. 61 Laut Wahltagsbefragungen von Infratest-Dimap verlor die PDS knapp 300.000 Wähler an die SPD. Vgl. Der Spiegel, Wahlsonderheft ´02 vom 24.09.2002; S. 42 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 38 Auch auf kommunaler Ebene musste die SPD erheblich Federn lassen. Sie ist flächendeckend hinter CDU und PDS auf den dritten Platz zurückgefallen. Allerdings hält sie die Mehrheit der Oberbürgermeisterposten in den neuen Ländern. Mit Manfred Stolpe, Matthias Platzeck, Harald Ringstorff und Wolfgang Tiefensee (Oberbürgermeister von Leipzig) hat die ostdeutsche SPD zwar nicht wenige „Aushängeschilder“, jedoch stellen die dünne Personaldecke und der enorme Mitgliederschwund ein Problem für die Partei dar. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich die Resultate bei Landtags- und Kommunalwahlen mittelfristig nicht erheblich verbessern werden. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 39 3.2 Landtagswahlen in der Ära Schröder – viele Niederlagen, wenig Siege62 Traditionell verlaufen Landtagswahlen im Großen und Ganzen ungünstig für die die Bundesregierung führende Partei, wobei partiell auch der kleine Koalitionspartner hiervon betroffen sein kann. Die SPD-Resultate bei Landtagswahlen seit der Regierungsübernahme auf Bundesebene im Oktober 1998 fallen sehr ernüchternd aus. Bereits im Februar 1999 erlitt die SPD mit dem Machtverlust in Hessen die erste Niederlage bei der ersten Landtagswahl nach dem Bonner Machtwechsel. Zwar konnte sie 1,4 % hinzugewinnen und erreichte 39,4 %, jedoch ging die Regierungsmehrheit aufgrund der hohen Verluste der Grünen von 4,0 % verloren. Die rot-grüne Bundesregierung hatte infolgedessen bereits nach gut drei Monaten Amtszeit ihre absolute Mehrheit im Bundesrat eingebüßt. Es folgte im Juni zwar ein deutlicher Hinzugewinn in Bremen von 9,2 %, doch die Landtagswahlen im Herbst 1999 wurden für die Sozialdemokraten zum Fiasko. 39,3 % in Brandenburg (minus 14,8 %), 44,4 % im Saarland (minus 5,0 %), 18,5 % in Thüringen (minus 11,1 %), 22,4 % in Berlin (minus 1,2 %) und 10,7 % in Sachsen (minus 5,9 %) – das schlechteste SPD-Ergebnis bei Landtagswahlen überhaupt – bedeuteten schwere Niederlagen. Dabei verlor sie im Saarland die Regierungsmehrheit, in Brandenburg die absolute Mehrheit, und in Thüringen musste sie aus der großen Koalition ausscheiden. In Wahlumfragen im Herbst 1999 erreichte man bundesweit durchschnittlich nur noch gut 30 %. Infolge des Spendenskandals der CDU verbesserte sich die Stimmung für die SPD zum Ende dieses unerfreulichen Jahres wieder deutlich, sie stieg in Umfragen über 40 %. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Fühjahr 2000 gelang der Partei schließlich wieder ein Wahlsieg. Sie erreichte 43,1 %, was einem Stimmengewinn von 3,3 % entsprach. Im Norden konnte die amtierende rot-grüne Koalition ebenso fortgesetzt werden wie in Nordrhein-Westfalen nach der dortigen Landtagswahl im Mai 2000. Allerdings musste man an Rhein und Ruhr Verluste von 3,2 % hinnehmen und konnte mit 42,8 % zusammen mit den ebenfalls geschrumpften Grünen (7,0 %) die Mehrheit nur knapp behaupten. Betrachtet man die Wahlergebnisse für sich allein, kann das Jahr 2001 als das bisher mit Abstand erfolgreichste in der Ära Schröder bezeichnet werden, wenngleich man erneut Stimmenverluste im Bundesrat zu beklagen hatte. Bei den Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg (33,3 %) und Rheinland-Pfalz (44,8 %) war die SPD mit Gewinnen von 8,2 % bzw. 5,0 % die große Wahlsiegerin, wobei sich an der Regierungszusammensetzung in beiden Ländern allerdings nichts änderte. Im September 2001 konnten die Sozialdemokraten in Hamburg ihr Ergebnis zwar geringfügig um 0,3 % auf 36,5 % verbessern, doch ähnlich wie in Hessen 1999 verloren sie durch die starken Verluste der Grünen erstmals seit 44 Jahren die Regierungsmehrheit. Wenige Wochen 62 Die Daten sind www.election.de und www.wahlrecht.de entnommen, teilweise auch eigene Recherche. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 40 später konnte die SPD bei den vorgezogenen Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin wieder deutlich zulegen (plus 7,3 %) und erzielte 29,7 %. Zu Beginn des Wahljahres 2002 rutschte die SPD infolge der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur Edmund Stoibers in Umfragen wieder deutlich unter 40 %. Die einzige Landtagswahl im Vorfeld der Bundestagswahl im April 2002 in Sachsen-Anhalt bedeutete eine dramatische Niederlage für die Genossen. Man fiel von 35,9 % auf 19,9 % nicht nur vom ersten auf den dritten Platz hinter die PDS zurück, sondern musste den Gang in die Opposition antreten. Durch die Regierungsübernahme von CDU und FDP in Sachsen-Anhalt errang die bürgerliche Opposition erstmals seit 1991 wieder eine absolute Mehrheit im Bundesrat. Durch einen Stimmungsumschwung wenige Wochen vor der Bundestagswahl gelang es Rot-Grün nach monatelangem Umfragetief, die Regierungsmehrheit knapp zu behaupten. Der SPD-Erfolg bei der zeitgleichen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fiel mit 40,6 % und einem Gewinn von 6,3 % überraschend hoch aus, gleichzeitig war es das beste SPD-Ergebnis im Nordosten und das zweitbeste bei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern überhaupt. Bereits wenige Wochen nach der Bundestagswahl verschlechterte sich die Stimmung für die Sozialdemokraten wieder erheblich. Bei den Wahlen in Niedersachsen und Hessen folgten dramatische Verluste für die Partei. So büßte man in Niedersachsen 14,5 % der Stimmen ein und fiel auf 33,4 % – dem schlechtesten Nachkriegsergebnis – zurück. In Hessen erzielte man mit 29,3 % ebenfalls das schlechteste Ergebnis aller Zeiten und erlitt ebenso einen zweistelligen Stimmenverlust von 10,1 %. Seitdem pendeln die Sozialdemokraten in bundesweiten Umfragen zwischen 25 und 33 %. Im September 2003 folgte mit einem Stimmenanteil von 19,6 % in Bayern eine weitere schwere Niederlage (minus 8,9 %). Die Niederlagenserie setzte sich auch im Jahr 2004 fort. In Hamburg erlitt man mit 30,7 % einen Verlust von 5,8 %, im Juni erreichte die Partei in Thüringen nur 14,5 % (minus 4,0 %). Der Herbst 2004 brachte mit den Landtagswahlen im Saarland (30,5 %; minus 13,9 %), in Brandenburg (31,9 %; minus 7,2 %) und Sachsen (9,8 %; minus 0,9 %) weitere Abfuhren. In der Ära Schröder erzielte die SPD in den letzten vier Jahren ihre schlechtesten Landtagswahlresultate seit Kriegsende in Bayern, Niedersachsen, Hessen, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg. In Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Saarland musste die SPD die Regierungsmehrheit abgeben, konnte im Gegenzug der CDU mit Berlin lediglich ein Bundesland „abnehmen“. Derzeit werden nur noch Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen von einer rot-grünen Koalition regiert, womit der Bundesregierung im Bundesrat nur noch zehn von 69 Stimmen sicher sind. Im Falle eines Regierungswechsels in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2005 hätte ein Oppositionsbündnis im Bundesrat erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Zweidrittel-Mehrheit. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 41 4. Die programmatische und gesellschaftliche Stellung der SPD Die potenziellen Perspektiven für die SPD korrelieren eng mit der Programmatik der Partei, ihrer historischen und aktuellen Stellung in der Gesellschaft und insbesondere dem Verhältnis zu anderen politischen Parteien und Interessenverbänden. Dieses Kapitel soll sich deshalb ausführlich mit dem innerparteilichen, parlamentarischen und gesellschaftlichen Standort der Partei befassen. Als Interessenverband soll dabei beispielhaft ein Blick auf das Verhältnis zum DGB geworfen werden, da die Sozialdemokratie diesem auch historisch stets eine sehr große Bedeutung beigemessen hat, während das Verhältnis zu Kirchen und Arbeitgeberverbänden eher als nüchtern bezeichnet werden kann. 4.1 Parteien in der Partei – Die Flügel der SPD Mit über 600.000 Mitgliedern bietet die SPD zwangsläufig ein breites Spektrum an Meinungen und politischen Richtungen. Zwar bekennen sich die Mitglieder zu den Grundzielen der Sozialdemokratie – was bekanntlich auch Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft ist – allerdings finden sich gerade in wirtschaftspolitischen Fragen teilweise erhebliche Differenzen zwischen so genannten Parteilinken und Parteirechten. Eine Mitgliederpartei, wie es die SPD (noch) ist, die eine innerparteiliche Willensbildung von unten nach oben zum Prinzip hat, besteht zwangsläufig aus verschiedenen politischen Strömungen. Historisch betrachtet bestand die SPD immer aus mehreren innerparteilichen Flügeln. Bereits die Vereinigung des 1863 von Ferdinand Lassalle gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) und der 1869 von Wilhelm Liebknecht und August Bebel gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1875 in Gotha hatte die Entstehung verschiedener politischer Richtungen in der Partei zur Folge. Allerdings waren Intensität und Motivation der innerparteilichen Konflikte ständigen Schwankungen unterworfen. Jürgen Dittberner fasst das Binnenleben der SPD auch in historischer Perspektive recht prägnant zusammen: „Waren es in früheren Zeiten Marxisten und Revisionisten, die um Programme und Macht rangen, so in der Bundesrepublik ´rechte´ und ´linke´ Flügel, die sich bis zum Bundesparteitag und Bundesvorstand hin bekämpften. Ganze Regionalverbände wurden ideologisch zugeordnet. Hessen-Süd war ein klassisch linker Bezirk, Berlin ein mehr rechter. Die Jugendorganisationen, die Jungsozialisten und besonders die Studentenverbände SDS und SHB gehörten zur Linken, während die Gewerkschafter zum rechten Flügel gezählt wurden.“63 Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre lief die Konfliktlinie eher entlang der Frage Ökonomie versus Ökologie, was durch die neu entstandenen Grünen verstärkt wurde. Während 63 Vgl. Dittberner, Jürgen; Sind die Parteien noch zu retten?; Logos-Verlag; Berlin, 2004; S. 210 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 42 Sozialdemokraten wie Erhard Eppler der SPD ein eher ökologisches Antlitz geben wollten, drängte insbesondere der gewerkschaftlich orientierte Flügel auf die Beibehaltung des primären wirtschaftspolitischen Ziels „Wachstum und Vollbeschäftigung“. Die teilweise sehr intensiv ausgetragenen innerparteilichen Kontroversen waren mitverantwortlich für das Ende der sozialliberalen Koalition 1982, da gerade die Parteilinken Helmut Schmidt bei Dekreten wie dem NATO-Doppelbeschluss die Gefolgschaft versagten. Auch bis weit in die 1980er Jahre hinein litt die SPD unter der mangelnden Geschlossenheit, was beim Bundestagswahlkampf 1987 seinen Höhepunkt fand, als diverse Gegner in der Partei, darunter der damalige niedersächsische Fraktionsvorsitzende Gerhard Schröder, den Kanzlerkandidaten Johannes Rau offen kritisierten und damit die ohnehin geringen Chancen der SPD, die Regierung Kohl abzulösen, zusätzlich schmälerten. In den Jahren 1996/97 wurde eine Gruppierung in so genannte „Modernisierer“ und „Traditionalisten“ ausgemacht. Dabei wurde der damalige niedersächsische Ministerpräsident Schröder als wichtigster Fürsprecher der ersten Gruppe wahrgenommen, während Oskar Lafontaine, seinerseits Ministerpräsident des Saarlands, als Protagonist letzterer Gruppe dem gegenüberstand. Tatsächlich wichen die Konfliktstrukturen innerhalb der SPD von dieser Einschätzung ab, wie Analysen von Andreas Timm oder Ulrich von Alemann belegen. Die „Modernisierer“ stellten keineswegs einen großen Anteil in der Partei dar. Es handelte sich um eine „kleine Gruppe um Gerhard Schröder und den (…) nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement, die vor allem davon lebte, sich gegen den Mainstream der eigenen Partei zu profilieren.“64 Die Tatsache, dass sowohl die als Parteilinke geltende damalige Juso-Vorsitzende Andrea Nahles als auch Harald Ehrenberg, Mitglied des konservativen Seeheimer Kreises, zu Schröders größten innerparteilichen Kritikern gehörten, dokumentiert dies eindrucksvoll. Lafontaine als Parteivorsitzender füllte vielmehr die Position des Vermittlers aus, wenngleich er nicht zuletzt aufgrund der noch offenen Frage der Kanzlerkandidatur bereits vor seinem spektakulären Rücktritt im März 1999 als innerparteilicher Gegner Schröders galt. Konfliktpotenzial innerhalb der SPD boten Fragen zur Ausbildungsplatzabgabe, der Höhe des Spitzensteuersatzes oder der ökologischen Steuerreform. Die heutigen innerparteilichen Rivalitäten und die heftig ausgetragenen Diskussionen auf Regionalkonferenzen über Themen wie Arbeitslosengeld II, Mindestlöhne, 1-Euro-Jobs oder Ausbildungsplatzabgabe dokumentieren in starkem Maße die Heterogenität der Partei. Die von Schröder und Lafontaine viel beschworene Geschlossenheit im Bundestagswahlkampf 1998 ist somit nur als vorübergehender Zustand anzusehen. Andreas Timm spricht in diesem Zusammenhang von einer „Spiegelstrich-Demokratie“65 in der SPD, da jede Interessengruppe der Partei im Leitantrag „ihren“ Passus erhält, um auf Bundesparteitagen allzu große Diskussionen zu 64 Vgl. Timm, Andreas; Die SPD-Strategie im Bundestagswahlkampf 1998; Verlag Dr. Kovac; Hamburg, 1999; S. 61 65 Vgl. Timm, a. a. O., S. 59 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 43 vermeiden. Auf Dauer erscheint ein programmatischer Konsens nur oberflächlich möglich, weswegen der SPD in ihren Inhalten und Zielen ein zu hohes Maß an Beliebigkeit drohe. Des weiteren sieht Timm in einer geringen Orientierungskraft des Grundsatzprogramms für das Gros der Parteimitglieder einen weiteren Grund für die Heterogenität der politischen Ansichten. Dabei habe das Berliner Programm seinen größten Schwachpunkt darin, dass es in den 1980er Jahren entwickelt wurde und nun im Zuge der weltweiten politischen und wirtschaftlichen Umbrüche 1989/90 an Aktualität und Verbindlichkeit eingebüßt hat. Bei den verschiedenen Parteiflügeln ist jedoch zu beachten, dass es sich um informelle Interessengemeinschaften handelt. Lediglich in der Bundestagsfraktion kann von eindeutigen Gruppierungen gesprochen werden. Die bedeutendsten sind hier der „Seeheimer Kreis“, die „Parlamentarische Linke“ und das „Netzwerk junger Abgeordneter“. Während sich die Parlamentarische Linke (Generalsekretär Klaus-Uwe Benneter oder der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg, Ortwin Runde, sind u. a. Mitglied) für ein soziales Profil der SPD stark macht und den aktuellen Reformen der Regierung Schröder eher kritisch gegenüber steht, setzt sich der Seeheimer Kreis (Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zählt hier zu den Mitgliedern) traditionell für eine stärkere wirtschaftsliberale Orientierung der SPD ein. Letzterer hat allerdings an Bedeutung innerhalb der Fraktion zugunsten des ebenfalls eher konservativen „Netzwerks“ (Ute Vogt, parlamentarische Geschäftsführerin und Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg gehört zu den prominentesten Mitgliedern) eingebüßt. Zahlreiche Seeheimer wie Johannes Kahrs sind gleichzeitig Netzwerk-Mitglieder. Mittlerweile gehen von den Seeheimern nur noch wenige bedeutende Initiativen aus, dieser traditionsreiche Zusammenschluss von Parteirechten hat sich zu einer Art Zählgemeinschaft bei fraktionsinternen Abstimmungen entwickelt. Angesichts der unübersehbaren Heterogenität überrascht es nicht weiter, dass innerparteiliche Flügelkämpfe zumeist in der Bundestagsfraktion ihren Ursprung haben, wie das Beispiel 1982 (vgl. Kapitel 5.4.1) veranschaulicht. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 44 4.2 Die Stellung der SPD im bundesdeutschen Parteiensystem Die Sozialdemokraten haben sich in den letzten 20 Jahren zur koalitionsfähigsten Partei Deutschlands entwickelt. Sie arbeiten auf Bundes- bzw. Landesebene mit allen im Bundestag vertretenen Parteien zusammen. Sowohl mit Bündnis 90/Die Grünen (Bund, NordrheinWestfalen, Schleswig-Holstein) als auch FDP (Rheinland-Pfalz), CDU (Sachsen, Brandenburg, Bremen) und PDS (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) bestreitet die SPD Regierungskoalitionen. Dies bringt ihr insbesondere in den ostdeutschen Ländern einen strukturellen Vorteil gegenüber der CDU ein. Trotzdem ist das Verhältnis der Sozialdemokraten zu den anderen politischen Kräften alles andere als harmonisch und auch historisch von zahlreichen Schwierigkeiten begleitet. Daher soll dieses Kapitel das Verhältnis der SPD zu den potenziellen Koalitionspartnern Bündnis 90/Die Grünen, FDP und PDS beleuchten. Insbesondere die Frage des Umgangs mit Letztgenannten hat zu hitzigen innerparteilichen und politischen Debatten geführt.66 4.2.1 Von den „Dachlatten“ zum Wunschkoalitionspartner – Das Verhältnis zu Bündnis 90/Die Grünen Als sich Holger Börner, damaliger Ministerpräsident des Landes Hessen, im Frühjahr 1982 im Vorfeld der hessischen Landtagswahl zu den größtenteils aus Grünen bestehenden Startbahngegnern des Flughafens Frankfurt am Main sehr nachdrücklich äußerte („Ich bedauere, dass es mir mein hohes Staatsamt verbietet, den Kerlen eins in die Fresse zu hauen. Früher auf dem Bau hat man solche Dinge mit Dachlatten erledigt.“67), konnte man definitiv nicht davon ausgehen, dass eben dieser vermeintliche politische Gegner nur wenige Jahre später zum Wunschkoalitionspartner werden sollte. Noch im gleichen Jahr änderte Börner seine Meinung bezüglich der Grünen und bildete nach dem Scheitern des bisherigen Koalitionspartners FDP an der 5 %-Hürde am 1. Dezember 1982 eine Minderheitsregierung, die sich von den Grünen tolerieren ließ. Der Bruch der sozialliberalen Koalition auf Bundesebene im September 1982 machte die Suche nach einem neuen potenziellen Koalitionspartner notwendig und mit den Grünen schien die SPD überraschend schnell einen solchen gefunden zu haben. Allerdings war die Annäherung zwischen SPD und Grünen alles andere als störungsfrei. Insbesondere der pragmatisch orientierte nordhessische SPD-Bezirk konnte einer Zusammenarbeit mit einer Partei, die in zahlreichen gesellschaftspolitischen Fragen der SPD diametral gegenüberstehende Ansichten vertrat (Wehrpflicht, KKW Biblis und Ausbau des Frankfurter Flughafens seien hier beispielhaft erwähnt), wenig abgewinnen. Bei vorgezogenen Neuwahlen in Hessen 1983, die 66 Auf eine Analyse des Verhältnisses zu CDU und CSU soll an dieser Stelle aufgrund der bekanntermaßen großen Konkurrenz beider Volksparteien verzichtet werden. 67 Vgl. Nitzschke, Bernd; Goethe ist tot, es lebe die Kultur; in: P.J. Moebius; Über das Pathologische bei Goethe; Mattes & Seitz; München, 1982; S. 19 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 45 infolge von Streitigkeiten zwischen beiden Parteien notwendig wurden, konnte die SPD deutliche Hinzugewinne erzielen. Eine Koalition mit der FDP war nun rechnerisch wieder möglich, da diese in den Landtag zurückkehrte. Es war nach den Vorkommnissen im Herbst 1982 jedoch nicht gerade überraschend, dass sich Börner und die Sozialdemokraten dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit den Grünen auf Tolerierungsbasis fortzusetzen, was insbesondere auf Druck des linksgerichteten südhessischen Bezirks geschah.68 Diese Kooperation erwies sich jedoch als äußerst instabil, man sprach in der Politik bei Instabilitäten „bald sprichwörtlich [von] hessischen Verhältnissen.“69 Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde am 12. Dezember 1985 die erste rotgrüne Regierungskoalition auf Landesebene gebildet – insbesondere die Sozialdemokraten erhofften sich von einem verbindlichen Koalitionsvertrag eine verlässlichere Zusammenarbeit. Joseph („Joschka“) Fischer wurde dabei erster grüner Minister in der bundesdeutschen Geschichte; das Bild vom Minister in Sportschuhen sorgte dabei in Deutschland für Aufsehen. Damit kann die hessische SPD im Hinblick auf eine Annäherung an die Grünen als Vorreiter bezeichnet werden. Auf Bundesebene herrschte zu diesem Zeitpunkt noch „Eiszeit“ zwischen beiden Parteien. Eine Koalitionsaussage der Sozialdemokraten zugunsten der Grünen fand bei den Bundestagswahlen 1987 und 1990 ebenso wenig statt, wie eine effektive Zusammenarbeit und ein geschlossenes Auftreten in der Opposition in den 1980er Jahren. Aber auch in zahlreichen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Hamburg bestanden zum Teil noch große Vorbehalte gegen eine Annäherung bzw. Zusammenarbeit. Im Laufe der folgenden Jahre kam es jedoch nach zu nach zu erstmaligen rot-grünen Koalitionen auf Länderebene (1989 in Berlin, 1990 in Niedersachsen, 1994 in Sachsen-Anhalt, 1995 in Nordrhein-Westfalen, 1996 in Schleswig-Holstein, 1997 in Hamburg), in Brandenburg und Bremen (1990 bzw. 1991) wurde eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen gebildet. Doch anders als die sozialliberalen Koalitionen, die vornehmlich in den 1970er Jahren gebildet wurden, waren die rot-grünen Bündnisse zunächst von vielen Querelen und Streitigkeiten gekennzeichnet. So scheiterten die Ampelkoalitionen in Bremen und Brandenburg vornehmlich an den Grünen, die Zusammenarbeit in Berlin endete bereits vorzeitig nach knapp 600 Tagen70, in Niedersachsen sorgten vor allem Differenzen zwischen Ministerpräsident Schröder und Umweltminister Jürgen Trittin dafür, dass die SPD primär eine Alleinregierung nach der Landtagswahl 1994 anstrebte. Vor etlichen Zerreißproben stand auch die rot-grüne Regierung im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen, die 1995 bei Abschluss des Koalitionsvertrags von beiden Parteien als Modell für den Bund angepriesen wurde. Zwischen dem in Nordrhein-Westfalen eher konservativen SPD-Landesverband unter dem damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau und den Grünen, zu diesem Zeitpunkt an Rhein und Ruhr noch mit einer Mehrheit von „Fundis“, 68 Vgl. Schiller/von Winter, a. a. O., S. 286 Vgl. Abendroth, Elisabeth/Böhme, Klaus; Drei Hessen unter einem Hut; in: Wehling, Hans-Georg (Hrsg.); Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 2000; S. 137 70 Das im Februar 1989 in Berlin-West gebildete rot-grüne Bündnis war an der Frage von Zulassungen von linksgerichteten Demonstrationen bereits im Herbst 1990 gescheitert. 69 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 46 entzündeten sich anhand zahlreicher Themen, wie dem Braunkohletageabbau Gartzweiler II, dem Ausbau des Flughafens Düsseldorf, dem Bau des Metrorapid von Düsseldorf nach Dortmund oder der Förderung neuer Energien in recht kurzen Abständen durchaus ernste Konflikte. Im Januar 1998 beriefen die Bündnisgrünen sogar einen Sonderparteitag in Jüchen bei Aachen ein, um über den Fortbestand der Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten abzustimmen. Die Auseinandersetzungen um den Braunkohletageabbau in Gartzweiler II hatten an Schärfe zugenommen, die SPD-Landtagsfraktion konnte sich mit ihrer Zustimmung zum Abbau gegen den Koalitionspartner durchsetzen, was die Basis in Unmut versetzte. Doch die Aussicht eines SPD/CDU-Bündnisses im Falle des Scheiterns von Rot-Grün und die Überzeugung, in der Regierung mehr Einfluss insbesondere auf die Entwicklungen bzgl. Gartzweiler II zu haben, als in der Opposition, bewogen die, wenn auch überraschend knappe Mehrheit der Delegierten letztendlich, für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der SPD zu stimmen. Die Position der Grünen innerhalb der Koalition indes war schwächer geworden, die Regierungsfähigkeit von RotGrün konnte neun Monate vor der Bundestagswahl 1998 trotz des Fortbestandes des Düsseldorfer Bündnisses zumindest angezweifelt werden. Bei der Annäherung der beiden Parteien fällt allerdings auf, dass sie von Seiten der Grünen länger und intensiver betrieben wurde, während sich die SPD bis zur Bundestagswahl 1998 auf Bundesebene nicht einmal zu einer Koalitionsaussage zugunsten der Bündnisgrünen durchringen konnte. Dem standen Wahlaussagen der Grünen im Weg, einen Benzin-Preis von 5 DM pro Liter anzustreben, sowie das sozialdemokratische Wahlkampfkonzept „Die neue Mitte“, womit man bürgerlich-konservative Wähler für die SPD gewinnen wollte. Nach wie vor gibt es zwischen SPD und Grünen insbesondere in den Feldern Wehrpflicht, Zuwanderung, Innere Sicherheit, Forschung und Innovation, sowie Landwirtschaftspolitik noch wahrnehmbare Meinungsverschiedenheiten. Beispiel: „Der Innovationsbegriff der Koalitionäre unterscheidet sich grundsätzlich, und die Grünen haben dies in Wörlitz auch klargemacht. Zwar verzichteten sie in ihrem Innovationsbeschluss auf direkte Kritik an den Vorstellungen der SPD. Auch lieferten sie ein Bekenntnis zu Wirtschaftswachstum durch Innovation. Aber ein Wirtschaftswachstum ´um jeden Preis´ lehnen sie ab. Es geht uns um die Qualität und nicht allein um die Quantität des Wachstums.“71 Allerdings haben diese im Zuge der schwindenden Bedeutung des Fundi-Flügels zugunsten des Realo-Flügels innerhalb der Bündnisgrünen in den letzten Jahren abgenommen. Das Koalitionsklima in der Bundesregierung sowie den noch existierenden rot-grünen Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat sich folglich verbessert, Regierungskrisen sind eher selten geworden. Bündnis 90/Die Grünen haben sich somit zum Wunschkoalitionspartner auf Bundesebene und in den meisten Ländern und Kommunen entwickelt. Ausnahmen bilden derzeit die Landesverbände 71 Vgl. Haselberger, Stephan; Grüne setzen bei Innovation andere Schwerpunkte als SPD; aus: Berliner Morgenpost vom 10.01.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 47 in Rheinland-Pfalz und Bremen, wo trotz parlamentarischer Mehrheit eines rot-grünen Bündnisses einer Zusammenarbeit mit FDP bzw. CDU der Vorzug gegeben wurde. In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin bietet sich aufgrund der aktuellen politischen Verhältnisse (die Grünen sind lediglich in Sachsen und Berlin parlamentarisch vertreten, von einer rot-grünen Mehrheit ist man hier jedoch weit entfernt) derzeit keine Möglichkeit für eine Zusammenarbeit, weswegen die Sozialdemokraten gezwungenermaßen nach anderen potenziellen Partnern Ausschau halten mussten, aktuell sind dies je nach Bundesland CDU oder PDS. Besorgnis erregend aus Sicht der Sozialdemokraten erscheint jedoch die vorsichtige Annäherung zwischen CDU und Grünen, die auf kommunaler Ebene bereits zu zahlreichen schwarz-grünen Koalitionen geführt hat. So entschieden sich die Bündnisgrünen in der Vergangenheit beispielsweise in Großstädten wie Saarbrücken, Kiel, Mülheim an der Ruhr oder im Kreis Ludwigshafen, mit den Christdemokraten zusammen zu arbeiten, obwohl auch die Möglichkeit einer rot-grünen Koalition im jeweiligen Kreis- oder Gemeindetag bestand. Im rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen gibt es seit 1999 auf kommunaler Ebene mittlerweile mehr schwarz-grüne als rot-grüne Bündnisse, am meisten Aufsehen erregte die Koalition in Köln. Auf Länderebene kam es in den letzten Jahren regelmäßig zu Diskussionen sowohl bei CDU als auch bei Grünen, eine Zusammenarbeit nicht mehr per se auszuschließen, zuletzt im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen im Juni 2004. Aber auch die Christdemokraten haben insbesondere, eingedenk der Wahlerfolge der zunehmend bürgerlich auftretenden Öko-Partei seit der Bundestagswahl 2002, ihr Verhältnis zu dieser vermehrt diskutiert. „Michael Glos [Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag; Anm. des Verfassers] hält schwarz-grüne Koalitionen auf Länderebene für denkbar. So seien die Grünen beispielsweise in der Steuerpolitik realistisch.“72 Den Grünen droht bei einem Machtverlust der rot-grünen Koalitionen bei den Landtagswahlen in SchleswigHolstein und Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2005 das Ausscheiden aus dem Bundesrat, da sie in keiner Landesregierung mehr vertreten wären. Die Grünen profitieren elektoral zwar von der Schwäche der Sozialdemokraten, allerdings beschneiden die schweren Verluste letzterer die Chancen, eine rot-grüne Regierung im jeweiligen Bundesland zu bilden. Auf Bundesebene werden SPD und Grüne allerdings mittel- bis langfristig weiter die Zusammenarbeit suchen – bei der Bundestagswahl 2006 ist eine gegenseitige Koalitionsaussage sicher. Darüber hinaus fehlen Bündnis 90/Die Grünen die Alternativen zu einer rot-grünen Koalition, so lange noch keine schwarz-grüne Landesregierung und damit eine spürbare Annäherung zu den Unionsparteien existiert. 72 Vgl. Union denkt über Verhältnis zu Grünen nach; in: www.tagesschau.de vom 15.06.2004; http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID3360118,00.html; aufgerufen am 09.10.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 48 4.2.2 Mal Freund, mal Feind – Das Verhältnis zur FDP Der Umgang zwischen Sozialdemokraten und Liberalen ist seit der Gründung der Bundesrepublik von starken Wellenbewegungen gekennzeichnet. Erste Bündnisse gab es zwar bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Bundesländern, jedoch wurden diese im Rahmen von Mehrparteienkoalitionen, an denen neben den Unionsparteien auch die DP, der BHE und sogar die KPD bzw. DKP beteiligt waren, geschlossen. Die ersten sozial-liberalen Koalitionen gab es in den Stadtstaaten – 1957 in Hamburg, 1959 in Bremen und 1963 in Berlin. Bei allen drei Bündnissen fällt auf, dass die SPD trotz der Möglichkeit, alleine zu regieren, die Zusammenarbeit mit der FDP suchte. Insbesondere der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, erkannte früh, dass die SPD auf Bundesebene ohne Koalitionspartner kaum realistische Chancen hatte, die Regierung, geschweige denn, den Bundeskanzler zu stellen. Die 1960er Jahre können somit als das Jahrzehnt der rot-gelben Annäherung bezeichnet werden. Der Verlust der absoluten Mehrheit von CDU/CSU bei der Bundestagswahl 1961, die Querelen mit dem Koalitionspartner FDP hinsichtlich des vorzeitigen Rücktritts Konrad Adenauers als Bundeskanzler, das Erstarken der SPD insbesondere in den Ländern nach Verabschiedung des Godesberger Programms und die wachsenden Verschleißerscheinungen des christlich-liberalen Bündnisses im Bund infolge starker inhaltlicher Differenzen, welche Maßnahmen zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme im Zuge der Rezession Mitte der 1960er Jahre ergriffen werden sollten, brachte den Sozialdemokraten einen erheblichen Bedeutungszuwachs. Das Ende des Union/FDP-Bündnisses im Dezember 1966 sowie der Koalitionswechsel in Nordrhein-Westfalen im selben Jahr73 sorgten für eine verstärkte Annäherung zwischen SPD und FDP. Vor allem die Liberalen – nun einzige Oppositionspartei im Bundestag – warben in den Jahren der Großen Koalition nun offensiv für ein sozial-liberales Bündnis. So verhalf die FDP beispielsweise 1969 bei der Bundespräsidentenwahl dem Sozialdemokraten Gustav Heinemann mit ihren Stimmen zum Sieg. Nach der Bundestagswahl im gleichen Jahr bildete der bisherige Vizekanzler Brandt unter seiner Führung eine SPD/FDP-Koalitionsregierung. Die langjährige behutsame Annäherung zwischen beiden Parteien bis hin zur Regierungskoalition im Bund sollte sich schließlich bezahlt machen. Koalitionskrisen waren in der Zeit zwischen 1969 und 1982 eher selten zu beobachten. Lediglich im Frühjahr 1972, als einige FDPBundestagsabgeordnete aus Protest gegen die Brandtsche Entspannungspolitik der Regierungskoalition ihre Unterstützung versagten, geriet das Bündnis ins Wanken. Das von CDU/CSU angestrengte konstruktive Misstrauensvotum gegen Brandt blieb erfolglos, brachte allerdings die Notwendigkeit von Neuwahlen mit sich, da eine Pattsituation im Bundestag vorherrschte. Aus diesen Neuwahlen gingen SPD und FDP als klare Sieger hervor, es kam somit zu einer Neuauflage der Koalition. Diese überdauerte u. a. die Guillaume-Affäre 1974, die 73 Die FDP beendete im Jahr 1966 die Koalition mit der CDU und arbeitete von nun an mit der SPD im einwohnerstärksten Bundesland zusammen. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 49 Ölkrise, den Terrorismus, die bis dahin schwerste wirtschaftliche Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Mitte der 1970er Jahre, sowie die Bundestagswahlen 1976 und 1980 schadlos. Die Liberalen waren in dieser Dekade ein für die SPD verlässlicher Partner, was gerade in der stark politisierten Zeit der 1970er Jahre von großer Bedeutung war. Parallel zur Bundesregierung stellten SPD und FDP auch in zahlreichen Ländern in diesem Zeitraum die Landesregierungen, so in Berlin (1963-81), Bremen (1959-71), Hamburg (1957-66 und 1970-78), Hessen (1970-82), Niedersachsen (1974-76) und Nordrhein-Westfalen (1966-80). Die aufziehende Rezession Anfang der 1980er Jahre und mehrere Wahlniederlagen der Liberalen bei Landtagswahlen in den Jahren 1981 und 1982, wo sie den Einzug in einige Landtage verfehlten, vor allem aber Querelen innerhalb der SPD über den künftigen wirtschafts- und außenpolitischen Kurs (vgl. Kapitel 5.4.1), führten wiederum zu einer erheblichen Verschlechterung im Umgang miteinander. In Niedersachsen und im Saarland war es bereits 1976 bzw. 1977 zur Bildung von CDU/FDP-Koalitionen gekommen, 1981 wechselte die FDP auch in Berlin den Koalitionspartner. Die zunehmende elektorale Stärke der Christdemokraten auf Länderebene, sowie das Aufkommen einer neuen Partei, den Grünen, erschwerte die Bildung von sozial-liberalen Koalitionen erheblich, so dass die FDP wieder verstärkt mit der CDU zusammenarbeitete, um Regierungsverantwortung in den Ländern zu tragen. Der Bruch des SPD/FDP-Bündnisses in Bonn am 17. September 1982 und die Bildung einer CDU/CSU/FDPBundesregierung mit der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler am 1. Oktober 1982 führte relativ schnell zu einer Entfremdung zwischen Sozialdemokraten und Liberalen. Auf Länderebene standen SPD/FDP-Koalitionen ab 1982 nicht mehr zur Debatte. Während sich die FDP nach den Austritten diverser Gegner der „Bonner Wende“ wie Günter Verheugen oder Ingrid MatthäusMaier, wieder an der Seite der Union sah, suchte die SPD in den Grünen verstärkt einen potenziellen Koalitionspartner. Zwar kam es in Hamburg 1987 wieder zur Bildung einer SPD/FDP-Koalition (wenn auch ausschließlich aufgrund der fehlenden Bereitschaft der Hamburger Sozialdemokraten, mit den Grünen zusammenzuarbeiten), allerdings standen dieser mittlerweile CDU/FDP- Landesregierungen in Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin gegenüber. In der Ära Kohl zeigte sich eine immer stärkere Lagerbildung mit dem christlich-liberalen Lager auf der einen und dem sozialdemokratisch-grünen Lager auf der anderen Seite. Der SPD gelang es zwar, in diesem Zeitraum, gemeinsam mit den Grünen in zahlreichen Bundesländern regierende CDU/FDP-Bündnisse abzulösen (Berlin, Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt) und die Mehrheit im Bundesrat für sich zu gewinnen, das Verhältnis zur FDP verschlechterte sich indes weiter. Als Ausnahme kann hier die Entwicklung in Rheinland-Pfalz angesehen werden. Bei der Landtagswahl 1991, als die SPD erstmals überhaupt stärkste politische Kraft im Land wurde, hatte ihr siegreicher Spitzenkandidat Rudolf Scharping die Wahl zwischen der Bildung einer rotgelben und rot-grünen Landesregierung. Der eher konservative Landesverband entschied sich Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 50 dafür, Gespräche mit der FDP zu führen. Die Liberalen wiederum hatten nach der Landtagswahl 1996 ihrerseits die Möglichkeit, sich den Koalitionspartner auszusuchen – sowohl ein christlichliberales als auch sozial-liberales Bündnis hatte eine parlamentarische Mehrheit. Man entschied sich, die nach Angaben von FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle erfolgreiche Zusammenarbeit mit der SPD fortzusetzen. Nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 und dem CDU-Spendenskandal 1999/2000 distanzierte sich die FDP von der Union und versuchte, sich als eigenständige politische Kraft zu profilieren, die sowohl mit SPD als auch CDU koalitionsfähig sein müsse. Dies zeigte sich zunächst bei der Wahl zum Bundespräsidenten im Mai 1999, als sich einige prominente Freie Demokraten, unter ihnen Jürgen Möllemann, offen zur Wahl des später erfolgreichen SPDKandidaten Johannes Rau bekannten. Zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2000 verzichtete die FDP auf eine Koalitionsaussage. Sie konnte zwar in beiden Ländern die 5 %-Hürde deutlich überspringen und die Bündnisgrünen überholen, die Umwerbungsversuche in Richtung SPD blieben jedoch erfolglos und die amtierenden rot-grünen Koalitionen wurden fortgesetzt. Doch die guten Wahlergebnisse und Umfragewerte in den Jahren 2000 und 2001 bestärkten die Liberalen in ihrem Vorhaben, zur Bundestagswahl 2002 ohne Koalitionsaussage und mit eigenem Kanzlerkandidaten – dem neuen Parteivorsitzenden Guido Westerwelle – sowie einem sehr ehrgeizigen Wahlziel von 18 % der Stimmen anzutreten. In Anbetracht des sensationellen Ergebnisses von 13,3 % bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2002 schien dieses Konzept aufzugehen. Die Liberalen wollten im Wahlkampf nicht als Mehrheitsbeschaffer von SPD oder Union auftreten, sondern viel mehr durch ihre Eigenständigkeit als auf Augenhöhe mit den beiden Volksparteien stehend um Wähler werben. Das gemessen an den Erwartungen sehr enttäuschende Wahlresultat im September 2002 von 7,4 % führte wieder zu einem Umdenken in der FDP. Es muss hinterfragt werden, ob eingedenk des recht knappen Wahlausgangs 2002 zugunsten von SPD und Bündnis 90/Die Grünen nicht gerade die Taktik, keine Koalitionsaussage zu treffen, eine gewisse Beliebigkeit und fehlende Verlässlichkeit der Liberalen in der Öffentlichkeit und somit dieses recht mäßige Wahlergebnis verursachte. Anhänger eines schwarz-gelben oder rot-gelben Bündnisses könnten infolge dessen eher zur Wahl von CDU/CSU bzw. SPD motiviert worden sein. Eben diese Überlegungen, sowie die Bevorzugung der Grünen als Koalitionspartner durch die Sozialdemokraten dürften innerhalb der FDP schließlich dazu geführt haben, sich wieder verstärkt als natürlicher Partner der Union zu sehen. „Die FDP suchte [seit 2002] ihr Glück wieder in der Funktionspartei und als Mehrheitsbeschafferin, sah sich bescheiden nur noch als ´Scharnier der Vernunft´.74 74 Vgl. Walter, Franz; Zurück zum alten Bürgertum: CDU/CSU und FDP; in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 40/2004 vom 27. September 2004; Bonn, 2004; S. 36 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 51 Das Ziel der Liberalen ist von diversen Spitzenpolitikern bereits klar und deutlich formuliert worden, nämlich bei der Bundestagswahl 2006, die amtierende rot-grüne Bundesregierung gemeinsam mit der Union abzulösen. Erster Schritt hin zu diesem Vorhaben war im Mai 2004 die Wahl des Bundespräsidenten. CDU/CSU und FDP präsentierten mit Horst Köhler einen gemeinsamen Kandidaten, der schließlich gewählt wurde. Es ist darüber hinaus damit zu rechnen, dass die Freien Demokraten bei den wichtigen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Februar bzw. Mai 2005 mit einer Koalitionsaussage zugunsten der CDU in den Wahlkampf ziehen werden. Eine Annäherung an die SPD erscheint unter den gegebenen Voraussetzungen mittelfristig sehr unwahrscheinlich. Abschließend lässt sich also feststellen, dass sich das Verhältnis zwischen SPD und FDP zwar gegenüber 1982 wieder verbessert hat, nachdem es nach dem damaligen Koalitionsbruch auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt war. Allerdings ist eingedenk der aktuellen politischen Lage nicht damit zu rechnen, dass es wieder zu Verhältnissen wie in den 1970er Jahren kommen wird. Die Mehrheit der FDP-Mitglieder und -Wähler spricht sich für eine Koalition mit den Unionsparteien aus, wenn die Mehrheitsverhältnisse es erlauben.75 Die Sozialdemokraten ihrerseits befinden sich in einem äußerst ausgeprägten und lang anhaltenden Stimmungstief, was ihnen zuletzt bei Wahlen auf sämtlichen Ebenen die Mehrheitsposition verwehrt hat. CDU/CSU haben sich nach ihrem Tiefpunkt bei der Bundestagswahl 1998 zumindest in den alten Bundesländern wieder zur strukturellen Mehrheitspartei entwickelt, während die Grünen eben dort bei den letzten Wahlen zumeist bessere Ergebnisse erzielen konnten als die Liberalen. Ein sozial-liberales Bündnis ist folglich auf praktisch keiner Ebene aktuell mehrheitsfähig. 4.2.3 Erwürgen durch Umarmen? – Das Verhältnis zur PDS Keine andere Partei im bundesdeutschen Parteiensystem war und ist im Umgang mit einer anderen Partei so gespalten wie die SPD mit den SED-Nachfolgern. Bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 26. Juni 1994 kam für die Sozialdemokraten keine Form der Zusammenarbeit mit der PDS auf Landes- und Bundesebene in Frage. Nachdem sich die Landes-SPD an besagtem Wahltag denkbar knapp hinter der CDU mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste, änderte sie gegen den Widerstand der Bundespartei ihre Meinung. Man entschloss sich, eine Minderheitsregierung mit Bündnis 90/Die Grünen zu bilden, die von der PDS toleriert wurde. Diese als „Magdeburger Modell“ bezeichnete Zusammenarbeit sorgte bundesweit sowohl innerhalb der SPD als auch beim politischen Gegner für Aufsehen. Die SPD reagierte im Herbst 1994 auf Initiative des damaligen Bundesvorsitzenden Rudolf Scharping mit der so genannten „Dresdener Erklärung“, die im Dezember 1994 verabschiedet wurde. Diese besagte, dass die Sozialdemokraten jede Form der Zusammenarbeit mit der PDS auf Bundes- und Landesebene ablehnen. Bei den vier Landtagswahlen in den neuen Bundesländern im Herbst 1994 stellte sich 75 Bei Bürgerschaftswahl in Hamburg 2001 beispielsweise entschied sich die FDP, mit CDU und Schill-Partei einen Senat zu bilden. Eine Koalition aus SPD, GAL und FDP wäre rechnerisch ebenfalls möglich gewesen. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 52 die Frage nach einer SPD/PDS-Koalition in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, wo die Landtagswahlen zeitgleich zur Bundestagswahl stattfanden. Dort hatte die SPD als zweitstärkste Partei die Wahl zwischen einer rot-roten und einer großen Koalition als Junior-Partner mit der CDU. In beiden Ländern verzichtete man schließlich im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt auf das Amt des Ministerpräsidenten und arbeitete – auch auf Druck der Bundespartei – fortan mit den Christdemokraten zusammen. Das Thema „Verhältnis SPD-PDS“ verschwand in den Folgejahren weitestgehend von der politischen Agenda.76 Als im April 1998 wieder Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt anstanden, flammte die Diskussion allenthalben wieder auf. Das Scheitern des grünen Koalitionspartners an der 5 %-Hürde, der Einzug der DVU in den Landtag und ein deutlich unter den Erwartungen gebliebenes eigenes Wahlergebnis machten die Hoffnungen der SPD auf eine Alleinregierung oder zumindest einer Neuauflage der rot-grünen Koalition zunichte. Direkt nach der Wahl nahmen die Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf, die allerdings nach weniger als zwei Wochen scheiterten, woraufhin man Gespräche mit der PDS suchte. Dieses hatte der SPDKanzlerkandidat zur Bundestagswahl 1998, Gerhard Schröder, stets versucht, zu verhindern, da die Bundespartei ihren „Neue Mitte-Kurs“ und somit ihr Vorhaben gefährdet sah, bürgerliche Wähler für sich zu gewinnen. Es kam schließlich zu einer Neuauflage des „Magdeburger Modells“ – die Sozialdemokraten bildeten eine Alleinregierung, die sich von der PDS tolerieren ließ. Die Bundespartei distanzierte sich erneut von der Entscheidung der Magdeburger Genossen. Franz Müntefering, damals Bundesgeschäftsführer, schränkte jedoch ein, dass Kooperationen und Koalitionen in den neuen Bundesländern zwischen SPD und PDS möglich sein müssten, wenn „als Lohn die Machtübernahme winkt“77, auf Bundesebene wurde eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit jedoch weiterhin abgelehnt. Zeitgleich mit der Bundestagswahl 1998 konnte die SPD auch die Landtagswahl in MecklenburgVorpommern gewinnen. Hier hatte sie nun die Wahl zwischen einer Koalition mit der PDS und der CDU. Nach nur recht kurzen Sondierungsgesprächen entschloss sich die Nordost-SPD unter Harald Ringstorff, erstmals eine Koalition mit der PDS einzugehen. Die Bildung dieser ersten rotroten Landesregierung war Startschuss für eine zunehmende Normalisierung des Verhältnisses zwischen beiden Parteien in den Folgejahren. In Mecklenburg-Vorpommern wurde dabei u. a. die Beendigung der Beobachtung der PDS durch den Landesverfassungsschutz in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Die Landtagswahlen im Herbst 1999 offenbarten allerdings weiterhin ein recht zwiespältiges Verhältnis der Sozialdemokraten zur PDS. Der Verlust der absoluten Mehrheit in Brandenburg machte die Bildung einer Koalition notwendig. Nach einwöchigen Sondierungsgesprächen mit CDU und PDS entschied sich die brandenburgische SPD unter Ministerpräsident Manfred Stolpe für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit 76 Zwischen 1995 und 1997 fanden in den neuen Bundesländern keine Landtagswahlen statt, somit kam es auch nicht zu Diskussionen über mögliche SPD/PDS-Koalitionen. 77 Vgl. UNION 3/98; Union-Verlag GmbH & Co.; Bonn, 1998; S. 17 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 53 den Christdemokraten. In Thüringen, wo eine Woche später gewählt wurde, strebte der SPDSpitzenkandidat Richard Dewes hingegen offen ein SPD/PDS-Bündnis an, welches die amtierende große Koalition nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns ablösen sollte. In Sachsen wiederum lehnten die Sozialdemokraten eine Zusammenarbeit mit der PDS kategorisch ab, das Ziel war eine Koalition mit der CDU, wenngleich die Chancen, hier den Ministerpräsidenten zu stellen, aufgrund der politischen Konstellation im Freistaat sehr gering waren. Damit folgten die ostdeutschen SPD-Landesverbände den neuen Vorgaben der Bundespartei, dass jeder Landesverband vor Ort autonom entscheiden solle, ob eine Zusammenarbeit mit der PDS angestrebt werden soll. Die PDS selbst arbeitete verstärkt daran, sich der SPD auch auf Bundesebene als Regierungspartner anzubieten. Es fällt auf, dass „häufiger der Versuch gemacht wurde die Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern als Muster für die anderen neuen Bundesländer anzusehen und in letzter Konsequenz auch als Vorbild für den Eintritt in eine Bundesregierung in Berlin.“78 Die Jahre 1998 und 1999 können somit ohne weiteres als Jahre der Annäherung zwischen SPD und PDS bezeichnet werden, wobei jedoch auch nicht unerwähnt bleiben darf, dass diese zu teils heftigen Kontroversen innerparteilicher Art führte. So führte die Bildung der SPD/PDS-Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern zu Parteiaustritten und innerparteiliche Kritik, die allerdings in der Minderheit blieb. Ehemalige DDR-Bürgerrechtler in der SPD wie Markus Meckel betonten, „die […] Koalition in Mecklenburg-Vorpommern widerspreche einem Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion vom 5. Dezember 1994, in dem eine Bündnisstrategie mit der PDS ausgeschlossen wurde.“79 Ein generelles Koalitionsverbot wurde interessanterweise nicht gefordert. Andere, vor allem dem traditionalistischen Flügel zuzurechnende SPD-Politiker, forderten hingegen sogar, den Entwicklungen der Jahre 1998/99 Rechnung zu tragen und die Dresdener Erklärung auch offiziell aufzuheben. Insbesondere die Äußerung des damaligen Parteivorsitzenden Lafontaine, „man solle doch die PDS aus ihrer Märtyrerrolle holen und sie als politische Partei ernst nehmen“80, sorgte in diesem Zusammenhang für Aufsehen. Aber nicht nur die Frage, ob eine Zusammenarbeit mit den Postkommunisten gesucht werden solle, auch der Umgang der Sozialdemokraten mit ihnen war und ist alles andere als geradlinig. Einerseits gab man in Mecklenburg-Vorpommern der Forderung der PDS nach, sie nicht mehr vom Landesverfassungsschutz beobachten zu lassen, andererseits stand dies in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo ebenfalls sozialdemokratisch geführte Landesregierungen amtierten, nicht zur Debatte. Ebenso widersprüchlich mutet die Tatsache an, dass die SPD einerseits im nordöstlichsten Bundesland die Überprüfung auf ehemalige Stasi-Tätigkeit bei Einstellung in die öffentliche Verwaltung wiederum auf Geheiß der PDS abschaffte, gleichzeitig aber „schreckte die Vgl. Hirscher, Gerhard; Jenseits der „Neuen Mitte“: Die Annäherung der PDS an die SPD seit der Bundestagswahl 1998; Hanns-Seidel-Stiftung – Akademie für Politik und Zeitgeschehen; München, 2001; S. 5 79 Vgl. Hirscher, a. a. O., S. 7 80 Vgl. Elfferding, Wieland; Wenn die Opposition mitregiert – Die FDP als „Neue Mitte“; in: Freitag vom 19.03.1999 78 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 54 SPD-Parteiführung sofort davor zurück, eine 32-jährige Journalistin aus Ostdeutschland, […] Dörte Caspary, als Pressesprecherin einzustellen, nachdem bekannt wurde, dass sie als Jugendliche eine Verpflichtungserklärung für das MfS unterschrieben hatte.“81 Der ohnehin beschwerliche Weg der Annäherung zwischen Sozialdemokraten und PostKommunisten erlitt im Frühjahr 2000 einen schweren Rückschlag, für den die PDS verantwortlich zu machen ist. Auf dem Bundesparteitag in Münster am 8./9. April 200082 konnte sich die PDS-Parteiführung um Lothar Bisky und Gregor Gysi mit ihrem Antrag, fallweise Militäreinsätzen der Vereinten Nationen, wenn hierfür ein Mandat vorhanden sei, zuzustimmen, nicht durchsetzen. Dies hatte deren Rücktritt als Partei- bzw. Fraktionsvorsitzende zur Folge und brachte den innerparteilichen Reformern eine empfindliche Niederlage ein. Gleichzeitig bewirkten die Ereignisse dieses Parteitags nicht nur schlechte Presse, sondern auch sehr kritische Äußerungen der mittlerweile wieder aus dem Umfragetief emporgekommenen SPD. Franz Müntefering, inzwischen Generalsekretär, sprach sogar von einem Scheitern des Experiments PDS. Bemerkenswerterweise hielten sich die SPD-Landesverbände in den neuen Ländern mit Kritik an den PDS-Beschlüssen von Münster zurück, die Bündnisse in Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern blieben hiervon unberührt. Höppner ging inmitten der allgemeinen Verstimmung zwischen beiden Parteien sogar auf die Postkommunisten zu, indem er Ende April 2000 ankündigte, nach der nächsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Frühjahr 2002 das Magdeburger Tolerierungsmodell zu beenden und dieses durch eine Koalition zu ersetzen.83 Alles in allem hatte die PDS jedoch selbst zu verantworten, dass ihre Koalitionsfähigkeit nach Münster erheblich beschädigt war und darüber hinaus die Heterogenität der Mitglieder der Akzeptanz der PDS als demokratische Partei im Weg stand. Die Bemühungen der Partei, sich der SPD als möglicher Koalitionspartner auf Bundesebene anzudienen, wurden durch „Querschüsse“ der nach wie vor dogmatisch orientierten Basis – genannt sei hier insbesondere die Kommunistische Plattform (KPF) unter der Führung von Sarah Wagenknecht – konterkariert. Die wesentlich weniger reformorientierte neue Parteiführung um Gabi Zimmer und Roland Claus war bemüht, der PDS wieder ein Image zu verpassen, welches sie als Vertreterin der Interessen der neuen Bundesländer und zu einer Partei der sozialen Gerechtigkeit machen sollte. Damit blieb die PDS eine ostdeutsche Regionalpartei. Die SED-Nachfolgepartei musste im Jahr 2000 allerdings nicht nur die schmerzhafte Erfahrung machen, dass ihre Mitgliederbasis den Aufstieg zu einer gesamtdeutschen (Regierungs-)Partei vorerst verhindert hatte, sondern auch, dass sich ihr einziger realistischer Koalitionspartner – die SPD – auf Bundesebene in erster Linie als politischer Gegner entpuppte. 81 Vgl. Hirscher, a. a. O., S. 8 Der Münsteraner Parteitag war der erste seiner Art in den alten Bundesländern, was der PDS bei ihrer geplanten „Westausdehnung“ behilflich sein sollte. 83 Vgl. Hirscher, a. a. O., S. 33 82 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 55 Die Entwicklung der zunehmenden Re-Entfremdung der beiden Parteien schien sich weiter fortzusetzen und erreichte einen Höhepunkt bei der Bundesratsabstimmung im Mai 2001, als Ringstorff dem Gesetzesantrag der Bundesregierung zur Rentenreform zustimmte, entgegen der Vereinbarung der Schweriner Landesregierung, die besagte, dass sich das Land MecklenburgVorpommern enthalten solle. Diese Vorkommnisse hatten die bislang einzige ernsthafte Koalitionskrise in Schwerin zur Folge; Teile der PDS erwogen, die Zusammenarbeit zu beenden. Im Endeffekt war die Koalition jedoch nie ernsthaft gefährdet, weil sich die Postkommunisten weiter ihrer Koalitionsfähigkeit beraubt und mittelfristig kaum mehr Chancen gehabt hätten, an einer Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und möglicherweise auch den anderen neuen Bundesländern beteiligt zu werden. Damit zeigte sich, dass die SPD in dieser rot-roten Koalition die bessere Position hatte, da ein Koalitionsbruch für sie weit weniger unerfreuliche Konsequenzen gehabt hätte – schließlich blieb ihr die Option, mit der CDU zusammenzuarbeiten. Ringstorff wusste die Scharnierstellung seiner Partei im Parteiensystem des nordöstlichsten Bundeslandes geschickt auszunutzen. Das Auseinanderbrechen der großen Koalition mit der Abwahl Eberhard Diepgens als Regierender Bürgermeister in Berlin bescherte der PDS im Juni 2001 ein kaum für möglich gehaltenes „Comeback“ und führte wieder zu einer Verbesserung des Verhältnisses zur SPD. Am 16. Juni 2001 wurde die seit 1991 amtierende CDU/SPD-Koalition durch einen rot-grünen Minderheitssenat abgelöst, der nach Magdeburger Vorbild (1994-1998) von der PDS toleriert wurde. Erstmals war die PDS in einem nicht-neuen Bundesland zu einem Machtfaktor geworden. Sie erklärte lediglich einen Tag nach der Inthronisierung Klaus Wowereits als Regierenden Bürgermeister Gregor Gysi zu ihrem Spitzenkandidaten, wodurch sie in den Folgemonaten in den Medien viel Beachtung fand. Bei den vorgezogenen Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus konnte die PDS schließlich erhebliche Zuwächse verzeichnen: Sie gewann 4,7 %, errang im Ostteil der Stadt die absolute Mehrheit der Stimmen, gewann die meisten Wahlkreise und konnte auch in zahlreichen Bezirken in Berlin-West zweistellige Ergebnisse erzielen. Die Sozialdemokraten hatten nun die Wahl zwischen einer Neuauflage der Koalition mit der CDU, der Bildung einer Ampelkoalition mit FDP und Grünen sowie einem rot-roten Bündnis. Man entschied sich vor allem auf Druck der Bundesparteiführung, zunächst Koalitionsgespräche mit FDP und Grünen zu suchen, die jedoch scheiterten. Im Dezember 2001 wurden Verhandlungen mit der PDS aufgenommen. Im Januar 2002 wurde schließlich die bundesweit zweite SPD/PDS-Koalition gebildet. Der Berliner CDU-Spendenskandal hat in Kombination mit den durch Korruption, Filz und Vetternwirtschaft angehäuften Milliardenschulden der Bankgesellschaft Berlin somit eine noch im Frühjahr 2001 kaum für möglich gehaltene Renaissance im Verhältnis von SPD und PDS bewirkt. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 56 Trotz der Abwahl des Magdeburger Modells zugunsten eines CDU/FDP-Bündnisses in SachsenAnhalt im Frühjahr 2002 waren es mittlerweile drei bis vier Bundesländer, in denen die PDS der bevorzugte Koalitionspartner der SPD ist (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, evtl. Thüringen). Lediglich in Brandenburg wurde eine Zusammenarbeit mit der SEDNachfolgerin nicht primär angestrebt, in Sachsen wurde diese sogar strikt abgelehnt. Im Herbst 2002 kam es im Zuge des Bundestagswahlkampfes jedoch wieder zu einer deutlichen Abkühlung zwischen beiden Parteien. So ermöglichte u. a. die konsequente Ablehnung einer Beteiligung der Bundeswehr an einem denkbaren Irak-Krieg durch die rot-grüne Bundesregierung einen nicht mehr für möglich gehaltenen Stimmungsumschwung zu Gunsten der SPD kurz vor der Bundestagswahl. Dies hatte jedoch einen Nebeneffekt. Bislang galten die SED-Nachfolger stets als die am stärksten pazifistisch orientierte Partei im Bundestag. Die unbeirrte Ablehnung des Irak-Kriegs durch SPD und Grüne und die damit verbundene Besetzung des Themas Pazifismus durch diese Parteien führte zu einer beträchtlichen Wählerwanderung von PDS hin zu SPD, so dass die Postkommunisten deutlich unter die 5 %-Hürde rutschten und somit erstmals seit 1990 aus dem Bundestag ausschieden. Zeitgleich erlitten sie dramatische Verluste in Höhe von 8,0 % bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie sich erstmals als Regierungspartei zur Wahl stellen mussten. Trotz vieler Bedenken seitens der PDS-Basis kam es zu einer Neuauflage der rot-roten Regierungskoalition in Schwerin. Doch das Ausscheiden aus dem Bundestag führte der PDS einmal mehr vor Augen, dass die SPD eher ein politischer Gegner denn ein verlässlicher Partner ist, nicht einmal in den Bundesländern, in denen sie mit ihnen koaliert. Der große Erfolg der PDS bei der Europawahl 2004 und der zeitgleich stattfindenden Landtagswahl in Thüringen brachte die Partei zurück auf die Tagesordnung. Die in der Bevölkerung zunehmend als unsozial empfundenen Reformen der rot-grünen Bundesregierung gaben den Postkommunisten in Ostdeutschland deutlichen Auftrieb, allerdings bezahlten sie für die Wahlerfolge einen hohen Preis. Der eingeschlagene, recht populistische Konfrontationskurs zur SPD im Zusammenhang mit den so genannten Hartz IV-Reformen sorgte bei den Sozialdemokraten für großen Unmut, so dass beispielsweise in Brandenburg selbst linke Parteimitglieder nach der Landtagswahl im September 2004 eine Koalition mit der CDU favorisierten – die Sondierungsgespräche mit der PDS scheiterten hier bereits nach zwei Treffen. „Rot-Rot ist tot. Und zwar nicht nur, weil die Sozialdemokraten nicht als Juniorpartner einer PDS-Ministerpräsidentin Dagmar Enkelmann zur Verfügung stünden. Das Verhältnis zwischen SPD und PDS ist durch den Wahlkampf der PDS gegen Hartz IV schwer, man kann sagen, auf längere Zeit irreparabel gestört.“84 Die PDS beraubte sich durch das Fahren der PopulismusSchiene ihrer Koalitionsfähigkeit. So nahm sie sogar eine Koalitionskrise in Berlin in Kauf, als prominente Vertreter, darunter der Fraktionsvorsitzende Stefan Liebich, zu einer „Anti-Hartz84 Vgl. Gestörtes Verhältnis; in: Lausitzer Rundschau vom 30.08.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 57 Demonstration“ aufriefen. „Trotz aller Proteste seitens der mitregierenden SPD ruft die PDS ihre Anhänger auch zur Teilnahme an der zweiten Montagsdemonstration in der Hauptstadt auf.“85 Das Verhältnis zwischen SPD und PDS ist durch die Ereignisse von 2002 und 2004 nicht nur deutlich abgekühlt, es durchlebt derzeit ein ausgeprägtes Tief. Es ist vorerst nicht mit einer Verbesserung zu rechnen, da weitere tief greifende Reformen in Zukunft notwendig sind und die PDS daher auch weiterhin nicht vor Frontalangriffen populistischer Art gegen die Bundesregierung zurückschrecken dürfte. Offenkundig ist den Postkommunisten eine höhere Anzahl an Mandatsträgern mittlerweile wichtiger als eine Regierungsbeteiligung. Es ist allerdings mittelfristig nicht mit einer ernsthaften Gefährdung der Koalitionen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu rechnen. Nach den aktuellen Entwicklungen ist abschließend festzuhalten, dass SPD und PDS, anders als SPD und Grüne, in erster Linie politische Gegner sind, die um Stimmen im gleichen Wählerlager kämpfen. Die PDS ist für die Sozialdemokraten in einigen neuen Bundesländern ein Machtfaktor, allerdings ist dies aus der Not heraus geboren, da die Grünen als Koalitionspartner nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollte den SED-Nachfolgern auch zu denken geben, dass die SPD als Juniorpartner der PDS in den neuen Ländern nicht zur Verfügung steht, der CDU jedoch schon. 85 Vgl. Rada, Uwe; Liebich demonstriert gegen SPD; in: Die Tageszeitung vom 21.08.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 58 4.3 „Nachkriegs-Hassliebe“ – Das Verhältnis zum DGB Rund 90 % der Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und 100 % der Mitglieder des SPDParteivorstandes waren 1994 gewerkschaftlich organisiert. 15 von 16 DGB- Einzelgewerkschaftsvorsitzenden und sieben von neun Mitgliedern des DGB-Vorstandes, sowie etwa 80 % aller Vorstandsmitglieder der DGB-Einzelgewerkschaften und zwei Drittel aller Mitglieder von Gewerkschaftskongressen sind Mitglied der SPD.86 Alleine diese Zahlen dokumentieren eindrucksvoll die Nähe der Sozialdemokraten zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Man kann uneingeschränkt von einer sowohl inhaltlichen als auch personellen Verbundenheit beider Organisationen sprechen. Lediglich vier Jahre nach der SPD verabschiedete sich der DGB 1963 von der Marxschen Wirtschaftstheorie und wandte sich dem Keynesianismus zu. Die SPD avancierte somit zum Schrittmacher einer Programmrevision. Das DGB-Grundsatzprogramm ist laut Bodo Zeuner „ein konkretisierender Nachvollzug des Godesberger Programms.“87 Auch in den aktuellen Grundsatzprogrammen finden sich noch zahlreiche Übereinstimmungen. Im Berliner Programm der SPD heißt es beispielsweise: „Demokratische Kontrolle der wirtschaftlichen Macht des Kapitals verlangt einen handlungsfähigen Staat. (…) Der Markt (…) kann weder Vollbeschäftigung herstellen noch Verteilungsgerechtigkeit bewirken. (…) Wettbewerb so weit wie möglich – Planung so weit wie nötig!“88 Das 1981 beschlossene DGB-Grundsatzprogramm besagt zur aktiven Politik der gesamtgesellschaftlichen Steuerung: „Zur Kontrolle der wirtschaftlichen Macht in ihren vielfältigen Formen sind (…) verschiedene Methoden anzuwenden. Entscheidend ist, dass der Missbrauch wirtschaftlicher Macht verhindert und eine soziale Gestaltung der Wirtschaft geleistet wird.“89 Allerdings war und ist das Verhältnis insbesondere in Zeiten, in denen die SPD Regierungsverantwortung trug bzw. trägt, nicht immer störungsfrei. Wegen der häufig offen ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten, bei denen jedoch die intensive inhaltliche Zusammenarbeit nie ernsthaft infrage gestellt wurde, kann man von einer „Hassliebe“ zwischen beiden Organisationen sprechen. Eine knappe Darstellung der Entwicklung des Verhältnisses seit Ende des Zweiten Weltkriegs, was gleichzeitig die Geburtsstunde der Einheitsgewerkschaft war, Vgl. Langkau, Jochem/Matthöfer, Hans/Schneider Michael (Hrsg.); SPD und Gewerkschaften – Band I: Zur Geschichte eines Bündnisses; Verlag J. H. W. Dietz; Bonn, 1994; S. 69f. Die Zahlen sind zwar auf dem Stand von 1994, haben sich jedoch nur unwesentlich bis zum heutigen Tag verändert. 87 Vgl. Zeuner, Bodo; Solidarität mit der SPD oder Solidarität der Klasse? – Zur SPD-Bindung der DGBGewerkschaften; in: Prokla – Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 1/1977; S. 17 88 Vgl. SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands; Berlin, 1989; S. 34 89 Vgl. DGB-Bundesvorstand (Hrsg.); Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes; Düsseldorf, 1981; S. 10 86 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 59 und eine Analyse der gegenwärtigen Lage sollen Aufschluss darüber geben, wie sich das Bündnis SPD-DGB weiterentwickeln wird. 4.3.1 Historischer Abriss seit 1945 Das 1945 im britischen Exil von deutschen Gewerkschaftern auch in Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten erarbeitete Konzept der Einheitsgewerkschaft sollte die Richtungsgewerkschaften der Weimarer Republik ablösen. Letztgenannte wurden als zunehmend unproduktiv empfunden, da die Gewerkschaftsbewegung selten mit einer Stimme sprach. Schnell wurde deutlich, dass eine wie auch immer geartete Einheitsgewerkschaft parteipolitisch unabhängig sein sollte. Dies stand jedoch nicht im Gegensatz zu einer fehlenden politischen Neutralität, schließlich behielt sich der 1949 gegründete DGB vor, zu politischen Ereignissen und Entwicklungen Stellung zu beziehen. Es überrascht nicht, dass dies zumeist zugunsten der SPD war, die sich als große Befürworterin der Einheitsgewerkschaft hervortat. Auf ihrem Parteitag im Sommer 1947 in Nürnberg stimmte die SPD der Gründung einer parteipolitisch unabhängigen Einheitsgewerkschaft zu, warnte jedoch vor einem wachsenden Einfluss der kommunistischen Mitglieder innerhalb der Organisation, zumal die Gewerkschaftsbewegung in der Sowjetischen Besatzungszone (FDGB) zunehmend in die Abhängigkeit der kommunistischen Führung geriet. Der damalige SPD-Parteivorsitzende Kurt Schumacher brachte es in einer Rede auf besagtem Parteitag auf den Punkt: „Ihr könnt das Ziel der politischen Neutralität der Gewerkschaften, das wir bejahen, nicht dadurch erreichen, dass ihr den Gegnern der Sozialdemokraten innerhalb der Gewerkschaften Narrenfreiheit gebt.“90 Von Gewerkschaftsseite hieß es in dieser Frage: „Das Verhältnis der Gewerkschaften zu den einzelnen Parteien bestimmen die Parteien selbst durch ihr Verhalten gegenüber den Gewerkschaften.“91 Nachdem in den einzelnen westdeutschen Besatzungszonen getrennt voneinander Gewerkschaftsräte gegründet wurden92, wurde der Zusammenhalt und eine gemeinsame programmatisch-inhaltliche Ausrichtung in regelmäßigen so genannten Interzonenkonferenzen sichergestellt. Beim Gründungskongress des DGB am 13. Oktober 1949 in München wurde schließlich der Wille zur Neutralität manifestiert, indem gemäß der Linie des ersten Vorsitzenden Hans Böckler in § 8 des Statuts die „Unabhängigkeit gegenüber Regierungen, Verwaltungen, Unternehmen, Konfessionen und politischen Parteien“93 bekräftigt wurde. Heinz Oskar Vetter hat in Interpretationen des DGB-Statuts wichtige Prinzipien 90 Vgl. SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Protokoll der Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 29. Juni bis 2. Juli 1947 in Nürnberg; Hamburg, o. J.; S. 48 91 Vgl. Entschließung der VII. Interzonenkonferenz vom 3. bis 5. Februar 1948 in Dresden; in: Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Hrsg.); Versprochen – Gebrochen: die Interzonenkonferenzen der deutschen Gewerkschaften von 1946-1948; Düsseldorf; o. J.; S. 199 92 Am 6. November 1947 wurden in der britischen und amerikanischen Besatzungszone Gewerkschaftsräte gegründet, am 20. Dezember 1948 schließlich auch in der französischen. 93 Vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.) – Satzung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, beschlossen vom Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 13. Oktober 1949 in München; in: Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes – Protokoll; Köln, 1950; S. 309 (§ 8) Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 60 herausgearbeitet, die u. a. die entschiedene Ablehnung von Weisungen aus Parteizentralen jeder politischen Couleur sowie wechselseitigen finanziellen Abhängigkeiten zum Inhalt hatten.94 Doch unabhängig von derartigen Absichtserklärungen musste der DGB eine politische Standortbestimmung durchführen, die im Sinne der SPD ausfiel – aufgrund zahlreicher inhaltlicher Übereinstimmungen in DGB- und SPD-Grundsatzprogramm nicht weiter verwunderlich. Wolf-Gunter Brügmann beispielsweise bezeichnete den DGB sogar als „sozialdemokratische Richtungsgewerkschaft“95. Bereits im Bundestagswahlkampf 1953 ließ der DGB durch die Kampagne „Wählt einen besseren Bundestag“ seine Präferenzen für die SPD erkennen, was allerdings zu Unmutsbekundungen christdemokratischer Gewerkschafter und somit innerorganisatorischen Spannungen führte. Die Gründung der jedoch alles in allem bedeutungslos gebliebenen DGB-Abspaltung „Christlicher Gewerkschaftsbund“ im Jahr 1955 war die Folge. Auch allgemein war eine Einbindung von CDU/CSU-Anhängern in die Gewerkschaftsarbeit zunehmend schwierig. Die Ereignisse in Ost-Berlin vom 17. Juni 1953 führten im DGB zum Ausschluss von kommunistischen Mitgliedern, womit die sozialdemokratischen Gewerkschafter ihre dominierende Stellung innerhalb des DGB weiter ausbauen konnten. Trotz der unübersehbaren Neigung der Gewerkschaften, die SPD zu unterstützen, konnten bereits zu Beginn der 1950er Jahre inhaltliche Differenzen festgestellt werden. Der DGB befürwortete beispielsweise die Gründung der Montanunion und zunächst auch den Beschluss der Regierung Adenauer zur Wiederbewaffnung96, womit die SPD nicht konform ging. Umgekehrt wehrte sich der DGB mit aller Vehemenz gegen die 1960 geplante Notstandsgesetzgebung, während die SPD grundsätzlich Gefallen an besagtem Vorhaben der Bundesregierung fand. Angesichts allgemeiner Übereinstimmung in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen sind diese Meinungsverschiedenheiten jedoch vernachlässigbar. Die Transformation der SPD von der Arbeiter- zur linken Volkspartei mit dem Godesberger Programm im Jahr 1959 blieb auch für den DGB nicht ohne Folgen, der sich den wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen der Sozialdemokraten mit seinem in Düsseldorf verabschiedeten neuen Grundsatzprogramm im Jahr 1963 anpasste. Michael Schneider u. a. sehen durch die Begründung des Prinzips der parteipolitisch neutralen Einheitsgewerkschaft eine Verkomplizierung des Verhältnisses von SPD und DGB, da die Gewerkschaften sich von einer sozialen Bewegung zu einem Interessenverband entwickelt haben. „Die gemeinsame soziokulturelle Basis begann sich aufzulösen.“97 Die erstmalige Regierungsbeteiligung der SPD 1966 bedeutete für die Gewerkschaften einen erheblichen Bedeutungsschub; mit der Person von Georg Leber wurde ein Gewerkschaftsvorsitzender Bundesverkehrsminister. Folgerichtig änderte sich das Verhältnis des 94 Vgl. Vetter, Hans Oskar; DGB und politische Parteien; in: Gewerkschaftliche Monatshefte 4/1974; S. 203 Vgl. Brügmann, Wolf-Gunter; Der DGB und der Staat; in: Frankfurter Rundschau vom 16.03.1981; S. 3 96 Im Oktober 1954 lehnte der DGB auf seinem dritten Bundeskongress die Wiederbewaffnung doch ab. 97 Vgl. Langkau u. a., a. a. O., S. 60 95 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 61 DGB zur Bundesregierung fundamental, ein reiner Konfrontationskurs konnte nun nicht mehr gefahren werden. Im Zuge der Gründung der APO im Jahr 1968 kam es zu Spannungen im Verhältnis zwischen SPD und DGB. Während die SPD als Koalitionspartner der Unions-Parteien den so genannten 68er-Bewegungen kritisch gegenüber stand, beteiligten sich Gewerkschafter aktiv an diesen. Doch wie auch bei früheren Gereiztheiten, kam es auch hier nicht zu ernsthaften Zerwürfnissen, da von beiden Seiten stets die große Fülle inhaltlicher Gemeinsamkeiten und die Notwendigkeit des Bündnisses betont wurden.98 Die Bildung der sozial-liberalen Koalition im Herbst 1969 führte zu einer weiteren Aufwertung der DGB-Gewerkschaften, die nun nicht nur in Form von Ministerämtern an der Bundesregierung direkt beteiligt waren, sondern auch inhaltlich eine gewichtige Rolle, wie beispielsweise in der so genannten „Konzertierten Aktion“, spielten.99 Nach dem Kanzlerwechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt 1974 kam es zu einer Abkehr von der Wirtschaftspolitik nach dem Vorbild von Keynes. Die stark ansteigende Staatsverschuldung engte den Handlungsspielraum in so starkem Maße ein, dass nicht nur dem Wunsch der Gewerkschaften nach einem Ausbau des Sozialstaats nicht mehr entsprochen werden konnte, sondern sogar ein Sparkurs im sozialen Bereich geführt werden musste. Nicht zuletzt das 1976 verabschiedete Mitbestimmungsgesetz, welches eher die Handschrift der FDP trug, führte zu weit reichenden Unmutsbekundungen von Seiten des DGB. Im Übergang von den 1970er zu den 1980er Jahren schienen sich beide Organisationen sichtlich auseinander zu leben. Daran änderten auch Bekundungen von Seiten Willy Brandts und Heinz Oskar Vetters nichts, die 1981 auf dem Jubiläumskongress zum 75jährigen Bestehen des Mannheimer Abkommens100 die Notwendigkeit der intensiven Zusammenarbeit betonten. Vetter zu den damals aktuellen Spannungen: „Es kommt auch weiterhin entscheidend darauf an, dass Gewerkschaften und Partei ihre Aufgaben für diese Gesellschaft erfüllen können. In schwierigen Zeiten darf eben keiner den anderen über das hinaus fordern, was für ihn von seiner sozialen Basis her existentiell ist.“101 Durch die Abkehr vom Keynesianismus schien das „Verhältnis 98 Vgl. Langkau u. a., a. a. O., S. 62f. Unter der „Konzertierten Aktion“ versteht man heute die konsequente Durchsetzung keynesianischer Wirtschaftspolitik zum Ende der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre. Im wirtschaftlichen Bereich erweiterte der Staat seine Tätigkeit durch Instrumente wie antizyklische Geld- und Fiskalpolitik oder staatliche Konjunkturprogramme. Vgl. auch: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung; Wirtschaft heute; Bundeszentrale für politische Bildung; Mannheim, Bonn, 2000; S.12f. 100 Die 1906 auf dem SPD-Parteitag beschlossene Resolution zur Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft manifestierte die tiefe Verbundenheit zwischen Sozialdemokraten und Gewerkschaften. So wurde u. a. der Beitritt von Parteigenossen in Gewerkschaften gefordert. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit der Existenz von Gewerkschaften im Kampf gegen die Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiterklasse betont. Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten in Mannheim vom 23. bis 29. September 1906; Berlin, 1906; S. 305 101 Vgl. Matthias, Erich (Hrsg.); Einheitsgewerkschaft und Parteipolitik. Zum 75. Jahrestag des Mannheimer Abkommens zwischen Sozialdemokratischer Partei Deutschlands und Freien Gewerkschaften von 1906; Düsseldorf, 1982; S. 28 99 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 62 zwischen DGB und SPD, begründet im Keyenesianismus, in eine Sackgasse geraten.“102 Die Zeit nach der Bonner Wende von 1982 zeigte, dass dem nicht so war. Zwar verbesserte sich der Umgangston zwischen beiden Organisationen wieder – die SPD konnte sich nun wieder stärker als Schutzpatron des Sozialstaats gegen die als neoliberal empfundene Politik von CDU/CSU und FDP profilieren –, allerdings sorgte das Liebäugeln der SPD mit Koalitionen auf Länder- und kommunaler Ebene mit den Grünen für Irritationen beim DGB. Dies fand in der ersten Hälfte der 1980er Jahre „keineswegs die Zustimmung der Gewerkschaften, die sich als Dinosaurier des Industriezeitalters gebrandmarkt und ins Abseits gedrängt sahen.“103 Auch sorgten Ereignisse wie der 1988 vom damaligen saarländischen Ministerpräsidenten unterbreitete Vorschlag zur Arbeitszeitverkürzung ohne vollen Lohnausgleich mitten hinein in die Tarif-Verhandlungen des öffentlichen Dienstes für Kontroversen. Laut Langkau u. a. zeigt jedoch gerade die besondere Medienaufmerksamkeit bei Spannungen im Verhältnis SPD-DGB, dass derartige Konflikte eher die Ausnahme bilden und die Zusammenarbeit insgesamt relativ gut funktionierte. Meinungsverschiedenheiten können demnach als „Familienkrach“ abgetan werden. Die Beteuerungen von beiden Seiten, wie wichtig und unersetzlich die enge Zusammenarbeit sei, untermauern dies. Hans-Jochen Vogel, Ende der 1980er Jahre Parteivorsitzender, sah den Zusammenhalt sogar als überlebensnotwendig für beide Seiten, da „die Schwächung des einen in aller Regel auch die Schwächung des anderen und zumeist eine Stärkung der konservativen, wenn nicht der reaktionären Kräfte bedeutet.“104 1989 nahmen die Sozialdemokraten die wichtige Rolle der Gewerkschaften für die Gesellschaft in ihr neues Grundsatzprogramm auf.105 Die Lehre aus diesem historischen Abriss zeigt, dass das Konfliktpotenzial zwischen SPD und DGB-Gewerkschaften in Zeiten einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung höher ist, als zu Oppositionszeiten. Dieser Fakt hinderte den DGB jedoch nicht daran, die SPD insbesondere bei der Bundestagswahl 1998 zu unterstützen. Mit der Aktion „Politikwechsel“ nahm man so offen wie nie zuvor Partei für die Sozialdemokraten und sprach sich für eine Abwahl Helmut Kohls als Bundeskanzler aus.106 Auch in der ersten Amtsperiode der Regierung Schröder/Fischer wurden zwar handwerkliche Fehler angeprangert, allerdings wurde die „konsequente Korrektur von unsozialen Einschnitten der Vorgängerregierung“107 gelobt. Auch im Bundestagswahlkampf 2002 betonte der DGB seine Zufriedenheit mit den Ergebnissen der rot-grünen Bundesregierung und stellte diese in einen klaren Gegensatz zur schwarz-gelben 102 Vgl. Kim, Myeoun-Hoei; Das Verhältnis zwischen DGB und SPD unter den Bedingungen der Globalisierung der Ökonomie; Inguraldissertation; vorgelegt an der Freien Universität Berlin; Berlin, 1999; S. 50 103 Vgl. Langkau u. a.; a. a. O., S. 66 104 Vgl. Vogel, Hans-Jochen; SPD und Gewerkschaften; in: Gewerkschaftliche Monatshefte 7/1988; S. 391 105 Vgl. SPD-Parteivorstand, a. a. O., 1989; S. 50f. 106 Vgl. u. a. www.berlin-brandenburg.dgb.de/article/articleview/101/1/31/; aufgerufen am 30.11.2004 und Hettlage, Manfred C.; Gegenprüfsteine für den DGB – Zur Gewerkschaftsfrage nach der Bundestagswahl; in: Die neue Ordnung 6/1998; http://die-neue-ordnung.de/Nr61998/MH.html aufgerufen am 30.11.2004 107 vgl. DGB-Bundesvorstand (Hrsg.); Die Geschichte des DGB; in: www.dgb.de/dgb/geschichte/bewegtez/Herausforderung/neue_herausforderungen.htm#chancen; aufgerufen am 30.11.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 63 Vorgängerregierung. Eine Wahlempfehlung ist der folgenden Aussage ohne weiteres zu entnehmen: „Die Ellenbogengesellschaft drohte unsere Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft zu verdrängen. Mit dem Regierungswechsel 1998 hat eine Wende hin zu einer neuen Politik für Arbeit und soziale Gerechtigkeit begonnen. Dieser Weg muss über den Herbst 2002 hinaus konsequent weiter beschritten werden.“108 4.3.2 Aktuelle Situation und Perspektiven Nach der Bundestagswahl 2002 begann die SPD, teilweise einschneidende Reformen auf den Weg zu bringen. Hierdurch kam es nicht nur zu innerparteilichen Konflikten, sondern auch wieder zu Spannungen mit den DGB-Gewerkschaften, die ihre Anliegen in der rot-grünen Reformpolitik nur unzureichend berücksichtigt sahen. Bei Vorhaben wie Agenda 2010 (2003) und „Hartz IV“ (2004) sind auch nach wie vor keine Annäherungen zwischen beiden Seiten feststellbar. Dagegen gab es in der Frage der Regelung der gesetzlichen Mindestlöhne eine sehr enge Kooperation. Myeoun-Hoei Kim hat sich in seiner Dissertation intensiv mit den drei bekanntesten Thesen zur künftigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen DGB und SPD beschäftigt, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. Dabei unterscheidet er nach der Reformismus-These, der Staatsfixierungs-These und der Korporatismus-These, die er allesamt kritisch bewertet. Die Verfechter der Reformismus-These gehen davon aus, dass die Bindung des DGB an die SPD auf der gemeinsamen wirtschaftspolitischen Idee des Keynesianismus beruht. Doch gerade diese Ansicht ist laut Kim spätestens seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre als überholt anzusehen. Das verstärkte Abrücken der Sozialdemokraten von Keynesianischer Wirtschaftspolitik und die gleichzeitig weiterhin sehr starke politische Nähe des DGB zur SPD widersprechen dieser Mutmaßung.109 Bodo Zeuner setzt der offensichtlich nicht mehr zeitgemäßen Reformismus-Theorie die These der „generalisierenden Staatsfixierung“ entgegen. Demnach lautet das Ziel der Gewerkschaften weniger die Durchsetzung ihrer politischen Ziele an der Seite der Sozialdemokraten, sondern vielmehr die „Mitwirkung an den herrschaftsausübenden Institutionen in Politik und Ökonomie.“110 Die politische Nähe zur Sozialdemokratie spielt demnach eine untergeordnete Rolle. „Es wird deutlich, dass es bei seiner Erklärung (…) nicht mehr um eine Bindung an die SPD geht, sondern dass es sich vielmehr um eine bestimmte Strategie gegenüber dem Staat (…) handelt.“111 Kim interpretiert die Konsequenz aus Zeuners These dahingehend, dass das Verhältnis zwischen DGB und SPD einerseits sowie DGB und CDU/CSU andererseits nicht mehr Vgl. DGB-Bundesvorstand (Hrsg.); Der Mensch im Mittelpunkt – eine gerechte Zukunft wählen; Berlin, 2002; S. 3 109 Vgl. Zeuner; 1977, a. a. O., S. 9 110 Vgl. Zeuner, Bodo (Hrsg.); Genossen, was tun? – Bilanz und Perspektiven sozialdemokratischer Politik; Hamburg, 1983; S. 92 111 Vgl. Kim, a. a. O., S. 170 108 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 64 unterscheidbar sei. Schließlich sähen die Gewerkschaften eine große Notwendigkeit, generell gute Beziehungen zu einer Bundesregierung aufzubauen, um ihre Interessen zu vertreten. Die laut Kim unverändert stark vorhandene Loyalität des DGB zu den Sozialdemokraten auch nach dem Regierungswechsel von 1982 spricht dieser Theorie jedoch die Richtigkeit ab. Darüber hinaus missachtet Zeuner laut Kim die sinkende Bedeutung des Nationalstaates in der Wirtschaftspolitik seit Ende der 1970er Jahre, da diesem der Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt wurde. Insofern ist Zeuners Mutmaßung nicht stichhaltig, was aber auch mit dem Zeitpunkt der Aufstellung dieser (1983) zusammenhängen dürfte. Der dritte von Kim untersuchte Erklärungsansatz für das Verhältnis zwischen DGB und SPD ist die These des Korporatismus und kann als Weiterentwicklung der Staatsfixierungs-These angesehen werden. „Charakteristisch für den demokratischen Korporatismus ist die Einbindung der wichtigsten Interessengruppen, sowohl bei der Formulierung politischer Ziele und den Entscheidungen darüber, als auch bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben und Leistungen.“112 Die DGB-Gewerkschaften wurden zu Zeiten der sozial-liberalen Koalition in die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung eng eingebunden, so beispielsweise durch die „Konzertierte Aktion“. Hella Kastendiek und Hugo Reister, die bekanntesten Verfechter dieser These, bezeichnen den Korporatismus als eine spezifisch sozialdemokratische Politikform, da mit Regierungswechsel von 1982 der Korporatismus an Bedeutung verloren habe. 113 dem Die Einbeziehung des DGB in die Entscheidungsprozesse könne als Ausdruck sozialdemokratischer Affinität interpretiert werden, eine sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Blockbildung innerhalb der Bundesregierung sei folglich zwischen 1966 und 1982 pausenlos beibehalten worden. Kim hält dem einmal mehr die Tatsache entgegen, dass die Abkehr der SPD von der Keynesianischen Wirtschaftspolitik Mitte der 1970er Jahre zu einem Scheitern des korporatistischen Bündnisses geführt hat, da die inhaltlichen Gemeinsamkeiten für eine solch starke Einbindung des DGB wie zwischen 1966 und 1973 nicht mehr ausreichend gegeben waren.114 Auch Otto Jacobi widerspricht der Ansicht einer dauerhaften Einbindung: „Herrschten anfänglich noch Formen kooperativen Interessenausgleichs vor, so sind diese seit Mitte des abgelaufenen Jahrzehnts [gemeint sind die 1970er Jahre, Anm. des Verfassers] infolge der durch die Arbeitslosigkeit gegenüber den Gewerkschaften entstandenen Druckmittel in den Hintergrund getreten.“115 Darüber hinaus hält der Korporatismus auch in christdemokratisch geführten Bundesregierungen 112 Vgl. Nohlen, Dieter; Kleines Lexikon der Politik; Verlag, C. H. Beck; Heidelberg, München, 2001; S. 266 Vgl. Kastendiek, Hella/Reister, Hugo; Neue Technikbeherrschung durch die Reetablierung korporativer Handlungsstrukturen?; in: Herzog, Dietrich u. a.; Konfliktpotenziale und Konsensstrategien; Opladen, 1989; S. 216 114 Vgl. Müller-Jentsch, Walther; Gewerkschaften im Umbruch – Ein qualitativer Vergleich; in: Müller-Jentsch, Walther (Hrsg.); Zukunft der Gewerkschaften – Ein internationaler Vergleich; Frankfurt am Main, New York, 1988; S. 268 115 Vgl. Jacobi, Otto; Industrielle Beziehungen, Korporatismus und Disziplinierung; in: Brandt, Gerhard/Jacobi, Otto/Müller-Jentsch, Walther (Hrsg.); Anpassung an die Krise – Die Gewerkschaften in den siebziger Jahren; Frankfurt am Main, New York, 1982; S. 249 113 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 65 Einzug, wie das noch unter Kohl initiierte, aber letztendlich gescheiterte „Bündnis für Arbeit“ im Frühjahr 1996, an dem Gewerkschaften und Arbeitgeber beteiligt waren, unter Beweis stellt. Schließlich stellt Kim den drei von ihm abgelehnten Theorien die These der Alternativlosigkeit der SPD-Bindung an die DGB-Gewerkschaften gegenüber. Die Loyalität des DGB zur SPD habe sich auf Bundesebene trotz veränderter wirtschaftspolitischer Zielsetzungen nicht verändert. Auf der programmatischen Ebene sei die Nähe zur SPD nach wie vor enger als zu allen anderen parlamentarischen Kräften. „Insbesondere in der politischen Kultur der sozialstrukturellen Polarität zwischen SPD und CDU/CSU dürfen die Gewerkschaften die SPD als Nutzenfaktor auf der parlamentarischen Ebene nicht unterschätzen.“116 Da der Keynesianismus als Leitmotiv sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik untauglich wurde, sind zwar nicht unerhebliche inhaltliche Übereinstimmungen verschwunden, jedoch scheinen die Sozialdemokraten für den DGB nach wie vor die Partei zu sein, die am ehesten in der Lage ist, ihre Anliegen durchzusetzen. Da die Gewerkschaften bisher jedoch nicht der Lage waren, den Regeln des kapitalistischen Weltmarktes unter den Bedingungen der Globalisierung schlüssige und brauchbare eigene Konzepte als Alternative entgegenzusetzen, wird es auch nach wie vor zu Spannungen mit einer Regierungspartei SPD kommen.117 4.3.3 Fazit Kim stellt in seinen Ausführungen die Alternativlosigkeits-These auf. Diese wird von Langkau u. a. im Großen und Ganzen bestätigt: „Eine inhaltliche und strategische Alternative zur Zusammenarbeit von SPD und Gewerkschaften war und ist wohl kaum in Sicht.“118 Auch Jürgen Dittberner kommt zu einem ähnlichen Ergebnis.119 Trotz aller Spannungen und Querelen, die eine solch enge Zusammenarbeit mit sich bringt, wird sich der DGB somit auch künftig nicht von der SPD abwenden. Gerade im Vorfeld von Bundestagswahlen werden inhaltliche Differenzen zweitrangig. Von der engen Verbundenheit der Organisationen miteinander profitieren beide: Der DGB weiß um die Problematik, dass ausschließlich die Sozialdemokraten zumindest theoretisch in der Lage sind, ihre Interessen zu vertreten, allein schon aufgrund der großen personellen Verquickung beider. Die SPD wiederum hat ebenfalls ein berechtigtes Interesse an einer intensiven Zusammenarbeit mit den DGB-Gewerkschaften, da ein Interessenverband mit sechs Millionen Mitgliedern über eine große Lobby in der Gesellschaft verfügt. Der DGB ist die einzige Großorganisation, die in der Lage ist, sozialdemokratische Politik gesellschaftlich abzusichern120, gerade im Wahlkampf ein nicht zu unterschätzender Faktor. Beim Verhältnis SPD-DGB handelt es sich also auch um ein Zweckbündnis des „Geben und Nehmens“, in Kims Analysen gewinnt man zum Teil den Eindruck, als werde diese intensive Verbindung nur auf Initiative der 116 Vgl. Kim, a. a. O., S. 177f. Vgl. Kim, a. a. O., S. 181 118 Vgl. Langkau u. a., a. a. O., S. 73 119 Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 211 120 Vgl. Langkau u. a., a. a. O., S. 73 117 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 66 Gewerkschaften aufrechterhalten, während von Seiten der Sozialdemokraten in dieser Hinsicht keine großen Anstrengungen unternommen werden. Insofern wird die Notwendigkeit dieses Bündnisses zu einseitig untersucht. Überdies sind beide Organisationen gleichermaßen vom Strukturwandel in der Gesellschaft betroffen, beide befinden sich in einer Legitimationskrise und haben mit der sinkenden Zahl an Arbeitern in der Bevölkerung zu kämpfen. Die Gewerkschaften stehen vor dem Dilemma, „ob sie sich für die sozialen Errungenschaften der Beschäftigten einsetzen sollen oder für eine Beschäftigungspolitik zu Lasten der tariflichen Besitzstände.“121 Die SPD wiederum steht bzw. stand vor der Frage, ob sie ihre politische Programmatik weiterhin auf die Arbeiterschaft ausrichten oder eingedenk des sinkenden Arbeiteranteils verstärkt andere gesellschaftliche Gruppen ansprechen soll. Insofern steht abschließend zu erwarten, dass die engen Verbindungen zwischen SPD und DGB trotz zahlreicher Differenzen langfristig bestehen bleiben werden. Allerdings zeigen die Beispiele des Godesberger Programms der SPD von 1959 und des Düsseldorfer Programms des DGB von 1963, dass dieses im Großen und Ganzen gute Verhältnis stets anhand aktueller politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen erneuert werden muss. Sowohl SPD als auch DGBGewerkschaften stehen im Prozess einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Dies müssen beide Seiten für sich begreifen. Die SPD hat in der Vergangenheit stets schneller gesellschaftliche Veränderungen als Anstoß begriffen, sich neu zu positionieren und war mehr als einmal Schrittmacherin für den DGB. Hier gilt es allerdings zu bedenken, dass die SPD mit lediglich einem Zehntel der DGB-Mitglieder auch wesentlich zügiger und effektiver interne Debatten zu einem Ergebnis bringen kann. Beide Organisationen, aber insbesondere die Gewerkschaften, müssen sich den Realitäten der ökonomischen Globalisierung in viel stärkerem Maße als bisher stellen und diese in ihre Programmatik einbeziehen, wollen sie in der Öffentlichkeit nicht weiterhin als „Reformbremse“ wahrgenommen werden. 121 Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 211 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 67 5. Perspektiven der SPD – eine Prognose Das Aufzeigen von Perspektiven und Prognosen gerade für eine traditionsreiche Volkspartei wie die SPD birgt stets das Risiko, dass solche Szenarien durch unvorhergesehene Ereignisse schnell obsolet werden können. So wurde beispielsweise noch Mitte August 2002 allenthalben angenommen, CDU/CSU und FDP würden die bevorstehende Bundestagswahl gewinnen. Doch die Flutkatastrophe im gleichen Monat, die vorwiegend die neuen Bundesländer betraf, sowie die aufziehende Debatte um eine Beteiligung der Bundeswehr an einem Militäreinsatz im Irak, bewirkten einen Stimmungsumschwung zugunsten der rot-grünen Bundesregierung und ihre Wiederwahl. Derartige Geschehnisse sind allenfalls partiell vorhersehbar. Somit können die im folgenden Kapitel vorgelegten Prognosen bezüglich der kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklungsszenarien der Sozialdemokratie auch nur unter dem Vorbehalt unvorhergesehener Geschehnisse betrachtet werden. Ferner besteht die Problematik, dass Vorhersagen auf Spekulationen beruhen, die aus gegebenen Tatsachen heraus entwickelt werden. Dabei können auch parteipolitische Neigungen eine gewichtige Rolle spielen. Ein SPD-Mitglied oder ein der SPD nahe stehender Thesenverfasser wird tendenziell eher eine positive Ausprägung der Prognosen zugunsten der Sozialdemokraten erkennen lassen als ein Autor, der der SPD weniger wohl gesonnen gegenübersteht, wenngleich die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass es auch hier Ausnahmen gibt.122 Gerade in der Politikwissenschaft werden politische und vor allem tagespolitische Entwicklungen vielfach höchst unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Da den vorliegenden Prognosen und Thesen der Kenntnisstand von Januar 2005 zugrunde liegt, sind insbesondere Vorhersagen über Wahlen wie die in Nordrhein-Westfalen oder auf Bundesebene und deren Konsequenzen für die SPD hoch spekulativ. In diesem Fall ist ein Zurückgreifen auf vorhandene wissenschaftliche Literatur nur eingeschränkt möglich, weshalb sich ein vergleichender historischer Abriss als notwendig erweist. 122 Es ist ebenso möglich, dass ein Sozialdemokrat in Sorge um seine Partei ein besonders düsteres Szenario entwirft, um einen Umdenkungsprozess innerhalb der Partei zu bewirken bzw. zu beschleunigen. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 68 5.1 Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 2005 – mögliche Szenarien bei einer Niederlage Das einwohnerstärkste Bundesland an Rhein und Ruhr gilt als sozialdemokratisches Kernland. Die SPD regiert hier seit 1966 ununterbrochen in unterschiedlichen Konstellationen (vgl. Kapitel 3.1.7). Landtagswahlen und andere politische Entwicklungen schienen in Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit nicht selten Modellcharakter für den Bund zu haben. Es gilt nun, herauszufinden, wie wichtig Nordrhein-Westfalen für die Sozialdemokraten ist und welche die Auswirkungen bei einem Machtverlust am 22. Mai 2005 wären. Immerhin würden die Oppositionsparteien Union und FDP im Falle eines Regierungswechsels in den letzten beiden rotgrün regierten Ländern Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen – in beiden Ländern finden im Frühjahr 2005 Landtagswahlen statt – über eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat verfügen. Hierdurch könnte eine noch größere Zahl von Bundesgesetzen, nämlich auch die einfach zustimmungspflichtigen, zu Fall gebracht werden – die Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung könnte die Folge sein. Darüber hinaus wäre der kleine Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen trotz zu erwartender Hinzugewinne in beiden Bundesländern in keiner Landesregierung und damit auch erstmals seit Januar 1989 nicht mehr im Bundesrat vertreten. Aussagen wie die von Joachim Becker: „Ohne machtpolitische Alternative wird das Grün bald welk sein“123 bekämen neuen Zündstoff. Ebenso dürften sich die innerparteilichen Konflikte in der SPD über den künftigen inhaltlichen Kurs der Partei und der Politik der SPD-geführten Bundesregierung verschärfen, wenn eine derart wichtige Hochburg wie Nordrhein-Westfalen „verloren“ ginge. Schließlich handelt es sich bei der nordrhein-westfälischen SPD um den mitgliederstärksten Landesverband. 5.1.1 Die wahrscheinlichsten Szenarien Letztendlich wären bei einer Wahlniederlage also drei verschiedene Szenarien für die Partei denkbar: 1) Die rot-grüne Bundesregierung tritt zurück, da sie sich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat als nicht mehr handlungsfähig betrachtet. Eine Zweidrittelmehrheit der Opposition in der Länderkammer wäre in der bundesdeutschen Geschichte ein absolutes Novum. Allerdings wäre für diese Alternative auch ein Regierungswechsel in Schleswig-Holstein notwendig, der eingedenk der aktuellen Umfragewerte von November/Dezember 2004 und der machtpolitischen Alternative von SPD und Grünen in Form des SSW124 schwieriger zu realisieren sein dürfte als in Nordrhein-Westfalen. Die Sozialdemokraten würden im Falle des Endes von Rot-Grün wohl eine 123 Vgl. Becker, Joachim; Suche nach Bündnissen; in: Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996; S. 93 124 Der SSW würde im Falle einer fehlenden Mehrheit sowohl für Rot-Grün als auch Schwarz-Gelb in Schleswig-Holstein eher eine SPD-geführte Landesregierung unterstützen. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 69 große Koalition bis zum nächsten Bundestagswahltermin 2006 anstreben, realistischer wären in diesem Fall jedoch vorgezogene Neuwahlen, aus denen CDU/CSU und FDP mit hoher Wahrscheinlichkeit als Sieger hervorgehen würden. 2) Die rot-grüne Bundesregierung bleibt im Amt. Jedoch dürfte der Druck innerhalb der SPD auf Gerhard Schröder nach den zahlreichen Wahlniederlagen und dem ungebremst starken Mitgliederschwund so enorm anwachsen, dass dieser als Bundeskanzler zurücktreten müsste. Angesichts des Schrumpfungsprozesses der Partei würden vor allem Parteilinke seine wirtschaftsund sozialpolitischen Konzepte als gescheitert betrachten. Insbesondere in der sozialdemokratischen Hochburg, dem Ruhrgebiet, würde sich großer Unmut breit machen, wenn aufgrund dieser als unsozial empfundenen Politik Wahlen verloren gingen. Franz Müntefering oder Wolfgang Clement wären in diesem Fall die wahrscheinlichsten Nachfolger Schröders im Kanzleramt. 3) Gerhard Schröder und die rot-grüne Bundesregierung bleiben unverändert im Amt, allerdings mit nicht abschätzbaren Folgen für das Verhältnis zwischen den Koalitionspartnern. Da die Grünen zwar einerseits bei Wahlen in zunehmendem Maße Stimmen hinzugewinnen, andererseits jedoch aufgrund der ausgeprägten elektoralen Schwäche der Sozialdemokraten in den Ländern an Einfluss verlieren – weil mit ihrem Wunschkoalitionspartner keine Regierungsmehrheiten gebildet werden können –, könnte man sich mittelfristig auf Länderebene koalitionstaktisch umorientieren. In Ländern, in denen eine Machtperspektive mit der SPD dauerhaft nicht vorhanden ist, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, würden die Grünen vor Ort den Automatismus einer Koalitionsaussage zugunsten der Sozialdemokraten zumindest überdenken. Dies würde die Position der SPD in zahlreichen Bundesländern weiter schwächen. 5.1.2 Kritische Bewertung Um die möglichen Konsequenzen einer Niederlage in Nordrhein-Westfalen abschätzen zu können, bietet sich ein Rückblick auf die Folgen des letzten Regierungswechsels an Rhein und Ruhr am 8. Dezember 1966 an. „Das Jahr 1966 stellte die Weichen für den Übergang von einer vornehmlich christdemokratisch geprägten Zeit zu einer SPD-Führung. Dies gilt in gleicher Weise auf Bundesebene wie für das Land Nordrhein-Westfalen.“125 Am 10. Juli 1966 wurde die SPD bei der Landtagswahl mit 49,5 % zwar stärkste Partei, verfehlte jedoch die absolute Mehrheit denkbar knapp. CDU und FDP setzten mit einer knappen Mehrheit von 101 gegen 99 Stimmen im Landtag ihre Zusammenarbeit zunächst fort. Am gleichen Tag des Bruchs der christlichliberalen Koalition in Bonn am 27. Oktober 1966 mit der Entscheidung der FDP, diese nicht fortzusetzen126, wurde auch das CDU/FDP-Bündnis in Düsseldorf durch die Liberalen beendet. Die SPD-Landesspitze um den späteren Ministerpräsidenten Heinz Kühn bevorzugte anfangs das 125 Vgl. http://www.nrw2000.de/nrw/koalition.htm; aufgerufen am 22.11.2004 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.); 1949-1969 – 20 Jahre Politik der Bundesregierung; aus der Reihe: Bonner Almanach; Bonn, 1970; S. 169 126 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 70 Bonner Modell einer Zusammenarbeit mit den Christdemokraten, die Parteibasis favorisierte hingegen ein sozial-liberales Bündnis und setzte sich schließlich durch. Knapp drei Jahre später kam es zur Bildung der ersten SPD/FDP-Bundesregierung unter Willy Brandt. Somit hatten sich die Düsseldorfer Verhältnisse auf Bonn übertragen und nicht umgekehrt. Nordrhein-Westfalen kam damit in der Entwicklung einer zunehmenden Annäherung zwischen SPD und FDP scheinbar eine entscheidende Rolle zu. Die FDP nahm ihre Rolle in der Opposition auf Bundesebene gleichzeitig mit dem Abschluss des Koalitionsvertrags im Land zum Anlass, sich in gesellschaftspolitischen Fragen verstärkt der SPD zuzuwenden (vgl. Kapitel 3.2.2). Analog zu dieser Entwicklung sahen vor allem viele Sozialdemokraten, aber auch Medien, die Bildung der ersten rot-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1995 als eine Art Modell für den Bund, ignorierten dabei jedoch, dass dieses Bündnis aufgrund des Verlustes der absoluten Mehrheit der SPD notgedrungen geschlossen wurde und der damalige Ministerpräsident Johannes Rau nicht gerade als glühender Befürworter dieser Zusammenarbeit galt. Eingedenk der aufgezeigten Tendenzen muss untersucht werden, ob das Land NordrheinWestfalen tatsächlich eine solch gewichtige Rolle bei parteipolitischen Entwicklungen und koalitionstaktischen Erwägungen auf Bundesebene spielt oder ob die skizzierte Entwicklung von 1966 im Hinblick auf 1969 eher zufälliger Natur war. Schließlich waren ernstere Spannungen zwischen SPD und FDP erstmals bereits 1976 in Niedersachsen nach dem Auseinanderbrechen der dortigen sozial-liberalen Koalition zugunsten eines CDU/FDP-Bündnisses wahrzunehmen127, während die nordrhein-westfälische FDP noch 1978 bei der Wahl Raus zum Ministerpräsidenten fest an der Seite der SPD stand.128 Das rot-gelbe Bündnis wurde nicht durch einen Bruch, sondern durch das Erreichen der absoluten Mehrheit durch die SPD bei der Landtagswahl 1980 beendet. Die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen fanden somit sogar umgekehrt proportional zu den bundespolitischen statt. „Die bundespolitische Wende zur konservativ-liberalen Koalition 1982 ist von den nordrhein-westfälischen Wählern nicht mit vollzogen worden.“129 Dem Bruch der SPD/FDP-Koalition auf Bundesebene gingen landespolitische Ereignisse dieser Art lediglich in Berlin voraus130, die sozial-liberale Zusammenarbeit in Hessen wurde erst nach dem Wechsel in Bonn beendet, nämlich am 30. November 1982. Insofern ist das Ausmaß der Bedeutung Nordrhein-Westfalens für bundespolitische Entwicklungen zu relativieren, eine Vorreiterrolle für neue politische Entwicklungen besitzt das Land somit definitiv nicht, allein schon aufgrund der Tatsache, dass die erste rot-grüne Koalition im Land erst zehn Jahre nach der ersten rot-grünen Landesregierung überhaupt (1985 in Hessen) gebildet wurde. 127 Dieses Ereignis kann jedoch definitiv nicht als Anzeichen für eine zunehmende Entfremdung der beiden Parteien angesehen werden, da SPD und FDP ihre Zusammenarbeit nach den Bundestagswahlen 1976 und 1980 fortsetzten. 128 Vgl. http://www.nrw2000.de/nrw/rau_minister.htm, aufgerufen am 21.11.2004 129 Vgl. Biegler, a. a. O., S. 410 130 Die SPD/FDP-Koalition in Berlin wurde 1981 von einer CDU/FDP-Koalition abgelöst. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 71 Vor diesem Hintergrund erscheint das erste der möglichen Szenarien äußerst unwahrscheinlich, ebenso wenig lässt sich im Falle einer Abwahl von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen zwangsläufig ein Automatismus für eine Abwahl im Bund im September 2006 ableiten. Darüber hinaus hätte eine Beendigung der Koalition auf Bundesebene sowohl für die SPD, als auch die Grünen negative Folgen. Eine Koalition aus SPD und Union würde in jedem Fall an den Widerständen der CSU scheitern, die traditionell Gegnerin einer solchen Konstellation ist, da ihre Stimmen in Legislative und Exekutive, anders als in einer christlich-liberalen Zusammenarbeit, nicht mehr entscheidend wären. Im vorliegenden Fall würde sich allerdings auch die CDU ob der Aussicht auf einen wahrscheinlichen Wahlsieg und den Posten des Regierungschefs nach Neuwahlen gegen die Option des Juniorpartner-Daseins aussprechen. SPD und Grüne würden sich nach vorgezogenen Neuwahlen aller Wahrscheinlichkeit nach in der Opposition wieder finden. Die dann vorherrschende politische Großwetterlage würde einen neuerlichen Wahlsieg von Rot-Grün kaum möglich machen. Überdies ist eine Zweidrittelmehrheit der Oppositionsparteien in der Länderkammer nicht zwangsläufig mit dem Läuten der Sterbeglocke für eine Bundesregierung gleichzusetzen. Bereits seit Frühjahr 2002 gibt es insbesondere in den Feldern der Einwanderungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik eine engere Zusammenarbeit zwischen rot-grün dominiertem Bundestag und schwarz-gelb dominiertem Bundesrat, d. h. eine faktische große Koalition. Eine Abwahl Schröders als Bundeskanzler infolge von Widerständen in der eigenen Partei ist nicht gänzlich auszuschließen, allerdings aufgrund der aktuellen innerparteilichen Entwicklungen kaum vorstellbar. Die SPD-Bundestagsfraktion, die einen solchen Antrag initiieren müsste, wäre durch die Wahlniederlagen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nicht unmittelbar betroffen. Die Erfahrung aus früheren schweren Wahlniederlagen wie in Niedersachsen, Hessen oder Hamburg zeigen, dass die Stimmung in der Fraktion infolgedessen nicht zuungunsten des Bundeskanzlers kippt. Auch Abstimmungen, wie die zum Militäreinsatz in Afghanistan in Verbindung mit der Vertrauensfrage im November 2001, haben bewiesen, dass die Bundestagsfraktion auch in schwierigen inhaltlichen Fragen geschlossen hinter Schröder steht. Abwahlbestrebungen von der Partei ausgehend sind wiederum zwar wahrscheinlicher, jedoch nur Erfolg versprechend, wenn für die Gruppe der Abwahlbefürworter eine Art Leader vorhanden ist. Da sich im Falle eines Rücktritts Schröders nach jetzigem Stand mindestens zwei bundespolitische Größen (Clement und Müntefering) ernsthafte Hoffnungen auf die Kanzlerschaft machen könnten, wäre deren Lager gespalten, nicht zuletzt im mitgliederstärksten Landesverband Nordrhein-Westfalen, da beide potenziellen Kandidaten aus diesem kommen. Pragmatisch orientierte Landesverbände wie Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz würden Clement favorisieren, Müntefering stünde wohl bei traditionalistisch geprägten Landesverbänden wie Bayern oder Schleswig-Holstein höher im Kurs. Die Folge einer solchen Auseinandersetzung Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 72 wäre aufgrund der fehlenden Zuordnung der nordrhein-westfälischen Genossen zu einem bestimmten Lager eine tiefe innerparteiliche Spaltung und ein weiterer Ansehensverlust in der Öffentlichkeit, da eine solche Auseinandersetzung auf einem Sonderparteitag ausgetragen werden würde. Alternativ hierzu könnte die SPD eine Urwahl der Mitglieder nach dem Vorbild der Wahl des Parteivorsitzenden im Jahr 1993 durchführen. Hier hätte Müntefering aufgrund seiner langjährigen gut ausgefüllten Vermittlerrolle zwischen Parteivorstand und Parteibasis möglicherweise die besten Karten, wenngleich er sich im Zuge der Parteireform in NordrheinWestfalen 2000 (Abschaffung der mächtigen Bezirke) schon stark abgenutzt hatte. Die schlechten Erfahrungen von 1993, als sich Rudolf Scharping gegen Schröder und Heidemarie WieczorekZeul durchsetzen konnte, weisen jedoch daraufhin, dass die Parteibasis nicht zwangsläufig in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen.131 Das auf den ersten Blick harmloseste Szenario, das zugleich das Denkbarste ist, dürfte für die SPD mittelfristig die problematischsten Auswirkungen haben, gerade weil sie in keiner Weise abschätzbar sind. In Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen ist die SPD strukturell, teilweise auch traditionell, gegenüber der CDU deutlich im Hintertreffen, in Hessen, Saarland, Hamburg oder Niedersachsen ist sie es nach den letzten Wahlergebnissen. Rotgrüne Mehrheiten in besagten Ländern erscheinen mittelfristig nur unter der Prämisse ausgesprochen guter bundespolitischer Großwetterlagen realisierbar. Mittlerweile haben auch Bündnis 90/Die Grünen erkannt, dass ihre Gestaltungsmöglichkeiten an der Regierung größer sind als auf der Oppositionsbank. Die Partei ist darüber hinaus zunehmend bürgerlich bzw. realpolitisch geprägt – sowohl hinsichtlich der Wähler- als auch der Mitgliederschaft und programmatischen Ausrichtung. Es ist deshalb denkbar, dass beispielsweise nach der Landtagswahl 2006 in Baden-Württemberg im Falle des Verlustes der Mehrheit der aktuell amtierenden CDU/FDP-Koalition eine Zusammenarbeit mit der CDU angestrebt wird. Bereits in Thüringen kursierten im Vorfeld der Landtagswahlen im Juni 2004 Gerüchte über eine mögliche schwarz-grüne Koalition, sollte die CDU infolge des Verlustes der absoluten Mehrheit einen Partner benötigen. Die zahlreichen Bündnisse zwischen CDU und Bündnisgrünen in nordrheinwestfälischen Kommunen stehen beispielhaft für einen sich vollziehenden Paradigmenwechsel in der Partei von Joschka Fischer.132 Aber auch schwarz-grüne Koalitionen in Städten wie Kiel, Saarbrücken oder Mülheim/Ruhr (bis 1999), wo auch Rot-Grün eine Mehrheit gehabt hätte, zeigen, dass sich die Grünen nicht auf Gedeih und Verderb als kleiner Partner der SPD sehen. Die zunehmende Schwäche der Sozialdemokraten auf Länderebene, die eine Perspektivlosigkeit für rot-grüne Mehrheiten zur Folge hat, dürfte diese Tendenzen verstärken. Die SPD läuft somit Gefahr, gerade in den zuvor genannten Bundesländern, isoliert dazustehen. Sie würde folglich Vgl. Walter, Franz; Die SPD – Vom Proletariat zur Neuen Mitte; Alexander-Fest-Verlag; Berlin, 2002; S. 236 Zwischen 1999 und 2004 gab es in den nordrhein-westfälischen Kommunen mehr schwarz-grüne als rotgrüne Bündnisse, so u. a. in der größten Stadt Köln, da die SPD in vielen Stadträten keine Mehrheit bildender Partner war. 131 132 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 73 nicht mehr als Machtalternative zur CDU wahrgenommen, da eine Mehrheit jenseits der Christdemokraten nur schwer vorstellbar wäre – in Berlin, Brandenburg und MecklenburgVorpommern leidet die CDU aktuell unter den umgekehrten Vorzeichen. Eine weitere Verschlechterung der sozialdemokratischen Wahlergebnisse dürfte die Folge sein. Die Bundestagswahlen 1983 und 1987 stehen wiederum exemplarisch für diese Vermutung, als die SPD einer christlich-liberalen Bundesregierung allein gegenüberstand und, aufgrund der zu diesem Zeitpunkt auf Bundesebene kaum vorhandenen Annäherung an die Grünen, nicht plausibel machen konnte, wie sie unter den gegebenen Voraussetzungen Regierungsverantwortung übernehmen wolle und verlor die Wahlen deutlich. Ebenso fehlte der Berliner CDU im Vorfeld der vorgezogenen Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus im Oktober 2001 ein potenzieller Partner, weswegen sie in der Wählergunst besonders massiv abstürzte. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 74 5.2 Mitgliederpartei ohne Mitglieder – Der Genossenschwund eine Bedrohung? Die SPD ist von ihrem Selbstverständnis her eine Mitgliederpartei.133 Es gab zwar in der ersten Hälfte der 1990er Jahre im Zuge des Mitgliederrückganges innerparteiliche Diskussionen, ob die Sozialdemokraten an dieser Bezeichnung festhalten sollen – doch wurden derartige Überlegungen schnell verworfen. Dieses Kapitel soll nun Gründe für den Mitgliederrückgang benennen und einschätzen, ob und inwiefern eine solche Entwicklung für den Bestand der Partei gefährlich ist. Auch sollen mögliche Lösungen aufgezeigt werden, wie die SPD diese Herausforderung zu bewältigen imstande ist. 5.2.1 Ausmaß und Gründe für den Mitgliederschwund Die Mitgliederentwicklung (siehe Kapitel 2.2) ist Besorgnis erregend. Nachdem in den Jahren bis 2002 noch von einer für alle Parteien recht typischen Entwicklung gesprochen werden konnte – auch CDU, CSU, FDP, PDS und seit 1999 Bündnis 90/Die Grünen mussten Mitgliederverluste verkraften – hat sich die Negativentwicklung bei der SPD in den Jahren 2003 und 2004 drastisch beschleunigt, während die bürgerlichen Parteien ihren Mitgliederbestand stabilisieren konnten. Darüber hinaus verlieren Union, FDP und PDS ihre Mitglieder eher aus Gründen der Altersstruktur; auch trägt die zunehmende Entpolitisierung der Gesellschaft zu dieser Entwicklung bei, jedoch kommen bei der SPD seit 2002/2003 noch politisch-programmatische Gründe hinzu. Die Verabschiedung zahlreicher Reformpakete durch die rot-grüne Bundesregierung wie die Agenda 2010 (Frühjahr 2003) oder „Hartz IV“ (Frühjahr 2004), wachsende innerparteiliche Dissonanzen aufgrund der sich verändernden wirtschafts- und sozialpolitischen Ausrichtung der Partei und eine Parteiführung, die zunehmend klassisch sozialdemokratischen Grundsätzen zuwiderhandelt und somit die Bedürfnisse der Parteibasis nach deren Einschätzung nicht mehr ausreichend zur Kenntnis nimmt, haben seit der Bundestagswahl 2002 zu einer Austrittswelle geführt, die in der Parteigeschichte ihresgleichen sucht. Seit 1989 haben per Saldo rund 300.000 Sozialdemokraten ihr Parteibuch zurückgegeben, was in etwa der Einwohnerzahl von Städten wie Bielefeld, Mannheim oder Bonn entspricht. Zwischen 1998 und 2003 waren es allein 130.000 – der Abwärtstrend hat sich somit extrem beschleunigt. Auch wenn bereits zu Beginn der 1980er Jahre definitiv nicht mehr damit gerechnet werden konnte, die hohen Mitgliederzahlen des vorangegangenen Jahrzehnts wieder zu erreichen, kann die Entwicklung seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre nicht mehr als ein für politische Parteien typisches Phänomen betrachtet werden. Der Verlust von rund 13.000 Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen134 allein im 133 Vgl. Parteivorstand der SPD Abt. Organisation (Hrsg.); Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Mitgliederentwicklung“ des SPD-Parteivorstandes; Bonn, 1995; S. 7 134 Erstmals seit den 1960er Jahren ist SPD damit im einwohnerstärksten Bundesland nicht mehr mitgliederstärkste Partei. Vgl. Breuer, Helmut; Rote Angst; in: Die Welt vom 31.08.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 75 ersten Halbjahr 2004 stellt gewiss keinen für das bundesdeutsche Parteiensystem charakteristischen Rückgang dar. Zusätzlich zum Mitgliederrückgang an sich macht der SPD auch die rückläufige Aktivität der Genossen zu schaffen und bedroht in zunehmendem Maße ihre Kampagnenfähigkeit (vgl. Kapitel 2.2). Überdies war keine Partei in den letzten 15 Jahren so massiv von der zunehmenden Überalterung der eigenen Mitgliederschaft betroffen wie die SPD (vgl. Tabelle 2). Die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Eröffnung neuer Freizeitmöglichkeiten (Stichwort „Spaßgesellschaft“) lassen eine Mitgliedschaft in Parteien, „mit denen (…) häufig enttäuschende politische Arbeit“135 verbunden ist, als nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Eine britische Studie, wonach Kinder mit wenig Freunden später eher dazu neigen, sich in einer politischen Partei zu engagieren, dürfte wohl kaum dazu beitragen, das Image von Parteien und deren Mitgliedern wieder zu verbessern.136 Es ist angesichts dieser Faktoren schwer, junge Menschen, denen viele Optionen der Freizeitgestaltung offen stehen, für die oft trockene und mühsame Parteiarbeit bei Stammtischen, Diskussionsrunden oder Canvassing zu gewinnen. Laut Soell vermochte der starke Mitgliederzuwachs der SPD in den 1960er und 1970er Jahren nicht, die personellen Defizite auszugleichen. „Die Partei zog zwar in steigendem Maße Mitglieder mit Hochschulbildung an (…). Aber diese stammten überwiegend aus den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, deren Ideologieträchtigkeit durch die Renaissance des NeoMarxismus (…) stark zugenommen hatte.“137 Da diese Ideologieträchtigkeit jedoch mittlerweile dem Pragmatismus in der politischen Debatte, auch in der SPD, gewichen ist, fällt es folglich schwer, diese Gruppe zum Verbleib in der SPD zu bewegen. Auch hier ist eine hohe Anzahl von Austritten die Folge. 5.2.2 Mögliche Gegenmaßnahmen Der SPD-Parteivorstand, aber auch Sozialdemokraten nahe stehende Sozialwissenschaftler wie Horst Becker oder Jürgen Rohde haben den Mitgliederschwund hinterfragt und nach Lösungen zur Eindämmung dieser Verluste gesucht. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe „Mitgliederentwicklung“ des Parteivorstands sind zwar zu Oppositionszeiten (1995) erarbeitet worden, allerdings nach wie vor aktuell. Die wichtigsten Maßnahmen lauten138: Vgl. Teschner, Manfred; Partei im Spagat – Eine Bestandsaufnahme zum Wandel der deutschen Sozialdemokratie; in: Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996; S. 40 136 Vgl. Studie: Kinder ohne Freunde gehen später oft in die Politik; in: Berliner Morgenpost vom 27.12.2003; in: http://morgenpost.berlin1.de/ausgabe/2003/12/27/aus_aller_welt/649807.html; aufgerufen am 17.11.2004 137 Vgl. Soell, Hartmut; Von den Füßen auf den Kopf – Wie der innerparteiliche Kulturkampf die Arbeitnehmer vertrieb; in: Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996; S. 60 138 Im wesentlichen entnommen aus: Becker, Horst u. a., a. a. O., S. 67ff. SPD-Parteivorstand, 1995, a. a. O., S. 8ff. 135 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 76 Abbau von Parteiverdrossenheit durch Reduzierung der Diffamierung anderer Parteien und durch Vermittlung der Unersetzbarkeit von Parteien Adäquates Kommunikationsverhalten der Parteiführung (z. B. durch bessere Absprachen untereinander; Konzentration auf die hauptsächlichen Ziele und professionelle Kommunikation, stärkere Verkörperung einer unverwechselbaren Parteiidentität) Schnelle Integration neuer Mitglieder in Ortsvereine Kontaktpflege zu Mitgliedern, die nicht an Versammlungen und Sitzungen teilnehmen (Geburtstagsglückwünsche, Anrufe, mündliche Einladungen usw.) Schaffung von Transparenz bei innerparteilichen Entscheidungsprozessen Stärkere Beteiligung der Mitgliederbasis an Entscheidungsprozessen Schaffung einer positiven Grundstimmung innerhalb der Partei („Wir-Gefühl“) Wahlkämpfe auch für verstärkte Mitgliederwerbung nutzen Schaffung von großen Projekten und Kampagnen auch außerhalb von Wahlkampfzeiten Schaffung von Wettbewerb zwischen Kreisverbänden durch Veröffentlichung von Mitgliederzahlenentwicklung Klima von innerparteilicher Demokratie schaffen Effektivierung der Parteiarbeit zur Entlastung der regelmäßig Aktiven Verstärkte Einrichtung von Projektgruppen und zeitlich befristeten Arbeitskreisen zur Motivation zur partiellen Mitarbeit Verbesserung der Motivforschung für Parteiaustritte Zugezogenen Neu-Mitgliedern mehr Aufmerksamkeit schenken 5.2.3 Fazit Es stellt sich auf Dauer die Frage, ob die Organisation der Partei im Zuge der Mitgliederverluste nicht völlig verändert werden muss. Bereits heute erklären sich zunehmend weniger Parteimitglieder bereit, ehrenamtliche Tätigkeiten, wie klassisches Canvassing oder Organisation von Kundgebungen und Parteiveranstaltungen zu übernehmen. Die nachfolgenden Generationen werden – abgesehen davon, dass sie schwerer für Politik und Parteimitgliedschaften zu begeistern sind – ihre Informationen über eine politische Partei weniger durch die Lektüre von Informationsbroschüren oder seitenlangen Grundsatz- und Wahlprogrammen gewinnen, sondern über Fernsehen und Internet. Und selbst dort werden im Regelfall lediglich Informationen zur Bundes- und teilweise Landespolitik gesucht. Durch die wachsende Mobilität der Bevölkerung ist das Interesse an lokaler Politik allgemein rückläufig. Die Pflege der Homepage der Bundes- oder Landespartei und die adäquate Präsentation sozialdemokratischer Spitzenpolitiker in Medien ist Aufgabe eines hauptamtlich aktiven Parteiapparates. Ehrenamtliches Engagement ist hier nur zweitrangig. Zwar betreuen ehrenamtliche Mitarbeiter zumeist die Internetangebote von Ortsvereinen, doch werden diese in den seltensten Fällen regelmäßig, geschweige denn täglich, Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 77 aktualisiert. Die CDU steht hier vor ähnlichen Problemen.139 Auch andere Aufgaben, die Ortsvereine vor Ort ehrenamtlich bewältigen, wie das Anbringen von Plakaten, erscheinen auf Dauer ineffektiv. Wahlplakate dienen hauptsächlich dazu, Stammwähler an den Wahltermin zu erinnern. Wechselwähler hingegen lassen sich durch diese Form der Werbung eher selten gewinnen. Da ihr Anteil an der Gesamtwählerschaft jedoch immer weiter steigt, sinkt gleichzeitig auch der Nutzen von Wahlplakaten. Auch Wahlkampfveranstaltungen werden im Medienzeitalter auf Dauer unproduktiv, da ein deutlich kleinerer Personenkreis erreicht wird, als über TV und Internet. Die tendenziell älter werdende Besucherschaft von solchen Veranstaltungen kann ebenfalls als Beleg dafür gesehen werden, dass es sich hierbei um ein Auslaufmodell der politischen Kommunikation handelt. Letztlich wird sich die SPD im Laufe der kommenden Jahre zu einer Kampagnenpartei nach USVorbild umstrukturieren müssen. Die jetzige Form des Angewiesenseins auf eine starke Mitgliederbasis und des Festhaltens am Begriff „Mitgliederpartei“ ist nicht zukunftsfähig. Jürgen Dittberner steht dieser Mutmaßung zwar eher kritisch gegenüber: „Es ist jedoch fraglich, ob der Typus der Maschinenpartei amerikanischer Provenienz die Zukunft der SPD sein kann. In der politischen Tradition Deutschlands hat die Willensbildung in den politischen Parteien durchaus eine wichtige Probe- und Katalysatorwirkung für das Gemeinwesen, zu dessen Konsens es beiträgt, dass die diversen Interessen und Ansichten nicht direkt, sondern eben durch die Mitgliederschaften der Parteien gefiltert werden.“140 Allerdings ist gerade die SPD zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein gutes Beispiel dafür, dass auch Parteien mit einer hohen Mitgliederzahl der Öffentlichkeit unausgegorene und nicht-mehrheitsfähige Vorschläge unterbreiten können. Die wenig professionelle Handhabung der Debatte um die Abschaffung des 3. Oktober als Feiertag im Herbst 2004 steht beispielhaft hierfür. Die vom SPD-Parteivorstand und Autoren wie Horst Becker vorgeschlagenen Maßnahmen gegen den Mitgliederrückgang sind zum größten Teil zwar richtig und nachvollziehbar, jedoch recht allgemein gehalten und hinterlassen eher den Eindruck von Flickschusterei: „Themenvorgaben und Aktionsanforderungen höherer Parteigliederungen müssen zwingend handlungsorientiert sein und Handlungsvorschläge beinhalten.“141 Auch erwecken Vorschläge wie eine intensivere Mitgliederbetreuung den Anschein, dass das Problem der fortschreitenden Überalterung der SPDMitglieder nicht hinreichend zur Kenntnis genommen wird. Keine andere deutsche Partei hatte in den letzten Jahren derart stark mit einer Überalterung ihrer Mitglieder zu kämpfen wie die Sozialdemokraten.142 Die aktivste und zahlenmäßig wachsende Gruppe der Über-60-jährigen wird sich zwangsläufig auf Dauer aus dem aktiven Parteigeschehen zunehmend zurückziehen, eine intensivere Mitgliederbetreuung ist somit nicht Ziel führend. Vielmehr müssen verstärkt 139 Vgl. Dambeck, Holger; Unterwandert von Elke Mustermann; in: Spiegel Online am 19.07.2004; in: http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,309321,00.html; aufgerufen am 17.11.2004 140 Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 210 141 Vgl. Becker, Horst u. a., a. a. O., S. 69 142 Vgl. Niedermayer/Gabriel, a. a. O., S. 292 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 78 Anstrengungen unternommen werden, neue Mitglieder zu akquirieren, denn die Verluste durch das Ausscheiden älterer Mitglieder werden durch Neueintritte zurzeit bei weitem nicht kompensiert. Somit muss ernsthaft bezweifelt werden, ob die SPD momentan tatsächlich Antworten auf das Problem der gesellschaftlichen Entpolitisierung und des Mitgliederverlustes hat. Es ist zwar damit zu rechnen, dass sich der dramatische Mitgliederrückgang der Jahre 2003 und 2004 wieder normalisieren wird, wenn die Sozialdemokraten ihre innerparteilichen Auseinandersetzungen hinsichtlich einer wirtschafts- und sozialpolitischen Neuausrichtung überwunden und das Gros der Mitglieder die Notwendigkeit einschneidender und unbequemer Reformen wie „Hartz IV“ erkannt hat. Die strukturellen Gründe für das abnehmende Interesse der Bürger, einer Partei beizutreten, die sinkende Bereitschaft der Mitglieder zum aktiven Engagement vor Ort und die Überalterung der Parteimitglieder werden hingegen dauerhafte Probleme bleiben. Die SPD wird ihren Mitgliederschwund allenfalls mildern, aber nicht aufhalten können. Noch im Jahr 1995 gab der Parteivorstand das Ziel aus, den Mitgliederbestand bei 850.000 Genossen zu stabilisieren.143 Dieses Ziel wurde deutlich verfehlt. Die SPD steht nun am Scheideweg: Entweder sie akzeptiert den Mitgliederrückgang als eine normale gesellschaftliche Entwicklung und baut die Parteiorganisation zu einem hauptamtlichen Parteiapparat um, der auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene schlagfertiger, effektiver und unabhängig von der schrumpfenden Basis vor Ort agieren kann. In diesem Fall müssten sich die Sozialdemokraten jedoch vom Attribut „Mitgliederpartei“ verabschieden. Oder aber sie setzt auch in Zukunft auf eine breite Mitgliederbasis und versucht weiterhin mehr schlecht als recht dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken. In diesem Fall wäre die Entwicklung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu stoppen und die Kampagnenfähigkeit der Partei aufgrund der schrumpfenden Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter und Wahlkämpfer vor Ort auf Dauer infrage gestellt. 143 Vgl. SPD-Parteivorstand; 1995, a. a. O., S. 3 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 79 5.3 WASG – eine ernste Gefahr für die SPD? Die Sozialpolitik der rot-grünen Bundesregierung wurde von Seiten zahlreicher Parteilinker und Gewerkschaftsmitglieder insbesondere im Zusammenhang mit „Hartz IV“ als zunehmend sozial unausgewogen empfunden. Bereits Ende 2003 wurde die Idee ins Leben gerufen, eine neue Partei zu gründen, die das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ nach ihren Worten wieder zum Primärziel haben solle. Hauptinitiator war dabei Klaus Ernst, Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt. Ein Antreten bei der Bundestagswahl 2006 war das erklärte Ziel. Der SPD-Parteivorstand – durch die aufkommende Konkurrenz von links sichtlich beunruhigt 144 Parteiausschlussverfahren gegen die sozialdemokratischen Mitinitiatoren. – drohte mit Im März 2004 kam es schließlich zur Gründung der „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG), einer Wählerinitiative, aber noch keiner Partei. Letztere sollte erst gegründet werden, wenn man über genügend Mitglieder verfügen würde. „Die maßgeblich von fünf bayerischen IG-MetallFunktionären und SPD-Mitgliedern getragene Gruppierung will als Sammelbecken dienen für Kritiker des ´neoliberalen Kurswechsels der Regierungsparteien´.“145 Seither wurde mit der WASG stets der Name Oskar Lafontaine assoziiert, da der Initiative nach eigener Einschätzung für einen Erfolg bei Urnengängen eine charismatische Führungsfigur fehle, die das kommissarisch amtierende Spitzenquartett, bestehend aus Klaus Ernst, Axel Troost, Sabine Lösing und Thomas Händel nicht ausfüllen könne.146 In ihrem ersten Programmentwurf verlangt die "Wahlalternative" unter anderem „eine Rücknahme der gerade beschlossenen Hartz-IV-Gesetze. Statt einer Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose sollte es einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.400 Euro geben. Außerdem setzt sich das Bündnis für eine Wiedereinführung der einprozentigen Vermögenssteuer und einen Spitzensteuersatz von mindestens 45 Prozent ein.“147 Eine Parteigründung stand nach Begründung der Initiative noch aus, per Urabstimmung wurden die gut 6.000 Mitglieder der WASG befragt. „Der eigentliche Gründungsparteitag soll Ende April/Anfang Mai 2005 in Nordrhein-Westfalen stattfinden.“148 Die Einschätzungen innerhalb der SPD darüber, ob die WASG als neue Linkspartei eine ernstzunehmende Gefahr bei Wahlen für die Sozialdemokraten darstellt, divergierten zunächst erheblich. Während der niedersächsische Fraktionsvorsitzende Siegmar Gabriel wenig Anlass zur Beunruhigung sieht („Das ist für die SPD nicht bedrohlich, wenn sich sechs Jungs in Bayern 144 Vgl. SPD-Spitze bei Unterstützern einer Linkspartei unversöhnlich; in: Financial Times Deutschland Online vom 20.03.2004; http://www.ftd.de/pw/de/1079712459691.html?nv=5wn; aufgerufen am 03.12.2004 145 Vgl. Vor dem SPD-Parteitag: Debatte über Linkspartei; in: DIE WELT vom 19.03.2004 146 Vgl. Lafontaine notfalls in neuer Linkspartei – Wahlalternative erfreut; in: GlaubeAktuell vom 08.08.2004; http://www.glaubeaktuell.net/portal/nachrichten/nachricht.php?IDD=1091896762&IDDParent=1092736936&Su che=1&IDT=35&IDB=1; aufgerufen am 03.12.2004 147 Vgl. Linkspartei lässt SPD zittern; in: Die Tageszeitung vom 05.07.2004; S. 1 148 Vgl. Keine kadermäßige Linkspartei; in: Stern Online vom 21.11.2004; www.stern.de/politik/deutschland/index.html?id=532615; aufgerufen am 04.12.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 80 treffen und einen Aufruf unterschreiben“149), fällt die Beurteilung vom Vorsitzenden der Jusos, Niels Annen, der vor einem Wunschdenken warnte, in einer neuen Linkspartei keine Gefahr zu sehen, erheblich negativer aus. Seit der Absichtserklärung der WASG, zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai 2005 antreten zu wollen150, befürchten u. a. Franz Müntefering und Michael Müller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, dass die Wahlalternative die Sozialdemokraten Stimmen kosten könnte.151 Auch Parteienforscher wie Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen sehen in der WASG kurzfristig eine nicht unerhebliche Bedrohung für die Sozialdemokraten.152 Tatsächlich haben neu gegründete Parteien in der Vergangenheit bei Wahlen häufiger Erfolge erzielen können. Die „Partei Rechtsstaatliche Offensive“ unter Ronald Schill, die im Herbst 2001 bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg mit dem Wahlkampfthema Innere Sicherheit, insbesondere auf Kosten der CDU aus dem Stand 19,4 % der Stimmen gewann, kann hier als jüngstes Beispiel genannt werden. Auch die „Freien Wähler“ in Bayern konnten bei der Landtagswahl 1998 bei ihrem ersten Antreten mit 3,7 % zumindest einen Achtungserfolg verbuchen, während die „STATT-Partei“ 1993 in Hamburg bei ihrer ersten Wahl sofort 5,6 % errang und eine Regierungskoalition mit der SPD einging. Allerdings hatten diese Parteineugründungen eines gemeinsam: Sie konnten ihre (Achtungs-)Erfolge bei den darauf folgenden Wahlen nicht wiederholen und blieben ein regionales Phänomen. Die Wahlerfolge waren vor allem im Fall Schill in der Aktualität eines bestimmten tagespolitischen Themas begründet, welches von den etablierten Parteien entweder nicht hinreichend angesprochen wurde oder aber die Bevölkerung diesen keine Kompetenz in der Lösung dieses Problems zuschrieb. Demzufolge sind die Voraussetzungen für die WASG, in Nordrhein-Westfalen 2005 in nennenswertem Umfang Stimmen zu gewinnen, durchaus gegeben, mit dem Thema „Soziale Gerechtigkeit“ stellt sie eine Art „One-Issue-Partei“ dar. In einem Bundesland wie NordrheinWestfalen, das vor allem im Ruhrgebiet sehr stark vom Strukturwandel erfasst wurde, ist die Besorgnis in der Bevölkerung, als Verlierer dieser Umbrüche dazustehen, stark ausgeprägt. Die hohe Arbeitslosigkeit in Städten wie Dortmund, Gelsenkirchen oder Duisburg und die nach wie vor schwache Binnenkonjunktur, sind ein allgemein guter Nährboden für Parteien, die sich im sozialen Bereich als Bewahrer des Status quo zu profilieren versuchen und unbequeme, aber notwendige Reformen der regierenden Parteien scharf attackieren. Gerade im traditionell stark sozialdemokratisch geprägten Ruhrgebiet, wo der Arbeiteranteil an der Bevölkerung unverändert hoch ist, stieß die gezwungenermaßen starke Christdemokratisierung der SPD-Wirtschafts- und Sozialpolitik (vgl. Kapitel 5.5.4) auf wenig Verständnis. Die Kommunalwahlen in den Jahren 1999 und 2004 haben gezeigt, dass eine sozialdemokratische Dominanz in den dortigen 149 Vgl. DIE WELT, 19.03.2004, a. a. O. Vgl. WASG Regionalverband Köln; Pressemitteilung vom 25.11.2004; in: www.wasgkoeln.de/Files/PresseKoeln/041126_PEK_WahlenNRW.pdf; aufgerufen am 02.12.2004 151 Vgl. Die Tageszeitung, 05.07.2004; a. a. O. 152 Vgl. DIE WELT, 19.03.2004, a. a. O. 150 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 81 Kommunen bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Die Wähler sind durchaus bereit, nach Alternativen zur SPD-Wahl zu suchen. Da im Zuge der Hartz IV-Debatte im Herbst 2004 auch die CDU ob ihrer Zusammenarbeit mit der Bundesregierung zunehmend unter Druck geriet, ist sie trotz ihrer sozialpolitischen Orientierung an Rhein und Ruhr nicht zwangsläufig eine Alternative zur SPD. Rein theoretisch könnte die WASG in dieses von den Sozialdemokraten hinterlassene Vakuum eindringen; praktisch ist jedoch aufgrund eines nach wie vor fehlenden schlagfertigen Parteiapparats und einer zu dünnen Mitgliederbasis hiermit nicht zu rechnen. Allerdings ist ein Stimmenanteil von 2-3 % nicht gänzlich auszuschließen, und eben diese würden im Endeffekt hauptsächlich Rot-Grün fehlen, was im Hinblick auf die sehr knappe Ausgangslage nach den Umfragen Ende 2004153 fatale Konsequenzen haben könnte. Gerade darin liegt allerdings auch die Chance für die Sozialdemokraten, nämlich den Wählern im Wahlkampf zu vermitteln, dass jede Stimme für die WASG der SPD bzw. Rot-Grün schadet und ein mögliches CDU/FDPBündnis nach der Landtagswahl wahrscheinlicher macht. Darüber hinaus ist das Verhalten der WASG allgemein recht widersprüchlich. Einerseits attackiert sie auf populistische Art die Politik der Bundesregierung154 mit dem Ziel, ihr zu schaden, andererseits stünde man für eine Koalition mit den Sozialdemokraten unter der Bedingung bereit, dass sie die „Politik des Sozialabbaus“ aufgebe.155 Allerdings stellt sich die Frage, warum sich die Mitglieder der so genannten „Wahlalternative“ nicht weiterhin innerhalb der SPD für eine Korrektur der Sozialpolitik engagieren, anstatt diese mittels einer Fremdpartei herbeiführen zu wollen. In der bundesdeutschen Geschichte kam es zweimal zu Parteineugründungen, die sich im Parteiensystem erfolgreich etablieren konnten. Dies waren zum einen zu Beginn der 1980er Jahre die Grünen und zu Beginn der 1990er Jahre die PDS. Die Grünen entstanden aus einer Reformbewegung, die mit den Themen Umweltschutz (Ökologie wurde zum Schlagwort), Frieden und Gleichberechtigung von Frauen Abbild eines gesellschaftlichen Wandels war, wobei einer fundamentalen Kritik an der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zentrale Bedeutung zukam.156 Das wachsende Protestpotenzial der ökologisch fundierten außerparlamentarischen Opposition richtete sich vor allem gegen sicherheitspolitische Beschlüsse der Bundesregierung wie den NATO-Doppelbeschluss 1982/83 und forderte einen sofortigen Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Der 153 Laut einer Umfrage von Forsa zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Auftrag des Nachrichtensenders „n-tv“ von Dezember 2004 liegen die regierende rot-grüne Koalition und das schwarz-gelbe Oppositionsbündnis gleichauf. Vgl. http://www.n-tv.de/5457469.html; aufgerufen am 05.12.2004 154 Vgl. Bischoff, Joachim; Mindestlohn vom SPD-Tisch; Pressemitteilung der WASG vom 30.11.2004; in: http://www.w-asg.de/28.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=7b95 861d0f; aufgerufen am 05.12.2004 155 Vgl. Wahlalternative stellt Weichen für die Gründung einer Linkspartei; in: Financial Times Deutschland Online vom 21.11.2004; www.ftd.de/pw/de/1100939995722.html; aufgerufen am 05.12.2004 156 Vgl. Piehl, Joachim; Beiträge zur Politikwissenschaft: Machtwechsel 1982; Peter Lang-Verlag; Frankfurt am Main, 2002; S. 328 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 82 Postmaterialismus spielte in der Gesellschaft in dieser Zeit eine wachsende Rolle. Insbesondere junge Menschen fühlten sich von der linken Volkspartei SPD nicht mehr hinreichend vertreten. Diese Faktoren begünstigten den rasanten Aufstieg der Grünen zur parlamentarischen Kraft in Bund und Ländern. Die PDS wiederum entstand als Nachfolgeprodukt der DDR-Staatspartei SED. Sie profitiert nach wie vor von der anhaltenden gesellschaftlichen und ökonomischen Spaltung des wiedervereinigten Deutschlands und ist über ihren Status als Regionalpartei Ost nicht hinausgekommen. Im Jahr 2004 sind solche Faktoren, die eine langfristige Etablierung einer neuen Linkspartei begünstigen könnten, nicht vorhanden. Zwar war der Protest in der Bevölkerung gegen Sozialreformen der rot-grünen Bundesregierung beispielsweise in Form der so genannten Montagsdemonstrationen im Sommer/Herbst 2004 vor allem in Ostdeutschland massiv, allerdings zeigte das vergleichsweise schnelle Abflauen derselben, dass die Kritik nicht allzu fundamental war. Nicht zuletzt deshalb kann kaum von einem gesellschaftlichen Wandel gesprochen werden, der einer neuen Linkspartei ein dauerhaftes Bestehen ermöglichen würde. Darüber hinaus zeigen Umfragen, dass sich zwar 16 % der Befragten zumindest vorstellen könnten, eine neue Linkspartei zu wählen, jedoch waren lediglich 14 % von diesen Anhänger der SPD, während eine Linkspartei im Lager von Bündnis 90/Die Grünen (22 %) und vor allem PDS (41 %) wesentlich erfolgreicher Wähler gewinnen könnte.157 Insofern würde soeben vorgestellter Erhebung zufolge die WASG sogar in verstärktem Maße eine Gefahr für Grüne und PDS darstellen. Letztendlich lässt sich also aufgrund der vorhandenen Rahmenbedingungen und angesichts des historischen Abrisses ohne weiteres konstatieren, dass die WASG, wenn überhaupt, nur kurzfristig zu einer Bedrohung für die SPD werden kann. Wie in Kapitel 5.1 jedoch bereits verdeutlicht, könnten die Folgen einer Wahlniederlage durchaus verheerend sein. Insofern wären die Sozialdemokraten gut beraten, die neue Linkspartei zumindest kurzfristig ernst zu nehmen und einer Ausfransung des linken Parteienspektrums entgegenzuwirken, zumal mit der PDS eine weitere Konkurrenz im einwohnerstärksten Bundesland droht. 157 Vgl. ZDF-Politbarometer vom 09.07.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 83 5.4 Möglicher Machtverlust 2006 – Ein Vergleich mit 1982 Der Übergang von der Regierung in die Opposition stellt für eine Partei immer eine Zäsur dar. Fehleranalysen und personelle sowie programmatische Erneuerung sind in aller Regel die Folgen. Von Seiten vieler Parteienforscher, Medienvertretern und führenden Parteimitgliedern wird die Frage nach Aussichten der Partei in ihrer neuen gesellschaftlichen Rolle gestellt, dabei kommt es auch zu Spekulationen, wie lange diese in der Opposition verbleibt. Das folgende Kapitel soll die Aussichten der SPD nach einem eventuellen Verlust der Regierungsmehrheit nach der Bundestagswahl im Herbst 2006 eruieren, wobei der Grad der Wahrscheinlichkeit einer Niederlage bei besagter Wahl keine Rolle spielen soll. Da solche Mutmaßungen hochspekulativ sind, bietet sich ein Vergleich zum Machtverlust der Sozialdemokraten im Jahr 1982 an und einer kurzen Skizzierung des damaligen Zustands der Partei. Abschließend soll eine Beurteilung aufgestellt werden, ob die Perspektiven nach einer Wahlniederlage 2006 besser oder schlechter im Vergleich zu 1982 einzuschätzen sind und inwiefern überhaupt eine Vergleichsmöglichkeit besteht. 5.4.1 Der innerparteiliche Zustand der SPD vor dem 17. September 1982 Die sozial-liberale Regierungskoalition wurde bei der Bundestagswahl 1980 zwar mit Zuwächsen bestätigt, trotzdem geriet sie bereits kurze Zeit nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Instabilitäten. Verantwortlich hierfür war die gewachsene FDP-Fraktion, in der nun mehr Rechtsliberale saßen, die traditionell dem sozial-liberalen Kurs ihrer Partei kritisch gegenüberstanden158, hauptsächlich allerdings die in eine Identitätskrise gestürzten Sozialdemokraten. Die aufkommende Ökologie- und Friedensbewegung Ende der 1970er Jahre, das Erstarken der Grünen seit 1980 und die pragmatisch orientierte Außen- und Sicherheitspolitik der Regierung Schmidt sorgten für innerparteiliche Konflikte bisher ungekannten Ausmaßes. Altbundeskanzler und Parteivorsitzender Willy Brandt, Präsidiumsmitglied Erhard Eppler und Oskar Lafontaine wurden zu den größten Widersachern von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie sich die SPD den Protestgruppen, der so genannten „Neuen Linken“, gegenüber verhalten solle. Während insbesondere Brandt einen „verständnisvollen Umgang mit den angegrünten Schichten der jungen Generation“159 favorisierte, hatten Vertreter des pragmatischen Parteiflügels kein Interesse an einer Annäherung, was zuvorderst mit den Sachzwängen der Politik in einer Koalitionsregierung begründet wurde. Darüber hinaus befürchtete man bei Wahlen den Verlust von traditionellen Wählern aus dem Arbeiterlager an die Unionsparteien. 158 159 Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 42 f. Vgl. Piehl, a. a. O., S. 332 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 84 Willy Brandt bezeichnete in einer Rede am 21. Oktober 1981 die Friedensbewegung als Freunde der Sozialdemokratie, womit er in Anbetracht seines offenen Affronts gegen den Bundeskanzler die Regierungsfähigkeit der SPD ungewollt in Frage stellte und die SPD/FDP-Koalition destabilisierte. Auch verkannte Brandt die Tatsache, dass die Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen in den letzten beiden Regierungsjahren unter Schmidt mehr Wähler an die CDU als an die Grünen verlor und das Verlustpotenzial nach rechts folglich deutlich höher war.160 Auch der bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 1980 erfolglose Spitzenkandidat Erhard Eppler hielt sich mit rhetorischen Nackenschlägen gegen den Bundeskanzler nicht zurück: „Die (…) Frage ist, ob nicht eben jeder Politiker – (…) das (…) gilt gerade für (…) Helmut Schmidt – seine geschichtliche Stunde und seine spezielle geschichtliche Aufgabe hat, was dann bedeutet, dass ihm nicht jede beliebige Aufgabe zugemutet werden kann.“161 Aber nicht nur die Frage des Umgangs mit den linken Protestgruppen entzweite die SPD in zunehmendem Maße, auch inhaltlich rückten weite Teile der Partei von der Bundesregierung ab, dabei kam es in der Außenund Sicherheitspolitik zu erheblichen Differenzen. Brandt beispielsweise torpedierte das Vorhaben der Regierung Schmidt/Genscher, den NATO-Doppelbeschluss umzusetzen, indem er bei einem Besuch in Moskau 1981 den Friedenswillen der Sowjets lobte, in Missachtung des Faktums, dass die UdSSR noch 1976 ein massives Hochrüstungsprogramm beschloss. Auch die Haushaltspolitik wurde zu einer Art Sollbruchstelle innerhalb der SPD, als wiederum Brandt in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften im September 1981 eigene den Kabinettsbeschlüssen widersprechende Positionen entwickelte. Hierdurch wurde auch die Geschlossenheit des größten Machtinstrumentes eines Bundeskanzlers – die Bundestagsfraktion – untergraben. Helmut Schmidt scheiterte als Bundeskanzler letztendlich an seiner eigenen Partei. Ebenso wie Ludwig Erhard wurde ihm zum Verhängnis, dass nicht er, sondern ein ihm innerparteilich wenig wohl gesonnener Parteifreund den Parteivorsitz innehatte. Doch auch Schmidt machte den entscheidenden Fehler, dass er die Entwicklungen 1979-82 in Partei und Gesellschaft nicht ausreichend zur Kenntnis nahm, bzw. sie in ihrer Intensität falsch einschätzte. Zum einen „machte er keinen Hehl aus seiner Geringschätzung der Befindlichkeiten seiner Partei, deren Debatten er als Realpolitiker schon lange nicht mehr nachvollziehen konnte.“162 Längst hatten sich ganze Bezirksverbände offen gegen seine Politik ausgesprochen. Mittlerweile fand der Bundeskanzler bei seinem Koalitionspartner FDP sowie der oppositionellen CDU/CSU mehr Zustimmung als in der eigenen Partei, die sich in einem Prozess der Reideologisierung befand. Zum anderen wusste er keine überzeugenden Antworten auf die Protestwelle für Frieden und Umweltschutz im Land. Zwar wird die Überlegung Brandts, auf die Protestgruppen zuzugehen und sie in die SPD zu integrieren, allgemein als wenig Erfolg versprechend bezeichnet, die Taktik seines Widersachers Vgl. Lösche, Peter/Walter Franz; Die SPD: Klassenpartei – Volkspartei – Quotenpartei; Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Darmstadt, 1992; S. 123 161 Vgl. Gespräch mit Erhard Eppler; in: Der Spiegel vom 15.06.1981 162 Vgl. Piehl, a. a. O., S. 329 160 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 85 Schmidt, sie völlig zu ignorieren steht dem jedoch in nichts nach, was sowohl Dittberner („Die Regierung – voran der Kanzler – hatte die Entwicklung ´draußen im Land´ nicht mehr im Griff“163) als auch Piehl, der eine „bornierte Ignoranz des Politikers Schmidt gegenüber der historischen Dimension der Ökologiefrage“164 sieht, dem Hamburger Sozialdemokraten attestieren. Nach zahlreichen Wahlniederlagen 1981/82, wo die FDP teilweise in den Abwärtssog der SPD geraten war und beispielsweise in Niedersachsen von den immer stärker werdenden Grünen überholt wurde, gingen auch die Liberalen zunehmend auf Distanz zum Bundeskanzler. Zwar konnte Schmidt in einer Abstimmung über ein Beschäftigungsprogramm im Februar 1982 noch mal die Reihen schließen, doch die Zerfallserscheinungen der Regierung, aber auch innerhalb der SPD – die seit der Bundestagswahl 1980 per saldo gut 30.000 Mitglieder verloren hatte – waren unübersehbar. In historisch-analytischer Perspektive blieb der FDP schon aus Gründen der Selbsterhaltung keine andere Wahl, als die Koalition mit den Sozialdemokraten aufzukündigen. Allenthalben wurde bei der planmäßigen Bundestagswahl im Herbst 1984 mit einem Einzug der Grünen in den Bundestag und starken Verlusten der SPD gerechnet165, weswegen dem amtierenden SPD/FDP-Bündnis ohnehin die Regierungsmehrheit aller Wahrscheinlichkeit nach abhanden gekommen wäre. Längst hatten innerhalb der FDP vor allem die Parteirechten die Fühler zur CDU/CSU ausgestreckt, um die koalitionspolitische Neuorientierung von 1969 rückgängig zu machen. Linksgerichtete FDP-Funktionäre hatten sich zwar gegen ein solches Vorhaben ausgesprochen, allerdings stellten sie im Zuge der selbst zerstörerischen Tendenzen innerhalb der SPD nur noch eine Minderheit. Das so genannte „Lambsdorff-Papier“166 vom 9. September 1982 bedeutete nach 13 Jahren schließlich das endgültige faktische Ende der sozialliberalen Koalition. Am 17. September 1982 kam es zur Entlassung der FDP-Minister durch Schmidt, der durch ein konstruktives Misstrauensvotum von CDU/CSU und FDP am 1. Oktober 1982 von Helmut Kohl als Bundeskanzler abgelöst wurde. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass gerade Willy Brandt, der wie kaum ein zweiter Sozialdemokrat die SPD für neue Gesellschaftsschichten wählbar und damit regierungsfähig machte, zu einem der Hauptverantwortlichen für das Ende der Koalition wurde. Es wurde die Legende vom Verrat durch die FDP geboren, die durch die Übertritte u. a. von Ingrid Matthäus-Meier und Günter Verheugen von den Liberalen zu den Sozialdemokraten noch Zulauf gewann. Die SPD verkannte jedoch vollends, dass sie aufgrund der immer schwereren innerparteilichen 163 Auseinandersetzungen und der laufenden Torpedierung von Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 44 Vgl. Piehl, a. a. O., S. 329 165 Laut ZDF-Politbarometer vom März 1982 hätten nur noch 33 % der Befragten die SPD gewählt, während die Unions-Parteien auf einen Spitzenwert von 50 % kamen. Die sozial-liberale Koalition war somit weit von einer parlamentarischen Mehrheit entfernt. 166 Otto Graf Lambsdorff hatte in einem Thesenpapier wirtschaftspolitische Forderungen aufgestellt, die selbst für den Pragmatiker Helmut Schmidt, geschweige denn die SPD-Bundestagsfraktion, unannehmbar waren. 164 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 86 Kabinettsbeschlüssen durch eigene Vorstands- und Fraktionsmitglieder die Liberalen zusehends in die Arme der Union trieb. „Die Profilierungsthesen der sozialdemokratischen Enkel Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder und Rudolf Scharping (…) hatten als Ausdruck des sich anbahnenden Generationswechsels an der SPD-Spitze alle Bemühungen des Bundeskanzlers desavouiert, die sozial-liberale Koalition zu stabilisieren.“167 Das rot-gelbe Bündnis hatte seine Regierungsfähigkeit vollends eingebüßt. 5.4.2 Die Sozialdemokraten nach dem Koalitionsbruch Nach dem Gang in die Opposition war Helmut Schmidt in seiner Partei weitestgehend isoliert. Überraschenderweise machte sich durch den Machtverlust bei führenden Sozialdemokraten nicht unbedingt Enttäuschung, sondern eher Erleichterung breit. Schmidts Kanzlerschaft und die Regierungsverantwortung wurde „zuletzt nur noch als Fessel empfunden, als Zumutung, ja als Vergewaltigung sozialdemokratischer Positionen.“168 Die SPD erlebte in den Jahren 1983/84 einen starken Linksruck, man hatte mit den Positionen Schmidts und Wehners gebrochen, womit sie wissentlich ihre Regierungsfähigkeit unterminierte. Micha Hörnle zitiert drei Optionen, welchen Weg die SPD gehen konnte: „1. die Gesamtintegration von neuen Themen und Gruppen (um die Grünen überflüssig zu machen), 2. die Konzentration auf sozialdemokratische Kernthemen (Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik), 3. ein arbeitsteilig-kooperatives Reformbündnis (kein Verdrängungswettbewerb mit den Grünen, sondern das Akzentuieren der jeweiligen Identitäten).“169 Die Partei sprach sich auf dem Kölner Parteitag 1983 nun mit deutlicher Mehrheit gegen den NATO-Doppelbeschluss aus und wollte an den neuen sozialen Bewegungen im Land mitwirken und mit ihnen enger zusammenarbeiten. Vor allem junge Wähler, die sich in den letzten beiden Regierungsjahren von der SPD abgewendet hatten, sollten wieder zurück gewonnen werden, indem man sich das Protestpotenzial zueigen machen wollte. Nach der vernichtenden Niederlage bei der Bundestagswahl im März 1983, wo die SPD 4,7 % der Stimmen einbüßte und die Grünen mit einem Zuwachs von 4,1 % gleichzeitig erstmals in den Bundestag einzogen, sahen sich viele Parteistrategen bestätigt, die SPD müsse sich dem Wertewandel in der Gesellschaft anpassen. Es entstand wieder eine verstärkte Programmdiskussion, die die Partei zu Regierungszeiten aus Gründen der erforderlichen Kompromissbereitschaft in der Koalition vernachlässigt hatte. Der Postmaterialismus wurde zum Nonplusultra erklärt; man glaubte, radikale Veränderungen in der Gesellschaft ausgemacht zu haben. Franz Walter fasst die sozialdemokratische Einschätzung der 167 Vgl. Piehl, a. a. O., S. 558 Vgl. Walter, 2002, a. a. O., S. 215 169 Vgl. Hörnle, Micha; What´s left? – Die SPD und die British Labour Party in der Opposition; in: Beiträge zur Politikwissenschaft, Band 76; Verlag Peter Lang; Frankfurt/Main, 2000; S. 402 168 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 87 vermeintlichen gesellschaftlichen Umbrüche zu Beginn der 1980er Jahre treffend zusammen: „Aufmerksam lasen die Sozialdemokraten die zahlreichen Jugendstudien, die (…) zu dem Schluss kamen, dass die jungen Menschen pessimistisch in die Zukunft blickten, dass sie sich (…) vor dem Vormarsch des Computers fürchteten und keinen großen Wert auf materiellen Besitz legten.“170 Die tatsächliche Entwicklung in den darauf folgenden Jahren zeigte, dass die SPD einem Zeitgeist aufgesessen war.171 Trotz ihres Linksrucks vermochte es die Partei nicht, den Aufstieg der Grünen zu ihren Ungunsten zu vermeiden. Der Rückgang bei Wahlbeteiligungen und Parteimitgliedschaften war zudem Beweis einer zunehmenden Entpolitisierung in den 1980er Jahren im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt. Dass die Wahlergebnisse ab 1985 für die Sozialdemokraten dennoch gut ausfielen, obwohl sie die gesellschaftlichen Entwicklungen falsch einschätzte, lag eher im allgemeinen politischen Trend begründet, demzufolge die die Bundesregierung tragenden Parteien bei Landtagswahlen eher Stimmen verlieren; zudem mussten CDU und CSU infolge der für die Landwirte enttäuschenden EG-Agrarpolitik Stimmenverluste im ländlichen Raum hinnehmen172 – die Wahlniederlagen in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 1986/87 seien hier stellvertretend erwähnt. Die SPD litt allerdings auch unter der tiefen innerparteilichen Zerrissenheit hinsichtlich des Umgangs mit den Grünen. Während Hans-Jochen Vogel und Johannes Rau, Kanzlerkandidaten bei den Bundestagswahlen 1983 bzw. 1987, eine Zusammenarbeit ablehnten, sah die so genannte Generation der „Enkel Willy Brandts“, unter ihnen der aufstrebende Oskar Lafontaine, in den Grünen einen Machtfaktor, um eine Mehrheit jenseits des christlich-liberalen Bündnisses zu bilden. Hier erwies sich der Weg Ersterer als weniger Erfolg versprechend. Denn die Grünen waren im Grunde eine bürgerlich angehauchte Partei, die in den Ländern nicht nur der SPD, sondern auch der FDP liberale Wähler abspenstig machte und per Saldo das rot-grüne Lager hinzugewann. Somit eröffneten sich der SPD neue Möglichkeiten, auf Länderebene Regierungsverantwortung zu übernehmen, da vielerorts infolge der FDP-Schwäche der CDU der Wunschkoalitionspartner abhanden gekommen war.173 Diese Chancen wurden von Landesverbänden wie Hessen oder Niedersachsen relativ früh wahrgenommen, auf Bundesebene wurden sie in den ersten vier Oppositionsjahren verkannt. Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade der spätere Parteivorsitzende Björn Engholm Kritik an seiner Partei wegen einer sich in diesem Jahrzehnt in der SPD breit machenden „Closed-Shop-Mentalität“ übte. „Er erkannte früh, dass die SPD sich sozial und gesellschaftlich isolierte.“174 Die Sozialdemokraten standen nach dem Machtverlust von 1982 also in zwei Bereichen vor dem Scheideweg, nämlich der programmatischen Ausrichtung und der koalitionstaktischen Überlegungen und hatten folgenschwere Entscheidungen zu treffen. In beiden Fällen kann 170 Vgl. Walter, 2002, a. a. O., S. 216 Vgl. Piehl, a. a. O., S. 557 und Lösche/Walter, a. a. O., S. 124 172 Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 49 173 „Stürze“ der FDP unter die 5 %-Klausel häuften sich. 174 Vgl. Walter, 2002, a. a. O., S. 230 171 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 88 festgestellt werden, dass zumindest in der Bundespartei der falsche Weg beschritten wurde, womit die SPD ihre Chancen minimierte, nach den Bundestagswahlen 1983 und 1987 die Regierung zu übernehmen. Auch handelte die SPD wider besseren Wissens, denn die klar gewonnene Landtagswahl 1985 in Nordrhein-Westfalen mit Johannes Rau als Ministerpräsidenten offenbarte, dass die Partei ohne postmaterialistische Tendenzen in ihrer Programmatik eher Wahlen gewinnen konnte, während eben dieser Postmaterialismus der SPD ein Abwandern der klassischen Klientel bescherte.175 5.4.3 Vergleich und Fazit Der erste und bis heute einzige Machtverlust der SPD 1982 entstand, ebenso wie der erste Machtverlust der CDU/CSU 1969, nicht durch Abwahl durch die Bevölkerung, sondern infolge einer koalitionstaktischen Neu- bzw. Rückorientierung der Freien Demokraten. Ein Gang in die Opposition für die Sozialdemokraten 2006 würde hingegen aller Voraussicht nach aus einer Wahlniederlage resultieren, ebenso wie für CDU/CSU 1998. Insofern muss die Vermutung aufgestellt werden, dass ein Vergleich 1982 – 2006 dem berühmten Vergleich von Äpfel und Birnen ähneln würde. Eine genauere Betrachtung der Ausgangslage im Falle des Machtverlustes 2006 ist somit von Nöten. Der Verlust der Regierungsmehrheit für die SPD würde einhergehen mit dem Verlust der rotgrünen Mehrheit im Bundestag und der vermutlichen Ablösung des Bündnisses durch eine Koalition aus CDU/CSU und FDP. Folglich würden SPD und Bündnisgrüne gemeinsam in die Opposition gehen, die SPD wäre also, anders als 1982, nicht auf sich alleine gestellt. Damals standen auf der einen Seite das neue christlich-liberale Bündnis und auf der anderen die neu entstandenen Grünen, zu denen die SPD lange ein ungeklärtes Verhältnis hatte und die von weiten Teilen, insbesondere den Parteirechten, als politischer Gegner betrachtet wurden.176 Das Fehlen eines potenziellen Koalitionspartners hatte die Wahlchancen der SPD bei den Bundestagswahlen 1983 und 1987 erheblich beschnitten; das Erreichen der absoluten Mehrheit war illusorisch. Einer oppositionellen SPD nach 2006 bliebe dieses Schicksal mit hoher Wahrscheinlichkeit erspart. Die Erfahrung aus diversen Bundesländern sowie der Bundestagswahl 1998 lässt den Schluss zu, dass abgewählte Regierungsbündnisse im Regelfall in der Opposition weiter kooperieren, d. h. eine Art „Koalition in der Opposition“ führen (Beispiele: Hessen 1999, Niedersachsen 1990 oder Hamburg 2001). SPD und Grüne würden, wie schon vor 1998 häufig, als Oppositionsfraktionen eng zusammenarbeiten, um bei der darauf folgenden Bundestagswahl wieder gemeinsam zu reüssieren. Auch Union und FDP haben nach dem Verlust ihrer Regierungsmehrheit 1998 in der Opposition zumeist zusammengearbeitet und gemeinsame Gesetzesentwürfe eingebracht. Folglich bliebe den Sozialdemokraten ein Machtfaktor in Form von Bündnis 90/Die Grünen erhalten, zudem ist auch das Verhältnis zur PDS Schwankungen unterworfen, weswegen eine 175 176 Vgl. Hörnle, a. a. O., S. 406 Vgl. Piehl, a. a. O., S. 335 f. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 89 Annäherung auf Bundesebene zu Oppositionszeiten nicht völlig auszuschließen ist. Die Verhältnisse im Bundesrat wären mit denen von 1982 vergleichbar. Nach jetzigem Stand hätte eine schwarz-gelbe Bundesregierung auch in der Länderkammer eine Mehrheit. Bei Amtsantritt von Helmut Kohl stellte die SPD lediglich in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg die Regierung. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch nicht damit zu rechnen, dass sie beispielsweise in der langjährigen christdemokratischen Hochburg Rheinland-Pfalz die Regierungsverantwortung übernehmen würde, weswegen eine Prognose bezüglich der künftigen politischen Entwicklung in den Ländern nicht sinnvoll wäre. In programmatischer Hinsicht ist die Lage der SPD gegenüber 1982 ebenfalls von Schwankungen gekennzeichnet. Wie bereits in Kapitel 5.3 erwähnt, sind derzeit keine gesellschaftlichen Umbrüche oder zeitgeistliche Erscheinungen existent, die das Entstehen einer neuen Partei begünstigen könnten, was der SPD folgenschwere Auseinandersetzungen wie in der ersten Hälfte der 1980er ersparen würde. Innerparteiliche Konflikte in der SPD betreffen weniger den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik bzw. Haushaltspolitik, als vielmehr die Wirtschafts- und Sozialpolitik, jedoch weniger ausgeprägt als 1982. Das Auftreten Schröders und seine entideologisierte, pragmatische Politik, gelegentlich nach außen hin losgelöst von seiner Partei, lassen durchaus Parallelen zu Schmidt erkennen Doch die innerparteiliche Opposition – einmal mehr die Parteilinken – konnte sich in der Spätphase der Regierung Schmidt deutlich mehr Gehör verschaffen und machte öffentlichkeitswirksam Front gegen die Regierungspolitik. Die Mitgliederverluste der letzten Jahre und Jahrzehnte, das mangelnde Nachwuchspersonal und das Fehlen von Alternativen zur Abkehr von klassischer sozialdemokratischer Politik nahmen der größtenteils unzufriedenen Parteibasis den Wind aus den Segeln. „Schröder konnte – anders als Schmidt – stark sein, weil die SPD im Innern schwach war. (…) Freilich wissen die sozialdemokratischen Aktivisten, dass ihre Vorstellungswelt untergegangen ist.“177 Zu Beginn der 1980er Jahre waren es die sozialdemokratischen Enkel, die Schmidt das Regieren erschwerten und vor allem eins im Sinn hatten: in der Partei so schnell wie möglich Karriere zu machen. Aktuell gibt es keine prominenten Parteilinken, die sich offen gegen den Kurs der Regierung Schröder aussprechen und einen innerparteilichen Aufstieg anstreben. Die SPD ist personell ausgeblutet. Die übrig gebliebenen Kritiker treten zudem nicht mehr als Kritiker des gesamten Systems auf, die im Zuge einer sozialen Bewegung einen radikalen gesellschaftlichen Wandel forcieren möchten, sondern vertreten nur noch in Ausnahmefällen die klassischen sozialdemokratischen Ideale. Laut Dittberner ist die SPD nur noch „eine Ansammlung von Karriereristen und Funktionären der Macht, die ihre Anbindung an eine soziale Bewegung längst verloren hatte. (…) soziale Ziele (…) wurden immer unerreichbarer, und so werkelten die sozialdemokratischen Oligarchen strategielos in den Tag.“178 177 178 Vgl. Walter, 2002, a. a. O., S. 261 u. 263 Vgl. Dittberner, a. a. O., S. 206 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 90 Doch gerade die vermeintliche „Stille“ in der Partei könnte nach einer Wahlniederlage negative Folgen haben. Die SPD befindet sich in einem innerparteilichen Reformprozess; sie entfernt sich zusehends von der Programmatik klassischer linker Wirtschaftspolitik, eine Entwicklung, die in der Opposition höchstwahrscheinlich fortgesetzt würde. Allerdings ist eine programmatische Neuausrichtung stets mit Galionsfiguren wie seinerzeit Willy Brandt verbunden, die personelle Auszehrung der Partei in den letzten Jahren erschwert dies zunehmend. Die Parteikarrieren von Spitzenpolitikern wie Schröder, Clement, Eichel und wahrscheinlich auch Müntefering dürften nach einem Machtverlust 2006 beendet sein, auf Länderebene finden sich außer Matthias Platzeck, Siegmar Gabriel und Klaus Wowereit kaum hoffnungsvolle charismatische Nachwuchspolitiker.179 Es ist deshalb denkbar, dass die Partei in eine Führungskrise gerät, die durch eine möglicherweise unsachliche Analyse der Ursachen für die Niederlage bei der Bundestagswahl verstärkt werden könnte. Die Parteilinken könnten so wieder die Oberhand gewinnen, was die notwendigen programmatischen Reformen verlangsamen dürfte. Nach dem Bruch der sozial-liberalen Koalition hatte die Partei zwar ein „breiteres Personalangebot“ (Stichwort Enkel), jedoch war schnell ersichtlich, dass die Parteiführung in der Ära nach Schmidt in Person von Hans-Jochen Vogel und Johannes Rau nur eine innerparteiliche Übergangslösung darstellte, was sich negativ auf deren Wahlchancen auswirkte. Auch der neue CDUParteivorsitzende nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 Wolfgang Schäuble kann in historisch-perspektivischer Betrachtung nur als Übergangslösung innerhalb eines Generationenwechsels bezeichnet werden. Abschließend kann also der SPD in koalitionstechnischer Hinsicht für 2006 eine deutlich bessere Ausgangsposition für ein erfolgreiches Oppositionsdasein attestiert werden als 1982. Inhaltlichprogrammatisch sind Auseinandersetzungen zwar existent, aber nicht mit der Intensität von 1982 zu vergleichen, was den Sozialdemokraten ein positiveres Bild in der Öffentlichkeit bescheren dürfte, da die Mehrheit der Wähler Wert auf die Geschlossenheit einer Partei legt.180 Zudem ist keine ernstzunehmende Partei in Sicht, die sich dauerhaft im linken Parteienspektrum etablieren und die SPD beunruhigen könnte. Personell hingegen ergeben sich deutliche Nachteile im Vergleich zu 1982; die Sozialdemokraten stehen vor einem ernsten Nachwuchsproblem. Die zunehmende „Mattheit“ der Parteibasis verringert zudem die Kampagnenfähigkeit bei Landtagsund Kommunalwahlen.181 179 Hier besitzt die CDU mit Roland Koch, Ole von Beust, Peter Müller, Günther Oettinger, Dieter Althaus und Christian Wulff ein deutlich größeres Potenzial. 180 Vgl. u. a. Dittberner, a. a. O., S. 211 181 Vgl. u. a. Walter, 2002, a. a. O., S. 263 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 91 5.5 Untergangsszenarien – Ende der Sozialdemokratie? In Krisenzeiten der Sozialdemokratie – nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern – kommt es verstärkt zu Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Arbeiten, die dieser aus vielerlei Gründen ein baldiges Ende vorhersagen. Die Aufstellung dieser Untergangsszenarien hatte in den 1980er und in der ersten Hälfte der 1990er Jahre Hochkonjunktur, als sich sozialdemokratische Parteien in Europa mehrheitlich in der Opposition befanden. Die aktuelle Krisensituation der SPD wirft erneut die Frage auf, ob für eine MitteLinks-Volkspartei im Parteiensystem noch Platz ist. Diese Schwarzmalereien wechseln wie Ebbe und Flut mit betont optimistischen Prognosen zur Zukunft der Sozialdemokratie. So war gegen Ende der 1990er Jahre, als in sämtlichen EU-Staaten außer Spanien und Luxemburg Sozialdemokraten die Regierung stellten, sogar vom Anbruch des sozialdemokratischen Zeitalters die Rede. Dies wiederum lässt Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Prognosen über die Zukunft von Parteien aufkommen, da diese sich möglicherweise zu stark von tagespolitischen Ereignissen bzw. kurzfristigen Entwicklungen beeinflussen lassen. Dieses Kapitel wird daher die zahlreichen Untergangsszenarien von Seiten diverser Autoren kritisch hinterfragen und versucht abschließend zu beurteilen, wie realistisch die derzeit wieder häufiger artikulierten Vorhersagen eines baldigen Untergangs der SPD als Volkspartei sind. Thomas Meyer hat sich sehr detailliert mit den so genannten End-Prognosen für die Sozialdemokraten auseinandergesetzt und diese kritisch beleuchtet. Er macht dabei unterschiedliche Arten von End-Prognosen aus. Demnach müsse man nach ökonomischen, soziologischen und politischen End-Prognosen unterscheiden. 5.5.1 Ökonomische End-Prognosen Klassische sozialdemokratische Wirtschafts- und Sozialpolitik lässt sich unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen nicht mehr realisieren. Die von der SPD propagierte nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, die u. a. staatliche Ausgabenprogramme in Zeiten wirtschaftlicher Baisse vorsehen, ist angesichts der stark defizitären Lage der öffentlichen Haushalte kaum noch umzusetzen. Aufgrund der gegebenen Sachzwänge wird die Partei ihrer Unverwechselbarkeit im Vergleich zu den bürgerlich-konservativen Parteien beraubt, die Besonderheiten sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik fallen der Globalisierung zum Opfer. „Sie [die SPD, Anm. des Verfassers] kann (…) ihre historische Rolle einer Politik der Vermehrung der Massenkaufkraft, der Verbesserung der sozialen Sicherung und der Umverteilung der Einkommen durch den Sozialstaat nicht mehr spielen.“182 In europäischen Ländern mit sozialdemokratisch geführten Regierungen ist man zunehmend von der bis in die Vgl. Meyer, Thomas; Die Transformation der Sozialdemokratie – Eine Partei auf dem Weg ins 21. Jahrhundert; Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger; Bonn, 1998; S. 73 182 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 92 1970er Jahre hinein praktizierten keynesianischen Wirtschaftspolitik abgerückt. So beinhaltete das SPD-Bundestagswahlprogramm 1998 eindeutig Elemente einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik: „Die SPD-geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass die zerrütteten Staatsfinanzen wieder in Ordnung gebracht werden. Dazu gehört strenge Haushaltsdisziplin. (…) Für neue kreditfinanzierte Konjunkturprogramme gibt es keinerlei Spielraum.“183 Die seit 1997 amtierende New Labour-Regierung in Großbritannien kann ebenso wenig als Verfechterin klassischer sozialdemokratischer Politik bezeichnet werden. Die von den Konservativen unter Margret Thatcher in den 1980er Jahren eingeleiteten Reformen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die zu einer starken Liberalisierung der britischen Gesellschaft geführt haben, sind im Großen und Ganzen fortgeführt worden. Martin Seeleib-Kaiser sieht eine Christdemokratisierung der SPD in den vergangenen Jahren und spricht von der Übernahme programmatischer Bestandteile, die originär Ziele der Unionsparteien sind. „Meine These lautet, dass die Sozialdemokratie heute weder eine Politik der ´alten Sozialdemokratie´ betreibt, noch sich dem Neo-Liberalismus angepasst, sondern vielmehr die Programmatik der Christdemokratie in weiten Teilen übernommen hat.“184 Vicenc Navarro sieht dies in seiner Untersuchung des insbesondere vom britischen Premierminister Tony Blair verfochtenen so genannten Dritten Wegs ähnlich.185 „Das Konzept der Rechte 186 sozialdemokratischer Sozialpolitik.“ und Pflichten ist zunehmender Bestandteil Tatsächlich finden sich beispielsweise im Bereich Staatsausgaben durchaus ähnliche Ziele und Formulierungen bei SPD und CDU: „Um das Staatsdefizit weiter abzubauen (…) gibt es keinen anderen Weg, als die Staatsausgaben zurückzuführen.“187 Gleichzeitig enthielt die Wirtschaftspolitik der CDU/CSU-geführten Bundesregierung unter Konrad Adenauer in den 1950er und 1960er wiederum sozialdemokratische Züge, wie beispielsweise den Aufbau einer wohlfahrtsstaatlichen Absicherung, weswegen die Nachkriegszeit allenthalben als die goldene Ära der Sozialdemokratie bezeichnet wird, obwohl in der Mehrzahl der westeuropäischen Länder bürgerliche Parteien die Regierung stellten. Es wäre nun eine genauere Untersuchung der Wahlprogramme von SPD und CDU der letzten Jahre notwendig, um die Mutmaßung der zunehmenden Christdemokratisierung der Sozialdemokratie auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Hierauf soll aus Platzgründen jedoch verzichtet werden. Jens Borchert sieht den Spielraum sozialdemokratischer Politik ebenfalls eingeengt, macht hierfür jedoch die konservativen Parteien verantwortlich. „Die von konservativen Regierungen in einigen Vgl. Vorstand der SPD – Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.); Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit – SPDWahlprogramm zur Bundestagswahl 1998; Bonn, 1998; S. 30 184 Vgl. Seeleib-Kaiser, Martin; Ende oder Neubeginn der Sozialdemokratie, ZeS-Arbeitspapier 16/2001; Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen; Bremen, 2001; S. 6 185 Vgl. Giddens, Antony; The Critics of the Third Way; Cambridge Polity Press; Cambridge, 2000; S. 18 186 Vgl. Seeleib-Kaiser, a. a. O., S. 20 187 Vgl. CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.); Zukunftsprogramm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands; Bonn, 1998; S. 32 183 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 93 wichtigen Ländern Europas vorgenommenen Veränderungen [seien] so tief greifend, dass damit sozialdemokratischen Konzepten die finanzielle Grundlage entzogen ist.188 Allerdings bleibt der Autor Beispiele hierfür schuldig. Folgende, ebenfalls von ihm getätigte Aussage steht in diametralem Gegensatz zu dieser Behauptung: „Selbst konservative Regierungen scheiterten mit dem Versuch, das Ausmaß der Staatsinterventionen zu senken und die wesentlichen Bestandteile des Wohlfahrtsstaats in Frage zu stellen.“189 Das Argument der Übernahme konservativer Politikansätze durch Sozialdemokraten taucht allerdings auch bei Borchert auf. „Der zunächst unabhängige Weg sozialdemokratischer Hochburgen in Nord- und Mitteleuropa (…) ging nach Wertung Borcherts in einen Prozess der Anpassung an die konservativen Politikrezepte über.“190 Seeleib-Kaiser sieht die Entwicklung jedoch differenzierter, indem er eine Unterscheidung christdemokratischer und konservativer Wirtschafts- und Sozialpolitik vornimmt, Christdemokraten halten im Gegensatz zu Konservativen eine stärkere Rolle des Staates für notwendig.191 Die Verfechter der ökonomischen End-Prognose sehen jedoch im Fehlen einer Alternative zu konservativer oder liberaler Wirtschaftspolitik eine Gefahr für die Sozialdemokratie. „Wenn sozialdemokratische Parteien sich aber ihren liberalen Gegenspielern in den wichtigsten Grundfragen der Politik anpassen, so verlieren sie nicht nur die Existenzberechtigung, sondern auch die Voraussetzungen, um in den öffentlichen Arenen glaubwürdig und bei Wahlen erfolgreich sein zu können.“192 Borchert sieht die Perspektiven ebenfalls kritisch: „Hauptargument für das Ende des Wohlfahrtsstaates und damit der Sozialdemokratie ist (…), dass ein weiteres Wachstum des Wohlfahrtsstaates kaum mehr möglich ist. (…) Dennoch schließt Borchert sozialdemokratische Wahlerfolge für die Zukunft nicht aus – etwa bei Tony Blair in Großbritannien – hält sie allerdings für kurzlebig.“193 Meyer wiederum widerspricht diesen End-Prognosen und sieht stattdessen durchaus Handlungsspielraum für sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, wenngleich er es hier versäumt, konkrete Beispiele zu nennen. Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass zahlreiche Parteienforscher ein Ende der Sozialdemokratie vorhersagen, weil sie sich in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen in zu starkem Maße hin zum bürgerlichen Spektrum bewegt hat. Andere wiederum sehen von Seiten der Sozialdemokraten zwar die Notwendigkeit, diverse Ausrichtungen in diesem Politikfeld zu überdenken, halten deren Ansätze jedoch nach wie vor für tauglich, die aktuellen ökonomischen Vgl. Lanc, Erwin; Sozialdemokratie in der Krise – zwischen ökonomischer Globalisierung und gesellschaftlicher Atomisierung; Promedia Druck GmbH; Wien, 1996; S. 202 189 Vgl. Lanc, a. a. O., S. 202 190 Vgl. Lanc, a. a. O., S. 203 191 Möglicherweise fehlt bei Borchert die Differenzierung zwischen Christdemokraten und Konservativen, da er die Entwicklungen in USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland untersucht hat – drei von vier dieser Länder haben keine (bedeutenden) christdemokratischen Parteien. 192 Vgl. Meyer, a. a. O., S. 75 193 Vgl. Lanc, a. a. O., S. 203 188 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 94 Herausforderungen zu meistern. Eine dritte Gruppe von Parteienforschern bezeichnet die Christdemokratisierung der Sozialdemokratie insofern als problematisch, als dass die Parteidifferenzierungsthese, wonach es einen Unterschied mache, ob Sozial- oder Christdemokraten regieren, zumindest auf dem Feld der Wirtschafts- und Sozialpolitik an Aussagekraft einbüßt.194 Eine primäre Gefahr für die Existenz sozialdemokratischer Parteien wird von dieser Seite jedoch nicht ausgemacht. 5.5.2 Soziologische End-Prognosen Die gesellschaftliche Komponente der Untergangsszenarien ist die wohl Schwerwiegendste, da diese große strukturelle Schwierigkeiten für die Sozialdemokratie erkennen lässt. Das klassische sozialdemokratische Milieu, nämlich das der Arbeiter, hat sich im Zuge des Wandels hin zu einer Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft in den letzten Jahrzehnten drastisch verkleinert. Der Anteil der Arbeiter an der erwerbstätigen Bevölkerung ist auf deutlich unter 20 % gesunken, auch der Arbeiteranteil unter den SPD-Mitgliedern hat sich erheblich verringert.195 „Da die sozialdemokratischen Parteien, so lautet der Kern dieses Arguments, als Arbeiterparteien entstanden sind und in ihrer gesamten Geschichte politisch immer von der Mehrheit der Arbeiterstimmen gelebt haben, aufgrund ihrer politischen Identität aber in anderen sozioökonomischen Schichten nicht im selben Maße Unterstützung hinzugewinnen können wie sie durch den sozialen Wandel im Bereich der klassischen Arbeiterschaft verloren geht, schwindet allmählich aber unumkehrbar ihr soziales Fundament dahin.“196 Diese These wird durch die Abschwächung der Wahlergebnisse in Großstädten, nicht zuletzt in ehemaligen Arbeiterhochburgen wie dem Ruhrgebiet oder der Rhein-Neckar-Region gestützt. Das Abbröckeln dieses einst so wichtigen sozialen Milieus erzeugt wiederum eine zunehmende Individualisierung der Gesellschaft, womit es gerade für eine Volkspartei schwieriger wird, Wähler und vor allem Mitglieder für sich zu mobilisieren bzw. zu gewinnen. Nicht wenige Teilschichten des so genannten Unterschichten-Milieus können mittlerweile nicht mehr zwangsläufig als primär sozialdemokratisch bezeichnet werden. Die wachsende Zersplitterung des Arbeitnehmerlagers macht es für die SPD zusätzlich schwer, inhaltlich zu punkten, da die Interessen in dieser Bevölkerungsgruppe in zunehmendem Maße divergieren. Folglich „erfordern sie (…) artistisch anmutende Spagatleistungen, will sie die teilweise entgegen gesetzten (…) gesellschaftlichen Ansprüche miteinander verknüpfen.“197 Den Sozialdemokraten ist es infolgedessen demnach kaum mehr möglich, einen eindeutigen, widerspruchslosen politischen Kurs zu fahren. 194 Vgl. Seeleib-Kaiser, a. a. O., S. 23 In der Nachkriegszeit war noch jedes zweite SPD-Mitglied Arbeiter, mittlerweile ist es nicht einmal mehr jedes Vierte. 196 Vgl. Meyer, a. a. O., S. 76 197 Vgl. Teschner, a. a. O., S. 39 195 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 95 Thomas Meyer widerspricht dieser Theorie jedoch ebenso wie der ökonomischen End-Prognose, da die Sozialdemokratie, anders als von den Verfechtern der Untergangsszenarien behauptet, nicht von der Stärke der Arbeiterschaft abhängig sei. Denn „weder die sozialdemokratischen Grundwerte noch die wichtigsten politischen Projekte der Sozialdemokratie sind ein für allemal auf den Typ des klassischen Arbeiters fixiert.“198 Unter Verweis auf Studien von Wolfgang Merkel, der den Angestellten- und Arbeiterrepräsentationsindex der sozialdemokratischen Wählerschaft im EU-weiten Vergleich beleuchtete,199 verneint Meyer die Mutmaßungen der EndPrognosen-Theoretiker, die Sozialdemokratie sei durch den Niedergang des Arbeiter-Milieus ebenfalls in einen unumkehrbaren Prozess des Niedergangs geraten. Aus der zuvor erwähnten Untersuchung geht hervor, dass die sozialdemokratischen Parteien zwar tatsächlich je nach Land – mit Ausnahme von Dänemark – Einbußen im Gesamtanteil der Wählerstimmen im Lager der Arbeiter im Untersuchungszeitraum von 1975 bis 1990 haben hinnehmen müssen, diese jedoch durch Hinzugewinne von Wählern aus der größer werdenden Gruppe der Angestellten vollends ausgleichen konnten. Gerade in Großbritannien und den Benelux-Staaten sind deutliche Verschiebungen sogar zugunsten der sozialdemokratischen Parteien feststellbar. Folglich sind die neuen Angestelltenschichten trotz ihrer Heterogenität für Sozialdemokraten keineswegs unerreichbar. Somit sei der gesellschaftliche Wandel vielmehr eine Herausforderung für die Sozialdemokratie, als eine Sackgasse. Allerdings schränkt Meyer ein, dass die einzelnen sozialdemokratischen Parteien in der Lage sein müssen, auf jene neuartigen Herausforderungen durch strukturelle Anpassungsmaßnahmen zu reagieren. Die Erhebungen Merkels zeigen, dass die SPD hier noch Defizite aufweist.200 Die Mobilisierung von Wählern und Mitgliedern werde durch die jüngsten Entwicklungen schwieriger, sozialdemokratische Wahlerfolge würden eingedenk der vorliegenden Statistiken allerdings nicht zwangsläufig vermieden. Diesen Einschätzungen widerspricht Hartmut Soell, der kein singuläres Defizit der SPD im Bereich der Arbeiterwählerschaft sieht, sondern eher in der gesamten Gruppe der Arbeitnehmer. Jedoch fußen diese Beurteilungen auf Entwicklungen seit Mitte der 1970er Jahre: „Schon vorher hatte in vielen Ortsvereinen (…) ein innerparteilicher Klassen- und Kulturkampf begonnen, der nicht nur die Mehrzahl der gewerblichen Arbeitnehmer aus der Aktivmitgliedschaft vertrieb, sondern auch in der Binnen- und Außenwirkung die Anhänger und Wähler aus der technischen, wissenschaftlichen und ökonomischen Intelligenz verprellte.“201 198 Vgl. Meyer, a. a. O., S. 80 Vgl. Merkel, Wolfgang; Ende der Sozialdemokratie? Machtressourcen und Regierungspolitik im westeuropäischen Vergleich; Campus-Verlag; Frankfurt/Main; S. 81 Der Repräsentationsindex vergleicht den Anteil der sozialdemokratisch wählenden Arbeiter/Angestellten mit deren Anteil an der Gesamtwählerschaft. 200 Die SPD konnte die Verluste in den Arbeiterschichten durch Hinzugewinne aus den Angestelltenschichten im Untersuchungszeitraum nicht kompensieren. 201 Vgl. Soell, a. a. O., S. 59 199 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 96 5.5.3 Politische End-Prognosen Es besteht hier eine sehr starke Verquickung mit der soziologischen End-Prognose, denn sie ergibt sich aus der wachsenden Heterogenität der Gesamtwählerschaft. Bereits in den 1980er Jahren wurde am Beispiel der SPD veranschaulicht, dass sie Schwierigkeiten hatte, ihre potenziellen Wähler zeitgleich zu Urnengängen zu mobilisieren, ein zusätzlicher struktureller Nachteil gegenüber bürgerlich-konservativen Parteien. Zum Zeitpunkt einer in der „Wirtschaftswoche“ vom 7. November 1986 veröffentlichten Studie wurde der CDU/CSU für die alte Bundesrepublik eine strukturelle Mehrheitsposition zugesprochen, da sie zum einen auf eine höhere Zahl an Stammwählern zurückgreifen könne als die SPD, zum anderen eine in Bezug auf Lebenseinstellungen homogenere Wählerschaft habe. Die den Unionsparteien zugewandten Wählergruppen (leistungsorientierte Durchschnittsbürger, gehobene Konservative, aktive ältere Menschen und Kleinbürger mit Arbeitertradition) haben vor allem ein geordnetes Familienleben als zentralen Lebensinhalt, „mit Sparsamkeit, Disziplin und Familiensinn etwas Anständiges zu erreichen.“202 Der klassische CDU/CSU-Stammwähler ist demnach katholisch mit enger Kirchenbindung, von Beruf leitender Angestellter oder Beamter, Selbständiger oder Landwirt und nicht gewerkschaftlich organisiert. Die SPD hingegen muss eine wesentlich verschiedenartigere Wählerschaft ansprechen. Sie reicht „von aufstiegsorientierten Facharbeitern und mittleren Angestellten, für die im Leben vor allem Karriere, Prestige und Geld zählen, über das traditionelle Arbeitermilieu, in dem Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenwürde wichtigere Werte sind, bis zu den Links-Alternativen, denen es auf Mitmenschlichkeit, Selbstverwirklichung und Kommunikation (…) ankommt.203 Der klassische SPD-Stammwähler ist Arbeiter, Protestant mit schwacher Kirchenbindung und Mitglied einer Gewerkschaft. Folgerichtig spricht die von Hermann Adam zitierte Studie von einer strukturellen Mehrheitsposition der Unionsparteien, was durch die Bundestagswahlergebnisse bis einschließlich 1994 bestätigt werden kann. Die Verfechter der politischen End-Prognose greifen laut Meyer bei der Untermauerung ihrer Thesen vor allem auf den Umstand der Heterogenität der SPD-Wählerschaft zurück. „Während sich konservative und liberale Parteien auf die großen Milieus der materialistisch geprägten Mittel- und Oberschichten-Wähler und z. T. sogar der Unterschichten-Wähler stützen können, die in wichtigen Fragen eine vergleichbare Interessenwahrnehmung (…) haben, und während sich grüne Parteien auf kleinere und homogenere Milieus von postmaterialistisch gesonnenen Menschen (…) stützen können, ist die Sozialdemokratie aufgrund ihres Selbstverständnisses, aufgrund ihrer Grundwerte und wegen der wichtigsten politischen Projekte (…) darauf angewiesen, Wähler in beiden unterschiedlichen Wertewelten zu überzeugen.“204 Manfred Teschner sieht ebenso wie die von Meyer wiedergegebenen Thesen der End-Prognose wegen 202 Vgl. Adam, Hermann; Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 1995; S. 38 203 Vgl. Adam, a. a. O., S. 38f. 204 Vgl. Meyer, a. a. O., S. 83 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 97 dieser Gegebenheit auf Dauer ein Glaubwürdigkeitsproblem der SPD bzw. der Sozialdemokratie im Allgemeinen, die sich teilweise diametral gegenüberstehenden Interessen der Wählerschaft zu verknüpfen. Der Begriff „Spagat“ wird dabei in der vorliegenden Literatur häufig verwendet. Eine Variante der politischen End-Prognose, die von Ralf Dahrendorf vertreten wird, besagt, dass die Sozialdemokratie sich in den vergangenen Jahrzehnten selbst überflüssig gemacht hat, indem ihre Kernforderungen (soziale Absicherung, gesellschaftlicher Aufstieg der Arbeiterklasse usw.) im Großen und Ganzen umgesetzt wurden. Somit sei sozialdemokratische Politik gegenstandslos geworden. Meyer wiederum hält die politischen End-Prognosen, ebenso wie die beiden vorherigen für empirisch nicht fundiert genug und sieht sie durch die Wahlerfolge der sozialdemokratischen Parteien in den späten 1990er Jahren, gerade in Großbritannien und Frankreich, widerlegt. Doch wie schon zuvor lässt er konkrete Beispiele vermissen, um die Mutmaßungen der End-PrognosenVerfechter ausreichend zu entkräften. 5.5.4 Fazit Das Totsagen einer so bedeutenden und geschichtsträchtigen Bewegung wie der Sozialdemokratie ist grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Thomas Meyer stellt die einzelnen Formen der Untergangsszenarien vor, beschreibt diese jedoch recht überspitzt: „Sie [gemeint ist die Sozialdemokratie, Anm. des Verfassers] muss eine an Arbeiterinteressen orientierte, radikalsozialistische Politik formulieren, die ihr allein Profil geben und ein ausreichendes Maß an Wahlunterstützung im Arbeiterbereich sichern kann. Falls sie darauf verzichten würde, müsste sie dieser politischen These zufolge unausweichlich zur strukturellen Minderheitenpartei werden.“205 Es muss zunächst hinterfragt werden, wie überhaupt klassische sozialdemokratische Politik definiert werden kann. Dieter Nohlen liefert zwar eine recht ausführliche Begriffsbestimmung206, ebenso wie Uwe Andersen/Wichard Woyke207, doch treten teilweise erhebliche programmatische Unterschiede innerhalb der Mitgliedsparteien der SPE im Europäischen Parlament auf. Jede politische Partei ist einem Prozess der Weiterentwicklung und Veränderung unterworfen. Hiervon können sich auch die sozialdemokratischen Parteien im Allgemeinen und die SPD im Speziellen nicht ausnehmen. Während die schwedischen Sozialdemokraten bereits in der Nachkriegszeit zentrale Bestandteile angebotsorientierter Wirtschaftspolitik in ihr Programm aufgenommen haben208, verfolgten die deutschen Sozialdemokraten bis Godesberg 1959 primär die Politik eines demokratischen Sozialismus in der Tradition von Karl Marx. Eine Verallgemeinerung fällt unter diesen Gesichtspunkten recht schwer, somit erscheint auch die Diskussion, ob Sozialdemokraten noch sozialdemokratische Politik betreiben, nicht Ziel führend. Fakt ist jedoch, betrachtet man 205 Vgl. Meyer, a. a. O., S. 82 Vgl. Nohlen, Dieter; Kleines Lexikon der Politik; Verlag C.H. Beck; Heidelberg, München, 2001; S. 450ff. 207 Vgl. Andersen, Uwe/Woyke, Wichard (Hrsg.); Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 4. Auflage; Verlag Leske & Budrich; Bonn, 2000; S. 546f. 208 Vgl. Seeleib-Kaiser, a. a. O., S. 9 206 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 98 lediglich Deutschland und Großbritannien, dass New Labour 1997 und 2001 bzw. der SPD 1998 mit großer Wahrscheinlichkeit keine derart glanzvollen Wahlsiege gelungen wären und nicht dermaßen viele Wählerstimmen von bürgerlich-konservativen Parteien hätten gewonnen werden können, wenn in der Wirtschafts- und Sozialpolitik keine pragmatischeren Positionen propagiert worden wären, die in der Lage sind, in der Bevölkerung eine Mehrheit zu finden. Schließlich war die SPD mit ihrem Auftreten als Verteidigerin des Sozialstaats vom Machtverlust 1982 bis Mitte der 1990er Jahre bundesweit nicht mehrheitsfähig. Auch Labour konnte erst durch eine wirtschafts- und sozialpolitische Hinbewegung zu pragmatischeren Politikzielen wieder zu einem ernstzunehmenden politischen Gegner der Konservativen werden. Das Vertrauen der deutschen und britischen Bevölkerung in die originären Politikkonzepte von SPD bzw. Labour war zu gering, die Wahl entscheidende wirtschaftspolitische Kompetenz wurde stärker im bürgerlichen Spektrum gesehen. Beide Parteien wurden von der Wirklichkeit des sich verschärfenden globalen ökonomischen Wettbewerbs eingeholt. Die von ihnen mehrere Jahrzehnte verfolgten Konzepte der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik, staatlicher Konjunktur- und Ausgabenprogramme nach Vorbild von Keynes und dem Aufbau eines umfassenden Wohlfahrtssystems haben sich in Zeiten ökonomischer Prosperität, Vollbeschäftigung und gesunden Staatsfinanzen wie in den 1950er und 1960er Jahren als geeignet erwiesen, Wohlstand zu schaffen.209 Da die ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahrzehnten, gänzlich andere sind, können diese Rezepte nicht mehr greifen. Die britische Labour-Party hat dies vollends realisiert und akzeptiert, vor allem dank Blair kam es daher zu durchgreifenden innerparteilichen Reformen in programmatischer Hinsicht. Innerhalb Europas verläuft der Anpassungsprozess der sozialdemokratischen Parteien ungleichzeitig. Die SPD hat eine solche Entwicklung noch vor sich, anders als Labour hat sie eine Neubestimmung ihrer wirtschafts- und sozialpolitischen Positionen in Oppositionszeiten versäumt und muss dies nun in Regierungszeiten nachholen, was gerade im traditionalistisch orientierten Parteiflügel zu großer Missstimmung und zahlreichen Parteiaustritten führte. Die jüngst teilweise sehr scharf geführten innerparteilichen Auseinandersetzungen über aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung sowie der Rücktritt Gerhard Schröders als Parteivorsitzenden zeigen, dass die SPD diesbezüglich noch eine lange Wegstrecke zurückzulegen hat. Allerdings ist eine ökonomische End-Prognose für die Sozialdemokratie aufgrund der wirtschaftsund sozialpolitischen Neuausrichtung recht unrealistisch. Die SPD kann nur als Volkspartei bestehen bleiben, wenn sie sich den gesellschaftlichen Realitäten stellt und dementsprechend handelt. Es besteht weniger die Gefahr des Verlustes der Unverwechselbarkeit sozialdemokratischer Politikansätze, wie von zahlreichen Verfechtern besagter End-Prognose behauptet, vielmehr ist es das Propagieren einer zunehmend realitätsfernen Politik, das eine 209 Vgl. Teschner, a. a. O., S. 42 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 99 Bedrohung für eine Partei darstellt. Das Ausbleiben von Wahlerfolgen, ein fortgesetztes Verbleiben im demoskopischen Tief und weitere Mitgliederverluste wären die Folge. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich gerade der parteirechte Seeheimer Kreis für einen Paradigmenwechsel in der SPD stark macht.210 Die soziologische End-Prognose für die Sozialdemokratie ist auf den ersten Blick zwar um einiges besser nachzuvollziehen, da ein starker Rückgang von Stammwählern und Mitgliederverluste grundsätzlich bedrohliche Auswirkungen auf eine Volkspartei hat. Tatsächlich hat sich der Stimmenanteil sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa in den vergangenen Jahren verringert211, dabei besonders stark in mitteleuropäischen Ländern. Jedoch muss hier hinterfragt werden, ob die genannten soziologischen Schwierigkeiten nur auf die Sozialdemokratie zutreffen. Der Rückgang an Stammwählern ist ubiquitär feststellbar, auch christdemokratische Parteien leiden ob des Abbröckelns des katholischen Milieus unter einer solchen Entwicklung. CDU/CSU beispielsweise sind ebenso wie die österreichische ÖVP bei den letzten nationalen Wahlen deutlich unter den Ergebnissen der 1950er und 1960er Jahre geblieben. Die starken CDU-Verluste bei den letzten Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Sommer/Herbst 2004 oder auch andere mit starken Schwankungen behaftete Wahlergebnisse in Ostdeutschland (Sachsen-Anhalt 1998, Berlin 2001), wo ein katholisches Milieu mit Ausnahme des thüringischen Eichsfeld nicht vorhanden ist, zeigen, dass auch christdemokratische Parteien elektoral ins Bodenlose abstürzen können. Kleine Parteien wie die FDP hatten von Anfang an ein deutlich geringeres Stammwählerpotenzial.212 Ebenso stellt die Problematik des Mitgliederrückgangs an sich kein betont singuläres Problem der Sozialdemokratie dar – vielmehr haben im Zuge des generellen Bedeutungsverlustes der Politik momentan Parteien aller politischen Richtungen unter einem derartigen Schrumpfungsprozess zu leiden. Auch wenn dieser momentan bei der SPD infolge von schweren innerparteilichen Konflikten und Polarisierungen um den künftigen wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs schärfer zum Ausdruck kommt, während die Unionsparteien ihren Mitgliederbestand in den letzten beiden Jahren weitgehend stabilisieren konnten, so kann man aufgrund der Veränderung der Lebensverhältnisse und der zunehmenden Entpolitisierung der Gesellschaft, gerade im Vergleich zu den 1970er Jahren, von einem strukturellen Problem für alle politischen Parteien sprechen. Abschließend kann also die soziologische End-Prognose auf die Volksparteien im Generellen angewendet werden, weit weniger aber ausschließlich auf die Sozialdemokratie. Volksparteien haben nicht nur in Deutschland im Zuge von Mitgliederverlusten und Rückgang von Wahlbeteiligungen mit zunehmenden Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung zu kämpfen, wie die letzten Wahlergebnisse gezeigt haben. Der Verlust von Stammwählern hat für die Parteien im Vgl. Die Seeheimer in der SPD; In der Krise liegt die Chance – Die Sozialdemokratie im Umbruch; in: www.seeheimer-kreis.de; aufgerufen am 10.11.2004 211 Vgl. Nohlen, a. a. O., S. 451 212 Der Stammwähleranteil an der Gesamtwählerschaft von SPD und CDU/CSU betrug in den 1980er Jahren ungefähr 75 %, bei der FDP waren es lediglich knapp 50 %. Vgl. Adam, a. a. O., S. 34 210 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 100 Hinblick auf Wahlkämpfe vor allem finanzielle Folgen; die zunehmende Zahl an Wechselwählern muss mit immer aufwändigeren Mitteln umworben werden, die Außendarstellung der Politik gewinnt hierdurch zunehmend an Bedeutung. Die politische End-Prognose fußt zwar auf einer richtigen Feststellung, ist jedoch im Ergebnis kaum nachvollziehbar und wird paradoxerweise durch die soziologische End-Prognose entkräftet. Die Problematik der heterogeneren Wählerschaft im Vergleich zu konservativen und liberalen Parteien hat zwar insofern Auswirkungen, dass sozialdemokratische Parteien in den meisten europäischen Ländern strukturell im Hintertreffen im Vergleich zu zuvor genannten Parteien sind, wie beispielsweise die Bundestagswahlergebnisse der SPD zeigen. Allerdings erscheint es doch mehr als voreilig, aufgrund eines strukturellen Defizits ein Untergangsszenario zu entwerfen, schließlich sind die Schwierigkeiten diesbezüglich keine neue Entwicklung, sondern bestehen bereits seit der Neuausrichtung der SPD nach 1959. Der im Schrumpfungsprozess befindliche Arbeiteranteil an der deutschen Gesamtbevölkerung, sowie der SPD-Wählerschaft machte eine verstärkte Ausrichtung sozialdemokratischer Politik auf die Interessen der Angestellten notwendig. Da der Arbeiteranteil auch in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach rückläufig sein wird, dürfte der so genannte Spagat, den die SPD bewerkstelligen muss, weniger schwierig werden. Die von Dahrendorf vertretene These, die Sozialdemokratie habe sich selbst in zunehmendem Maße überflüssig gemacht, indem ihre politischen Ziele im Großen und Ganzen erreicht worden seien, kann nur unter der Bedingung als korrekt angesehen werden, dass im Fall der SPD keine Neuausrichtung der Politikziele stattfindet und die Wähler nicht hinreichend von der Notwendigkeit einer SPD-Wahl überzeugt werden können. Insofern würde die SPD auf Dauer definitiv ihre Existenzberechtigung einbüßen. Doch wie schon bei der soziologischen EndPrognose kann auch hier die Möglichkeit der universellen Anwendung der Mutmaßung auf andere Parteien festgestellt werden. Denn auch die zentralen Politikziele der CDU (Deutsche Wiedervereinigung, Europäische Einheit, Geldwertstabilität usw.) sind größtenteils verwirklicht. Folglich müssten sich auch die Christdemokraten verstärkt Gedanken über eine Neuausrichtung ihrer Politik machen und neue Visionen entwickeln. In vielerlei Hinsicht ist die Lage der SPD mit der eines kriselnden Wirtschaftsunternehmens vergleichbar. In der freien Wirtschaft müssen sich Unternehmen in schwierigen Situationen neu positionieren, möglicherweise auch ihr Image ändern und unbequeme Entscheidungen treffen, um im freien Wettbewerb nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Ebenso müssen sich Parteien im Zuge eines gesellschaftlichen Wandels neu finden und ihre Konzepte der Wirklichkeit anpassen. Die originären sozialdemokratischen Rezepte in der Wirtschafts- und Sozialpolitik waren zum Ende der 1950er Jahre kaum noch zeitgemäß, weswegen die SPD bei Bundestagswahlen kaum mehr als 30% der Stimmen erringen konnte und viel mehr eine Milieu- als eine Volkspartei war. Erst eine wirtschaftspolitische Neuausrichtung durch das Godesberger Programm im Jahr 1959 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 101 machte die SPD für andere Bevölkerungsschichten als die Arbeiterschaft wählbar, die Wahlergebnisse stiegen in den 1960er Jahren kontinuierlich an. Ein solcher Umbruch steht der SPD erneut bevor, will sie nicht dauerhaft unter dem starken Vertrauensentzug durch die Wähler leiden. New Labour zeigt, dass eine innerparteiliche Neuausrichtung entlang der gesellschaftlichen und ökonomischen Realitäten dauerhaft Wahlsiege sichern kann, eine dritte Wiederwahl Blairs als Premierminister scheint unter den gegeben Umständen äußerst wahrscheinlich. New Labour zeigt auch, dass die Übernahme christdemokratischer oder konservativer Konzepte nicht zu einem Verlust an Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit führen muss, jedoch stattdessen das Einbrechen in ein originär bürgerlich-konservatives Wählerlager ermöglicht.213 213 Bei der Bundestagswahl 1998 konnte die SPD nach Berechnungen von Infratest-Dimap über 1,6 Millionen Wähler von CDU/CSU gewinnen. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 102 6. Zusammenfassung und Ausblick Die programmatischen, organisatorischen und vor allem politischen Bedingungen für die Entwicklung der SPD und der hiermit verbundenen Perspektiven zeigen ein sehr vielschichtigeres und komplexeres Bild als es die aktuelle Lage vermuten lässt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kurz zusammengefasst werden: 1) Der Bundestagswahlsieg vom 22. September 2002 hat sich für die Sozialdemokraten mittlerweile als ein Pyrrhussieg erwiesen. Denn das Verhältnis der SPD zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien hat sich seither aus unterschiedlichen Gründen negativ entwickelt. Die FDP versteht sich nach dem knappen rot-grünen Wahlsieg wieder klar als Partner der Union. Die Bundespräsidentenwahl sowie Koalitionsaussagen im Vorfeld mehrerer Landtagswahlen belegen dies. Zur Bundestagswahl 2006 ist folglich – anders als 1998 und 2002 – mit einem Lagerwahlkampf zwischen Rot-Grün auf der einen und Schwarz-Gelb auf der anderen Seite zu rechnen. Die PDS ist nach dem Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag nach der letzten Wahl auf Distanz zu den Sozialdemokraten gegangen, da sie diese für ihr Ausscheiden mitverantwortlich machte (vgl. Kapitel 4.2.3). Im Vorfeld der Landtagswahlen 2004 in den neuen Bundesländern attackierte sie die Regierungspolitik in populistischer Manier, wodurch sie sich ihrer Koalitionsfähigkeit beraubte. So standen die Sozialdemokraten in Brandenburg beispielsweise vor der Alternativlosigkeit einer Regierungsbildung mit der CDU. Es ist nach den Ereignissen der Jahre 2002 und 2004 vorerst nicht damit zu rechnen, dass sich beide Parteien wieder annähern, wenngleich die Regierungskoalitionen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hiervon unberührt bleiben dürften. Bündnis 90/Die Grünen werden zur Bundestagswahl 2006 sowie den Landtagswahlen 2005 zwar an der Seite der SPD in die jeweiligen Wahlkämpfe ziehen, jedoch gibt es erste Tendenzen von Seiten der Grünen, sich nicht auf „Gedeih und Verderb“ an die Sozialdemokraten zu ketten. Schwarz-grüne Koalitionen auf Länderebene sind mittelfristig nicht zuletzt aufgrund der immer pragmatischer und bürgerlicher auftretenden Bündnisgrünen in Ländern wie Baden-Württemberg nicht mehr auszuschließen. Trotz allem werden die Sozialdemokraten auch in Zukunft der Wunschkoalitionspartner der Grünen bleiben, wie in Kapitel 4.2.1 veranschaulicht. 2) Die SPD wurde infolge zahlreicher schwerer Wahlniederlagen in vielen Bundesländern in die Opposition verwiesen. In nicht wenigen Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Niedersachsen oder Thüringen ist der Rückstand zur regierenden Union mittlerweile so groß, dass mittel- bis langfristig nur im Falle ausgesprochen günstiger bundespolitischer Großwetterlagen Perspektiven bestehen, wieder Regierungspartei im jeweiligen Land zu werden. Hierdurch dürften sich auch ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten insbesondere im Bundesrat vorerst kaum verbessern. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 103 3) Die DGB-Gewerkschaften werden ungeachtet aller inhaltlichen Differenzen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik auch künftig eine enge Zusammenarbeit mit der SPD suchen. In wahlkampffreien Zeiten sind zwar weiterhin Auseinandersetzungen um politische Themen zu erwarten, jedoch sind sich die Gewerkschaften durchaus bewusst, dass die SPD in viel stärkerem Maße als CDU/CSU in der Lage ist, ihre Anliegen zumindest partiell durchzusetzen bzw. auf die politische Agenda zu setzen (vgl. Kapitel 4.3.3). Der DGB wird daher bei Bundestagswahlen auch in Zukunft Partei zugunsten der Sozialdemokraten ergreifen. Andererseits kennt auch die SPD die Bedeutung des knapp sechs Millionen Mitglieder starken DGB für elektorale Erfolge auf Bundesebene. Darüber hinaus besteht neben der inhaltlichen auch nach wie vor eine unvermindert starke personelle Verquickung zwischen beiden Organisationen. 4) Ein Verlust der Regierungsmehrheit in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai 2005 würde die rot-grüne Bundesregierung, wie in Kapitel 5.1.2 skizziert, erheblich schwächen, aber nicht in bedrohlichem Maße destabilisieren. Vielmehr könnten sich die in der ersten These der Zusammenfassung aufgezeigten Tendenzen der Annäherung zwischen CDU und Bündnisgrünen auf Länderebene verstärken. Da die Grünen aktuell in zahlreichen Bundesländern in der SPD keinen Machtfaktor mit Perspektiven für eine baldige Regierungsübernahme finden, könnte es zu einer Umorientierung kommen, worauf das Koalitionsverhalten in mehreren nordrheinwestfälischen Kommunen bereits hindeutet. Die SPD könnte letztendlich in diversen ohnehin strukturell für sie ungünstigen Bundesländern ohne Partner dastehen, womit eine Regierungsübernahme im jeweiligen Fall immer unwahrscheinlicher würde. 5) Die SPD wird den Mitgliederrückgang aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, insbesondere im Zusammenhang mit dem veränderten Freizeitverhalten (vgl. Kapitel 5.2.1), allenfalls verlangsamen, nicht aber stoppen können. Zudem bedroht das reduzierte Engagement der stark geschrumpften Mitgliederschaft gerade bei regionalen Wahlen zusätzlich die Kampagnenfähigkeit der Partei. Die SPD ist daher gezwungen, sich in organisatorischer Hinsicht neu zu orientieren und sich vom Attribut „Mitgliederpartei“ zu trennen. Sie muss sich stattdessen zu einer „Kampagnenpartei“ nach US-amerikanischem Vorbild entwickeln. Dies erfordert eine erhebliche Stärkung des hauptamtlichen Parteiapparates zugunsten des ehrenamtlichen Engagements vor Ort, welches ohnehin immer weniger Wähler erreicht. Angesichts der skizzierten Umbrüche sind Wahlen im 21. Jahrhundert nur noch über Fernsehen und Internet und nicht mehr durch Wahlkampfveranstaltungen und Canvassing-Stände zu gewinnen. Das umfangreiche Medienengagement der für die SPD ertragreichen DDVG (Kapitel 2.3.3) stellt zudem eine weitere Einnahmequelle neben Mitgliedsbeiträgen und Spenden dar, weswegen die SPD in finanzieller Hinsicht weniger auf eine starke Mitgliederbasis angewiesen sein dürfte, als die Unionsparteien. 6) Die Entstehung einer neuen Linkspartei in Form der WASG wird die SPD mittelfristig nicht in Bedrängnis bringen. Zum einen sind, wie Kapitel 5.3 dokumentiert, weder personell noch Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 104 sozioökonomisch die notwenigen Voraussetzungen gegeben, um elektoral dauerhaft zu reüssieren, zum anderen würde die WASG laut ZDF-Politbarometer eher Grünen und PDS Wähler in nennenswertem Umfang abnehmen. Kurzfristig sind allerdings je nach Stimmungslage und Bundesland, so beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 2005, Stimmenanteile von annähernd 2 % möglich, was wiederum die Chancen eines rot-grünen Wahlsiegs konterkarieren würde. Die SPD wäre daher gut beraten, die WASG als politischen Gegner zumindest kurzfristig nicht zu unterschätzen. 7) Ein möglicher Machtverlust nach der Bundestagswahl 2006 wäre aus den im Kapitel 5.4.3 angesprochenen drei Gründen für die SPD kaum mit dem von 1982 zu vergleichen. Allerdings ist schwer abschätzbar, ob sich die Lage der Partei infolge obigen Szenarios günstiger darstellt. Mit den Bündnisgrünen und gegebenenfalls der PDS hätte man im Bundestag zwei denkbare Koalitionspartner, um einem aller Wahrscheinlichkeit nach regierenden christlich-liberalen Bündnis Paroli bieten zu können. Bei den Bundestagswahlen 1983 und 1987 konnte die SPD mangels potenzieller Koalitionspartner der Bevölkerung nicht glaubhaft vermitteln, wie sie die Regierung übernehmen wollte. In personeller Hinsicht erscheint die Partei ausgezehrt. Hinter Schröder, Müntefering, Clement und anderen aktuellen Spitzenpolitikern der Sozialdemokratie ist ein akutes Nachwuchsproblem zu beobachten. 1982 hingegen hatte man in persona der so genannten „Enkel Willy Brandts“ ein wesentlich größeres Personalaufgebot „in der Hinterhand“. Die geringere Zahl an Mitgliedern und die dünnere Personaldecke in den Landesverbänden lassen vor allem regionale Wahlerfolge, wie sie die SPD in den 1980er Jahren erzielte, unwahrscheinlicher erscheinen, wenn auch nicht ausschließen. Die Sozialdemokraten stehen inhaltlich-programmatisch wiederum vor weitaus geringeren Herausforderungen als 1982. Zwar besteht aktuell ein gewisser innerparteilicher Dissens über den künftigen wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs der SPD, dieser wird jedoch zum einen mit verminderter Schärfe ausgetragen, zum anderen wächst die Zahl derjenigen Parteimitglieder stetig, die die Notwendigkeit einschneidender Reformen im sozialen Bereich, auch die eigene Klientel betreffend, erkannt haben. Ferner sind aktuell keine sozialen Bewegungen in Deutschland zu erkennen, die in ihrer Bedeutung mit denen der Ökologie- und Friedensbewegung der frühen 1980er Jahre vergleichbar wären. Eine Tatsache, die innerparteiliche Debatten, wie man diesem Protestpotenzial zu begegnen hat, erübrigt. 8) Die SPD befindet sich, wie jede andere Partei auch, in einem fortwährenden Prozess der Weiterentwicklung und Anpassung an die gesellschaftlichen Realitäten. Die Abkehr der SPD von bestimmten wirtschaftspolitischen Leitlinien, wie dem demokratischen Sozialismus 1959 oder dem Keynesianismus in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, bedeutet nicht a priori das Scheitern der Sozialdemokratie. Nicht wenige Parteienforscher und Politologen, die von einem Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 105 Zurückweichen klassischer sozialdemokratischer Politik sprechen, übersehen, dass keine allgemeingültige Definition einer solchen existiert. So unterschieden bzw. unterscheiden sich beispielsweise die programmatischen Ausrichtungen der deutschen, schwedischen und britischen Sozialdemokraten (vgl. Kapitel 5.5.1) durchaus erheblich, trotzdem nehmen alle drei für sich in Anspruch, sozialdemokratische Politik zu propagieren und zu betreiben. Daher ist allenfalls von einem Scheitern der originären wirtschaftspolitischen Konzepte der SPD auszugehen, eine Tatsache, die sie in den letzten Jahrzehnten mehr als einmal veranlasste, diese zu überdenken. Allerdings muss dieser Prozess nicht unbedingt das Scheitern der SPD-Politikansätze in Gänze zur Folge haben. Eine Partei muss sich den ökonomischen und gesellschaftlichen Realitäten anpassen, will sie nicht ihre Existenzberechtigung einbüßen. Die SPD ist somit gezwungen, sich nicht nur organisatorisch, sondern auch programmatisch neu zu positionieren. 9) Innerhalb der SPD ist in den letzten Jahren eine zunehmende Christdemokratisierung ihres Verständnisses von Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu beobachten. In den Programmen zu den Bundestagswahlen 1998 und 2002 finden sich Ziele, die eindeutig christdemokratische Züge tragen (Geldwertstabilität, Sparmaßnahmen in öffentlichen Haushalten, Verneinung von Konjunkturprogrammen, Umbau des Sozialstaates, restriktivere Zuwanderungsgesetzgebung). Allerdings stellt diese Entwicklung, wie Kapitel 5.5.1 zeigt, sowohl in historischer als auch komparativer Betrachtung kein Novum dar. So bekannten sich die Sozialdemokraten 1959 in ihrem Godesberger Grundsatzprogramm zu den Zielen der Sozialen Marktwirtschaft, an deren Entwicklung die CDU maßgeblich und gegen den Widerstand der SPD beteiligt war. Auch die britische Labour Party übernahm unter der Führung Tony Blairs mit der Agitation des so genannten „Third Way“ zahlreiche wirtschaftspolitische Programmpunkte der Konservativen. Die Unterhauswahlen 1997 in Großbritannien und die Bundestagswahl 1998 belegen, dass die Übernahme bürgerlich-konservativer Politikkonzepte nicht primär zu einer Unverwechselbarkeit der Sozialdemokraten im Vergleich zu konservativen und christdemokratischen Parteien führt, sondern sie vielmehr für eine größere Zahl von Wählergruppen wählbar machen. 10) Die von zahlreichen Politologen als primär sozialdemokratisch empfundenen Strukturprobleme sind größtenteils auch auf die CDU anwendbar. Beide Volksparteien haben mit schrumpfenden Sozialmilieus (Arbeiter- bzw. katholisches Milieu) zu kämpfen und stehen vor der Problematik, dass viele ihrer urtümlichen Ziele (Teilhabe der Arbeiterklasse am allgemeinen Wohlstand, Aufbau eines Wohlfahrtstaates bzw. Preisstabilität, deutsche und europäische Einheit, allgemeiner Wohlstand) als verwirklicht betrachtet werden können. Die Wahlergebnisse des Jahres 2004 und aktuelle Umfragewerte dokumentieren, dass sich die Volksparteien pauschal in einer Struktur- und Vertrauenskrise befinden. Es wäre jedoch utopisch, sie deshalb zu einem Auslaufmodell zu erklären, sollten doch durchaus in der Lage sein, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 106 11) Die sozialdemokratische Wählerschaft ist seit der Abkehr der SPD vom Marxschen Wirtschaftsmodell Ende der 1950er Jahre verglichen mit der bürgerlich-konservativer Parteien deutlich heterogener geprägt, was die SPD gegenüber den Unions-Parteien strukturell benachteiligt. Die Mobilisierung der eigenen Anhängergruppen, die teilweise gegenläufige Interessen haben, erfordert von der Partei in ihrem Auftreten und bei der Formulierung von Wahlaussagen einen zum Teil waghalsigen Spagat (vgl. Kapitel 5.5.3). Da der Anteil der Arbeiterschaft – nach wie vor mit die wichtigste Klientel der Partei – an der Gesamtbevölkerung rückläufig ist, wird dieses Problem jedoch auf absehbare Zeit an Schärfe verlieren. Es existieren letztendlich sowohl positive als auch negative Faktoren, die die Entwicklung der SPD bestimmen. Hieraus allgemeingültige Perspektiven abzuleiten, kann durchaus zweischneidig sein, da keine einheitliche Tendenz bei den hier skizzierten Ergebnissen festzustellen ist. Es steht zu erwarten, dass die Sozialdemokraten ihr aktuelles Umfragetief mittelfristig werden verlassen können und bei Wahlen wieder reüssieren. Die jüngste Vergangenheit offenbart, dass sich die vier wichtigsten Parteien stets nur vorübergehend in einer demoskopischen Baisse befanden (SPD 1995/96 und 1999, Union 1997/98 und 2000, FDP 1994-99, Grüne 1998-2002) und sich Vorhersagen über den baldigen Niedergang der jeweiligen Partei als verfrüht und falsch erwiesen. Es bestehen darüber hinaus, anders als die Erhebungen Ende 2004 erahnen lassen, sehr gute Chancen für die SPD, die Bundestagswahl 2006 zu gewinnen. Schließlich befinden sich auch CDU/CSU aktuell in einem beklagenswerten Zustand. Der mit wenig Charisma ausgestatteten Parteivorsitzenden und wahrscheinlichen Kanzlerkandidatin Angela Merkel mangelt es an Führungskraft. Die fehlende Geschlossenheit der CDU beispielsweise bei der Benennung des Unions-Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten im März 2004 oder aber die wochenlangen Auseinandersetzungen mit der Schwesterpartei CSU um eine mögliche Gesundheitsreform im Herbst 2004 stehen beispielhaft hierfür. Auch die der Union traditionell nahe stehenden Arbeitgeber äußern sich eher zurückhaltend zu der Parteivorsitzenden und den Christdemokraten im allgemeinen.214 In der hypothetischen Kanzlerfrage mehrerer Umfrageinstitute sind die Sympathien in der Bevölkerung eindeutig zugunsten Schröders verteilt. Die grundlegenden in der vorliegenden Arbeit zitierten Schwierigkeiten der SPD würden jedoch auch bei einem Wahlsieg 2006 fortbestehen. Hier ist die Partei gezwungen, zu handeln, will sie die wie Ebbe und Flut wiederkehrenden Untergangsszenarien nicht Realität werden lassen. Es bestehen allerdings Zweifel, ob das aktuelle Führungspersonal der Partei, welches seit mehr als einem Jahrzehnt zu einem nicht unerheblichen Teil aus Karrieristen besteht, dazu in der Lage sein wird. Der SPD fehlt es aktuell an Visionären wie einst Erich Ollenhauer, Kurt Schumacher oder Willy Brandt, die in ihrer politischen „Blütezeit“ in der Lage waren, die Partei in schwierigen Phasen mit ihren Ideen zu begeistern und mitzureißen. 214 Vgl. Diering, Frank; Führungskräfte zweifeln an Merkels Format; in: DIE WELT vom 28.10.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 107 7. Anhang Tabelle 1 Mitgliederentwicklung der SPD 1990-2003 Jahr (jeweils 31.12.) Mitgliederzahl 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 943.402 919.871 885.958 861.480 849.374 817.650 792.773 776.183 775.036 755.066 734.667 717.513 693.894 650.798 Veränderung zum Vorjahr absolut ---- 23.531 - 33.913 - 24.478 - 12.106 - 31.724 - 24.887 - 16.590 - 1.147 - 19.970 - 20.399 - 17.154 - 23.619 - 43.096 Veränderung zum Vorjahr in % ---- 2,5 - 3,7 - 2,8 - 1,4 - 3,7 - 3,0 - 2,1 - 0,1 - 2,6 - 2,7 - 2,3 - 3,3 - 6,2 Quellen: Niedermayer/Gabriel, a. a. O., S. 274-296; eigene Berechnungen Tabelle 2 SPD- und CDU-Parteimitglieder nach Alter 1990-2003 unter 29 Jahre 30-59 Jahre über 60 Jahre Jahr (jeweils 31.12.) SPD CDU SPD CDU SPD CDU 1990 10,2 % 6,6 % 65,2 % 63,7 % 24,6 % 29,2 % 1991 9,9 % 6,8 % 65,0 % 63,1 % 25,2 % 29,6 % 1992 9,1 % 6,2 % 65,3 % 62,8 % 25,6 % 30,6 % 1993 8,5 % 5,7 % 65,4 % 62,3 % 26,0 % 31,7 % 1994 8,1 % 5,4 % 65,6 % 61,2 % 26,4 % 33,0 % 1995 7,4 % 5,2 % 65,2 % 59,8 % 27,4 % 34,5 % 1996 6,9 % 5,1 % 64,7 % 58,6 % 28,3 % 36,0 % 1997 6,5 % 4,9 % 64,1 % 57,0 % 29,4 % 37,7 % 1998 5,6 % 5,1 % 61,7 % 55,3 % 32,7 % 39,3 % 1999 4,6 % 5,5 % 58,9 % 53,7 % 36,5 % 40,4 % 2000 4,4 % 5,5 % 57,6 % 51,8 % 38,1 % 42,4 % 2001 4,4 % 5,3 % 56,5 % 50,4 % 39,2 % 44,0 % 2002 4,6 % 5,2 % 55,0 % 49,4 % 40,4 % 44,9 % 2003 4,6 % 5,4 % 53,2 % 48,6 % 42,2 % 45,7 % Quelle: Angaben der Bundesgeschäftsstellen von SPD und CDU Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 108 Tabelle 3 Mitgliederbestand der SPD nach Beschäftigungsverhältnis Beschäftigung Angestellte/r (Fach-)Arbeiter/in Arbeitslos Auszubildende/r Beamter/Beamtin Hausfrau/-mann Landwirt/-in Rentner/in Schüler/in bzw. Student/in Selbständig Unbekannt Gesamt Mitglieder Anteil % Männlich % Weiblich % 180.897 27,80 68,21 31,79 120.913 18,58 93,02 6,98 13.495 2,07 72,74 27,26 10.667 1,64 76,80 23,20 70.493 10,83 82,24 17,76 65.119 10,01 1,08 98,92 598 0,09 95,99 4,01 88.886 13,66 75,19 24,81 51.344 7,89 72,51 27,49 30.935 4,75 81,17 18,83 17.451 2,68 71,58 28,42 650.798 100,00 70,06 29.94 Quelle: Angaben der SPD-Bundesgeschäftsstelle Stand: 31.12.2003 Tabelle 4 Wählerstruktur der SPD bei den Bundestagswahlen 1998 und 2002 1998 2002 40,9 % 38,5 % Männer 41 % 35 % Frauen 42 % 39 % 18-24 Jahre 36 % 37 % 25-34 Jahre 42 % 36 % 35-44 Jahre 43 % 36 % 45-59 Jahre 43 % 38 % 60 Jahre und älter 41 % 37 % Arbeiter 49 % 41 % Angestellte 42 % 37 % Beamte 37 % 35 % Selbständige 22 % 19 % Rentner 43 % 39 % in Ausbildung 37 % 37 % Arbeitslose 44 % 39 % evangelisch 46 % 41 % katholisch 36 % 29 % ohne Bekenntnis 41 % 41 % Gesamtergebnis Geschlecht Alter Tätigkeit Konfession Quelle: Befragungen von Infratest-Dimap an den Wahltagen 1998 und 2002 (20.000 Befragte; Zahlen gerundet) in: Der Spiegel, Wahlsonderheft ´98 vom 29.09.1998; S. 34 Der Spiegel, Wahlsonderheft ´02 vom 24.09.2002; S. 42 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 109 8. Danksagung Hinweise, Ratschläge, Vermittlung von Gesprächspartnern und offene Ohren – all das hat zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen. Aus diesem Grund möchte ich mich bei allen, die mir geholfen haben, an dieser Stelle herzlich bedanken: bei Herrn Professor Dr. Jürgen Dittberner für die ausgezeichnete Betreuung bei meinen Eltern, die mich während des gesamten Studiums unterstützt haben bei meinen Gesprächspartnern Roland Klapprodt und Konrad Klingenburg bei Sebastian Rüter für die Vermittlung der Gesprächspartner bei Gerrit Senger für seine technische Unterstützung Dominique Sévin, im Januar 2005 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 110 9. Literatur- und Quellenverzeichnis Allgemeine Literatur Abendroth, Elisabeth/Böhme, Klaus; Drei Hessen unter einem Hut; in: Wehling, Hans-Georg (Hrsg.); Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 2000 Adam, Hermann; Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 1995 Andersen, Uwe/Woyke, Wichard (Hrsg.); Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 4. Auflage; Verlag Leske & Budrich; Bonn, 2000 Becker, Horst/ Kraus, Hans Bernd/Otten, Karl-Heinz/Rohde, Jürgen/Schäfer, Ute/Wehrhöfer, Ulrich; NRW-SPD von innen – die wichtigsten Ergebnisse; in: Walsken, ErnstMartin/Wehrhöfer, Ulrich (Hrsg.); Mitgliederpartei im Wandel – Veränderungen am Beispiel der NRW-SPD; Waxmann-Verlag; Münster, 1998 Becker, Joachim; Suche nach Bündnissen; in: Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996 Biegler, Dagmar; Nordrhein-Westfalen; in: Hartmann, Jürgen; Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn, 1997 Boll, Friedhelm; Die deutsche Sozialdemokratie und ihre Medien – Wirtschaftliche Dynamik und rechtliche Formen; Verlag J.H.W. Dietz; Bonn, 2002 Brandt, Gerhard/Jacobi, Otto/Müller-Jentsch, Walther (Hrsg.); Anpassung an die Krise – Die Gewerkschaften in den siebziger Jahren; Frankfurt/Main, New York, 1982 Decker, Frank; Hamburg; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Dittberner, Jürgen; Sind die Parteien noch zu retten?; Logos-Verlag; Berlin, 2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 111 Feser, Andreas; Der Genossen-Konzern – Parteivermögen und Pressebeteiligungen der SPD; Olzog-Verlag; München, 2002 Giddens, Antony; The Critics of the Third Way; Cambridge Polity Press; Cambridge, 2000 Grabow, Carsten; Abschied von der Massenpartei – Die Entwicklung der Organisationsmuster von SPD und CDU seit der deutschen Wiedervereinigung; Deutscher Universitätsverlag; Wiesbaden, 2000 Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Herzog, Dietrich; Konfliktpotenziale und Konsensstrategien; Opladen, 1989 Hirscher, Gerhard; Jenseits der „Neuen Mitte“: Die Annäherung der PDS an die SPD seit der Bundestagswahl 1998; Hanns-Seidel-Stiftung – Akademie für Politik und Zeitgeschehen; München, 2001 Hoffmann, Hansjoachim; Berlin; in: Wehling, Hans-Georg (Hrsg.); Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 2000 Hörnle, Micha; What´s left? – Die SPD und die British Labour Party in der Opposition; in: Beiträge zur Politikwissenschaft, Band 76; Verlag Peter Lang; Frankfurt/Main, 2000 Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996 Ismayr, Wolfgang/Kral Gerhard; Bayern; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Jacobi, Otto; Industrielle Beziehungen, Korporatismus und Disziplinierung; in: Brandt, Gerhard/Jacobi, Otto/Müller-Jentsch, Walther (Hrsg.); Anpassung an die Krise – Die Gewerkschaften in den siebziger Jahren; Frankfurt/Main, New York, 1982 Kastendiek, Hella/Reister Hugo; Neue Technikbeherrschung durch die Reetablierung korporativer Handlungsstrukturen?; in: Herzog, Dietrich; Konfliktpotenziale und Konsensstrategien; Opladen, 1989 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 112 Kim, Myeoun-Hoei; Das Verhältnis zwischen DGB und SPD unter den Bedingungen der Globalisierung der Ökonomie; Inguraldissertation; vorgelegt an der Freien Universität Berlin; Berlin, 1999 Lanc, Erwin; Sozialdemokratie in der Krise – Zwischen ökonomischer Globalisierung und gesellschaftlicher Atomisierung; Promedia Druck GmbH; Wien, 1996 Langkau, Jochem/Matthöfer, Hans/Schneider Michael (Hrsg.); SPD und Gewerkschaften – Band I: Zur Geschichte eines Bündnisses; Verlag J. H. W. Dietz; Bonn, 1994 Lösche, Peter/Walter Franz; Die SPD: Klassenpartei – Volkspartei – Quotenpartei; Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Darmstadt, 1992 Marcinkowski, Frank: Kommunales Wahlverhalten zwischen Eigengesetzlichkeit und Bundestrend – Eine Fallstudie aus Nordrhein-Westfalen; Polis Nr. 51/2001, Hagen, 2001 Massing, Peter/Petratis, Mechthild; Berlin; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Merkel, Wolfgang; Ende der Sozialdemokratie? Machtressourcen und Regierungspolitik im westeuropäischen Vergleich; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, 1993 Meyer, Thomas; Die Transformation der Sozialdemokratie – Eine Partei auf dem Weg ins 21. Jahrhundert; Verlag J.H.W. Dietz; Bonn, 1998 Moebius, P. J.; Über das Pathologische bei Goethe; Mattes & Seitz; München, 1982 Müller-Jentsch, Walther; Gewerkschaften im Umbruch – Ein qualitativer Vergleich; in: MüllerJentsch, Walther (Hrsg.); Zukunft der Gewerkschaften – Ein internationaler Vergleich; Frankfurt/Main, New York, 1988 Müller-Jentsch, Walther (Hrsg.); Zukunft der Gewerkschaften – Ein internationaler Vergleich; Frankfurt/Main, New York, 1988 Niedermayer, Oskar/Gabriel, Oscar W.; Parteimitgliedschaften: Entwicklung und Sozialstruktur; in: Niedermayer, Oskar/Gabriel, Oscar W./Stöss, Richard (Hrsg.); Parteiendemokratie in Deutschland, 2. Auflage; Bundeszentrale für politische Bildung; Wiesbaden, 2002 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 113 Niedermayer, Oskar/Gabriel, Oscar W./Stöss, Richard (Hrsg.); Parteiendemokratie in Deutschland, 2. Auflage; Bundeszentrale für politische Bildung; Wiesbaden, 2002 Nitzschke, Bernd; Goethe ist tot, es lebe die Kultur; in: Moebius, P. J.; Über das Pathologische bei Goethe; Mattes & Seitz; München, 1982 Nohlen, Dieter; Kleines Lexikon der Politik; Verlag, C. H. Beck; Heidelberg, München, 2001 Piehl, Joachim; Beiträge zur Politikwissenschaft: Machtwechsel 1982; Peter Lang-Verlag; Frankfurt/Main, 2002 Roth; Reinhold; Bremen; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Schiller, Theo/Winter, Thomas von; Hessen; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Schneider, Herbert; Baden-Württemberg; in: Hartmann, Jürgen (Hrsg.); Handbuch der deutschen Bundesländer; Campus-Verlag; Frankfurt/Main, Bonn; 1997 Seeleib-Kaiser, Martin; Ende oder Neubeginn der Sozialdemokratie, ZeS-Arbeitspapier 16/2001; Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen; Bremen, 2001 Soell, Hartmut; Von den Füßen auf den Kopf – Wie der innerparteiliche Kulturkampf die Arbeitnehmer vertrieb; in: Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996 Teschner, Manfred; Partei im Spagat – Eine Bestandsaufnahme zum Wandel der deutschen Sozialdemokratie; in: Inacker, Michael J./Schelling, Siegmar; Was ist los mit der SPD? – Besorgte Sozialdemokraten melden sich zu Wort; Ullstein-Verlag; Frankfurt/Main, Berlin, 1996 Timm, Andreas; Die SPD-Strategie im Bundestagswahlkampf 1998; Verlag Dr. Kovac; Hamburg, 1999 Walsken, Ernst-Martin/Wehrhöfer, Ulrich (Hrsg.); Mitgliederpartei im Wandel – Veränderungen am Beispiel der NRW-SPD; Waxmann-Verlag; Münster, 1998 Walter, Franz; Die SPD – Vom Proletariat zur Neuen Mitte; Alexander-Fest-Verlag; Berlin, 2002 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 114 Wehling, Hans-Georg (Hrsg.); Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft; Verlag Leske & Budrich; Opladen, 2000 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung; Wirtschaft heute; Bundeszentrale für politische Bildung; Mannheim, Bonn, 2000 Zeuner, Bodo (Hrsg.); Genossen, was tun? – Bilanz und Perspektiven sozialdemokratischer Politik; Hamburg, 1983 Literatur der SPD SPD-Parteivorstand; Abt. Organisation (Hrsg.); Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Mitgliederentwicklung“ des SPD-Parteivorstandes; Bonn, 1995 SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands; Berlin, 1989 SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1979-1981; Bonn, 1981 SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Machen Sie sich ein Bild von uns – Geschichte, Ziele und Organisation; Berlin, 2004 SPD-Parteivorstand – Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.); Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit – SPDWahlprogramm zur Bundestagswahl 1998; Bonn, 1998 SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Organisationsstatut der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands; Berlin, 2004 SPD-Parteivorstand; Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten in Mannheim vom 23. bis 29. September 1906; Berlin, 1906 SPD-Parteivorstand (Hrsg.); Protokoll der Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 29. Juni bis 2. Juli 1947 in Nürnberg; Hamburg, o. J. Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 115 Literatur anderer Organisationen und Institutionen CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.); Zukunftsprogramm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands; Bonn, 1998 Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.) – Satzung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, beschlossen vom Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 13. Oktober 1949 in München; in: Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes – Protokoll; Köln, 1950 DGB-Bundesvorstand (Hrsg.); Der Mensch im Mittelpunkt – eine gerechte Zukunft wählen; Berlin, 2002 DGB-Bundesvorstand (Hrsg.); Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes; Düsseldorf, 1981 Entschließung der VII. Interzonenkonferenz vom 3. bis 5. Februar 1948 in Dresden; in: Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Hrsg.); Versprochen – Gebrochen: die Interzonenkonferenzen der deutschen Gewerkschaften von 1946-1948; Düsseldorf; o. J. Matthias, Erich (Hrsg.); Einheitsgewerkschaft und Parteipolitik. Zum 75. Jahrestag des Mannheimer Abkommens zwischen Sozialdemokratischer Partei Deutschlands und Freien Gewerkschaften von 1906; Düsseldorf, 1982 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.); 1949-1969 – 20 Jahre Politik der Bundesregierung; aus der Reihe: Bonner Almanach; Bonn, 1970 UNION, 3/98; Union-Verlag GmbH & Co.; Bonn, 1998 Vetter, Hans Oskar; DGB und politische Parteien; in: Gewerkschaftliche Monatshefte 4/1974 Vogel, Hans-Jochen; SPD und Gewerkschaften; in: Gewerkschaftliche Monatshefte 7/1988 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 116 Medien-Quellen Blome, Nikolaus; Schröder geht´s zu gut; in: DIE WELT vom 20.09.2004 Breuer, Helmut; Rote Angst; in: Die Welt vom 31.08.2004 Brügmann, Wolf-Gunter; Der DGB und der Staat; in: Frankfurter Rundschau vom 16.03.1981 Clement, Wolfgang; Gesprächsbericht in: SPD-Spitze streitet über ihre Medien; in: Rheinische Post vom 13.06.2002 Der Kanzler gerät immer stärker in die Zange; in: DIE WELT vom 13.05.2003 Der unheimliche Milliardär; in: Der Spiegel 21/2001 vom 21.5.2001 Der Spiegel, Wahlsonderheft ´98 vom 29.09.1998 Der Spiegel, Wahlsonderheft ´02 vom 24.09.2002 Diering, Frank; Führungskräfte zweifeln an Merkels Format; in: DIE WELT vom 28.10.2004 Elfferding, Wieland; Wenn die Opposition mitregiert – Die FDP als „Neue Mitte“; in: Freitag vom 19.03.1999 FOCUS Wahl Spezial 2002 vom 24.09.2002 Gespräch mit Erhard Eppler; in: Der Spiegel vom 15.06.1981 Gestörtes Verhältnis; in: Lausitzer Rundschau vom 30.08.2004 „Ich hätte schwören können…“ – Interview mit Inge Wettig-Danielmeier; in: Focus Nr. 52/2000 vom 22.12.2000 Haselberger, Stephan; Grüne setzen bei Innovation andere Schwerpunkte als SPD; aus: Berliner Morgenpost vom 10.01.2004 Kleppinger, Hans-Matthias; in: Genossen unter Druck, Focus Nr. 13/2000 vom 27.3.2000 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 117 Lieber gestern als heute – Gerhard Schröder will angeblich die profitablen SPD-MedienBeteiligungen an die WAZ verkaufen; in: DIE WELT vom 10.01.2002 Linkspartei lässt SPD zittern; in: Die Tageszeitung vom 05.07.2004 Medien-Tenor; Forschungsbericht Nr. 119 vom 15.4.2002 Rada, Uwe; Liebich demonstriert gegen SPD; in: Die Tageszeitung vom 21.08.2004 Schöppner, Klaus-Peter; Stimmungshoch der CDU war nur Stimmungstief der SPD; in: DIE WELT vom 25.09.2004 SPD-Finanzchefin: „Die SPD ist eine mittelgroße Verlegerin“ – Interview mit Inge WettigDanielmeier; in: Rheinische Post vom 13.12.2000 Vor dem SPD-Parteitag: Debatte über Linkspartei; in: DIE WELT vom 19.03.2004 Walter, Franz; Zurück zum alten Bürgertum: CDU/CSU und FDP; in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 40/2004 vom 27. September 2004 Zeuner, Bodo; Solidarität mit der SPD oder Solidarität der Klasse? – Zur SPD-Bindung der DGBGewerkschaften; in: Prokla – Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 1/1977 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 118 Internet-Quellen (bei fehlender Jahresangabe war diese bei der Recherche nicht ausfindig zu machen) Bischoff, Joachim; Mindestlohn vom SPD-Tisch; Pressemitteilung der WASG vom 30.11.2004; in: http://www.w-asg.de/28.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=7b95 861d0f; aufgerufen am 05.12.2004 Dambeck, Holger; Unterwandert von Elke Mustermann; in: Spiegel Online am 19.07.2004; in: http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,309321,00.html; aufgerufen am 17.11.2004 DGB Berlin-Brandenburg; Politikwechsel jetzt; in: http://www.berlinbrandenburg.dgb.de/article/articleview/101/1/31/; aufgerufen am 30.11.2004 DGB-Bundesvorstand (Hrsg.); Die Geschichte des DGB; in: http://www.dgb.de/dgb/geschichte/bewegtez/Herausforderung/neue_herausforderungen.htm#chancen; aufgerufen am 30.11.2004 Flegelskamp, Gert; Die SPD und die Medien; in: http://www.flegel-g.de/spd-verlagswesen.html; aufgerufen am 15.10.2004 Flegelskamp, Gert; Die SPD und die Medien, Organigramm der DDVG; in: http://www.flegelg.de/spd-verlagswesen-ornanigramm.html; aufgerufen am 15.10.2004 Grose, Bert; Genossenkonzern oder Bonsai-Imperium – Rezension „Andreas Feser, Der Genossenkonzern“; Berlin, 2004; in: www.viewmag.de/kultur/04/16/feser.html; aufgerufen am 21.10.2004 Hettlage, Manfred C.; Gegenprüfsteine für den DGB – Zur Gewerkschaftsfrage nach der Bundestagswahl; in: Die neue Ordnung 6/1998; in: http://die-neue-ordnung.de/Nr61998/MH.html; aufgerufen am 30.11.2004 Keine kadermäßige Linkspartei; in: Stern Online vom 21.11.2004; in: www.stern.de/politik/deutschland/index.html?id=532615; aufgerufen am 04.12.2004 Studie: Kinder ohne Freunde gehen später oft in die Politik; in: Berliner Morgenpost vom 27.12.2003; in: http://morgenpost.berlin1.de/ausgabe/2003/12/27/aus_aller_welt/649807.html; aufgerufen am 17.11.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 119 Lafontaine notfalls in neuer Linkspartei – Wahlalternative erfreut; in: GlaubeAktuell vom 08.08.2004; in: http://www.glaubeaktuell.net/portal/nachrichten/nachricht.php?IDD=1091896762&IDDParent=1092736936&Suche= 1&IDT=35&IDB=1; aufgerufen am 03.12.2004 Merz will SPD-Besitz an Medien verbieten; in: Berliner Morgenpost vom 04.09.2002; in: http://morgenpost.berlin1.de/archiv2002/020904/politik/story546380.html; aufgerufen am 22.10.2004 SPD-Spitze bei Unterstützern einer Linkspartei unversöhnlich; in: Financial Times Deutschland Online vom 20.03.2004; in: http://www.ftd.de/pw/de/1079712459691.html?nv=5wn; aufgerufen am 03.12.2004 Union denkt über Verhältnis zu Grünen nach; in: tagesschau.de vom 15.06.2004; http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID3360118,00.html; aufgerufen am 09.10.2004 Wahlalternative stellt Weichen für die Gründung einer Linkspartei; in: Financial Times Deutschland Online vom 21.11.2004; www.ftd.de/pw/de/1100939995722.html; aufgerufen am 05.12.2004 www.election.de; Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahlen in Berlin; in: www.election.de/hist/hist_be.html; aufgerufen am 02.09.2004 www.nrw2000.de; 8. Dezember 1966 – Die erste sozial-liberale Koalition in NRW; in: http://www.nrw2000.de/nrw/koalition.htm; aufgerufen am 22.11.2004 www.nrw2000.de; 20. September 1978 – Johannes Rau wird Ministerpräsident von NRW; in: http://www.nrw2000.de/nrw/rau_minister.htm; aufgerufen am 21.11.2004 www.n-tv.de; Stimmung in NRW wechselt – Wählerlager gleichauf; in: www.n-tv.de/5457469.html; aufgerufen am 05.12.2004 www.seeheimer-kreis.de; Die Seeheimer in der SPD; In der Krise liegt die Chance – Die Sozialdemokratie im Umbruch; in: http://www.seeheimer-kreis.de/cgi-bin/contentoffice/view.cgi?rowid=26; aufgerufen am 10.11.2004 www.spd.de; Parteigliederung, in: http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1009388/index.html; aufgerufen am 28.10.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 120 www.wahlrecht.de; Landtagswahlergebnisse in Bayern; in: www.wahlrecht.de/ergebnisse/bayern.htm; aufgerufen am 29.08.2004 www.wasg-koeln.de; WASG Regionalverband Köln; Pressemitteilung vom 25.11.2004; in: www.wasg-koeln.de/Files/PresseKoeln/041126_PEK_WahlenNRW.pdf; aufgerufen am 02.12.2004 www.zdf.de; Politbarometer vom 09.07.2004; in: Informationsgespräche (aus denen nicht zitiert wird; keine Transkription) Klapprodt, Roland; Leiter des Referats Parteiorganisation im SPD-Parteivorstand; in seinem Büro im Willy-Brandt-Haus in Berlin-Kreuzberg; geführt am 21.10.2004 Klingenburg, Konrad; Department of Policy Planing; in einem Konferenzraum in der DGBBundeszentrale in Berlin-Mitte; geführt am 09.11.2004 Perspektiven der deutschen Sozialdemokratie 121 10. Eidesstattliche Erklärung Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen wurden als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. Dominique Sévin, im Januar 2005