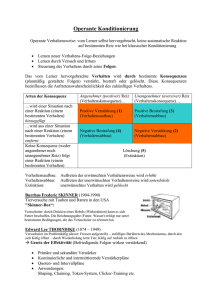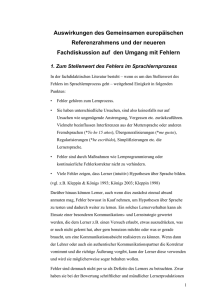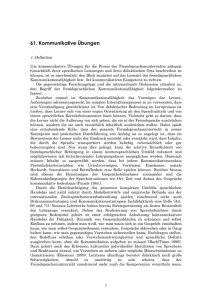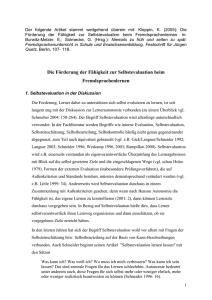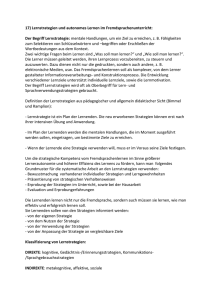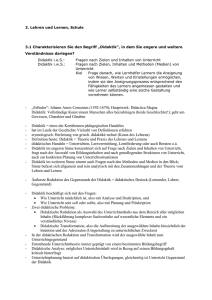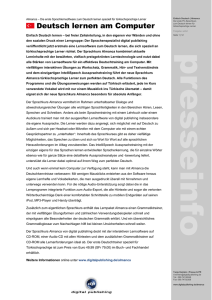Didaktische Vielfalt
Werbung
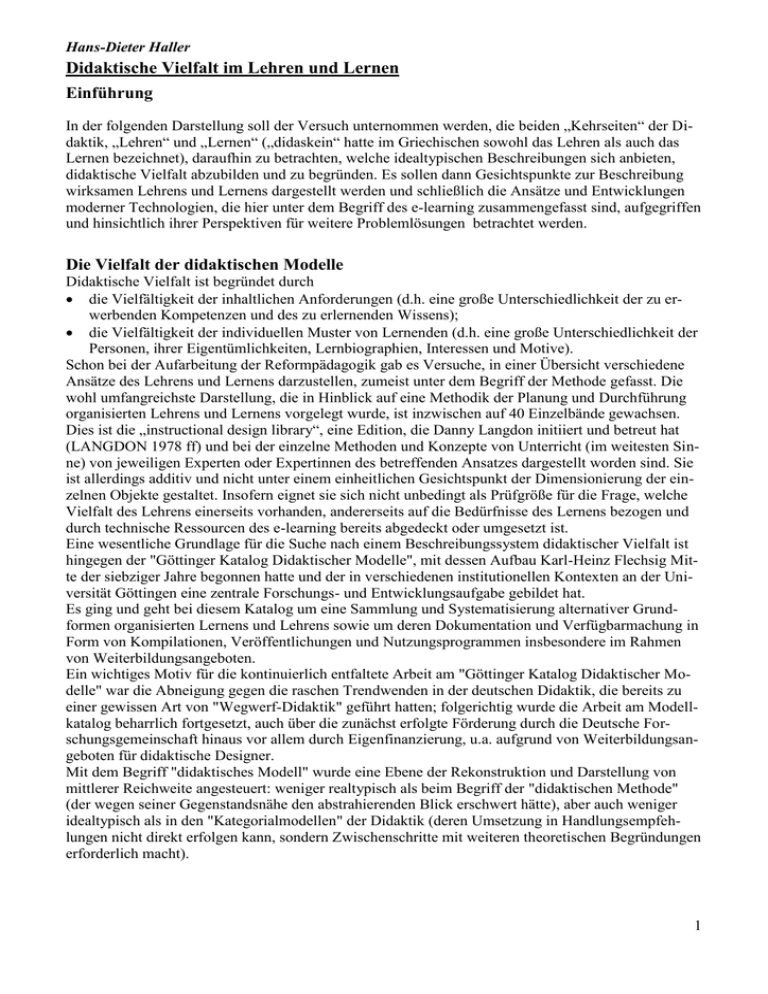
Hans-Dieter Haller Didaktische Vielfalt im Lehren und Lernen Einführung In der folgenden Darstellung soll der Versuch unternommen werden, die beiden „Kehrseiten“ der Didaktik, „Lehren“ und „Lernen“ („didaskein“ hatte im Griechischen sowohl das Lehren als auch das Lernen bezeichnet), daraufhin zu betrachten, welche idealtypischen Beschreibungen sich anbieten, didaktische Vielfalt abzubilden und zu begründen. Es sollen dann Gesichtspunkte zur Beschreibung wirksamen Lehrens und Lernens dargestellt werden und schließlich die Ansätze und Entwicklungen moderner Technologien, die hier unter dem Begriff des e-learning zusammengefasst sind, aufgegriffen und hinsichtlich ihrer Perspektiven für weitere Problemlösungen betrachtet werden. Die Vielfalt der didaktischen Modelle Didaktische Vielfalt ist begründet durch die Vielfältigkeit der inhaltlichen Anforderungen (d.h. eine große Unterschiedlichkeit der zu erwerbenden Kompetenzen und des zu erlernenden Wissens); die Vielfältigkeit der individuellen Muster von Lernenden (d.h. eine große Unterschiedlichkeit der Personen, ihrer Eigentümlichkeiten, Lernbiographien, Interessen und Motive). Schon bei der Aufarbeitung der Reformpädagogik gab es Versuche, in einer Übersicht verschiedene Ansätze des Lehrens und Lernens darzustellen, zumeist unter dem Begriff der Methode gefasst. Die wohl umfangreichste Darstellung, die in Hinblick auf eine Methodik der Planung und Durchführung organisierten Lehrens und Lernens vorgelegt wurde, ist inzwischen auf 40 Einzelbände gewachsen. Dies ist die „instructional design library“, eine Edition, die Danny Langdon initiiert und betreut hat (LANGDON 1978 ff) und bei der einzelne Methoden und Konzepte von Unterricht (im weitesten Sinne) von jeweiligen Experten oder Expertinnen des betreffenden Ansatzes dargestellt worden sind. Sie ist allerdings additiv und nicht unter einem einheitlichen Gesichtspunkt der Dimensionierung der einzelnen Objekte gestaltet. Insofern eignet sie sich nicht unbedingt als Prüfgröße für die Frage, welche Vielfalt des Lehrens einerseits vorhanden, andererseits auf die Bedürfnisse des Lernens bezogen und durch technische Ressourcen des e-learning bereits abgedeckt oder umgesetzt ist. Eine wesentliche Grundlage für die Suche nach einem Beschreibungssystem didaktischer Vielfalt ist hingegen der "Göttinger Katalog Didaktischer Modelle", mit dessen Aufbau Karl-Heinz Flechsig Mitte der siebziger Jahre begonnen hatte und der in verschiedenen institutionellen Kontexten an der Universität Göttingen eine zentrale Forschungs- und Entwicklungsaufgabe gebildet hat. Es ging und geht bei diesem Katalog um eine Sammlung und Systematisierung alternativer Grundformen organisierten Lernens und Lehrens sowie um deren Dokumentation und Verfügbarmachung in Form von Kompilationen, Veröffentlichungen und Nutzungsprogrammen insbesondere im Rahmen von Weiterbildungsangeboten. Ein wichtiges Motiv für die kontinuierlich entfaltete Arbeit am "Göttinger Katalog Didaktischer Modelle" war die Abneigung gegen die raschen Trendwenden in der deutschen Didaktik, die bereits zu einer gewissen Art von "Wegwerf-Didaktik" geführt hatten; folgerichtig wurde die Arbeit am Modellkatalog beharrlich fortgesetzt, auch über die zunächst erfolgte Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft hinaus vor allem durch Eigenfinanzierung, u.a. aufgrund von Weiterbildungsangeboten für didaktische Designer. Mit dem Begriff "didaktisches Modell" wurde eine Ebene der Rekonstruktion und Darstellung von mittlerer Reichweite angesteuert: weniger realtypisch als beim Begriff der "didaktischen Methode" (der wegen seiner Gegenstandsnähe den abstrahierenden Blick erschwert hätte), aber auch weniger idealtypisch als in den "Kategorialmodellen" der Didaktik (deren Umsetzung in Handlungsempfehlungen nicht direkt erfolgen kann, sondern Zwischenschritte mit weiteren theoretischen Begründungen erforderlich macht). 1 Ein noch heute verwendetes Moment der Nutzung dieses Katalogs ist seit 1989 ein Softwaresystem, zunächst bezeichnet als CEDID ("Computer-ergänztes Didaktisches Design"), später als CEWID ("Computer-ergänztes Wissens Design"). Seine Umsetzung auf das Internet ist in Arbeit. Nachdem schon sehr früh begonnen wurde, Interessenten eine Nutzung des "Göttinger Katalogs" durch besondere Trainingsangebote zu erleichtern, stellte die 1987 begonnene Einbindung von elektronischer Datenverarbeitung, für die der Autor zusammen mit dem Entwickler des Göttinger Katalogs verantwortlich ist, eine neue Dimension der Nutzung dieser vielfältigen Ressourcen dar. Es war zunächst damit begonnen worden, auf der Grundlage einer eigenen Programmierung (zunächst in dBase IIIa, dann in CLIPPER-Sommer '87, schließlich in CLIPPER 5.01 und jetzt in Visual Objects) eine Hilfestellung für die Beurteilung der Anwendbarkeit verschiedener didaktischer Modelle in gegebenen Kontexten von Lehr-/Lernsituationen zu entwickeln. Es wurden 15 Prüfkriterien zusammengestellt, die didaktischen Designern (den Anwendern) für ein „rating“ vorgelegt wurden. Diese Prüfkriterien enthielten Aussagen über gegebene Voraussetzungen sowie erwünschte Anforderungen bezüglich der zu gestaltenden Lehr-/Lernkontexte: das durchschnittliches Vorwissen der Lerner/Lernerinnen in der Zielgruppe, die durchschnittlichen Erfahrungen der Lerner/Lernerinnen der Zielgruppe mit unterschiedlichen Lehr-/Lernformen, Fähigkeit der Lerner/Lernerinnen der Zielgruppe zu selbsttätigem Lernen, die Abkömmlichkeit der Zielgruppe vom Arbeitsplatz, die Übereinstimmung der Lernumgebung mit dem Praxisbereich, die didaktische Qualifikation verfügbarer Lernhelfer/-helferinnen, die Verfügbarkeit über Medien und andere Ressourcen, die Möglichkeit, Lernzeit in größere Blöcke zu gliedern, die Kurs-Festlegung durch Lernerfolgsnachweise der Grad des zu vermittelnden Orientierungswissens der Grad des in diesem Kurs/Unterricht o.ä. zu vermittelnden Handlungswissens der Grad des in diesem Kurs zu vermittelnden Deutungswissens inwieweit bei den Anforderungen an den Kurs/Unterricht der Aspekt der Anpassung an veränderte Verhältnisse wichtig ist, inwieweit Anforderungen an den Kurs/Unterricht in bezug auf eine Vorwegnahme (antizipatorisches Lernen) gestellt sind inwieweit Anforderungen an diesen Kurs/Unterricht an die Entwicklung der Persönlichkeit und der Selbstkompetenz der Lernenden gestellt sind. Sieht man einmal von dem Kriterium „Abkömmlichkeit vom Arbeitsplatz“ ab (e-learning ist geradezu ein Programm, auch am Arbeitsplatz Weiterbildung zu ermöglichen), so dürften diese Prüfkriterien mit geringen Nuancierungen oder Umformulierungen auch für die neuen Entwicklungen von Bedeutung sein. Für jedes der 20 didaktischen Modelle, die im Rahmen des "Göttinger Katalogs didaktischer Modelle" beschrieben sind, war ein Anforderungsprofil erstellt worden, welches die für das betreffende Modell vorauszusetzenden Werte in Form eines „ratings“ (Ordinalskala zu den Bezeichnungen: "sehr hoch", "ziemlich hoch", "ziemlich gering", "gering") enthielt. Das Programm prüfte dann die Übereinstimmungen bzw. Abweichungen zwischen Eingaben und Profil und gab entsprechende Empfehlungen über die Anwendbarkeit des betreffenden didaktischen Modells in dem gegebenen Kontext. Dabei wurde unterschieden zwischen einer optimalen und bedingten Anwendbarkeit, d.h. im Fall nicht zu großer Abweichungen erfolgten Hinweise darauf, welche Bedingungen ggf. nachzubessern seien bzw. bei welchen Anforderungen Abstriche zu machen seien. Zusätzlich wurde auf die vielfältigen Ressourcen des "Göttinger Katalogs didaktischer Modelle" zurückgegriffen und eine Wissensbasis zusammengestellt, die detailliertere Auskunft geben konnte über die einzelnen didaktischen Modelle. Diese beinhaltete und unterschied in den menügesteuerten Aufrufmöglichkeiten verschiedene Dokumente zu einer Vielzahl von Stichworten: Definitionen im Sinne von einführenden Texten (maximal 20 Zeilen), Erläuterungen (längere, handbuchartige Artikel), 2 Beispiele (Beschreibungen von Praxis), Formulare (weiterverwendbare Textgerüste), Datenbanken (Tabellen), Bild- und Tondokumente, Quellenverweise in einer Gesamtbibliographie. Die mit CEDID durchführbaren Operationen waren in die folgenden Grundoperationen gegliedert: Kontextanalyse (Abfrage und Zusammenstellung von Daten über Bezugssysteme, Zielgruppen, Ressourcen, Anforderungen), Programm-Design (Abfrage, Zusammenstellung und Bewertung über Ziele und Konzepte des für einen Kurs zugrundeliegenden Aus- bzw. Weiterbildungsprogramms), Modellauswahl (Angaben in Form von ratings zu 15 Prüfkriterien und darauf folgende Empfehlungen und deren Begründungen zur Verwendbarkeit der 20 didaktischen Modelle in einem gegebenen Lehr-/Lernkontext), Kurs-Design (Erstellung einer Wissens-Landkarte, Durchführung einer Wissensanalyse zu den fachlichen Inhalten und Zusammenstellung der Kompetenzbeschreibungen), Block-Design (differenzierte modellspezifische Beschreibung der beabsichtigten Lernumgebungen und ihrer Elemente, der einzuleitenden Lehr- und Lernfunktionen sowie der verschiedenen Phasen und dabei auszuführenden didaktischen Handlungen von Lehrenden und Lernenden), Fertigung (Darstellung von Gesichtspunkten für die weitere, von CEDID dann nicht mehr gestützte Ausgestaltung von Leitfäden und Lernmaterialien), Erprobung (Hinweise für die Erprobung eines mit CEDID erstellten didaktischen Designs mit einer Zielgruppe), Evaluierung (Bewertung des mit CEDID erstellten didaktischen Designs nach etwa 70 einzelnen Gesichtspunkten durch den Designer selbst oder eine andere Person). Der Begriff "didaktisches Design" war bewusst in Analogie zu den im Zusammenhang der Nutzung von EDV für gestalterische Tätigkeiten entstandenen Bezeichnungen wie CAD ("Computer-aided Design") gewählt worden und sollte betonen, dass es um die Unterstützung von fachlich kundigen didaktischen Planerinnen und Planern bei ihren Konstruktionen für die Gestaltung von Lernumgebungen gehen sollte. 3 Didaktische Modelle, nach: K.-H. Flechsig, Kleines Handbuch Didaktischer Modelle, Göttingen 1991, 3. Aufl. Arbeitsunterricht Lerner bearbeiten individuell oder in kleinen Gruppen (schriftlich formulierte) Aufgaben mit möglichst mehreren Aspekten, um Kenntnisse und Fertigkeiten zu üben und anzuwenden. Beispiel: Varianten Gruppenunterricht, -arbeit Projektseminar GESTALTUNG DER LERNUMGEBUNG: Es müssen sorgfältig ausgearbeitete und AUSWERTUNG: ERFAHRUN- schriftlich formulierte LERNAUFGABEN vorGEN DER ARBEITSGRUPPE liegen. Geeignete ARBEITSMITTEL und WERKAG Thema: ZEUGE sollten in hinreichender Zahl vorhanden sein. AG Betreuer/in: In geschlossenen Räumen sollte der LERNORT so groß sein, dass pro Lerner mindesProjektnummer: tens 4 qm zur Verfügung stehen. LERNAUFGABEN: Kurze Beschreibung des ProLerner werden aufgefordert, jekts: individuell oder in einer Kleingruppe vorgegebene, unter Alternativen auszuNotwendige Vorbereitung/ wählende oder selbst gestellte Aufgaben Art zu bearbeiten, die darin bestehen, Zeitaufwand gut definierte Probleme mittlerer Komple(organisatorisch-inhaltlich) xität zu lösen, Produkte zu erstellen oder wichtige Adressen Tätigkeiten auszuführen wofür (z.B. für Außenkontakte)? sich dabei (ggf. unter Beratung) Wissen anzueignen, Wichtige Literatur und Medien die Ergebnisse einer Person oder einer wofür? Gruppe zu präsentieren sowie anschließend zu reflektieren, zu diskutieBenötigte Materialien/Hilfsmittel ren, zu bewerten und zu sichern. wo erhältlich? Lerner: Sie sind aktiv und produktiv HANDELNErforderliche Finanzen/wie DE. beschafft Sie sind zugleich PARTNER und GRUPwofür? PENMITGLIEDER. Wie viel? Sie sind LERNHELFER für andere. Gelegentlich sind sie auch WETTBEFazit: Erfolge, Misserfolge, WERBER. Mängel, Probleme, Schülerak Und sie sind BEURTEILER der Arbeit zeptanz anderer. Lernhelfer: Ergebnisse/ "hergestellte Pro ORGANISATOREN, dukte" (wenn möglich mit Be MODERATOREN, legexemplar bzw. Verbleibhin EXPERTEN und weis) BERATER. Verbesserungsvorschläge: didaktische Prinzipien selbsttätiges Lernen individualisiertes Lernen ganzheitliches Lernen In der "Orientierungsphase" gewinnen die Lerner einen Überblick über den Lebensbereich, dem die Aufgaben zugehören ("orientieren"), "klären" die Lerner ihr Vorwissen und ihre Interessen ("interessieren"), werden die Lerner in vorhandene und zu beschaffende Arbeits- und Hilfsmittel eingeführt ("vorbereiten"), machen sich die Lerner mit den am Ende des Blocks zu erreichenden Kompetenzen vertraut ("vorstrukturieren"), erfahren sie, nach welchen Bewertungskriterien diese beurteilt werden. In der "Planungsphase" werden Aufgaben von den Lernern selbst entwickelt oder vom Organisator als Alternativen zur Auswahl gestellt ("entwickeln", "entscheiden"), wird der Sinn der Aufgaben erörtert ("begründen"), werden Arbeitsgruppen nach sozialen Gesichtspunkten und/oder Interessen und/oder vorhandenen Kompetenzen gebildet, sei es durch freie Wahl oder durch Zuordnung ("gruppieren"), "formulieren" die Arbeitsgruppen ihre Lernaufgaben schriftlich ( ggf. durch einen "Lernkontrakt") und "planen" die Arbeitsgruppen ihr Vorgehen bei der Bearbeitung der Aufgaben In der "Interaktionsphase" bearbeiten die Lerner in Kleingruppenarbeit oder individuell Aufgaben oder Teilaufgaben (interagieren), nutzen die Lerner selbständig Arbeitsmittel, Werkzeuge und Informationsmittel, z.B. um Daten zu erheben, konsultieren die Lerner gegebenenfalls Mitlerner und/oder Berater, wenden sie verschiedene Formen der Selbstkontrolle an (kontrollieren), bemühen sich die Lerner um einen Konsens in der Kleingruppe in bezug auf die Qualität ihrer Lösung oder ihres Produkts (diskutieren) und bereiten sie die Präsentation ihrer Lösung bzw. ihres Produkts im Plenum vor. e-Learning: Arbeitsaufträge, die sich auf Informationen im Netz beziehen. Bearbeitung schriftlicher Objekte, individuell oder in Partner- oder Kleingruppenarbeit. Praktische Arbeiten sind visuell zu dokumentieren (Video) und durch begleitende Kommentare zu korrigieren. Es fehlt eine handschriftliche Korrekturmöglichkeit zur Vorlage der Lernenden. Präsentation von Ergebnissen im Netz. 4 Disputation Definition Varianten Lerner eignen sich in öffentlicher und geordneter Rede und Gegenrede vor allem Argumentations- und Urteilsfähigkeit an. Beispiel DIE LERNUMGEBUNG ist geprägt durch den VORSITZENDEN, der die Disputation einleitet und abschließt, das Wort erteilt und auf die Einhaltung der "Spielregeln" achtet; das PUBLIKUM (Auditorium), das die Öffentlichkeit repräsentiert, der Disputation folgt und reagiert und das an einem Schlussvotum beteiligt werden kann. SEKUNDANTEN können die Disputanten unterstützen, vorbereitete THESENPAPIERE können eine Disputation übersichtlicher gestalten. LERNAUFGABEN zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell eine eigene Position in bezug auf einen kontroversen Sachverhalt zu entwickeln und sich dabei Wissen anzueignen, diese (ggf. schriftlich in einem Thesenpapier) zu formulieren und sie anschließend in einem Streitgespräch mit dem Vertreter einer Gegenposition zu vertreten und zu verteidigen. Lerner übernehmen die Rollen des PUBLIKUMS, das die Disputation beobachtet und ggf. in Bewertungs- und Rückmeldungsprozesse einbezogen wird, der DISPUTANTEN, in der Regel einem PROPONENTEN und einem OPPONENTEN (sofern diese nicht Lernhelfer sind), und SEKUNDANTEN (sofern diese nicht Lernhelfer sind). Lernhelfer übernehmen die Rollen des VORSITZENDEN, der die Disputation organisiert, über die Annahme der Thesen entscheidet und Verfahrensfragen und Konflikte regelt, der DISPUTANTEN, in der Regel eines PROPONENTEN und eines OPPONENTEN (sofern diese nicht Lerner sind), und der SEKUNDANTEN (sofern diese nicht Lerner sind). didaktische Prinzipien Disput Streitgespräch Debatte Thesenverteidigung Podiumsdiskussion argumentierendes Lernen dialektisches Lernen In der "Vorbereitungsphase" geht es darum, zu klären und zu regeln, wer, wann, wo, aus welchem Anlass mit wem worüber "disputieren" soll, welche "Spielregeln" gelten sollen, wer die Rollen des Vorsitzenden und ggf. der Disputanten übernehmen soll und wer als Publikum eingeladen wird. In der "Rezeptionsphase" (Thesenpräsentationsphase) werden die disputationswürdigen Thesen vom Vorsitzenden und/oder den Disputanten vorgeschlagen, von den Disputanten und ggf. den Sekundanten akzeptiert und so veröffentlicht, dass ein Publikum gewonnen, eingeladen und vorinformiert werden kann. In der "Interaktionsphase" (Argumentationsphase) tragen nacheinander Proponent und Opponent stützende und widersprechende Argumente vor, prüfen, belegen, bestreiten und untermauern die Disputanten in weiteren Runden ihre Argumentation, ziehen die Disputanten ggf. Argumente zurück, entscheidet der Vorsitzende ggf. über die Zulässigkeit der Argumente und folgt das Publikum dem Argumentationsprozess ggf. mit Äußerungen des Beifalls oder der Ablehnung, mit Kommentaren oder Beurteilungen. In der "Bewertungsphase" wird die Disputation selber gegebenenfalls mit einem Votum abgeschlossen; dieses Votum kann beispielsweise auch von den anwesenden Zuhörern abgegeben werden. e-Learning: Wird im „chat“ möglich. Es sind aber wenig Merkmale hervorgehoben, z.B. Übersicht und Markierung von pro/contra, Präsentation von „Podiumsteilnehmern“ http://www.debattierclubs.de/faq.html 5 Erkundung Lerner begeben sich in natürliche Umwelten oder Institutionen zur Beobachtung und Datenerhebung, um Zusammenhänge zu überschauen sowie um Interessen und Standpunkte zu gewinnen. Beispiel Beispiel für einen Erkundungsleitfaden: Projekte in Bildungsinstitutionen Wo ist die Institution gelegen? Wie groß ist sie (räumlich, personell)? Welche Geschichte hat sie? Wie wird sie finanziert? Was kann man mit ihr noch verbinden? Welche Anbindung hat die Unterrichtseinheit an sie? Wer ist der Projektleiter? Wer arbeitet an dem Projekt mit? (Qualifikationen, Funktionen, zeitliche Belastung, Alter, Bedürfnisse, Zahl der Mitarbeiter)? Welche Geschichte hat das Projekt? Welche Perspektiven ergeben sich durch das Projekt? Wie lässt sich die Leitidee des Projekts beschreiben? Didaktische Prinzipien/pädagogische Prinzipien wie sind sie begründet (Systemanalyse, Ziele, Normen)? in welchen Handlungen sind sie besonders deutlich? woran erkennt man, dass sie realisiert sind? in welche "Schule" ordnet man sich ein (Wissenschaftsverständnis)? was geschieht, um Konflikte (Normen-, Zielkonflikte) und ihre Struktur transparent zu machen? Wer sind die Handlungsträger der Praxis? welches sind ihre dominanten Interessen? welche Schlüsselqualifikationen werden vorausgesetzt bzw. vermittelt? wie sind die Beziehungen zueinander organisiert? wer sind die Betroffenen des Projekts? Welches sind die projektspezifischen didaktischen Handlungen? welche Ressourcen werden benötigt? Welche Wirkungen sollen/werden diese herbeiführen? Welche Evaluierungspraktiken hat die Projektgruppe? woran sind sie orientiert? Was geschieht im Projekt speziell, um die Transparenz für die Lernenden zu sichern? den Umweltbezug zu sichern? die Vielfalt der Interaktionen zu sichern? die Rückmeldung zu sichern? die Persönlichkeitsentwicklung zu sichern? die Selbststeuerung der Handlungsträger zu sichern? Welchen Anwendungsbereich hat das Modell? welche Adressaten? welche Institutionen? welche Lerninhalte? welche normativen Systeme? In welcher Form wird das Projekt oder die Projektmaterialien dargestellt? Nachfragen nach: a) Projektbeschreibungen b) Originalmaterialien c) AV-Medien d) internen Papieren e) weiteren Kontaktpersonen didaktische Prinzipien Exkursion Exploration Hospitation Praktikum Feldstudie Die Lernumgebung umfasst im wesentlichen folgende Elemente: Informationsmittel über das Erkundungsfeld sind in der Regel nützlich und notwendig; "Kontaktpersonen" im Feld und ggf. "Berater"; Werkzeuge bzw. Instrumente zum Erheben und Speichern von Daten werden häufig benötigt: Messinstrumente, Kameras, Tonbandgeräte, Notizbücher etc.; am Ende jeder Erkundung steht ein Erkundungsbericht, der die gewonnenen Erfahrungen festhält, ordnet und damit die Grundlage für die Auswertung der Erkundung bildet. Lernaufgaben: Typische Lernaufgaben bei Erkundungen zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell oder in einer Kleingruppe eine Einrichtung oder eine natürliche Umwelt aufzusuchen, dort (ggf. vorangemeldete) Kontakte aufzunehmen bzw. Orte aufzusuchen, anschließend spezifische Erhebungen oder Beobachtungen durchzuführen, diese zu protokollieren (schriftlich, Tonaufzeichnung, Photo), darüber (ggf. mit Checkliste) einen Erkundungsbericht zu erstellen und diesen in einem spezifischen Kontext zu präsentieren. Rolle der Lerner: Bei einer Erkundung befindet sich der Lerner in der Rolle eines aktiven Beobachters. "Aktiv" bedeutet im besonderen, dass der Lerner weiß, was er wissen und warum er es wissen will, dass er, zum Beispiel durch Fragen, Informationen sammelt und festhält, dass er über geeignetes Vorwissen verfügt, wenn er sich an Lernorte begibt, insbesondere über Hilfsmittel und Gefahren. Lernhelferrollen: Lernhelfer treten bei Erkundungen grundsätzlich möglichst wenig in Erscheinung, da die Lerner in diesem didaktischen Modell vor allem selbständig vorgehen sollen. Dennoch übernehmen Lernhelfer wichtige Rollen, sie sind Organisatoren, die für erste Kontakte und institutionelle Rahmenbedingungen einer Erkundung sorgen; ggf. Berater, an die sich die Lerner wenden können, oder die von sich aus z.B. auf Gefahren aufmerksam machen; in einigen besonderen Fällen auch selber Kontaktpersonen (Experten, Gewährsleute etc.) im Feld, und Organisatoren (Reiseleiter, Lehrer etc.). e-Learning: Vorbereitung durch Recherchen im Netz, z.B. geographische Daten. Erkundungen im Netz durchführen, das ja selbst Lebenswelt ist. Präsentation von Erkundungsergebnissen im Netz. 6 Varianten Lernen durch unmittelbare Erfahrung Lernen durch direkten Umgang orientierendes Lernen beiläufiges Lernen Phasen In der "Vorbereitungsphase" wird das Erkundungsfeld von Lernern und ggf. Beratern abgegrenzt, werden Erkundungsmöglichkeiten erörtert, Kontakte zu Kontaktpersonen im Feld hergestellt, mögliche Gefahren und Risiken überlegt, wahrscheinliche Kosten abgeschätzt und mögliche positive wie negative Nebeneffekte diskutiert. In der Klärungsphase klären die Lerner ab, welches das Hauptinteresse bei der Erkundung sein soll, prüfen die Lerner, ob und in welchem Umfang dieses Interesse durch die Erkundung wahrscheinlich befriedigt wird, und verknüpfen sie ihre Interesse mit früheren und künftigen Erfahrungen. In der Planungsphase entscheiden die Lerner, welche Informationen sie in erster Linie erheben wollen, weisen die Lerner einander auf beiläufig erhebbare Informationen hin, vereinbaren die Lerner Termine und Kontakte, verteilen die Lerner Erkundungsaufträge und Rollen, beschaffen oder entwickeln die Lerner Erkundungsinstrumente und beschaffen die Lerner VorabInformation (durch Korrespondenz oder Telefonkontakt). In der Interaktionsphase erheben die Lerner Informationen entsprechend dem Plan, erheben die Lerner Informationen über beiläufig gemachte Erfahrungen, zeichnen die Lerner ihre Erfahrungen auf und erstellen die Lerner den "Erkundungsbericht" einzeln oder in kleinen Gruppen. In der Bewertungsphase nehmen die Lerner die Erkundungsberichte zur Kenntnis, stellen die Lerner einen Rückbezug zwischen ihren Lerninteressen und den erhobenen Informationen her, bewerten die Lerner den Erkundungsprozess, werten die Lerner die Erkundungsberichte aus und entwickeln die Lerner Perspektiven für künftiges Lernen, Handeln und Leben (in der Regel im Plenum). Fallmethode Lerner bearbeiten einzeln oder in Gruppen rekonstruierte Praxisfälle, um sich Wissen über die betreffende Praxis oder Prozedur anzueignen und ihre Urteilsund Entscheidungsfähigkeit auszubilden. Vdidaktische Prinzipien a praxisnahes Lernen r problemlösendes Lernen i a n t e n F a l l s t u d i e 7 Beispiel Im einzelnen kann man sich hinsichtlich der Abfolge einer Fallbearbeitung an die folgenden Schritte halten, die für Entscheidungs- und Problemlösungsfälle zusammengestellt worden sind: 1. Ausgangspunkt einer Fallstudienbearbeitung ist immer die Darstellung des Falles bzw. die Präsentation der Fallbeschreibung. Sie muss allen Beteiligten gut zugänglich sein. Am Ende der Falldarstellung erfolgt die Aufgaben- oder Problemstellung. 2. Zumeist können in der Fallbesprechung sodann die „Stolpersteine" (d.h. die besonderen Auffälligkeiten des Falles herausgearbeitet werden; sie können z.B. in sehr bekannten (eklatanten) Merkmalen, aber auch in Ungereimtheiten und Widersprüchen bestehen; Unklarheiten, Verständnis- und Begriffsprobleme sind zunächst auszuräumen. 3. Eine genauere Analyse der Aussagen und Merkmale sollte dann in einer gewissen Systematik erfolgen; oft geht es in der Ausbildung geradezu darum, diese Parameter über einen Untersuchungs- oder Problemlösungsalgorithmus aufzuspüren. Als allgemeinstes Schema für einen solchen Algorithmus bieten sich im Deutschen die W-Fragen an, also z.B.: Wer hat mit wem? und mit welchen Mitteln? warum? wann? wo? mit welcher Absicht? und mit welcher Wirkung? was getan? 4. Aus dem so erschlossenen Wissensbestand über den Fall lassen sich „Eckwerte" des Falles, d.h. die zentralen Problempunkte („critical incidents"), die grundlegenden Parameter oder auch das Besondere des Falles herauskristallisieren. Vielleicht lohnt es sich nun, in Art einer Wissens-Landkarte diese „Eckwerte" zusammenzustellen und auch schon ihre möglicherweise bestehenden Beziehungen zueinander (Ursache-Wirkungs-Verhältnisse, Bedingungswahrscheinlichkeiten u.ä.) darzustellen. 5. Auf diese Zusammenstellung folgt der Versuch einer Problemlösung, Hypothesenbildung o.ä.; so können u.U. verschiedene Lösungswege, Hypothesen o.ä. entstehen, die hinsichtlich ihrer Konsequenzen zu betrachten sind (z.B.: „Wenn es stimmt, dass..., dann müsste auch ..."). Hierbei ist auch an das vorhandene Deutungswissen (theoretische Wissen, Hintergrundwissen) anzuknüpfen; u.U. sind auch mehrperspektivische Betrachtungsweisen möglich und sinnvoll („nach dieser Theorie handelt es sich um..., nach jener Theorie hingegen um ..."). 6. Wurde eine Lösung gefunden oder eine Entscheidung getroffen, so sollte sie zur Absicherung und zur nochmaligen Veranschaulichung der bisherigen Fallbearbeitung und der einzelnen Schritte an die Ausgangslage zurückgeführt werden (Rückschau); die zentrale Frage lautet: „Haben wir eine gute Lösung gefunden resp. Entscheidung getroffen?" (noch könnte revidiert und der Arbeitsschritt wiederholt werden!). Ist es beim besten Willen zu keiner Lösung gekommen (auch im wirklichen Leben gibt es nicht immer Lösungen, oder Entscheidungen werden vermieden), so sollte wenigstens das zugrunde liegende Dilemma dargestellt und begründet werden. 7. Zum Schluss sollte der Blick nach vorn gerichtet werden; es sind Fragen zu stellen und zu behandeln, welche Folgerungen aus den bisherigen Erkenntnissen für die weitere Studiengestaltung abgeleitet werden können, was noch gelernt werden müsste, welche Routinen zu entwickeln sind, u.ä.. Hierbei geht es auch um mögliche Verallgemeinerungen, d.h. welche Typik sich aus dem bearbeiteten Fall ergeben hat. Für die Lernumgebung ist der FALL das Hauptelement der Lernumgebung; er sollte der Realität entstammen und verfremdet werden (Gründe: Diskretion und Datenschutz); sollte das FALLMATERIAL, das die zu bearbeitenden Fallbeispiele zumeist in Form von Akten (Fall-Mappen) vermittelt, gut ausgewählte und übersichtlich angeordnete Dokumente enthalten; sollten HINTERGRUNDINFORMATIONEN zum Umfeld des Falles ebenfalls zugänglich sein (sie können jedoch von den Lernern gemeinsam genutzt werden). Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell oder in einer Kleingruppe eine Falldarstellung zu lesen und zu analysieren, Lösungsalternativen zu entwickeln und sich dabei Wissen anzueignen, sich für eine Lösung bzw. Interpretation zu entscheiden, diese zu formulieren, von Lernhelfern oder anderen Informationen über reale Lösungen abrufen und diese Lösungen mit der eigenen Lösung zu vergleichen. Lerner übernehmen die Rollen von ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN, die über den Fall zu entscheiden haben, von BETROFFENEN, die von der Entscheidung betroffen sind, und ggf. von unabhängigen Gutachtern (SCHIEDSRICHTERN), die zu dem Fall eine unabhängige Stellungnahme abgeben. Lernhelfer übernehmen die Rollen von AUTOREN, die den Fall rekonstruieren und die Fallmaterialien erstellen, ORGANISATOREN, die die Arbeitsprozesse der Lerner koordinieren, BERATERN, die in den Fall einführen und ggf. weitere Hintergrundinformationen beschaffen, und von EXPERTEN, die Rückmeldungen und Auswertungen ggf. unterstützen. In der "Vorbereitungsphase" werden Fälle von Autoren dokumentiert und aufbereitet; werden die Lerner in den Themenbereich eingeführt, erhalten die Lerner Hinweise auf Handlungsmöglichkeiten und werden ggf. mit der Fallmethode vertraut gemacht. In der "Rezeptionsphase" (Analysephase) klären die Lerner, was ihr Interesse am Fall erregt; prüfen die Lerner ggf., um welchen Problemtyp es sich handelt; arbeiten die Lerner das Fallmaterial durch; interpretieren die Lerner den Fall und beschaffen sich die Lerner Hintergrundinformationen für den Fall. In der "Interaktionsphase" (Bearbeitungsphase) bilden die Lerner ggf. Kleingruppen; vergleichen die Lerner Interpretationen; verständigen sich die Lerner, über Problemoder Falldefinitionen; entwickeln die Lerner Lösungsmöglichkeiten; prüfen die Lerner Alternativen und entscheiden sie sich für eine Lösung. In der "Bewertungsphase" der Fallmethode präsentieren die Kleingruppen ihre Lösungen, nehmen die Lerner Lösungen und Begründungen anderer zur Kenntnis, werden die Lösungsalternativen diskutiert und bewertet und wird im Plenum eine Entscheidung über die beste Lösung gefällt. e-Learning: Vorbereitung durch Recherchen im Netz, z.B. Firmenportale mit Informationen über den Betrieb. Fallbearbeitung vernetzt durchführen. Präsentation von Fallbeschreibungen im Netz. http://www.e-bfi.at/ http://www.leu.bw.schule.de/beruf/material/umat/hot/leu-ktu.htm#fall 8 Famulatur Praktiker eignen sich spezielles oder seltenes Wissen von hoher Qualität an, indem sie einer sehr erfahrenen Fachperson bei deren Arbeit über einen längeren Zeitraum helfen. Varianten Assistenz Volontariat didaktische Prinzipien Beispiel Die Lernumgebung besteht im Wesentlichen aus dem PRAXISFELD (z.B. einer Werkstatt oder einer Klinik), dem LERNPLAN (z.B. einem LEITTEXT), dem LERNKONTRAKT (Vertrag), der in der Regel schriftlich abgeschlossen wird und die wesentlichen Vereinbarungen der Famulatur regelt, insbesondere Zeitdauer, wechselseitige Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten sowie die Art des ZERTIFIKATS (Zeugnisses), falls ein solches erteilt wird. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell Kontakt zu einem Experten ihres Fachs oder ihrer Profession aufzunehmen, mit diesem einen Lernvertrag auszuhandeln und abzuschließen, mit seiner Hilfe einen Lernplan auszuarbeiten, sich von diesem "Meister" in ein Tätigkeitsfeld einweisen zu lassen, ihn über einen längeren Zeitraum teilverantwortlich bei seiner Arbeit zu unterstützen, aufmerksam zu beobachten, Techniken einzuüben, Rückfragemöglichkeiten wahrzunehmen und die eingebetteten Lernvorgänge sorgfältig zu dokumentieren. Lerner übernehmen die Rollen des LEHRLINGS, MEISTERSCHÜLERS oder VOLONTÄRS, eines ASSISTENTEN, der Meister oder andere qualifizierte Mitarbeiter unterstützt, sowie eines AKTIVEN BEOBACHTERS, der sich möglichst viel Wissen durch Nachahmung aneignet. Ein Lernhelfer übernimmt die Rolle des MEISTERS oder MENTORS, der ein besonders kompetenter Praktiker sein sollte, an der Weitergabe seines Wissens interessiert ist, sein Handeln erklären und begründen kann sowie den Lehrling beraten und dessen Leistungen konstruktiv-kritisch bewerten kann. Lernen durch Assistieren Lernen am Modell In der "Vorbereitungsphase" sucht der Lerner eine geeignete Stelle im Praxisfeld auf, diskutiert der Lerner mit dem Meister die wechselseitigen Erwartungen, insbesondere auch die Arbeitsbedingungen, trifft er Absprachen und Vereinbarungen bzw. schließt einen Lernvertrag ab und erstellt bzw. übernimmt er einen Lernplan. In der "Interaktionsphase" (Assistenzphase) beobachtet der Lerner den Meister bei seiner Tätigkeit, assistiert der Lerner dem Meister entsprechend der Absprache, stellt der Lerner dem Meister Fragen (fragen), wird der Lerner vom Meister beraten und erhält der Lerner vom Meister Rückmeldung (rückkoppeln). In der "Bewertungs(-/Auswertungs)phase" reflektiert der Lerner zwischenzeitlich und abschließend seinen Lernprozess, lässt sich der Lerner vom Meister zwischenzeitlich und abschließend evaluieren und diskutiert er mit ihm ggf. das Zertifikat. In der "Anwendungsphase" (bei dieser Methode auch Kollationsphase genannt) wird den Lernern die im realen Fall tatsächlich getroffene Entscheidung vorgestellt; vergleichen die Lerner die von ihnen gefundene Lösung mit der realen Lösung und werden mögliche Gründe und Folgerungen diskutiert. e-Learning: Nur geringe Möglichkeiten. Erforderlich wäre eine handlungsbegleitende Videodokumentation, und zwar für beide Seiten. Problem der Rückmeldung. 9 Fernunterricht Lernende eignen sich durch Lektüre von speziell aufbereiteten Lehr-/Lernmaterialien sowie durch Bearbeiten von schriftlich gestellten Aufgaben überwiegend theoretisches Wissen (Fakten, Begriffe, Modelle etc.) an. Beispiel DIE LERNUMGEBUNG umfasst im wesentlichen folgende Elemente: das LEITMEDIUM (Korrespondenz, Fernsehen, Rundfunk, Zeitung), das den Kontakt zum Lerner herstellt, das KURSMATERIAL (z.B. schriftliche Texte, Rundfunk- und Fernsehsendungen, gelegentlich auch weitere Zusatzmaterialien), den STUDIENLEITFADEN, der einen Überblick über den Kurs, Ratschläge für zweckmäßige Lernstrategien sowie organisatorische Hinweise enthält, die AUFGABEN, die auf das Kursmaterial abgestimmt sind, und KORREKTUREN (Rückmeldungen auf Aufgaben, Berichtigungen etc.). Lerner sind ORGANISATOREN des eigenen Lernprozesses, entscheiden also selbst über Lernzeiten, Lernorte und soziale Kontexte, und LESER und ggf. HÖRER oder ZUSCHAUER sowie ggf. GRUPPENMITGLIED einer Tutorengruppe. LERNHELFER sind AUTOREN von Lehrtexten und (Fernseh, Rundfunk-) Sendungen, KORREKTOREN von eingesandten Aufgaben sowie BERATER und TUTOREN von individuellen Lernern oder Kleingruppen. Varianten didaktische Prinzipien Fernkurs, -studium Korrespondenz-Unterricht Telekolleg Funkkolleg Lernen in Einzelarbeit Lernen mit Medien aufgabenbezogene Rückmeldung In der "Orientierungsphase" orientieren sich die Lerner über das Kursangebot und die damit verbundenen Qualifikationsmöglichkeiten, klären die Lerner ihr eigenes Vorwissen und ihre Lerninteressen, entwickeln die Lerner ihre Studien- und Lerntechniken und nehmen ggf. an kursübergreifenden Orientierungseinheiten teil. In der "Rezeptionsphase" empfangen die Lerner die einzelnen Einheiten (Sendungen) der Kursmaterialien eines Blocks (per Post, Rundfunk, Fernsehen, Zeitung oder über das Telefonbzw. ein PC-Netz), organisieren die Lerner ihren Lernprozess selbst, indem sie Lernzeiten und Lernorte festlegen, eignen sich die Lerner Wissen selbsttätig und ggf. unter Anwendung besonderer Lektüretechniken an und greifen sie ggf. auf Lernhilfen (Referenzwerke und personen) zurück. In der "Interaktionsphase" (die hier auch als Aufgabenlösungsphase bezeichnet wird) bearbeiten die Lerner Aufgaben verschiedenen Typs, üben die Lerner das angeeignete Wissen, indem sie es anwenden, nutzen die Lerner Lernhilfen und Beratungsmöglichkeiten, achten sie ggf. auf Termine für die Rücksendung der Aufgaben und senden sie die bearbeiteten Aufgaben an den Korrektor. In der RÜCKMELDUNGSPHASE erhalten die Lerner Rückmeldung vom Korrektor/Tutor, indem sie über Lösungen und Fehler informiert werden, vergleichen die Lerner Lösungen und eigene Ergebnisse und erhalten sie ggf. Ratschläge und Lernhilfen für nötig werdende Überarbeitungen. e-Learning: „Klassisches“ Modell für einige Komponenten des e-learning (historischer Vorläufer), insbesondere netzbasierte Kursangebote. 10 Frontalunterricht Varianten Lernen wird durch lehrergesteuerte Gespräche initiiert, die durch Anschauungsmittel unterstützt werden und vor allem der Vermittlung fachspezifischen Orientierungswissens dienen. Beispiel Gesichtspunkte zur Erklärung von Begriffen (weiterentwickelt zu Hans Aebli, Grundformen des Lehrens, Klett-Verlag, Stuttgart, 9. Aufl. 1976, S. 204) Zu welchen anderen Begriffen steht dieser Begriff in einer Beziehung? o übergeordnete Begriffe o untergeordnete Begriffe o gleichgeordnete Begriffe o konkurrierende" Begriffe Inwieweit kann auf ein Netz von Beziehungen (zwischen Begriffen) zurückgegriffen werden? o vorherige Erklärungen/Erfahrungen der Lernenden o im Zusammenhang dieser Erklärung mitschwingende" Begriffserklärungen o geplante weitere Begriffserklärungen Erwartbarer Vorbegriff" (Vorverständnis) bei den Lernenden zu diesem Begriff o folkloristischer Vorbegriff (Alltagsverständnis) o störender Vorbegriff o entwickelbarer Vorbegriff Anknüpfungspunkte bei den Lernenden o der erwartete Vorbegriff o bekannte Erfahrung („Sie kennen alle...") o bekannte oder bereits entwickelte Problemstellung, zu der sich mit diesem Begriff nun eine Lösung oder andere Beziehung entwickeln läßt o bisherige Studienerfahrungen, z.B. aus anderen Fachgebieten Hilfselemente o Beispiele o Analogien o visuelle und enaktive Veranschaulichungen (z.B. Schemazeichnung, vereinfachendes Modell) o Zwischenkonstruktionen" (z.B: Eselsbrücken") Wichtige Teilergebnisse festhalten" prägnante Formulierung Konsolidierung (Haben Sie das bis hierher verstanden?") Rückblick und Ergebnissicherung Nachträgliche Festigung (Wiederaufnahme) DIE LERNUMGEBUNG besteht im Wesentlichen aus der WANDTAFEL bzw. anderen PROJEKTIONSFLÄCHEN (z.B. für den Tageslichtprojektor), ANSCHAUUNGSMITTELN (z.B. Modellen, Landkarten, Objekten), LEHRTEXTEN (im besonderen Lehrbüchern), HAUSAUFGABEN und ÜBUNGSARBEITEN, die diese Lernumwelt ergänzen und gleichzeitig die Brücke zum Prüfungssystem bilden, sowie einer nach LEKTIONEN gegliederten homogenen Zeitstruktur. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner/Lernerinnen aufgefordert werden, individuell vom Lehrer/von der Lehrerin (oder anderen Lernenden) gestellte Einzelfragen zu beantworten und/oder Übungsaufgaben von geringer Komplexität zu bearbeiten, während der Lehrer/die Lehrerin oder andere reden, zuzuhören, dem Gesprächsverlauf aufmerksam zu folgen und Notizen anzufertigen, das Wahrgenommene und Notierte zu behalten, Regeln in den Einzelaufgaben zu entdecken, bereit zu sein, diese Regeln in anderen Aufgaben(kontexten) anzuwenden, und das Wahrgenommene durch Hausaufgaben einzuüben und abzusichern. Lerner/Lernerinnen übernehmen die Rollen der SCHÜLER, deren Rolle von den Vorgaben der Institution und der kulturellen Überlieferung geprägt ist, und der KLASSENKAMERADEN, die die zentrale soziale Bezugsgruppe bilden, welche das Anforderungsniveau und den Lernfortschritt bestimmt und zusätzliche Erfahrungen aus der außerschulischen Umwelt einbringt. Lernhelfer übernehmen die Rolle des LEHRERS, die sich im besonderen durch Professionalisierung der Ausbildung und Rollenbündelung (Erzieher, Fachvertreter, Staatsvertreter etc.) auszeichnet, und des PRÜFERS, der nicht nur Lernerfolge (oder -misserfolge) der Lerner feststellt und bewertet, sondern zugleich auch das Privileg hat, die Qualität seiner Tätigkeit (in der Regel) selbst zu bewerten. darbietender Unterricht entwickelnder Frageunterricht entwickelnder Impulsunterricht didaktische Prinzipien lehrergesteuertes Lernen Lernen im Klassenverband thematisch orientiertes Lernen In der "Orientierungsphase" (Anknüpfungsphase) formulieren die Lerner ihr Vorwissen und ihre Vorerfahrungen, sammelt der Lehrer die Beiträge der einzelnen Lerner, ordnet der Lehrer die Beiträge, grenzt der Lehrer den Themenbereich ab, antizipieren die Lerner mögliche Lernaufgaben, verknüpfen die Lerner Vorwissen und Vorerfahrungen mit Interessen, strukturieren die Lerner die zu erwartende Lerntätigkeit vor. In der "Rezeptionsphase" (hier vom Lehrer her eine Präsentationsphase) präsentiert der Lehrer neues Wissen, veranschaulicht der Lehrer abstrakte Beispiele, interessiert (motiviert) der Lehrer die Lerner, stellt der Lehrer zwischendurch Verständnisfragen, macht der Lehrer Handlungen vor, erklärt der Lehrer Begriffe, stellen die Lerner Fragen, verwendet der Lehrer Medien, verweist auf das Lehrbuch und erhalten die Lerner erste Rückmeldungen auf ihre Äußerungen. In der "Interaktionsphase" (Verarbeitungsphase) reduzieren die Lerner das Wissen auf einen Umfang, der ihnen die Aneignung ermöglicht, integrieren die Lerner das neue Wissen in ihre Erfahrung, verknüpfen die Lerner das Wissen mit persönlichem Sinn und Bedeutung, gewinnen die Lerner allgemeine Einsichten, nutzen die Lerner Hilfsmittel, gibt der Lehrer Hilfen bei Lernschwierigkeiten, und erhalten die Lerner erste Rückmeldung für ihre Arbeit. In der "Festigungsphase" (Absicherungsphase) sichern die Lerner neu erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten durch Bearbeitung von Übungsaufgaben ab, wiederholen die Lerner Kenntnisse und Fertigkeiten, entwickeln die Lerner Gewohnheiten, machen die Lerner Hausaufgaben und erhalten sie Rückmeldung auf Übungen und Aufgabenlösungen. In der Anwendungsphase übertragen die Lerner das erworbene Wissen auf neue Fälle und Gebiete, wenden die Lerner ihr neues Wissen in der Praxis an, entwickeln die Lerner Handlungs- und Lebensperspektiven, evaluiert der Lehrer den Lernprozess zumeist durch Prüfungen, und reflektieren Lehrer und Lerner Lernprozesse und -ergebnisse. e-Learning: Nach wie vor wohl vorherrschendes Modell in formellen Bildungseinrichtungen, für e-learning geradezu nicht gedacht oder geeignet. 11 Individualisierter Programmierter Unterricht Beispiel Definition Varianten Lernende eignen sich mit Hilfe programmierter Lehrtexte in kleinen Lehrschritten selbständig und individuell genau festgelegte Kenntnisse und Fertigkeiten an. LERNAUFGABEN Typische Lernaufgaben im Individualisierten Programmierten Unterricht zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell einen geeigneten Lernort aufzusuchen, sich genügend Lernzeit zu nehmen, ein vorgegebenes, in kleine Einzelschritte unterteiltes Lernprogramm (als gedruckten Text oder am Bildschirm) zu bearbeiten, sich an eine vorgegebene Abfolge zu halten oder diese selbst zu wählen, die vom Programm gegebenen Rückmeldungen wahrzunehmen, sich auf diese Weise Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, das Erlernte durch Tests und/oder einen Abschlusstest prüfen zu lassen und ggf. soziale Kontakte o.ä. selbst zu organisieren. Lerner übernehmen die Rolle des LESERS und BETRACHTERS, der selbständig Texte liest und graphische Darstellungen betrachtet, um sich auf diese Weise Wissen anzueignen, des BEWERTERS, der Rückmeldungen und Testergebnisse zur Kenntnis nimmt und daraus Folgerungen für weitere Lerntätigkeit zieht, und ggf. des PARTNERS, der mit anderen Lernern Erfahrungen austauscht. Lernhelfer übernehmen die Rolle des AUTORS, der das Lernprogramm (ggf. mit Hilfe eines AUTORENSYSTEMS) entwickelt und erprobt, des ORGANISATORS, der die technischorganisatorische Betreuung der Lernumgebung übernimmt, und des BERATERS, der die Selbstdiagnose und die Selbstkontrolle der Lerner unterstützt sowie ggf. bei Lernschwierigkeiten und emotionalen Schwierigkeiten hilft. computergestützter Unterricht programmiertes Lernen CBT (Computerbased Training) didaktische Prinzipien individualisiertes Lernen programmiertes Lernen zielerreichendes Lernen In der "Einrichtungsphase" wird das Lernprogramm von den Autoren entwickelt, von einer Versuchsgruppe erprobt, ggf. revidiert und von Lernern und/oder Beratern ausgewählt und beschafft. In der "Vorbereitungsphase" überprüfen Lerner und/oder Berater, ob die entsprechenden Lernvoraussetzungen gegeben sind, die Lernen mit dem Programm ermöglichen, eignen sich Lerner ggf. fehlende Lernvoraussetzungen (Eingangsvoraussetzungen) an und machen sich diejenigen Lerner, die noch nicht selbständig mit Lernprogrammen gelernt haben, mit dieser besonderen Lernform vertraut. In der "Interaktionsphase" lesen die Lerner vom Blatt oder vom Bildschirm den Text oder betrachten die Graphik einer Lerneinheit (eines Lernschritts), nehmen die Lerner Reaktionsvorgaben (z.B. Fragen) zur Kenntnis, reagieren die Lerner auf diese, indem sie eine Auswahlantwort wählen oder selbst eine Antwort bzw. Lösung formulieren, erhalten die Lerner daraufhin eine Rückmeldung (Verstärkung), werden die Lerner vom Programm zum nächsten Lernschritt weitergeführt. In der "Bewertungsphase" bewerten ("evaluieren") die Lerner ihren Lernerfolg selbst, indem sie einen Zwischentest oder den Endtest durchführen, entscheiden sich Lerner ggf. für eine Wiederholung einzelner Lernschritte, Programmabschnitte oder des gesamten Programms, reflektieren die Lerner ggf. mit Partnern den Lernprozess, planen die Lerner ggf. Anschlussaktivitäten. e-Learning: Weiterer Vorläufer für Komponenten des e-learning („Web-based training“). Bietet Vorteile für serialistische Lerner/Lernerinnen wegen klarer Struktur und Vorgaben (entspricht dem Sicherheits- und Orientierungsbedürfnis vor allem auch bei didaktisch eng sozialisierten Lernern/Lernerinnen. 12 Individueller Definition Lernplatz Varianten Lernende eignen sich mit Hilfe von ausge wählten und systematisch geordneten Texten und AV-Medien selbständig Begriffs- und Faktenwissen an, das zu zuvor erarbeiteten Fragestellungen in Beziehung steht. Beispiel Elemente der Lernumgebung sind die LEITFRAGEN der Lerner, die den Aneignungsprozess steuern, der thematisch ausgewählte und kognitiv geordnete MEDIENBESTAND, der LEITFADEN, der den Überblick über das Gesamtsystem vermittelt und alternative Lernwege sowie Möglichkeiten der Beratung ausweist, das STICHWORT-REGISTER, das Begriffe und Fundstellen enthält, die LITERATUR- UND MEDIENKARTEI (eine Karte pro Dokument) und der ORGANISATOR und BERATER, (Lehrer, Tutor, Mitlerner). Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell einen mit Texten, Graphiken, AV-Medien und/oder einem Computer ausgestatteten Lernort aufzusuchen, eine Leitfrage oder mehrere Leitfragen selbst zu formulieren oder aus vorgegebenen Leitfragen auszuwählen, selbständig dem eigenen Lernstil entsprechend aus dem aufbereiteten Wissensbestand geeignete Dokumente zum eigenen Lernfeld auszuwählen, diese zu nutzen und zu bearbeiten und sich so selbständig (i.d.R.) Begriffs- und Faktenwissen zu diesem Lernfeld anzueignen. Der Lerner übernimmt die Rolle des REFLEKTIERENDEN, der sein Lerninteresse und seinen Lernbedarf so weit klärt, dass er sinnvolle Leitfragen stellen kann, des ORGANISATORS, der Entscheidungen über Lernzeit, Lernort, Lerninhalte und ggf. Dialogpartner selbst trifft, des LESERS und BETRACHTERS, der selbständig Texte liest sowie Grafiken und andere AV-Medien betrachtet, und des BEWERTERS, der seinen Lernprozess kontrolliert und beurteilt. Der Lernhelfer übernimmt die Rolle des AUTORS, der die Lernumgebung einrichtet, des ORGANISATORS, der die technisch organisatorische Betreuung der Lernumgebung übernimmt, und des BERATERS, der ggf. für Lernberatung zur Verfügung steht. Selbstlernplatz Infothek didaktische Prinzipien selbsttätiges Lernen Lernen mit Medien Passung zwischen kognitiven Strukturen und den Wissensordnungen In der Einrichtungsphase richten die Autoren den Lernplatz ein, wählen die Wissensbestände aus, ordnen und bereiten diese auf, erstellen einen Leitfaden, und machen sie andere Hilfen verfügbar, die eine rasche Zugänglichkeit der Informationen sichern. In der "Klärungsphase" (hier auch als Passungsphase bezeichnet) klären die Lerner individuell oder in Gruppen ihre Fragestellungen und ihre Lerninteressen ebenso wie ihre kognitiven Strukturen und wählen die Lerner einen "passenden" Einstieg“ in den auch nach Gesichtspunkten kognitiver Theorie geordneten Wissensbestand. In der "Interaktionsphase" (hier auch als Selbstlernphase bezeichnet) wählen die Lerner mit Hilfe eines Leitfadens geeignete individuelle Lernwege aus, lesen sie Texte und betrachten Graphiken und AV-Medien, wobei sie sich Wissen in einer ihrem Lernstil und ihrer kognitiven Struktur angepassten Weise aneignen, und nehmen sie ggf. Beratung durch Berater oder Mitlerner in Anspruch. In der "Bewertungsphase" stellen die Lerner den Bezug zwischen dem angeeigneten Wissen und ihren Leitfragen her, überprüfen die Lerner individuell oder in der Diskussion mit anderen ihren Wissensstand, entwickeln sie ggf. Vorschläge zur Verbesserung der Lernumgebung und entwickeln sie ggf. Perspektiven für Anwendungen und/oder für weiteres Lernen. e-Learning: Ist im e-learning gut möglich, bislang zumeist informell, dabei Gefahr der Redundanz, des Sich-Verlierens. Viele Webportale bieten sich als „Knotenpunkte“ an, indem sie (meist themenspezifisch) Verknüpfungen bieten. Aufbereitete Informationssammlungen sind wohl noch selten, zumeist gibt es nur unstrukturierte Glossare. 13 Definition KleingruppenLerngespräch Beispiel Varianten Lernende eignen sich durch strukturier- ten Informations- und Meinungsaustausch vorwiegend Wissen über per sönliche Erfahrungen, Bewertungen und Einstellungen sowie Wünsche an. Gesprächskreis, - runde Rundgespräch TZI (Themenzentrierte Inter- aktive Methode) Die Lernumgebung besteht aus dem GESPRÄCHS-THEMA, das möglichst klar Im Rahmen der Problemanalyse können zu bestimmen ist, Fragenkataloge in Form von Checklisten dem MODERATIONS-LEITFADEN, der ggf. zu hilfreich sein. Nützliche Fragen sind etwa: entwickeln ist, -> Welche Forderungen werden maxi den GESPRÄCHSREGELN, die mündlich oder mal/minimal an die Problemlösung gestellt? schriftlich vereinbart sein können, und -> In welche Teilprobleme ist das Haupt den ARGUMENTEN, die ggf. gegliedert nach problem zerlegbar? GESPRÄCHS-RUNDEN vorgetragen und be-> In welcher Situation ist das Problem legt werden. entstanden? Typische Lernaufgaben -> Welche Bedeutung hat die Lösung des zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert Problems? werden, in Kleingruppen -> Was geschieht, wenn das Problem sich aktiv am Informations- und Meinungsausnicht/später gelöst wird? tausch zu beteiligen, -> Gibt es wichtigere Probleme als dieses? auf Vorteilsnahmen zu verzichten und die -> Ist das Problem oder sind Teile des Gesprächsregeln einzuhalten, Problems bereits gelöst worden? zu Metakommunikation bereit zu sein, Was sagt die Wissenschaft, was die ggf. eine gesonderte Rolle in der Gruppe (MoPraxis? derator, Protokollant, Organisator) zu über-> Sind die in der Aufgabenstellung benutznehmen, ten Begriffe eindeutig? sich dabei Wissen vorwiegend über persönliche -> Sind irgendwelche Richtlinien bei der Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen anProblemlösung zu beachten? Welche? zueignen, -> Ist die Personengrup so die anderen Gruppenmitglieder kennen zu pe/Interessentengruppe genau bestimmt, lernen die vom und an der Ergebnissicherung (z. B. ProtoProblem betroffen ist, das Problem verurkollerstellung) mitzuwirken. sacht hat und zur Problemlösung Lerner übernehmen die Rollen des beitragen kann? GRUPPENMITGLIEDS, das als gleichberechQuelle: Thiele, Albert: Karriereziele verwirk- tigter Teilnehmer Beiträge leistet und zur lichen, Landsberg/Lech 1988, Verlag MoKenntnis nimmt, derne Industrie. MODERATORS, der das Gespräch leitet, PROTOKOLLANTEN, der die Gesprächsergebnisse festhält und zwischenzeitlich sowie am Ende mündliche oder schriftliche Zusammenfassungen bzw. Protokolle erstellt, und ggf. eines STIMULATORS, der besondere Gesprächsreize einbringt. Lernhelfer werden in der Regel nicht benötigt. Wo dies doch z.B. aus Gründen der Öffentlichkeit oder beim Gesprächstraining der Fall ist, übernehmen professionelle oder semiprofessionelle Helfer die Rollen des MODERATORS, des SUPERVISORS (vor allem beim Gesprächstraining) und in seltenen Fällen auch die des PROTOKOLLANTEN. Lernen durch wechselseitigen Erfahrungsaustausch Lernen durch strukturierte Gespräche In der "Vorbereitungsphase" bilden die Lerner eine Gesprächsgruppe (gruppieren), vereinbaren die Lerner Regeln für die Gesprächsführung und den Gesprächsablauf (z.B. eine Gliederung nach "Runden"), vereinbaren die Lerner das Gesprächsthema bzw. Gesprächsziel, entwickeln die Lerner Gesprächsideen, entscheiden die Lerner ggf. über eine Moderation, wählen die Lerner ggf. einen Protokollanten aus (auswählen) und entwickeln ggf. einen ModerationsLeitfaden. In der "Interaktions- (oder Kommunikations-) Phase" kommunizieren die Lerner miteinander, argumentieren die Lerner und belegen ihre Argumente, thematisieren die Lerner ihre Gefühle und Stimmungen, thematisieren die Lerner ggf. Störungen, organisieren die Lerner das Gespräch (ggf. nach "Runden"), formulieren die Lerner ggf. Konsens und/oder Beschlüsse, moderiert der Moderator das Gespräch und protokolliert der Protokollant ggf. das Gespräch. In der "Bewertungsphase" die auch zwischenzeitlich angesetzt sein kann (BLITZLICHT), entscheiden die Lerner über Bewertungskriterien, reflektieren und evaluieren die Lerner Gesprächsverlauf und Gesprächsergebnisse, können Moderator oder Protokollant ggf. die Gesprächsergebnisse zusammenfassen, transferieren die Lerner ihre Erfahrungen auf neue Situationen und entwickeln sie ggf. Perspektiven für weiterführende Aktivitäten. e-Learning: Typisch für „chat“ und Forum, allerdings bislang wenig Ansätze der Strukturierung 14 didaktische Prinzipien Lernausstellung Varianten Lernende eignen sich an offenen Lernorten Wissen an, indem sie ausgestellte und kommentierte Objekte oder Abbildungen in bestimmter Reihenfolge betrachten und ggf. handhaben. Beispiel DIE LERNUMGEBUNG besteht aus dem AUSSTELLUNGS-LEITFADEN bzw. dem Leit-STAND, der über Konzept, Gliederung und mögliche Pfade informiert, den STÄNDEN, welche die organisatorischen Einheiten von Lernausstellungen bilden, den AUSSTELLUNGS-STÜCKEN und zusätzlichen INFORMATIONSMITTELN, die jeder Stand präsentiert, den PFADEN, auf denen die Lernausstellung durchlaufen werden kann, und den RUHEZONEN, in denen Lerner ausruhen und nachdenken können. LERNAUFGABEN Typische Lernaufgaben in der Lernausstellung zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell oder in Kleingruppen einen geeigneten offenen Lernort (Museum, Zoo etc.) aufzusuchen, sich ggf. einen Ausstellungsleitfaden zu besorgen und sich mit seiner Hilfe einen Überblick über die Ausstellung zu verschaffen, die ausgestellten Objekte zu betrachten, Kommentare zu lesen und ggf. die Objekte zu handhaben, dabei einer sinnvollen vorgegebenen oder eigenen Reihenfolge zu folgen, die eigenen Wahrnehmungen zu reflektieren und ggf. mit anderen Lernern über das Wahrgenommene zu kommunizieren. Lerner übernehmen die Rollen des PLANERS, der sein Lerninteresse klärt und seinen Pfad durch die Ausstellung festlegt, des AKTIVEN BEOBACHTERS (Besuchers) und des REFLEKTIERENDEN, der die gewonnenen Erkenntnisse und das erworbene Wissen in den eigenen Erfahrungszusammenhang einordnet. Lernhelfer übernehmen die Rollen von AUTOREN, die das Konzept der Ausstellung entwickeln und die Stände einrichten, und von BERATERN, die als "Führer", "Standpersonal" oder "Wärter" Orientierung, Information und Lernhilfen vermitteln. didaktische Prinzipien Messe Aktivmuseum ambulantes Lernen Lernen an "ausgestellten Stücken" Phasen: In der "Einrichtungsphase" entwickeln Autoren Konzept und Gliederung der Lernausstellung, wählen die Autoren bzw. Aussteller Stücke aus und entwickeln ggf. das Konzept und das Design der Stände (auswählen), stellen sie Leitfaden und Informationsmittel her, richten die Stände ein, indem sie Stücke und Zusatzinformationen einander zuordnen), und trainieren sie ggf. Berater (Standbetreuer). In der "Orientierungsphase" verschaffen sich die Lerner (mit Hilfe des Leitfadens oder am Leitstand) einen Überblick über die Lernausstellung (orientieren, vorstrukturieren), klären die Lerner ggf. mit Mitlernern ihre Lerninteressen und planen sie ihren Pfad durch die Ausstellung. In der "Interaktionsphase" (Wanderphase) wählen die Lerner einen Pfad aus (auswählen), um Stände zu besuchen, betrachten sie Stücke und beobachten ggf. Prozesse, lesen sie ggf. Zusatzinformationen, kommunizieren sie ggf. mit Beratern und anderen Besuchern, eignen sie sich dabei selbsttätig Wissen an (aneignen), machen sie sich ggf. Notizen (notieren) und reflektieren sie in selbstgewählten Pausen ihren Lernprozess. In der "Bewertungsphase" (am Schluss oder als "Zwischenbilanz" in der Mitte) evaluieren die Lerner individuell oder mit Partnern die Lernausstellung und ihre Lernprozesse, stellen sie einen Rückbezug zu ihren Interessen und Vorerfahrungen her (rückkoppeln, reflektieren), geben sie ggf. Autoren bzw. Ausstellern Rückmeldung und entwickeln sie ggf. Perspektiven für Anschlussaktivitäten. e-Learning: Im Bereich der Museumsportale bereits sehr elaborierte Beispiele, ist als Element in den Autorentools für Lernplattformen noch nicht erkennbar. http://www.viamus.de 15 16 Lerndialog Varianten Lernende führen mit anderen Personen ausführliche und geordnete Zwiegespräche, um Erkenntnisse über sich und ihre Beziehungen zur Umwelt zu erlangen. sokratischer Dialog therapeutischer Dialog dialektisches Gespräch didaktische Prinzipien dialogisches Lernen entdeckendes Lernen Beispiel LEHRERFRAGEN UND -AUFFORDERUNGEN (nach Drake 1993) * Fragen nach beobachteten Sachverhalten (Merkmalen) von x ** Fragen nach erinnerten Sachverhalten (Merkmalen) von x Fragen nach gemeinsamen Merkmalen und Unterschieden von x (und y) Fragen nach Folgerungen aus x (und y) Fragen nach Ordnungen, in denen x steht Fragen nach Ursachen von x Fragen nach Wirkungen von x Fragen nach Anwendungsmöglichkeiten von x Fragen nach Bewertungen von x Fragen nach weiterführenden Überlegungen in bezug auf x Drake, Larry, Overview of Teaching Strategies. Module. (1991) FRAGEN-TYPOLOGIE Im Alltag kommt es darauf an, situativ zu prüfen, welche der folgenden Fragearten den eigenen Gesprächs- und Fragezielen am dienlichsten sind: - Informationsfrage: Der Fragende weiß etwas nicht und vermutet, dass sein Wissensdefizit vom Befragten ausgeglichen werden kann. - Einschätzungsfrage und Einstellungsfrage: Der Fragende zielt hier bei auf die persönlichen Meinungen, Einstellungen und Einschätzungen seines Gegenübers. "Wie schätzen Sie die Zukunft des schnellen Brüters ein?" "Was halten Sie von einem schwarz-grünen Bündnis auf Bundesebene?" - Diagnostische Frage: Hierbei will man vom Befragten in Erfahrung bringen, wie er die Lage sieht, welche Probleme er für bedeutsam hält und welche Ursachen seiner Meinung nach zu diesen Problemen geführt haben. - Problemlösungsfrage: Der Gesprächspartner wird befragt nach neuen Ideen, Lösungsvorschlägen, Konzepten, Maßnahmen u. ä. zur Verbesserung der gegebenen (unbefriedigenden) Situation. - Entscheidungs- oder Alternativ-Frage: Diese Frage verlangt eine bestimmte Stellungnahme vom Befragten, ob er sich für die Lösung A oder B entscheidet, ob er dieses oder jenes bevorzugt oder ablehnt. - Weiterführende Frage: Diese Frage soll auf die Konsequenzen des Gesagten (etwa eines Lösungsvorschlags) aufmerksam machen und den Befragten zum Weiterdenken anregen bzw. Schwachstellen offen legen. "Welche Folgen ergeben sich daraus in finanzieller/psychologischer/ökologischer Hinsicht...? - Prüfende Frage. Der Fragende weiß etwas und will sich vergewissern, ob der Befragte es auch weiß. Oftmals als unfaires Mittel eingesetzt, um die Sachkompetenz des anderen zu schmälern. - Sokratische Frage: Der Fragende weiß etwas und ist sicher, dass der Befragte es nicht weiß. Sokrates begründete die sogenannte Mäeutik (Hebammenkunst), bei der durch Fragen und beharrliches Weiterfragen "das Wissen/oder Nicht-Wissen aus dem Gesprächspartner herausgehoben werden soll" (wie die Hebamme das Neugeborene aus der Mutter heraushebt). Häufig zielten die sokratischen Fragen darauf, den Gegner in Beweisnot zu bringen (in die sogenannte Aporie) und ihm die Einsicht zu vermitteln, dass er in Wahrheit nichts weiß. - Ja-Frage: Hierbei wird die Frage so gestellt, dass der Befragte nur mit "Ja" antworten kann. Die für den Verlauf von Verkaufgesprächen wichtige Hypothese: Ein Ja-Sagen begünstigt ein weiteres Ja-Sagen! - Suggestiv-Frage: Der Fragende bringt durch seine Fragestellung seine eigene Meinung zum Ausdruck. Beispiel: "Sie sind sicherlich auch der Meinung, dass..." Vorsicht: Eine Suggestiv-Frage reizt zum Widerspruch! - Kontrollfrage: Sie soll sicherstellen, dass das Gesagte auch verstanden wurde. Beispiel: "Habe ich Sie recht verstanden, wenn..." - W-Fragen: Allgemein kann systematisches Fragen so gekennzeichnet werden, dass ein vorher "unbefragter" Gegenstand, zum Beispiel "Lernen" nach bestimmten Aspekten befragt wird. Erweitert man den auf Aristoteles zurückgehenden Katalog von W-Fragen, so sieht eine systematische Befragung des Gegenstandes "Lernen" folgendermaßen aus: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leitfragen Aspekte (des "Lernens") --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wer? Person ("Lernender") Was? Gegenstand ("Lerninhalt") Wie? Art und Weise ("Lernstil") Wo? Ort ("Lernort") Wann? Zeit ("Zeitpunkt und Dauer des Lernens") Warum? Motiv ("Lernmotiv") Wozu? Ziel ("Lernziel") Womit? Mittel ("Lernmittel") --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit Hilfe dieser Leitfragen lassen sich die Facetten eines Gegenstandes relativ leicht benennen und sodann - je nach Zielsetzung – weiter analysieren. Sie sind hilfreich bei der Sammlung und Gliederung von Informationen, bei der Definition von Problemen, bei der Entwicklung von Checklisten, bei der Vorbereitung von Seminaren, Besprechungen, Vorträgen, usw. als Merkstütze für den inneren Aufbau von Artikeln, Berichten, u. ä. speziell für die Arbeitsfelder des Journalisten. Quelle: Thiele, Albert: Karriereziele verwirklichen, Landsberg/Lech 1988, Verlag Moderne Industrie FRAGEN-LEITFADEN Stellen Sie jeweils nur e i n e Frage Fragen Sie knapp, präzise und leicht verständlich Verbinden Sie eine freundliche Grundhaltung mit Konsequenz in der Sache Geben Sie dem Befragten Zeit zum Nachdenken. Formulieren Sie die Frage gege- DIE LERNUMGEBUNG besteht aus den jeweiligen Dialog-PARTNERN, dem MEDIUM, in der Regel dem gesprochenen Wort, das direkt oder indirekt (über Telefon) den Dialog vermittelt, und den Dialog-REGELN, die beiden Partnern bekannt sein müssen. Beim computergestützten Lerndialog übernimmt der Computer die Funktionen "Partner" und "Medium", wobei auch graphische Komponenten den Dialog bestimmen können. LERNAUFGABEN zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, mit einem Gesprächspartner ein offenes und z. B. durch vorher vereinbarte Fragestellungen strukturiertes Zwiegespräch zu führen, dabei vorher vereinbarte oder "offenkundige" Gesprächsregeln einzuhalten, insbesondere auf (lehrhafte) Monologe ohne Partnerbezug zu verzichten und die Äußerungen des Partners konstruktiv aufzugreifen, und so Erkenntnisse über sich selbst und die eigene Umwelt zu gewinnen. Lerner übernehmen wechselseitig die Rolle von (sprachlich handelnden) Dialog-PARTNERN, die den Dialogregeln entsprechend (im "strengen" Dialog) miteinander sprachlich kommunizieren, um die eigene Position und die des jeweiligen Partners aufzuklären und damit Lerntätigkeiten in Gang zu setzen, die auf Bewusstseinsbildung gerichtet sind. Lernhelfer kommen meistens nicht vor, da die Lerner diese Funktionen wechselseitig übernehmen. Nur beim "asymmetrischen" Lerndialog übernimmt ein Lernhelfer die Rolle des DIALOGFÜHRERS, der als dominanter Dialogpartner (den Sokrates mit einem "Geburtshelfer" vergleicht) in methodischer Weise Wissen und (Selbst-)Erkenntnis aus dem Lerner/Partner herausholt ("entbindet"). IN DER KLÄRUNGSPHASE, die auch als Phase der FRAGESTELLUNG bezeichnet wird, vereinbaren die Dialogpartner ein Thema, arbeiten sie den Einstieg in die Fragestellung bzw. in das Problem deutlich heraus (einsteigen, klären) und formulieren sie das Problem ggf. schriftlich. IN DER INTERAKTIONSPHASE, die auch als Phase der PRODUKTIVEN VERUNSICHERUNG bezeichnet wird, sammeln die Lerner/Partner ihr vorhandenes Wissen, bemühen sie sich darum, Wissen von Scheinwissen zu unterscheiden, verweisen sie sich auf Widersprüche hin (widersprechen), fordern sie wechselseitig Erklärungen und Definitionen (auffordern), problematisieren sie sprachliche Formulierungen und Behauptungen, erfragen (fragen) sie wechselseitig Belege für Behauptungen und halten sie unwiderlegbares Wissen fest (festhalten). IN DER ANWENDUNGSPHASE, die hier auch als Phase der EIN-SICHT bezeichnet wird, vereinbaren die Lerner/Partner, was als Erkenntnis zusammenfassend festzuhalten ist (zusammenfassen), halten sie Erkenntnislücken fest (festhalten), formulieren sie das Ergebnis ihres Dialogs, evaluieren sie ggf. die Qualität des Dialogs und entwickeln sie Perspektiven für die Anwendung ihrer Erkenntnis. 17 e-Learning: Ein frühes Beispiel (1966) war das Programm „Eliza“ von Joseph Weizenbaum, mit dem eine Gesprächstherapie nach Rogers (parodistisch gedacht, von vielen seiner Studierenden aber ernst genommen) simuliert wurde. Im Internet sind Nachfolgeprogramme in Fülle vorhanden. Die Automatisierung widerspricht eigentlich dem Ansatz menschlicher Kommunikation. http://de.wikipedia.org/wiki/ELIZA http://www.uib.no/People/hhiso/eliza/index.htm Lernkabinett Varianten Lernende eignen sich durch reale Tätigkeit in speziell eingerichteten und didaktisch besonders aufbereiteten Lernumwelten theoretisches und praktisches Wissen aus mehreren Handlungsperspektiven an. didaktische Prinzipien Beispiel Lernen in elementaren Situationen mehrperspektivisches Lernen zweckfreies Lernen DIE LERNUMGEBUNG besteht aus dem LEITFADEN, der eine Übersicht über die Elemente, Regeln und Handlungsmöglichkeiten des Lernkabinetts bietet, den OBJEKTEN, die den zu vermittelnden Kompetenzen entsprechen, den WERKZEUGEN und ARBEITSHILFEN (job aids), welche die Ausführung der Handlungen unterstützen, und den auf die Wissensgebiete bezogenen INFORMATIONSMITTELN. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell oder in kleinen Gruppen eine didaktisch aufbereitete Lernumgebung aufzusuchen, dort aus einem Katalog von LernaufgabenVorschlägen auszuwählen und die ausgewählte Aufgabe zu bearbeiten, sodann neue Lernaufgaben selbst zu erfinden, dabei die Lernumgebung weiterzuentwickeln bzw. umzugestalten, die eigene Tätigkeit zu bewerten, zu reflektieren und ggf. mit anderen Lernern über die Tätigkeit zu kommunizieren und sich dabei theoretisches und praktisches Wissen anzueignen. In der "Einrichtungsphase" wird die "aufklärende" und elementare Lernumgebung vom Autor mit OBJEKTEN, WERKZEUGEN, ARBEITSHILFEN und INFORMATIONSMITTELN so eingerichtet, dass alle für die Kompetenzentwicklung erforderlichen Lerntätigkeiten der Lerner möglich sind (einrichten), wird vom Autor ein LEITFADEN erstellt (entwickeln, herstellen) und werden ggf. ORGANISATOREN und BERATER auf ihre Aufgaben vorbereitet (vorbereiten). In der "Orientierungsphase" werden die Lerner in die elementare Lernumgebung so eingeführt, dass sie mögliche Handlungsziele, Umgangsformen und Sichtweisen erfahren (orientieren, einführen), diskutieren die Lerner ihre Handlungsmöglichkeiten, klären sie ihre Lerninteressen, machen sie sich mit dem didaktischen Modell vertraut, nach dem sie lernen, und planen sie ihre Lerntätigkeit. In der "Interaktionsphase" nutzen die Lerner die Lernumgebung für selbstgesetzte Lernzwecke, LERNERROLLEN wechseln sie dabei zwischen den Gemäß dem für das Lernkabinett charakteristiRollen "Betroffener", "Handelnder", schen "Mehrperspektivenprinzip" übernehmen "Bezugsgruppen-Mitglied" und Lerner die Rolle "Schiedsrichter"(interagieren), des HANDELNDEN (in entlasteten Situatio- erzeugen die Lerner ggf. Produkte nen), (entwickeln, herstellen) des (von den Handlungen der Mitlerner) und diskutieren sie den sozialen Sinn BETROFFENEN, ihrer Tätigkeit. des GRUPPEN-MITGLIEDS ("bedeutsamen In der "Anwendungsphase" (GestaltungsGegenübers") phase) und des SCHIEDSRICHTERS ("verallgemei- verändern die Lerner ihre Lernumgenerten Anderen"). bung, entwickeln sie weiter und gestalten sie um, Lernhelfer übernehmen die Rolle erproben die Lerner neue Handlungs des AUTORS, der die Lernumgebung konzimöglichkeiten, piert und gestaltet, eignen sie sich ggf. dafür erforderliche des ORGANISATORS, der ihre NutzungsKompetenzen an (aneignen) weisen durch Lerner koordiniert und verwal- und entwickeln sie ggf. die Organisatitet, und on weiter. des BERATERS, der im Falle von Orientierungs- oder Lernschwierigkeiten Hilfen anbietet. e-Learning: Dazu sind mir keine Beispiele bekannt; wie beim Arbeitsunterricht müssten Komponenten der Dokumentation von praktischen Tätigkeiten eingebaut sein. 18 Lernkonferenz Varianten Lernende kommen mit anderen zusammen, um sich gegenseitig in Vorträgen, Diskussionen und mit anderen vorberei- teten Beiträgen (aktuelles) Deutungs- oder Problemlösungs- wissen zu vermitteln. Beispiel Die Lernumgebung besteht aus der ANKÜNDIGUNG, die Vorinformationen über die Konferenz enthält, dem KONFERENZPROGRAMM, das über Ort, Zeit und Thema informiert, den KONFERENZUNTERLAGEN (ggf. mit Kurzfassungen von Vorträgen, mit Thesen, Adressen und Informationen über flankierende Aktivitäten), den SITZUNGEN, die als Plenarveranstaltungen, Arbeitsgruppen oder freie Aktivitäten (z.B. Ausstellungen und Präsentationen) stattfinden, dem KONFERENZBERICHT, der ggf. an die Teilnehmer verschickt wird und ggf. einem RAHMENPROGRAMM (z.B. Ausstellungen oder Unterhaltung). Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, in einer Gruppe vorab individuell Konferenzunterlagen zu bearbeiten, ggf. einen eigenen Beitrag / eigene Beiträge zu erstellen, die Zusammenkunft, die die Lernkonferenz bildet und die wenige Stunden bis mehrere Tage dauern kann, zu besuchen, an Vorträgen und anderen eingebetteten Lernformen teilzunehmen, dabei beiläufigen Lernprozessen Beachtung zu schenken, die Konferenz gründlich nachzubereiten und sich so vor allem aktuelles Problemlösungs- und Deutungswissen anzueignen. Lerner übernehmen die Rolle des (Konferenz-)TEILNEHMERS, der sich aus Unterlagen und Referaten sowie durch Teilnahme an Diskussionen selbsttätig Wissen aneignet, ggf. von REFERENTEN, die aus den Reaktionen auf Beiträge lernen, ggf. des AUSSTELLERS, der seine Projekte oder Produkte (z.B. auf Tafeln) präsentiert und aus den Reaktionen anderer darauf lernt, und ggf. von PROTOKOLLANTEN, die am Konferenzbericht mitwirken. Lernhelfer, die ggf. gleichzeitig auch Lerner sind, übernehmen die Rolle der ORGANISATOREN, die an der Konferenzorganisation mitwirken, des PUBLIKUMS, das auf Beiträge und Präsentationen reagiert, der REFERENTEN, die ggf. Expertenwissen einbringen, und der PROTOKOLLANTEN, die die Ergebnisse der einzelnen Sitzungen oder der ganzen Konferenz für den Konferenzbericht schriftlich festhalten. Kongress Symposium Tagung didaktische Prinzipien kollegiales Lernen beiläufiges Lernen In der "Einrichtungsphase" gestalten die Organisatoren / ein Team die Lernumgebung, legen sie die Rahmenbedingungen der Lernkonferenz fest, sammeln sie Beiträge, verschicken sie Unterlagen und vergeben ggf. Aufträge. In der "Vorbereitungsphase" bereiten sich die Lerner auf die Konferenz vor, insbesondere durch Lektüre der Unterlagen ("vorbereiten", "aneignen"), "planen" Lerner ihre Teilnahme an einzelnen Vorträgen, Arbeitsgruppen, Präsentationen und flankierenden Aktivitäten und bereiten sie ggf. eigene Beiträge und Referate vor. In der "Orientierungsphase" klären die Lerner ihre Interessenschwerpunkte an der Lernkonferenz, orientieren sie sich über Angebote, anwesende Personen und Arbeitsgruppen (an denen sie ggf. teilnehmen), werden sie (z.B. durch ein Grundsatzreferat) in thematische und organisatorische Aspekte der Lernkonferenz eingeführt (einführen), planen sie ihr persönliches Lernprogramm (z.B. Termine, Besuch von Vorträgen, Teilnahme an Arbeitsgruppen etc.) und diskutieren sie ihren Plan mit Partnern. In der Interaktionsphase (Sitzungsphase) nehmen die Lerner an ausgewählten Sitzungen teil und eignen sich dabei Wissen an (teilnehmen, aneignen,anhören,interagieren), notieren sie wichtige Beiträge, diskutieren sie mit Mitlernern und Referenten, nehmen sie ggf. an informellen Gesprächen sowie am Rahmenprogramm teil und konsultieren sie ggf. Berater oder Partner. In der (am Ende liegenden oder zwischenzeitlich eingeschobenen) "Bewertungsphase" reflektieren die Lerner ihren Lernprozess, diskutieren sie Prozess und Ergebnisse mit anderen, erheben Lernhelfer / Organisatoren Daten über Verlauf und Wirkungen der Lernkonferenz, üben Lernhelfer/Organisatoren ggf. `Manöverkritik (evaluieren) und entwickeln Lerner und Lernhelfer / Organisatoren Perspektiven für die Nachbereitung der Konferenz und für Anschlussaktivitäten. 19 e-Learning: Entspricht den Programmen für Projektmanagement und Videokonferenz. http://www.web2con.com/ Lernnetzwerk Lernende erzeugen neues Wissen, insbesondere über innovative Praxisbereiche, und vermitteln es sich wechselseitig und uneigennützig mit Hilfe von zumeist schriftlichen Mitteilungen. Beispiel 20 didaktische Prinzipien Erfahrungsring computer conferencing video conferencing mail-box DIE LERNUMGEBUNG besteht aus: einer koordinierenden REDAKTION, die Wissen empfängt, kopiert, dokumentiert und verteilt, ohne es jedoch zu bewerten oder auszuwählen, einem REGISTER, das Definitionen des zusammengetragenen Wissen enthält, einer KARTEI (Mitgliederadressen und Kompetenzbeschreibungen), die von den Netzwerk-Teilnehmern vereinbarten (Verhaltens-)REGELN und dem Netzwerk-RUNDBRIEF, der als Rundschreiben, als Zeitschrift oder als Mailsystem (ggf. mit spezieller Software) gestaltet sein kann. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, in einer Gruppe Wissen zum gemeinsamen Interessenbereich zu erzeugen, das erzeugte Wissen uneigennützig und für alle Teilnehmer in gleicher Weise zugänglich in das Netzwerk einzuspeisen (über schriftliche Mitteilungen bzw. Telekommunikation), von anderen Teilnehmern erzeugtes Wissen wahrzunehmen und zu erproben, hierüber dem Autor/den Autoren Rückmeldung zu geben, sich an die für das Netzwerk vereinbarten Regeln zu halten und ggf. Vorschläge zur Verbesserung des Netzwerks einzubringen. Lerner übernehmen die Rolle des gleichberechtigten NetzwerkGRUPPENMITGLIEDS, das Wissen in das Netzwerk eingibt, empfängt, erprobt und bewertet sowie an der organisatorischen Gestaltung des Netzwerks mitwirkt, und ggf. auch Rollen als KOORDINATOR, EXPERTE und BERATER. e-Learning: Beispiele sind Foren und news-groups http://www.prayogpariwar.net/ http://www.farabis.net Varianten erfahrungsbezogenes Lernen wechselseitiges Lernen Aktivierung von dynamischem Wissen In der EINRICHTUNGSPHASE richten die ersten Lerner (Initiatoren) das Lernnetzwerk ein, definieren die Initiatoren den Lernbereich, vereinbaren die Lerner/NetzwerkMitglieder Spielregeln, richten die Initiatoren eine Koordinationsstelle ein und gewinnen sie weitere Lerner/Netzwerk-Mitglieder. In der "Interaktionsphase" (die auch als Phase experimenteller Mitarbeit bezeichnet wird) erfahren alle Lerner, was sie von allen anderen lernen können, formulieren Lerner Fragen und erbitten Ratschläge, machen Lerner selbst Vorschläge, erproben Lerner die erhaltenen Ratschläge experimentell, melden Lerner das Ergebnis ihrer Erprobung zurück, machen Lerner ggf. Vorschläge zur (Um-)Organisation des Netzwerks und koordinieren die Lerner ihre Lernprozesse. In der "Verbreitungsphase" wird der Wissensbestand durch "Schneeballeffekte" verdichtet, erweitert und verbessert sowie nicht genutztes Wissen automatisch ausgesondert, so dass es am Ende dieser Phase zur Ausdifferenzierung und Einrichtung neuer Netzwerke kommen kann. Lernprojekt Lernende wirken an Projekten innovativer Praxis mit, um die Anwendung erworbenen Wissens in realen Situationen und Institutionen zu erlernen und zur Verbesserung einer Praxis beizutragen. Varianten didaktische Prinzipien innovatives Lernen fächerübergreifendes (interdisziplinäres) Lernen 21 Beispiel Beim Lernprojekt besteht die Lernumgebung aus dem Praxis-FELD, in dem das Projekt angesiedelt ist, einer LERNMATRIX, die erlernbare Kompetenzen auflistet, dem PROJEKTPLAN, der Projekt-DOKUMENTATION, dem Projekt-BERICHT, den Instrumenten der ÖFFENTLICHKEITSARBEIT und den (materiellen oder ideellen) PRODUKTEN. LERNAUFGABEN IM LERNPROJEKT Typische Lernaufgaben für Lernprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, in kleinen Gruppen sich vorab Orientierungswissen über den Lebensbereich anzueignen, in dem das Projekt angesiedelt ist, an einem (innovativen) Praxisprojekt arbeitsteilig aktiv mitzuwirken, Wissen einzubringen, anzuwenden, zu prüfen und ggf. zu modifizieren, im Projekt mit Partnern - auch anderer Disziplinen - zu kooperieren, neues Wissen anzueignen und neues Wissen zu vermitteln, Lernprozesse aus dem Projekt zu reflektieren und abzusichern und Verantwortung für die Projektfolgen zu übernehmen. LERNERROLLEN IM LERNPROJEKT Beim Lernprojekt übernehmen Lerner die Rolle des verantwortlich HANDELNDEN (Praktikers) und des KOLLEGEN, der mit anderen ebenfalls verantwortlich Handelnden kooperiert. LERNHELFERROLLEN IM LERNPROJEKT Beim Lernprojekt übernehmen Lernhelfer die Rolle von KONTAKTPERSONEN im Praxisfeld, die dort verantwortlich handeln und Lerner in die Projektarbeit einbeziehen, von EXPERTEN, die in besonderen Fällen herangezogen werden, um Spezialwissen in die Projektarbeit einzubringen, und von PROJEKTLEITERN, die für die Arbeitsorganisation, die Dokumentation, das "Monitoring" und die Evaluierung des Projekts verantwortlich sind. Phasen: In der "Vorbereitungsphase" eines Lernprojekts wird die Projektleitung eingerichtet (einrichten), entscheidet die Projektleitung über Thema und Konzept, regelt die Projektleitung die Zertifikatsproblematik, lädt sie Interessenten zu Vorgesprächen über eine Projektteilnahme ein (einladen), informiert sie Interessenten über die Bedingungen der Mitarbeit, nimmt sie Kontakte mit Institutionen auf (kontaktieren) und entscheiden sich Lerner für eine Teilnahme (entscheiden). In der "Planungsphase" eines Lernprojektes bilden Lerner Gruppen und legen deren Aufgaben fest (gruppieren), entscheiden die Gruppen über Ziele und erstellen Pläne (planen), können sich Lerner ggf. fehlende Voraussetzungen/Kompetenzen aneignen, diskutieren die Lerner mit den Betroffenen im Feld ihre Pläne, vereinbaren Lerner, Projektleitung und Betroffene die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit und ihrer Lerntätigkeit und ggf. die Qualität der im Rahmen des Projekts zu erstellenden Produkte. In der "Interaktionsphase" (Durchführungsphase) eines Lernprojekts bearbeiten die Lerner/Projektmitarbeiter Teilprojekte, eignen sie sich ggf. ad hoc fehlende Kompetenzen an (aneignen), beschaffen Lerner Informationen, diskutieren Lerner (ggf. mit der Leitung) den Projektfortschritt, evaluiert die Projektleitung den Projektfortschritt, stellen die Lerner Projektdokumente her (herstellen), übernimmt die Projektleitung die Supervision der Untergruppen und wird von allen Öffentlichkeitsarbeit geleistet (publizieren). In der "Bewertungsphase" eines Lernprojektes (die zwischenzeitlich oder am Ende liegen kann) evaluieren und reflektieren Lerner Projektfortschritt, Lernerfolg und Wirkungen auf das Praxisfeld, analysieren Lerner und Lernhelfer auftretende Schwierigkeiten, versuchen die Lerner, ihre Erfahrungen zu generalisieren, erstellen die Lerner Projektberichte (publizieren), diskutieren diese mit Betroffenen und/oder in der Öffentlichkeit und entwickeln Lerner und Projektleitung Pläne für Folgeaktivitäten (planen). e-Learning: Auch hier fehlt die Komponente der praktischen Tätigkeit, ansonsten können Programme für Projektmanagement das verteilte Arbeiten koordinieren. http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-02/3-02review-kassel-d.pdf Lernsimulation Varianten Lernende übernehmen (oft spielerisch) Rollen und/oder betätigen sich in simulierten Umwelten, um vor allem Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit in lebensnahen, jedoch entlasteten Situati- onen zu entwickeln und zu trainieren. 22 Planspiel Rollenspiel Simulatortraining didaktische Prinzipien spielendes Lernen antizipatorisches Lernen Beispiel DIE LERNUMGEBUNG IN DER SIMULATION besteht aus dem SPIELMATERIAL, das aus Objekten, symbolischen Figuren (Spielfiguren), Abbildungen, Texten oder Computer-Software besteht, den (Spiel-)REGELN, d.h. den Vorschriften bzw. Vereinbarungen, welche die erlaubten Handlungen der Lerner festlegen, zusätzlichen HINTERGRUNDINFORMATIONEN, die von der Spielleitung vorgegeben oder von außen beschafft werden können, und BEWERTUNGSKRITERIEN für Erfolg/Gewinn bzw. Misserfolg/Verlust. DIE LERNERROLLE IN DER SIMULATION ist die - des SPIELERS, der in einer von Handlungsdruck entlasteten und reduzierten Lernumgebung Strategien entwickelt und anwendet, um Erfolg zu erzielen bzw. zu gewinnen. LERNHELFERROLLEN IN DER SIMULATION sind die des des AUTORS, der die Spielidee entwickelt, durch modellhafte Rekonstruktion eine simulierte Umwelt erzeugt und Spielregeln festlegt, und der SPIELLEITUNG, die Erfahrung in der Spieldurchführung hat, die in das Spiel einführt, die Einhaltung der Regeln überwacht, ggf. auch Zusatzereignisse/Zusatzinformationen liefert und an der Evaluierung mitwirkt. Phasen: In der EINRICHTUNGSPHASE können Lerner oder Lernhelfer vorhandene Simulationen auswählen, oder analysieren Lernhelfer/Autoren Merkmale der Lerner und der Lernumgebung, rekonstruieren sie ein Modell von Umgebungen, Rollen, Situationen und Regeln, d.h. sie "entwickeln" ausgehend von einer Spielidee die Simulation, lassen sie das Modell von Experten auf Realitätsnähe evaluieren und stellen sie eine spielfähige Fassung und das Spielmaterial her. In der Rezeptionsphase nehmen die Lerner die Spielbeschreibung, Rollenkarten etc. entgegen, klären sie die organisatorischen Fragen (Gruppenund Raumaufteilung etc.), machen sie sich mit den weiteren Ressourcen vertraut (z.B. Schreibmöglichkeiten), verteilen sie u.U. Aufgaben in ihrer Gruppe. In der INTERAKTIONSPHASE interagieren die Lerner rollengerecht mit der simulierten Umwelt, beschaffen die Lerner ggf. Zusatzinformationen, kommunizieren die Lerner mit der Spielleitung und anderen Teams, diskutieren und entscheiden die Lerner zwischen Alternativen, evaluieren die Lerner Zwischenergebnisse, reflektieren die Lerner ggf. den Lernprozess und den Realitätsbezug und reagieren sie ggf. auf unvorhergesehene Ereignisse. In der BEWERTUNGSPHASE , die zwischenzeitlich oder nach einer "Spielrunde" stattfinden kann, interpretieren Lerner und Spielleitung die Ergebnisse als Gewinn oder Verlust ("Manöverkritik"), evaluieren die Lerner die Qualität des Spiels und ggf. auch der Spielleitung, entwickeln sie Perspektiven und antizipieren sie ggf. Anschlussaktivitäten. e-Learning: Planspiele sind schon sehr früh über Computer und dann auch das Internet organisiert worden. Wie können dramatisierte Spielszenen eingebaut werden? http://www.findarticles.com/p/articles/mi_go1855/is_200302/ai_n7374984 http://www.heacademy.ac.uk/embedded_object.asp?id=21660&filename=Paris http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/5995/ http://www.leu.bw.schule.de/beruf/material/umat/hot/leu-ktu.htm#Plan Tutorium Varianten Lernende übernehmen begrenzte Lehrfunktionen, um es an andere (zumeist jüngere oder Novizen) weiterzugeben. didaktische Prinzipien Lernen durch Leh- ren Lernhelfer-System Lernen durch Lehren Lernen von Gleichgestellten 23 Beispiel Die Lernumgebung besteht für die Lerner aus dem LEITFADEN für Lerner, der dazu dient, das Konzept, das Programm und die Organisation überschaubar zu machen, und aus SITZUNGEN, in denen sie individuell oder in kleinen Gruppen mit Tutoren kommunizieren. Für die Tutoren besteht die Lernumgebung ebenfalls aus einem LEITFADEN, der einen Überblick über das Wissensgebiet des zugehörigen Kurses und Empfehlungen für Beratungssituationen enthält, und - SITZUNGEN mit den für den Kurs verantwortlichen Dozenten. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, individuell oder in kleinen Gruppen sich Wissen zu einem Themengebiet anzueignen, sich didaktisch vorzubereiten / vorbereiten zu lassen, die Tutoriumssitzungen zu planen und zu organisieren, in den Sitzungen anderen Lernern Wissen gezielt und geplant zu vermitteln, die Vorteile aus der gleichen Lage von Lernern und Tutoren zu nutzen, Rücksprachemöglichkeiten mit Supervisoren wahrzunehmen, eigene Lernprozesse aus Vorbereitung und Wissensvermittlung zu reflektieren und Lerngewinne abzusichern. Lerner übernehmen die Rolle des TEILNEHMERS, der individuelle Beratung erhält und an Sitzungen von TutoriumsGruppen teilnimmt, sowie des GRUPPENMITGLIEDS, das mit anderen Lernern einer Tutoriumsgruppe eigene Lernschwierigkeiten identifiziert und Lernbedarfe formuliert, die in den Sitzungen mit Tutoren bearbeitet werden. Lernhelfer übernehmen die Rolle des LEHRERS und EXPERTEN, der die Wissensgebiete definiert, die Gegenstand des Tutoriums sein sollen, der ggf. zusätzliche Lehrangebote gestaltet und die Tutoren betreut, von TUTOREN, die kleinere Gruppen von Lernern individuell und/oder in Gruppensitzungen betreuen und dabei vor allem Lernschwierigkeiten behandeln und Lernhilfen geben, von SUPERVISOREN, die ggf. die Tutoren bei ihrer Arbeit beraten, und ggf. von speziellen ORGANISATOREN (bei sehr vielen Teilnehmern). In der "Einrichtungsphase" (Tutorentrainingsphase) entwickeln Dozenten und spätere Tutoren das Konzept für das Tutorium, das in Verbindung zu einem Kurs oder einem Programm steht, erhalten die Tutoren einen Überblick über das Wissensgebiet des zugeordneten Kurses oder Programms (orientieren), antizipieren Dozenten und Tutoren Lernschwierigkeiten der Lerner, und wird die Arbeit der Tutoren vertraglich vereinbart. In der Vorbereitungsphase eignen sich Tutoren die Qualifikationen, die sie weitervermitteln sollen, intensiv an (aneignen) oder wiederholen sie, eignen sie sich ggf. weitere fachliche Kompetenzen an, die für die Sitzungen wichtig sind, und konsultieren ggf. Supervisoren. In der "Planungsphase" ordnet ein Tutor sein Wissen für die Zwecke der Weitervermittlung, bereitet er sich auf Fragen und Einwände vor ("vorbereiten"), antizipiert (ggf. noch einmal oder detaillierter, vgl. "Einrichtungsphase") erLernschwierigkeiten der Lerner und bereitet er ggf. Lehrmaterialien vor. In der "Interaktionsphase" organisieren Lerner und Tutoren Sitzungen, können sich Tutoren der unterschiedlichsten Lehrstrategien bedienen, stellen Lerner den Tutoren Fragen (fragen), nutzen sie ggf. die bereitgestellten Lernmaterialien, eignen sich die Lerner Wissen und Kompetenzen an (aneignen), erhalten sie Rückmeldung nutzen sie Möglichkeiten der Lernberatung (konsultieren, beraten), entwickeln und verbessern sie Lernstrategien, diskutieren und bearbeiten sie Lernschwierigkeiten und reflektieren sie ihren Lernprozess. In der "Bewertungsphase" (Auswertungsphase) evaluieren die Lerner den eigenen Lernerfolg und das Tutorium, evaluieren ggf. Supervisoren die Tutoren, evaluieren Tutoren die Lerner, evaluieren Dozenten, Tutoren und Lerner den Kurs, erhalten alle Beteiligten Rückmeldung (rückmelden) werden Perspektiven für Anschlussaktivitäten entwickelt (rückmelden). e-Learning: Bekommt neue Impulse, da viele Plattformen für Aus- und Weiterbildung die tutorielle Funktion als wesentliches Merkmal enthalten. http://www.schoolrenewal.org/strategies/i-mentoring-gf.html http://www.tutormentorconnection.org/Render.asp?nID=3238&nSectionID=37 http://www.e-tutor.com/ http://www.iearn.org/circles/mentors.html http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/61439/ 24 Vorlesung Lernende nehmen als Zuhörende und/oder Zuschauende an mündlichen und teilweise durch Medien unterstützten Informationsdarbietungen eines Redners/einer Rednerin teil, um sich Wissen und Wertvorstellungen anzueignen. Beispiel Erkläre warum... Analyse von Vorgängen und Begriffen, die eindeutig oder unausgesprochen zum Vortrag gehören. Varianten didaktische Prinzipien Lesung Vortrag Vorführung bzw. Demonstration DIE LERNUMGEBUNG besteht aus dem VORTRAG, der den Kern der Vorlesung bildet, dem VORTRAGSMANUSKRIPT, das den Vortragstext (ggf. Stichworte) enthält und (Erkläre wie...) ggf. auch von anderen Personen (vorübersetzt Begriffe in anderen Wortschatz. )gelesen wird, dem Vorlesungs-LEITFADEN der einen Was ist der Hauptgedanke von ...? Überblick über die Vorlesung vermittelt und Identifizierung des Hauptgedankens des Vortrags, sei er i. allg. orientierende Texte enthält, explizit oder implizit. (ggf.) audiovisuellen MEDIEN und VORFÜHRUNGEN als Ergänzung und Wie würdest Du ... nutzen, um...? WERKZEUGEN, die dem Aufzeichnen des Anwendung von Information in anderen Kontexten - vielVortrags ("Mitschrift") dienen. leicht in Beziehung zu vorhergehendem Wissen oder Erfah- Klare Lernaufgaben strukturieren auch hier die rungen. Wissensaneignung vor und unterstützen sie. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch Was ist ein neues Beispiel für...? aus, dass Lerner aufgefordert werden, Erzeugen ungewohnter, überraschender Beispiele eines individuell oder in Gruppen Begriffs oder Vorgangs sich durch Klären des eigenen Vorwissens vielleicht Miteinbeziehen des Verhältnisses und ggf. Lektüre vorzubereiten, zu vorhergehendem Wissen oder Erfahrung. der mündlich vorgetragenen und häufig durch Medien unterstützten Darstellung Was denkst Du würde passieren, wenn...? Wiederherstelaufmerksam zu folgen, lung/Neubelebung von Hintergrundwissen und Integrieren Notizen anzufertigen und in eine selbstgeins Vortragsmaterial, um Voraussagen zu machen. wählte Struktur einzubinden, ggf. Begleit- und Zusatzmaterialien zu Was ist der Unterschied zwischen.. und...? nutzen, Analyse zweier Begriffe – Vergleich und Kontrastierung von Zwischenfragen zu stellen, Ideen (KomBegriffen. mentare) einzubringen In welcher Hinsicht gleichen sich.. und...? Analyse zweier Und sich dabei vor allem OrientierungsBegriffe – Vergleich und Kontrastierung von Begriffen. und Deutungswissen anzueignen. Lerner übernehmen die Rolle des TEILNEHWelche Folgerungen ziehen Sie über...? Schlussfolgern MERS, aufgrund der vorgestellten Inhalte. der sich zuhörend und/oder zuschauend Wissen aneignet, dabei ggf. eine Mitschrift anfertigt, Wie beeinflussen sich... und ...? durch Nachfragen offene Punkte klärt (sofern Analyse von Beziehungen zwischen Vorstellungen. der Vortragende dazu Gelegenheit gibt) und ggf. durch Reaktionen (Applaudieren, Murren etc.) Was sind die Stärken und Schwächen von...? seine Bewertung des Vortrags zum Ausdruck Analyse und Integration von Begriffen. bringt. Lernhelfer übernehmen die Rolle Welches ist das beste nach... und warum? des REFERENTEN (Redners, VortragenAuswerten von Vorstellungen, Kriterien und Beweismaterial. den, Dozenten), der mündlich und mit schriftlichen, graphischen, bildlichen, mimiIn welcher Beziehung steht... zu..., das wir vorher behandelt schen und gestischen Mitteln Fragestellunhaben? gen und Wissen präsentiert, und Aktivieren von vorhergehendem Lernen und Integration von des PUBLIKUMS (Auditoriums), das durch neuen Informationen. seine Reaktionen dem individuellen Lerner zusätzliche Informationen liefert. Quelle: "Strategies for Learning from Lectures". In: American Educational Research Journal, vol. 29, No. 2 Summer 92, S.309. personale Wissensrepräsentation Lernen durch mündliche Rede In der VORBEREITUNGSPHASE bereiten sich Lerner ggf. durch Diskussionen und Lektüre auf den Vortrag bzw. die Vorlesung vor (vorbereiten), entscheiden sie sich zur Teilnahme an der Vorlesung und klären sie ihr Vorwissen und ihre Interessen. In der "Interaktionsphase" (Kommunikationsphase) hält der Referent den Vortrag (vortragen), rezipieren die Lerner den Vortrag und beobachten den Redner, fertigen sie ggf. Notizen an (notieren), stellen sie ggf. Zwischenfragen (fragen), reagieren sie ggf. auf den Vortrag (Applaus/Missbilligung), beobachten sie ggf. die Reaktionen des Publikums und reflektieren sie ihren Lernprozess. In der "Festigungsphase" (Erinnerungsphase) erinnern sich die Lerner an den Vortrag, lesen sie ihre Mitschriften, ordnen sie ggf. ihre Notizen (um), fertigen sie ggf. Zusammenfassungen und Übersichten an (zusammenfassen), führen sie ggf. Anschlussdiskussionen (diskutieren) und erinnern und festigen sie so das in den Mitschriften und Zusammenfassungen enthaltene Wissen. e-Learning: Gegenüber den Vorlesungen in Präsenzkontexten sind andere dramaturgische Mittel notwendig, z.B. eingeblendete Totalaufnahmen von Experimenten oder Projektionen, eine kürzere Zeitspanne scheint wesentlich zu sein, da andere Aufmerksamkeitsspannen gegeben sind. Rückmeldung für Vortragenden fehlt. http://www.iconic-turn.de/ http://netzspannung.org/tele-lectures/series/ 25 Beispiel Werkstattseminar Varianten Erfahrene Personen eignen sich überwiegend aktuelles Wissen an, das entweder von einzelnen Teilnehmenden eingebracht oder gemeinsam erzeugt wird, und lösen zumindest exemplarisch Probleme. Die Lernumgebung besteht aus dem LERNORT, in der Regel einer Tagungsstätte, die konzentrierte Arbeit fördert und Gelegenheiten zur Freizeitnutzung bietet, dem INFORMATIONSZENTRUM, das alle Ressourcen (WERKZEUGE, INFORMATIONSMITTEL) in übersichtlich geordneter Weise bereithält, und den MATERIALMAPPEN, die an die Teilnehmer vorab verschickt werden. Typische Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass Lerner aufgefordert werden, in einer Gruppe sich auf das Seminar, vor allem eigene Beiträge dafür, vorzubereiten, sich als Experten aktiv an einer meist mehrtägigen Veranstaltung zu beteiligen und die Expertenschaft der anderen Teilnehmer anzuerkennen, Wissen, insbesondere eigene Erfahrungen, in die wechselseitigen LehrLern-Prozesse einzubringen und (Problemlösungs-)Wissen zu erzeugen mit den anderen Teilnehmern zusammen ein Produkt/Produkte zu erstellen, sich an der Auswertung des Seminars bzw. der Ergebnissicherung und ggf. an der Verbreitung der Seminarergebnisse zu beteiligen. Lerner übernehmen die Rolle des gleichberechtigten, kompetenten und aktiven TEILNEHMERS, des (Arbeits-)GRUPPENMITGLIEDS, das mit anderen Probleme formuliert, löst und Produkte erstellt, sowie ggf. des MODERATORS und des ORGANISATORS. Lernhelfer übernehmen die Rolle des ORGANISATORS, falls diese nicht von Lernern selbst übernommen wird, des EXPERTEN, falls die anstehenden Themen und Probleme deren Einbeziehung verlangen, und des MODERATORS, falls diese Rolle nicht (ebenfalls) von den Lernern selbst übernommen wird. Workshop Lernstatt Qualitätszirkel didaktische Prinzipien produktorientiertes Lernen kollegiales Lernen In der "Initiationsphase" bildet sich der Kreis der Initiatoren (initiieren), wird die (Selbst-)Organisation gesichert (organisieren), wird von den Initiatoren der Kreis der Teilnehmer festgelegt, wird ein Rahmenthema formuliert (thematisieren), werden von den Initiatoren Entscheidungen herbeigeführt über den Kreis der Teilnehmer, über Ort, Zeit und Rahmenbedingungen sowie über Rolle und Auswahl von Organisatoren, Experten und Moderatoren (entscheiden). In der "Vorbereitungsphase" informieren die Organisatoren die (potentiellen) Teilnehmer über das Vorhaben eines Werkstattseminars, fordern Organisatoren die Teilnehmer auf, Beiträge einzureichen, und verschicken Vorbereitungsmaterialien (vorbereiten). In der "Klärungsphase" strukturieren die Lerner/Teilnehmer gemeinsam die zu bearbeitenden Probleme bzw. die zu erstellenden Produkte vor (vorstrukturieren), bilden sie Arbeitsgruppen (gruppieren), und beschaffen diese Arbeitsgruppen die benötigten Ressourcen im Informationszentrum und ggf. von außerhalb. In der "Interaktionsphase", die auch als Problemlösungsphase bezeichnet wird, formulieren und spezifizieren die Lerner in Arbeitsgruppen Probleme diskutieren sie Lösungswege und Alternativen, entwickeln sie Lösungen und erstellen Produkte (herstellen), bereiten sie die Präsentation der Lösungen und Produkte vor (vorbereiten), die im Plenum/in der Öffentlichkeit stattfinden soll, konsultieren sie ggf. Experten, nutzen sie Ressourcen und fertigen sie erste Produkte bzw. Präsentationen an. In der "Präsentationsphase" stellen sich die einzelnen Arbeitsgruppen wechselseitig ihre Lösungen bzw. Produkte vor (präsentieren), diskutieren sie diese im Plenum, erproben sie diese gegebenenfalls und erheben sie Verbesserungsvorschläge und Zusatzinformationen im Plenum. In der "Bewertungsphase" reflektieren die Lerner/Teilnehmer die Seminarergebnisse und deren Anwendungsperspektiven, evaluieren sie ihre Lernprozesse und ihre neuen Erkenntnisse, entscheiden sie ggf. über Anschlussaktivitäten und bereiten Organisatoren und Lerner die Erstellung der Dokumentation und des Abschlußberichts vor (vorbereiten). e-Learning: Wiederum entsteht das Problem der Abbildung und Koordinierung von praktischen Tätigkeiten. Für verbale Kommunikation sind „chats“ wegen reduzierter Ausdrucksformen nur begrenzt geeignet (besser Videokonferenz). Hilfreich ist auch das Angebot von gemeinsamen Schreib- und Malflächen („whiteboard“). 26 Didaktische Vielfalt: Lernen Ein weiteres Motiv für die Überzeugung vom Sinn didaktischer Vielfalt ist in der historischen, kulturellen und interindividuellen Diversität des Lehrens und Lernens begründet: Menschen haben zu verschiedenen Zeiten und in ihren jeweiligen kulturellen Orientierungen unterschiedliche didaktische Grundmuster herausgebildet; frühere Versuche, vor allem mittels empirischer Unterrichtsforschung einen didaktischen "Königsweg" zu finden, sind fallengelassen worden angesichts sich zunehmend durchsetzender Überzeugung, dass insbesondere die spezifischen Kompetenzen, die erworben werden sollen, und die persönlichen Voraussetzungen von Lernerinnen und Lernern unterschiedliche Zugangsweisen erfordern. Wer heutzutage eine didaktische Praxis empirisch auf ihre Wirkungen hin untersucht, ist gut beraten, die Zufriedenheitsund Lernerfolgsdaten der Lerner und Lernerinnen auch daraufhin zu untersuchen, ob nicht Heterogenität vorherrscht, einige also sehr gut lernen oder sehr zufrieden sind, andere aber gerade nicht. Schon bei der Entwicklung des CEDID/CEWID-Systems war die Überzeugung ausschlaggebend für die Programmgestaltung, dass Menschen unterschiedliche Lern- und Arbeitsstile aufweisen, die man nicht "wegbügeln" dürfe. Ein Modell von G. PASK war dabei eine Leitlinie für die konzeptionellen Überlegungen; dieses Modell steht im Kontext verschiedener Ansätze zur Entwicklung von Lernertypologien (vgl. HALLER 1992) und weist zwei Grundformen auf: holistische (ganzheitlich, am Wechsel von Konkretion und Abstraktion orientierte) und serialistische (Schritt-für-Schritt, aus Konkretionen allmählich Abstraktionen aufbauende) Lernstile. Holistische Lernende verfolgen einen globalen, ganzheitlichen Ansatz bei der Aufgabenlösung und nutzen eine top-down-orientierte Vorgehensweise. Dies bedeutet, dass sie sich zuerst ein Gesamtbild von einer Sache verschaffen und sich auf komplexe Themenzusammenhänge und weite Gesichtspunke konzentrieren, bevor sie in die Details gehen. Sie legen großen Wert darauf, den Überblick zu bewahren, prüfen stets mehrere Aspekte gleichzeitig und betonen mögliche Analogien. Dadurch entwickeln sie viele eigene Gedanken und Ideen zum Lernstoff oder auch darüber hinausgehend. Der holistische Lernprozess ist zudem durch einen ständigen Wechsel zwischen konkreten und abstrakten Aspekten geprägt. Serialistische Lernende gehen stattdessen Schritt für Schritt vor und lernen bottom-up-orientiert. Dies bedeutet, dass sie sich zuerst mit den konkreten Einzelaspekten eines Sachverhalts befassen und sich sukzessive in kleinen und folgerichtigen Schritten einem Gesamtverständnis annähern. Erst wenn sie einen Aspekt verstanden haben, wenden sie sich dem nächsten zu. Eine vorausgehende Aufgabe muss abgeschlossen sein, bevor die nächste Aufgabenstellung in Angriff genommen wird. Serialistische Lernende achten sehr stark auf die Details einer Sache und gehen vom Konkreten zum Abstrakten. Aufgrund geringerer Fähigkeiten zur Analogiebildung lernen sie die verschiedenen Lerndetails getrennt voneinander und memorieren dadurch unverbundene kleine Wissensinseln. Es konnten ihnen auffällig gute Gedächtnisleistungen nachgewiesen werden. Für die Gestaltung von Lern- und Arbeitsprogrammen auf PCs leitet sich aus den Erfahrungen von PASK, dass Serialisten kaum in der Lage sind, mit holistisch konzipierten Programmen umzugehen, während Holisten bedingt und Vielseitige ("versatiles", die kontextabhängig beide Lernstile anwenden können) problemlos auch mit serialistischen Programmen umgehen können, die Forderung ab, einerseits eine "serialistische Basis" zu ermöglichen, andererseits auch "holistische Möglichkeiten" zu eröffnen. In CEWID ist diese Forderung durch die Abgrenzung zwischen operativem Wissen (das in der Regel eher serialistisch angeordnet werden dürfte) und Hintergrundwissen (dessen Nutzung nach eigenem Ermessen vor allem den holistischen Bedürfnissen entgegenkommen kann) aufgegriffen worden. Diese Abgrenzung stellt zugleich eine Balance zwischen einer statischen (Hintergrundwissen, auch: deklaratives Wissen) und einer dynamischen (operatives Wissen) Komponente des Systems dar. Inzwischen haben verschiedene darstellungs- und nutzungstechnische Möglichkeiten u.a. dazu geführt, dass der Aktionsradius der Lerner und Lernerinnen erweitert worden ist; so das System der Verknüpfung von Dokumenten („hyperlinks“) oder ikonische (bild- und symbolhafte) Repräsentationen von Kontroll- und Schaltelementen, mit denen in Lernprogrammen Abläufe gesteuert werden können. Dies lässt sich unter dem Sammelbegriff „Navigation“ fassen. Unter didaktischen Gesichtspunkten ist diese Entwicklung ebenso als ein Meilenstein anzusehen wie die spätere umfängliche und leicht verfügbare Vernetzung durch das Internet. 27 Von Interesse ist nun festzustellen, inwieweit die vielfältigen modernen Möglichkeiten der Navigation in computergestützten Lernprogrammen ein differenzierteres Lernverhalten stützen oder gar entwickeln helfen, als das vor Jahren noch mit den vornehmlich Schritt-für-Schritt vorgehenden Programmen der Fall war. Im Rahmen dieser Forschungen wird der kognitive Lernstil als Disposition oder Neigung definiert, eine spezifische Lernstrategie übersituativ zu verwenden. Der individuelle Lernstil ist dem Strategiegebrauch gewissermaßen vorgeschaltet und bestimmt, welche Strategie habituell verwendet werden soll. Mischformen werden als versatiler Lernstil bezeichnet. In einer empirischen Untersuchung des Lernverhaltens von Studierenden (N=50) mit solchen Programmkomponenten konnte SCHULZ-WENDLER (2001) feststellen, dass beide Lernstile in der Population vertreten waren, und zwar in eindeutiger Ausprägung beim konkreten Verhalten 10% serialistisch und 12% holistisch, sowie vorwiegend serialistisch 44% und vorwiegend holistisch 24%; demgegenüber in einer Selbsteinschätzung aber nur 14% insgesamt serialistisch und 12% insgesamt holistisch; 10% der Lernenden im konkreten Verhalten als versatil (wechselnd) einzustufen waren, aber 74% bei einer Selbsteinschätzung; einem serialistischen Lernstil das Bedürfnis nach Steuerung durch ein vorgegebenes System entsprach; einem holistischen Lernstil das Bedürfnis nach Selbststeuerung entsprach; es zwar hinsichtlich operativem und deklarativem Wissen überwiegend den Lernstilen entsprechende Vorgehensweisen gab, dennoch einige Lerner oder Lernerinnen das in Form eines Lexikons alphabetisch geordnete Hintergrund als Serialisten stur von vorn nach hinten durcharbeiteten, also sogar eine alphabetische Reihenfolge als Systemsteuerung schätzten. Am letzten Punkt ist anzusetzen, wenn man einen praktischen Nutzen dieses Modells, aber auch der Lernstilforschung generell für die Gestaltung von webbasierten Lernprozessen sucht. Die Entwicklung dieses Parts (Hintergrundwissen) wird allgemein sträflich vernachlässigt, meistens findet man nur Glossare mit kurzen Definitionen. Stattdessen wird eher noch versucht, die unterschiedlichen Lernwege im operativem Teil auszudifferenzieren. Da muss dann immer wieder ein Modell zugrundegelegt werden, aufgrund von Typologien die Verschiedenartigkeit vorprogrammiert „bedienen“ zu können. Wäre es nicht hingegen einfacher (und angesichts des noch immer nicht sehr elaborierten Standes der Lernstilforschung auch angemessener), man gäbe im operativen Teil mit geringfügigen Ausdifferenzierungen (Verzweigungen) dem serialistischem Lernweg seine Entfaltungsmöglichkeit und würde durch klug entwickelte vielfältige Hintergrundangebote dem holistischem Lerner (der sich ja sein „Menü“ eh gern selbst zusammenstellt) Appetit auf eine Erkundungsreise machen? Und vielleicht wagt sich der Serialist ja auch einmal dahin, kann er doch sicher sein, immer wieder auf den Boden seiner serialistischen Basis zurückkehren zu können. Und für denjenigen unter den Holisten, den PASK den (unvorsichtigen, überschnell generalisierenden, nicht auf dem soliden Boden der Tatsachen sich gründenden) „globetrotter“ nennt, würde umgekehrt die serialistische Basis das Korrektiv der konkreten Anforderungen darstellen. Ein Vorschlag zur Überwindung einer nur alphabetischen Ordnung des Hintergrundwissens ist dessen Gliederung nach: Definitionen, Erläuterungen, Beispielen, Formularen, Regeln/Regulationen/Gesetzen, Algorithmen/Operationen, wobei aber den Autoren andere Gliederungen freigestellt sein sollten. Das wären nun zwei Lernwege, die vorbereitet und angeboten werden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass beide ihre Nutzer finden. Zur wissenschaftlichen Diskussion über Lernstile als individuellen Komponenten des Lernens 28 Der erste Ausgangspunkt unserer Fragestellungen ist die in einigen Ländern und ihrer didaktischen Forschung (insbesondere in den USA, Großbritannien, Schweden und Australien) seit etwa 1970 verstärkt auftretende Sichtweise von individuellen Unterschieden im Lernverhalten von Menschen. In der Erforschung des menschlichen Lernens, die zu der Zeit auf ca. 100 Jahre moderner Forschungsgeschichte zurückblicken konnte, war zunächst der Versuch der nomothetischen Aussage (allgemeingültige Gesetzlichkeit) vorherrschend; seien es die physio-psychologischen Untersuchungen von Wundt, die Experimente von Ebbinghaus zu Gedächtnisleistungen, die Variationen des Schreibund Leseunterrichts bei Lay, später die großen Methodenexperimente (z.B. im Hochschulunterricht der Vergleich zwischen Vorlesungs- und Seminarmethode) etc.: immer ging es um die Suche nach dem „Königsweg“, d.h. der einen bestimmenden Einflußgröße und ihrer Verbesserung. Gelegentlich waren dabei schon Gesichtspunkte zu idiosynkratischen Phänomenen (voherrschende Eigentümlichkeiten) aufgetaucht, so z.B. bei Meumann der Hinweis auf unterschiedliche Sinnestypen (Menschen, die stärker visuell orientiert seien, würden entsprechende Lehrangebote bevorzugen, andere Menschen auditive Reize). Ein neues Paradigma der Lehr/Lernforschung entstand dann aber erst Ende der 60er Jahre. Vor allem die Untersuchungen über Reflexivität vs. Spontaneität im Verhalten von Kindern scheinen dabei zunächst eine Rolle gespielt zu haben. Unter der Bezeichnung „ATI-Forschung" (Aptitude-TreatmentInteraction) wurden vielfältige Versuche zusammengefaßt, die bestimmenden Merkmale in solchen Idiosynkrasien ausfindig zu machen. Es ging also nicht um eine konsequent phänomenologische, d.h. die Eigentümlichkeiten der Individuen diversifiziert belassende Betrachtungsweise, sondern -gewissermaßen als Zwischenstation zur Nomothetik- um möglichst „handfeste" Typologien, mit denen dann wiederum gestaltende Interventionen begründet werden konnten. Menschen lernen unterschiedlich und auch im Verhältnis zu Lehrenden entwickeln sich unterschiedliche kognitive Bezüge. Wenn eine Bildungseinrichtung dies gestattet, wie in Teilen an der Hochschule, die ungleich mehr als Schulen den Lernenden die Wahl von Lehrenden ermöglicht, entwickeln sich dadurch Passungsverhältnisse. Die Frage ist nur, ob sie im wesentlichen kognitiv bestimmt sind und dieses gewissermaßen in einem freien Markt geschieht und so bleiben sollte, oder ob solche (kognitiven) Passungen zwischen Lehrenden und Lernenden gezielt erreicht werden können und sollten. Zur weiteren Behandlung dieser Frage bedarf es zunächst einmal genauerer Kenntnisse über die Art solcher Passungen sowie über die ihnen zugrundeliegenden kognitiven Muster, eigentlich auch (aber das wäre ein sehr aufwendiges Unterfangen) über deren Entstehungsbedingungen. Der ATI-Ansatz selbst war offensichtlich bald schon nicht mehr handhabbar, weil solche Ausdifferenzierungen (aufgrund der immer neuen Korrelationen [Wechselbeziehungen], die gefunden wurden) letztlich zurück zur totalen idiosynkratischen Betrachtungsweise führen mussten: Es ist dann eben doch jedes Kind, jeder oder jede Lernende ein singulärer Fall und müßte entsprechend individuell belehrt (und beschult) werden. Der wenig später als die ATI-Forschung einsetzende Ansatz von Lernstiluntersuchungen ging von vornherein aus von entweder additiven oder systematischen Typologien. Zu den ersteren gehört eine Auflistung von Barbara und Louis Fischer: „Zuwachslerner“, „intuitive Lerner“, „Sinnespezialisten“, „Sinnesgeneralisten“, „emotionell Beteiligte“ (FISCHER/FISCHER 1968). Eine der wenigen Untersuchungen aus der Bundesrepublik (SCHRADER 1994) legte ebenfalls eine additive Typologie vor, und zwar bezogen auf Erwachsene in der beruflichen Weiterbildung („Theoretiker“, „Anwendungsorientierte“, „Musterschüler“, „Gleichgültige“ und „Unsichere“). Zu den letzteren gehören die Modelle von KOLB (erstmals 1972) und PASK (1976). Das Modell von Pask geht von einem dualistischen Ansatz aus und unterscheidet nach der Art und Weise des Entwicklungsverlaufs im Hinblick auf Abstraktionen aus konkreten Erfahrungen und Einzelheiten zwischen Serialisten (die stufenweise aus Konkretionen zu Abstraktionen gelangen) und Holisten (die laufend zwischen Konkretionen und Abstraktionen interferieren) sowie Versatilen, die (wohl kontextbezogen) beide Muster anwenden können. Besonders interessant ist die Feststellung, dass Holisten notfalls auch mit serialistischen Lehrangeboten zurechtkommen, während Serialisten bei holistischen Angeboten Probleme haben. Einen besonderen Ansatz stellt das Kolbsche Modell dar, weil es unter Rückgriff auf Intelligenz- und Kreativitätsforschung sowie das Piagetsche Assimilations-/Akkomodationsmodell 4 Grundkomponenten („Konkrete Erfahrung“, „Reflektiertes Beobachten“, „Abstrakte Begriffsbildung“ und „Aktives Experimentieren“) zu 2 bipolaren Dimensionen ordnet, so dass sich 4 Grundtypen ergeben: „Divergierer“ (mit Neigungen zu „Konkreter Erfahrung“ und „Reflektiertem Beobachten“), „Assimilierer“ (mit Neigungen zu „Reflektiertem Beobachten“ und „Abstrakter Begriffsbildung“), „Konvergierer“ (mit Neigungen zu „Abstrakter Begriffsbildung“ und „Aktivem Experimentieren“) sowie „Akkomodierer“ (mit Neigungen zu „Aktivem Experimentieren“ und „Konkreter Erfahrung“). Aus den bisherigen Erfahrungen in der Verwendung speziell dieses Instrumentes zur Erfassung individueller Lernstile ist zweierlei hervorzuheben; zum einen in den USA festgestellte Affinitäten zu Studien- und Berufswahlen, zum anderen die Vermutung, dass zwischen Personen in diametralen Positionen des Kolbschen Modells („Konvergierer“ zu „“Divergierern“ und „Assimilierer“ zu „Akkomodierern“) kognitive Konflikte auftreten können, was sich z.B. in Gruppenarbeit oder zwischen Lehrenden und Lernenden als Störung bemerkbar machen kann (wofür wir in begleitenden nichtstandardisierten Gruppeninterviews tatsächlich immer wieder Bestätigungen finden konnten, vgl. GABRIEL/HALLER 1982). 29 Inwieweit nun ergibt sich aus solchen Typologien und ihren Anwendungen als diagnostischen Instrumentarien ein Vorteil für die Lernenden? Gehen wir davon aus, dass zunächst einmal ein gewisses Mindestmaß von Validität und Reliabilität für diese Instrumentarien gewährleistet ist, woran nach einer faktoriellen Vergleichsuntersuchung mehrerer Instrumente von FERRELL(1983) bereits Zweifel bestehen. In der Regel weisen solche Typologien etwa 4 bis 6 Grundmuster auf. Die Konsequenz daraus ist dann logischerweise eine Zuordnung der Individuen zu einem dieser 4 bis 6 Typen. Es ist nun nicht vorstellbar (und sicherlich auch nicht sinnvoll), eine solche Typologie zur Grundlage einer didaktischen Planung dergestalt zu machen, dass jeweils Lernende eines Typus’ „zusammengestellt“ oder typuspassende Lehrende und Lernende einanderzugeordnet würden. Vielmehr zeigen die Erfahrungen aus einem spezifischen Einsatz solcher Instrumente, wie wir ihn seit nunmehr 15 Jahren praktizieren, dass mit ihnen eine Reflexionsdynamik ausgelöst werden kann, die bei den Betreffenden zu Überlegungen darüber führt, wie sie gewohnt sind zu lernen, welche Vorlieben und Abneigungen sie haben, welches ihre besonderen Strategien und Techniken sind, welche kognitiven Muster (z.B. in der Abfolge von Konkretion und Abstraktion) dabei für sie eine Rolle spielen, etc. Durch den Nachweis von Unterschieden und deren Legitimsetzung setzt diese Reflexionsdynamik sich in der Überlegung fort, dass andere Menschen ja andere Lerngewohnheiten haben, andere Vorlieben und Abneigungen aufweisen, andere Strategien und Techniken bevorzugen, andere kognitive Muster suchen, etc. Entscheidend im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit für die fortdauernde Übernahme von Lernmustern, die in solchen Metadiskussionen als sinnvoll und hilfreich bewertet werden, dürfte dabei deren Bestätigung „im tatsächlichen Leben“ sein, d.h. der daraus resultierende bessere Lehr- und Lernerfolg. Wenn man von einem konkreten Anwendungsnutzen der Lernstilforschung sprechen kann, dann ist es vor allem die Begründung für didaktische Vielfalt in den Lehrangeboten und Lehrmethoden (FLECHSIG 1996), die aus all diesen Ansätzen herauszulesen ist. Die Berücksichtigung individueller Lernstile ist selbst schon Ausdruck einer individualistischen Orientierung als Wertsetzung. Eine Person wird als Lerner oder Lernerin mit eigentümlicher Art gesehen; dies grenzt sich von Sichtweisen ab, in denen das Lernen als allgemein gattungsgebundenes Verhalten betrachtet wird, das vorgegebenen Mustern zu folgen habe. Und auch die Sachverhalte selbst, die gelernt werden (sollen oder können), sind unterschiedlich betrachtet: einmal sind es konstruierte Wahrheiten, die auch im Aneignungsprozess „geschaffen" werden: im anderen Fall sind es objektiv vorhandene Wahrheiten, die möglichst originalgetreu zu erfassen oder zu reproduzieren sind. Eine sehr wesentliche Erfahrung beim Einsatz von Messinstrumenten (Inventaren) zur Erfassung individueller Lernstile ist deren elaborative Funktion. Wenn sie -wie dies z.B. beim LSI von Kolb der Fall ist- von den betreffenden Personen sofort selbst ausgewertet werden können (um Rückmeldung zu geben, welcher „Typ man denn sei"), kann dieses der Ausgangspunkt eines Gruppengesprächs sein, in dem Erfahrungen zum Lernverhalten ausgetauscht und reflektiert werden. Gerade angesichts mancher Zweifel an der Güte solcher Inventare ist damit auch eine methodologische Korrektur und Relativierung erreicht, die sehr an das Konzept der „kommunikativen Validierung" erinnert. Somit ist der Beitrag solcher Inventare zum Thema Identität mehr auf die Identitätsfindung zu beziehen. Wenn man zudem das Lehren als Spiegel des Lernens betrachtet, so sind ähnliche Prozesse auch für Lehrende festzustellen. Die Reflexion über ihren Lernstil bringt auch Lehrende auf ein Nachdenken über eigene Identität und kann geeignet sein, ihnen zu verdeutlichen, dass ihre Stärken und Schwächen nicht absolut zu setzen sind, sondern Beziehungen aufweisen zu jeweils einigen unter ihren Lernern und Lernerinnen. Literaturhinweise: Ferrell, Barbara G.: A Factor Analytic Comparison of Four Learning-Styles Instruments. In: Journal of Educational Psychology, 1983, Heft 1, S. 33-39. Fischer, Barbara B. / Fischer, Louis: Styles in Teaching and Learning. In: Educational Leadership, 1979, S. 245-254. Flechsig, Karl-Heinz: Kleines Handbuch didaktischer Modelle, Eichenzell, Neuland - Verlag für lebendiges Lernen, 1996 Gabriel, Alfred/Haller, Hans-Dieter: Untersuchungen zu Lernstilen von Erwachsenen an Abendgymnasien. In: Festschrift „10 Jahre Abendgymnasium Göttingen“, 4. Juni 1983, S. 11-20. Haller, Hans-Dieter: An die Tür des Geistes klopfen. Lernen und Problemlösen. In: ManagerSeminar, 1992, 7, S. 42-49 Heue, Matthias: Die Erfassung kultureller Wertorientierungen an Hand der Ansätze von Kluckhohn/Strodtbeck und Hofstede und deren Verwendungsmöglichkeiten für Situationen des Kulturaustausches, Diplom-Arbeit, Fachbereich Sozialwissenschaften, Universität Göttingen, 1995. Hofstede, Geert: Culture´s Consequences. International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills - London - New York, Sage Publications. 1980. Hofstede, Geert:Cultures and Organizations. Software of the Mind. London etc., McGraw-Hill Book Company, 1991. Hofstede, Geert: Interkulturelle Zusammenarbeit. Wiesbaden, Gabler, 1993. 30 Katz, Noomi: : Individual learning style: Israeli norms and cross-cultural equivalence of Kolb's Learning Style Inventory. In: Journal-of-CrossCultural-Psychology, 1988, S. 361-379. Kolb, David A.: The Learning Style Inventory. Technical Manual. Boston, Mass., 1976. Kolb, David A.: Learning Styles and Disciplinary Differences. In: Chickering, Arthur W. (Hrsg.), The Modern American College. San Francisco etc.. 1981, S. 232 - 255. Pask, Gordon: Styles and Strategies of Learning. In: British Journal of Educational Psychology. 1976, S. 128-148. Pask, Gordon: Learning Strategies, Teaching Strategies, and Conceptual or Learning Style. In: Schmeck, Ronald R. (Hrsg.), Learning Strategies and Learning Styles. New York - London, Plenum Press, 1988, S. 83-100. Quinn, N. & Holland, D., Culture and Cognition, in: Holland, D. & Quinn, N. (eds.), Cultural Models in Language and Thought. Cambridge MA 1987. Richardson, John T.E.: Cultural specifity of approaches to studying in higher education: A literature survey. In: Higher Education, 1994, S. 449468. Sandhaas, Bernd: Lernen in Fremder Kultur.- Didaktische Orientierungen bei angehenden Hochschullehrern aus Ländern der Dritten Welt im Auslandsstudium in der Bundesrepublik Deutschland. Göttingen, Zentrum für didaktische Studien, 1988. Schank, R. & Abelson, R., Scripts, Plans, Goals, and Understanding: An Inquiry into Human Knowlege Structure, Hillsdale 1977. Schrader, Josef: Lerntypen bei Erwachsenen, empirische Analysen zum Lernen und Lehren in der beruflichen Weiterbildung. Weinheim, Dt. Studien-Verlag, 1994. Tait, H. / Entwistle, N.: Identifying students at risk through ineffective study strategies. In: Higher Education, 31, 1996, S. 97-116. 31 Didaktische Modelle und deren Bezug zum e-learning Die im "Göttinger Katalog" aufgewiesenen 20 didaktischen Modelle sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst und bereits mit stichwortartigen Hinweisen zu ihrem Entwicklungsstand hinsichtlich des elearning versehen. Diese Hinweise sind nicht durch systematische Dokumentation und Recherchen begründet, sie sind nur persönliche Erfahrungen und Eindrücken entsprungen. Obwohl es mittlerweile bereits die ersten Bücher zu „Webdidaktiken“ (u.a. KHAN 2001, KHAN 2002, MEDER 2002, SEUFERT/BACK/HÄUSLER 2001) gibt, bzw. solche bei Verlagen angekündigt sind, fehlt es noch an einer systematischen Dokumentation mit Belegen aus der Praxis. Die beiden linksstehenden Spalten (Definition, Signum, didaktische Prinzipien, Varianten) sind aus dem Modellkatalog bzw. der Computerfassung zusammengestellt, die rechte Spalte (Bezug zum e-learning) ist neu geschrieben. didaktisches Modell/ Definition didaktische Prinzipien/ Varianten Bezug zum E-learning Arbeitsunterricht: selbsttätiges Lernen, individualisiertes Lernen, ganzheitliches Lernen; Arbeitsaufträge, die sich auf Informationen im Netz beziehen. Bearbeitung schriftlicher Objekte, individuell oder in Partner- oder Kleingruppenarbeit. Praktische Arbeiten sind visuell zu dokumentieren (Video) und durch begleitende Kommentare zu korrigieren. Es fehlt eine handschriftliche Korrekturmöglichkeit zur Vorlage der Lernenden. Präsentation von Ergebnissen im Netz Es fehlt eine handschriftliche Korrekturmöglichkeit zur Vorlage der Lernenden. Lernende bearbeiten individuell oder in kleinen Gruppen (schriftlich formulierte) Aufgaben mit möglichst mehreren Aspekten, um Kenntnisse und Fertigkeiten zu üben und anzuwenden. Disputation: Lernende eignen sich in öffentlicher und geordneter Rede und Gegenrede vor allem Argumentations- und Urteilsfähigkeit an. 32 Gruppenunterricht, arbeit, Projektseminar; argumentierendes Lernen, dialektisches Lernen; Disput, Streitgespräch, Debatte, Thesenverteidigung, Podiumsdiskussion; Wird im „chat“ möglich. Es sind aber wenig Merkmale hervorgehoben, z.B. Übersicht und Markierung von pro/contra, Präsentation von „Podiumsteilnehmern“ Erkundung: Lernende begeben sich in natürliche Umwelten oder Institutionen zur Beobachtung und Datenerhebung, um Zusammenhänge zu überschauen und um Interessen und Standpunkte zu gewinnen. Lernen durch unmittelbare Erfahrung, Lernen durch direkten Umgang, orientierendes Lernen, beiläufiges Lernen; Fallmethode: Exkursion, Exploration, Hospitation, Praktikum, Feldstudie; praxisnahes Lernen, problemlösendes Lernen; Lernende bearbeiten einzeln oder in Gruppen rekonstruierte Praxisfälle, um sich Wissen über die betreffende Praxis oder Prozedur anzueignen und Fallstudie; ihre Urteils- und Entscheidungsfähigkeit auszubilden. Famulatur: Praktiker eignen sich spezielles oder seltenes Wissen von hoher Qualität an, indem sie einer sehr erfahrenen Fachperson bei deren Arbeit über einen längeren Zeitraum helfen. Fernunterricht: Lernende eignen sich durch Lektüre von speziell aufbereiteten Lehr/Lernmaterialien sowie durch Bearbeiten von schriftlich gestellten Aufgaben überwiegend theoretisches Wissen (Fakten, Begriffe, Modelle etc.) an. Lernen durch Assistieren, Lernen am Modell; Vorbereitung durch Recherchen im Netz, z.B. geographische Daten. Erkundungen im Netz durchführen, das ja selbst Lebenswelt ist. Präsentation von Erkundungsergebnissen im Netz. Vorbereitung durch Recherchen im Netz, z.B. Firmenportale mit Informationen über den Betrieb. Fallbearbeitung vernetzt durchführen. Präsentation von Fallbeschreibungen im Netz. Nur geringe Möglichkeiten. Erforderlich wäre eine handlungsbegleitende Videodokumentation, und zwar für beide Seiten. Problem der Rückmeldung. Assistenz, Volontariat; Lernen in Einzelarbeit, Lernen mit Medien, aufgabenbezogene Rückmeldung; „Klassisches“ Modell für einige Komponenten des e-learning (historischer Vorläufer), insbesondere netzbasierte Kursangebote. Fernkurs, studium, 33 KorrespondenzUnterricht, Telekolleg, Funkkolleg, Telelernen; Frontalunterricht: Lernen wird durch lehrergesteuerte Gespräche initiiert, die durch Anschauungsmittel unterstützt werden und vor allem der Vermittlung fachspezifischen Orientierungswissens dienen. lehrergesteuertes Lernen, Lernen im Klassenverband, thematisch orientiertes Lernen; darbietender Unterricht, Entwickelnder Frageunterricht, entwickelnder Impulsunterricht; Individualisierter Pro- individualisiergrammierter Untertes Lernen, richt: programmierLernende eignen sich mit tes Lernen, Hilfe programmierter zielerreichenLehrtexte in kleinen Lehr- des Lernen; schritten selbständig und individuell genau festge- computergelegte Kenntnisse und Fer- stützter Untigkeiten an. terricht, programmiertes Lernen, CBT (Computer-based Training); Individueller Lernplatz: Lernende eignen sich mit Hilfe von ausgewählten und systematisch geordneten Texten und AVMedien selbständig Begriffs- und Faktenwissen an, das zu zuvor erarbeiteten Fragestellungen in Beziehung steht. selbsttätiges Lernen, Lernen mit Medien, Passung zwischen kognitiven Strukturen des Lernenden und den Wissensordnungen; Selbstlernplatz, Infothek; 34 Nach wie vor wohl vorherrschendes Modell in formellen Bildungseinrichtungen, für e-learning geradezu nicht gedacht oder geeignet. Weiterer Vorläufer für Komponenten des e-learning („Web-based training“). Bietet Vorteile für serialistische Lerner/Lernerinnen wegen klarer Struktur und Vorgaben (entspricht dem Sicherheits- und Orientierungsbedürfnis vor allem auch bei didaktisch eng sozialisierten Lernern/Lernerinnen. Ist im e-learning gut möglich, bislang zumeist informell, dabei Gefahr der Redundanz, des Sich-Verlierens. Viele Webportale bieten sich als „Knotenpunkte“ an, indem sie (meist themenspezifisch) Verknüpfungen bieten. Aufbereitete Informationssammlungen sind wohl noch selten, zumeist gibt es nur unstrukturierte Glossare. KleingruppenLerngespräch: Lernen durch wechselseitigen Erfahrungsaustausch, Lernen durch strukturierte Gespräche; Lernende eignen sich durch strukturierten Informationsund Meinungsaustausch vorwiegend Wissen über persönliche Erfahrungen, Bewertungen und Einstellungen sowie Wünsche an Gesprächskreis, -runde, Rundgespräch TZI (Themenzentrierte Interaktive Methode); Lernausstellung: ambulantes Lernende eignen sich an Lernen, offenen Lernorten Wissen Lernen an an, indem sie ausgestellte "ausgestellten und kommentierte Objek- Stücken"; te oder Abbildungen in bestimmter Reihenfolge Messe, betrachten und ggf. Aktivmuseum; handhaben. Lerndialog: Lernende führen mit anderen Personen ausführliche und geordnete Zwiegespräche, um Erkenntnisse über sich und ihre Beziehungen zur Umwelt zu erlangen. Lernkabinett: dialogisches Lernen, entdeckendes Lernen, (Selbstfindung im doppelten Sinne); sokratischer Dialog, therapeutischer Dialog, dialektisches Gespräch; Lernen in elementaren Situationen, mehrperspektivisches Lernen, zweckfreies Lernen; Lernende eignen sich durch reale Tätigkeit in speziell eingerichteten und didaktisch besonders aufbereiteten Lernumwelten theoretisches und praktisches Wissen aus mehreren HandlungsperFreinetspektiven an. Pädagogik; Typisch für „chat“ und Forum, allerdings bislang wenig Ansätze der Strukturierung Im Bereich der Museumsportale bereits sehr elaborierte Beispiele, ist als Element in den Autorentools für Lernplattformen noch nicht erkennbar. Ein frühes Beispiel (1966) war das Programm „Eliza“ von Joseph Weizenbaum, mit dem eine Gesprächstherapie nach Rogers (parodistisch gedacht, von vielen seiner Studierenden aber ernst genommen) simuliert wurde. Im Internet sind Nachfolgeprogramme in Fülle vorhanden. Die Automatisierung widerspricht eigentlich dem Ansatz menschlicher Kommunikation. Dazu sind mir keine Beispiele bekannt; wie beim Arbeitsunterricht müssten Komponenten der Dokumentation von praktischen Tätigkeiten eingebaut sein. 35 Lernkonferenz: Lernende kommen mit anderen zusammen, um sich gegenseitig in Vorträgen, Diskussionen und mit anderen vorbereiteten Beiträgen (aktuelles) Deutungs- oder Problemlösungswissen zu vermitteln Lernnetzwerk: Lernende erzeugen neues Wissen, insbesondere über innovative Praxisbereiche, und vermitteln es sich wechselseitig und uneigennützig mit Hilfe von zumeist schriftlichen Mitteilungen Lernprojekt: Lernende wirken an Projekten innovativer Praxis mit, um die Anwendung erworbenen Wissens in realen Situationen und Institutionen zu erlernen und zur Verbesserung einer Praxis beizutragen Simulation: Lernende übernehmen (oft spielerisch) Rollen und/oder betätigen sich in simulierten Umwelten, um vor allem Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit in lebensnahen, jedoch entlasteten Situationen zu entwickeln und zu trainieren 36 kollegiales Lernen, beiläufiges Lernen; Entspricht den Programmen für Projektmanagement und Videokonferenz. Kongress, Symposium, Tagung; erfahrungsbe- Beispiele sind Foren und newszogenes Lergroups nen, wechselseitiges Lernen, Aktivierung von dynamischem Wissen; Erfahrungsring, computer conferencing, video conferencing, Internet; innovatives Lernen, fächerübergreifendes (interdisziplinäres) Lernen; Auch hier fehlt die Komponente der praktischen Tätigkeit, ansonsten können Programme für Projektmanagement das verteilte Arbeiten koordinieren. Vorhaben; spielendes Lernen, antizipatorisches Lernen; Planspiel, Rollenspiel, Simulatortraining; Planspiele sind schon sehr früh über Computer und dann auch das Internet organisiert worden. Wie können dramatisierte Spielszenen eingebaut werden? Tutorium: Lernende übernehmen begrenzte Lehrfunktionen, um es an andere (zumeist jüngere oder Novizen) weiterzugeben Lernen durch Lehren, Lernen von Gleichgestellten; Bekommt neue Impulse, da viele Plattformen für Aus- und Weiterbildung die tutorielle Funktion als wesentliches Merkmal enthalten. Lernen durch Lehren, LernhelferSystem; Vorlesung: Lernende nehmen als Zuhörende und/oder Zuschauende an mündlichen und teilweise durch Medien unterstützten Informationsdarbietungen eines Redners/einer Rednerin teil, um sich Wissen und Wertvorstellungen anzueignen Werkstattseminar: personale Wissensrepräsentation, Lernen durch mündliche Rede; Lesung, Vortrag, Vorführung bzw. Demonstration; produktorienerfahrene Personen eig- tiertes Lernen, nen sich überwiegend kollegiales aktuelles Wissen an, das Lernen; entweder von einzelnen Teilnehmenden einge- Workshop, bracht oder gemeinsam Lernstatt, erzeugt wird, und lösen Qualitätszirkel; zumindest exemplarisch Probleme Gegenüber den Vorlesungen in Präsenzkontexten sind andere dramaturgische Mittel notwendig, z.B. eingeblendete Totalaufnahmen von Experimenten oder Projektionen, eine kürzere Zeitspanne scheint wesentlich zu sein, da andere Aufmerksamkeitsspannen gegeben sind. Rückmeldung für Vortragenden fehlt. Wiederum entsteht das Problem der Abbildung und Koordinierung von praktischen Tätigkeiten. Für verbale Kommunikation sind „chats“ wegen reduzierter Ausdrucksformen nur begrenzt geeignet (besser Videokonferenz). Hilfreich ist auch das Angebot von gemeinsamen Schreiv- und Malflächen („whiteboard“). Der besondere Charakter des e-learning zeigt sich in der in wenigen Jahren bereits erreichten Vielfältigkeit einerseits des Aufgreifens von Handlungsmustern und Elementen der Lernumgebungen der verschiedenen didaktischen Modelle; andererseits auch des Eindringens in die verschiedenen didaktischen Modelle. So ist z.B. im Modell Arbeitsunterricht eine Ausweitung der Lernumgebung auf das Internet möglich, um Ideen, Anregungen, Beispiele für die gestellte Lernaufgabe zu sammeln oder um die fertiggestellten Produkte über das Internet zu präsentieren. Dieses sind zunächst noch Lernaktivitäten, die funktionell um die ei37 gentlichen praktischen Tätigkeiten, wie sie für den Arbeitsunterricht typisch sind (man denke an den Kerschensteinerschen Starenkasten), herumgelagert sind. Die weiterreichende Überlegung, auch solche praktischen Tätigkeiten über elektronische Repräsentationen vorzustellen und in ihrem Ablauf zu kontrollieren, ist z.Zt. Gegenstand eines Dissertationsprojektes am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen; es geht dabei um einen Kurs über Töpferei. e-learning in Hybrid-Lösungen e-learning ist im Sinne des „Göttinger Katalogs didaktischer Modelle“ nicht als ein eigenes didaktisches Modell anzusehen, gerade weil es eine hohe Vielfalt von Lehr- und Lerntätigkeiten ermöglicht (und in Zukunft dies sicherlich in noch höherem Maße). Es ist zunächst einmal als Trägersystem (für Medien) und als Liefersystem („delievery system“, für Informationsfluss) anzusehen und wird so auch schon seit längerem bezeichnet. Es ist aber natürlich dann nicht mehr beliebig, welche konkreten Lehr-/Lernformen und – tätigkeiten sich auf diesem System „abspielen“, d.h. dieses System hat seine Eigentümlichkeiten und führt deshalb zu spezifischen Ausprägungen und Lösungen, aber möglicherweise auch Restriktionen hinsichtlich einzelner didaktischer Modelle. So kann z.B. bei der Vorbereitung und Gestaltung von Fallmethoden eine Fülle von Daten verfügbar gehalten, dramaturgisch aufbereitet sowie in Sekundenschnelle präsentiert werden, so dass sich viel eher die Bereitschaft einstellen könnte, solche Daten zunächst probeweise abzurufen, als wenn man dazu einen größeren zeitlichen Aufwand „investieren“ müsste. Zu den Restriktionen gehören insbesondere der praktische und szenische Handlungsteil. Daraus folgt eine Hybrid-Technik in der Nutzung des e-learning als Ergänzung oder in einigen Fällen der „bessere“ Weg, dabei aber auch durchaus mit der Perspektive fließender Übergänge, d.h. dass mit fortschreitender technischer Entwicklung auch weitere didaktische Funktionen „übernommen“ werden können. Als ein Beispiel sei hier die Praxis eines Dozenten der medizinischen Fakultät in Göttingen erwähnt, bei der es um die Vorbereitung von Studierenden durch e-learning und die Nachbereitung der Vorbereitungsergebnisse sowie weiterführende Darstellungen in der anschließenden Vorlesung geht. Die Studierenden erhalten Bilder von pathologischen Phänomenen mit Aufgabenstellungen und senden ihre Lösungen an den Dozenten zurück, der dann in der Vorlesung selbst auf die Fehler und richtigen Lösungen verweisen und sie kommentieren kann. Hier zeigt sich, dass mit einer Verbindung beider Lernformen die klassische Vorlesung neue Impulse erhält. Zu den Fragestellungen, im Hinblick auf die es zumeist in den Diskussionen um den akademischen Unterricht geht, gehören im Hinblick auf Vorlesungen vor allem Gesichtspunkte der Rhetorik, der Veranstaltungskritik und des Mitschreibens durch die Studierenden. Weniger wurde diskutiert, welchen Stellenwert eine Vorlesung in einem integrativen Konzept haben könnte, d.h. inwieweit sie z.B. ergänzt wird durch begleitende Seminare und/oder Tutorien. Ein sehr umfangreiches und ausgearbeitetes sowie vielfältig erprobtes Konzept stellt der sog. Keller-Plan dar, auch PSI (personalized system of instruction) genannt, in dem Kurse mit verschiedenen Aktionsformen gestaltet sind: Vorlesungen werden ergänzt durch Tutorien, selbst-instruktionales Begleitmaterial, kleine Zwischentests, individuelle Beratung und Lerndialoge. Daraus ergibt sich ein stetiger Fluss von Informationsaufnahme, -verarbeitung und –kontrolle in verschiedenen didaktischen Handlungsformen. Nun ist zwar in der didaktischen Forschung der Stellenwert von Lernvoraussetzungen seit langem hinreichend bekannt, jedoch wurde wenig Augenmerk auf eine vorbereitende Lernaktivität gerichtet. Im Schulbereich gibt es wohl die vorbereitenden Hausaufgaben, aber es scheint so, dass man auch dort darauf nur zurückgreift, wenn es sich um Auseinandersetzungen der Lernenden mit Lerninhalten handelt, bei denen sie so oder so einen individuellen Aufgabenteil absolvieren müssen: typisch z.B. im Deutschunterricht, wenn ein Text gelesen worden sein muss, über den dann der Unterricht handeln soll. Im System des „Göttinger Katalogs didaktischer Modelle“, spielen Vorbereitungs- und Nachbereitungsphasen in einzelnen didaktischen Modellen eine wichtige Rolle, auch solche mit einer ausdrücklichen Beteiligung der Lernenden. So wird z.B. das Werkstattseminar als Modell beschrieben, in welchem die Vorbereitungsphase gerade für die Lernenden eine notwendige Voraussetzung für einen Durchführungserfolg darstellt: Sie müssen ihre Problembeschreibungen vorher erbringen, damit für die eigentliche Durchführungsphase die entsprechenden Vorbereitungen in Form der Zusammenstellung von erforderlichen Materialien und Aufgabenbearbeitungen getroffen werden können. 38 Ist als Leitmodell des akademischen Unterrichts hingegen die Vorlesung gewählt, so vermisst man diesen Aspekt der Vorbereitung durch die Lernenden. Sie kommen gewissermaßen als erwartungsfrohe und aufnahmebereite Kundschaft und werden vom vortragenden Dozenten mehr oder weniger formvollendet „bedient“. Der Verbindlichkeitscharakter hinsichtlich eines regelmäßigen Besuchs der einzelnen Vorlesungsstunden ist zudem relativ gering, so dass jede Vorlesungsstunde möglichst einen in sich abgeschlossenen thematischen Zusammenhang darstellen sollte. (Daraus ergibt sich auch ein „überschlagender Einsatz“, d.h. jede einzelne Vorlesungsstunde sollte zu Beginn die wesentlichen Aspekte der vorhergehenden Stunde zusammenfassen und zum Schluss einen Vorblick auf die nachfolgende Stunde geben.) Auch wenn gern von der „Interaktivität“ gesprochen wird, die nun durch technologische Entwicklungen gestützt sei, ist damit noch nicht der Gesichtspunkt von Programmierung außer Acht gelassen: Gemeint ist die Möglichkeit, den Lernenden spezifische Informationen und Hilfestellungen geben zu können, entsprechend ihren Fehlern oder Nachfragen und Wünschen. Dieses war als Prinzip aber auch schon in den Lehrprogrammen der 60er Jahre realisiert, wenn auch noch nicht in der heute möglichen Komplexität. Die Entwicklungen des computergestützten Unterrichts sind zunächst nach dem Modell „Individualisierter programmierter Unterricht“ erfolgt. Das entsprach einerseits dem behavioristischen Leitbild der 60er Jahre, andererseits aber auch den technologischen Bedingungen. Gegen Ende der 70er Jahre entwickelten sich dagegen kognitivistische und konstruktivistische Sichtweisen in der Lernpsychologie und auch in der Didaktik; dem entsprach dann aber erst gegen Ende der 80er Jahre die Weiterentwicklung in der Technologie durch 2 wesentliche „Erfindungen“, die auch heute noch ausschlaggebend sind für die Navigation in Computerprogrammen und dargebotenen Dokumenten: die Verknüpfung von Dokumenten oder Objekten durch „Hyperlinks“ und das Zeiger- und Steuerungssystem „Maus“. Zuvor dominierte die „Blättermaschine“. Dennoch sind auch heute noch computergestützte Lehrangebote als programmierter Unterricht zu bezeichnen, selbst wenn sie eine solche Navigation durch verknüpfte Dokumente ermöglichen, da diese Verknüpfungen alle zunächst einmal vorbereitet worden sind. Auch solch komplexe Systeme, wie sie von verschiedenen Plattformen für vernetzte Aus- und Weiterbildung inzwischen angeboten werden, sind programmiert, was die Navigationsmöglichkeiten anbetrifft, bzw. sind Schnittstellen für vorbereitete Verknüpfungen. Literaturangaben Flechsig, Karl-Heinz: Der Göttinger Katalog Didaktischer Modelle.- Theoretische und methodologische Grundlagen. Göttingen (Zentrum für Didaktische Studien e.V.), 1983. Flechsig, Karl-Heinz / Gronau-Müller, Monika: Kleines Handbuch Didaktischer Modelle. Göttingen (Zentrum für Didaktische Studien e.V.), 2. Aufl. 1988. Flechsig, Karl-Heinz: Kleines Handbuch Didaktischer Modelle. Göttingen (Zentrum für Didaktische Studien e.V.), 3. Erweiterte Auflage 1991. Haller, Hans-Dieter: Autonomes Lernen unter dem Gesichtspunkt von Forschungen zu Lernstilen und Lernstrategien. In: Fremdsprachen und Hochschulen 17 (1986), S. 11-22. Haller, Hans-Dieter: Am Anfang war der Löcherstanzer.- 20 Jahre Computer-Erfahrung in der didaktischen Forschung und Entwicklung. In: Deutsche Universitäts-Zeitung, 1-2/1989, S. 24. Haller, Hans-Dieter: Erfassung und Veränderung von Lernstilen durch Computerprogramme. In: R. Duda/P. Riley (Hrsg.), Learning Styles. Nancy (Presses Universitaires de Nancy) 1990, S. 127-134. Haller, Hans-Dieter: ...an die Tür des Geistes klopfen.- Lernen und Problemlösen. In: ManagerSeminare, Heft 7/1992, S. 42-49. Haller, Hans-Dieter: Wissensorganisation mit CEWID, einem wissensorientierten und tätigkeitsunterstützenden System. In: N. Meder/P.Jaenecke/W. Schmitz-Esser (Hrsg.): Konstruktion und Retrieval von Wissen. Frankfurt/M., INDEKS Verlag, 1995, S. 14-21. Haller, Hans-Dieter: Alternative Instructional Models and Knowledge-Organization and Design-Support With CEDID. In: Tennyson, R. / Schott, F./Seel, N.M./Dijkstra, S.(eds.), Instructional Design: International Perspectives, Vol.1: Theory, Research, and Models. Mahwah, New Jersey/London. Lawrence Erlbaum, Associates, 1997, S. 371-379. Haller, Hans-Dieter/Stickan, Walter: Navigationselemente in komplexen multimedialen Lernangeboten, Referat auf der Fachtagung "Lehren und Lernen mit neuen Medien", Landesarbeitskreis Niedersachsen "Multimedia und Telematik", am 25.11.1999 in Hildesheim, s. Tagungsband). 39 Khan, Badrul H. (ed.): Web-Based Instruction, Englewood Cliffs, Educational Technology Publications, 2001. Khan, Badrul H. (ed.): Web-Based Training, Englewood Cliffs, Educational Technology Publications, 2001. Langdon, Danny (ed.): The Instructional Design Library, 40 vols. Englewood Cliffs 1978 ff. Langdon, Danny (ed.): Audio-Workbook. Volume Five in the Instructional Design Library. Edited by Danny G. Langdon. Englewood Cliffs, 1978. Meder, Norbert: Web-Didaktik, angekündigt, 2002. Ripley, David E.: "Langdon and the Instructional Design Library." In: Instructional Design and Training. International Society for Performance Improvement (ISPI). Washington, DC., 1998. Schulz-Wendler, Bettina: Lernstile und Fremdsprachenlernen: empirische Studie zum computergestützten Grammatiklernen. Bochum, AKS-Verlag, 2001. Seufert, Sabine / Back, Andrea / Häusler, Martin: E-learning.- Weiterbildung im Internet. Kilchberg, Smartbook Publishing AG, 2001. 40