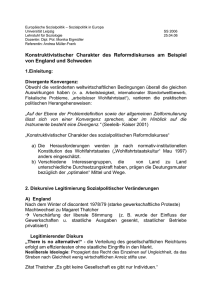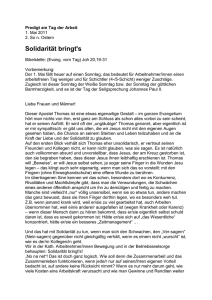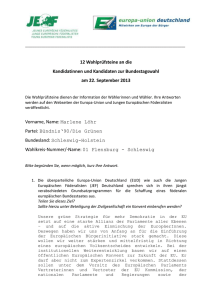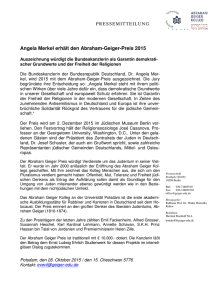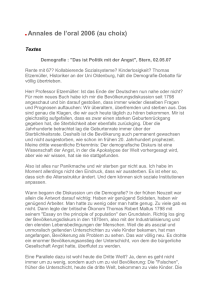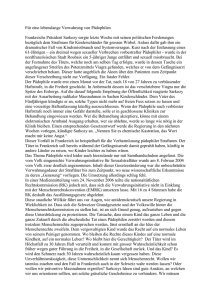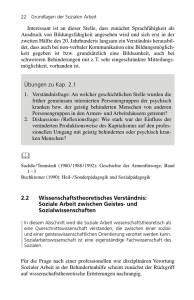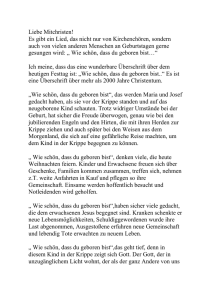Frame-Analysis (Rahmenanalyse) politischer Diskurse
Werbung

Die Eiserne Lady, der weiße Ritter und die Schuldenkrise Published in Jeder für sich oder alle gemeinsma in Europa ? Die Debatte über Identität, Wohlstand und die institutionellen Grundlagen der Union, ed. by Frank Baasner and Stefan Seidendorf, Nomos, 2013, p. 119-141. Einleitung Ohne Zweifel stellt die durch den Finanzkrach 2008 ausgelöste europäische Schuldenkrise für die Europäische Union (EU) und das deutsch-französische Tandem im Besonderen einen historischen Testfall dar. Während die Griechenland 2010 gewährte Finanzhilfe eine erste Notreaktion war, machten die fortwährenden Drohgebärden der Finanzmärkte gegenüber mehreren Mitgliedstaaten die Notwendigkeit einer vertieften Koordination der Wirtschaftspolitik in der Eurozone klar. Die wiederholten deutsch-französischen Krisengipfel und Treffen des Europäischen Rates führten zuerst zur Annahme des „Euro-Plus-Pakts“ im März 2011, der permanente Mechanismen zum Umgang mit der Finanzkrise etablierte: die Europäische Finanzmarkt-Stabilisierungs-Fazilität (EFSF) und den Europäischen Stabilitäts Mechanismsu (ESM). Ein weiterer Schritt erfolgte im Dezember 2011, als Frankreich und Deutschland eine Übereinkunft mit allen anderen EU-Staaten (außer Großbritannien) erzielte. Diese führte zur Unterzeichnung eines Regierungsabkommens, dessen Ziel die Verankerung strengerer Regeln zur europäischen Überwachung der nationalen Fiskalpolitik der Mitgliedstaaten ist. Während dieser turbulenten Monate richteten sich die Blicke der Beobachter, Kommentatoren und Medien besonders auf die Reaktionen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese wurden als zu langsam und zögerlich betrachtet, Deutschlands „Europadefizit“ oder „Europaskepsis“ wurden kritisiert und vor einer „Schweizer Versuchung“ gewarnt. Angela Merkel wurde als Europas neue „eiserne Lady“ bezeichnet. In der französischen Presse wurde der Pakt für den Euro bisweilen als Beleg dafür gelesen, dass Deutschland sein Wirtschaftsmodell der ganzen Union aufzwänge. Obwohl Deutschland Haushaltsdisziplin erzwungen hat (durch Schuldenbremse / Goldene Regel), konnte es auch erfolgreich der EU Kommission Kompetenzen für die Überwachung der nationalen Haushalte übertragen. Die Tatsache, dass sich deutsche Präferenzen in der Neudefinition der ökonomischen Governance der EU verwirklichen konnten, ist nicht sehr überraschend. Während es lange im Schatten der französischen Diplomatie stand, ist Deutschland im 21. Jahrhundert zu Europas hauptsächlicher wirtschaftlicher und politischer Macht geworden. Es sind deshalb eher die von Deutschland gemachten Konzessionen, die eine Untersuchung rechtfertigen. So, wie Nicolas Sarkozy seinen Eifer 1 als „weißer Ritter“, der Griechenland und ganz Europa rettete, mäßigen musste, musste umgekehrt die „Eiserne Lady“ im Laufe der Ereignisse ihre Position aufweichen. Der Pakt für den Euro enthält eine Reihe französischer Vorstellungen zur Governance (Deubner 2001), wie beispielsweise die Schaffung eines permanenten Krisenfonds, der finanzielle Solidarität innerhalb der Eurozone garantiert, die Veränderung der Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) hin zu einer stärker interventionistischen Haltung, und die Schaffung einer sogenannten „Wirtschaftsregierung“ der Eurozone mit dem Ziel verstärkter Koordination der Wirtschaftspolitik, einschließlich erster Schritte zur Steuerharmonisierung. Obwohl Angela Merkel die Vergemeinschaftung von Staatsschulden durch Eurobonds nach wie vor ablehnt, ist ein solcher Schritt in der Zukunft nicht auszuschließen, vor allem bei einem Regierungswechsel hin zu einer Rot-Grünen Koalition 2012. Obwohl Angela Merkel jeden deutschen Beitrag zu europäischer Solidarität 2009 abgelehnt hat, hat das Land schließlich 27% des ESM übernommen, das sind 22 Milliarden Euro, und weitere 168 Milliarden als Ausfallgarantien. Im Januar 2012 fordern sowohl die französische Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Christine Lagarde, als auch der italienische Premierminister Mario Monti, die Verdoppelung des ESM auf 1 Billion Euro. Die Antworten auf die Schuldenkrise stehen also zusammengenommen eher für die Kontinuität des deutsch-französischen Kompromisses in Europa, als für einen Bruch in der deutschen Europapolitik. Einmal mehr akzeptierte Frankreich ein deutsches Politikmodell (hier Austerität anstelle von Keynesianismus), um weitere Integrationsschritte zu erlangen. Das war bereits der deutsch-französische „Deal“ im Maastrichter Vertrag, der die Europäische Währungsunion ermöglichen sollte (Parsons 2003). Es stellt sich also die Frage, warum Deutschland, wirtschaftlich und politisch der mächtigste Staat in der EU, dennoch so viele Forderungen nach vertiefter Integration und finanzieller Unterstützung im Laufe der Krise akzeptieren musste. In letzter Zeit haben einige Wissenschaftler einen Trend zur „Politisierung“ deutscher und französischer EU-Politik ausgemacht, die die Europäische Integration den oft durch Furcht und Skepsis gekennzeichneten Präferenzen der nationalen Wähler stärker aussetzt (Harnisch 2006, Schild 2008, Schild 2009). Dieser Trend scheint sich in den Antworten auf die Schuldenkrise der EU zu bestätigen. In Angela Merkels Reden über Deutschlands nationale Interessen und die „europäische Realpolitik“ (s. die vorhergehenden Kapitel) zeigt sich mit Sicherheit die klare wahltaktische Orientierung an den Präferenzen der eigenen öffentlichen Meinung. Allerdings gelang es ihr nicht, auf europäischer Ebene genügend Handlungsautonomie zu gewinnen, um diese Position durchzusetzen, so dass sie die Verhandlungspräferenzen der deutschen Regierung nachjustieren musste. Im Folgenden argumentiere ich, dass dieser deutsche Diskurs deshalb politisch wenig erfolgreich war, weil er nicht auf den legitimen Normen der europäischen Arena basierte. Während es Nicolas 2 Sarkozy erfolgreich gelang, französische Positionen innerhalb der legitimierten europäischen Normen, wie Solidarität und Bekenntnis zu einer „immer engeren Union“, zu verankern, war Angela Merkels Diskurs die zu offensichtliche Verkörperung nationaler Bedenken. Dieses Argument bezieht sich auf eine sowohl normative, als auch diskursive Konzeption der europäischen Arena. Einerseits entsteht die Legitimität von Entscheidungen und politischen Prozessen in der EU aus der Kongruenz mit gemeinsam geteilten Normen. Während sich die Wissenschaft in diesem Zusammenhang bisher auf (repräsentative oder partizipative) demokratische Normen konzentriert hat (Saurugger 2009, Schimmelfennig 2010), kann Solidarität ebenfalls als eine der normativen Grundlagen der EU gesehen werden. Andererseits hängt die interaktive Herausbildung von Präferenzen und das Verhandeln in der EU von diskursiven Praktiken und „rhetorischem Handeln“ ab (Schimmelfennig 2003, Schmidt 2006). Dieses Kapitel konzentriert sich auf die erste Phase der Krise, die mit der Explosion der griechischen Staatsschulden im Herbst 2009 begann und mit der Annahme des „Pakts für den Euro“ im März 2011 endete. Diese Sequenz steht für die Herausbildung der diskursiven Wahrnehmung (framing) der Krise, die sich seitdem nicht besonders verändert hat. Dabei dient eine Rahmenanalyse (frameanalysis) von 34 Pressekonferenzen und Presseinterviews französischer und deutscher führender Politiker als empirische Grundlage. Das Kapitel unterteilt sich in drei Teile. Der erste Abschnitt erklärt die Relevanz und grundsätzliche Herangehensweise einer Diskursanalyse für die Untersuchung der Euro-Krise. Der zweite Teil stellt eine Rekonstruktion der Dynamik der Debatten dar, die im „Pakt für den Euro“ zu einem Kompromiss geführt haben. Der letzte Abschnitt führt aus, wie die schwache normative Rechtfertigung des deutschen Diskurses die Wirksamkeit der Position Angela Merkels beeinträchtigte und sie zwang, die deutschen Präferenzen anzupassen: von einer Position, die nach mehr Autonomie in Europa suchte, zu einer Haltung, die das Management von Interdependenz in den Vordergrund stellte. Diskurs: Die Substanz und der Motor europäischer Politik Die normative Dimension des Diskurses Der Untersuchung von Diskursen kommt aus mehreren Gründen eine entscheidende Bedeutung zu, wenn es um die Erklärung der Frage geht, ob in der Eurokrise eher Tendenzen auszumachen sind in Richtung verstärkte politische Integration und Solidarität, oder, im Gegenteil, in Richtung Egoismus und Minimalkompromissen. Erstens vermitteln die Reden politischer Verantwortungsträger deren Vorstellungen über ihr Land und Europa. Sie dienen der Rechtfertigung ihrer Entscheidungen und Handlungen, sowohl gegenüber den anderen europäischen Partnern, als auch gegenüber der 3 heimischen öffentlichen Meinung. Öffentliche Äußerungen, die die EU-Politik eines Mitgliedstaates rechtfertigen sollen, wohnt eine stark strukturierte Dimension inne, da Eliten dabei durch traditionelle Vorstellungen von Europa eingeschränkt werden – wie bspw. der grenzenlose Binnenmarkt, oder der Wertegemeinschaft – die dem nationalen Wahlvolk von ihren Vorgängern vermittelt wurden (Schmidt i.E.). Vor allem in Krisenzeiten kommt Diskursen deshalb eine bedeutende Rolle zu bei der Generierung von Entscheidungen, oder, in anderen Worten, politischen Ergebnissen, als Resultat von Debatten, Widerspruch, Deliberation oder Verhandlung zwischen den diversen politischen Akteuren. Wie V. Schmidt schreibt, „hängt ein ‚erfolgreicher Diskurs‘ von der relativen Stärke seiner kognitiven Argumente, der Resonanz seiner normativen Argumente, der Angemessenheit der Informationen, auf denen das Argument beruht, der Relevanz oder Anwendbarkeit seiner Empfehlungen, der Konsistenz seiner Ideen, und weiteren Elemente ab“ (Schmidt 2010:62). Die in diesem Beitrag entwickelte Erklärung fokussiert spezifisch auf die normative Dimension des Elitendiskurses. Das von F. Schimmelfennig entwickelte Konzept des „rhetorischen Handelns“ ist besonders nützlich, um die Mechanismen hinter der EU-Politik zu verstehen. Der analytische Ansatz des „rhetorischen Handelns“ basiert auf der Annahme, dass die EU eine Gemeinschaftsumwelt aus Werten und Normen ist, d.h. es wird von allen Mitgliedern erwartet, dass sie sich zu diesen gemeinsamen Werten bekennen. Auch wenn die Akteure in erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgen: „die Notwendigkeit der Rechtfertigung erlaubt und zwingt die Akteure, zu argumentieren. Sie sind verpflichtet, ihre politischen Ziele zu rechtfertigen auf Basis der in der EU institutionalisierten Identität, Werte und Normen. In anderen Worten, der Legitimitätsstandard dient als Garantie oder Absicherung für die Gültigkeit eines Arguments im Diskurs. Akteure, deren Eigeninteressen mit den Gemeinschaftsnormen übereinstimmen, haben die Möglichkeit, ihre Position relativ günstig zu rechtfertigen. Sie werden ihre egoistischen Ziele argumentativ absichern und die Position ihrer Gegner delegitimieren. Dieser strategische Nutzen von normbasierten Argumenten zur Verfolgung von Eigeninteressen ist rhetorisches Handeln“ (Schimmelfennig 2001: 63). Darüber hinaus sollte präzisiert werden, dass es in der Diskursanalyse nicht darum geht, ob Akteure wirklich „glauben“, was sie sagen, sondern vielmehr soll gezeigt werden, wie Akteure Diskurse strategisch nutzen können, um Überzeugung zu produzieren und Politikergebnisse zu beeinflussen. Schließlich muss noch betont werden, dass innerhalb der europäischen Arena die normative Dimension der EU-Politik partikularistische Argumente von Vertretern der Mitgliedstaaten effektiv 4 begrenzt, da sich partikularistische Diskurse innerhalb der europäischen Arena kaum legitimieren lassen1. Interessen und Präferenzen als Konstrukt Die hier verwendete konstruktivistische und diskursive Perspektive ist deshalb nicht irrational. Allerdings weicht sie stark von realistischen Analysen und Analysen rationaler Wahl ab, die davon ausgehen, dass Machtressourcen und nationales Interessenkalkül der hauptsächliche Antrieb der Interaktion zwischen Staaten sind. Diskurse reflektieren nicht einfach (wirtschaftliche oder geostrategische) ‚objektive‘ Interessen. Interessen und Präferenzen sind nicht gegeben, sie sind politische und soziale Konstruktionen, die sich auf bestimmte Ideen gründen (Hay 2010). Sie unterliegen der interaktiven Dynamik rhetorischen Handelns. Präferenzen werden durch die Gewichtung der multiplen Interessen eines Akteurs geformt. Sie entstehen in einer politischen Umgebung, die durch Unsicherheit gekennzeichnet ist, in der der Wahrnehmung von Interessen und Situationen eine wichtige Rolle zukommt, und sind das Ergebnis der Reaktion der Akteure auf eine Abfolge von Ereignissen (Hall 2005). Daraus ergibt sich, dass Interessen dynamisch sind und im Laufe der Ereignisse neu zusammengestellt werden. Obwohl realistische und rationalistische Ansätze wichtige Aspekte der Motivation von Akteuren verdeutlichen, sind sie schlecht gerüstet, um das politische Resultat der Eurokrise zu erklären: Wie könnten sie erklären, dass Frankreich so erfolgreich seine Sichtweise einem stärkeren, mächtigeren Deutschland aufgezwungen hat, dessen Präferenzen noch dazu dem im Maastrichter Vertrag historisch etablierten institutionellen Rahmen der Währungsunionen entsprachen? Dieses Kapitel argumentiert, dass der deutsche Diskurs sich während der Eurokrise in der Dynamik rhetorischen Handelns verfangen hat. Es war kein „guter Diskurs“ in dem Sinne, dass wesentliche Elemente fehlten, um die deutsche Position und ihre politischen Optionen in den Augen der anderen europäischen Partner zu legitimieren – besonders Frankreichs, aber man kann hier auch den Chef der Eurogruppe und Luxemburger Premierminister Jean-Claude Juncker anführen. Angela Merkel wurde als „schlechte Europäerin“ bezeichnet und musste entsprechend ihre Position anpassen. Nicolas Sarkozy dagegen formulierte sehr erfolgreich einen legitimen Diskurs. Das bedeutet jedoch selbstverständlich nicht, dass die französische Position weniger partikularistisch war. Vielmehr war der französische Präsident in der Lage, die französischen nationalen und materiellen Interessen diskursiv mit der gemeinsamen Norm der Solidarität kompatibel zu machen. 1 Außer in bestimmten Zusammenhängen, wenn politische Akteure zum Beispiel in Referendumskampagnen an demokratische Werte (Volkssouveränität, Selbstbestimmung, usw.) appellieren. 5 Frame-Analysis (Rahmenanalyse) politischer Diskurse Unter Bezug auf verschiedene Forschungsansätze, die die Rolle von Ideen und Diskursen in den Vordergrund stellen, basiert die folgende Analyse auf dem Ansatz des „diskursiven Institutionalismus". Die grundsätzliche Annahme ist, dass die dialektische Beziehung zwischen Diskurs und dem institutionellen Umfeld, in dem er geäußert wird, darüber entscheidet, wie sehr der Diskurs den politischen Prozess beeinflussen kann. Die Äußerungen französischer und deutscher Politiker können als „kommunikativer Diskurs“ verstanden werden, der auf Normen und Werten basiert und sich an ein weiteres Publikum richtet, im Gegensatz zum „koordinativen Diskurs“, der kognitive Argumente bedient und sich eher in begrenzten Politikzirkeln entfaltet (Schmidt 2008). Dieser theoretische Ansatz wird nun über eine Rahmenanalyse von 34 Reden auf Pressekonferenzen und Presseinterviews französischer und deutscher verantwortlicher Politiker operationalisiert. Von den Arbeiten des Soziologen Erving Goffman inspiriert, gibt es seit vielen Jahren eine Konjunktur von Arbeiten zu sozialen Bewegungen oder staatlicher Politik, die untersuchen, wie politische Akteure eine Debatte „rahmen“, d.h. den Gegenstand einer Debatte definieren, konstruieren, und begrenzen, wie ein Debattengegenstand also wahrgenommen wird. Rahmung (framing) kann definiert werden als die Art und Weise wie Akteure „relevanten Ereignissen und Bedinungen Bedeutung zuschreiben und diese interpretieren“ (Snow und Bendford 1988). Rahmungen sind Interpretationsschemata, die drei Funktionen erfüllen: i) Sie setzen Grenzen, um die Aufmerksamkeit auf Ereignisse zu lenken, die sich innerhalb des Rahmens befinden, und von anderen Ereignissen abzulenken; ii) einen bestimmten Lauf der Dinge vorzugeben (Schön und Rein 1994); und iii) Unterstützung zu stärken und Gegner zu schwächen (Snow und Bendford 1988). In diesem Kapitel werden drei Arten von frames identifiziert: i) dynamische narrative frames, ii) kognitive und normative frames, iii) Identitäts-frames. Die dynamischen frames erlauben es erstens, die verschiedenen Narrative der Krise zu rekonstruieren. Einerseits schreiben die Politiker der Krise Sinn zu, formulieren eine Diagnose und bezeichnen Verantwortlichkeiten, indem sie die Fragen beantworten: „was ist das Problem?“ und „was ist passiert?“. Andererseits enthält die Prognose die Antwort auf die Frage „was soll getan werden?“: hier stellen politische Verantwortungsträger ihre bevorzugte politische Lösung vor. Zweitens beziehen sich die normativen und kognitiven Frames auf die Lösungsvorschläge, die von politischen Führungspersönlichkeiten und Gestaltern unterstützt werden. In der Literatur wurden bereits vielfach Typologien entwickelt, um jene Ideen zu konzeptualisieren, die im politischen Prozess einflussreich werden (Hall 1993; Marks und McAdam 1996; Sabatier 1998; Metha 2010). Vivian Schmidts Unterscheidung von drei Abstraktionsebenen, deren Argumente von den am stärksten kognitiv geprägten (Rechtfertigung durch Expertise und Problemlösungsfähigkeit) zu den am stärksten normativ geprägten (Rechtfertigung durch den Bezug auf Werte und Legitimität) reichen, überzeugt besonders: 6 - Ideen, die sich auf konkrete politische Maßnahmen und Lösungen beziehen (zum Beispiel den permanenten Rettungsschirm) - Ideen, die sich auf umfassendere politische Programme und Paradigma beziehen (zum Beispiel Stabilität oder Konvergenz) - Ideen, die sich auf Philosophien oder Normen beziehen (z. B. Frieden, Solidarität). In unserem Fall ist die wirtschaftliche Umverteilungs-Dimension, zwischen partikularistischen politischer Haltungen einerseits und den Befürwortern von Umverteilungsmechanismen in der EU andererseits, von besonderer Bedeutung (s. das Einleitungskapitel dieses Bandes). Um der Schuldenkrise zu begegnen, beinhalten die unterschiedlichen Lösungsansätze unterschiedliche Umverteilungsmechanismen zwischen den Mitgliedsländern der Union. Drittens müssen Identitäts-Frames untersucht werden, um zu verstehen, welche Vorstellung politische Verantwortungsträger von Europa und der Rolle ihres Landes in Europa haben. Eine der Arbeitshypothesen dieses Buches ist, dass der Erfolg einer politischen Forderung nach Rückzug auf eine partikularistische Position (also Ablehnung von Gemeinschaftseuropa) einhergeht mit einer erfolgreichen identitären Mobilisierung. Der geschichtliche Hintergrund erklärt im deutschen Fall, warum Identitätspolitik in der gegenwärtigen politischen Landschaft Deutschlands nicht verfängt. Dennoch existiert, wie in anderen europäischen Ländern, die Vorstellung, dass die Bereitschaft für Solidarität – und Transferzahlungen – in erster Linie im Zugehörigkeitsgefühl zu einer nationalen Gemeinschaft wurzelt. Insofern entspricht die in der heutigen EU notwendige Solidarität also keineswegs den 1990 nach der Wiedervereinigung entwickelten Transfermechanismen innerhalb Deutschlands. Erhoben werden Frames, die Grenzen konstruieren zwischen „uns“ (den Deutschen, den Europäern) und „den anderen“ (die Problemländer, die Spekulanten…). Aus der Untersuchung dieser drei Dimensionen (dynamisch, kognitiv und normativ, identitärer Zugehörigkeitsframe) wird ein Verständnis der Europavisionen resultieren, in denen französische und deutsche Politiker ihre politischen Vorschläge verankert haben. Auf dem Weg zum Kompromiss Eine Reihe empirischer Studien haben gezeigt, dass neben dem Inhalt eines Diskurses der diskursiven Dynamik ein Schlüssel beim Verständnis politischer Debatten in der EU zukommt (Crespy 2010, Seidendorf 2010). Der politische Kontext und die Sequenzierung der Interaktionen zwischen den Akteuren des politischen Spiels sind entscheidend, um die Bedeutung des Diskurses zu entschlüsseln. Dieser abstrakte Gedanke soll in diesem Abschnitt konkret vermittelt werden am Beispiel der 7 Divergenz französischer und deutscher Krisennarrative zu Beginn des Untersuchungszeitraums und der anschließenden Entwicklung der deutschen Position nach einem Prozess diskursiver Konfrontation, in der ein Kompromiss mit dem französischen Partner gefunden werden musste. Dabei lassen sich grob zwei Sequenzen unterscheiden: zwischen Februar und März 2010 konzentrierte sich die Debatte auf die Notfallmaßnahmen, um Spekulationsattacken gegen die griechischen Staatsschulden zu unterbinden. Zwischen Juni 2010 und 2011 wurden dann neue Elemente einer weitergehenden makroökonomischen Koordination diskutiert, als (mit dem irischen Fall) deutlich wurde, dass die Schuldenkrise nicht nur ein griechisches Problem war, sondern ein strukturelles Problem der ganzen Eurozone. Der Weg zum Kompromiss war dabei durch einen intensiven, konfrontativen Dialog zwischen Frankreich und Deutschland gekennzeichnet. Einerseits hielten Nicolas Sarkozy und Angela Merkel fünf gemeinsame Pressekonferenzen in Brüssel, Berlin oder Paris innerhalb eines Jahres, um ihre Einigkeit zu demonstrieren. Andererseits war diese Phase auch geprägt durch intensive bilaterale Interaktion, die auf die Überzeugung der politischen Klasse und der öffentlichen Meinung im jeweiligen Nachbarland zielte. Dazu gehörten bspw. Interviews führender französischer Politiker, besonders Christine Lagardes, in der deutschen Presse, und umgekehrt. Auch eine Reihe bilateraler Treffen fand statt, bspw. der Besuch Wolfgang Schäubles in Paris im Juli 2010, ein deutsch-französischer Gipfel in Deauville im Oktober 2010, und ein Arbeitstreffen beider Finanzminister in Straßburg im Januar 2011. Die deutsche Rahmung der Krise gründet sich auf der Idee der Ordnungspolitik. Dieses ordoliberale Paradigma war in den 1950er Jahren entwickelt worden und gab den Rahmen für das Wirtschaftswunder im Nachkriegsdeutschland unter der Führung Ludwig Erhards. Dabei handelt es sich um eine allumfassende und besondere Form des Neoliberalismus, die als Alternative zum Keynesianismus entwickelt worden war und die, bis zu einem gewissen Grad, auch das deutsche Konzept der sozialen Marktwirtschaft geprägt hat (Ptak 2004). In dieser Logik ist die Rolle des Staates darauf beschränkt, die Rahmenbedingungen für das Funktionieren der Marktwirtschaft zu sichern. Europäische wirtschaftliche Integration wird entsprechend als das Resultat funktionierender, integrierter Märkte verstanden. Im Gegensatz dazu gründet die französische Wahrnehmung der Krise in Keynesianismus und staatlichem Interventionismus. Die beiden unterschiedlichen frames wurzeln sehr deutlich in den respektive ordoliberalen bzw. interventionistischen nationalen Kulturen, die fortbestehen und die jeweiligen Konzeptionen der EU-Integration rahmen: während französische Politiker sich politischem Voluntarismus verschrieben haben (z.B. Wachstum und eine europäische Industriepolitik zu fördern), favorisieren deutsche Entscheider Regulierung, Wettbewerb und die Unabhängigkeit von Regulierungsbehörden wie der Zentralbank (Uterwedde 2011). Diese unterschiedlichen Paradigmen konstituieren mächtige, pfadabhängige ideelle Strukturen, indem sie zu völlig unterschiedlichen Analysen von Ursachen und Lösungen der Krise führen, und damit zu 8 kontrastierenden Narrativen, zu unterschiedlichen politischen Präferenzen. Aus deutscher Sicht war die Verletzung der Maastrichter Regeln und die Laxheit gegenüber den ansteigenden nationalen Schuldenbergen und Haushaltsdefiziten die Erbsünde. Angela Merkels Krisennarrativ „rutscht“ von der Vorstellung, dass die griechischen Schulden eine Konsequenz der Krise seien (Interview in der FAZ, 5.02.2010) zur Vorstellung, dass die griechischen Schulden die Ursache der Krise seien (Rede im Bundestag, 05.05.2010). In wiederholten Äußerungen stellt Merkel klar, dass Griechenland, als Ergebnis der schlechten Gewohnheiten, nun am Vertrauensverlust sowohl der EU-Partner, allen voran Deutschland, als auch der Finanzmärkte, zu leiden habe. Der Unterschied zur französischen Rahmung der Krise wird sehr deutlich in Nicolas Sarkozys Narrativ, dass „es die Spekulation gegen Griechenland ist, mit dem Ziel, den Preis für das Geld, das Griechenland benötigt, künstlich hochzutreiben, was in vielen Ländern passieren könnte, wenn wir uns keine gemeinsame Antwort vorstellen können“ (Pressekonferenz 07.03.2010, s. auch C. Lagarde in der FAZ, 17.05.2010). Als Folge der divergierenden Analyse der Ursachen der Krise formulieren Frankreich und Deutschland auch unterschiedliche Problemlösungsvorschläge. Ich werde mich dabei im Folgenden auf drei Maßnahmen-Sets konzentrieren, in denen Deutschland eindeutig seine Präferenzen verändern musste: Die finanzielle Hilfe für überschuldete Staaten, die möglichen Sanktionen gegen diese Staaten, die Koordination der Wirtschaftspolitik der 27 EU-Mitgliedstaaten als Ganzes. In allen drei Fällen zeigten sich die deutschen Ideen als unrealistisch, sie wurden in ihrer Tragweite durch den französischen Gegen-frame entscheidend geschwächt: Als die griechische Regierung ernsthafte Probleme bei der Refinanzierung der griechischen Staatsschuld einräumen musste, war Angela Merkel bekanntermaßen erst nach längerem Zögern zu einer Rettung des Landes bereit. Auf der ersten gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten im Februar 2010 insistierte sie dass „wir zur selben Gruppe gehören, aber dass es Regeln gibt und dass es deshalb wichtig ist, dass Griechenland heute sagt, dass es nicht um Geld bittet“, und später, dass „es extrem wichtig ist, über Griechenlands Probleme zu reden, und Griechenland fragte nicht nach finanzieller Hilfe“, wobei sie auch erwähnte, dass „Regeln respektiert werden müssen, dass wir uns völlig darauf verlassen können müssen, was Griechenland tut“. Auf derselben Pressekonferenz betonte N. Sarkozy vor allem, dass „Griechenland Teil der Eurozone ist, Griechenland ist Teil Europas, wir unterstützen Griechenland“ (Pressekonferenz 11.02.2010). Letztendlich, angesichts der Ereignisse und der rapiden Verschlechterung der griechischen Kreditwürdigkeit auf den Finanzmärkten, musste Angela Merkel jedoch einen Rettungsplan akzeptieren, wobei es jedoch drei Monate – von März bis Mai 2011 – dauern sollte, die geforderte starke Konditionalität zu verhandeln, das heißt, die Verknüpfung finanzieller Unterstützung mit einem drastischen Spar- und Austeritätsprogramm für Griechenland. In diesem Zeitraum erhöhte 9 Nicolas Sarkozy den Druck auf die deutsche Kanzlerin, wobei er den Appell an ihre europäischen Überzeugungen für sich instrumentalisierte: „Ich glaube an die Solidarität Deutschlands mit Europa, ich glaube an Frau Merkels europäische Überzeugungen“ (Pressekonferenz 07.03.2010). Dennoch bestand Deutschland zunächst weiter auf seiner zögerlichen Haltung, was finanzielle Unterstützungen betraf. Finanzminister Wolfgang Schäuble erläuterte in der heimischen Presse, dass finanzielle Unterstützung vorübergehend und begrenzt sein würde (Interview in der FAZ, 24.07.2010, Pressekonferenz 16.09.2010). Außerdem gelang es Angela Merkel, eine Übereinkunft mit dem Internationalen Währungsfonds durchzusetzen, der einen Teil der Lasten übernehmen sollte, was Nicolas Sarkozy gerne verhindert hätte. Als schließlich der 700 Mrd € EFSF im März 2011 angenommen wurde, rechtfertigte Angela Merkel Deutschlands Beteiligung unter Bezug auf die „dauerhafte Stabilisierung der Eurozone“ (Pressekonferenz 23. März 2011). Die zweite wichtige Forderung Deutschlands in der Krise war die Stärkung der Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Ländern, die die im Stabilitätspakt verankerten Regeln missachteten (Bild am Sonntag 02.05.2010). Dazu sollten finanzielle Sanktionen wie die Blockierung von Mitteln aus den Europäischen Kohäsionsfonds gehören, ebenso wie die Suspendierung von Stimmrechten im Ministerrat der EU (FT Deutschland 12.03.2010). Die Idee finanzieller Sanktionen wurde jedoch von französischer Seite als irrelevant und kontraproduktiv kritisiert (FAZ 17.05.2010). Schließlich wurde dann letztere Möglichkeit, als erweiterte Sanktionen die Stimmrechte eines Landes zu suspendieren, im Pakt für den Euro verankert. Da jedoch Einstimmigkeit für eine solche Entscheidung notwendig wäre, wird der deutsche Wunsch kaum jemals verwirklicht werden können. Drittens zögerte Angela Merkel, sich auf eine verstärkte makroökonomische Koordinierung einzulassen. Falls unumgänglich, war ihre klare Präferenz ein Mechanismus, der alle 27 Mitgliedstaaten einbeziehen würde, also nicht nur die Eurostaaten, wie die französische Idee einer „Wirtschaftsregierung“ es lange vorgesehen hatte. In vielerlei Hinsicht hielt sie ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten für den falschen Weg zu mehr Integration. Ihr Argument war, dass Wirtschaftspolitik mit dem gemeinsamen Binnenmarkt, dem Kern des europäischen Integrationsprozesses, verbunden bleiben sollte (Pressekonferenz 26.03.2010). Dieses Argument erwies sich jedoch als schwächer als das französische, wonach Geldpolitik primär zwischen Mitgliedern der Eurozone diskutiert werden sollte, wobei die anderen Mitgliedstaaten bei Bedarf einbezogen werden könnten, wenn weitere Themen betroffen wären. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Eurozone vor allem über ihre Fähigkeit, ihre eigenen Probleme zu lösen, diskutiert. Dahinter stand die Diskussion über andere potentielle Risiken zurück. Als die beiden Staaten schließlich im Februar 2011 sich auf den Pakt für den Euro einigten, hatte sich der deutsche Diskurs deutlich in Richtung auf die französische Perspektive einer politischen Integration Kerneuropas 10 hinbewegt, wie Angela Merkel anlässlich der Eröffnung einer gemeinsamen Pressekonferenz anmerkte: „Deutschland und Frankreich werden deutlich machen, dass wir den Euro nicht nur als Währung verteidigen – dies ist normal – sondern dass der Euro auch ein politisches Projekt ist. Das meint, dass wir neben den Maßnahmen für Solidarität […] auch als Europäische Union zusammenwachsen wollen, und dies vor allem mit den Ländern, die dieselbe Währung teilen.“ (Pressekonferenz 04.02.2011). Diese drei Beispiele – finanzielle Unterstützung, Sanktionen, Wirtschaftsregierung – zeigen, wie sich die deutsche Position im Laufe der intensiven, manchmal kontroversen Debatten und Verhandlungen mit dem französischen Partnern wandelte, im Angesicht der heimischen Öffentlichkeit, der anderen EU-Sstaaten und der ganzen Welt, die gebannt auf die Entscheidungen starrte, die die schlimmste Krise seit Bestehen des Integrationsprojekts lösen sollten. Während deutlich wurde, dass das, was Beobachter europäischer Politik als feststehende „nationale Positionen“ bezeichnen, dynamische diskursive Konstrukte sind, wird der nächste Abschnitt erklären, wann und warum die „Eiserne Lady“ in ihrem Willen, Deutschlands Rolle in Europa neu zu definieren, eingeschränkt wurde. Ergebnisse und Rechtfertigungen: Altes Frankreich: 1 – Neues Deutschland: 0 Das Argument dieses Kapitels ist, dass Deutschland, trotz seiner relativ überlegenen Machtposition, keinen Diskurs entwickeln konnte, der eine „realpolitische“ Vision der Rolle Deutschlands in Europa hätte legitimieren können. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Normalisierung Deutschlands beschleunigt und auch wenn es der reichste und daher größte Beitragszahler der EU bleibt, geht es heute nicht mehr darum, übertriebene finanziellen Lasten der europäischen Integration zu begleichen, um für die Verbrechen der Vergangenheit zu büßen. Vielmehr fehlen Bundeskanzlerin Merkel, im Angesicht der starken wirtschaftlichen und politischen Interdependenz, die normativen Grundlagen, um einen Paradigmenwechsel der deutschen Europapolitik zu mehr Autonomie zu legitimieren. Deutsche Ordnungspolitik: Stabilität, Konditionalität, Wettbewerbsfähigkeit Wie bereits erwähnt, war der deutsche Diskurs während der Krise vor allem durch das Konzept der Ordnungspolitik gerahmt. Im gegenwärtigen Kontext ist die Kernaussage dieses Frames, dass Staaten 11 die Kontrolle über ihre öffentlichen Finanzen behalten müssen und dazu exzessive Schulden verhindern müssen. In den vielen Konzepten, um diesen Gedanken in der deutschen Sprache auszudrücken – Haushaltsdisziplin, Haushaltskonsolidierung, Defizitkontrolle, Sparkurs etc.2 – kehrt dieses Leitmotiv des deutschen politischen Establishments regelmäßig wieder. Es ist bezeichnend, dass dieser Diskurs ohne philosophische oder explizite normative Rechtfertigung einhergeht. Stattdessen basiert er auf drei Ideen, die sich grob als politisch programmatische (V. Schmidt) oder paradigmatische Prinzipien (P. Hall) verorten lassen: Stabilität, Konditionalität, Wettbewerbsfähigkeit. Stabilität ist die traditionelle Rahmung, die dem monetaristischen Geist des Maastricht Vertrags entspricht: in diesem Vertragswerk ist die Kernaufgabe der EZB, Preisstabilität zu sichern (niedrige Inflationsrate), während die grundsätzlichen ordnungspolitischen Leitlinien im Stabilitäts- und Wachstumspakt etabliert wurden. Wie Jean-Claude Juncker es formuliert: „Ordnungspolitik ist nicht Austerität, es ist eine grundsätzliche Haltung, die sich aus der historischen Erfahrung der zweifachen totalen Zerstörung des Eigentums der Bürger entwickelte, wir sollten uns nicht darüber lustig machen, sondern diejenigen – wie ich, die Deutschland kennen und mögen – sollten diesen Zusammenhang immer wieder denjenigen erklären, die dieses Land nicht so gut kennen und es vielleicht nicht so sehr mögen.“ (PK 04.03.2011). Auch Angela Merkel erinnert häufig daran, dass Deutschland das Prinzip des ausgeglichenen Haushalts („Schuldenbremse“) in das Grundgesetz aufgenommen hat (PK 10.05.2010, Le Monde 19.05.2010). Die Stabilität der europäischen Währung ist deshalb eng verbunden mit, oder sogar eine Rechtfertigung für, die „Solidität“ der öffentlichen Finanzen durch Sparmaßnahmen in ganz Europa (Le Monde, 19.05.2010). Das zweite politisch-programmatische Element des deutschen Diskurses ist „Wettbewerbsfähigkeit“. Das Wort Wettbewerbsfähigkeit (und damit verbundene Ideen) wird in jeder Rede der Kanzlerin überstrapaziert: „Es ist eine Tatsache, und das wird überall anerkannt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Euro-Länder unterschiedlich ist und dass es uns allen nützt im Hinblick auf die wettbewerbsfähigsten Länder der Welt, wenn uns daran gelegen ist, unsere GesamtWettbewerbsfähigkeit zu pflegen und zu stärken. Wir müssen darauf achten, dass dies nicht zu exzessiven Divergenzen im Rahmen der Eurozone führt, sondern dass wir uns stattdessen durch eine bessere Wettbewerbsfähigkeit annähern“ (PK 04.02.2011). 2 So wie in Frankreich der Begriff „rigueur“ wegen seiner negativen politischen Konnotation vermieden wird, wenn über Austeritätsmaßnahmen gesprochen wird, wird im deutschen Diskurs „Konsolidierung“ gegenüber „Sparkurs“ vorgezogen. 12 Entsprechend war das deutsche Framing des neuen Vertrags, der im März 2011 angenommen wurde, die „Wettbewerbsfähigkeit“. Auch wenn der Vertrag im Anschluss, wegen der Divergenzen mit Frankreich, als „Pakt für den Euro“ bezeichnet wurde, wird er von deutschen Politikern doch regelmäßig als „Wettbewerbspakt“ bezeichnet (PK 04.02.2011, PK 11.03.2011). Indem sie diese Ideen einander annähert, vermittelt Angela Merkel implizit die Vorstellung, dass politisches Handeln in Richtung „Null Defizit“ automatisch zu stärkerer Wettbewerbsfähigkeit führt (Le Monde 19.05.2010). Diese Denkweise führt zurück zu den in der deutschen Kultur tief verankerten Prinzipien des Ordoliberalismus, dem in diesem Kontext eine starke normative Dimension zukommt. Jedoch wird diese ökonomisch-politische Kultur nicht von allen europäischen Ländern geteilt. Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit stellen diskursive Rechtfertigungen auf der politisch-programmatischen Ebene dar, aber ihnen fehlt eine tiefergehende normative Begründung, die für alle Europäer selbstverständlich wäre. Diese Schwäche des deutschen Diskurses lässt sich besser verstehen, wenn wir genauer auf die Identitäts-Dimension des Diskurses blicken, darauf, wie Grenzen zwischen „uns“ und „den Anderen“ Gruppen konstruiert und verbreitet werden. Es ist dabei bezeichnend, dass der gegenwärtige deutsche Diskurs Deutschland gegen den Rest Europas stellt. Nicht nur Griechenland, sondern auch Portugal und Spanien und in einem geringeren Maße Irland werden als „die Anderen“ dargestellt, die problematischen Länder, die die gemeinsamen Regeln verletzt haben und deutsches Vertrauen und das deutsche Bekenntnis zum europäischen Projekt missbraucht haben (Die Zeit, 31.03.2010). In diesem Zusammenhang führt Kritik an Deutschlands zögerlicher Unterstützung zu einem gewissen Rückschlag als sich zum Beispiel Finanzminister Schäuble auf ein Recht Deutschlands zur „Normalität“, das heißt einer Betonung seiner „nationalen Interessen“, berief (FT Deutschland 12.03.2010, Die Zeit 31.03.2010). Der Verdacht, dass es Deutschland an europäischem Engagement fehle, wird zurückgewiesen, während auf diejenigen, die die gemeinsamen Regeln nicht respektiert haben, mit den Fingern gezeigt wird: „ein guter Europäer ist nicht notwendigerweise jemand, der sehr schnell hilft. Ein guter Europäer ist jemand, der den europäischen Verträgen und nationalen Gesetzen treu bleibt, um den Euro nicht zu beschädigen.“ (Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag, 05.05.2010). Darüber hinaus wurden weitere Ausgaben zur finanziellen Hilfe Griechenlands vor der deutschen öffentlichen Meinung oft mit Bezug auf das „nationale Interesse“ gerechtfertigt (Die Zeit 31.03.2010). Daraus folgte, dass die Bundeskanzlerin nur unter dem Prinzip der „Konditionalität“3 zu finanzieller Hilfe bereit war, das heißt einer Verpflichtung der 3 Konditionalität ist interessanterweise kein neuer Rahmen in der europäischen Politik. Dieses Prinzip ist im Rahmen der EU-Erweiterungspolitik wohl bekannt: Präadhäsions-Hilfen der EU wurden mit der Bereitschaft zu ökonomischen und politischen Reformen in den Beitrittsstaaten verbunden, um so die EU-Standards zu erlangen. 13 überschuldeten Länder auf drastische Sparmaßnahmen um die öffentlichen Finanzen ins Gleichgewicht zu bringen (Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag, 05.05.2010). Das bedeutet praktisch, dass Unterstützung für überschuldete Länder abhängig ist von deren Bereitschaft, sich überprüfen und kontrollieren zu lassen und sogar direkte Eingriffe der anderen Mitgliedsländer und der EU-Institutionen in einem bisher zentralen Bereich nationaler Souveränität zu akzeptieren, nämlich die Fiskalpolitik. Letztendlich ist die hauptsächliche Rechtfertigung, um überschuldeten Ländern Hilfe zu gewähren, die gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz): „als wir die Währungsunion in den 1990ern verhandelt haben, war dies nicht vorhersehbar. Die Welt hat sich gewandelt, die Interdependenz ist jetzt eine völlig andere. Damals konnten wir uns nicht vorstellen, dass eine Krise in einem Land, das nur einige wenige Prozentpunkte aller Euroländer ausmacht, auf die Märkte anderer Länder innerhalb weniger Tage überschwappen könnte“ (FAZ 16.07.2010). Als die Kanzlerin den Bundestag um Unterstützung für den Rettungsplan für Griechenland bittet, beschwört sie die Geschichte, um Interdependenz und die daraus für Deutschland sich ergebende Verantwortung greifbar zu machen. Das hier entwickelte Narrativ zeichnet sich durch einen Übergang aus von „Deutschland ist ohne Europa nichts“ zu „Europa ist ohne Deutschland nichts“: „Die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg kann nicht von der sich parallel entwickelnden Europäischen Union getrennt werden. Darum ist die Europäische Integration ohne das deutsche Engagement nicht vorstellbar“ (Rede im Bundestag, 05.05.2010). Das framing der deutschen Position während der Eurokrise wurde also durch die politischen Paradigmen Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Konditionalität gerechtfertigt. Dieses framing wurde mit einem defensiven Identitätsdiskurs verbunden, der Deutschland als „aus Interdependenz zur Solidarität verpflichtet“ und zum Bezahlen der Sünden der Anderen gezwungen sieht. Diese defensive Haltung und die fehlende normative Rechtfertigung nährten den Verdacht, dass Deutschland selbstbezogen handelte und es an europäischem Engagement fehle. Als Konsequenz musste die Eiserne Lady jedoch nachgeben und den europäischen Partnern Solidarität geloben. Der französische Diskurs: Solidarität und Konvergenz Im Gegensatz zu Angela Merkel war Nicolas Sarkozy eifrig darauf bedacht, sich selbst als der „weiße Ritter“ darzustellen, der Griechenland rettet. Diese Diskrepanz zwischen dem französischen und deutschen Diskurs während der Eurokrise wurde noch durch die zwei unterschiedlichen Politikstile im heimischen Kontext der beiden Politiker verstärkt. Während Angela Merkel dafür kritisiert wurde, häufig zu vorsichtig und unentschieden zu agieren und zu einer Reihe von Punkten keine festen Überzeugungen zu haben, verkörperte Nicolas Sarkozy Voluntarismus und den Kampf gegen 14 politischen Stillstand, was ihn oft zu impulsiven Handlungen brachte. Dabei waren die wichtigsten Ideen in der französischen Rahmung der Krise, Solidarität und Konvergenz, klar auf die Einheit Europas gerichtet. Im französischen Diskurs war die Idee der Solidarität die wesentliche Rechtfertigung für die schnelle Annahme eines finanziellen Rettungsplans für Griechenland: „Der Euro impliziert Solidarität. Es kann keinen Zweifel über den Ausdruck dieser Solidarität geben (…). Die Solidarität der Währung, dieser ökonomische Binnenmarkt und die Solidarität der Währung gründen auf Solidarität. Ein Mitgliedsland der Eurozone muss sich in erster Linie auf die anderen Länder der Eurozone verlassen können, was sollte sonst der Sinn einer gemeinsamen Währung sein?“ (PK 08.05.2010). Indem das Prinzip der Solidarität in den Mittelpunkt gestellt wurde, tauchten die natürlich auch vorhandenen französischen nationalen Interessen bei der Konstruktion der französischen Position nicht auf, was dazu führte, dass diese Position in der Debatte als legitimer als die deutsche Position wahrgenommen wurde. In dieser Strategie findet sich auch der Hauptgrund, warum Frankreich eine Beteiligung des IWF ablehnte und stattdessen eine rein europäische Lösung favorisierte. In der Verhandlung über den Plan musste Frankreich schließlich Angela Merkels Willen akzeptieren, dass der IWF einen Teil der Lasten übernehmen sollte. Dieser Punkt betrifft dabei nicht nur die französischen und deutschen Divergenzen, was die konkreten politischen Lösungen betrifft, sondern auch, was die identitäre Wahrnehmung angeht. Dem Trend zur Stigmatisierung der verschuldeten Länder im deutschen Diskurs setzten Nicolas Sarkozy und Christine Lagarde regelmäßig die Rahmung eines europäischen „Wir“ gegen „die Anderen“ entgegen, wobei die Anderen die Finanzmärkte waren. Das Echo dieser Rahmung findet sich auch im oben erwähnten Narrativ, das die Gründe der Krise aus französischer Sicht darstellt. Öffentliche Schulden und Haushaltsdefizit sind hier nur Teil des Problems, sie werden erst durch die akute Bedrohung durch Spekulanten zum konkreten Problem. Schließlich zeigt sich Präsident Sarkozy auch eher bereit, auf das große historische Narrativ Europas zurück zu greifen, als die Kanzlerin: „Der Euro ist Europa, und Europa bedeutet Friede auf dem Kontinent“ (PK 08.05.2010). Neben Solidarität ist die wichtigste französische Rahmung der Krise die Idee der Konvergenz. Neben entgegengesetzten frames gibt es allerdings auch eine Reihe diskursiver Elemente, die nicht umstritten sind, sondern zwischen Franzosen und Deutsche geteilt werden. Dazu gehört bspw. die Idee einer weitergehenden wirtschaftspolitischen Koordination und, zu einem geringeren Grad, Stabilität und sogar Wettbewerbsfähigkeit. Zum Ende des Untersuchungszeitraums wird jedoch klar, dass Sarkozy Konvergenz, nicht Wettbewerbsfähigkeit, als das wichtigste Ziel des Pakts für den Euro sieht. Die Diskrepanz der Rahmung wird vom französischen Präsidenten zugegeben: 15 „Wir haben auch den Namen geändert, es heißt nun ‚Pakt für den Euro für Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz‘. Das beendet die Debatte zwischen denen, die für Konvergenz sind, und denen, die Wettbewerbsfähigkeit bevorzugen.“ (PK 11.03.2011). Mittlerweile findet sich auch die Rahmung der Wettbewerbsfähigkeit zu einem beträchtlichen Teil im französischen Diskurs (Christine Lagarde im Spiegel, 14.02.2001). Der wichtigste französische Erfolg im Blick auf die angestrebte Konvergenz ist die Etablierung der sogenannten Wirtschaftsregierung der EU, eine Zusammenkunft der Mitglieder der Eurozone in der französischen Vorstellung. Während von deutscher Seite die Lohnkonvergenz (mit einem Ende des automatischen Lohnausgleichs entsprechend der Inflationsrate) in den Vordergrund gestellt wurde, forderte Nicolas Sarkozy einen Schritt, den Frankreich schon lange vertreten hatte, nämlich den Einstieg in die Steuerharmonisierung als Beginn der Integration der Fiskal- und Steuerpolitik. Bedeuten die Unterschiede in der Wahrnehmung der Krise durch Frankreich und Deutschland, dass die beiden Länder unterschiedliche Vorstellungen von Europa haben? Wie finden sich die vorgestellten nationalen Positionen zur europäischen Solidarität in den jeweiligen institutionellen Präferenzen wieder, was den weiteren Ausbau der EU angeht? Der folgende Abschnitt geht diesen Fragen nach. Unterschiedliche Vorstellungen von Europa? Historisch war Deutschland ein Vertreter eines föderalen Ansatzes in Europa. Dies fand seinen Ausdruck in der berühmten Rede Joschka Fischers vor der Humboldt-Universität in Berlin, als er die Verabschiedung einer Verfassung für Europa forderte. Das vorliegende Kapitel argumentiert nun, dass ein Jahrzehnt später die deutsche Vorstellung von Europa sich dramatisch verändert hat und sich näher auf die französische Vorstellung eines Europas souveräner Staaten zubewegt hat. Der deutsche Diskurs zeigt immer noch eine größere Sensibilität für die supranationalen Institutionen, besonders die EZB und die Europäische Kommission, die Angela Merkel wesentlich häufiger erwähnt, als Nicolas Sarkozy, wenn sie die auf EU-Ebene getroffenen Entscheidungen erläutert. Sie ist sich auch der Rolle des Europäischen Parlaments stärker bewusst, welches nicht ein einziges Mal von Nicolas Sarkozy erwähnt wird. Dieser vertritt stattdessen eine konfrontative Haltung gegenüber JeanClaude Trichet und einigen Kommissaren. Gefragt nach der Kritik der Kommissarin Viviane Reding an den Methoden Frankreichs und Deutschlands, ihre Entscheidungen anderen EU-Ländern aufzuzwingen, antwortet der Präsident herablassend: „Ich kenne sie persönlich nicht und ich betrachte es nicht als wichtig, was gesagt wurde. Im Gegenteil sehe ich jedoch die einstimmige Entscheidung des Europäischen Rates als sehr wichtig an. Dies hat eine völlig andere Bedeutung“ (PK 29.29.2010). Nicolas Sarkozy besteht durchgehend auf der wichtigen Rolle des Europäischen Rates (und seines Präsidenten H. van Rompuy), im Gegensatz zur untergeordneten Rolle der Kommission: 16 „Die Kommission implementiert die Wirtschaftspolitik, die vom Europäischen Rat entschieden wurde. Das ist klar. Der Europäische Rat ist für die Koordination verantwortlich und entscheidet über die Leitlinien der Wirtschaftspolitik, entsprechend der Entwicklung der europäischen und globalen Situation. Die Kommission setzt dies um.“ (PK 25.03.2010). Gefragt, ob die Annahme des Rettungspakets einen Schritt in Richtung einer föderalen Ordnung bedeute, antwortete Christine Lagarde, dass die Schaffung des Stabilisierungsfonds keinerlei Kompetenztransfer auf die EU-Kommission beinhalte, und dass diese den Entscheidungen der Staaten untergeordnet bleibe. Gleichermaßen bestand Angela Merkel darauf, dass die Mitgliedstaaten die Kontrolle behalten und keine weitere Kompetenz auf die Gemeinschaft übertragen würden: „Deutschland wäre zögerlich (weitere EU-Kompetenzen zu schaffen). In keiner Weise gibt es einen neuen Kompetenztransfer auf die europäische Ebene: es handelt sich um Koordination zwischen Regierungen. Das bedeutet, die nationalen Parlamente müssen gefragt werden. Natürlich wird das Europäische Parlament informiert werden, aber es handelt sich, wie es bereits genannt wird, um eine intergouvernementale Kooperation zwischen Europäischen Mitgliedsländern (…) ohne Kompetenztransfer. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir ändern die Verträge nicht und wir definieren keine neuen Kompetenzen außerhalb der Verträge: Die Kommission wird sozusagen nur bewerten. Die Kommission hat die ganzen statistischen Daten über die Länder…“ (04.02.2011). Das föderale Modell scheint von einem zögerlichen Bundestag und einer skeptischen öffentlichen Meinung abgelehnt zu werden. In Deutschland wie in Frankreich muss jeder Schritt zu mehr Integration mit der Garantie versehen werden, dass die Staaten die Kontrolle behalten. Zusammenfassung Dieses Kapitel zielte darauf ab, dem Pakt für den Euro sinnhaft zu verstehen als Ergebnis französischer und deutscher Präferenzen. Bis zu einem gewissen Grade kann der Pakt als das Resultat von gemeinsamen Verhandlungen verstanden werden. Einerseits wurde der deutsche Versuch, die eigene Machtposition von den finanziellen Lasten der Integration in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten zu befreien, durch den französischen Diskurs stark eingeschränkt. Dafür waren die Basiselemente dieses Diskurses, die Idee der europäischen Solidarität und der notwendigerweise verstärkten politischen Konvergenz und integrierten Governance, verantwortlich. Andererseits bekannte sich das französische politische Establishment, voller Bewunderung für die Erfolge des deutschen Wirtschaftsmodells, zur Wichtigkeit einer effizienten Kontrolle und Disziplin der öffentlichen Haushalte bei der Suche nach Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung des Euro. 17 Außerdem sehen wir eine klare Konvergenz im Hinblick auf ein intergouvernementales Modell der Integration, in dem die wichtigen Entscheidungen durch die Staaten getroffen werden. Diese sollen in der Lage bleiben, ihre nationalen Eigeninteressen zu vertreten, im Gegensatz zu einem Modell, in dem supranationale Institutionen das Gemeinwohl vertreten. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass diese (begrenzte) Konvergenz aus einem diskursiven Prozess resultierte, in dem die deutsche Kanzlerin ihre zunächst unflexible Haltung aufgeben musste, die einseitig von einer partikularistischen Haltung im Hinblick auf finanzielle Unterstützung inspiriert gewesen war und sich in der öffentlichen Meinung in der Weigerung widerspiegelte, sich im Rahmen der EU finanziell zu engagieren. Diese einseitig nationale, europäisch nicht legitime Position führte dazu, dass Deutschland, der mächtigste Spieler in der heutigen EU, eine Reihe französischer Forderungen akzeptieren musste, besonders die erweiterte Governance der makroökonomischen Politik der Mitgliedstaaten. Wir haben eingangs dafür plädiert, dass ein konstruktivistischer und diskursiver Ansatz zur Erklärung von EU-Politik dieses (nur scheinbare) Paradox am besten erklären kann. Diskursive Interaktion zwischen politischen Verantwortungsträgern ist das entscheidende Element, um das Resultat von Debatten und Verhandlungen in der EU zu erklären: Um die Legitimität der eigenen Position zu sichern (und damit den Einfluss auf die Entscheidungsfindung zu gewährleisten), müssen die politischen Führer mit den in der EU entwickelten Normen übereinstimmen. Dabei bedienen sie sich vor allem einer strategischen Nutzung des Diskurses, oder „rhetorischem Handeln“, was darauf abzielt, bestimmte nationale Präferenzen als übereinstimmend mit gemeinsamen Normen darzustellen und diejenigen zu kritisieren, denen es nicht gelingt, ihr Gemeinschaftsengagement glaubhaft zu versichern. Während der Eurokrise scheiterte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf spektakuläre Weise daran, die neue deutsche Real(Europa)Politik in einem europäischen Gemeinwohl zu verankern. Dagegen rechtfertigte Nicolas Sarkozy regelmäßig seine Forderung nach der Schaffung finanzieller „Rettungsinstrumente“ mit dem Bezug auf europäische Solidarität. Das Ergebnis war, dass die französische Haltung auf europäischer Ebene legitimer erschien, während Angela Merkel ihr Egoismus vorgeworfen wurde und sie letztendlich nachgeben musste. Die Bedeutung der normativen Macht von Diskursen in der EU-Politik hat beträchtliche Bedeutung für die weitergehenden Fragestellungen, die in diesem Buch behandelt werden. Die meisten Beiträge finden einen Trend in Richtung verstärkt egoistischer, partikularistischer Argumente und Sichtweisen auf allen Ebenen von Regierungshandeln im gegenwärtigen Europa. Die Analyse der deutschfranzösischen Antwort auf die Schuldenkrise in der EU findet Belege dafür, dass dieser Trend dort an seine Grenzen stößt, wo gemeinsame Normen und Werte institutionell verankert sind und strategisch benutzt werden können, um gefährlichen Zentrifugalkräften entgegen zu wirken. Dabei geht es nicht darum, die materielle Realität und Bedeutung ökonomischer Interdependenz in Europa 18 zu leugnen. Da Ereignisse und die Wirkung von Entscheidungen jedoch im Hinblick auf eine unsichere Zukunft gedeutet werden müssen, könnte der entscheidende Unterschied zwischen weiterer Integration oder Desintegration jedoch sehr wohl in der institutionellen Festigkeit der normativen Grundlagen der EU liegen. Außerdem haben sich seit der Wahl von François Hollande zum neuen französischen Präsidenten die deutsch-französischen Auseinandersetzungen intensiviert. Da François Hollande – noch mehr als Nicolas Sarkozy – ein Befürworter finanzieller Solidarität mit südlichen EULändern ist, erhöhte sich Druck auf das von der deutschen Kanzlerin geforderte Modell und dessen normative Rechtfertigung erheblich. Nach den ersten Kontakten zwischen beiden Staatschefs bleibt die Debatte weit offen. Literatur Crespy, A. (2010). "When 'Bolkestein' is trapped by the French anti-liberal discourse: a discursiveinstitutionalist account of preference formation in the realm of European Union multi-level politics." Journal of European Public Policy 17(8): 1253-1270. Deubner, C. (2001) "Mieux gouverner la zone euro. Le fragile compromis franco-allemand." Notes du Cerfa Volume, DOI: Hall, P. A. (1993). "Policy Paradigm, Social Learning and the State : The Case of Economic Policy in Britain " Comparative Politics 25(3): 275- 296. Hall, P. A. (2005). Preference Formation as a Political Process: The Case of Monetary Union in Europe. Preferences and Situations. I. Katznelson and B. R. Weingast. New York, Russel Sage Foundation: 129160. Harnisch, S. (2006). Internationale Politk un Verfassung. Die Domestizierung der deutschen Socherheits- und Europapolitik. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften. Hay, C. (2010). Ideas and the Construction of Interests. Ideas and Politics in Social Science Research. R. H. Cox and D. Béland. Oxford, Oxford University Press: 65-82. Marks, G. and D. McAdam (1996). "Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity in the European Union." West European Politics 19(2): 249-278. Mehta, J. (2010). The Varied Role of Ideas in Politics: From "Whether" to "How". Ideas and Politics in Social Science Research. R. H. Cox and D. Béland. Oxford, Oxford University Press: 23-46. 19 Parsons, C. (2003). A certain idea of Europe. Ithaca, Cornell University Press. Ptak, R. (2004). Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft: Stationen des Neoliberalismus in Deutschland. Baden-Baden, VS Verlag für Sozialwissenschaften. Sabatier, P. A. (1998). "The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe." Journal of European Public Policy 5(1): 98-130. Saurugger, S. (2009). "The social construction of the participatory turn: The emergence of a norm in the European Union." European Journal of Political Research 49(4): 471-495. Schild, J. (2008) "Franzosische Europapolitik in einer verunsicherten Gesellschaft. Soziale Identitäten, europapolitische Präferenzen und Europadiskurse seit den 1980er Jahren’." Volume, DOI: Schild, J. (2009). Die "Domestizierung" französischer Europapolitk. Frankreich jahrbuch 2008. D.-F. Institut. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften. Schimmelfennig, F. (2001). "The Community trap: Liberal norms, rhetorical action, and the Eastern enlargement of the European Union." International Organization 55(1): 47-80. Schimmelfennig, F. (2003). "The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement of the European Union." International Organization 55(1): 47-80. Schimmelfennig, F. (2010). "The Normative Origins of Democracy in the European Union: Towards a Transformationalist Theory of Democratization." European Political Science Review 2(2): 211-233. Schmidt, V. A. (2006). Democracy in Europe. The EU and National Polities. Oxford & New York, Oxford University Press. Schmidt, V. A. (2008). "Discursive institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse." Annual Review of Political Science 11: 303-326. Schmidt, V. A. (2010). Reconciling Ideas and Institutions Through Discursive Institutionalism. Ideas and Politics in Social Science Research. D. Béland and R. H. Cox. Oxford, Oxford University Press: 4765. Schmidt, V. A. (2012). "European elites' diverging visions of the EU: diverging differently snce the economic crisis and the Arab Spring?" Journal of European Integration 34(2): 169-190. Schön, D. A. and M. Rein (1994). Frame Reflection. Towards the Resolution of Intractable Policy Controversies. New York, Basic Books. 20 Seidendorf, S. (2010). "Contesting Europe: the constitutive impact of discursive dynamics on national referendum campaigns." European Political Science Review 3(2): 423 -450. Snow, D. A. and R. D. Bendford (1988). "Ideology, frame resonance, and participant mobilization." International Social Movement Research 1: 197-218. Uterwedde, H. (2011). Quelles visions allemandes de l'Europe économique? L'unification allemande et ses conséquences, 20 ans après. S. Martens. Villeneuve d'Ascq, Presses du Septentrion: 107-121. 21