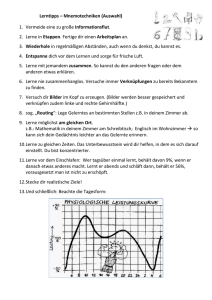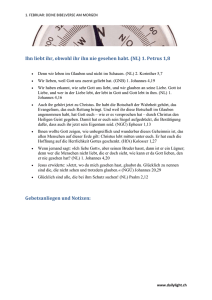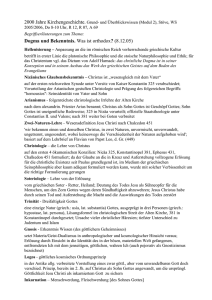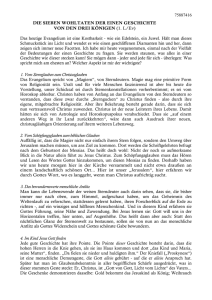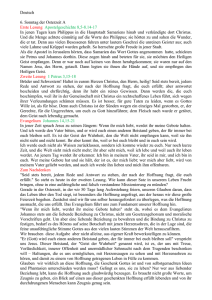Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes
Werbung

Predigt zu Römer 15,7 von Superintendentin Pfarrerin Ilka Federschmidt „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Liebe Schwestern und Brüder, als Paulus diese Worte schreibt, da geht es ihm um Konflikte in der christlichen Gemeinde in Rom. Christinnen und Christen jüdischer Herkunft und römisch oder griechisch heidnischer Herkunft tun sich schwer miteinander und stehen einander zum Teil in unversöhnlicher Fremdheit gegenüber. In diesen Kontext legt ihnen Paulus ans Herz: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Ein ganz anderer Kontext also als der, der uns heute bewegt, wenn wir Erfahrungen aus 50 Jahren Telefonseelsorge im Sinn und im Herzen haben. Aber die Aufforderung des Paulus greift von ihrem Wesen her weiter als nur in die Situation des damaligen Gemeindekonflikts. Sie gehört auch in die Telefonseelsorge, sie gehört in unser Leben und berührt es in der Tiefe. In dem Buch einer amerikanischen Psychologin zur Suchtprävention schreibt sie: „Uns Menschen (ist) das Bedürfnis in die Wiege gelegt, vorurteilslos und rückhaltlos gesehen, beachtet und aufgenommen zu werden.“ Das Bedürfnis, angenommen zu werden. Hinter wieviel Telefonanrufen verbirgt sich genau dieses Bedürfnis? Wie oft mögen Sie diese tiefe Sehnsucht zwischen den Zeilen oder ganz ausdrücklich hören: angenommen zu sein? Das Bedürfnis, mit offenen Augen angesehen zu werden – oder mit offenen Ohren angehört, ehrliches Interesse zu finden, Solidarität zu erfahren, dass jemand mir unter die Arme greift, mich ernst nimmt, meine Geschichte erträgt – ohne Urteil. So haben wir es eben gehört. Die Sehnsucht, angenommen zu sein – wie sehr kennen wir sie selbst? Und wie sehr tun wir uns schwer damit, macht sie uns Angst. „Ich schaffe das schon alleine. Ich habe immer alles geschafft, ohne Hilfe.“ So legt man den Panzer an gegen die Sehnsucht, angenommen zu sein. Wir brauchen es, angenommen zu sein. Das Bedürfnis ist uns in die Wiege gelegt. Aber das bedeutet ja: Angewiesenheit. Um das Bedürfnis zuzulassen müsste ich bejahen, dass ich ein angewiesenes Wesen bin – angewiesen auf Liebe, auf die Beachtung, auf die Aufmerksamkeit anderer. Das Angewiesensein auf Liebe, auf Beachtung, ist eine sehr empfindliche und verletzliche Angelegenheit, das wissen und erfahren wir alle. Sie werden in ihren Telefongesprächen viel davon hören – und vielleicht noch mehr Schweigen wahrnehmen: über Erfahrungen, benutzt worden zu sein in der eigenen Angewiesenheit, Missbrauch erfahren zu haben statt Annahme, oder die Erfahrung, dass mich jemand mit der Geste der Angewiesenheit unter Druck setzt, immer wieder meine Zuneigung zu beweisen. Kränkung und verletztes Vertrauen statt Angenommensein. Mangelndes Interesse statt wirklich wahrgenommen zu werden. Da muss dann jemand allen Mut zusammen nehmen, um über das zu sprechen, was im eigenen Leben schlecht gelaufen ist, was eine Last ist. Ich muss an die Paradiesgeschichte am Anfang der Bibel denken. Da leben die ersten Menschen, Adam und Eva, in glücklicher freier Angewiesenheit auf Gott und aufeinander. Und Gott zeigt Angewiesenheit auf sie: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir lesen von Gott, wie er durch den Paradiesgarten schlendert und mit dem Menschen spricht. Unbefangenes Angewiesen- und Angenomensein in der lebendigen Beziehung zu Gott und zwischen den beiden Menschen. Da flüstert die Schlange mit der Stimme der Versuchung. Sollte Gott gesagt haben, sie dürfen von der einen Frucht nicht essen? Gott weiß, flüstert sie ihnen ein, dann werdet ihr sein wie Gott. Ein Riss geht durch das Paradies. Das unbeschwerte Angenommensein durch Gott wird verdächtigt. Sein wie Gott, das müsste es sein. In dem Angewiesensein könnten sie zu kurz kommen. Die Erzählung vom Sündenfall erzählt von der unbegreiflichen Zerstörung der vertrauensvollen und erfüllenden Angewiesenheit auf Gott. Wenn ich dieses versucherische Angebot der Schlange „Ihr werdet sein wie Gott“ übersetze, dann heißt es doch: Ihr werdet alles allein schaffen. Ohne Hilfe. Ihr braucht Gott nicht. Ihr braucht einander nicht. In eindrücklichen Worten hat Fulbert Steffensky geschrieben: „Ein wundervolles Glück in der Liebe oder in der Freundschaft ist, wenn ein Mensch sagt: Ich brauche dich! Es ist eine der schönsten Liebeserklärungen… Es ist das größte Vertrauen, das Liebende einander schenken können, wenn sie ihre Unabhängigkeit und die eigene Autarkie aufgeben … Die Kälte des Lebens ist da hereingebrochen, wo man einander sagt: Ich brauche dich nicht mehr!“ Ich brauche dich – das ist der Satz der Angewiesenheit. Die Bejahung, das Angenommensein zu brauchen, gegenseitig. Steffensky schreibt: „Ich brauche dich! Ist ein verkappter religiöser Satz. Wer ihn spricht, weiß, was Gnade ist - nicht das Mittel, die Unterlegenheit des einen vor dem anderen zu überbrücken, auch nicht die Unterlegenheit des Menschen vor Gott. Gnade ist die Gewährung des Ansehens und der Liebe der Angewiesenen untereinander. Und so können wir nicht nur sagen, dass wir Menschen von der Gnade Gottes leben, er ist auch auf unsere Gnade angewiesen. Gott will geliebt werden…“ Diese Angewiesenheit auf das Angenommensein- sie macht den Menschen groß. Und die erstaunliche Erfahrung ist ja immer wieder, dass gerade die Erfahrung, angenommen zu sein, Menschen frei macht, andere anzunehmen. Sie macht frei, mal von sich selber abzusehen, nicht immer um sich selbst zu kreisen und in sich zu wühlen. Freiheit zur Selbstvergessenheit. Aber das vertrauensvolle Angewiesensein erhält einen Bruch. Es wird verdorben. Es wird zur Nahtstelle schlimmster Verletzungen und auch der Gewalt. Kain erhebt sich gegen Abel. Menschen tun sich schwer mit dem Annehmen und dem Angenommen werden. Vielleicht, weil im Paradies eins verloren ging: Sich selbst annehmen zu können. Als ein Wesen, dass eben nicht autark ist. Das angewiesen ist auf das Angenommensein. Ein Wesen, dass sich dann erst richtig erfährt und findet, wenn es sich in der liebenden Aufmerksamkeit Gottes findet. Ein Wesen, dass seine Erfüllung darin findet, angenommen zu sein und Gott und den anderen Menschen annehmen zu können. Wie oft habe ich diesen Druck schon in Seelsorgegesprächen gespürt: Als müsse man es alleine schaffen. Bis in die Debatte um die Sterbehilfe reicht dieser Druck, wenn die Würde des Lebens gleich gesetzt wird mit Selbstbestimmtheit, möglichst wenig Angewiesenheit. Kann ich mich noch annehmen, lieben, wenn ich nicht mehr – so – kann? Selbstannahme schöpfen wir ganz offenbar nicht aus uns selbst. Sie speist sich nicht aus uns selbst, sondern aus der Liebe, die wir erfahren – als tiefste und ursprüngliche Quelle aus der Liebe Gottes. Darum lebt für mich die Aufforderung „Nehmt einander an“ aus der Zusage: „Wie Christus euch angenommen hat“. Wie Christus euch angenommen hat. Können wir denn das zulassen? Das Christus uns angenommen hat? Können wir das an uns heran lassen? Aus der Schublade eines richtigen Glaubenssatzes heraus in unser Leben? Vielleicht haben Sie auch schon einmal in Gedanken überlegt, wie es wohl wäre, wenn Sie Jesus Christus leibhaftig gegenüberstünden, wissend, dass er es ist, wie seine Nachfolgerinnen und Nachfolger damals. Wie das wäre, wenn er Sie ansähe. Und mit einem Mal wird Ihnen bewusst, dass diese Augen ihr ganzes Leben sehen, in Ihre Seele blicken, auch das wahrnehmen, was wir in allem Tätigsein und Erleben vor uns verbergen, verdrängen, alle die Geschichten, für die man allen Mut zusammen nehmen muss? Würde es bei aller Freude nicht auch ein mulmiges Gefühl geben: Müsste ich mich vor diesen Augen nicht schämen? Was bleibt vor ihm von mir, von meinem Selbstbild, meinem Lebensgebäude? Ich denke an Petrus, der vor Jesus auf die Knie geht und sagt: Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was bleibt vor Jesus? Das sagen uns die Worte im Römerbrief: Es bleibt genau der Mensch, den er rückhaltlos und vorurteilslos sieht und liebt, achtet und annimmt – und dessen Liebe er selber braucht. Der Mensch bleibt. Und darf wieder atmen, zum Vorschein kommen: eine neue Kreatur, sagt Paulus. Wie Christus euch angenommen hat: in fünf Worten nicht blinde Liebe, sondern rückhaltlose Liebe. Liebe, die in uns das Bild Gottes sieht – gegen alles Versagen, gegen die eigene Kärglichkeit., gegen alle Unerträglichkeit und Feigheit. In fünf Worten Liebe, die die Kraft der Auferstehung hat: Die uns Menschen wieder holt in das wunderbare Glück, Gott zu brauchen – und von ihm gebraucht zu werden, andere zu brauchen – und von ihnen gebraucht zu werden. Wie Christus euch angenommen hat. Für die Aufmerksamkeit Gottes möchte ich gerne aufmerksam werden. Alle Wahrheit, alle Scham, alle unbändige Freude, alle Stärke, alles Glück, die Lebendigkeit, die oft zurückgehalten wird, alle Scherben, Schmerz und Glanz: Sie gehören in das Gespräch mit ihm. In die vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Der Klang der biblischen Worte, das Gebet wie auch immer radebrechend es sein mag, die Zwiesprache der Seelsorge: sie sind wie ein Freiraum, ein Asyl. Da kann ich erfahren: Aus den Händen Jesu Christi, die mich annehmen – kann ich mich selbst von ihm zurück empfangen und annehmen. Ich möchte die Meditation aufgreifen: Öffnen wir dafür unser Herz, strahlt auf wunderbare Weise Verehrung und Liebe in allen Facetten in unser Leben. Das ist längst nicht immer ein Gemütsgefühl, eine emotionale Bewegtheit, ein tiefer innerlicher Prozess – das zu erwarten kann auch ein Druck werden. Ich glaube, manchmal geht es um etwas sehr Nüchternes: Um einen Bund mit Gott, auf den man sich verlassen kann. Von daher wächst Freiheit, auch von sich selbst – für den anderen, die andere. Angenommen zu sein ist ein Grund unter den Füßen, der auf andere zugehen lässt. Gibt den Raum, andere Menschen einmal anzusehen und anzuhören als Menschen, die Jesus Christus angenommen hat. Die für ihn seiner ganzen Liebe wert sind – mit ihren unerträglichen Geschichten, den ganz-und-gar-nichtRuhmestaten, den Versuchungen. Glauben ist nicht zuletzt ein Lernen, unsere Mitmenschen wieder zu sehen – sie am Telefonhörer so zu hören – als von Gott Angesehene und Angenommene. Im Glanz seines Lichtes, im Klang seines Wortes. Ich möchte nocheinmal Fulbert Steffensky aufgreifen: „Manchmal lerne ich etwas über Gott, wenn ich die Menschen meiner Stadt sehe. Ich lerne, wie zärtlich er ist, wenn zwei Liebende küssen. Ich lerne, wie geduldig er ist, wenn ich einen Vater sehe, wie er mit seinem Kind spielt. Ich lerne, wie zornig er ist, wenn ich den Zorn der jungen Leute gegen den Krieg sehe. Ich lerne, wie schön er ist, wenn ich die Schönheit einer alten Frau und eines jungen Mannes sehe. Manchmal lerne ich nichts über Gott, wenn ich die verwüsteten, glatten oder brutalen Menschengesichter sehe. Aber ich lerne etwas über diese Gesichter, wenn ich mich erinnere: Es sind Ebenbilder Gottes. Sie werden diese Würde nicht los, nicht im Hotel Vierjahreszeiten, nicht im Gefängnis und nicht in den Bordellen.“ Wieviel weniger Krieg könnte es geben, ließen wir das zu, ließen wir das gelten für uns und andere: Angenommene Ebenbilder Gottes zu sein. Wenn wir uns selber einmal vor Jesus haben stehen sehen mit dem Schamgefühl eines Petrus und mit der Erleichterung eines Petrus über die ungebrochene Liebe Jesu, dann könnte ein bisschen mehr Güte in unser Herz ziehen. Großherzigkeit. Ausharrungsvermögen. Weniger Sorge um sich selbst. Weniger Reinstolpern ins Erleben und Tätigsein. Angenommen sein heißt: belastbar sein. Lasten teilen können. Wenigstens ein Stück davon. Das tun Sie in der Telefonseelsorge. Das Angenommensein haben Sie Menschen auf vielfältige Weise schon zugesprochen. Ihnen eine Last vielleicht nicht abgenommen, aber für einige Minuten mit getragen, ein kleines Stückchen. So wird das Telefonnetz zu einem großen Netz zum Lob Gottes. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass die Botschaft, die Sie selber damit weitergeben, in Ihre eigenen Ohren zurückklingt und Ihnen selbst weiterhin zu einem großen Segen wird. Amen.

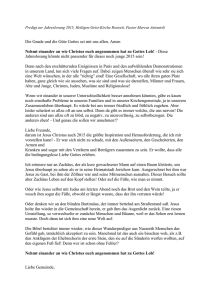
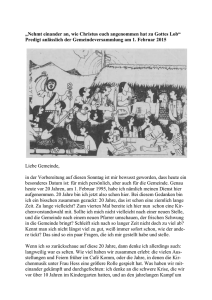
![Gottesdienst zur Verabschiedung PfrinHar[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/002231049_1-c68b29c1887bf43882c4652d18b1bf52-300x300.png)