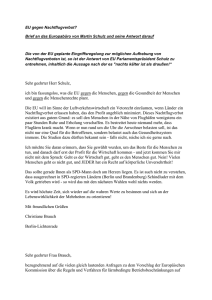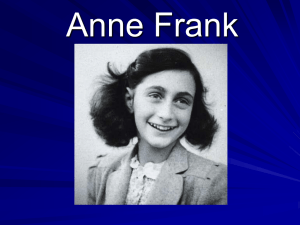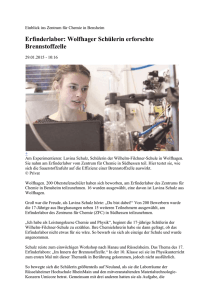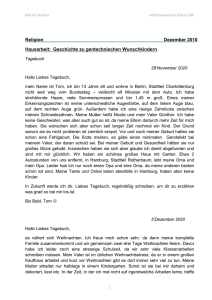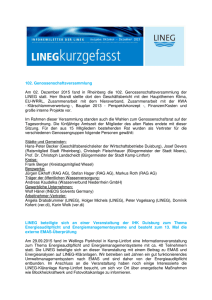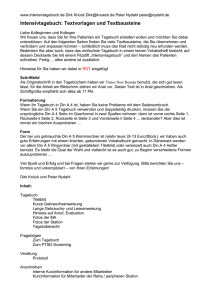Tagebuch seite 3 - Europeana 1914-1918
Werbung
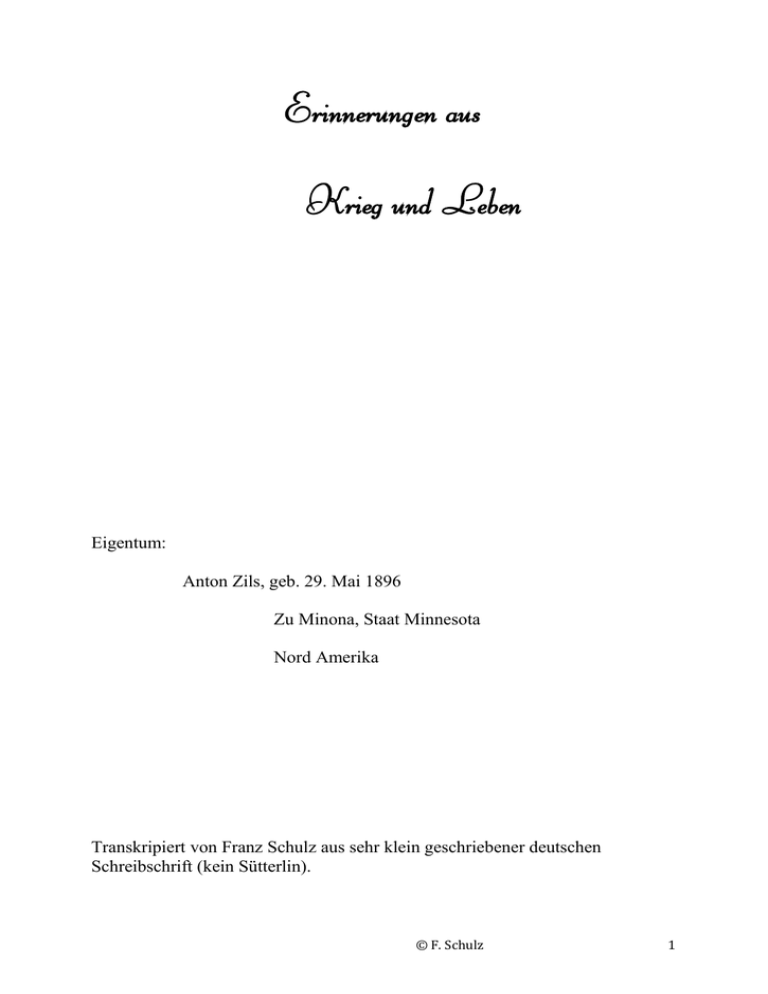
Erinnerungen aus Krieg und Leben Eigentum: Anton Zils, geb. 29. Mai 1896 Zu Minona, Staat Minnesota Nord Amerika Transkripiert von Franz Schulz aus sehr klein geschriebener deutschen Schreibschrift (kein Sütterlin). © F. Schulz 1 Tagebuch Seite 1 I. Abschnitt: Von August 1914 – Dezember 1914 1.August 1914 Beendigung der Lehre als Buchbinder bei Albert Sigloch, Stuttgart, Blumenstor 36a. 22. August 1914 Eintritt als Kriegsfreiwilliger beim Res. Inf. Reg. 120 Ersatz. Battl. Rekruten Depot II in der Stöckachschule, Einkleidung daselbst. Ausbildung auf dem Stöckachplatz, Privatquartier bei Kaufmann, Werastr., später bei Köm.(?) Rat Spemann hohen Geren 5. Beidemale ausgezeichnete Quartiere und gute Behandlung. Froh erlebte Stunden in Gesellschaft der Lehrertochter Emma Schmidt, die als wohltätiger Engel mir im Felde auch stets mit Rat und Tat hilfreich beistand. Gedenken will ich hier auch der Herrschaft, Herr und Frau Spemann, sowie der Tochter Eleonore, die mit offenen Händen reichlich Wohltaten spendeten. 18. November Abschied von der Heimat. Abtransport ins Feld. Kühler Abschied von Klara Aller, der Schwester meines Lernkameraden bei Sigloch. Die Fahrt ging durch das herrliche Rheinland.. Grenzstation Herbestal, durch Luxemburg und Belgien. Bei Böven (?) erstmals die Spuren des Krieges erkannt, kam mir leichtes Grausen über uns Kriegsfreiwillige. Weiter ging die Fahrt nach Nordfrankreich bis Be??. Daselbst wurden wir ausgeladen. Durch bitterkalte Nacht ging der Marsch. Nach 5 Stunden erreichten wir Pys, (Anm.: in der Nähe von Albert, Nordfrankreich) wo wir in einer Scheune Quartier bezogen. Die ganze Nacht brachten wir vor Kälte kein Auge zu. Die ersten Entbehrungen ließen uns erkennen, wie grausam doch der Krieg ist, auch aber auch wie stark wir sein mussten, um durch diese Strapazen und unsere Heimat zu schützen.. Mit argwöhnischen Augen wurden wir von der Zivilbevölkerung gemustert und mancher Blick des Hasses traf uns tief ins Herz. Tagebuch Seite 2 Er sollte uns aber auch vor Augen führen, wie groß die Feindschaft sein müsste; und wie stark wir noch werden mussten; um unsere Aufgabe richtig zu erfassen. Unser täglicher Dienst waren Feldübungen, Feldwachen an den Ortsausgängen und Kleiderreinigen. Das Wetter war miserabel. Das erste Mal auf Feldwache gab es Festtagsbraten: Der Hund des Nachbars musste das Fleisch liefern. Aber es schmeckte ausgezeichnet. Von der Front her kamen auch einige verirrte Granaten in unsere Nähe, die uns © F. Schulz 2 aber weiter nicht störten. Auch beobachteten wir eines Nachts von unserem Posten aus Lichtsignale vom Kirchturm her, nach einigen Tagen erfuhren wir, dass der katholische Pfarrer festgenommen wurde und erschossen sein soll. Diese letzten Wochen galten auch dem letzten Schliff für unser künftiges Frontsoldatenleben. Entbehrungen, Härte und Ausdauer sind notwendig für die kommenden Kämpfe. So nahte das erste Kriegsweihnachten. In der Abenddämmerung des 24. Dezember traten wir an. Der Marsch an die Front ging über Be-sur und Courselette nach La-Boiselle. Der Abend war ruhig. Immer näher kamen wir an die Front. Schon konnten wir die Leuchtkugeln von Freund und Feind unterscheiden. Rauchen durften wir nicht mehr. Einzelne Gewehrschüsse waren zu hören. Die ersten Gräben tauchten auf. Am Ortseingang von La-Boiselle war ein Unterstand als Verbandsplatz bezeichnet. Wir machten halt und wurden nun in die verschiedenen Kompanien verteilt. Ich kam zur 12. Kompanie. Ein Laufgraben links der Straße brachte uns in den Kampfbereich derselben. Wir wurden von den alten Frontkämpfern gut empfangen. Ich wurde der K?lschaft des Unteroffiziers Götz zugeteilt. Es sah da vorn anscheinend nicht gut aus, den die Worte des Unteroffiziers Tagebuch Seite 3 „Gott sei Dank, dass ihr kommt“ ließ vieles ahnen. In meinem kleinen Unterstand für 4 Personenlegte ich meinen Tornister ab. Der Krieg förderte gute Kameradschaft. Es war die Heilige Nacht. Zur Zeit der Postenablösung frug der Unteroffizier, wer von uns freiwilligen zuerst mit auf Posten wolle. Ich meldete mich, und so ging ich mit dem Unteroffizier und noch 2 Mann durch lange Laufgräben an ein vorgeschobenes Grabenstück, um hier auf Feldwache Posten zu stehen. Wir sprachen leise miteinander. Ich bekam, nachdem ich über unsere Lage und die Lage des Feindes unterrichtet war, schon etwas Mut. Die Gedanken an Weihnachten und die Heimat wurde ich nicht los. Plötzlich ein leises Geräusch. Das musste eine feindliche Patrouille sein. Vor uns bewegten sich einige Schatten. Der Unteroffizier gab leise den Befehl. Wenn ich los sage, wird geschossen in die Richtung, wo die Schatten waren. Vor uns bewegten sich die Schatten. „los“ Schon krachten 4 Gewehrschüsse durch die Stille der Nacht. Alles blieb still. Hatten wir getroffen? Vielleicht der erste Mord in der Heiligen Nacht? Das waren meine Gedanken. Nach 2 Stunden wurden wir von anderen Kameraden abgelöst. Wir legten uns in unserem Unterstand nieder, summten leise ein Weihnachtslied und schliefen selig ein. Friede den Menschen auf Erden. Der Weihnachtsmorgen fing an zu grauen. Welch schauriges Erwachen, als ich bei Tag zum ersten Mal alle Verwüstung des Krieges erkannte und mich damit abfinden musste, auch unseren Teil dazu beitragen zu © F. Schulz 3 sollen. Doch dieser Tag, 25. Dezember, er sollte mir meine Feuertaufe, meine Bewährung bringen, schrecklicher es keine Phantasie erträumen könnte. Der Vormittag verlief ruhig. Meine Kameraden beschäftigten sich mit den Grüßen aus der Heimat. Auch ich hoffte in dieser Tagebuch Seite 4 trostlosen Einsamkeit auf ein paar liebende Worte, aber vergebens. Das Gewehr in der Hand, den kalten Blick, dem Feinde zugewandt, überkam mich ein Gefühl des Verzagens und des Vergessenseins. Am Nachmittag kam der Befehl zur Ablösung der 5.ten Kompanie die in vorderster Stellung am Westrand von La Boiselle, etwa 40m vom Feinde lag. Ein einzelner Hof, zur Hälfte zusammengeschossen. Der Granatenhof(?) von La Boiselle gemeut(?), war vom Feinde festungsartig ausgebaut, immer für die unseren unbequem. Unsere Stellung war ein Schützengraben mit Schutzschilden und Unterständen, die mit Baumstämmen belegt, mit Erde aufgeschüttet waren. Diese Stellung sollten wir beziehen und die 5. Kompanie in unsere zurückgehen. Um 3 Uhr machten wir uns marschbereit, verließen unsern Laufgraben am Hohberg, und kamen in den Graben der durch das zerschossene Dorf dort in die Stellung führte. Verschiedene Stellen konnten vom Franzosen eingesehen werden. War es Unvorsichtigkeit oder Unerfahrenheit, jedenfalls hat uns der Franzose gesehen. Schon kam die erste Granate. Aber auch die erste Furcht bei uns jungen Kriegern vermissten. Die Alten gingen in Deckung oder suchten einen noch guten Keller auf während wir noch hilflos diesem immer mehr sich steigerndem Granatenhagel schutzlos und ohne Kenntnis gegenüberstanden. Ich war plötzlich allein, sah nichts mehr als Staub und Wolken und herabfallende Steine und Erdbrocken. Vor mir türmen sich noch die stehende Mauerwand der Kirche, hinter die ich mich verkroch und wartete und wartete. Die Gedanken überstürzten sich, ich glaubte nicht mehr, aus dieser Hölle heraus zu kommen. Immer wieder sausten Steine und Erde auf mich herab. Die Lage wurde immer unhaltbarer. Langsam kehrte in mir die Überlegung zurück. Ich musste etwas tun. So schüttelte ich Erde und Staub von mir, richtete mich auf, aber oh weh! Der Laufgraben war eben zerschossen. Ich machte trotzdem den Versuch, vorwärtszukommen, die ersten Kugeln der Franzosen pfiffen an mir vorbei. Ich hatte die Feuertaufe bestanden. Tagebuch Seite 5 © F. Schulz 4 In gebückter Haltung schlich ich weiter nach vorn. Ich musste doch noch auf Kameraden stoßen. Schon bog ich um die Ecke eines zerfallenen Hauses, da sah ich vor einem Kellereingang, zugehängt mit einem Sack. Ein Sprung, und schon kugelte ich einige Treppen hinab vor die Füße der Kameraden der 5. Kompanie. Auch sie waren erstaunt, dass ich mich so lange im Freien aufgehalten hatte. Beim Schein einer Kerze erkannte ich dann auch einige von meiner Kompanie, die besser orientiert waren, und den Unterstand natürlich sofort aufsuchten. Langsam fing es an zu dunkeln, und damit hörte aber auch das Granatfeuer auf. Wie wir uns alle wieder fanden, ist mir nicht bekannt worden. Wir gingen bei Nacht die wenigen Schritte in den Graben und verteilten uns gruppenweise in die Unterstände. Ich selbst wurde auch gleich auf Posten gestellt mit einem weiteren Kameraden. Da hatten wir Gelegenheit, im Schein aufsteigender Leuchtraketen uns die Stellung des Gegners zu betrachten. Der Granatenhof hauptsächlich hatte es mir angetan. Dass wir kein Auge von ihm liessen obwohl auch dort alles in tiefer Stille verharrte. Nochmals kehrten wir in Gedanken zurück in die Heimat, denn es war doch Weihnachten. Nach zwei Stunden wurden wir abgelöst und kehrten in den Unterstand zurück, wo wir uns niederlegten, und ein tiefer Schlaf uns alles vergessen lies, was wir in den letzten Stunden erlebt. Mit dem Tagsgrauen wurden nur noch Einzelposten aufgestellt, sodass wir übrigen uns in unserem Unterstand etwas einrichten konnten. Auch wurden Briefe geschrieben an die Heimat. Was hätten sie alles erzählen können. So war es in den ersten Tagen schon ein stilles Heldentum. Der Vormittag verlief meistens ruhig, aber mit dem Nachmittag begann auch wieder die Artillerie Beschießung in einem Maße, die nichts gutes ahnen lies. Der Graben wurde oben geschossen, sodass abends Pioniere mit Sandsäcken die Stellung wieder aufbauen mussten. Auch hatten wir in diesen Tagebuch Seite 6 Tagen unter den Freiwilligen die ersten Toten zu beklagen. Der Posten, der aus Neugier den Kopf zu hoch über den Grubenrand hob, erhielt einen Kopfschuss und fiel lautlos am Postenstand herunter. Er wurde von uns sofort hinter dem Graben zur letzten Ruhe gebettet. Die Franzosen hatten in der Mauerwand des Granatenhofes ihre Gewehre so eingebaut, dass sie jeden, der auf Posten stand und sich über den Graben beugte mit tödlicher Sicherheit trafen. Selbst durch das kleine Loch eines Schutzschildes wurde ein Mann verwundet. Auch mussten deshalb die Postenstände öfters gewechselt werden. Dieser Zustand war auf die Dauer unhaltbar. Am 27. Dezember kam der Befehl, den Granatenhof zu stürmen. Am Abend © F. Schulz 5 vorher erhielten wir auch unsere Weihnachtsliebesgaben. Auch gab es Wein und Schnaps. Der Angriff auf den Granatenhof war für uns gewissermaßen eine Erleichterung, würde doch endlich dieses Nest ausgehoben. Allerdings die späteren Folgen ahnten wir auch wieder. 5 min bis 1 Uhr nachts. Lautlos waren wir angetreten und standen an den Grabenwänden. Es sollte nur ein Teilangriff sein. Wir die 12. Kompanie und ein Zug 13-er Pioniere. Der Angriff war auf 1 Uhr festgesetzt. Eine Leuchtkugel sollte uns das Zeichen geben. Links und rechts sollten uns die Nachbarkompanie durch Gewehrfeuer die Flanken decken. 1 Uhr. Die Leuchtkugel ging hoch. Wir raus aus dem Graben. Mit wenigen Schritten hatten wir die französische Stellung erreicht. Der Posten konnte nicht einmal mehr einen Schuss abgeben. Wir besetzten die Kellereingänge des Granatenhofes und schrien hinab, sie sollten sich ergeben. Schon kamen die ersten Franzosen die Treppe herauf. Einer bot mir Zigaretten an, ich deutete jedoch, denn es waren so viele, dass mir ein wenig bang wurde. Die Gefangenen wurden in unsere Stellung geschickt. Von dort denn weiter transportiert. Wo man sich weigerte, die Keller zu verlassen, wurde mit Handgranaten nachgeholfen. Dann kamen Tagebuch Seite 7 sie alle. 4 Offiziere 100 Mann wurden gefangen abgeführt. Wir selbst hatten keine Verluste. Nun begannen die Pioniere ihre Arbeit. Die Keller wurden gesprengt. Die Reste der Häuser mit Öl begossen und angezündet. Nach einer Stunde war unsere Arbeit beendet, wir gingen in unsere Stellung zurück. Nur vom Friedhof her wurden wir etwas belästigt, ohne uns aber Verluste hinzuzufügen. Die Rache der Franzosen sollte allerdings nicht ausbleiben. Die Verluste durch Artilleriefeuer wurden immer größer. Bei Tag wurde der Graben eingeschossen, bei Nacht musste er wieder aufgebaut werden. Es verging kaum ein Tag, wo nicht ein Unterstand angegriffen wurde. Unsere Kompanie schmolz immer mehr zusammen. Noch in den letzten Tagen des Dezembers unsere Rote-Kreuz-Leibespakete. Auch von meinem Quartierherrn erhielt ich Wünsche, Esswaren und auch 1 Flasche Cognac. Ich hatte alles schön in meinem Tornister verstaut. Wieder war es einmal Zeit, den Posten abzulösen. Ich machte mich fertig. Die Nacht war kalt. So nahm ich meinen Cognac mit und trank ihn aus. Immer noch schoss der Franzose von Albert heraus auf unsere Stellung. Langsam trat Stille ein. Nach zwei Stunden wurden wir abgelöst. Aber wir fanden unseren Unterstand nicht mehr. Er war eingeschossen in futsch alle Linksgaben. Wir suchten ein anderes Quartier. Durch Verluste schmolzen wir immer mehr zusammen. Die Hälfte von und sind Kriegsfreiwilligen war tot oder verwundet. Endlich wurden wir abgelöst und kamen einige © F. Schulz 6 Tage in Ruhe nach Miraumont. Dort reinigten wir uns wieder von allem Dreck, reinigten unsere Gewehre und schrieben Briefe an die Heimat. Auch wir erhielten wieder Grüße und Liebesgaben. Nach 3-tägiger Ruhe mussten wir wieder vor in Stellung. Es wurde etwas ruhiger, die Artillerie lies auch nach mit Schüssen, dafür begann aber ihr Minenkrieg, über und unter der Erde. Unsere Minenwerfer mit ihren 2 Zentner–Minen richteten beim Franzosen schweres Unheil an. Selbst wir hatten darunter zu leiden. Denn der Luftdruck war so stark, dass wir selbst glaubten, zu zerspringen und manche Mütze flog da vom Kopfe. Tagebuch Seite 8 Unsere Lage wurde dadurch aber nicht besser, denn der Franzose zahlte 10-fach zurück. So gingen Wochen dahin. Immer denselben Dienst, immer dieselben Gefahren, bis wir eines Tages abgelöst wurden. In Ruhe kommen zur Erholung und Ergänzung unseres Menschenund Materialbestandes, um für neue Aufgaben gerüstet zu sein. In diese Zeit fällt noch ein Ereignis, das es besonders verdient, hervorgehoben zu werden. . Wir lagen in Vertry (?) in Reserve. Das kleine Städtchen war voll von Truppen. Kein Wunder, dass französische Flieger ihre täglichen Besuche machten. So auch an einem klaren Frühlingstage. Plötzlich zeigten sich am Himmel ein Dutzend französische Flieger, die bestimmt gutes Material mitgenommen hätten, wenn nicht hinter unserer Front ein anderes Geschwader aufgetaucht wäre. Unser Herz schlug rascher voll spannender Erwartung, denn es waren die weithin erkennbaren roten Flieger Richthofens. Wir ließen alle Vorsicht außer Acht, denn es war ein Schauspiel, das wir während des ganzen Feldzuges nicht mehr in dem Ausmaß erleben durften. Der Luftkampf entbrannte. Die roten Flieger erledigten ihre Aufgabe im Angriff, wie in der Abwehr, als wäre die Luft ein Exerzierplatz. T?holt??? ½ Stunde waren 10 französische Flieger abgeschossen, die meisten stürzten als brennende Feuersäulen ab. Leider war auch ein deutsches Flugzeug im Heldenkampf vernichtet worden. Einige Flugzeuge waren in allernächster Nähe abgestürzt. Die Insassen waren nur noch verkohlte Leichen. Der war echt Richthofen mit seinen Heldenfliegern. Die Stadt Wiburg und deren Besatzung ist dadurch von einer Beschießung verschont worden. Bald sollte für uns eine neue Aufgabe anstehen. Es war dies vielleicht der schrecklichste Tag meines Lebens. Der 6.April 1915 bei Beaumont. Tagebuch Seite 9 © F. Schulz 7 Der Angriff auf eine verlorengegangene Stellung war auf 6 Uhr früh angesetzt. Unsere Kompanie zählte ungefähr 70 Gewehre. Der Gegner musste unsere Pläne gekannt haben, kaum hatten wir unsere Stellung verlassen, setzte ein derart heftiges Granatfeuer ein, dass es unmöglich war, weiter vorzustossen. Wir erreichten wohl einen Graben aber unsere Aufgabe konnte nicht gelöst werden, und der Angriff muß als fehlgeschlagen betrachtet werden. Unsere Kompanie hatte 5 Tote 18 Verwundete also 23 Mann Verluste zu verzeichnen. Am späten Abend noch schrieb ich in die Heimat: Bin gesund und munter. Aber das Herz blutete mir noch über all dem Elend und Grauen, das ich an diesen Tagen geschaut. Wider wurden wir zurückgezogen und aufgefrischt zur neuen Verwendung. Die Zukunft war uns noch verhüllt, aber die Geschehnisse an der Front bei Arrns (?) liessen uns ahnen, was uns bevorstand. Lange Nachtmärsche brachten uns näher zum Ziel. Als wir die Stadt Lens (?) erreichten, waren wir schon im Bilde. Die Front war durchbrochen worden. Die Truppenteile bei Steuville(?) und Hernblein(?) waren entweder gefangen oder hatten sich ganz aufgelöst. So begann am 9. Mai 1915 der Vormarsch und Angriff. Tatsächlich hatten wir vor uns keine deutschen Truppen mehr. Der Angriff erfolgte auf breiter Front. Links von uns (Bat. 120) hatten wir die sächsischen Reg. 105 und 106. Rechts davon waren ??? Reg. Eingesetzt. Auch wussten wir, daß unser Gegner schwarze Truppen waren. Wir stießen lange auf keinen Widerstand. Erst langsam setzte die französische Artillerie ein. Der Vormarsch ging vorerst noch gut. Die sächsischen Regimenter waren mit jungem, frischen Blut aufgefüllt, die nach Aussage eine sehr kurze Ausbildung hinter sich hatten. Tagebuch Seite10 Die Jungen schienen das erste Mal im Feuer zu sein. Haufenweise ballten sie sich zusammen. Dem Gegner ein gutes Ziel bietend. So kam es auch, dass ein Volltreffer in eine Gruppe von acht Mann fuhr und ein grässliches Blutbad anrichtete. Auf einer Höhe von Hamblein angekommen, erhielten wir das erste Mal Infanteriefeuer. Vom Gegner sah man nichts. Schon gab es die ersten Verwundeten. Ein Kamerad hinter einem Busch liegend, rief mich an. Er war verwundet. Ich schnitt ihm den Ärmel auf und verband den Arm. Zum Dank durfte ich jetzt die halbe Feldflasche mit Schnaps austrinken. Durch den Samariterdienst hatte ich mich etwas verspätet, sodass ich fast allein im Feuer auf der Höhe war. Vor uns war nur ein Tal, das im sogenannten toten Winkel lag, das der Feind nicht übersehen konnte. Dorthin waren meine Kameraden geeilt und die Truppe hat sich dort © F. Schulz 8 wieder geordnet. Links am Abhang war ein kleines Wäldchen. Um dem Feind nicht als Zielscheibe zu dienen, nahm ich mir vor durch das Wäldchen zu springen. Kaum hatte ich das Wäldchen erreicht, stockte mein Schritt und mein Atem. 10 m vor mir entfernt standen, große Messer im Munde, die zähnefletschenden Schwarzen.. Ich gab mich verloren, denn meine Kameraden sahen mich nicht. Einen hätte ich ja erledigen können, aber die zwei Anderen. Ich stand still. Gedanken hatte ich keine mehr. Über diese schwarzen Tiere sollte das Schicksal bestimmen. Langsam kamen sie auf mich zu, mit vorgehaltenem Gewehr warte ich der Dinge, die da kommen sollten. Immer heftiger klopfte mir das Herz. Abmurksen lassen wollte ich aber doch nicht. Da kam mir Hilfe. Zwei zurückgebliebene Kameraden hatten mich Tagebuch Seite 11 eingeholt und die Lage sofort erkannt. Mein Schuss galt dem ersten Teufel, während die Kameraden fast gleichzeitig die 2 anderen zur Strecke brachten. 3 Schreie und schwer fielen die Körper zur Erde. Ein leichtes Rollen ihrer Augen noch und weiß hatte gegen schwarz gesiegt. Ein kurzer Lauf durch den Wald und wir hatten die Unseren wieder erreicht. Das aber erkannten wir auch, dass wir nach links keinen Anschluss mehr hatten. Die Sachsen waren zurückgeblieben. Langsam ging die Sonne unter. Der Vormarsch ging weiter, aber nicht mehr lange. Unsere Lage war ernst. In der Nacht erreichten wir einen Laufgraben, der nicht besetzt war. Er sollte unsere Stellung geben. Hungrig und abgekämpft legten wir uns im Graben nieder. Unser guter Zugführer, Leutnant Tosenhans bewies hier als Führer, was gute Kameradschaft ist. Er war sorgend und arbeitend um uns bemüht. Leider sollte er so bald von uns gerissen werden. Die Nacht war kühl. Wir wussten nichts vom Gegner. Vorne links ganz abgeschnitten, rechts wurde der Anschluss mit den braven Bayern hergestellt. Bald graute der Tag und wir konnten vor uns wieder die Schwarzen ungeniert hantieren sehen. Unser linker Flügel hatte Anschluss an die große Allee, die nach Arvas führt. Vor uns eine Höhe, die berühmte Lorrettohöhe mit ihrem Kapellchen. An der Allee war nur ein einzelnes Haus, wo die Schwarzen ein- und ausgingen, wie sie wollten. Links über die Straße eine kleine Anhöhe; unser Graben war kerzengerade ohne Schießscharten und Unterstände und konnte gut eingesehen und beschossen werden. Wir mussten uns daher Nischen eingraben, denn die Schwarzen konnten uns im Graben über den Haufen schießen. Tagebuch Seite 12 © F. Schulz 9 Im Laufe des Tages mussten wir eine andere Wahrnehmung machen. Die Schwarzen fingen an, uns auf dem linken Flügel, wo ja keine Truppen mehr waren, einzukreisen und von hinten zu beschießen. Die Lage wurde immer ernster. Auch hatten wir seit bald 3 Tagen nichts mehr zu essen. Immer wieder gab es Tote und Verwundete. Die Stimmung wurde immer gedrückter. Wir schienen ganz verlassen zu sein. Da am 12. Mai kam der erste Befehl. Abend 6 Uhr sollten wir angreifen, um uns aus dieser Lage zu befreien. Reservetruppen schienen keine da zu sein. Der Angriff schien von vorneherein ein sinnloses Blutvergießen zu sein und sollte es auch werden. Punkt 6 Uhr erfolgte das Zeichen. Unser Kompanie-Führer, ein Hauptmann stieg als Erster aus dem Kragen (?). Kaum stand er hoch, fiel er auch schon tödlich getroffen in den Graben zurück. Keiner von denen, die den Graben verließen, kam gesund wieder zurück. Tote und Verwundete lagen vor dem Graben. Auch unser guter Leutnant Tosenhans traf sofort das tödliche Blei. Von drei Seiten beschossen, musste der Angriff scheitern. Ich kam schon 10 Schritte, da fühlte ich einen Schlag an der rechten Hand. Das Gewehr fiel in 2 Teilen zu Boden. Drei Finger waren mir durchschossen. Ein zurück war unmöglich. So legte ich mich flach auf den Boden und grub den Kopf in die Erde. Die Kugeln pfiffen nur so vorbei. Manchmal schlug eine durchs Kochgeschirr. So lag ich drei Stunden, bis es dunkel war und ich es erwägen konnte, in den Graben zurück zu kriechen. Tagebuch Seite 13 Im Graben erhielt ich dann den ersten Verband. Nun rannte ich zurück nach Hamblain (Anm.:Hamblain-les-Prés, Frankreich), wo in einem Keller der Verbandsplatz war. Überall standen und lagen Verwundete. Schmerzen hatte ich keine, meine rechte Hand war leblos. Zum ersten Mal nach drei Tagen etwas zu essen, der Arzt gab mir ein Teller mit Reissuppe, ein fürstliches Essen nach all den Entbehrungen. Nachts ein Uhr trat ich den Marsch zurück an. Um 4 Uhr kam ich dann nach Haus zur Verwundeten–Sammelstelle. Aber welch ein Bild. Keinen Platz mehr zum Liegen. Wieder eine Reissuppe. Auf den Treppenstufen saßen wir und schliefen. Um acht Uhr morgens wurden wir gesondert und zum Bahnhof gebracht. Alles war transportfähig war wurde mit Lazarettzügen abgeschoben. Wir fuhren um 9 Uhr ab, kamen nach Lille. Dort waren alle Krankenhäuser und Lazarette überfüllt, so dass wir auf Matratzen und am Boden die Nacht verbringen mussten.. Die Verpflegung war reichlich und gut. Um ein Uhr Mittag wurden wieder die transportfähigen gesammelt und zum Bahnhof geführt. Unsere stille Hoffnung sollte sich bestätigen, wir fuhren der Heimat zu. Die Bahnfahrt auf deutschem Gebiete glich einer Triumphfahrt. Überall Liebesgaben und ein tiefes echtes Mitleid für uns © F. Schulz 10 Verwundete. Immer weiter gings das Rheinland hinab. Überall wurden Verwundete abgesetzt. Wir, als die Letzten kamen nach Essen. Ein Teil in die Kruppsche Villa. Wir kamen nach Essen West in St. Aunheim. Etwa 30 Mann lagen wir dort in einer Kleinkinderschule, betreut von katholischer Schwester, behandelt von einem sehr tüchtigen Arzt mit seiner überaus liebenswürdigen Assistentin. Tagebuch Seite 14 Acht Tage seit meiner Verwundung. Meine rechte Hand war noch immer ganz eingebunden. Die Wunde fing an zu heilen. Noch wussten die Lieben daheim noch nichts von meiner Verwundung. Ich konnte nicht schreiben. Ein Kamerad meines Regiments, der mich am Tage nach dem Angriff der Kompanie aufsuchen wollte, und mich nicht mehr fand, glaubte mich gefallen, und schrieb das nach Hause zu meinem Vater. Ihn selber traf am gleichen Tage, nachdem die Schwarzen angegriffen hatten, das tödliche Blei. So mag wohl in der Heimat Trauer geherrscht haben über mich. So ließ ich denn durch die Pflegeschwester vom Lazarett die meinen benachrichtigen, dass ich verwundet sei und in einem Lazarett liege. Die Freude mag wohl auf die erste Trauernachricht hin gewiss groß gewesen sein. Nach 4 wöchentlicher Behandlung war meine Hand soweit geheilt, dass ich entlassen werden konnte und die Fahrt zu meinen Lieben daheim antrat. Zuvor aber möchte ich noch derer gedenken, die mich gepflegt und behandelt haben und in inniger Dankbarkeit schied ich von dem mir lieben Essen, das mir fast wie eine Heimat anmutete. Viele Blätter wären notwendig wollte man all die Wohltäter und die Liebesgaben aufzählen, die uns alle bitteren Stunden vergessen ließen. Trotz des Verbotes waren die privaten Einladungen so zahlreich, dass man nicht immer Gebrauch davon machen konnte, wenn auch die Polizei oft zwei Augen zudrückte. So fiel mir eigentlich der Abschied schwer, doch je näher ich der Heimat kam, je schneller klopfte mir das Herz in Erwartung auf ein Wiedersehen mit meinen Lieben. Meine Freude mag groß gewesen sein, aber die Sorgen in Vaters Augen schienen noch nicht Tagebuch Seite 15 verflogen zu sein. Doch darauf folgende Urlaub verscheuchte alle trüben Gedanken. Im Ersatz-Bataillon in der Bergkaserne fanden sich denn langsam wieder die Kameraden, die draußen Schulter an Schulter gekämpft. Aber manchen deckt auch die Erde der Lorettohöhe für immer. © F. Schulz 11 Der Dienst im Ersatz-Bataillon war für uns, die wir schon im Felde waren, nicht besonders streng. Wir hießen ja Gennsommkompanie (?). Es gab auch reichlich Urlaub. Durch einen früheren Geschäftskollegen lernte ich dessen Schwester kennen. Ich weiß nicht, war es nur Zuneigung zu einer Freundschaft, oder regten sich tief in mir die ersten Triebe zur Liebe. Liebe war für mich damals noch ein fremder Begriff. Noch jung und frei von aller Belastung liebte ich eigentlich nur den Vater und meine Geschwister. Trotzdem glaubte ich festzustellen, dass Klara mir mehr sein wollte, als Kamerad. Meine Umgebung trug auch dazu bei, dass ich mich gegen früher etwas mehr mit dem Problem „Mann und Frau“ beschäftigte, ohne mich aber damit zu belasten. Was nützte es mir, die Heimat forderte mehr als Tränen, sie forderte Kampf und das Leben. So blieben mir die Begriffe Liebe und Liebesleid noch fremd. Und das war gut so. Es wurde September und mit ihm der Abschied von der Heimat, von Vater und Schwestern, (der Bruder war auch im Feld.) Es war schwer. Warum wusste ich eigentlich selber nicht. Trotzdem marschierten wir frohgelaunt von der Kaserne zum Bahnhof. Blumen schmückten Brust und Gewehr. Klara gab mir das Geleite bis zum Bahnhof, Tränen rollten über ihre Wangen. Am Bahnhof vor allen Tagebuch Seite 16 bat sie um den Abschiedskuss. Ich gab ihn, es sollte auch der letzte gewesen sein. Wir sollten dem Füselierregiment 122 zugeteilt werden. Die Fahrt war eine sehr lange, dafür aber interessante. Durch Böhmen, Österreich. Nach 5 tägiger Fahrt wurden wir Karschets(?), nahe der serbischen Grenze ausgeladen. Nach eintägigem Marsch kamen wir zur Zigeunerinsel zwischen Save und Donau. Die hier herrschenden Landessitten waren uns etwas neues. Die Orignale waren der Schweinehirt und die pfeifenrauchende Frau. Auch konnten wir schon Feststellungen machen über die Fähigkeiten der österreichischen Soldaten. das Urteil fiel nicht besonders günstig aus. Brot gab es zur Verpflegung sehr wenig., dafür entschädigte uns die Jagd auf Schweine und Hühner. Ein ideales Kriegerleben. Wir biwakierten im Walde. Das Wetter war schön und warm. Nur durften wir uns nicht sehen lassen, denn die Offensive stand bevor. Von der Heimat waren wir ganz abgeschnitten. So lagen wir einige Wochen bis der Aufmarsch beendet war. Am 9. Oktober kam der Befehl zur Offensive. Nachmittags drei Uhr begannen die Pioniere, die Pontons in die Save(?) zu setzen. Wir gleich hinein, immer so 20 Mann. Dann gings auf Leben und Tod über den breiten Fluss. Die Serben waren jedenfalls sehr überrascht. Die © F. Schulz 12 ersten Granaten jaulten daher. Wir hatten Glück. Unsere K???, als eine von den ersten landete am jenseitigen Ufer. Kein Gegner. 100 m vor uns eine Ortschaft. Hinter derselben ein einzelner Berg, wie zur Festung ausgebaut. Mann sah den Graben und auch die ersten Serben. Um uns war es so ruhig, dass wir fast Tagebuch Seite 17 misstrauisch wurden. Jeden Baum als Deckung benutzend, gingen wir durch das Ufergelände bis 50 m vor die Ortschaft heran, immer noch kein Feind. Wir gruben uns notdürftig ein und warteten, was da kommen sollte. Wir erfuhren auch, dass die Übersetzung seine Opfer forderte. Mancher Bonton mit Besatzung wurde ein Opfer der Granaten und ertranken. Die Pioniere mussten Heldenarbeit verrichten. Wo die Pioniere abgeschossen wurden, musste die Truppe sich selbst ans Ufer rudern. Es war bei uns eine Ungewissheit vor einem solchen Wagnis. Wenn die Serben Schneid gehabt hätten, so würden sie uns in den Fluss gejagt haben. Der Lage vollständig fremd, hatten wir keinen weiteren Befehl. So kam die Nacht. Die Ortschaft war mit einer Mauer umgeben, sodass wir nur die oberen Fenster der Häuser beobachten konnten. Aus diesen fielen auch die ersten Schüsse. Wir hatten die ersten Verluste. So kam die Nacht. Wir lagen in unseren Erdlöchern. Die Hälfte schlief, die anderen hielten Wache. Ich war mit einem Kameraden auf Vorposten, nahe der Mauer. Auch wir wechselten ab im Schlafen und Wachen, denn wir waren so erschöpft, dass uns fast allen die Augen zufielen.. Da plötzlich hörte ich ein Geräusch. Nahende Tritte verrieten uns den Gegner. Ich weckte meinen Kameraden und wir sprangen zurück zu den Unseren. Aber schon setzte ein Feuer von unserer Seite ein, dass wir Gefahr liefen, von den Eigenen erschossen zu werden. Langsam ließ das Feuer nach. Es war auch höchste Zeit, denn wir hatten nur noch wenige Schuss Munition und hatten auch keine Verbindung nach rückwärts über den Fluss. So verlief die Nacht ohne weitere Störung. Tagebuch Seite 18 Gegen Morgen kam dann auch neue Munition. Bei Tag konnten wir uns mit der Umgebung befassen. Unser Hauptaugenmerk galt den Fenstern. Von dem hinter der Ortschaft aufragendem Berg erhielten wir nun auch Feuer. Er schien uneinnehmbar zu sein. Mit Freuden vernahmen wir die Botschaft, dass von Stechern die österreichischen Motorenmörser den Berg beschießen würden. Wir konnten die Zeit kaum erwarten. Punkt ein Uhr kam die © F. Schulz 13 erste Granate. Sie ging etwas zu weit. Aber die zweite saß. Erdsäulen stoben gegen den Himmel. Menschenleiber flogen durch die Lüfte. Was sich dort oben noch rettete, wurde für uns zur Zielscheibe. Manches Händepaar streckte sich zum Himmel, ein Zeichen, dass wir gut getroffen hatten. Über zwei Stunden dauerte die Beschießung. Dann setzten wir zum Vormarsch an. Die Serben hatten sich zurückgezogen. Wir stießen auf keinen Widerstand. Die Zivilbevölkerung hatte weiße Tücher aus den Fenstern hängen. Es sollte aber nur zum Schein dienen. Denn oft wurden wir hinterrücks beschossen, selbst von den kleinsten Buben. Einzeln durften wir uns nie in der Ortschaft bewegen. Selbst die Misthaufen wurden lebendig, wenn man mit dem Seitengewehr hineinstach. Selbst dort hatten sich die Kerls versteckt. Feigheit und Hinterlist waren ihre Tugenden. So konnte man den Befehl verstehen, der ausgegeben wurde, weder Frau noch Kind zu schonen. Die Zivilbevölkerung wurde in Sammellager abgeschoben. Immer weiter ging der Vormarsch. Die Serben zogen sich zurück, um immer wieder von der nächsten Höhe uns zu beschießen. Erreichten wir dieselbe, war alles ausgeflogen. Bei Nacht verschanzten wir uns immer auf einer Höhe, um am andern Tag Tagebuch Seite 19 den Vormarsch fortzusetzen. Eine Patrouille mit einem Offizier und 20 Mann, die ausgeschickt wurde, um die nächste Ortschaft auszukundschaften, kam nicht wieder. Beim Vormarsch trafen wir einige tot auf der Straße mit ausgestochenen Augen oder mit einem Seitengewehr durchbohrt auf der Straße festgenagelt. Zurückgehende Verwundete wurden umgebracht. Ein Kamerad, der zwei Gefangene zurücktransportierte, wurde von einem Serben, der ein Beil unter dem Umhang versteckt hatte, der Schädel gespalten. Es war so begreiflich, dass wir keine Schonung mehr kannten. Einzelne gefangene Serben wurden einfach in ein Maisfeld gestellt und über den Haufen geknallt. Wir wollten keine mehr transportieren. Eine schöne Serbin, die uns Wein reichen wollte, wurde gezwungen, zuerst zu trinken. Nach kurzen Krämpfen fiel sie zu Boden und war tot. Vergiftet! Die Zivilbevölkerung wurde nun gesammelt und nach rückwärts in ein Sammellager gebracht. Bei Tag waren wir immer im Vormarsch, während wir bei Nacht uns auf einer Höhe eingruben. Die dritte Nacht lagen wir auf einem höheren Berg. Es war die Zeit, wo die Regenperiode beginnt. Wir hatten uns Löcher gegraben und schliefen darin. Schon begann es zu regnen. Unsere Müdigkeit war aber so groß, dass wir die Nässe nicht mehr spürten und mit dem ganzen Körper im Wasser lagen. Die Straßen waren unbefahrbar. Mancher Wagen musste ausgegraben werden. Zuletzt mussten wir sie doch noch zurücklassen. Zu essen gab es nichts © F. Schulz 14 mehr, als was(?) wir uns selber holten. Trauben und Fleisch war jetzt unsere Nahrung. So standen wir kurz vor Przarewick(?). Auf der Höhe hatten sich die Serben verschanzt und beschossen uns. Wir drangen durch mannshohe Maisfelder vor. Schon gab es die ersten Verluste. Tagebuch Seite 20 Lauter Kopfschüsse. Ich fühlte einen Schlag in meinem Gesicht, war auch getroffen. Langsam schwand mir der Boden unter den Füssen. Ich glaubte mein Ende nahen. Nahm im Geiste Abschied von allen in der Heimat, die mir lieb und teuer waren, besonders von meinem Vater, der zwei Feldzüge (1866 und 1870) mitgemacht, und ich als junger Bursche sollte schon sterben. Ein Blick ins Jenseits und mit einem stillen Gebet schwanden mir die Sinne. Ich war bewusstlos. Niemand hatte mich im hohen Maisfeld fallen sehen. Niemand vermisste mich, wo kaum einer den Anderen sah, nur hörte. So muss ich Stunden gelegen haben.. Bis ich entdeckt wurde. Am andern Morgen 8 Uhr wachte ich auf der Tragbahre im VerwundetenSammellager. Der Arzt fragte mich, wie es mir gehe. Ich wollte mich aufrichten, aber der Kopf war doch so schwer. Kein Laut kam aus meinem Munde. Der Oberkiefer war zerschossen. Der Arzt nickte stumm. Schmerzen hatte ich keine, alles war tot an mir. Aber Hunger hatte ich und konnte nichts essen. Nur die Gedanken waren klar, und langsam kam mir die Erinnerung von meiner Verwundung und von dem Abschied vom Leben. Gleichzeitig aber wusste ich auch, dass nur diesmal das Leben erhalten blieb. Und so ließ ich selbst mit mir geschehen. Der Trotz zum Leben war erwacht. Ich wollte die Heimat noch einmal sehen. So stimmte ich auch zu, als der Arzt fragte, ob ich eine mehrstündige Fahrt aushalten würde, nicht ahnend, welcher Leidensweg es sein sollte. Ein Bauernwagen wurde bis oben mit Heu gefüllt, und ich ganz sorgsam hineingelegt und los ging die Fahrt. 8 Stunden auf Straßen voll Löchern und Steinen. Jede Bewegung war ein Stich durch den Kopf. Ich war zu kraftlos, um mich zu halten. So stieß ich selbst oft den Kopf an den Wagen, wenn es über einen Graben ging. Tagebuch Seite 21 Ich glaube, der Fuhrmann, ein Sanitäter, fühlte und litt mit mir, denn sein trauriger Blick sagte mir alles. So kamen wir in einer Ortschaft zur Sanitätskollrun(?). Dort wurde ich in ein Auto umgeladen, und weiter gings. Hier waren die Straßen auch schon besser. Man spürte mehr © F. Schulz 15 Zivilisation. In dem schönen deutschen Städtchen Weißkirchen hielten wir vor einem Lazarett. Was ich vor Stunden hätte noch können, nun ging es nicht mehr. Man musste mich hineintragen. Ich war durch Blutverlust und durch die Fahrt zu schwach geworden. Freundliche Schwestern nahmen mich meiner an und reinigten mich von Schmutz und Blut, und ich kam in ein feines, weiches Bett. Der Schlaf hatte mich aber so übermannt, dass selbst ein neuer Verband noch etwas auf später verschoben werden musste. Nach einigen Stunden wachte ich auf. Ich hatte das Gefühl, als läge ich nur auf dem Kopf. Alles drehte sich herum. Ein Schwindelanfall. Ich verlangte nach dem Arzt. Sofort kam ich auf den Operationstisch. Staunend besahen sich die Ärzte die Wunden. Der Einschuss an der Nase schien nicht schlimm, aber der Ausschuss durch einen Querschläger veranlasst schier Faustgröße zu haben. Nun begann die Behandlung. Eine Unmenge von Knochensplittern musste tief herausgeholt werden.. Die Ärzte frugen mich, ob die Verwundung von einem Dum-DumGeschoß herrühre. Ich konnte es nicht sagen, und war froh, als sie mir den Verband anlegten und zurückbrachten. Ich konnte nicht liegen, da mich immer Schwindelanfälle befielen. Jeden Tag die gleiche Behandlung. Jede Nacht eine Ewigkeit, und eine Qual. Immer musste eine Schwester bei mir wachen. Rasende Schmerzen setzten nun ein. Fieberschreie hallten durch den Raum. Oft, wenn keine Schwester da war, stand ich auf, obwohl es streng Tagebuch Seite 22 verboten war, nur um ich zu vergessen. Mit Sehnsucht erwartete man den Tag. Im Bett neben mir lag ein Pfälzer, mit einem Beinschuss. Nach langem Zögern musste der Arzt ihm doch die Mitteilung machen, dass der Fuß abgenommen werden musste. Traurig und voll Verzweiflung nahm er die Botschaft auf, im Hinblick auf die immer wieder Sterbenden, denen nicht geholfen werden konnte. Für mich selbst begann nun die Behandlung. Drei Professoren sind für die Wunde, ein anderer für das durchschossene Ohr und wieder ein anderer für Kiefer und Zähne. Die Kiefer und Zahnbehandlung war die schwierigste und schmerzhafteste. Ein kleiner Trost war, dass die Assistentin des Arztes eine Schwäbin war, ich selbst auch der einzige Schwabe im Saal. Sie war es auch, die mich in den schmerzvollen Nächten tröstete und beruhigte. . Liebesgaben gab es in Hülle und Fülle. Hauptsächlich Trauben und Rauchwaren. H???rin d?? machten Besuche. Es war ein Trost in unserem stillen Heldentum, wenn Gruß von der Heimat kam. Wussten wir ja nicht, ob uns die Heimat uns je wieder sah. Langsam ließen die Schmerzen nach, nur die Schwindelanfälle plagten mich noch. Auch als ich endlich aufstehen durfte, machte sich der große Blutverlust durch große körperliche Schwäche © F. Schulz 16 bemerkbar. So wurde ich transportfähig. Nach 3 Wochen trat ich im Lazarettzug die Fahrt in die Heimat an. Ich war immer noch ans Bett gebunden, trotzdem war die Fahrt eine der schönsten in meinem Leben. So kam ich nach Sachsen in ein Lazarett. Zeitheim(?) war ein Truppenübungsplatz. In sauberen Baracken mitten im Tannenwald waren wir untergebracht. Dort wurde die Heilbehandlung dann fortgesetzt wie seither. So kam Weihnachten heran. Ein Fest, wo wir gerne Zuhause gewesen wären. Tagebuch Seite 23 Doch war auch hier Weihnachten, mitten im Walde, in winterlicher Landschaft schön und reich an Liebesgaben. Auch stand meine Entlassung in den nächsten Tagen fest. Endlich am 31. Dezember kam die Stunde der Abfahrt in die Heimat. War es eine Freude oder sollte es Enttäuschung sein. Wie musste mein entstelltes Gesicht wirken, blieben doch im Lazarett die Grüße von Klara ganz aus, sodass ich bei deren Herrschaft nach ihrem Ergehen anfragen musste. Das Eine war gewiss, das Vaterhaus würde mich mit offenen Armen aufnehmen. Und das andere? Eine stille Sehnsucht, vielleicht war es auch der erste Begriff von Liebe, hatte in mir Wurzel gefasst. Aber der Krieg und seine Folgen, die lange Abwesenheit, die Versuchungen, die Ungewissheit der Wiederkehr, sie hatten in manchem Frauenherz den Begriff der Treue schwinden lassen, und mancher junger Krieger, der erst im Begriff stand, Liebe und Frau kum(?) zu lernen, erhielt den ersten Dolchstoß von denen, für für die er sein Blut vergoss, für er gekämpft, gelitten, aber auch gesiegt hat. Es ist ein ungelöstes Rätsel, wenn 2 Menschen auseinandergerissen werden, nur weil der Krieg ein Mal ins Menschengesicht gezeichnet hat. Der Abschiedskuss war also ein Zuckerkuss gewesen. Wir Soldaten haben im Kriege die Frauenehre rein gehalten, warum sollte die Soldatenehre denn mit Füßen getreten werden? Um den Naturtrieb zu bannen, hatten wir oft Gelegenheit. So groß das Opfer der Entsagung war, so groß war auch unsere Liebe zur Heimat. Die Frau ist groß und erhaben, aber die Hingabe fürs Vaterland ist noch größer, edler und Tagebuch Seite 24 beständiger, denn sie klammert sich nicht an den Einzelnen, sondern ihr Wert verankert sich im ganzen Volke und seiner Heimat, das sie schützt. In solchen Stunden der Enttäuschung bot mir denn das Elternhaus wieder eine Stätte, wo Friede und Freude ausging und mich vergessen lies, dass unser Leben auch so reich an Bitterkeiten ist. © F. Schulz 17 Rasch vergingen die Tage des Urlaubs. Im Ersatz-Bataillion in Heilbronn mussten wir als dienstuntauglich weitere Weisungen abwarten. Die ärztliche Untersuchung bestätigte den Befund und ich wurde in die Heimat entlassen. Vor unserer Abreise wurden mir und noch einigen Kameraden das Eiserne Kreuz II. Klasse überreicht. Wieder gings der Heimat zu. Nach weiteren 4 Wochen wurde ich ganz vom Militärdient entlassen. Mit 30% Rente trat ich nun wieder ins Zivilleben ein. In Union Verlagsgesellschaft erhielt ich eine Stellung als Buchbinder. Mein Bruder, ebenfalls schwer verletzt, war noch vom Militärdienst entlassen, und hatte auswärts eine Stellung angetreten. Mit Vater und Schwester zusammen lebten wir in friedlicher Gemeinschaft, ohne aber vergessen zu können, die Helden der Front, den Krieg mit seiner Not, seinen Opfern und seinen Tränen. So kamen aber auch Stunden und Tage, wo die Gedanken dem Menschen erfassen und fragen, was ist deine Zukunft, wo steht dein Herz, was weißt du, trotz bitterer Erfahrung, von Liebe und Frau? Ist dein ganzes Sein nur auf den Krieg gerichtet. Schlägt in des Mannes Brust nicht auch ein Herz, warm und weich wie das eines Kindes. Bist du nicht schon aus Dankbarkeit verpflichtet. Wieviel Liebe wurde auch schon mir entgegengebracht. Und langsam schmolz das Eis der Enttäuschung, hin und wieder getrübt durch die Leidenschaft einzelner. Doch auch wieder aufgemuntert durch das Heldentum so vieler Frauen, die ihre Ehre rein hielten. Tagebuch Seite 25 Tage, Wochen, Monate vergingen, vor uns schützend, das feldgraue Heer, hinter uns die Heimat, beide rgfwed(?), leidend, liebend, trotz steigender Not und Entbehrungen. Im Januar erging an mich wiederum der Ruf des Heeres, auszumarschieren. Noch garnisonsdienstfähig kam ich zur Truppe. (7.R.121) wo ich als Essenträger zur vordersten Linie verwendet wurde. Bei anbrechender Dunkelheit begann unser Dienst. Das Essen war in großen Kannen, das Brot in Säcke verstaut, den ersten Teil des Weges, der noch befahrbar war, wurde mit dem Fuhrwerk zurückgelegt. Dann begann der Marsch. Stundenlang, den Esskessel oder einen Sack Brot auf dem Rücken, vorbei an zahllosen mit Wasser gefüllten Granattrichtern, waren wir dem Granatfeuer ausgesetzt, sodass wir täglich Verluste hatten, während die Kampftruppe vergebens auf Essen wartete. Beim Morgengrauen kehrten wir dann todmüde zurück. Oftmals hatten wir auch einen toten Kameraden zurückgetragen. Unser Weg war ein fortgesetzter Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner, oft hatten wir den Wunsch, mit den Kameraden vorn am Graben tauschen zu dürfen. Endlich wurden wir abgelöst. Der Stellungskrieg nahm © F. Schulz 18 uns wieder auf mit all seiner Wucht, seinen Leiden, bis wir ganz abgelöst ins Elsass in ??stellung kamen. Unsere weitere Verwendung war noch in Dunkel gehüllt. Eine Neueinkleidung für Gebirgstruppen ließ uns ahnen, dass ein neuer Kriegsschauplatz unser wartete. Heimatliche Flüsse, deutsche Leute, freudige Begrüßung auf der Fahrt, waren für uns dankbare Gaben, die die Heimat uns gab. Wie nahe waren wir dem Elternhaus und doch mussten wir vorbei, vorbei vielleicht für immer. Die Fahrt ging durch Bayern, Salzburg, Kärnten nach dem Süden. Italien sollte unser Gegner werden. In Karfreit (heute Kobarit) wurden wir ausgeladen. Es folgten lange, schwierige Märsche durch die Julischen Alpen. Tolmein, St. Lucia waren die ersten Zeugen furchtbaren Ringens; Monte Inoca (1150m) und Monte Kum (1070 m) waren das erste Angriffsziel unserer Truppe. Wenige Tage noch, wir hatten das Hochgebirge überschritten und kamen in die oberitalienische Tiefebene. Zueidele(?) war die erste Stadt, die wir erreichten, Brennende Häuser und Fabriken beleuchteten die Nacht, Tage schon hatten wir nichts mehr gegessen. Da die Maultiere mit Lebensmitteln nicht nachkommen konnten. Eilmarsch mit 60 km liessen für den Italiener nichts Gutes ahnen. Die Gefangenen wurden immer zahlreicher. Die Strassen waren vollgestopft mit Wagen und Viehherden. Unermessliche Werte wurden erbeutet. Unsere Ernährung war soweit sicher gestellt, Wein wurde getrunken wie Wasser. Tagebuch Seite 26 Verluste hatten wir in den ersten Wochen überhaupt keine. Udine wurde im Handstreich eingenommen. Zum ersten mal nach Monaten kamen wir in ein gutes weiches Bett. Weiter gings dem Tagliamento (Anm.: Fluss, Friaul, Oberitalien) entgegen. Der Übergang über die Brücke des 1800 m breiten Flusses war nicht möglich, Reserven hatten wir keine, es wäre ein Risiko gewesen, uns blindlings dem Gegner am anderen Ufer in die Arme zu werfen. Die Brücke war geladen und wurde auch gesprengt, Die Straßen waren auf Stunden mit Beute zurückgelassen, die Italiener waren feige. Tausende von Gefangenen fielen in unsere Hände, ohne Widerstand zu leisten. Unser gewaltiger Vormarsch hatte zur Folge, dass ganze Armeekorps ein- und abgeschlossen wurden und sich ergaben. Kraft und Ausdauer mit kluger Strategie verbunden, haben hier die größten Triumphe gefeiert. Unsere Pioniere brachten die Leistung fertig, trotz Artilleriefeuer in 7 Tagen eine befahrbare Brücke über den Tagliamento zu schlagen. Cotroigo (Bottrigo?), wo die Grenadiere kämpften gingen es heißer und nicht ohne Verluste ab, der Marsch über den Strom verlief ohne Störung. Das nächste Ziel war die Pinon (?), hier wurde uns dann ein Halt geboten. Die Offensive schien beendet zu sein.. Wir © F. Schulz 19 wurden zurückgezogen und kamen in Ruhe. 3 Wochen lagen wir in Simmette(?). Unsere Aufgabe war gelöst. Wir wurden wieder herausgezogen. Österreicher nahmen unsere Stellung ein. Der Rückmarsch war weniger eilig. Die Versorgung wurde spärlicher. Unsere Verluste, zum Teil durch Unvorsichtigkeit verschuldet, waren während der ganzen Offensive gering. (1 Toter, 6 Verwundete) Am 24. Oktober 1917 erhielt ich in Italien noch die silberne M.Verd.M. In San Daniele, nahe der Alpen, einem wunderschönen Städtchen kamen wir nochmals in Ruhe, daselbst feierten wir unser 4. Weihnachten. Mit diesem Fest machte sich auch wieder das Heimweh bemerkbar. Stunden des Friedens sind auch immer Stunden der Einkehr. Der Wunsch nach Frieden ist dem Weihnachtsfeste so nah, dass es wie ein Hohn klingt, Weihnachten im Feindesland zu feiern. Und wie sehr sehnte man sich doch nach der Heimat. Und wie bitterhart war die Enttäuschung. Kein Gruß, kein Wort, das Heimatluft atmete. Am Weihnachtsfest im fremden Land vergessen zu sein, das ist ein hartes Los. Bitterer Schmerz liegt auf der Seele. Der Gedanke an Undankbarkeit schwebt uns vor den Augen. Wäre die Liebe nicht stärker, sie würde der Verzweiflung, ja des Hasses Raum geben und Weihnachten wäre nur ein Traum. Tagebuch Seite 27 Neujahr wurde dann wieder in gehobener Stimmung gefeiert. Wein und Gesang waren die Brücken ins Neue Jahr. Wie viele Hoffnungen wurden aber auch in dieses Jahr gesetzt. Sollte es den Frieden bringen? Am 5. Januar wurde der Rückmarsch angetreten. Er sollte wieder dem Westen zu gehen. In St. Lucia (Santa Lucia, Verona) wurden wir verladen. Eisige Kälte, offene Viehwagen waren kein besonderer Reiz dieser Fahrt. In Salzburg war die Bahnstrecke zugeschneit, sodass wir 3 Tage Aufenthalt nehmen mussten. Herrliche Gebirgs- und Schneelandschaften zogen an unserem Auge vorüber. Deutsche Laute tönten an unsere Ohren. Freudig grüßende Menschen ließen unsere Herzen höher schlagen. Immer näher gings der Heimat zu. Wieder war es Angst, als wir unsere Stuttgarter Berge grüßten und mit ihnen unsere schlafenden Angehörigen, die es nicht ahnten, wie nahe wir ihnen waren. Einzelne hatten das Glück, mit ihren schon seit Stunden wartenden Angehörigen einige Worte zu sprechen. Unsere Fahrt endete im Elsass, in der Nähe von Straßburg. Dingolsheim, eine kleine Ortschaft, war unser Ruhequartier. Die Einwohner waren zum Teil gut deutsch, aber auch französisch gesinnt. Junge Mädchen sah man am Anfang überhaupt keine. Der Soldatenhumor sagte, sie seien im Keller eingesperrt. Tatsächlich hatte der Dorfpfarrer vor den deutschen Soldaten gewarnt. Trotzdem tauchten so allmählich die Dorfschönheiten auf, und stille Wege © F. Schulz 20 und Winkel hüten das Geheimnis einer Liebe, dem eine ganze Welt von Feinden nichts anhaben kann. Trotz Deutschenhass und christlicher Moralpredigten wurde das gute Verhältnis mit dem größten Teil der Einwohner ein sehr gutes. Manchen Feldgrauen sah man in Haus und Hof wirken und arbeiten, wo der Mann im Felde stand und die Hausfrau allein die Arbeit kaum bewältigen konnte. Und dankbar Tagebuch Seite 28 glänzte eine Träne im Auge eines alten Mütterleins, wenn wir Brot und essen mit ihren Enkelkindern teilten. Gänzlich unerwartet erhielt ich die Nachricht, in Urlaub fahren zu dürfen. Groß war die Freude. Die Stunde der Abfahrt schien nicht mehr kommen zu wollen. Voll Erwartung, was auch die Lieben in der Heimat machen werden, denn sie konnten nicht mehr vom Kommen benachrichtigt werden. In 12 Stunden Fahrt mit 3 Haltestationen. Der Zug war übervoll, lauter Urlauber, langte ich nachts 2 Uhr im Bahnhof Stuttgart an. Nach 13 Monaten wieder daheim. Alles war Ruhe und Frieden. Nichts erinnerte an den Krieg. Die Heimat war verschont geblieben. Tiefernste Gedanken waren meine Begleiter auf dem Wege ins Elternhaus. Ist noch alles gesund, was macht die Braut. Vielleicht hat ein Traum ihr meine Ankunft angezeigt. Schon streift mein Auge ihr Kammerfenster. Wenn du ahnen könntest. Nacht war es hinter den Vorhängen. Sollte ich sie wecken? Fast war die Sehnsucht stärker, als die Müdigkeit. So lenkte ich meine Schritte weiter dem Vaterhaus zu. Ein leises Klopfen am Fenster. Der Schwester verschlafene Stimme „Wer ist draußen? Ein zitterndes Grüß Gott aus übervollem Herzen. Fast glaubte ich, das Herz wollte mir zerspringen beim Anblick des durchfurchten, von Sorgen und Entbehrungen gezeichnetes und doch voll väterlichen Stolzes und unsagbarer liebe kündendes Gesicht des Vaters, während bei der Schwester durch diese Überraschung das Stimmwerk versagte. Die Freude wollte kein Ende nehmen. Die Nacht wurde ein Opfer dieses Wiedersehens. Während am Morgen Vater und Schwester ihren täglichen Pflichten nachgingen, legte ich mich zur Ruhe nieder. Ein tiefer Schlaf stärkte mich und lies alles vergessen, was im Laufe der Zeit Schreckliches ich erlebt. Stundenlanges Erzählen machte auch dann in der Heimat die Schrecken des Krieges klar und die Opfer wurden verständlich, die wir für die Heimat gebracht. Dankbar neigten sich die Häupter ob dem Heldentum der Frontsoldaten. Tagebuch Seite 29 © F. Schulz 21 Die erste Begegnung mit der Braut war ein stilles , fast ernstes Verstehen für den Augenblick. War es doch nur eine Frist von 14 Tagen, die uns gegeben war. Und schon mit den nächsten Tagen drängte sich der Gedanke des Abschiedes in unsere Reden, in unser Handeln und in unsere ferne Zukunft. Es schien, als ob die Liebe in diesen wenigen Tagen kein Anrecht hätte. Wohl erlebte ich schöne Stunden in dem Familienkreis meiner Braut. Besonders deren Mutter zeigte eine Hingabe, die mich manche schwere Stunde vergessen lies. Aber der heilige Wert der Liebe schien ein fremder Begriff zu sein. Vielleicht war das Feuer der Verbundenheit schon im Ausgehen. Wir kamen wie zwei Fremdkörper, die bestimmt sind , sich zu ergänzen, aber nie zur Einheit verschmelzen. Eines blieb uns vorbehalten. Unsere Ehre war rein geblieben. Nichts konnte uns erschüttern, der Leidenschaft sich zu ergeben. Es war das Geheimnis einer nie zu ergründenden Macht, weiches(?) Schicksal der Liebe. Je beständiger und öfter die Aussprache, je fremder wurden einander unsere Herzen. Vielleicht gerade deshalb, weil der starke Trieb zur Liebe sich nicht auswirken konnte, bevor die Zukunftsfragen nicht gelöst sind. ??? und ??? hat der Krieg ohnehin schon reichlich hinterlassen. Bittende Kinderarme greifen schwer ans Herz, wenn eine schwache Stunde ihr Erzeuger war. Auch der religiöse Bekenntnishintergrund schien noch keine regelung zu finden. So war die Zukunft noch voller Probleme, die einer ernsten Prüfung unterzogen werden müssten. Tage der Ruhe und des Friedens wollte ich erleben, aber dieser Ansturm, er müsste zermürben, das auch das Elternhaus seine Anrechte hatte und geltend machte. Es zog mich daher immer mehr ins traute Heim meines alten Vaters, wo ich immer mehr zur Erkenntnis kam, die Zukunft erst muss Rat schaffen. Meine einzige große Liebe, sie sollte sich entscheiden im Glutfeuer der Granaten und die Liebe meiner Braut, sie musste sich entscheiden in der Entsagung, im Opfer und in der Treue. So kam der Tag des Abschiedes. Schwer war er vom Vaterhaus. Die Braut aber konnte meine Standhaftigkeit nicht verstehen und warf mir Lieblosigkeit vor. Hier wurde der Abschied für mich eine Erlösung. Die Eltern taten mir leid. Tagebuch Seite 30 Ich wünschte es wäre mein letzter Gang gewesen. Rasch gings wieder dem Elsass entgegen zum Truppenteil. Einige Wochen und wir wurden wieder an die Westfront verladen. Flandern, Somme waren unsere Kampfgebiete. Schauplätze, wo viel Blut vergossen und manches junge Herz zum © F. Schulz 22 letzten Mal schlug, vielleicht noch mit einem letzten Gruß auf den Lippen, der den Lieben in der Heimat galt. Dort verlor ich auch einen guten Freund, den ein Volltreffer zerriss, und wir nur noch einige Fleischklumpen zur Bestattung zurücktrugen. Er war ein ruhiger Mann. Tags zuvor noch trug einer dem andern auf, im Ernstfalle die Heimat zu benachrichtigen. Mir sollte es bestimmt sein, seine Braut vom Heldentod Nachricht zu geben. Ich glaube, ich wäre lieber für ihn gegangen, Hoschlich hieß er. Seine Braut muss nach seiner Aussage eine Heldengestalt im Leben gewesen sein. Diese Nachricht mag sie aber doch gewaltig erschüttert haben. Wir kamen nach Reims, wo ein Großangriff geplant war. Der Hochberg war unser Ziel. Starke Befestigungen schienen kaum einnehmbar zu sein. In der vordersten Linie fanden wir keine Truppen mehr an. Unser Vormarsch wurde stark durch Artilleriefeuer gestört. Wiederum gab es Verluste. Am Abend hatten wir die Stellung am Fuße des Hochberges bezogen. Anderntags sollte der Angriff erfolgen. Unsere Artillerie hatte mit allen Kalibern die Stellung auf dem Hochberg sturmreif gemacht; wir konnten den Hochberg mühelos erreichen. Rasch gings den rückwärtigen Hang hinab. Dort aber empfing uns der Gegner von der Allee nach Reims her mit Maschinengewehrfeuer und Gasgranaten. Der Angriff kam ins Stehen. Wir mussten Stellung beziehen. Dort auch fiel unser geliebter Bataillionsführer, Hauptmann Schenoy. Ich selbst wurde durch viele Meldegänge zur Nachbardivision, wo ich fortwährend einen Talkessel durchqueren musste, der dauernd mit Gas beschossen wurde, gas krank und kam zurück ins Gaslazarett nach Ponte-on-fergen. Nach 10 Tagen war ich wieder geheilt und kam wieder zur Truppe. Tagebuch Seite 31 Die Grüße von daheim wurden immer spärlicher. Ein ernster Briefwechsel mit der Braut brachten mir wiederholt die Bestätigung, dass der vermeintliche Gedanke den Helden da draußen gegenüber nur in langweiligen Stunden, wo Feldpostbriefe geschrieben wurden, bestand. Diese Erkenntnis, den auch zur Loslösung führte, hatte tiefe Wunden in mein Herz geschlagen. Ich hoffte vergl. Noch durch eine spätere Aussprache eine für beide Teile gütliche Lösung. Aber ihr Wille dazu war auf der anderen Seite nicht mehr vorhanden. So blieb es bei der Trennung. Ein Trost waren mir die Worte meines Bruders. „Vergessen und vergeben, das ist der Liebe Losungswort“. So suchte ich zu vergessen. Immer wieder kamen mir aber meine Urlaubstage in den Sinn. Was ich da ahnte, war zur Gewissheit geworden. Tief will ich begraben dieses Geheimnis der enttäuschten Liebe, trotzdem mit dem Wunsche, möge ihr Leben immer glücklich sein. © F. Schulz 23 Tagebuch Seite 32 Für die nächste Zeit gab es dauernd Märsche der Front entlang, da wir in Reserve der obersten Heeresleitung waren. Bis wir zuletzt wieder am Chenin des danns(?) Fuß fassten und Stellung bezogen. Hier wurde die große Reservestellung, Siegfried, angelegt. Langsam wurde der Rückmarsch vorbereitet. Die Frontlinie sollte verkürzt werden. Eines Tages kam der Rückmarschbefehl. Bei Tag wurde marschiert, bei Nacht hatten wir Ruhe. Immer aber mussten wir durch Nachhutgefechte mit dem Feind in Berührung bleiben. Ein Glück war, dass die Franzosen langsam und vorsichtig nachrückten. Es waren aufregende Stunden, wenn französische Kavallerie anrückte und wir 70 Mann uns tapfer zu wehren hatten. Meistens zogen sie sich dann zurück, um bei Nacht dann ungestört uns zu folgen. Brückenübergänge und Strassenkreuzungen wurden gesprengt, um auch so den Vormarsch des feindes aufzuhalten. Die französische Bevölkerung sah mit Freude und Hass zugleich uns immer weiter zurückgehen. Schon tauchten Gerüchte auf von einem nahen Waffenstillstand. Aber wir konnten noch nicht recht daran glauben. Dass bald eine Änderung kommen muste ahnten wir ja auch. Man sprach ja schon von Meuterei. Offen gestanden, wir hatten auch genug, aber Feigheit kannten wir nicht und Meuterei war uns fremd. Die letzten Marschtage nahten, wir hatten nochmals Stellung bezogen. Uns eingegraben und die Maschinengewehre eingebaut. Am 7. November vormittags 11 Uhr, wir sahen die Franzosen schon auf einer Höhe anmarschieren. Der letzte Tagebuch Seite 33 Artillerieschuss hallte durchs Tal. Wir hatten uns einen Hafen Kartoffel gesotten, da ertönte das Ganze halt. Still und stumm war es bei Freund und Feind. Wir mussten antreten. Die Friedensbedingungen wurden bekanntgegeben. Der Krieg war aus, aber die Bedingungen unmenschlich und eine Schande für den deutschen Soldaten. Innerhalb 30 Tagen mussten wir die deutsche Grenze überschritten haben, andernfalls uns Gefangenschaft drohte. Hier zeigte sich nun in der Organisation des Rückmarsches wieder die Größe unseres Feldherrn Hindenburg, während der Kaiser nach Holland floh, marschierten wir Hunderte von km durch Frankreich, Belgien Luxemburg an den deutschen Rhein. Eine Neuerscheinung trat nun auf. Die Bildung von Soldatenräten. Ein Erzeugnis der Revolution. Mag die Heimat diese Schande unterstützt haben. Wir Feldsoldaten mit unseren © F. Schulz 24 Soldatenräten, wir wussten immer noch, was wir den Offizieren schuldig waren. Und wenn uns unser Oberst bat, (v. Brandenstein) er möchte mit uns in Ludwigsburg, der Garnison, einmarschieren, so waren wir Soldat genug, um freudig zuzustimmen. So kamen wir nach Kirchheim (Hessen), wo wir zwei Wochen lagen, bis der gute Soldatenrat in Deutschland uns Transportmöglichkeit genehmigte. Die Fahrt von Kirchheim bis nach Kornwestheim dauerte auch einige Tage, bis den lieben Soldatenräten die Schmiergelder hoch genug waren. In Ludwigsburg war der Soldatenrat so einsichtsvoll, uns den Einmarsch ohne Störung zu garantieren, von ??? dann wenige Tage vor Weihnachten erfolgte. 2 Bataillone hatten sich im Kornwestheim aufgestellt. Tagebuch Seite 34 Das Letzte fuhr gerade im Bahnhof ein. Der Einmarsch nach Ludwigsburg begann. Wer beschreibt den Jubel und die Freude. Den ganzen Weg bis nach Ludwigsburg waren beide Straßenseiten von Menschen belagert, die uns mit Blumen begrüßten. Da freute sich auch wieder das Soldatenherz und das Pflaster von Ludwigsburg erdröhnte im letzten Paradeschritt der Frontsoldaten. Der Empfang war so herzlich, dass wir selbst zum Teil beschämt, alle aber gerührt waren, ob der liebe und Begeisterung, die alle mitriss und uns wieder vergessen ließ, was die Heimat uns angetan. Zum ersten mal feierten wir dann wohl in Not und Elend, aber im Frieden wieder Weihnachten daheim. © F. Schulz 25