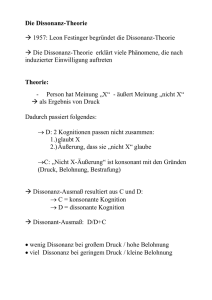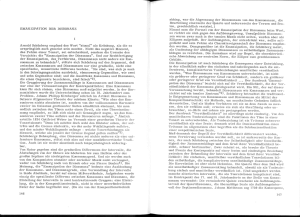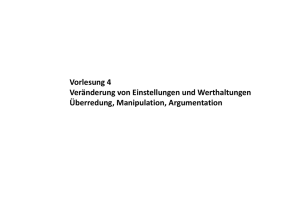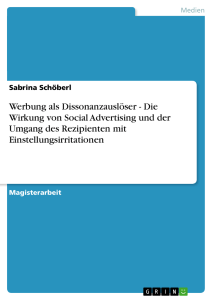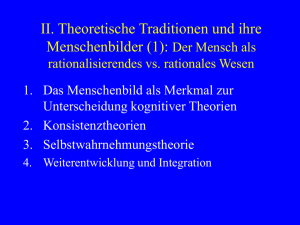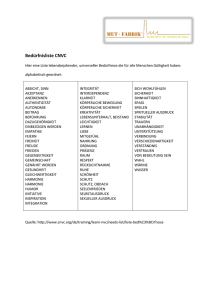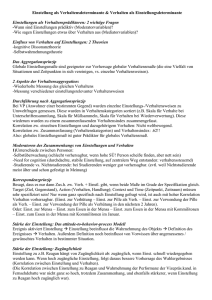Resonanzen
Werbung

RESONANZEN Zum letzten Themenheft »Dissonanzen« (Band 36, 2015, Heft 4) erhielt die Redaktion eine Resonanz von Prof. Dr. Fritz Hegi (Zürich). Darauf antworten einige Autorinnen und Autoren. Fritz Hegi Dissonanzen Es ist besonders verdienstvoll, dass die Redaktion der MU das Thema Dissonanzen aufnimmt und dazu mehrere differenzierte Beiträge bringt. Die Emanzipation dieses Intervall-Phänomens war und ist vor allem für die aktive Musiktherapie bezüglich Diagnostik und Interventionspraxis bedeutsam. Wie könnte sonst der musikalische Ausdruck von Wut, Schmerz oder Angst getroffen werden? Die Artikel des Bandes berichten auf vielfältige Weise über Verwendung, Interpretation und Wirkung von Spannungsakkorden in der Improvisation. Der Mainstream aktiver Methoden arbeitet heute erfolgreich mit offenen Prozessen dissonanter Klänge, zerfallenden Rhythmen oder schrägen Melodien. Zum Glück ist der schwierige Ruf der Musiktherapie als harmoniespendende Animation fast verschwunden. Dazu sind in allen Beiträgen interessante Belege formuliert: −− »Das ›Stören‹ der Harmonie kann eine gezielte Intervention sein und die Erfahrung vermitteln, dass ›Stören‹ nicht unbedingt mit ›Zerstören‹ gleichzusetzen ist« (Scheible S. 341).1 −− »Nur als Versöhnung des Leidens bewegen uns harmonische Akkorde, nicht als Konsonanzdiktatur« (Sloterdijk zit. in Möller S. 298). −− »Disharmonie grenzt Gefühle der Bedrohung, der Irritation und der Unerträglichkeit nicht aus […], sondern lässt […] Anspannung aufgrund der Gleichzeitigkeit sehr ambivalenter Gefühle erleben« (Strehlow zit. in Metzner S. 343). Es scheint, als müssten die AutorInnen die Dissonanz gegenüber der Konsonanz rechtfertigen. Andererseits wird die Harmonie – gleichsam schuldbewusst – als unverzichtbar erklärt. Demente zum Beispiel würden »einen Klang ohne ›Anklänge‹ an Harmonie […] nicht akzeptieren« (Muthesius S. 357) und seien auch rhythmisch »für Dissonanzen jeder Art wenig bereit« (ebda. S. 358). Muthesius’ Fazit ist, der »geerbten Liebe zur Konsonanz und dem Musiktherapeutische Umschau, 37, 1 (2016), S. 79–85 © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2016, ISSN 0172–5505 80 Resonanzen Wunsch zur erfrischenden, erneuernden Dissonanz gleichermassen mit Unschuld zu begegnen« (ebda. S. 359). Weshalb, frage ich erstaunt, leitet kein Text die Ursache, weshalb Konsonanz harmonisch und Dissonanz disharmonisch empfunden wird, von der einfachen Tatsache ab, dass obertonnahe Schwingungsverhältnisse weltweit und kulturunabhängig als ästhetisch gewünscht gelten, weil sie schwingungsverwandt sind. Der Mensch ist nicht durch musikalische Sozialisierung an Dreiklänge gewöhnt worden, wie der folgende Gedanke es nahelegen will: »möglicherweise sind dafür vielleicht schon im Mutterleib abgelaufene Lernprozesse verantwortlich« (Möller S. 298 nach Spitzer 2007), sondern der Mensch wohnt von Anfang an im Oberton-Raum, den die einfachen Teilschwingungen der Intervalle und Klänge uns vorgeben – woher diese Ordnung auch kommen möge. Die auf der Obertonreihe nächst­ gelegenen Töne sind die Oktave, die Quinte, die Quarte, die grosse und die kleine Terz – sie ergeben den Dreiklang unserer kosmischen Heimat, dieses nach Pythagoras für die Sterblichen nicht hörbare Ertönen der Himmelskörper infolge ihrer Bewegung im Weltenraum. Von Geburt bis Tod suchen wir die Harmonie in der Musik – und in den Beziehungen. Die erste Dissonanz-Spannung nach den Dreiklängen beginnt dann mit der Septime. Weiter oben in der Skala folgen die immer schwächer hörbaren Obertöne Sekunden, Tritonus, Viertel­töne und weitere Frequenzabweichungen wie die Naturtöne. In ihrer Überschichtung entstehen schliesslich die Geräusch-Cluster. Sie klingen fremd, dis-sonant und werden trotz subjektiven Vorlieben eher abgelehnt, weil sie im Übergang zum Rauschen, Unfassbaren oder Ungeordneten schwingen, das harmonische Obertongebäude verlassen. Wenn wir dann in diesen höheren Obertönen noch die abweichenden Frequenzen der Naturtöne von nichttemperierter Musik bei der Septime, der Dur-Terz, dem Tritonus einbeziehen – oder die Vierteltöne und Glissando-Skalen von Kulturen ausserhalb der klassischen Musik, so wird auf einfache Weise klar, woher der fliessende Übergang von Konsonanz zu Dissonanz kommt. Diese harmonikale Grundlagenordnung ist transdisziplinär gültig: in der Mathematik als ganzzahlige Teilfrequenzen, in der Architektur als goldener Schnitt, in der Biologie als obertonnahe Formgestaltungen bei Tieren und Pflanzen, in der Astro- und Quantenphysik als Gleichung von Makro- und Mikrostrukturen, in der Theologie als Sinn- und Seelsorge sowie in der Ästhetik der Philosophie oder Kulturanthropologie. Seit Kepler, Kaiser, Haase und andern ist sonnenklar, dass Konsonanzen einfache Schwingungsteilungen und Dissonanzen komplexe Schwingungsverhältnisse sind. Die einfache Teilung erfahren wir bei allen Bläsern beim ersten Überblasen der schwingenden Luftröhre, von selbst entsteht der Oktavsprung. So zeigte uns schon Pythagoras an einer Saite auf dem Monochord den Übergang von Konsonanz zu Dissonanz mit diesen harmonikalen Grundgesetzen: 1/2 Teilung = 2-fache Frequenz = Oktave 1/3 Teilung = 3-fache Frequenz = Quinte Resonanzen 1/4 Teilung = 4-fache Frequenz = Quarte (in der doppelten Oktave) 1/5 Teilung = 5-fache Frequenz = grosse Terz 1/6 Teilung = 6-fache Frequenz = kleine Terz (nächste Quint und damit Dreiklang) 1/7 Teilung = 7-fache Frequenz = kleine Septime (Übergang zu den Dissonanzen) Eine so einfache physikalische Gesetzmässigkeit erklärt, weshalb alle Menschen Harmonie suchen und sich an der klanglichen Ordnung der Musik orientieren. Diese zum Thema Dissonanzen therapeutisch bedeutungsvolle Erkenntnis ist in der hier diskutierten MU nur an zwei Stellen und nebensächlich erwähnt (Möller »Dissonanzgrade« S. 295; Unterberger »Schlussbemerkung« S. 375). Sonst aber wird in weitschweifigen Assoziationsschlaufen psychologisiert: »Wie kommt es zur Entstehung von Harmonie und Kakophonie?« (Möller S. 294). Es werden sogar sophistische Umkehrungen bemüht: »Nur weil Harmonie die Ausnahme ist, hat sie das attraktive Leuchten der Bedeutsamkeit um sich« (Sloterdijk zit. in Möller S. 298). Schon näher der Wahrheit behauptet der 12-Ton Pionier Schönberg: »Dissonanzen […] seien nur entferntere Konsonanzen« (zit. in Möller S. 302). Zuerst logisch, dann im hier argumentierten Ansatz beliebig und subjektivistisch erscheint die Formulierung, »dass etwas in der Musik für den einen so klingt und für die andere ganz anders […], dass es um Empfindungen und Zustände von Subjekten geht, die stets nur (! d. A.) aus der Perspektive des Subjekts zu verstehen sind« (Tüpker S. 286). Eine derart von der inneren Gesetzmässigkeit der Musik entfernte Ansicht neutralisiert die Verhältnisse von Dissonanz und Konsonanz bis zu ihrer Wirkungslosigkeit. Aus der Perspektive der Musik kann die Wirkung von Dissonanz und Konsonanz nicht nur sein, was einem mehr oder weniger gefällt, sondern ist immer auch verbunden mit Realitäten von Schwingungs- und Naturverhältnissen. Eine Ich-Psychologie kann nicht über die universale Ganzheit und Gesetz­mässigkeit der Musik gestellt werden. Die sinngebende Heilungskraft der Musik besteht gerade in einer spirituellen Dimension, die weit über ein subjektives Bewusstsein hinausgeht. Dadurch hat Harmonie eine emotionale Zufriedenheitswirkung und Disharmonie ist eine symbolische Heimat für schwierige Gefühle wie Spannungen, Angst, Wut oder Schmerz. Beide, Dissonanz und Konsonanz, sind wertfrei ein Geschenk des universellen Musikgeistes. Mit dem Poem von Friedrich Rückert traf die Redaktion im Editorial bereits die Essenz meiner Gedanken Wer den Ton gefunden, Der im Grund gebunden Hält den Weltgesang, Hört im grossen Ganzen Keine Dissonanzen, Lauter Übergang. (Editorial S. 282) 81 82 Resonanzen Zusammenfassend möchte ich hiermit die Haltung verstärken, dass Musiktherapie vom überbewussten Wirkungsfeld der Musik her betrachtet werden muss und nicht so sehr einem psychologisch-therapeutischen Vorgehen untergeordnet werden darf. Denn Musiktherapie ist die Therapie, die sich von allen andern dadurch unterscheidet, dass sie die Musik als ihre zentrale Lehrmeisterin betrachtet. 1 Die Quellenverweise beziehen sich alle auf das hier besprochene Heft der MU Band 36 4/2015 Prof. Dr. Fritz Hegi, Zürich [email protected] Dorothea Muthesius Lieber Fritz Hegi, ja, Du hast Recht. Da haben wir in dem Heft nach allen Facetten von Dissonanz gesucht und nahezu vergessen, die Basis zu bemühen. Der Mensch »wohnt im Obertonraum« – was ein schönes Bild! Woher diese uns zur Verfügung gestellt Ordnung kommt? Im Christentum sagen wir: von Gott. Und dermaßen systematisch akustisch erlebbar – in Form von Musik – hat sie (nur) der Mensch gemacht. Ohne den Menschen wäre sie nicht hörbar. In diesem Sinne ist Musik so menschlich und gleichzeitig göttlich. Umso erstaunter war ich, als mir deutlich wurde, wie wenig die Bibel auf das Thema Musik rekurriert. Allein der David, der sich ihrer so frei bedient. Nirgendwo hat der Mensch – mit der Entdeckung der musikalischen Harmonie – es geschafft, dem Göttlichen näherzukommen? Nach dem »Tanzlegendchen« von Gottfried Keller gibt es in der Himmelsmusik noch viel Schöneres als die irdische Harmonie. Unvorstellbar?! Und dennoch. Vollständige Harmonie ist ebenso ein Ideal wie Jesus ein Ideal der Liebe ist. Dieses Ideal ist die spirituelle, überindividuelle Dimension, auf die Du uns dankenswerter Weise noch einmal hinweist. Der »universelle Musikgeist« – auch für diese Metapher eine großen Dank! In der Strophe von Rückert fühlen sich alle die aufgehoben, die den Weltgesang im Ohr haben oder jedenfalls danach suchen. Ich musste/durfte mir das Ohr für diesen Weltgesang selbst erarbeiten. Das ist leider wirklich »Sozialisation«: Mir wurde vorgelebt, dass Dissonanzen nicht Übergang sind, sondern die Hölle, die man meiden muss. Dann wird Harmonie nicht himmlisch sondern Lähmung. Grüße aus dem Übergang. Dr. Dorothea Muthesius, Berlin [email protected] Resonanzen Susanne Metzner Über ein strittiges Intervall und das Problem mit der Wahrheit – ein Kommentar zum Leserbrief von Fritz Hegi Unterteilt man eine Saite in Teilabschnitte, und mag man dies auch noch so häufig wiederholen, die kleine Terz, bekanntlich Kennzeichen einer Molltonart gemäß der abendländischen Akkordharmonik, sucht man vergeblich. Folglich sei dieses Intervall »kein Donum der Natur« sondern eine Dissonanz, schrieb der Musiker Carl Friedrich Zelter in einem Brief an Johann Wolfgang von Goethe (zit. nach Baron 2008, S. 7)1. Zelter verwendet dieselbe mathematisch-physikalische, auf die Vorsokratiker zurückgehende Argumentation wie Fritz Hegi in seinem Kommentar auf das MU-Themenheft ›Dissonanzen‹. Doch hinterfragte schon Platon die Auffassung der Pythagoräer, in Akkorden Zahlen zu finden. Platon zufolge sei die Orientierung an Zahlen zur Bestimmung des Schönen zwar prinzipiell richtig, die Methodik sei aber falsch. Messbare Konsonanzen waren nach Plato unvollkommen, Idealzahlen nur a priori durch reines Denken zu erkennen (OB S. 23 Endnote Nr. 3). Welche Antwort erhielt Zelter nun von Goethe? Goethe argumentierte zugunsten der kleinen Terz und brachte – wie im übrigen auch Tüpker (2015) wenn auch in anderem Referenzrahmen – das ästhetische Subjekt ins Spiel als dem »genauesten physicalisch(n) Apparat« (OB S. 8). Damit entzog Goethe dem ästhetischen Urteil die damals herrschende mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlage: »Es ist vieles wahr, was sich nicht berechnen lässt« (ebda.). Gleichwohl hielt sich die auf mathematisches Vergleichen beruhende K ­ ategorisierung von Einklang und Dissonanz auch noch weit bis ins 19. Jahrhundert hinein. Zwar wurden weder die kleine Terz noch andere Intervalle wie von Zelter als ›Un-Natur‹ aufgefasst, aber die Dissonanz war fortan das musikalische Phänomen, das stets und unbedingt nach Auflösung strebt (OB S. 8–10). Es scheint es so, als ob dieses auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel zurückgehende Diktum bis in die Gegenwart und damit auch in die moderne Musiktherapie reicht. Außerhalb des Gesichtskreises, besser: außerhalb des Hörfeldes liegen dann aber die zahlreichen und immer neuen Gesichtspunkte einbeziehenden Auseinandersetzungen mit der Dissonanz als einer ästhetischen Kategorie, die OB ebenso differenziert wie spannend auffächert. Welch ein Kosmos! Ich persönlich habe von dieser Lektüre, die man im übrigen kostenlos über die Digitalen Sammlungen herunterladen kann (http://digi20.digitale-sammlungen.de/) profitiert – nicht nur für die Auseinandersetzung mit Anzeichen von Gewalt in zeitgenössischer Musik in meinem Beitrag (Metzner 2015). 83 84 Resonanzen Indem ich Fritz Hegis Ausführungen in den Kontext einer Ideen- und Musikgeschichte stelle, die nicht nur den Wandel des Naturverständnisses (vgl. Daston 2003) sondern auch des Menschenbildes spiegeln und damit letztlich auf die Herausforderungen der Gegenwart zulaufen, will ich nicht leugnen, dass Musiktherapie als ein Anwendungsfach bei allem Streben nach Wissenschaftlichkeit natürlich auch von Werten und Überzeugungen geleitet ist und dass Patienten ihr Musikverständnis und ihre Präferenzen in die Therapie mitbringen, auf die wir uns einstellen und mit (!) denen wir arbeiten, wie die Fallbeispiele im betreffenden MU-Themenheft dokumentieren. In der Psychologie und den Neurowissenschaften gibt es zahlreiche Ansätze die objektivierbaren Aspekte subjektiven Erlebens auch wissenschaftlich zugänglich zu machen. Ohne hier in Details gehen zu müssen, ist es schlicht aus wissenschaftstheoretischer Sicht unhaltbar, wenn Hegi gegen Beiträge, die ganz eindeutig einem idiographischen Wissenschaftsverständnis zuzuordnen sind, Einwände aus den logischen Wissenschaften wie der Mathematik erhebt. Auch ist es für den wissenschaftlichen Diskurs nicht optimal, wenn er zum Beispiel den Beitrag von Möller4 wie einen Steinbruch verwendet, indem er Textstellen und sogar Fremdreferenzen für die eigene ›Wahrheit‹ herausbricht. Um Wahrheit geht es gar nicht. Aber natürlich gilt die Meinungsfreiheit. Hegis Bemerkung, die Autoren würden quasi schuldbewusst argumentieren, hat mich zuerst verstimmt, weil ich sie als nicht angemessen empfand. Schreckliche, schöne Dissonanz! Schrecklich, weil sie einem geschätzten Kollegen gilt, schön deswegen, weil sie mir den Weg zu den offenen Fragen weist, nämlich woran Du, Fritz, das genau festmachst und was Du vielleicht eigentlich sagen willst? Quellen Baron, O. (2008): Dissonanz als ästhetische Kategorie. München: Fink, S. 7. Daston, L. (2003): Wunder, Beweise und Tatsachen. Zur Geschichte der Rationalität. Frankfurt/Main: ­Fischer. Metzner, S. (2015): Musik als Brennglas. Ein Essay zur ästhetischen Transformation von kollektiver Gewalt in zeitgenössischen Kompositionen. Musiktherapeutische Umschau 36,4, 342–351 Möller, H. (2015): Dis-sonare – Auseinanderklingen in der Musik. Musiktherapeutische Umschau 36, S. 294–308 Tüpker, R. (2015): Zur Psychästhetik der Dissonanz. Musiktherapeutische Umschau 36, S. 283–298 1 Alle weiteren auf diese Quelle zurückgehenden Ausführungen sind im folgenden Text durch die Initialen OB plus Seitenzahl in Klammern hinter der betreffenden Textstelle angegeben. Prof. Dr. Susanne Metzner, Magdeburg [email protected] Resonanzen Johannes Unterberger Das musiktherapeutische Berufsverständnis ist anders Das Themenheft »Dissonanzen« (MU 15/4) ist vielschichtig, tiefgründig, herausfordernd, also: rundum gelungen. Prof. Hegis Resonanz auf das Themenheft und sein Verweis auf die naturgesetzliche Grundlage der Dissonanz-/Konsonanz-Phänomene in der Obertonreihe sind begrüßenswert. In der abschließenden Zusammenfassung erkenne ich mein musiktherapeutisches ­Berufsverständnis allerdings nicht wieder. Folgende Punkte sind mir wichtig: −− Viele KollegInnen unserer Profession arbeiten im institutionellen Kontext und in multiprofessionellen Teams. Eine gemeinsame Sprache ist dafür unabdingbar. Sie wird in der Regel eine psychologisch-therapeutische sein. Welche denn sonst? Ich will erklären können, was in der Musiktherapie passiert. Ich will gehört und verstanden werden, wenn Psychotherapeuten, Psychiater, Sozialpädagogen, Therapeuten und Pflegekräfte die Entwicklung eines Patienten reflektieren und nächste Schritte gesetzt werden. −− Die Orientierung an Therapiemethoden hat sich in der Psychotherapieforschung als Sackgasse erwiesen. Positive therapeutische Effekte lassen sich auf allgemeine Wirkfaktoren zurückführen. Wirksamkeitsuntersuchungen und Prozess-Outcomestudien zeigen, dass die empirisch validierten Wirkfaktoren Therapiebeziehung, Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, Problembewältigung und motivationale Klärung entscheidend für positive Ergebnisse sind. Aspekte, in denen sich die Therapiemethoden unterscheiden, sind für die eigentliche Wirkung unerheblich. −− Musiktherapeuten sollten gelegentlich die Kirche im Dorf lassen und eine gelassenere Position bezüglich der Einzigartigkeit ihres Mediums einnehmen. Jede kreativ-therapeutische Methode kann Alleinstellungsmerkmale geltend machen. Die Poesie Therapie kann auf die Sprache verweisen, die uns in der Evolution eine so einzigartige Position ermöglicht hat. Die Kunsttherapie kann sich auf Farbgesetze und Formprinzipien berufen. Der Körper als Ausdrucksmedium in Tanz und Schauspiel ist einzigartig vielgestaltig. Die Obertonreihe ist unser numinoses Highlight, auf das wir uns gerne beziehen. Hesiod hat im 6. Jh. V. Chr. in seiner Theogonie von neun olympischen Musen gesprochen. Die »Kreativtherapien« waren damals schon alle vertreten, keine hat die anderen überstrahlt. Dabei sollten wir es auch heute belassen. Dr. Johannes Unterberger, Wasserburg [email protected] 85