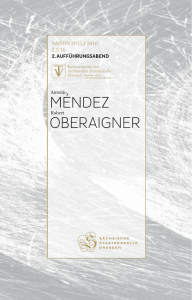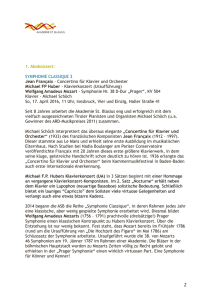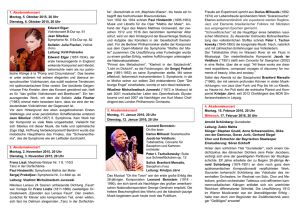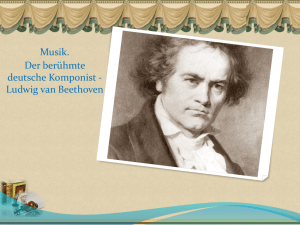hartmann schostakowitsch beethoven
Werbung

HARTMANN 2. Symphonie »Adagio« SCHOSTAKOWITSCH 9. Symphonie BEETHOVEN 5. Klavierkonzert GERGIEV, Dirigent TSUJII, Klavier Mittwoch 04_11_2015 20 Uhr FÜR IHREN GANZ PERSÖNLICHEN BRILLANTEN AUFTRITT: DER FRIDRICH SOLITÄR In unserem großen Angebot an Brillanten in vielen Größen ist sicher auch Ihr WunschSolitär dabei - fragen Sie uns! z.B. Solitärring in 585/– Weißgold mit 1 Brillant 0,15 ct G si für € 595,– TRAURINGHAUS · SCHMUCK · JUWELEN · UHREN · MEISTERWERKSTÄTTEN J. B. FRIDRICH GMBH & CO.KG · SENDLINGER STRASSE 15 · 80331 MÜNCHEN TELEFON: 089 260 80 38 · WWW.FRIDRICH.DE KARL AMADEUS HARTMANN Symphonie Nr. 2 »Adagio« DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH Symphonie Nr. 9 Es-Dur op. 70 1. Allegro 2. Moderato 3. Presto 4. Largo 5. Allegretto-Allegro LUDWIG VAN BEETHOVEN Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 1. Allegro 2. Adagio un poco moto 3. Rondo: Allegro, ma non tanto VALERY GERGIEV Dirigent NOBUYUKI TSUJII Klavier 118. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 Karl Amadeus Hartmann (1952) Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 3 Der realistische Komponist EGON VOSS KARL AMADEUS HARTMANN (1905–1963) Symphonie Nr. 2 »Adagio« reits während des Zweiten Weltkriegs, vermutlich 1943, komponiert; seine Neufassung unter der Bezeichnung »2. Symphonie« entstand unmittelbar nach Kriegsende im Jahr 1949. WIDMUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 2. August 1905 in München; gestorben am 5. Dezember 1963 in München. ENTSTEHUNG Die Urfassung des aus einem einzigen Adagio-Satz bestehenden Werkes wurde be- »Mein Adagio (Symphonie No. II) widme ich Herrn Paul Collaer, Brüssel, dem großen Mu­siker und wunderbaren Menschen, 1949«: Paul Collaer (1891–1989) war ein flämischer Chemiker, Musikwissenschaftler, Pianist, Dirigent und Rundfunkintendant, der seit dem Ende des Ersten Weltkriegs das belgische Musikleben über Jahrzehnte entscheidend prägte und ins­besondere für die Komponisten des 20. Jahrhunderts unschätzbare Aufbauarbeit leistete. URAUFFÜHRUNG Am 10. September 1950 in Donaueschingen im Rahmen der Donaueschinger Musiktage (Symphonieorchester des Südwestfunks unter Leitung von Hans Rosbaud). Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 4 EXPRESSIONISMUS UREIGENSTER PRÄGUNG sischen Groupe des Six, dem frühen Strawinsky des »Sacre du Printemps«. Karl Amadeus Hartmann gehört zu den Außenseitern der Neuen Musik. Das spiegeln nicht zuletzt die Aufführungszahlen seiner Werke, die in ungleichem Verhältnis zu deren Rang stehen. Hartmann passt in keine der großen Richtungen der Musik des 20. Jahrhunderts. Dass er bei Alban Berg studieren wollte und, da dieser allzu früh starb, schließlich bei Anton Webern Unterricht nahm, heißt keineswegs, dass er der Wiener Schule nahesteht. Den expressionistischen Gestus seiner Musik, der das vielleicht wesentlichste, auf jeden Fall aber das auffälligste Merkmal fast aller seiner Werke seit Beginn der 30er Jahre darstellt, nur auf Schönberg, Berg und Webern zurückführen zu wollen, hieße die Differenzen verkennen, die gewichtiger sind als die Gemeinsamkeiten. Der Expressionismus der Wiener Schule tendierte einer­seits – was selten beachtet wird – durchaus auch zum Impressionismus und andererseits aber auch zum AbstraktKonstruktiven, Konstruktivistischen. Beides ist Hartmanns Musik eher fremd. Vor allem aber wurzelt der Expressionismus der Wiener Schule im Fin-de-Siècle. Von dort bezieht er seine spezifische Qualität, die subtile Differenziertheit, die Gebrochenheit. Auch diese Eigenschaften bezeichnen keine Merkmale der Hartmanns ­Musik. Sie ist vielmehr bestimmt von vorwärts stürmendem Impetus, bruitistischer Grellheit, unbekümmert vital anmutender Motorik, von einem Impuls, der der Gebrochenheit den Glauben an eine ideale, humane Welt entgegensetzt. Das Ungezähmt- Wilde, Anarchistische, bisweilen auch Primitivistische von Hartmanns Musik steht dem frühen und mittleren Bartók nahe, dem jungen Hindemith, der franzö- DIMENSION DES APOKALYPTISCHEN Hartmann hat fremde Einflüsse nie gescheut und sich entsprechend vielfältig beeinflussen lassen. Dabei blieb er stets unabhängig, aller Orthodoxie abhold. So unüberhörbar motorisch seine Musik in den schnellen Sätzen seiner Symphonien auch ist, so unverkennbar ist zugleich, dass diese Form von Motorik eine andere ist als diejenige Paul Hindemiths, der stets die Tendenz zum In-sich-Kreisen innewohnt und die deshalb oft wie Bewegtheit um der Bewegtheit willen anmutet. Hartmanns Motorik gleicht einem Vorwärtsstürmen, wirkt wie ein hemmungsloses oder auch gewaltsames Voranhasten, Voranstürzen, sie gemahnt an eine Schussfahrt, die ins Ungewisse geht: sie hat apokalyptischen Charakter. Die Dimension des Apokalyptischen aber, wie auch die gewaltigen, ins Gestaltlos-Tumultuarische ausufernden Ausbrüche und Entladungen zeigen, definiert ein Hauptmerkmal der Musik Karl Amadeus Hartmanns. Deren Widerpart bilden lyrische Passagen, in denen Hartmann weder die Kantabilität noch die Süße geschmeidiger Geigenkantilenen scheute. So gewann er die Kontraste, die symphonisches Komponieren benötigt. »DURCHLEBTES KUNSTWERK MIT AUSSAGE« Hartmann komponierte stets gleichsam ungeschützt, nämlich ungeschminkt, lapidar, immer das Risiko des Scheiterns im Bewusstsein und es nicht scheuend. Die Angst, trivial zu erscheinen oder als unprofessionell zu gelten, kannte er nicht. Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 5 Karl Amadeus Hartmann (rechts) mit dem Dirigenten Hermann Scherchen (1935): »In ihm sehe ich meinen eigentlichen Lehrer…« Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 6 Sein Ziel war nicht die perfekte äußere Schale, erst recht nicht die Anpassung an Konventionen. Ausgesprochen ist es in dem oft zitierten Satz: »Ich will keine leidenschaftslose Gehirnarbeit, sondern ein durchlebtes Kunstwerk mit einer Aussage«. Auch dies ist ungeschützt, wirkt vordergründig, banal, klischeehaft. Die Avantgarde, die sich viel auf ihr Reflexionsniveau zugute hielt, mochte darüber die Nase rümpfen. Für Hartmann hatte es seine Gültigkeit. Der Satz zeigt die tiefe Skepsis gegenüber der Tendenz, die Konstruktion zum ästhetischen Zentrum der Komposition zu machen, die seit den 50er Jahren immer mehr zur streng und dogmatisch vertretenen Lehrmeinung wurde. Hartmann war tolerant genug, als Leiter der Münchner »Musica Viva« auch diese Richtung zu dulden, aber er ließ sich nicht von ihr vereinnahmen. Er hatte sich von der freien Atonalität und Schönbergs Zwölftontechnik ferngehalten und blieb auch zu den seriellen Techniken auf deutlicher Distanz. So vermochte er der »realistische« Komponist zu bleiben, der er stets gewesen war, ein Komponist nämlich, der bei allem artifiziellen Ehrgeiz doch nie den Bezug zu den einfachen, wirklichkeitsnahen Formen und Ausdrucksmitteln der Musik aufzugeben bereit war. UMFANGREICHES »WORK IN PROGRESS« In den Jahren des Nationalsozialismus hatte Hartmann Berufsverbot, was ihn jedoch nicht daran hindern konnte, zumindest heimlich sein Metier zu betreiben. Ohne jede Aussicht auf Aufführung, Resonanz und Erfolg schrieb Hartmann eine ganze Reihe von Werken, motiviert durch seine Opposition zum herrschenden Regime, aber sicherlich auch durch den Zuspruch, den er von außen, aus dem Ausland erhielt. Nach dem Ende des Nationalsozialismus war es jedoch keineswegs Hartmanns erstes Ziel, die in dieser Zeit komponierten Werke aus der erzwungenen Verborgenheit in die Öffent­lichkeit zu schicken. Vielmehr unterzog er diese Kompositionen einer strengen Kritik – so, als sei er sich ihrer nicht mehr ganz sicher, oder als sei es notwendig, sie den veränderten politischen Verhältnissen, der neuen gesellschaftlichen Lage anzupassen. Jedenfalls veröffentlichte Hartmann nicht ein einziges der während der Zeit des Nationalsozialismus komponierten Werke in unveränderter Form, sondern schuf vielmehr neue Kompositionen, die allerdings zu einem sehr großen Teil auf den älteren aufbauten. Das gilt auch für die 2. Symphonie, deren Urfassung bereits während des Zweiten Weltkriegs, vermutlich 1943, entstanden ist und die Hartmann schon bald nach Kriegsende aus der Schublade holte, um sie in seine »Symphonie No. II« umzuformen. SYMPHONIE IN EINEM SATZ Im Unterschied zu Hartmanns sonstigen Symphonien ist seine »Zweite« ein Werk in nur einem Satz. Man hat dabei jedoch nicht an die durch Franz Liszts Klaviersonate in h-Moll oder Arnold Schönbergs erste Kammersymphonie op. 9 bekannte Verbindung und Überlagerung von Einsätzigkeit und Mehrsätzigkeit zu denken und das Ineinander von Sonatensatzform – mit Exposition, Durchführung, Reprise und Coda – und traditioneller Viersätzigkeit – mit Allegro, Adagio, Scherzo und Finale. Gemeinsam mit den genannten Werken ist Hartmanns Symphonie nur, dass sie ohne Unterbrechung abläuft. Im Übrigen ist ihre Struktur sehr viel einfacher, frei von der formalen Mehrdeutigkeit einzelner Teile der Komposition, frei auch vom Charakter des Expe- Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 7 Karl Amadeus Hartmann mit seinem Sohn Richard (1946) rimentierens mit traditionellen und gewichtig-ehrwürdigen Formen und Gestaltungsmodellen. Das Formprinzip des Werkes ist der Wechsel zwischen thematisch gebundenen und quasi »themafreien« Abschnitten – ein Prinzip, das dem Rondo nahesteht, einer einfach-schlichten Form also, die weniger artifiziell als vielmehr volkstümlich-populär ist. VIER TÖNE UND EIN SAXOPHON Dem entspricht das Thema der im engeren Sinn »thematischen« Abschnitte, das nach einer kurzen vom gesamten Orchester gestalteten Einleitung zuerst im Bariton-­ Saxophon und ohne Begleitung ertönt. Die Beschränkung der Melodie auf nur vier Töne und der Verzicht auf Halbtonschritte – bei- Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 8 des wird erst bei der unmittelbaren Wiederholung des Themas durchbrochen – geben der Melodie einen primitiv-archaischen Charakter. Wachgerufen wird die Erinnerung an russische Folklore, und nicht zufällig assoziiert man als Hörer die frühen Werke Strawinskijs. Es ist darum alles andere als ein »symphonisches« Thema; denn sein Pendeln zwischen den wenigen Tönen, aus denen es besteht, und das Kreisen im stets gleichen Klang lassen keine Entwicklung zu, wie man sie von einem symphonischen Thema und im Rahmen einer »Symphonie« erwartet. Das Thema enthält keine Keime, die sich entfalten ließen, keinen Impuls, der – wie etwa das Anfangsmotiv in Beethovens 5. Symphonie – die Musik unaufhörlich vorantriebe. IMPROVISATORISCHE VERLAUFSSTRUKTUR Die Struktur des Themas und die formale Nähe des Ganzen zum Rondo bedingen sich also gegenseitig. Es ist auch kein Zufall, dass Hartmann das Thema stets unverändert wiederholt – von kleineren Details abgesehen, die wie improvisiert oder wie ornamental wirken und aus der Eigenart der Instrumente, die sie gerade spielen, entwickelt sind. Zwischen die rondoartig wiederkehrenden Themenzitate, die den Blasinstrumenten vorbehalten sind, vornehmlich der Trompete, hat Hartmann jeweils themenlose Abschnitte eingeschoben, in denen kurze, ein- oder mehrtaktige Melodie- und Rhythmusmodelle aufgestellt, wiederholt, sequenziert, variativ abgewandelt und vor allem immer wieder durch neue Modelle abgelöst werden, eingebettet in liegende Klänge und flankiert von ostinatohaften Repetitionen. Das Verfahren ist indessen nicht das der motivisch-thematischen Arbeit, wie man es aus Beethovens Symphonien kennt, sondern ein stets improvisatorisch anmutendes, gleichsam assoziatives Sich-Vorwärtsranken. Hartmanns Musik eignet weder die logische Verknüpfung der musikalischen Einzelheiten zum diskursiven Zusammenhang noch die strikte Ausrichtung auf ein Ziel wie das der Reprise oder des Finales. Die Form-Balance der klassischen Symphonie wird sozusagen überwuchert und, wie es scheint, auch ganz bewusst. INNERER SPANNUNGSBOGEN Überschrieben ist Hartmanns zweite Symphonie mit »Adagio« – als handele es sich primär um etwas anderes als eine Symphonie. Das Werk ist darum nicht etwa ein vereinzelter »Langsamer Satz« – so, als hätte Hartmann es lediglich unterlassen, dem Adagio die drei anderen üblichen Sätze einer Symphonie hinzuzufügen. Die Tempovorschrift Adagio findet sich nur zu Beginn und am Ende der Komposition; dazwischen gibt es zahlreiche andere Anweisungen zum Tempo. Beschrieben und vollzogen wird eine Entwicklung, die über viele Zwischenstufen von Adagio über Andante zu Allegro führt und über Maestoso und Molto tranquillo zu Adagio wieder zurückkehrt. Die schnelleren Sätze der klassischen Symphonie sind also, zumindest in der Gestalt ihrer Tempi, in das Adagio inte­ griert, das als Ganzes wesentlich von der Spannung zwischen Langsam und Schnell lebt. Die Symphonie schließt, wie sie begann: mit einem Solo der Violoncelli und Kontrabässe, das als Pendant zur unangetasteten Tonalität ihres Haupt­themas in reinstem G-Dur endet. Karl Amadeus Hartmann: 2. Symphonie 9 Anti-»Eroica« und Un-»Neunte« WOLFGANG STÄHR DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH (1906–1975) Symphonie Nr. 9 Es-Dur op. 70 1. Allegro 2. Moderato 3. Presto 4. Largo 5. Allegretto-Allegro mit Orchester, Chor und Solisten. Aber nach einem ersten Einstieg in das ambitionierte Projekt im Kriegswinter 1944/45 brach Schostakowitsch die Komposition unvermittelt ab und begann erst im darauffolgenden Sommer wieder mit einer Symphonie: obschon in der »heroischen« Tonart Es-Dur konzipiert, sollte sie den mittlerweile öffentlich verbreiteten Erwartungen an eine triumphalistische Sieges­ symphonie zuwiderlaufen. Am 30. August 1945 lag die Partiturreinschrift von Schos­ takowitschs »Neunter« vor. URAUFFÜHRUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 25. (12.) September 1906 in Sankt Petersburg; gestorben am 9. August 1975 in Moskau. ENTSTEHUNG Pläne und Ideen zu einer 9. Symphonie beschäftigten Schostakowitsch bereits während der Zeit des Zweiten Weltkriegs: Offenbar dachte er an ein großformatiges Werk Am 3. November 1945 in Leningrad (heute: St. Petersburg) in der Leningrader Philharmonie (Leningrader Philharmoniker unter Leitung von Jewgenij Mrawinskij). Die Uraufführung dieser unpathetischen und unheroischen »Neunten« sorgte für heiligen Zorn bis hinauf an die Spitze des sowjetischen Imperiums: Stalin selbst habe sich empört, erzählt Schostakowitsch in seinen Memoiren, ihm fehlten Chor, Solisten, Apotheose und Bombast, vor allem »die Beweihräucherung des ›Größten‹«, als den Stalin sich natürlich selbst ansah… Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie 10 PERSIFLAGE AUF ALLES HELDENHAFTE UND MILITÄRISCHE »Die Neunte« ! Eine Symphonie der allumfassenden Verbrüderung, das Hohelied des Weltfriedens, Lob und Preis für den »lieben Vater überm Sternenzelt« (Schiller): Ein solches Gipfelwerk war die angemessene Feier für Iosiff Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin, »der Stählerne«, zumal am triumphalen Ende des Großen Vaterländischen Krieges. So jedenfalls empfand es der Diktator selbst. Noch vor der deutschen Kapitulation hatte Dmitrij Schostakowitsch, unvorsichtig genug, das Projekt einer Siegessymphonie für großes Orchester, Chor und Solisten angedeutet, und durch eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS im Sommer 1945 war aus dem Gerücht Gewissheit geworden; zumindest schien es so. Als allerdings im Oktober der Komponist gemeinsam mit dem Pianisten Swjatoslaw Richter eine Klavierfassung dieser 9. Symphonie im Moskauer Komitee für Kunstangelegenheiten vortrug, verfinsterten sich die Gesichter der anwesenden Künstler und Kritiker. Die Leningrader Uraufführung am 3. November 1945 unter der Leitung von Jewgenij Mrawinskij geriet schließlich zum Skandal. Statt des erwarteten Heldenhymnus erklang – ausgerechnet in Es-Dur, der Tonart der »Eroica« – eine Persiflage auf alles Heroische und eine Ironisierung des Militärischen. Die ominöse Atmosphäre des »Moderato«, die weite und freie Deklamation des Solofagotts im »Largo« befremdeten das Auditorium: »O Freunde, nicht diese Töne !« Aber geradezu beleidigt registrierte man das Finale: Nicht die Spur von einer Apotheose, ganz im Gegenteil – eine maliziöse Variante des »per aspera ad astra« beschloss jene teils hintergründig klassizistische, mit Irritationen der tonalen Balance und trügerischer Periodizität spielende, teils abgründig pessimistische Symphonie. »Auf wen zählte Schostakowitsch, als er in seiner 9. Symphonie den leichtsinnigen Yankee darstellte, statt das Bild des siegreichen sowjetischen Menschen zu schaffen ?«, fragte empört nicht nur die »Sowjetskaja musyka«. Ein berühmter russischer Musikwissenschaftler fühlte sich persönlich gekränkt, ein einheimischer Tonsetzer sprach von einem »musikalischen Bubenstreich« und gefiel sich in dem betont bissigen Kommentar: »Der alte Haydn und ein waschechter Sergeant der US-Army, wenig überzeugend auf Charlie Chaplin getrimmt, jagten im Galopp mit allen Gebärden und Grimassen durch den ersten Satz dieser Symphonie…« Der junge Sergej Slonimskij hingegen, ein angehender Komponist, sah die angeblich unzeitgemäßen und skandalösen Eigenarten der Symphonie in einem ganz anderen Licht: »Wir Jugendliche damals spürten sofort die lebendige Angemessenheit und Notwendigkeit dieser Musik in jener Zeit. Unterbewusst nahmen wir die polemische Bedeutung der ›Neunten‹, ihren Spott über jede Art von Heuchelei, Pseudo-Monumentalität und bombastischem Redeschwall wahr.« Leonard Bernstein, der den subversiven Humor dieser »Neunten«, oder besser dieser Un-»Neunten«, über alles liebte, sollte später einmal in einem Vortrag Schostakowitschs Kunst der Desillusionierung mit einem amüsanten Vergleich würdigen: »Es ist, als würde man sich zu einem großen, hochoffiziellen Bankett niederlassen und dann mit Hotdogs und Potato chips bedient.« Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie Unter Aufsicht des Genossen Stalin und einer ins Abseits gerückten Voltaire-Büste: Schostakowitsch spielt für Offiziere der »Roten Armee« (um 1944) Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie 12 »SCHEUSSLICHE, ABSTOSSENDE, PATHOLOGISCHE TENDENZEN« Nicht erst mit dem ZK-Beschluss vom 10. Februar 1948 wurde offensichtlich, dass die sowjetische Kulturpolitik jeder Kunst entgegenzutreten entschlossen war, in der sie moderne westliche Einflüsse – etwa klassizistische – , Satire und Groteske und vor allem »Formalismus« zu erkennen glaubte. Der Begriff des »Formalismus« diente als Worthülse für alles, »was man nicht gleich versteht« (wie der Komponist Sergej Prokofjew sarkastisch anmerkte). In der Enttäuschung und Entrüstung über Schostakowitschs Opus 70 begann sich erneut – nach der Unterbrechung des Krieges – jene Ideologie der Volkstümlichkeit zu regen, die Schostakowitsch schon einmal, 1936, in der Kampagne gegen seine Oper »Lady Macbeth von Mzensk« erlebt hatte und die ihn 1948 mit verstärkter Brutalität treffen sollte. Doch Schostakowitsch hatte nicht nur »falsch« komponiert, »volksfremd« und für »auserwählte Ästheten«, sondern obendrein den fundamentalen Zorn Stalins erregt. »Der große Führer und Lehrer, so vermuten viele, habe in dieser schweren Nachkriegszeit sicherlich anderes zu tun gehabt, als sich über Symphonien und fehlende Huldigungen zu ärgern«, heißt es in Schostakowitschs Memoiren. »Man wird mir vielleicht wenig Glauben schenken, aber so absurd es auch klingen mag: Stalin kümmerte sich um ihm vorenthaltene Huldigungen sehr viel mehr als um die Angelegenheiten des Landes.« So konnte es nicht überraschen, dass Schos­ takowitsch, zusammen mit dem aus dem westlichen Exil heimgekehrten Prokofjew, an der Spitze einer Liste von Komponisten rangierte, gegen die sich der geballte Unmut der Partei richtete. An drei Tagen der ersten Februarwoche 1948 fand eine Sitzung des Zentralkomitees der KPdSU in Moskau statt, bei der man den »beklagenswerten« Zustand des sowjetischen Musiklebens im allgemeinen und der Kompositionen Schostakowitschs im besonderen erörterte. Resultat und Folge jener Tagung war der schon erwähnte ZK-Beschluss vom 10. Februar, der die »formalistische« Richtung in der zeitgenössischen Musik anprangerte: »Indem viele Sowjetkomponisten die besten Traditionen der russischen und westlichen ›klassischen‹ Musik verschmähen, verlieren sie auf der Jagd nach falsch verstandenem Neuerertum in der Musik die Fühlung mit den Anforderungen und dem künstlerischen Geschmack des Sowjetvolks, kapseln sich in einem engen Kreis von Fachleuten und musikalischen Feinschmeckern ab, setzen die hohe gesellschaftliche Rolle der Musik herab und schmälern ihre Bedeutung, die sie auf die Befriedigung des entarteten Geschmacks ästhetizistischer Individualisten beschränken.« Was die Partei verlangte, war eine Musik, welche »die kommunistische Bewusstheit hebt und zu großen Leistungen begeistert«. Noch im selben Februar 1948 traf sich der Moskauer Komponistenverband, um den zitierten ZK-Beschluss zu würdigen und zu begrüßen. Der Komponist Tichon Chrennikow hielt bei dieser Gelegenheit ein an agitatorischer Schärfe kaum zu überbietendes Referat und wurde daraufhin folgerichtig zum Generalsekretär des Gesamtverbandes der sowjetischen Komponisten erkoren – ein Amt, das er bis zum Jahr 1992 bekleidete… Chrennikow sagte: »Eine Art Chiffre, eine abstrakte Musiksprache verdeckt oft echte Emotionen. Das ist dem sowjetischen realistischen Schaffen fremd, das ist purer Epressionismus, Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie 13 Unter dem moralischen Diktat Beethovens: Schostakowitsch komponiert alles andere als eine »Neunte« (1945) Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie 14 ein sich Versenken in die Welt scheußlicher, abstoßender, pathologischer Erscheinungen. Solche Tendenzen finden sich auf vielen Seiten der 8. und 9. Symphonie Dmitrij Schostakowitschs.« »BESCHULDIGTER, VERBEUGE DICH UND BEDANKE DICH !« Selbstverständlich blieb den inkriminierten Komponisten das demütigende Ritual der öffentlichen Selbstbezichtigung nicht erspart. Auch Schostakowitsch sah sich gezwungen, der Partei, die ja nur sein Bestes wünschte, für ihre gerechte Kritik zu danken und zu versichern, »dass ich konkrete Wege suchen und finden muss, die mich zu einem sozialistischen, realistischen, volkstümlichen Schaffen führen werden. Ich soll und will den Weg zum Herzen des Volkes finden.« Wie Schostakowitsch in Wahrheit dachte, hat er später in seinen Memoiren offenbart: »Wenn man dich auf Befehl des Führers und Lehrers von oben bis unten mit Schmutz übergießt, wage ja nicht, dich zu säubern. Verbeuge dich und bedanke dich ! Es wird sowieso niemand deinen feindlichen Ansichten Beachtung schenken. Niemand wird für dich eintreten. Und das traurigste, du kannst dich nicht mal bei deinen Freunden aussprechen, denn unter diesen traurigen Umständen hast du gar keine Freunde mehr.« Schostakowitsch verfolgte nach den Ereignissen des Jahres 1948 eine Art Doppelstrategie. Einerseits lieferte er offizielle Musik, die den ästhetischen Maximen des »Sozialistischen Realismus« angenähert war: etwa ein Oratorium mit dem Titel »Das Lied von den Wäldern«, das Chrennikow als »Zeugnis der tiefen schöpferischen Wandlung des Komponisten« wertete, die Musik zu dem Film »Der Fall von Berlin«, die mit dem Stalinpreis Erster Klasse ausgezeichnet wurde, oder die zum XIX. Parteitag der KPdSU komponierte Kantate »Über unserer Heimat strahlt die Sonne«. Doch diese Stücke dienten als kalkulierte – und nach dem 10. Februar 1948 lebensnotwendige – Zugeständnisse, als »Teil eines Tributs, der zu entrichten war«. So hat es Schostakowitschs Sohn Maxim erläutert: »Man musste eben bestimmte Werke schreiben. Danach hatte Schostakowitsch die Möglichkeit, das zu komponieren, was er wirklich wollte. Wenn man weiß, dass er ständig eine Maske tragen musste, versteht man, dass er nur so sein eigentliches Œuvre retten konnte. Ich liebe diese offiziellen Arbeiten nicht besonders, möchte sie aber vom künstlerischen Standpunkt her nicht verdammen. Schließlich bin ich sein Sohn. Ich bin überzeugt, dass mein Vater richtig gehandelt hat, denn es war der einzig mögliche Weg.« In den späten 50er Jahren traf der deutsche Journalist Gerd Ruge einmal mit Schostakowitsch zusammen. »Schostakowitsch ist ein kleiner, grauhaariger Mann mit schmalem Gesicht und nervös umherirrenden Augen. Während ich ihm Fragen stelle, blickt er mich starr, wie hypnotisiert an. Wenn er antwortet, blickt er im Zimmer herum, fährt sich ständig mit zitternden Händen durch das kurze Haar, reibt sich die Augenbrauen, setzt die Brille auf und ab. Er spricht schnell und dennoch oft stockend, so als kontrolliere er sich bei jedem Satz, um ja nichts Falsches zu sagen. Selten ist es mir so schwer geworden, ein Gespräch zu führen«, gestand der deutsche Korrespondent. »Dmitrij Schostakowitsch ist ein gehetzter Mann, und vielleicht erklärt sich daraus jene Nervosität, die dem Besucher wie Unsicherheit vorkommt. Vielleicht ist er tatsächlich ganz zufrieden Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie 15 Dmitrij Schostakowitsch auf nicht enden wollender Wahrheitssuche in der »Prawda« (um 1960) damit, dass ihn die Partei vom ›Irrweg des Formalismus‹ zurückholte – als eine strenge und harte Lehrerin, die zu strafen, aber auch zu belohnen und zu verzeihen weiß. Niemand kann sagen, was ihn diese Entscheidung gekostet hat, und niemand kann wissen, was hinter dem zuckenden Gesicht vorgeht.« Dmitrij Schostakowitsch: 9. Symphonie 16 Joseph Willibrord Mähler: Ludwig van Beethoven als Orpheus in arkadischer Landschaft (1804) Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 17 Apotheose des Militärischen ? MARCUS IMBSWEILER LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 1. Allegro 2. Adagio un poco moto 3. Rondo: Allegro, ma non tanto LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geburtsdatum unbekannt: geboren am 15. oder 16. Dezember 1770 in Bonn, dort Eintragung ins Taufregister am 17. Dezember 1770; gestorben am 26. März 1827 in Wien. ENTSTEHUNG Am 22. Dezember 1808 fand jene berühmte Wiener »Akademie« statt, in der nicht nur die 5. und 6. Symphonie Beethovens zum ersten Mal erklangen, sondern auch die sog. »Chorfantasie«, Teile der C-DurMesse und das 4. Klavierkonzert G-Dur. Kurz danach begann Beethoven mit der Komposition eines weiteren Klavierkonzerts, das im Autograph den Titel »Klavierkonzert 1809« trägt. Die Arbeit an dem Werk zog sich offenbar über das gesamte Jahr hin und endete wohl erst im Februar 1810. WIDMUNG »Dédié à Son Altesse Imperiale Roudolphe Archi-Duc d’Autriche«: Beethoven widmete das Konzert seinem Freund und Gönner, dem Erzherzog (und späteren Kardinal) Rudolph von Habsburg (1788–1831), dem jüngsten Bruder des regierenden Kaisers Franz II., der 1819 Fürsterzbischof von Olmütz wurde. Dem Erzherzog, der wohl seit 1804 Beethovens Klavierschüler war, sind zahlreiche Werke gewidmet, darunter das 4. Klavierkonzert, die »Hammerklavier-Sonate« und die »Missa solemnis«. URAUFFÜHRUNG Am 28. November 1811 in Leipzig im Großen Gewandhaus-Saal (Leipziger Gewandhaus-Orchester unter Leitung von Johann Philipp Christian Schulz; Solist: Friedrich Schneider). Die Wiener Erstaufführung erfolgte Anfang 1812 mit dem BeethovenSchüler Carl Czerny am Klavier. Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 18 Kontrastierende Werkpaare sind eines der auffälligsten Merkmale im Schaffen Ludwig van Beethovens. Die 5. und 6. Symphonie bilden das wohl berühmteste dieser »Pärchen«, zu erwähnen sind aber auch die Symphonien Nr. 7 und 8, die beiden Cellosonaten op. 5 sowie die Klavierkonzerte Nr. 4 und 5. In all diesen Fällen wird Beethovens Bestreben deutlich, innerhalb ­einer Gattung möglichst unterschiedliche Ausdruckswelten auszuloten. Während etwa das 4. Klavierkonzert als schlechthin lyrisches, introvertiertes gilt, gibt sich das zwei Jahre später komponierte 5. Klavierkonzert dezidiert anders, nämlich selbstbewusst-auftrumpfend – ein Werk in der »heroischen« Tonart Es-Dur, von Marschtonfällen durchsetzt. Nicht umsonst trägt es im angelsächsischen Bereich den Beinamen »Emperor«, wobei offenbleibt, auf welchen »Herrscher« diese Musik gemünzt sein soll. Berühmtheit erlangte Alfred Einsteins Wort von der »Apotheose des Militärischen«, die er vor allem im 1. Satz verwirklicht sah; andere sprachen von Beethovens »kriegerischstem Konzert«. MUSIK IN ZEITEN DES KRIEGES Dass das Begriffsfeld des »Militärischen« gerade bei diesem Werk Anwendung findet, ist alles andere als ein Zufall. Im Entstehungsjahr 1809 kulminierten die jahrelangen bewaffneten Auseinandersetzungen der europäischen Mächte – auf der einen Seite Österreich, Preußen, England und Russland, auf der anderen die französische Republik unter ihrem Heerführer Napoléon Bonaparte – in der zweiten Besetzung ­Wiens. Am 11. Mai begann das Bombardement, das Beethoven, beide Ohren mit Kissen bedeckt, im Keller seines Bruders Caspar überstand. Nach der Kapitulation litten die Einwohner unter hohen Zwangsabgaben, Verknappung der Lebensmittel sowie allgemein unter Einschränkungen des öffent­ lichen Lebens. Vor diesem wahrhaft martialischen Hintergrund entstand das 5. Klavierkonzert. Nun hatte Beethoven bereits einige Jahre zuvor ein Es-Dur-Werk »heroischen« Charakters und »kriegerischer« Züge vorgelegt: die 3. Symphonie. Sie »ist eigentlich betitelt Bonaparte«, verriet Beethoven dem Verlag Breitkopf & Härtel. Später jedoch, in der Erstanzeige des gedruckten Werks, vermied er jede direkte Zuschreibung: »Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand’ uomo« / »Heroische Symphonie, komponiert, um das Andenken eines großen Mannes zu feiern«. Enttäuscht von Napoléons usurpatorischer Politik, soll Beethoven die Widmung getilgt haben. Wer aber verbirgt sich dann hinter dem »grand’ uomo« ? Möglicherweise der Preußenprinz Louis Ferdinand, dem Beethoven bereits sein 3. Klavierkonzert gewidmet hatte ? Der hochbegabte Musiker aus dem Hause Hohenzollern fiel im Oktober 1806 bei einem Gefecht gegen die Franzosen – kurz vor Erscheinen der »Eroica«. ZWISCHEN DEN FRONTEN Auch beim 5. Klavierkonzert lässt sich nicht entscheiden, wem der Beiname »Emperor« gelten könnte. An Napoléon wird Beethoven kaum gedacht haben, höchstens in Form eines Idealbilds, das längst von der Realität eingeholt worden war. An Franz I., den ehemals deutschen, jetzt österreichischen Kaiser, der aus seiner reaktionären Gesinnung kein Hehl machte, noch weniger. Nun findet sich im Autograph des Konzerts ein handschriftlicher Eintrag Beethovens, Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 19 Isidor Neugass: Ludwig van Beethoven (1805) Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 20 der auf Frankreichs »Empereur« Bezug nimmt – allerdings in negativer Weise: »Östreich löhne Napoleon«. Soll heißen: Das Land möge es dem Franzosen heimzahlen. Andererseits hatte sich Beethoven noch kurz vorher, Anfang 1809 nämlich, mit dem Gedanken getragen, als Kapellmeister nach Kassel zu gehen. Dort regierte kein Geringerer als der jüngste Bruder Napoléons, Jérôme. In Wien machte man ihm daraufhin ein Gegenangebot, gekrönt durch eine üppige Jahresrente von 4000 Gulden. Treibende Kraft hinter diesem »Ehrensold« war Erzherzog Rudolph, der Widmungsträger des 5. Klavierkonzerts. Dieses biographische Hin und Her lässt ahnen, in welcher Zwickmühle sich Beethoven 1809 befand. Hin- und hergerissen zwischen seinem einstigen Idol Napoléon, das den Kontinent mit Tod und Vernichtung überzog, und einer Adelsgesellschaft vor Ort, die ihn, den Republikaner, finanziell und künstlerisch unterstützte. Welche Berechtigung hatte in dieser Situation dann noch das Konzept des Heroischen ? War es angesichts der realen Verhältnisse nicht zum Scheitern verurteilt ? IM GESTUS DER UNBEUGSAMKEIT Tatsächlich beginnt das Es-Dur-Konzert mit einer musikalischen Geste, wie sie selbstsicherer kaum ausfallen könnte: einer simplen Kadenzformel im Orchester (Akkorde auf Es – As – B), die vom Solisten mit brillantem Skalenwerk angereichert wird. Grundtonart, harmonischer Rahmen, Lautstärke, Virtuosität, Klangspektrum – alles ist von vornherein da, nichts muss mühsam erarbeitet werden, nichts wird in Frage gestellt. Nur eines fehlt: ein Thema. Aber das wird sofort, nach Abschluss der Kadenz, vom Orchester nachgereicht. Breite Brust auch hier: ein stolz präsentierter Marschgedanke, klar gegliedert, ungetrübtes EsDur, zwar nur in Streicherbesetzung, dafür aber mit Hervorhebung der »zackigen« Punktierungen durch die Hörner. So weit, so eindeutig. Allerdings kleidet Beethoven bereits das Echo dieser Themenvorstellung in ein neues Klang- und Ausdrucksgewand: Die Solo-Klarinette übernimmt zu weicher Holzbläserbegleitung, piano und dolce. Kurze Irritation, dann kehrt der Militärgestus zurück, intensiviert durch den Einsatz von Blechbläsern und Pauke. Das Hauptthema erklingt in voller Ausdehnung, um in der Folge dem Seitenthema zu weichen. Und an dieser Stelle, dem Eintritt des Seitensatzes, zeigt sich, dass es sich bei der kurzen Eintrübung des Heroischen durch die Klarinette um keine spontane Klang­ variation handelte, sondern um einen wesentlichen Teil des Gesamtkonzepts. Denn statt eines fest umrissenen Seitenthemas präsentiert uns Beethoven gleich mehrere Ausprägungen derselben Grundidee, die in völlig verschiedene Richtungen weisen. Zunächst ein schüchtern stockendes Streichergebilde in es-Moll (!), das von den Hörnern gleichsam korrigiert wird: Sie formulieren es um zu einem lyrischen Bläser­duett in Es-Dur. Dies also, scheint Beethoven zu sagen, ist die korrekte Formulierung meiner Idee. Doch weit gefehlt: Bei der Wiederholung der Exposition löst der Solist das thematische Material erst in eine pendelnde Triolenbewegung auf, um es dann mit zarten Achtelläufen zu umspielen. Worauf das Orchester, erneut in waghalsiger Rückung, einen rüden Kasernenhofton anschlägt: das Seitenthema ertönt als lärmender, laut gestampfter Marsch mit Bläsergeklingel und starrem Bass. Ist dies nun die richtige Ver- Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 21 Franz Klein: Nach einer »Lebendmaske« gestaltete Büste Ludwig van Beethovens (1812) MPH_01011_PH-Thielemann5_RZ.indd 15 Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 25.02.11 17:19 22 sion, da sie dem Konzertbeginn am nächsten kommt ? Oder bloß eine besonders belanglose ? BRÜCHE, ZURÜCKNAHMEN, INFRAGESTELLUNGEN Da sich der geschilderte Ablauf in der Reprise fast wörtlich wiederholt, kann die Antwort nur lauten: Es gibt keine »richtige« Version. Das Seitenthema existiert in multiplen Gestalten, deren Ausdrucksgehalt ganz unterschiedliche Assoziationen hervorruft – und das Militärische ist nur ein Aspekt unter ihnen. Schaut man nun in die Mitte des Satzes, in die Durchführung, die so oft bei Beethoven den Kernkonflikt enthält oder einen Durchbruch erzwingt, so wird man feststellen, dass der dortige Höhepunkt von einer Aggressivität geprägt ist, die man durchaus »kriegerisch« oder »militärisch« nennen könnte. Den monotonen Marschsignalen des gesamten Bläserapparats schleudert der Solist dröhnende Akkorde entgegen und »flüchtet« sich in ein an Liszt gemahnendes Fugato in Doppeloktaven. Nur: Dieser Höhepunkt bleibt folgenlos. Er erzwingt nichts, sondern wird seiner Dynamik beraubt, ebbt ab, verliert sich schließlich im Nichts. Erst das Orchester gibt dem Ganzen wieder eine Richtung, und zwar durch Rückkehr zum Beginn des Konzerts: Mit der Kadenzformel der Anfangstakte setzt die Reprise ein. Von einer »Apotheose des Militärischen« lässt sich also nur auf den ersten Blick sprechen. Im Innern dieses so geharnischt anstürmenden Satzes walten Brüche, Zurücknahmen, Infragestellungen. Auch das Versprechen atemberaubender Virtuosität läuft ins Leere. So unbeherrscht der Solist dem eröffnenden Orchester ins Wort fällt, so technisch vertrackt auch sein Part ist: Kaum einmal erhält er Gelegenheit, sich frei von allen kompositorischen Zwängen zu entfalten, sondern bleibt stets eingebunden in das orchestrale Gewebe. Das betrifft sowohl die Gleichberechtigung der Stimmen, die sich die Ausformulierung der Gedanken teilen, als auch die totale Eingliederung der virtuosen Passagen, des Skalenwerks und der gehämmerten Oktaven in den thematischen Prozess. Dem fällt als äußerlich hervorstechendes Merkmal das Markenzeichen des klassischen Solokonzerts zum Opfer: die Kadenz. Beethoven gestattet dem Pianisten zum Ende des ersten Satzes lediglich ein aphoristisches Anreißen der Hauptgedanken, notiert ansonsten aber unmissverständlich: »Non si fa una cadenza« – »hier keine Kadenz«. ADAGIO UND RONDO Und die übrigen Sätze ? Das Finale gestaltet Beethoven als forsches Rondo mit rhythmisch widerborstigem Thema, einer Art kraftstrotzendem Geschwindwalzer. Zupackend wie der erste Satz, ist es doch meilenweit von allem kriegerischen Jargon entfernt. Dort, wo der Hörer des frühen 19. Jahrhunderts eine zweite Kadenz erwartete, kurz vor Ende des Finale nämlich, gelingt Beethoven ein wirklich atemberaubender Effekt: Ganz plötzlich wird der Schwung des 6/8-Takts gebremst, übrig bleiben, ständig retardierend, allein Klavier und Pauke mit kurzen, in sich zusammensackenden Themenfragmenten. Am Zielpunkt dieser Entwicklung, einer absoluten Tonlosigkeit, durchhaut der Solist gewaltsam den Knoten und leitet mit einem letzten trotzigen Skalenlauf zum Satzschluss über. Das ganz Andere präsentiert der langsame Satz: ein Adagio in H-Dur (!), so weihe- Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 23 Franz Jaschke: Die Wiener Burgbastei nach der Erstürmung durch französische Truppen (1809) voll-innig, dass der Klaviersolist der Wiener Erstaufführung, Beethovens Schüler Carl Czerny, in ihm »die religiösen Gesänge frommer Wallfahrer« zu hören glaubte. Vielleicht haben sie dem Komponisten tatsächlich vorgeschwebt; entscheidend ist jedoch, dass auch sie, wie zuvor die militärischen Versatzstücke, ummodelliert und in den thematischen Prozess eingebunden werden. Gesanglichkeit ist allerdings das herausragende Merkmal dieses Mittelsatzes, und so kommen denn auch die Holzbläser hier mehr als anderswo zu Wort. DIE KUNST DES ÜBERGANGS Einen letzten Hinweis darauf, dass Etiketten wie »militärisch« oder »religiös« immer nur ein bestimmtes, besonders auffälliges Äußeres einer Passage treffen, aber längst nicht das Werk insgesamt oder auch nur einen seiner Sätze, bieten die Übergänge zwischen den extrem kontrastreichen Sätzen. Vor dem Finale – dieser Effekt wurde zu recht immer wieder hervorgehoben – findet im Orchester eine überraschende Halbtonrückung nach unten statt (von H nach B), und in die neugeschaffene Atmosphäre hinein tastet sich der Solist mit den vorsichtigen Anfangsklängen des Rondothemas, bevor er das Finale geradezu überfallartig einläutet. Aber auch der Übergang vom 1. zum 2. Satz ist gestaltet, indem das Es, der Schlusston des Allegro, als Dis und damit als Terz von H-Dur am Beginn des Adagio steht. Die heroische Tonart wird, um mit Bernhard Rzehulka zu sprechen, »gleichsam umgebettet und muss sich neu bewähren«. Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 24 Kaiser, Pilger, Jäger WOLFGANG STÄHR VORBILDCHARAKTER UND GATTUNGSAUTORITÄT In Wechselspiel und Wettstreit, im spannungsreichen Gegensatz zwischen Tutti und Solo, Monumentalität und Intimität, ordnender Kraft und improvisatorischer Laune lag einst der Ursprung des Konzerts, seine Grundidee. Wenn Ludwig van Beet­ hoven am Beginn seines 5. Klavierkonzerts die wie Pfeiler eingerammten Tutti-Akkorde des Orchesters mit den Tonkaskaden und Passagen des Solisten kontrastieren lässt, so zelebriert er das konzertante Prinzip in seiner reinsten und elementarsten Form. Noch bevor auch nur ein Takt der Exposition erklungen ist, hat er mit diesem Prolog das wahre Thema des Konzerts angeschlagen, das sich wie ein Drama mit handelnden Akteuren ereignet: Dem Solisten gebührt natürlich die Hauptrolle, und er gestaltet sie mit einer Freiheit gegenüber dem Orchester, mit einem primadonnenhaften Selbstbewusstsein – etwa wenn er sich am Ende des ersten Orchesterritornells gleich mehrfach zum Auftritt bitten lässt – und einer Autorität, wie sie bis dahin in der Geschichte der Gattung ohne Beispiel waren. Die großen Virtuosenkonzerte eines Liszt, Tschaikowskij oder Rachmaninow finden in diesem epochalen Werk Ludwig van Beet­ hovens ihr Urbild. »EMPEROR CONCERTO« Aber der Eindruck von Freiheit und Improvisation, den der Solopart des 1809 komponierten Es-Dur-Konzerts op. 73 wachruft, basiert paradoxerweise auf der strengsten Kontrolle durch den Komponisten. Denn Beethoven überließ rein gar nichts dem Zufall oder etwa der momentanen Eingebung des Pianisten, sondern fixierte jedes vermeintlich aus dem Augenblick geborene Detail akkurat im Notentext. Selbst die Kadenz, traditionellerweise ein »Freiraum« des Solisten, steht auskomponiert und »vor«-geschrieben auf dem Papier. Gleichwohl: Beim Hören ist es nur der kühne, gebieterische, dominierende Charakter des Soloparts, der sich einprägt. Im angelsächsischen Sprachraum wird es deshalb als »Emperor Concerto« bezeichnet – in Frankreich erhielt es den Beinamen »L’Empereur«, in Italien »L’Imperatore«. Als »Kaiserkonzert« wurde Beethovens Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 25 Blasius Höfel [nach einer Zeichnung von Louis Letronne]: Ludwig van Beethoven (1814) Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert MPH_01011_PH-Thielemann5_RZ.indd 19 25.02.11 17:19 26 Opus 73 in Deutschland zwar nie tituliert, aber immerhin arrangierte der deutsche Musiker und Instrumentenbauer Wilhelm Wieprecht, ab 1845 mit der Reorganisation der preußischen Militärmusik betraut, die Orchesterexposition des 1. Satzes für die Besetzung einer Militärkapelle und ließ diese Fassung bei Aufmärschen und Platzkonzerten spielen. »FROMME WALLFAHRER« Auf zweifellos friedliches Terrain begibt sich Beethoven mit dem langsamen Satz, einem »Adagio un poco mosso«. Carl Czerny, Schüler des Komponisten und überdies Solist der Wiener Erstaufführung des EsDur-Konzerts, wusste zu berichten: »Als Beethoven dieses Adagio schrieb, schwebten ihm die religiösen Gesänge frommer Wallfahrer vor.« Czernys Aussage bezieht sich auf jenes weihevolle und hymnenartige Thema, das zuerst von den Streichern gespielt, im späteren Verlauf des Satzes vom Pianisten »cantabile« vorgetragen und schließlich von den Bläsern intoniert wird. Die stille Poesie und entrückte Klangschönheit dieser Musik suchen ihresgleichen; und weit in die musikalische Romantik weisen jene Takte voraus, in denen das Klavier zu Beginn auf den »religiösen Gesang« der Streicher antwortet: mit kontemplativen, suchenden, ziellosen Melodiezügen ohne Anfang und Ende, gleichsam Fragmenten einer geheimnisvollen, unhörbaren Musik. Unwillkürlich wird man an die Verse Friedrich Schlegels erinnert: »Durch alle Töne tönet / Im bunten Erdentraume, / Ein leiser Ton gezogen, / Für den, der heimlich lauschet.« »WILDER JÄGERCHOR« Am Schluss des »Adagio« wird der Hörer jedoch denkbar unsanft aus dieser träumerisch-unwirklichen Stimmung gerissen. Der Pianist scheint das Thema des sich unmittelbar anschließenden Finale mehr ertasten als spielen zu wollen – ehe plötzlich das Rondo mit Vehemenz hereinbricht und uns auf den Boden der Wirklichkeit zurückholt. Joseph Kerman, der amerikanische Beethoven-Forscher, vergleicht das eruptive Thema mit einem »wilden Jägerchor in einer noch nicht geschriebenen romantischen Oper«. Wollte man das Konzert als eine Art Rollenspiel ansehen, so wäre der Solist nach der Darstellung eines Gebieters oder Herrschers im 1. Satz und eines romantischen Pilgers im 2. Satz nun also in die Rolle eines Jägers geschlüpft. Aber selbst in diesem kraftbetonten und erdverbundenen Rondo hat Beethoven für den Pianisten die schönsten lyrischen Episoden erdacht, und nur von einem ostinaten Paukenrhythmus begleitet scheint es das Klavier mit einer sanft absteigenden Akkordfolge zu einem friedvollen Ende führen zu wollen. Doch bevor das Finale verklungen ist, setzt der Solist unvermittelt zu einer letzten virtuosen Attacke an. Dem Orchester bleibt danach gerade noch die Zeit zu einem hektischen und ziemlich abrupt gesprochenen Schlusswort, in der Sprache des Theaters: »Der Vorhang fällt schnell !« Ludwig van Beethoven: 5. Klavierkonzert 27 Valery Gergiev DIRIGENT In Moskau geboren, studierte Valery Gergiev zunächst Dirigieren bei Ilya Musin am Leningrader Konservatorium. Bereits als Student war er Preisträger des Herbert-­ von-Karajan-Dirigierwettbewerbs in Berlin. 1978 wurde Valery Gergiev 24-jährig Assistent von Yuri Temirkanov am MariinskijOpernhaus, wo er mit Prokofjews Tolstoi-­ Vertonung »Krieg und Frieden« debütierte. 2003 dirigierte Gergiev als erster russischer Dirigent seit Tschaikowskij das Saisoneröffnungskonzert der New Yorker Carnegie Hall. Valery Gergiev leitet seit mehr als zwei Jahr­ zehnten das legendäre Mariinskij-Theater in St. Petersburg, das in dieser Zeit zu einer der wichtigsten Pflegestätten der russischen Opernkultur aufgestiegen ist. Darüber hinaus ist er Leiter des 1995 von Sir Georg Solti ins Leben gerufenen »World Or­ chestra for Peace«, mit dem er ebenso wie mit dem Orchester des Mariinskij-Theaters regelmäßig Welttourneen unternimmt. Von 2007 an war Gergiev außerdem Chefdirigent des London Symphony Orchestra, mit dem er zahlreiche Aufnahmen für das hauseigene Label des Orchesters einspielte. Valery Gergiev präsentierte mit seinem Mariinskij-Ensemble weltweit Höhepunkte des russischen Ballett-und Opernrepertoires, Wagners »Ring« sowie sämtliche Symphonien von Schostakowitsch und Prokofjew. Mit dem London Symphony Orchestra trat er regelmäßig im Barbican Center London, bei den Londoner Proms und beim Edinburgh Festival auf. Zahlreiche Auszeichnun­ gen begleiteten seine Dirigenten­karriere, so z. B. der Polar Music Prize und der Preis der All-Union Conductor’s Competition in Moskau. Ab der Spielzeit 2015/16 ist Valery Gergiev neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Die Künstler 29 Nobuyuki Tsujii KLAVIER mit dem Mariinskij-Orchester St. Petersburg und natürlich mit zahlreichen japanischen Klangkörpern. Über »Nobu« wurden inzwischen in Japan Bücher publiziert, eine erste CD war bereits 2007 erschienen. Es folgten zahlreiche weitere Aufnahmen, u. a. mit Mussorgskijs »Bildern einer Ausstellung« und dem 2. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow unter Leitung von Yutaka Sado. Eine USA-Tournee mit dem Orpheus Chamber Orchestra führte Nobuyuki Tsujii nach New York, wo er schon früher mit einem Klavierabend in der Carnegie Hall debütiert hatte. Nobuyuki Tsujii wurde 1988 in Japan geboren und zeigte schon früh eine ungewöhn­ liche musikalische Begabung. Für den von Geburt an blinden Pianisten wurde das Klavier zum Ausdrucksmittel seiner inneren Welt; sein Repertoire erarbeitet er sich nicht mithilfe von Noten, sondern mit einem Vorspieler: Über das Hören und Nachspielen des Gehörten. 2009 begann mit der Goldmedaille beim Van Cliburn-Klavierwettbewerb Nobuyuki Tsujiis internationale Karriere. Inzwischen trat er mit zahlreichen Orchestern auf, u. a. mit den Londoner BBC-Orchestern, Das als amerikanisch-japanische Koproduktion realisierte Filmporträt »Touching the Sound – Die Klangwelt des blinden Pianisten Nobuyuki Tsujii« wurde im September 2014 beim Filmfestival in San Diego präsentiert und kurz darauf vom britischen Magazin »Gramophone« zur DVD des Monats gekürt. Regisseur Peter Rosen, der Tsujiis Leben zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet hat, will mit dem Film die Welt des blinden Musikers für sein Publikum sicht- und hörbar machen. Die Künstler 30 Die Philharmoniker als frühe Botschafter russischer Musik GABRIELE E. MEYER Russische Musik in München ? Ein Streifzug durch die Programme der Münchner Philharmoniker von 1893 (dem Gründungsjahr des Orchesters) bis in die frühen 30er Jahre zeigt, dass neben den wiederkehrenden Beethoven-, Brahms- und Bruckner-­ Zyklen, die zahlreichen Richard Wagner-­ Abende nicht zu vergessen, auch nicht-­ deutsche Musik, vor allem aber russische Musik aufgeführt wurde. Mit diesem Beitrag soll an einen Dirigenten und Komponisten erinnert werden, dem die Münchner Musikfreunde Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts einen äußerst spannenden Einblick in die damalige Musikentwicklung seines Landes verdankten, kannte man doch außerhalb Russlands bislang kaum mehr als die Musik des eher westeuropäisch orientierten Pjotr Iljitsch Tschaikowskij. Gefördert von Milij Balakirew studierte der am 5. Dezember 1869 in Tiraspol geborene Nikolaj Iwanowitsch von Kasanli (auch: Kazanli) neben seiner Offizierslaufbahn u. a. Komposition bei Nikolaj Rimskij-Korsakow, bevor er ins Ausland ging. Wie schon vor ihm Jurij Nikolajewitsch Gallitzin sah es auch Kasanli als seine vornehmste Aufgabe an, einen Überblick über die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen seiner Heimat zu geben. In seinem Münchner Debüt als Dirigent am 17. März 1897 – der ursprünglich angesetzte Termin wurde »wegen eingetretener Hindernisse« um zwei Tage verschoben – , stellte sich Kasanli sogleich mit eigenen Kompositionen vor. Die »Münchner Neuesten Nachrichten« würdigten seine eingangs gespielte Symphonie in f-Moll als durchaus ernstzunehmende Talentprobe. »Sie zeigt nicht nur, daß der junge Mann vortreffliche Studien gemacht hat, sondern sowohl im Aufbau wie in der Ausgestaltung der fast durchweg edel empfundenen Themen und Melodien ein Beweis wahrer Begabung ist. […] Der seine Werke selbst dirigierende Komponist wurde nach jedem Satze der vom Kaim-Orchester vortrefflich gespielten Symphonie durch verdienten starken Beifall geehrt.« Die Vokalbeispiele hingegen fanden deutlich weniger Anklang. Daran konnten auch die »Hervor- Russische Musik in München 31 Programm des letzten »Russischen Symphonie-Concerts« unter Leitung von Nikolaj von Kasanli Russische Musik in München 32 rufungen« am Ende des Abends nichts ändern. Zehn Monate später übernahm Kasanli die zweite Hälfte eines Konzerts mit der »Königlichen Hofopernsängerin Emilie Herzog aus Berlin«. Zunächst spielte das Orchester nochmals die f-Moll-Symphonie, danach Borodins »Steppenskizze aus Mittelasien« und Balakirews »Ouvertüre über ein spanisches Marschthema«. In dem am 30. Dezember 1898 geleiteten »Russischen Symphonie-Concert« machte Kasanli noch auf weitere Komponisten aus dem Umkreis des sogenannten »Mächtigen Häufleins« wie Sergej Ljapunow und Aleksandr Tanejew aufmerksam. Balakirew war diesmal mit der symphonischen Dichtung »Russia« vertreten, der Dirigent mit In­strumentationen von zwei Klavierstücken von Franz Liszt (»Sposalizio« und »Il Penseroso«) sowie von Schuberts »Erlkönig«. Das Echo war diesmal recht zwiespältig. »Es ist überhaupt mit der ganzen jung-russischen Schule eine eigene Sache. Ihre Vertreter bringen oft recht Interessantes, bei dem aber vielfach mehr Absonderlichkeit, als echte Originalität sich äußert.« Dank Kasanlis Engagement kam es ein gutes Jahr später gar zu einem »Concert Michael Glinka gewidmet«. Zum ersten Mal erklangen große Teile – »Fragmente« wie es damals hieß – aus der Oper »Ruslan und Ljudmila«, die trotz des Fehlens von Handlungsübersicht und der jeweiligen Szenentexte in der Konzerteinführung äußerst positiv aufgenommen wurden. So meinten die »Münchner Neuesten Nachrichten«, dass die Bruchstücke durchweg interessant und reich an charakteristischen Stellen seien, »deren Wirkung durch eine sehr farbenreiche Instrumentation gehoben wird«. Die sehr detaillierte Besprechung würdigte zudem die Leistung aller Mitwirkenden. »Das Kaim-Orchester hielt sich sehr wacker, und Herr v. Kasanli, der mit viel Schwung und Lebendigkeit dirigierte, wußte das oft sehr komplizierte Ensemble gut zusammenzuhalten, wenn auch viele Momente […] zu stärkerer Wirkung hätten gelangen können.« Weitere Konzerte mit wiederum zum Teil noch nicht gehörten Werken von Aleksandr Dargomyschskij, César Cui und Nikolaj Rimskij-Korsakow sowie von Balakirew, Borodin und Tanejew folgten, dann verließ Kasanli die Residenzstadt München. Bis auf Modest Mussorgskij hatte er alle wichtigen Komponisten vorgestellt, einen Bogen gespannt von Glinka und Dargomyschskij als den Vätern der russischen Tradition bis zu den Protagonisten und Sympathisanten des »Mächtigen Häufleins«, denen ja auch Kasanli angehörte. Doch riss die Vorliebe für das Russische nach seinem Weggang nicht ab. Nun gab es Komponisten zu entdecken wie beispielsweise die (bis heute) völlig unbekannten Sergej Bortkjewitsch, Wasilij Kalinnikow, Nikolaj Lopatnikow und Modest Mussinghoff, aber auch selten gespielte Werke von Anton Rubinstein, Anatol Ljadow, Aleksandr Skrjabin, Aleksandr Glasunow, Sergej Prokofjew, Igor Strawinskij, Aleksandr Tscherepnin und Wladimir Vogel. Noch bis zum Beginn der 30er Jahre wurden »Russische Abende« angesetzt, aber keiner hatte sich so engagiert für die Musik seines Landes eingesetzt wie jener heute zu Unrecht vergessene Dirigent, Komponist und unermüdliche Organisator Nikolaj von Kasanli. Am 23. Juli 1916 ist er in St. Petersburg gestorben. Russische Musik in München 33 Sonntag 08_11_2015 11 Uhr Freitag 13_11_2015 20 Uhr h4 2. KAMMERKONZERT Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz ARNOLD SCHÖNBERG »Begleitmusik zu einer Lichtspiel­szene« op. 34 ALEXANDER SKRJABIN »Prométhée. Le Poème du Feu« für Klavier, Chor und Orchester op. 60 RICHARD WAGNER »Die Walküre«, 1. Aufzug Konzertante Aufführung »Funkelnde Welt« LOUIS SPOHR Nonett F-Dur op. 31 FERENC FARKAS Alte ungarische Tänze aus dem 17. Jahrhundert für Bläserquintett NINO ROTA Nonett MICHAEL MARTIN KOFLER Flöte KAI RAPSCH Oboe LÁSZLÓ KUTI Klarinette BENCE BOGÁNYI Fagott MIA ASELMEYER Horn QI ZHOU Violine KONSTANTIN SELLHEIM Viola SISSY SCHMIDHUBER Violoncello SHENGNI GUO Kontrabass VALERY GERGIEV Dirigent DENIS MATSUEV Klavier ANJA KAMPE Sopran JOHAN BOTHA Tenor RENÉ PAPE Bass PHILHARMONISCHER CHOR MÜNCHEN Einstudierung: Andreas Herrmann Vorschau 34 Die Münchner Philharmoniker 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Lucja Madziar, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Helena Madoka Berg Iason Keramidis Florentine Lenz 2. VIOLINEN Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Triendl Ana Vladanovic-Lebedinski Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Julia Rebekka Adler, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler Yushan Li VIOLONCELLI Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth Das Orchester 35 KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich Zeller Thomas Hille Alois Schlemer Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler FLÖTEN POSAUNEN Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte Dany Bonvin, Solo David Rejano Cantero, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune OBOEN PAUKEN Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo Walter Schwarz, stv. Solo KLARINETTEN Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette FAGOTTE Lyndon Watts, Solo Sebastian Stevensson, Solo Jürgen Popp Jörg Urbach, Kontrafagott HÖRNER Jörg Brückner, Solo Matias Pin~eira, Solo Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach HARFE Teresa Zimmermann CHEFDIRIGENT Valery Gergiev EHRENDIRIGENT Zubin Mehta INTENDANT Paul Müller ORCHESTERVORSTAND Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim Das Orchester 36 IMPRESSUM BILDNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Abbildungen zu Karl Amadeus Hartmann: Franzpeter Messmer (Hrsg.), Karl-Amadeus-HartmannJahr 2005 in Bayern, München 2004; Sammlung Stephan Kohler, München. Abbildungen zu Dmitrij Schostakowitsch: Jürgen Fromme (Hrsg.), Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit – Mensch und Werk, Duisburg 1984; Solomon Wolkow (Hrsg.), Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch, Berlin / München 2000; Solomon Wolkow, Stalin und Schostakowitsch – Der Diktator und der Künstler, Berlin 2004. Abbildungen zu Ludwig van Beethoven: Joseph Schmidt-Görg und Hans Schmidt (Hrsg.), Ludwig van Beethoven, Bonn 1969; H. C. Robbins Landon, Beethoven – A documentary study, New York 1970. Sonstige Abbildungen: Privatbesitz. Künstlerphotographien: Marco Borg­gre­ve (Gergiev); Yuji Hori (Tsujii). Lektorat: Stephan Kohler Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Color Offset GmbH Geretsrieder Str. 10 81379 München TEXTNACHWEISE Egon Voss, Wolfgang Stähr, Marcus Imbsweiler und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler verfasste bzw. redigierte die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Künstlerbiographien (Gergiev, Tsujii): Nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. TITELGESTALTUNG Andreas Achmann beschäf­ tigt sich mit der Umsetz­ ung des Metaphysischen in der Fotografie. So auch im Motiv zu Beethovens 5. Klavierkonzert. >>Es führt uns aus der Dunkelheit Impressum durch Lichtbrechung in die Helligkeit – von Krieg zu Frieden, von Leid zu Erlösung. Geprägt von den welthistorischen Ereig­nis­ sen – Napoleon steht vor den Toren Wiens – beginnt Beethovens Konzert mit einem ersten sehr mäch­ tigen Satz, der den Krieg widerhallen lässt, und endet im dritten Satz in einem elegant tänzeri­ schen Finale um das große Thema Freiheit.<< (Andreas Achmann, 2015) DER KÜNSTLER Andreas Achmann, gebo­ ren 1969 in München, aus­ gebildeter Fotograf, wid­ met sich der >>Still-life pho­ tography<< und ist künstlerisch sowie im Auftrag von internatio­na­ len Magazinen und Werbe­ kunden tätig. Seine Werke sind von seinem Interesse an abstrakter und kon­ zeptueller Fotografie ge­ prägt. Zudem setzen sie sich mit dem Thema von >>den Ursprüngen und der Entwicklung von Kultur<< auseinander. www.andreas-achmann.com In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit VALERY GERGIEVS Freunde und Förderer DAS FESTIVAL DER MÜNCHNER PHILHARMONIKER — GASTEIG Freitag 13_11_2015 ERÖFFNUNGSKONZERT VALERY GERGIEV Samstag 14_11_2015 12 STUNDEN MUSIK EINTRITT FREI Sonntag 15_11_2015 PROKOFJEW–MARATHON VALERY GERGIEV MPHIL.DE 3 M FÜ U TA R SI GE AL K LE ’15 ’16