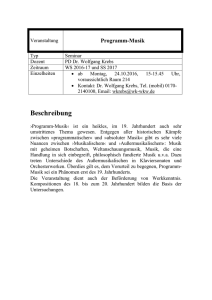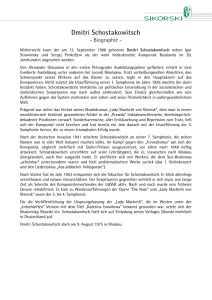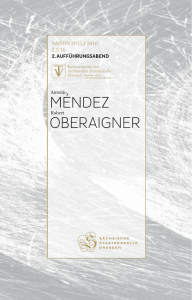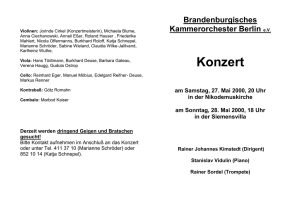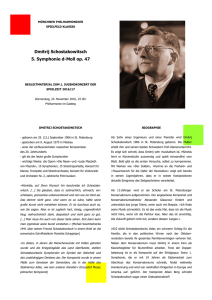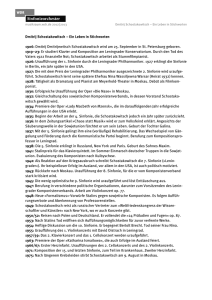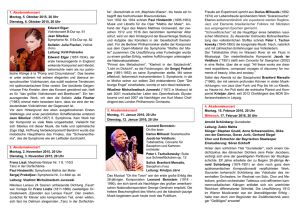beethoven schostakowitsch
Werbung

BEETHOVEN 1. Klavierkonzert SCHOSTAKOWITSCH 10. Symphonie AFKHAM, Dirigent LUPU, Klavier Mittwoch 26_10_2016 20 Uhr Donnerstag 27_10_2016 20 Uhr Freitag 28_10_2016 20 Uhr In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit VALERY GERGIEVS DAS FESTIVAL DER MÜNCHNER PHILHARMONIKER — GASTEIG Freitag 11_11_2016 ERÖFFNUNGSKONZERT Samstag 12_11_2016 PROKOFJEW–MARATHON PETER UND DER WOLF TANZPROJEKTE Sonntag 13_11_2016 PROKOFJEW SYMPHONIEN MOZART VIOLINKONZERTE INFOS UND KARTEN BEI MÜNCHEN TICKET & MPHIL.DE 3 M FÜ U TA R SI GE AL K LE LUDWIG VAN BEETHOVEN Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15 1. Allegro con brio 2. Largo (alla breve) 3. Rondo: Allegro scherzando DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH Symphonie Nr. 10 e-Moll op. 93 1. Moderato 2. Allegro 3. Allegretto – Più mosso 4. Andante – Allegro – L’istesso tempo DAVID AFKHAM, Dirigent RADU LUPU, Klavier 119. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 Ungeahnte »Schwierigkeiten und Effecte« PETER JOST LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15 1. Allegro con brio 2. Largo (alla breve) 3. Rondo: Allegro scherzando LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geburtsdatum unbekannt: geboren am 15. oder 16. Dezember 1770 in Bonn, dort Eintragung ins Taufregister am 17. Dezember 1770; gestorben am 26. März 1827 in Wien. ENTSTEHUNG Erstfassung: Skizzen ab 1793, Partitur abgeschlossen im März 1795 in Wien, Endfassung: Abschluss nach mehreren Überarbeitungen im Frühjahr 1800 in Wien, danach nochmals Revision des Soloparts April bis Dezember 1800. Kadenzen: Skizzen für die eigenen Improvisationen ca. 1796-98; ausgearbeitete Niederschriften vermutlich für Beethovens Schüler Erzherzog Rudolph von Österreich 1808/09. ERSTDRUCK UND ZÄHLUNG »Grand Concert pour le Forte-Piano, Œuvre 15«, Originalausgabe in Stimmen: Verlag T. Mollo & Co, Wien, März 1801. Wurde nachträglich als Nr. 1 gezählt, da das früher begonnene 2. Konzert B-Dur op. 19 durch zahlreiche Umarbeiten erst nach op. 15 im Dezember 1801 gedruckt wurde. Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert 3 Joseph Willibrord Mähler: Ludwig van Beethoven als »Orpheus« in arkadischer Landschaft (1804) Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert 4 WIDMUNG »A son Altesse Madame la Princesse Odescalchi née Comtesse Keglevics«. Anna Luise Barbara Fürstin Odescalchi (1778– 1813), geb. Gräfin von Keglevics de Buzin, war eine Klavierschülerin Beethovens, der zuvor schon die Klaviersonate Es-Dur op. 7 (1797) sowie die Klaviervariationen über »La stessa, la stessima« WoO 73 (1799) gewidmet wurden. URAUFFÜHRUNGEN Erstfassung: Am 29. März 1795 in Wien im Rahmen einer Akademie der Tonkünstler­Societät im (alten) Hofburgtheater (Solist: Ludwig van Beethoven). Endfassung: Am 2. April 1800 in Wien im Rahmen eines von Beethoven gegebenen Benefizkonzerts, das wiederum im (alten) Hofburgtheater stattfand (Solist: Ludwig van Beethoven). sender und komponierender Virtuose erhoffte, dürfte diesen ermuntert haben, sich zügig ein eigenes Solistenrepertoire aufzubauen. Nach dem ersten Versuch eines Konzertes in Es-Dur WoO 4 von 1784, von dem nur eine Abschrift des Soloparts erhalten ist, spielte für die kommenden Werke die Auseinandersetzung mit Mozart eine maßgebliche Rolle. Dabei ist das als Nr. 1 bekannte, weil früher im Druck als op. 15 erschienene Werk in C-Dur entstehungs­ geschichtlich das jüngere; ihm voran ging das Konzert Nr. 2 in B-Dur op. 19, dessen Anfänge (ca. 1786/87) weit in die Bonner Zeit zurückreichen. Während das B-Dur-­ Konzert, von dem Beethoven im Zeitraum von 1786/87 bis 1801 insgesamt vier Versionen niederschrieb, im Zeichen der Nachahmung des großen Vorbilds steht, setzt mit dem C-Dur-Konzert, zumindest mit der bekannten Endfassung, eine bewusste Abwendung von Mozart im Sinne einer individuellen Weiterentwicklung der Gattung ein. »GRAND CONCERT« »EIN ZWEITER WOLFGANG AMADEUS MOZART« Auch wenn er in Bonn hofmusikalische Dienste als Organist und Bratscher aus­ übte, stand für Beethoven doch von Anfang an das »Clavier« (Cembalo wie Fortepiano) im Mittelpunkt. Sein Musik- und Kompositionslehrer Christian Gottlob Neefe ließ schon 1783 öffentlich verkünden, sein Schüler spiele »sehr fertig und mit Kraft das Clavier« und »würde gewiß ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart, wenn er so fortschritte, wie er angefangen«. Neefe, der für seinen Zögling eine Karriere als rei- Erschien das früher entstandene B-Dur-­ Konzert schlicht als »Concert« im Druck, bezeichnete Beethoven das C-Dur-Werk selbstbewusst als »Grand Concert«. In dieser Benennung spiegelt sich äußerlich die vergrößerte Orchesterbesetzung (mit Klarinetten, Trompeten und Pauken) und die Ausdehnung mit einer Spieldauer von ca. 35 Minuten, innerlich jedoch das Selbst­ bewusstsein einer neu erreichten Unabhängigkeit. Während sich in op. 19 noch in vielen Details konkrete Mozart’sche Vorbilder namhaft machen lassen, trifft dies für op. 15 kaum noch zu. Mit »Grand Concert« spielte Beethoven nicht zuletzt jedoch auf einen Solopart an, der Virtuosität mit Brillanz verbindet, wobei das Orchester aus seiner früheren Rolle als bloßer Begleit­ Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert 5 Isidor Neugass: Ludwig van Beethoven (1805) Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert 6 apparat deutlich heraustritt und insofern zumindest stellenweise bereits auf das symphonische Konzertieren vorausweist, das im vollen Wortsinne erst ab dem 3. Konzert (c-Moll op. 37, 1799–1804) erreicht wurde. VIRTUOSE SPIELTECHNIKEN Die ersten beiden Klavierkonzerte haben trotz aller stilistischer und konzeptioneller Unterschiede die Gemeinsamkeit, dass Beethoven sie in erster Linie für sich selbst zur Präsentation in adligen Salons oder öffentlichen Konzerten schrieb. Zwischen 1795 und 1800 führte er op. 15 mindestens sieben Mal auf, nicht nur in Wien, sondern auch in Prag, Berlin, Preßburg und Budapest. Dabei ging es ihm nicht nur darum, sich als Komponist einen Namen zu machen, sondern sich auch als glänzender Pianist zu zeigen. Auf den ersten Blick dominieren im C-Dur-Konzert Spielfiguren, die schon zuvor durch Mozart etabliert wurden und daher um 1790 bereits zum festen Bestand der Wiener Klassik gehörten: gebrochene Dreiklänge, Skalenläufe und Albertibässe (ständig wiederholte gleichartige Akkordbrechungen). Beethoven weitete sie jedoch in zweifacher Hinsicht aus, sowohl räumlich, indem er den gesamten damaligen Tonumfang des Ins­ truments ausnutzte, als auch zeitlich, indem er durch die Ausdehnung und Intensität solcher Spielfiguren quasi symphonische Klangräume entstehen ließ. Auf den zweiten Blick lassen sich in den Figuren vielfältige klanglich-technische Innovationen erkennen: Unisono der Hände im Oktav­ abstand, chromatische Terzenläufe, schneller Wechsel zwischen normalen Achteln, Achteltriolen und Sechzehnteln, Gegeneinander von unterschiedlichen Rhythmen, synkopische Sforzati, Übergreifen der Hände in raschem Tempo, beidhändige Triller usw. Viele dieser Spieltechniken sind unmittelbar aus Beethovens legendären Improvisationen am Klavier entstanden. Beethovens Schüler Carl Czerny, der selbst rasch zum gefragten Pädagogen aufstieg, äußerte rückblickend über das (oft improvisierende) Spiel seines Lehrers: »Er bringt auf dem Clavier Schwierigkeiten und Effecte, von denen wir uns nie etwas haben träumen lassen« – ein Bonmot, das fraglos in besonderer Weise auf Opus 15 zutrifft. FORMALE ÜBERRASCHUNGEN Die Großform folgt dem klassischen Modell schnell-langsam-schnell: Zwei brillante Allegro-Sätze umrahmen einen gesang­ lichen Largo-Satz. Die Charaktere sind deutlich ausgeprägt: Dem heroisch auftrumpfenden Kopfsatz mit drei (statt wie üblich zwei) Themen folgt ein lyrischer Mittelsatz mit zwei unmittelbar nacheinander exponierten Themen, die figuriert wiederkehren. Darauf schließt sich ein scherzoartiges Rondo mit Refrain (A) und zwei Couplets (B, C) in der Form A-B-A-CA-B-A-Coda an. Aber bereits die Tonartenfolge verweist auf markante Eigenheiten. Das Largo steht in As-Dur, einer nur noch entfernt, nämlich terzverwandten Tonart zur Tonika C-Dur der Rahmensätze. Ähnliche Überraschungen bietet der erste Satz insofern, als nach dem Vortrag des Hauptsatzes durch das Orchester das zweite Thema nicht – wie zu erwarten – in der Dominante G-Dur, sondern in Es-Dur erklingt. Dieser Kunstgriff zeigt am deutlichsten, dass unerwartete Modulationen und Rückungen ein charakteristisches Mittel für den Komponisten sind, denn sie begegnen auch im Rondo, wo die Couplets zwar in nahe verwandten Tonarten (G-Dur und a-Moll) notiert sind, die Hin- und Rück- Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert 7 Blasius Höfel [nach einer Zeichnung von Louis Letronne]: Ludwig van Beethoven (1814) Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert MPH_01011_PH-Thielemann5_RZ.indd 19 25.02.11 17:19 8 führungen des Refrains sich jedoch weit von C-Dur weg bewegen. Nicht von ungefähr war in einer Besprechung einer Aufführung von 1804 von einem »Fortepianokonzert« die Rede, das »mit chromatischen Gängen und enharmonischen Verwechslungen bis zur Bizarrerie ausgestattet« sei. wurde dieses Grundprinzip in der Musiktheorie mit Bezeichnungen wie »entwickelnde Variation« oder »kontrastive Ableitung« umschrieben. ORGANISCHE ENTWICKLUNG DER THEMEN So lässt sich das zweite Thema im Eingangs-­ Allegro in den Kernmotiven von Skalenlauf und Doppelschlag (die Umspielung eines Zentraltons) als Umkehrung des ersten interpretieren. Selbst das dritte Thema kann seine Herkunft aus dem Hauptthema kaum verleugnen, denn eingebettet in klangvolle Akkorde von Oboen und Hörnern ist rhythmisch der Zentralimpuls genauso vertreten wie melodisch erneut auf die Doppelschlagstruktur zurückgegriffen wird. Bei genauerem Hinsehen lassen sich die erwähnten Kernmotive auch im zweiten Thema des Largo (rhythmisches Grundmuster langkurz-kurz-lang) sowie in den Couplets des Rondos (Doppelschlagsmelodik) ausmachen. Hier erreicht das Prinzip der kon­ trastiven Ableitung einen Höhepunkt, denn die innere Verbindung durch den gemeinsamen melodischen Kern führt äußerlich zu extremen Gegensätzen. Das erste Couplet gibt sich lyrisch-kantabel, das zweite dagegen tänzerisch-erregt. Offensichtlich soll die Verbindung dem Hörer nicht unmittelbar auffallen, sondern gleichsam unbewusst wirken – ein in der Folge weiter erprobter und verfeinerter Kunstgriff, um den Eindruck großer Geschlossenheit ohne Verlust an Mannigfaltigkeit und Varietät zu erreichen. Die erwähnte Abkehr von Mozart äußert sich am eindrucksvollsten in der Gestaltung und Verknüpfung der Themen. Der Kopfsatz beginnt mit einem Thema, das wie eine Fanfare anmutet. Seine Prägnanz zeigt sich nicht im Melodischen, sondern im Rhythmischen. Dessen elementare Folge lang-kurzkurz-lang wird zum tragenden Impuls nicht nur dieses Satzes, sondern der ganzen Komposition. Er ist prägend für das Hauptthema des langsamen Satzes (in der Begleitung der linken Hand des Solisten sowie der Streicher) – und bildet, nun auf kleinere Notenwerte verkürzt, auch die Basis für den markanten Refrain, mit dem der Solist das Rondo eröffnet. Während Mozart in seinen großen zwölf Klavierkonzerten (1784– 86) den Dualismus der Themen durch genau abgegrenzte, voneinander unabhängige Gedanken betont, geht es Beethoven um die organische Entwicklung von Themen und Motiven. Wie in den parallel entstehenden anderen Kompositionen in Sonatenform von den frühen Klaviersonaten bis hin zur 1. Symphonie, experimentierte Beet­ hoven in op. 15 mit einem Konzept, das später sozusagen zu seinem Markenzeichen wurde: Die Themen lassen sich als Varianten eines Grundmodells begreifen, werden demnach voneinander abgeleitet, wirken aber selbstständig, ja sogar als Kontraste, da sie jeweils markanten Veränderungen unterworfen werden. Später GESCHLOSSENHEIT BEI GRÖSSTER VARIETÄT Ludwig van Beethoven: 1. Klavierkonzert 9 »Lichte Trauer und innere Freiheit« SIGRID NEEF DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH (1906–1975) Symphonie Nr. 10 e-Moll op. 93 1. Moderato 2. Allegro 3. Allegretto – Più mosso 4. Andante – Allegro – L’istesso tempo LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 12. (25.) September 1906 in St. Petersburg; gestorben am 9. August 1975 in Moskau. ENTSTEHUNG Schostakowitsch begann die Arbeit an seiner lange geplanten 10. Symphonie im Juni 1953; die Partiturreinschrift des 1. Satzes beendete er am 5. August, die des 4. Satzes am 25. Oktober 1953. Nach Schostakowitschs Statement, das einer offiziellen Anhörung und Diskussion der neuen Symphonie durch den Sowjetischen Komponistenverband Ende März 1954 vorausging, enthalte der 1. Satz »weniger heroisch-­ dramatische oder tragische als vielmehr lyrisch-besinnliche Episoden« und verfolge damit andere Ziele als »die ersten Sätze einer Beethoven-, Tschaikowskij- oder Borodin-Symphonie«. In Bezug auf das Werk als Ganzes verlautbarte der Komponist in dem für ihn typischen Orakelton, dass es ihm speziell »in dieser Symphonie um die Darstellung menschlicher Gefühle und Leidenschaften« gegangen sei... URAUFFÜHRUNG Am 17. Dezember 1953 in Leningrad im Großen Saal der Leningrader Philharmonie (Leningrader Philharmoniker unter Leitung von Jewgenij Mrawinskij). Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 10 ENDLICH WIEDER EINE SYMPHONIE ! ERINNERUNGEN KÖNNEN FURIEN GLEICHEN Die 10. Symphonie Schostakowitschs entstand im Sommer 1953, wenige Monate nach Stalins Tod am 5. März. Zwar war der politische Spuk noch nicht vorüber, doch die Gefahren für Leib und Leben nicht mehr gar so drohend und allgegenwärtig. Wie es weitergehen und vor allem, ob es besser werden würde, wusste niemand. Eine Stunde Null also: ohne die alte Furcht, doch voll neuer Ängste. In der 10. Symphonie wird nach Schostakowitschs eigenem Zeugnis die Stalin-Ära beschworen und zwar im Sinne eines Befreiungsversuches von seelischen Verkrampfungen und Deformationen. Denn der Diktator hatte seine Untertanen geistig »vergiftet« – in Form lastender Hassgefühle. Wie Furien verfolgten quälende Erinnerungen die Davongekommenen. Dergestalt hatte Schostakowitsch – wie viele seiner Landsleute – psychische Probleme zu bewältigen. Die Suche nach einem symphonischen Konzept, das dieser Situation musikalischen Ausdruck geben konnte, wurde so zum schwierigen Prozess. In dieser Situation war Schostakowitsch sofort zur Komposition einer neuen Symphonie entschlossen, nachdem er auf die staatsoffiziellen Verurteilungen seiner 8. und 9. Symphonie von 1948 mit 8-jährigem Schweigen in diesem Genre geantwortet hatte. Trotzdem schritt die Arbeit nur langsam voran. Das war verwunderlich, gemessen an dem inneren Schaffensdruck und den äußerlich idealen Bedingungen. Den Sommer 1953 verbrachte der Komponist ungestört auf der Datscha seines Schwiegervaters. »Ich versuche, eine Symphonie zu schreiben. Aber obgleich mich niemand bei der Arbeit stört, geht sie nur mäßig voran (...). Bis jetzt ziehe ich mit Mühe und Not den 1. Satz hin, und wie es weitergehen soll, weiß ich nicht...«, gestand Schostakowitsch einem seiner Vertrauten Ende Juni. Die Ursachen für diese Mühsal waren in dem Vorhaben begründet, bei Wegfall der alten Furcht (vor Stalin), neue Ängste (vor dem kommenden Unbekannten) zu bestehen, um einen dringend benötigten »Selbstheilungsprozess« einzuleiten. Denn nicht die äußeren Verwüstungen, das tollhäuslerische Treiben des russischen Macbeth, sollten im Vordergrund dieser Symphonie stehen, sondern die von den Opfern erlittenen inneren Verwüstungen sowie die dramatischen Versuche einer seelischen Wiedergeburt. Einem der großen Dichter jener Jahre, Boris Pasternak, zufolge war die innere Freiheit der »einzig historische Gehalt der Nachkriegszeit«. Das Ringen um diese »innere Freiheit« wurde zum geistigen Programm der 10. Symphonie. 1. SATZ: »LICHTE TRAUER« Nicht zufällig besuchte Schostakowitsch im Vorfeld der Komposition das Tschaikowskij-­ Museum in Klin und studierte dort das handschriftliche Autograph der 6. Symphonie, die als musikalische Inkarnation einer Suche nach seelischer Klarheit bei dramatischer Einsicht in alle Schatten und Dunkelheiten des eigenen Ich gilt. Schos­ Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 11 Dmitrij Schostakowitsch in seinem Arbeitszimmer (um 1950) Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 12 takowitsch dürfte sich die Frage gestellt haben, wie der russische Klassiker mit dem musikalischen »Motto«-Thema bei der Komposition umgegangen war. Galt es Tschaikowskij nur als Symbol der den Menschen bestimmenden Kräfte, als ein von außen auferlegtes Schicksal, oder aber auch als Signet für eine selbst veranlasste geistig-­ seelische Disposition ? Schostakowitsch jedenfalls lässt in seiner 10. Symphonie das musikalische »Motto« als eine Klangchiffre sowohl für auferlegtes Schicksal als auch für innere Disposi­ tion erscheinen, als Zeichen also für eine geschichtliche Situation, in der alles im Werden ist und dem Subjekt Einhalten und Eingedenken Not tut. So beginnt der 1. Satz mit dem Motto-Thema quasi am Boden der »Hölle«, am Tiefpunkt eines Teufelskreises von Unterdrückung, Verblendung und Entfremdung: ganz leise hebt es in den tiefen Streichern, in gleichmäßig sanften Vierteln und in kleinen Tonschritten an, in der Art eines offenen Fragens, eines Hineinhörens und Hineingehens in die Welt. Man hat diesem geheimnisvollen und dabei einprägsamen Motto in der musikwissenschaftlichen Literatur ein Etikett geben wollen und glaubte, es durch eine Ähnlichkeit zum Hauptthema von Franz Liszts »Faust«-Symphonie gefunden zu haben. Doch der Faust-Typus gehörte nicht zu Schostakowitschs Gedankenkreis, eher die Bilderwelt Johann Sebastian Bachs, der für diese Symphonie, neben Tschaikowskij und Gustav Mahler, eine gestaltgebende Rolle spielen sollte. »Ich hatte viel Bekümmernis« heißt es, diesen 1. Satz trefflich charakterisierend, in einer Kantate des Leipziger Thomaskantors. Was geschieht in diesem Satz ? Eine Klageweise der Klarinette (2. Thema) und ein unendlich trauriger, zerborstener Walzer der Flöte (3. Thema) führen durch das Tal der Tränen. Tragische Erinnerungen harren dabei wie Räuber am Straßenrand, überwältigen den Wanderer und treiben ihn zu Verzweiflungsausbrüchen. Die anfängliche Offenheit und Klarheit geht in tosendem Lärm unter, bis kein Fragen und Klagen mehr möglich ist. Doch mit der musikalischen Reprise gewinnt der Anfangsimpuls wieder Gestalt: es kommt zu einer buchstäblichen und anrührenden Wiederkehr der anfänglichen Klarheit, und mit der neuerlichen Klageweise der Klarinette wird Fragen wieder möglich. Das Motto-Thema führt gemeinsam mit der kleinen, traurig tanzenden Flötenmelodie hinüber in den Bereich »lichter Trauer« – in einen der berühmten »morendo«-Schlüsse Schostakowitschs. 2. SATZ: NUR EIN STALIN-PORTRÄT ? Mit dem 2. Satz habe er »ein musikalisches Porträt von Stalin« geben wollen, bekannte Schostakowitsch später: »Natürlich enthält der Satz auch noch sehr viel anderes. Doch er basiert auf diesem Porträt. (...) Ich muss schon sagen, es war eine schwere Arbeit, den ›Wohltäter der Menschheit‹ symphonisch darzustellen, ihn mit musikalischen Mitteln zu bewerten. (...) Trotzdem erfüllte ich Stalin gegenüber meine Pflicht. Der Schuh passte, wie man so sagt. Und niemand kann mir vorwerfen, dieses schändliche Phänomen unserer Wirklichkeit übergangen zu haben.« Der Begriff »Porträt« mutet allerdings fast zu gemütvoll für dieses Scherzo an, denn es handelt sich um einen musikalischen Bannfluch. Vorherrschend sind stampfende Rhythmen, grelle Breaks und brüllende Orchestertutti. Auf dem Höhepunkt ertönen, Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 13 Unter Aufsicht Stalins und einer ins Abseits gerückten Voltaire-Büste: Schostakowitsch spielt für Offiziere der »Roten Armee« (um 1945) Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 14 immer im flotten und eben dadurch furchtbarem Cancan-Rhythmus, die Salven eines »Erschießungs-Pelotons«. Zugleich stellt der 2. Satz eine Anspielung auf den allseits beliebten Scherzo-Typus orientalisch­ folkloristischen Stils dar. Kaukasische Folklore diente in der russischen Musik seit jeher zur Darstellung faszinierender ungezähmter Vitalität. Der ironische Subtext in Schostakowitschs 10. Symphonie: Stalin gab sich als Kaukasier. Darüber hinaus hat Schostakowitsch sein Scherzo mit einem »musikalischen Kommentar« über das Verhältnis von Volk und Macht versehen. So ist das Hauptthema dieses Satzes aus einem Thema aus Modest Mussorgskijs Oper »Boris Godunow« gebildet, aus einer Szene, in der ein Fronvogt das Volk mit Knute und falschen Versprechungen – mit Zuckerbrot und Peitsche also – dazu bringt, einem neuen Tyrannen zu huldigen. Das Volk redet alsbald den Herrschenden nach dem Munde, und die Herrschenden maßen sich an, im Namen des entmündigten Volkes zu sprechen und zu handeln. Es kommt zu Lüge wie moralischer Verkommenheit auf beiden Seiten, Brüllen, Toben, Stampfen und Schreien einerseits sowie plärrende Litaneien und melodisches Grimassieren andrerseits. So sind Täter und Opfer in diesem genialen Scherzo quasi ineinander verschlungen. 3. SATZ: VON DEN TOTEN AUFERSTEHEN Grundlage für den 3. Satz, Sinn und Gestalt gebend vor allem, ist ein Viertonmotiv, D-Es-C-H ( = Dmitrij Schostakowitsch), aus den Initialen des Komponistennamens gebildet: dies allerdings nur dann, wenn man, dem historischen Vorbild B-A-C-H folgend, den russischen Namen deutsch schreibt. Dieses D-S-C-H erscheint, unablässig insistierend, auf dem Höhepunkt des musikalischen Geschehens und gibt rückwirkend eine Antwort auf die Frage, wem im Scherzo die Salven des Erschießungs-Pelotons galten. Deutlich schreit es der Komponist nun hier heraus: Ich, ich, ich war hier gemeint. Aber ist diese Ich-Betonung nicht unbescheiden, vor allem angesichts der vielen namenlosen, tatsächlich erschossenen Landsleute ? Keineswegs, denn Schostakowitsch steht auch hier in der Tradition Johann Sebastian Bachs. Dieser machte seine Initialen zum Symbol des durch Schöpferkraft geadelten Menschen und stellte sein B-A-C-H trotzig gegen alle durch Geburt oder Reichtum erworbene Macht. Eine ähnliche Bedeutung kommt auch dem D-S-C-H zu. Schostakowitschs Ich-Behauptung ist nicht Ich-Bespiegelung, sondern Gegenwehr. Wie heißt es doch in totalitären Systemen ? Das Kollektiv ist alles, der Einzelne nichts. Zielscheibe jeder Macht ist das dem Menschen eigentümliche Ich, es soll ausgelöscht, vernichtet werden. Aber es ist nicht auszulöschen, behauptet Schos­ takowitsch. Und so lässt er sein D-S-C-H wie von den Toten auferstehen. In Wahrheit ist dieser »Allegretto«-Satz ein verkapptes Largo, denn der Largo-­ Charakter dominiert in Gehalt wie Länge. Mit dem Largo setzen Erinnerungsschübe – Motive aus dem Scherzo – ein, das D-SC-H klettert in schreiende Höhen. Wenn mit Hornweise wie Motto-Thema schließlich Frieden einkehrt, darf neben dem D-S-C-H auch der Schelm, das C-D-S-H-Motiv, mittanzen. Verfolgt man die Spuren des Monogramms, stellt sich die Frage, was die »entstellten« Formen des D-S-C-H bedeu- Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 15 Dmitrij Schostakowitsch auf Wahrheitssuche in der »Prawda« (um 1960) Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 16 ten. Als D-C-H-S tauchte es bereits im 1. Satz auf und leitete dort die dramatische musikalische Entwicklung ein. Es scheint sich um Maskierungen zu handeln, mehr noch um Emanationen des Ich, das sich so als keine festgefügte, sondern eine veränderliche Größe erweist. 4. SATZ: »DURCH TRAURIGKEIT WÄCHST UNSER LEID« Folgt auf die Auferstehung des Ich der Jubel über das »ewige Leben« ? Wohl kaum. Eher – wie bei Gustav Mahler – ein »Trinklied vom Jammer der Erde«... Die Andante­Einleitung des 4. Satzes spricht vom notwendigen Eingedenken. Doch dann – endlich – scheint sich Jubel anzukündigen, ein Allegro im frisch-heiteren Stil, eine Art Kehraus. Aber alsbald machen sich Motive des Scherzos breit, ist die neue Freiheit von alter Gewalt bedroht. Allein das D-SC-H stellt sich dagegen. Doch: Der Kampf gegen das Böse verzerrt die Züge. Das Mono­gramm wird laut und schrill. Es taucht im Finale in einem brüllenden Unisono noch einmal auf, ehe die Trauermusik der Reprise einsetzt; davor aber erklingt die Peloton-­ Musik des Scherzos. Das sind deutliche Zeichen, nicht eines ewigen Lebens, sondern eines ewigen Kreislaufs. Warum diese teilweise konvulsisch-wüste und angestrengte Lustigkeit des 4. Satzes ? Wenn es auch paradox klingt: Stalins Tod löste nicht vornehmlich Freude aus, sondern vor allem Beklemmung und unüberwindlich scheinende Trauer angesichts der vielen Toten. Es gab Grund zum Aufatmen, aber keinen Grund zum Jubeln. Zu starke Trauer kann lähmen. Die Überlebenden geraten in Gefahr, im Nachhinein dem Tyrannen ebenfalls zum Opfer zu fallen, der qua- si noch aus dem Grab heraus nach ihnen greift. Entspannte Heiterkeit ist in einer solchen Situation nicht möglich und konnte daher von Schostakowitsch nicht komponiert werden. An deren Stelle trat eine Art grimmigen Trotzes, um lähmende Traurigkeit abzuwehren. Denn wir »machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit«, wusste schon Johann Sebastian Bach in seiner bereits erwähnten »Bekümmernis«-Kantate. HEIKLE URAUFFÜHRUNG Die am 25. Oktober 1953 in seiner Moskauer Wohnung beendete Partitur übertrug Schostakowitsch sofort und in größter Eile in eine vierhändige Klavierfassung. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Komponisten Moissej Wainberg, stellte er seine Symphonie alsbald dem Chefdirigenten der Leningrader Philharmoniker, Jewgenij Mrawinskij vor. Die Situation war heikel. Mit der 10. Symphonie sollte der Öffentlichkeit erstmals nach Stalins Tod ein sowjetrussisches Musikwerk vorgestellt werden, das bewusst gegen die 1948 formulierten und weiterhin gültigen Parteibeschlüsse verstieß, nach denen u. a. jedes Musikwerk »per aspera ad astra« (durch Nacht zum Licht) zu verlaufen habe. Weil sie dieser Prämisse nicht genügten, schlummerten Schos­ ta­kowitschs 1. Violinkonzert (1947/­4 8), der Vokalzyklus »Aus jüdischer Volkspoesie« (1948) sowie die Streichquartette Nr. 4 und 5 (1949/52) noch immer in der Schublade, waren weder aufgeführt noch gedruckt. Wie würden nun Publikum, Presse und Kulturbürokratie auf diesen ersten Vorstoß reagieren ? Man musste zwar nicht mehr um sein Leben, zumindest aber um seinen Posten fürchten. Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 17 Mit Mrawinskij war Schostakowitsch seit 1937 menschlich wie geistig eng verbunden, als der 1936 bei Stalin in Ungnade gefallene und um sein Leben bangende Komponist die Chance zur »Rehabilitation« erhalten und der damals noch unbekannte junge Dirigent mutig die Uraufführung der 5. Symphonie übernommen hatte. Die Leningrader Philharmoniker avancierten in der Folgezeit zum Schostakowitsch­­ Orchester par excellence; sie brachten acht der insgesamt fünfzehn Symphonien zur Uraufführung, und Schostakowitsch widmete seine 8. Symphonie dem Freund Mrawinskij. Der ging im Falle der 10. Symphonie sehr umsichtig vor und wählte als Uraufführungstermin eine sogenannte staatsoffizielle »Dekade sowjetischer Kultur«, so dass die Uraufführung am 17. Dezember 1953 von genügend Aufführungen systemtreuer Werke flankiert werden konnte. Das Werk wurde sofort bei Publikum wie Interpreten ein künstlerischer Erfolg. Jedoch die Kulturfunktionäre, die Neider und »ewig Gestrigen«, hielten ihre Argusaugen nicht geschlossen; der Parteiapparat funktionierte auch nach Stalins Tod. Auf einer eigens anberaumten Sitzung des Sowjetischen Komponistenverbands im März/April 1954, die sich über drei Tage hinzog, sollte Schostakowitsch erneut als »Volksfeind« angeprangert werden. Aber alle Mühe war vergebens; was zu Stalins Lebzeiten noch undenkbar war: die Moskauer Zeitschrift »Sowjetskaja Musyka« publizierte den gesamten Diskussionsverlauf, d. h. gegen Schostakowitsch konnte man nicht mehr mit repressiven Mitteln vorgehen. Auf das Schicksal der 10. Symphonie, auf ihre Beliebtheit bei Publikum wie Interpreten, hatte diese Diskussion keinen Einfluss. GEGEN DEN GANG DER GESCHICHTE Dem Komponisten war anderes wichtig. Die Politik der russischen Machthaber verfolgte seit 1917 das Ziel, den Typus des russischen Bürgers und selbständig denkenden Intellektuellen zu liquidieren, dafür den sogenannten »neuen Menschen« zu schaffen: ein innerlich unfreies Wesen, einen geistigen Sklaven. Schostakowitsch bekannte sich in der 10. Symphonie dazu, ein Bürger alten Formats bleiben zu wollen. Mit den von ihm verehrten klassischen Schriftstellern war Schostakowitsch der Meinung, dass der Gang der Geschichte einem gleichsam naturwüchsigen Prozess gleiche, wobei gesellschaftliche Entwicklungen unübersehbaren Faktoren unterlägen und sich daher langfristiger menschlicher Einflussnahme entzögen. Die »Führer der Revolution« hingegen liebten nichts so sehr wie die Fiktion ihrer Macht und deren Einflussnahme auf den »Gang der Geschichte«. Entsprechend gibt das geniale Scherzo der 10. Symphonie den Harlekinaden dürftiger Macht-Fiktionen musikalischen Ausdruck. Wie Charlie Chaplin im »Großen Diktator« ein über Hitler hinausweisendes Porträt eines wahnbesessenen »Führers« gelang, so Schostakowitsch in der 10. Symphonie ein über Stalin hinausweisendes Porträt eines selbsternannten »Wohltäters der Menschheit«. Vor allem aber schildert die 10. Symphonie auf exemplarische Weise ein Ringen um »innere Freiheit«. Wellen von Trauer, Angst und Hass branden auf, nachdenkliche Episoden halten dagegen; Furien-gleiche Erinnerungen recken sich empor, weichen immer wieder Momenten einer »lichten Trauer«. Dmitrij Schostakowitsch: 10. Symphonie 18 David Afkham DIRIGENT Der 1983 in Freiburg / Breisgau geborene Dirigent errang 2002 beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« einen ersten Preis in der Kategorie Klavier solo, wurde mit 15 Jahren Jungstudent in den Fächern Klavier, Musiktheorie und Dirigieren an der Musikhochschule seiner Heimatstadt und beendete später sein Dirigierstudium an der Hochschule für Musik »Franz Liszt« in Weimar. Als erster Stipendiat des Bernard Haitink Fund for Young Talents assistierte David Afkham Bernard Haitink bei Einstudierungen u.a. mit dem Concertgebouw­ orkest Amsterdam. Inzwischen ist David Afkham Chefdirigent des Spanischen Nationalorchesters Madrid und stand bereits am Pult des Philharmonia Orchestra London, der Wiener Symphoniker, der Filarmonica della Scala Milano, des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, der Staatskapelle Dresden, des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, des NHK Symphony Orchestra Tokyo und der Münchner Philharmoniker. Auftritte mit dem Cleveland Orchestra, dem Orchestre National de France, den Göteborger Symphonikern, dem Mozarteum-Orchester Salzburg, dem Residentie Orkest Den Haag, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Orchestre de Chambre de Lausanne schlossen sich an. David Afkham war Gewinner des Londoner Donatella-Flick-Wettbewerbs 2008 und erster Preisträger des neugegründeten Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award, den er im August 2010 erhielt. Operndirigate führten ihn inzwischen zum britischen Glyndebourne Festival, ans Teatro Real Madrid und an die Oper Frankfurt. Die Künstler 19 Radu Lupu KLAVIER cu- und 1969 beim Leeds-Wettbewerb. Er ist regelmäßiger Gast der wichtigsten internationalen Orchester wie dem Royal Concertgebouw Orchestra, den Londoner Orchestern, den Wiener Philharmonikern und den Berliner Philharmonikern. Mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan debütierte er 1978 bei den Salzburger Festspielen; acht Jahre später eröffnete Lupu die Festspiele mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti. Der 1945 in Rumänien geborene Pianist debütierte bereits als als 12-jähriger mit einem Programm, das u. a. auch eigene Kompositionen enthielt. Er setzte zunächst seine bei Florica Muzicescu und Cella Delavranca in Rumänien begonnenen Studien fort, bis es ihm ein Stipendium ermöglichte, von 1961 an am Moskauer Konservatorium bei Galina Eghyazarova, Heinrich und später Stanislav Neuhaus zu studieren. Radu Lupu gewann die jeweils 1. Preise bei drei bedeutenden Klavierwettbewerben: 1966 beim Van Cliburn-, 1967 beim Enes- Auch in den USA ist Lupu seit seinen ersten Konzerten mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Carlo Maria Giulini und dem Cleveland Orchestra unter Daniel Barenboim im Jahr 1972 ein viel gefragter Solist. Radu Lupu gastiert bei sämtlichen großen Musikfestivals; regelmäßig ist er etwa beim Lucerne Festival und bei den Salzburger Festspielen anzutreffen. Mehr als zehnmal reiste Radu Lupu auf Tournee nach Japan und konzertiert dabei auch in Seoul/ Südkorea. Von der italienischen Kritikervereinigung wurde ihm 1989 und 2006 der »Abbiati«-Preis verliehen; 2006 erhielt er darüber hinaus den »Premio Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli«. Die Künstler 20 »In der Musik liegt die Wahrheit« Ein Gedenkblatt für »Celi« GABRIELE E. MEYER Als Sergiu Celibidache, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, am 14. August 1996 in der Nähe von Paris starb, schien die musikalische Welt einen Augenblick inne­zuhalten. Das Gedenkkonzert unter Zubin Mehtas Leitung fand – nur wenige Wochen später – am 9. September statt. Auf dem Programm stand Anton Bruckners unvollendete »Neunte« – also die Symphonie, die in der oberösterreichischen Stiftskirche St. Florian zu dirigieren Celibidache nicht mehr vergönnt war. Selten haben die Philharmoniker mit so viel Anteilnahme, ja Inbrunst gespielt wie an jenem Abend. Am Ende erhoben sich die Zuhörer und warteten tief bewegt, bis der letzte Musiker vom Podium gegangen war. 17 Jahre lang hatte dieser »schwierige, aber ganz außerordentliche Mann« (Albrecht Roeseler) mit »seinem« Orchester gearbeitet. Unerbittlich fing der nur in Ausnahmefällen zu Zugeständnissen neigende Charismatiker dort an zu proben, wo andere aufhören. In harter Arbeit lernte jeder Musiker, ganz bewusst auf den anderen zu hören, seine eigene Stimme zwar wichtig zu nehmen, in gleicher Weise sich aber auch dem Gesamtverlauf einzufügen. Celibidache bestand auf einer klanglichen Ausgeglichenheit, die mühelos von kammermusikalischer Intimität zu orchestraler Fülle wechseln konnte. Und er ließ sich auch entgegen vielfach geäußerter Skepsis nicht von seiner grundsätzlichen Maxime abbringen, dass sich das Tempo nach der Komplexität des kompositorischen Ablaufs zu richten habe. Egal, um welches Werk seines durchaus weit gefächerten Repertoires der deutschen, französischen und russischen Musik es in all den Jahren bei den Münchner Philharmonikern ging: Jedes wurde einer radikalen Prüfung unterzogen und neu erarbeitet. »Musik ist nicht schön«, meinte Celibidache einmal. »Sie ist auch schön, aber die Schönheit ist nur der Köder. Musik ist wahr.« Das Orchester der Stadt ließ sich auf das Abenteuer ein und entwickelte sich in der Folge zu einem der weltweit besten Klangkörper. Celibidaches Vorliebe, insbesondere in seinen letzten Lebensjahren, galt dem gewaltigen symphonischen Kosmos Anton Bruckners. Seit jenem denkwürdigen Konzert vom 15. Oktober 1979 mit Bruckners 8. Symphonie in der Münchner Lukas-Kirche kam es im In- und Ausland immer wieder zu Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 21 Aufführungen, die sich tief in das musikalische Gedächtnis von Musikern und Zuhörern eingegraben haben. Ihnen bleibt die Aura des Ereignisses als Sonderfall. Doch ebenso erinnerungswürdig ist Celibidaches Umgang mit französischen Komponisten. Diesem Repertoireausschnitt sei das heutige Gedenkblatt zum 20. Todestag des Maestros gewidmet. Schon wenige Monate nach Celibidaches Einstand im Februar 1979 waren die Musiker mit der französischen Orchesterkultur vertraut. Auch später faszinierte diese neu erworbene Spielweise, die trotz aller Eleganz und klanglichem Raffinement nie außer Acht ließ, dass Musik eben mehr als nur »schön« ist. Ravels »La Valse«, die wie in einem Zerrspiegel geraffte Zusammen- Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 22 fassung des Wiener Walzers, ausgehend vom Wiener Kongress über Restauration, Biedermeier und Gründerzeit bis hin zur Katastrophe des 1. Weltkriegs, geriet unter Celibidaches Händen zum überwältigenden Publikumserfolg. Im »Boléro« wurden, wie Klaus Weiler zurückblickend ausführte, »Crescendo und Rhythmus unter der strikten Beibehaltung des Metrums zum elementaren Ereignis«. In »Daphnis et Chloé« und der »Rapsodie espagnole«, in der »Alborada del Gracioso« und in »Ma Mère l’Oye« triumphierte der Klangmagier. Auch die für die Ravel’sche Musik typischen metrischen Finessen entfalteten unter den subtil agierenden Händen des »südländischen Hexers« oder »Pulttänzers« – wie der Dirigent in früheren Jahren oft genannt wurde – ihren schier unwiderstehlichen Charme. Bei »Ibéria«, Debussys musikalischer Beschwörung Spaniens hingegen, machte der Maestro geradezu kongenial auf die Divergenz zwischen scheinbar statischer Klangfläche und strengster motivischer Konzentration aufmerksam. Mit dieser Wiedergabe traf der Dirigent genau ins Zentrum der Debussy’schen Konzeption – nämlich auf jegliche Tonmalerei zugunsten motivischer Arbeit zu verzichten. Ähnliche Wunder an Gleichzeitigkeit komplexer Verläufe und Farbentwicklungen waren auch in »La Mer« und dem »Prélude à ›L’Après-Midi d’un Faune‹« zu hören. Chorpartien auf die französische Diktion des lateinischen Textes achtete, verhieß eine ganz neue Sichtweise auf das Werk. Celibidache musizierte die »Berçeuse des Todes« bar jeglichen äußeren Effektes in so zarten Valeurs, als wolle er in der vom Komponisten selbst erweiterten, heute allgemein gebräuchlichen Orchestrierung auf die ursprünglichere, kammermusikalisch besetzte verweisen. Genauestens ausbalanciert waren die »mystische Sanftheit, manchmal Lieblichkeit« gegen die sparsam gesetzten majestätischen Akzente, überstrahlt von dem beinahe überirdisch leuch­ tenden Sopransolo »Pie Jesu«. Beglückt und gerührt bedankte sich der Maestro zunächst bei Margret Price, dann bei allen anderen Mitwirkenden für das für ihn schönste Geburtstagsgeschenk zu seinem bevorstehenden 70. Geburtstag am 11. Juli (28. Juni) 1982. Zwei Tage nach dem Tod des großen Dirigenten resümierte Wolfgang Schreiber in der »Süddeutschen Zeitung«: »Sergiu Celibidache war der gewiss interessanteste Außenseiter des kommerziellen Musiklebens, das er gnadenlos kritisierte – eine Figur wie aus Granit, der die Musik und ihre Würde kompromisslos verteidigte. Ein Glücksfall für München.« Aus heutiger Sicht darf man getrost hinzufügen: Für unzählige Musikbegeisterte in aller Welt. Die ruhige Gelassenheit von Gabriel Faurés »Messe de Requiem«, ja der fast heitere Zauber der Fauré’schen Sichtweise auf die »Letzten Dinge« und den Weg ins Paradies erfreuten sich hierzulande nie besonderer Zuneigung. Aber schon die Sorgfalt, mit der Celibidache während der Proben in den Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 23 Der »Unvergleichliche«, an dem sich alle Nachfolger messen lassen müssen – bis heute... Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 24 Münchner Klangbilder DIE KONZERTPLAKATE DER SPIELZEIT 2016/17 TITELGESTALTUNG ZUM HEUTIGEN KONZERTPROGRAMM »Dmitrij Schostakowitsch verbrachte seine gesamte künstlerische Existenz im Schatten des Diktators Stalin. Die 10. Symphonie ist ein Werk der Nachdenklichkeit und Rückschau der Stalinzeit. Zu sehen sind verflüssigte Formen aus Eis, Schnee und Gestein, welche für die Periode der Auflockerung und größeren Freiheit nach Stalins Tod stehen. Die dominierende Farbe Blau verdeutlicht die kühle und kalte Machtpolitik.« (Alexander Kneifel, 2016) DER KÜNSTLER Alexander Kneifel wurde 1990 in Frankfurt am Main geboren und studiert seit März 2015 Kommunikationsdesign an der Akademie U5 in München. DIE HOCHSCHULE Die Akademie U5 an der Einsteinstraße in München bildet seit mehr als 40 Jahren junge Kreative zu gestandenen Kommunikations-Designern aus. Die älteste deutsche Hochschule für werbliches Gestalten hegt das Motto: »Unsere Studenten sollen Wirklichkeit studieren.« Im Laufe von sechs Semestern erlernt man alles um nach dem Diplom-Abschluss in der Gestaltungsbranche Fuß zu fassen. Alexander Kneifel 25 Freitag 04_11_2016 20 Uhr k4 Samstag 05_11_2016 19 Uhr d Sonntag 06_11_2016 11 Uhr m Freitag 04_11_2016 10 Uhr Öffentliche Generalprobe HECTOR BERLIOZ »Le Corsaire« op. 21 MARC-ANDRÉ DALBAVIE Konzert für Flöte und Orchester ANTONÍN DVOŘÁK Symphonie Nr. 5 F-Dur op. 76 LIONEL BRINGUIER Dirigent HERMAN VAN KOGELENBERG Flöte SERGEJ SEMISHKUR Tenor EVGENY NIKITIN Bariton RENÉ PAPE Bass PHILHARMONISCHER CHOR MÜNCHEN Einstudierung: Andreas Herrmann KNABENSTIMMEN DER AUGSBURGER DOMSINGKNABEN Einstudierung: Reinhard Kammler Samstag 12_11_2016 11 Uhr Samstag 12_11_2016 12_30 Uhr 360º FESTIVAL FAMILIENKONZERT SERGEJ PROKOFJEW »Peter und der Wolf« op. 67 Freitag 11_11_2016 20 Uhr c SERGEJ PROKOFJEW Symphonie Nr. 1 D-Dur op. 25 »Symphonie classique« WOLFGANG AMADEUS MOZART Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur KV 219 RICHARD WAGNER »Parsifal«, III. Aufzug Konzertante Aufführung VALERY GERGIEV, Dirigent MALTE ARKONA, Sprecher MARIINSKY ORCHESTER VALERY GERGIEV Dirigent DANIEL LOZAKOVICH Violine KATHARINA RITSCHEL Sopran Vorschau 26 Die Münchner Philharmoniker 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Iason Keramidis Florentine Lenz Vladimir Tolpygo Georg Pfirsch 2. VIOLINEN Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Schmitz Ana Vladanovic-Lebedinski Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich Asami Yamada BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler VIOLONCELLI Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth Das Orchester 27 KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich Zeller FLÖTEN Alois Schlemer Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte POSAUNEN OBOEN PAUKEN Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo KLARINETTEN Dany Bonvin, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach Michael Leopold Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette HARFE FAGOTTE Valery Gergiev Teresa Zimmermann, Solo CHEFDIRIGENT Jürgen Popp Johannes Hofbauer Jörg Urbach, Kontrafagott EHRENDIRIGENT HÖRNER INTENDANT Jörg Brückner, Solo Matias Piñeira, Solo Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross Paul Müller Zubin Mehta ORCHESTERVORSTAND Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim Das Orchester 28 IMPRESSUM TEXTNACHWEISE BILDNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Martin-Moser-Straße 23 84503 Altötting Peter Jost, Sigrid Neef und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler redigierte bzw. verfasste die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Künstlerbiographien (Afkham; Lupu): Nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Abbildungen zu Ludwig van Beethoven: Joseph Schmidt­ - Görg und Hans Schmidt (Hrsg.), Ludwig van Beethoven, Bonn 1969; H. C. Robbins Landon, Beet­ hoven – A documentary study, New York 1970. Abbildungen zu Dmitrij Schostakowitsch: Jürgen Fromme (Hrsg.), Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit – Mensch und Werk, Duisburg 1984; Friedbert Streller, Dmitrij Schostakowitsch – Für Sie porträtiert, Leipzig 1987; Lothar Seehaus, Dmitrij Schostakowitsch – Leben und Werk, Wilhelmshaven 1991. Abbildugen zu Sergiu Celibidache: Archiv der Münchner Philharmoniker. Künstlerphotographien: Felix Broede (Afkham); Klaus Rudolph (Lupu). Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt Impressum In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit DAS FESTIVAL FÜR FAMILIEN FAMILIENKONZERT »Peter und der Wolf« EDUCATION TANZPROJEKT »Romeo & Julia« COMMUNITY MUSIC Performances für Groß und Klein Samstag 12_11_2016 — GASTEIG mphil.de 18 B G JA IS RA H TI RE S ’16 ’17 DAS ORCHESTER DER STADT