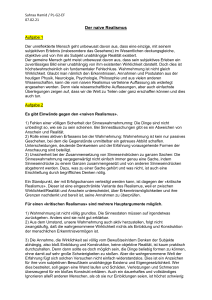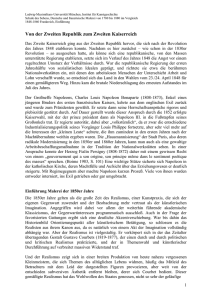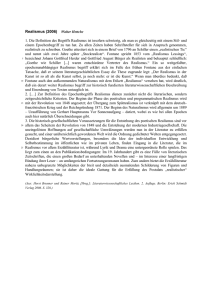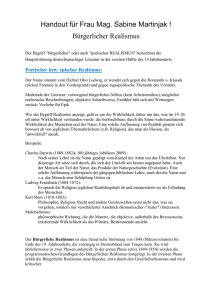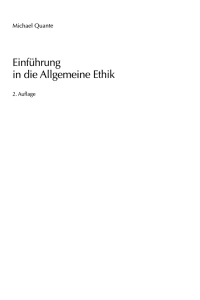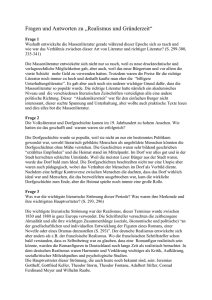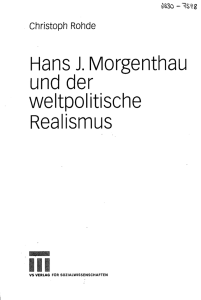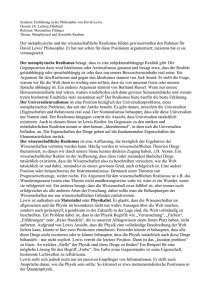Wirklichkeit und Wahrnehmung des Heiligen
Werbung
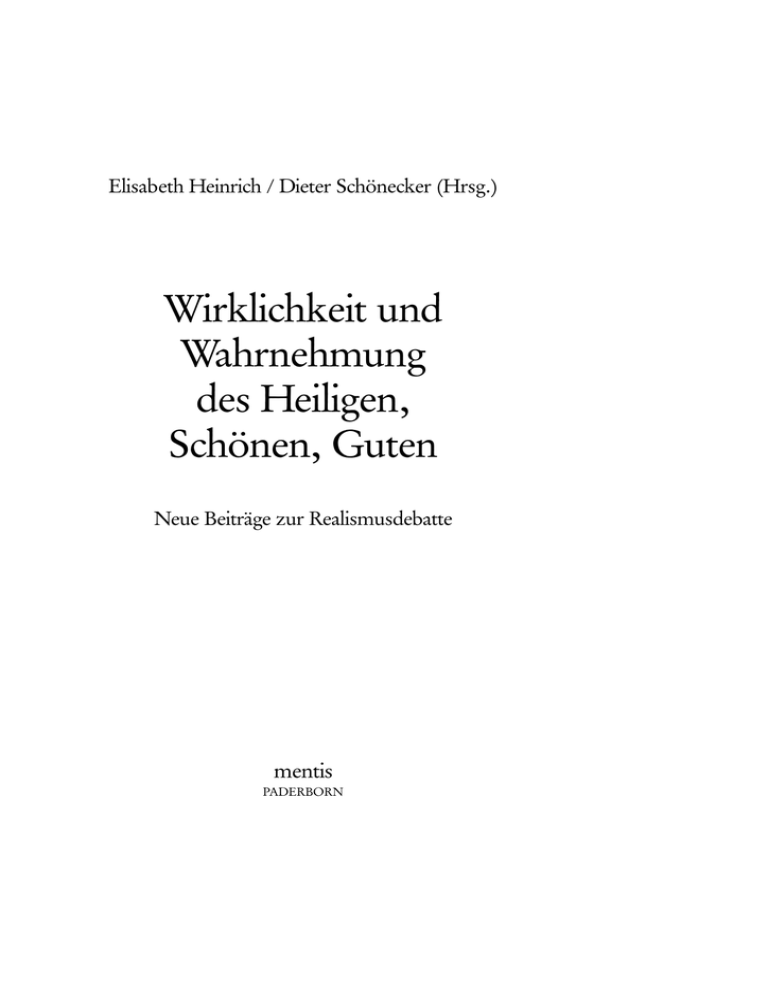
Elisabeth Heinrich / Dieter Schönecker (Hrsg.) Wirklichkeit und Wahrnehmung des Heiligen, Schönen, Guten Neue Beiträge zur Realismusdebatte mentis PADERBORN Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Einbandabbildung: Rica Schönecker: Compressus eris Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem und alterungsbeständigem Papier ∞ ISO 9706 © 2011 mentis Verlag GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 19, D-33100 Paderborn www.mentis.de Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zulässigen Fällen ist ohne vorherige Zustimmung des Verlages nicht zulässig. Printed in Germany Einbandgestaltung: Anna Braungart, Tübingen Satz: Rhema – Tim Doherty, Münster [ChH] (www.rhema-verlag.de) Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten ISBN: 978-3-89785-727-8 EINLEITUNG In jüngerer Zeit wird vor allem in der analytisch geprägten Philosophie unter dem Stichwort »Realismus/Antirealismus« eine Debatte geführt, die zwei auf den ersten Blick einfache Fragen zum Inhalt hat: Gibt es eine vom menschlichen Geist unabhängige, an sich existierende Realität, und wenn ja, wie und in welchem Umfang können wir sie erkennen? Realisten beantworten diese beiden Fragen auf die eine oder andere Weise positiv, Anti-Realisten hingegen geben eine negative Antwort. Der gesunde, oder jedenfalls naive Menschenverstand geht davon aus, dass etwa Bäume und Berge auch dann existieren, wenn kein vernünftiges Wesen da ist, das auf sie erkennend Bezug nimmt. Ähnliches gilt jenem Menschenverstand – und den realistischen Philosophien, die sich an ihn anschließen – für diejenigen Entitäten, die nicht auf perzeptive Weise dem Menschen unmittelbar gegeben zu sein scheinen, also z. B. für Naturgesetze und die von ihnen bestimmten Objekte (Elektronen, Kräfte, Felder, usw.), aber auch für die Gegenstände und Gesetze der Mathematik: Dass die Planetenbahnen Ellipsen sind, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht und dass die Kuben der Bahnhalbachsen der Planeten in einem festen Verhältnis zu den Quadraten ihrer Umlaufzeiten stehen, sind astronomische Gesetze, beschrieben mit Hilfe der Mathematik, die, so der Realismus, Kepler entdeckt hat, die aber schon gültig waren, bevor sie von ihm entdeckt wurden. Erfunden haben wir – dem Realismus zufolge – nur die Sprachen und Theorien, mit deren Hilfe wir die objektive Realität beschreiben und erklären; entdeckt wird dagegen das, was da ist und in seiner Existenz und Natur von uns beschrieben wird, ohne in seiner Existenz und Natur von unseren Beschreibungen abhängig zu sein. Doch dem Anti-Realismus zufolge entdecken wir nicht einfach Gegenstände, Gesetze und ihre Eigenschaften als Bestandteile des Universums, sondern sie werden vom menschlichen Geist erdacht oder erzeugt. Dass diese grobe Gegenüberstellung aber nicht erschöpfend ist, kann man schon daran erkennen, dass es, so eine dritte Variante, vielleicht Gegenstände an sich (unabhängig von Menschen) gibt, diese aber entweder gar nicht oder infolge der Natur der menschlichen Sprache und des menschlichen Erkenntnisvermögens nur begrenzt erkannt werden können. Man sieht leicht, dass solche Fragen und Probleme fast so alt und grundlegend sind wie die Philosophie selbst. So waren schon Platon und Aristoteles unterschiedlicher Meinung bezüglich des ontologischen Status von Wahrnehmungsgegenständen und Universalien, und dieser Streit entbrannte von neuem in der 8 Einleitung mittelalterlichen Philosophie. Und auch der erkenntnistheoretische Skeptizismus, der von der realistischen Prämisse ausgeht, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen den Weisen, in denen uns die Dinge erscheinen, und denen, wie sie wirklich sind, spielte bereits in der antiken Philosophie eine wichtige Rolle. Zu Beginn der Neuzeit rückte dann das durch Descartes’ methodischen Zweifel initiierte Problem des Realismus bezüglich der Außenwelt in den Brennpunkt der philosophischen Aufmerksamkeit und sollte die folgenden Jahrhunderte ganz maßgeblich bestimmen (Locke, Berkeley, Hume, Kant). Dennoch ist die neuere Debatte zwischen Realismus und Anti-Realismus durch epistemologische, sprachphilosophische und ontologische Antworten vor allem, aber keineswegs nur, aus der analytischen Philosophie unbestreitbar vorangebracht worden. Dies ist eine in der gegenwärtigen Philosophie offenkundige und allgemein anerkannte Tatsache, und sie spiegelt sich auch in den Beiträgen des vorliegenden Bandes. Nun ist es (de facto) umstritten, was genau »Realismus« und »Anti-Realismus« eigentlich bedeuten, und es gibt diverse ontologische, semantische und epistemologische Varianten nicht nur auf der allgemeinen Ebene (das gilt vor allem für die besagte dritte Möglichkeit, die einen großen Spielraum an Deutungsmöglichkeiten eröffnet), sondern auch und vor allem innerhalb der verschiedenen Felder und Disziplinen. Klar ist aber, dass Realismus (auf einem Gebiet) und Anti-Realismus (auf einem anderen Gebiet) einander nicht ausschließen, und manchmal scheinen sie sogar einander zu implizieren. So ist es z. B. möglich (und tatsächlich häufig der Fall), dass im Feld der theoretischen Erkenntnis (Erkenntnis allgemein, Mathematik, Natur- und Sozialwissenschaften) ein mehr oder weniger robuster Realismus vertreten wird (hier gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl von Varianten), während gleichzeitig eine anti-realistische Position in der Ethik, Ästhetik oder Religionsphilosophie eingenommen wird. (Umgekehrt geht das nicht oder nur auf einschränkende Weise: Realisten in der Ethik, Ästhetik und Religionsphilosophie können nicht grundsätzlich Anti-Realisten sein). Eine starke Version des Realismus in der Ethik kann man knapp auf die These bringen, dass ethisch-normative Aussagen wie »Diese Handlung ist moralisch verboten« durch moralische Tatsachen wahr gemacht werden, die als Tatsachen unabhängig von menschlicher Erkenntnis sind (auch hier gibt es offenkundig feinere, aber auch größere Unterschiede und Varianten); analoges gilt dann in der Ästhetik für Aussagen wie »Dieses Bild ist schön«. In der Religionsphilosophie besteht der Realismus in der These, dass wir Heiliges (bzw. in theistischer Perspektive einen personalen Gott, seine Existenz und seine Eigenschaften) erkennen können; theistische Antirealisten wie Gordon Kaufman und John Hick gehen dagegen davon aus, dass unsere Rede von Gott gar keine oder nur einen schwach analoge Referenz hat, ohne dass sie deshalb zu Atheisten oder Agnostikern würden. Wer bezüglich der theoretischen Erkenntnis Realist ist, ansonsten aber Anti-Realist, geht also davon aus, dass es in der Ethik, Ästhetik und Religionsphilosophie Probleme sui generis gibt, die die jeweilige realistische Position unplausibel machen. Einleitung 9 Diese Probleme sind vor allem ontologischer und epistemologischer, in der Ethik auch moralpsychologischer Natur. Das ontologische Problem betrifft den ontischen bzw. ontologischen Status, also die Existenzformen oder Seinsweisen des Guten, Schönen und Heiligen. Hier stellt sich die Frage, was »das Gute«, »das Schöne« oder »das Heilige« überhaupt ist oder sein kann, wenn es denn existiert; was genau ist überhaupt eine moralische oder ästhetische Tatsache, und was ist überhaupt das Heilige? Doch selbst wenn man einen kohärenten Begriff dessen bilden könnte, was das Gute (etwa Güter, Handlungen, Intentionen), das Schöne (das Kunstschöne, das Naturschöne, aber auch Gegenstände mit anderen ästhetischen Eigenschaften), und das Heilige (Gott oder gottähnliche Wesen) sind, wenn sie denn existieren, bleibt immer noch die Frage, welche Gründe dafür sprechen, dass sie existieren, und auf welche Weise wir sie durch diese Gründe erkennen. Denn selbst wenn es das Gute, Schöne, Heilige gibt, bleibt die Frage, wie wir sie erkennen können, wo doch unsere sonstigen Erkenntnisweisen (empirische Anschauung, apriorische Begriffsbildung) sich von der behaupteten Erkenntnis des Guten, Schönen und Heiligen erheblich zu unterscheiden oder für sie eben nicht geeignet scheinen. Dass sie sich erheblich unterscheiden, ist in jüngerer Zeit vor allem in der analytischen Religionsphilosophie bestritten worden, wenn auch auf durchaus verschiedene Weisen. In der Tat entstand die Idee zu diesem Band – oder vielmehr die Idee zu dem DFG-Netzwerk, aus dem das Buch hervorgegangen ist (Das Gute, Schöne und Heilige wahrnehmen – epistemologischer Realismus und AntiRealismus in der gegenwärtigen Ethik, Ästhetik und Religionsphilosophie) – aus der Beschäftigung mit der religionsphilosophisch motivierten Epistemologie William Alstons, der zusammen mit Alvin Plantinga die sogenannte »Reformed Epistemology« begründet hat (wobei Plantinga jedoch, wie wir meinen, einen ganz andersgearteten Ansatz vertritt). Alstons Kernthese, die er vor allem in seinem Hauptwerk Perceiving God entwickelt hat, lautet so: Es gibt mystische (religiöse) Wahrnehmungen Gottes, die prima facie nicht weniger Geltungsanspruch erheben müssen als andere Wahrnehmungen auch. Mystische Wahrnehmungen haben mit normalen Wahrnehmungen bestimmte Züge gemeinsam, so dass von mystischen Wahrnehmungen sinnvoll die Rede sein kann; und wo sie von normalen Wahrnehmungen unterschieden sind, wäre es Ausdruck eines epistemischen Imperialismus, nur diese, aber nicht jene für vertrauenswürdig zu halten. Dieser These liegt das sogenannte »principle of credulity« zugrunde, das auch bei Richard Swinburne Anwendung findet, allerdings in einem ganz anderen Kontext (daher fällt das sogenannte »argument from religious experience« bei Swinburne auch ganz anders aus als bei Alston): Swinburne bettet es in ein kumulativ-induktives Argument ein; und dieser Versuch, bestehende Sachverhalte (die Existenz des Universums überhaupt, seine Wohlgeordnetheit, die Entstehung von Bewusstsein und einiges mehr) durch die Existenz einer ewigen, omnipotenten, allwissenden, vollkommen freien und daher auch körperlosen und vollkommen guten Person 10 Einleitung zu erklären, unterscheidet sich prinzipiell nicht von anderen probabilistischen Versuchen, diese (oder andere) Sachverhalte zu erklären. Und auch Plantingas Ansatz vertritt im Kern diese Idee, dass sich religiöse (genauer: christliche) Überzeugungen insofern von anderen Überzeugungen (etwa über Mathematik, die Welt, die eigene Person) nicht unterscheiden, als sie wie diese basal sind, also zwar nicht im klassischen Sinne begründet, aber dennoch warranted, das heißt: entspringend aus einem richtig funktionierenden Erkenntnisvermögen, das zweckmäßig zur Wahrheitsfindung eingerichtet ist und sich in einem angemessenen kognitiven Umfeld befindet (ein solches Erkenntnisvermögen ist der sensus divinitatis). Während bei Alston und Swinburne (wenn auch auf unterschiedliche Weise) der Begriff der religiösen Erfahrung bzw. Wahrnehmung zentral ist, spielt dieser Begriff bei Plantinga keine substantielle Rolle; es geht bei ihm allgemeiner um Überzeugungen, die allerdings eine bestimmte erfahrungsartige, affektive Färbung haben. Nach grundsätzlicheren und einführenden Überlegungen zur RealismusAntirealismus-Debatte aus realistischer und antirealistischer Perspektive (Richard Schantz als Vertreter des direkten Realismus, Werner Stegmaier als Philosoph der Orientierung) geht der erste Teil des Buches auf die eben skizzierten Theorien in der analytischen Religionsphilosophie ein. Einen ausführlichen und kritischen Überblick über den Begriff und die Rolle religiöser Erfahrung (Wahrnehmung) bei Alston, Plantinga und Swinburne liefert der Aufsatz von Winfried Löffler. Die anderen Beiträge beschäftigen sich dann mit diversen Aspekten und Details dieser analytischen Philosophien: mit dem Begriff der religiösen Erfahrung bei Swinburne (Gregor Nickel und Dieter Schönecker); mit der Frage, ob und wie die unbestreitbare Vielfalt religiöser Erfahrung für Alstons religiöse Epistemologie ein unüberbrückbares Problem ist (Sebastian Maly); sowie mit der Frage, ob Alston tatsächlich, wie er behauptet, einen erkenntnistheoretischen Realismus vertritt (Elisabeth Heinrich). Gewissermaßen von außen nähern sich zwei weitere Beiträge dem Thema dieses ersten Teils: Alexandra Grund diskutiert aus religionswissenschaftlicher Sicht den Begriff des Heiligen und seiner Erfahrung; und Gregor Nickel versucht zu zeigen, dass neben der gegenwärtigen analytischen Philosophie auch die philosophische Tradition in Gestalt des Cusanus einen substantiellen Beitrag zur Theorie der religiösen Wahrnehmung leisten kann. Die Mitglieder des DFG-Netzwerkes verfolgten, neben der zentralen Beschäftigung mit neueren Überlegungen zur religiösen Erfahrung, auch die Aufgabe, die Wirklichkeit und Wahrnehmung des Schönen und Guten neu zu überdenken und dabei vor allem die neueren epistemologischen Ansätze aus der analytischen Religionsphilosophie zu berücksichtigen. Doch die Einschätzung fiel eher negativ aus: Kaum jemand zeigte sich von den Überlegungen Alston, Swinburnes oder Plantingas überzeugt oder auch nur hinreichend motiviert, sie auf die Ethik oder Ästhetik (oder genauer: Metaethik und Metaästhetik) zu übertragen. Das heißt aber nicht, dass die Wirklichkeit des Guten und Schönen (oder allgemeiner gesagt: genuin moralischer oder ästhetischer Eigenschaften) rundum bestritten Einleitung 11 wurde. So vertritt etwa Maria E. Reicher einen ästhetischen Realismus, den sie mit der These verbindet, dass genuine ästhetische Werturteile durch eine spezielle Art von (ästhetischer) Wahrnehmung begründet werden, also durch ein unmittelbares Erleben ästhetischer (Wert-)Qualitäten; dagegen versteht Gerhard Ernst so etwas wie einen Sinn für Schönheit als ein Vermögen der Vernunft. Der Ansatz von Georg W. Bertram widersetzt sich eher der üblichen Unterscheidung von Realismus und Anti-Realismus, behauptet aber dennoch, dass Objektivität im Zusammenhang mit Kunstwerken geltend gemacht werden kann, wobei auch Wahrnehmungsaktivitäten eine wichtige Rolle spielen. Reinhold Schmücker dagegen kritisiert die Argumente für einen ästhetischen Realismus und vertritt also selbst einen ästhetischen Anti-Realismus. Während in der Ästhetik die zentrale Rolle von Wahrnehmungen unbestreitbar ist, wie auch immer man sie philosophisch deutet – klarerweise sehen wir ja Gemälde, und wir hören Symphonien –, ist es in der Ethik umstritten, ob Wahrnehmungen, oder so etwas wie Wahrnehmungen, überhaupt eine substantielle Rolle spielen. Gewiss taucht der Wahrnehmungsbegriff in der jüngeren Tradition intuitionistischer Ansätze (etwa bei Meinong, Moore, Scheler, Lonergan, Murdoch) und auch in der zeitgenössischen Ethik (etwa bei McNaughton, McDowell, Nussbaum) auf. Um aber von so etwas wie moralischer Wahrnehmung zu sprechen, muss man natürlich zunächst einmal fragen – eine Frage, die aber in diesem Kontext tatsächlich selten gestellt wird –, was denn wesentlich für Wahrnehmungen ist, damit die Rede von moralischer Wahrnehmung überhaupt sinnvoll und gerechtfertigt ist: Wodurch wird überhaupt ein psychisches Ereignis zu einer Wahrnehmung, und was macht nun eine moralische Wahrnehmung zu einer Wahrnehmung? Gewiss muss man moralische Wahrnehmungen von gewöhnlichen Wahrnehmungen zwar abgrenzen; aber zugleich müssen sie ja auch etwas mit solchen gewöhnlichen Wahrnehmungen gemeinsam haben, das es rechtfertigt, überhaupt von moralischen Wahrnehmungen zu sprechen. Die Grundstrategie bei der Explikation der moralischen Wahrnehmung wäre dann analog zu der von Alston und Swinburne: Es gibt moralische Wahrnehmungen, und sie sind nach dem Prinzip der Glaubwürdigkeit prima facie gerechtfertigt. Nun werden auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht als Paradigmen stets die »Standardwahrnehmungen« der sog. fünf Sinne herangezogen; und dabei ist noch einmal besonders dominant das Sehen. Was es aber überhaupt bedeutet, etwas wahrzunehmen, ist höchst umstritten. Schon über den Gegenstand von Wahrnehmungen herrscht keine Einigkeit: Sind es, wie der direkte Realismus behauptet, physische Objekte, die uns in der Wahrnehmung ohne Vermittlung gegeben werden, oder sind die direkten Objekte des Bewusstseins in der sinnlichen Wahrnehmung mentale Repräsentationen (sogenannte »Sinnesdaten«)? Damit verknüpft ist die Frage, ob Wahrnehmung begriffs- oder sprachabhängig ist, oder jedenfalls in irgendeiner Weise interpretativ imprägniert, so dass es so etwas wie eine unmittelbare oder eben direkte Wahrnehmung gar nicht gäbe. Wesentlich für