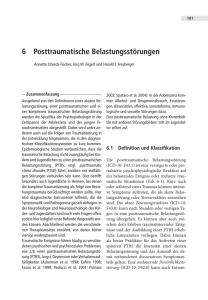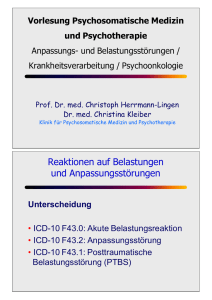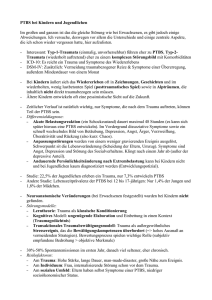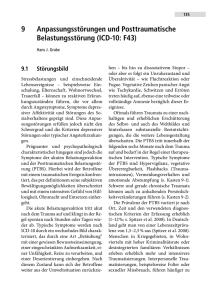Die Posttraumatische Belastungsstörung
Werbung

Aktuelles Wissen für Anästhesisten Refresher Course Nr. 39 April 2013 · Nürnberg Die Posttraumatische Belastungsstörung M. Sieberer · M. Ziegenbein Einleitung Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine schwere und oft chronische Störung bei einem Teil der Menschen, die extrem belastenden bzw. traumatisierenden Ereignissen ausge­ setzt waren. Dabei stellt die PTBS ein häufiges, wenngleich in der heutigen Definition erst seit etwa 30 Jahren akzeptiertes Krankheitsbild dar. Epidemiologie Die Lebenszeitprävalenz für die Posttraumatische Belastungs­ störung in der Allgemeinbevölkerung wird mit 1-14% (Deutsch­‑ land ca. 1,5-2%) angegeben, wobei die Schwankungen mit der Auswahl der Erfassungsmethode und der untersuchten Stichprobe zusammenhängen. Studien an Risikogruppen zeigen Prävalenzraten zwischen 3-58% (ca. 50% Prävalenz nach Vergewaltigung, ca. 25% Prävalenz nach anderen Gewaltver­ brechen, ca. 50% bei Kriegs- und Vertreibungsopfern, ca. 15% bei Verkehrsunfallopfern, ca. 15% bei schweren Or­ ganerkrankungen) [20,18]. Untersuchungen bei Patienten von Intensivstationen zeigen eine Prävalenz von 15-25% [13]. Die Prävalenz subsyndromaler Störungsbilder ist jedoch wesentlich höher. Sowohl die Expositionswahrscheinlichkeit be­ stimmter Personenkreise als auch die Art des Traumas sind unter präventionsmedizinischen Gesichtspunkten bedeutsam. So werden bestimmte Berufsgruppen wie bspw. Soldaten, Polizisten oder Angestellte im Rettungsdienst naturgemäß mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit und möglicherweise auch wiederholt mit schwerwiegenden traumatischen Ereignissen konfrontiert. Für jene Personen besonderer Gefährdung besteht demzufolge aufgrund der Expositionswahrscheinlichkeit ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer PTBS, was wiederum unter primärpräventiven Aspekten relevant ist [18]. Die welt­ weit häufigste Ursache für posttraumatische Störungen sind Erfahrungen von so genannter organisierter Gewalt, worunter laut WHO alle Formen zielbewusst eingesetzter physischer und psychischer Gewalt gegen Menschen durch Staaten, Or­ ganisationen und Gruppierungen verstanden werden. Hierunter fallen Folter, Unterdrückung, Geiselhaft, Kriegshand­ lungen und andere Formen politisch, religiös, ethnisch oder anderweitig weltanschaulich begründeter Gewalt [9]. Diese traumatischen Erfahrungen werden als „man-made disasters“ bezeichnet und haben – im Gegensatz zu Unglücksfällen oder Naturkatastrophen, die nicht bewusst durch menschliches Die Posttraumatische Belastungsstörung · M. Sieberer · M. Ziegenbein Handeln herbeigeführt werden – in der Regel schwere psychi­ sche Folgen. Jedoch sind nicht alle Menschen, die Gewalt erlebt haben, traumatisiert in dem Sinne, dass sie einer speziellen Be­ handlung bedürfen. Selbst ähnliche Traumatisierungen haben nicht bei allen Menschen die gleichen Folgen, da korrektive Faktoren bei der Verarbeitung der traumatischen Situation und protektive Faktoren im Sinne biographischer Disposition schützend oder zumindest mildernd wirken können [15]. Methodische Standards und Diagnosestellung Nach der Definition des leitgebenden Diagnostischen und Statistischen Manuals (DSM-IV) der Amerikanischen Psychia­ tervereinigung (American Psychiatric Association) [2], werden unter traumatischen Ereignissen nur solche verstanden, bei denen die Betroffenen ein Ereignis beobachtet oder erlebt haben, bei dem Leib und Leben der eigenen oder einer ande­ ren Person unmittelbar bedroht waren. Typische traumatische Ereignisse nach diesem Verständnis sind beispielsweise lebensbedrohliche Unfälle, Kriegseinsätze, Folter, schwere Na­ turkatastrophen, Vergewaltigung etc. Eine Person, die derartige Erlebnisse unter intensiver Angst und Hilflosigkeit erlebt, kann in der Folge Symptome einer PTBS entwickeln. Entscheidend für die Diagnose der PTBS ist, dass die betroffenen Menschen von der traumatischen Erfahrung nicht mehr losgelassen wer­ den. Dabei finden sich drei Symptomkomplexe, welche alle drei in einem ausreichenden Maß vorhanden sein müssen, um die Diagnose mit ausreichender Sicherheit stellen zu dürfen. Der eindrücklichste Symptomkomplex äußert sich im regelmäßigen ungewollten Wiedererleben des Ereignisses, das darin besteht, dass tagsüber (etwa in der Form sogenannter Flashbacks) oder nachts (in der Form von quälenden Alp­ träumen) die traumatische Situation in der Form von Bildern, Geräuschen, Gefühlen und häufig auch Körperempfindungen wieder erlebt wird. Die betroffenen Personen haben in diesen Momenten des Wiedererlebens das Gefühl, dass das Ereignis in diesem Moment und Ort erneut stattfindet. Dabei fühlen sie sich bedroht und hilflos, obwohl objektiv keine aktuelle Gefährdung mehr besteht. Dieses Erleben und die damit ver­ bundenen Gefühle der momentanen Bedrohung prägen den Alltag von traumatisierten Personen. Als Resultat dieser dauer­ haften Belastung versuchen die betroffenen Menschen, Reizen, die sie an die Vergangenheit bzw. an die traumatisierenden Ereignisse erinnern, aus dem Weg gehen. Es kommt zu einem ausgeprägten Vermeidungsverhalten, welches den zweiten 1 Refresher Course Nr. 39 Aktuelles Wissen für Anästhesisten April 2013 · Nürnberg Symptomkomplex der PTBS charakterisiert. Die wiederholten und aufdringlichen Erinnerungen an die traumatischen Erleb­ nisse dominieren zwar das Leben der betroffenen Menschen, jedoch vermeiden es die meisten Betroffenen, über ihre Erlebnisse zu sprechen, was dazu führt, dass sie sich häufig isoliert und ausgegrenzt fühlen. Selbst die Betroffenen, die pro­ fessionelle Hilfe aufsuchen, berichten meist nicht unmittelbar über ihre quälenden Erinnerungen, sondern eher über diffuse und wenig spezifische Symptome, wie körperliche Schmerzen, Schwindel, Taubheitsgefühle, Übelkeit, Schlafstörungen sowie Ängste. Dieser Umstand birgt die Gefahr, dass im Umgang mit traumatisierten Menschen unerfahrene Kliniker häufig andere Diagnosen stellen und die notwendigen Behandlungen ausbleiben. Neben dem Bemühen, Gedanken, Gespräche, Orte und Menschen, die an das Trauma erinnern, zu umgehen, findet sich als weitere Form des Vermeidungsverhaltens oft eine innere Betäubung. Die Betroffenen berichten, dass sie gefühlsmäßig kalt und abgestumpft wären. Die Fähigkeit in­ tensive Gefühle, wie Liebe und Zuneigung zu empfinden, aber auch tiefe Traurigkeit, geht dabei verloren. Der dritte Symptom­ komplex wird dominiert durch eine anhaltende körperliche Übererregung, die aus einem dauerhaften Bedrohungsgefühl resultiert. Die betroffenen Menschen haben das Gefühl, dass dauernd Gefahren drohen und sie davor auf der Hut sein müs­ sen. Dieser Umstand führt zu einer erhöhten Schreckhaftigkeit verbunden mit einer stetigen inneren Anspannung. Ferner finden sich gehäuft Schlafstörungen in Sinne von Ein- und/ oder Durchschlafstörungen sowie Konzentrationsproblemen. Viele Betroffene berichten von einer unterschwelligen Wut und Aggression, was sich in einer dauerhaften Reizbarkeit aus­ drücken kann. Teilweise mündet diese Reizbarkeit in plötzliche aggressive Durchbrüche mit verbaler oder körperlicher Gewalt auch gegenüber Familienangehörigen. Im Anschluss sind die von der PTBS Betroffenen meist zutiefst beschämt über dieses Verhalten, was zu weiterer Isolation führen kann. Nicht wenige Patienten mit PTBS empfinden dieses Verhalten als eine Verän­ derung der eigenen Persönlichkeit, weil es vor der Erkrankung nicht zu vergleichbaren Situationen gekommen ist. Im Resultat sind bei Personen, die an einer PTBS leiden, häufig massive Beeinträchtigungen in allen Funktionsbereichen des täglichen Lebens, wie dem Familienleben, dem Beruf und dem Kontakt zu Freunden kommen. Eine Posttraumatische Belastungsstörung kann in jedem Alter einschließlich der Kindheit auftreten. Die Symptome beginnen typischerweise innerhalb der ersten 3 Monate nach dem Trauma, obwohl sich die Ausbildung der Symptome auch um Monate oder sogar Jahre verzögern kann (late-onset PTBS). Die Symptome der Störung und das verhältnismäßige Vorherrschen des Wiedererlebens, des Vermeidungsverhaltens oder der Symptome der Übererregbarkeit können sich über die Zeit hinweg wandeln. Die Symptomdauer ist dabei unterschiedlich, wobei in der Hälfte der Fälle innerhalb von 3 Monaten eine vollständige Remission eintritt, bei vielen anderen Fällen die Symptome jedoch länger als 12 Monate nach dem Trauma noch fortbestehen [26]. 2 Komorbidität Bei Patienten mit einer PTBS bestehen häufig weitere psy­ chiatrische Krankheitsbilder als komorbide Störungen. Oft beeinflusst die PTBS den Verlauf parallel vorliegender psychia­ trischer Erkrankungen negativ [6]. Des Weiteren zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Vorliegen einer PTBS und der Inzidenz von beispielsweise kardiovaskulären und metaboli­ schen Erkrankungen [19]. In zwei großen epidemiologischen Studien, die in den USA und Australien durchgeführt wurden, zeigten sich bei 85-88% der Männer und 78-80% der Frauen mit einer PTBS komorbide psychiatrische Erkrankungen [11, 26]. Die Autoren schätzten, dass vor allem bei Depressionen und Substanzmissbrauch die PTBS in der Mehrzahl der Fälle als primäre Störung anzusehen sei, während das Verhältnis bei den Angststörungen umgekehrt zu sein schien. In einer Studie mit 801 Frauen fanden Breslau et al. [5] ein gut zweifach erhöhtes Risiko, nach einer PTBS erstmalig an einer Major Depression zu erkranken, und ein dreifaches Risiko, einen schädlichen Alkoholkonsum bzw. eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. Gleichzeitig war bei Frauen mit bereits zuvor bestehender Major Depression sowohl die Gefahr, ein trauma­ tisches Ereignis zu erleben, als auch die Wahrscheinlichkeit, in dessen Folge eine PTBS-Symptomatik zu entwickeln, erhöht. In der deutschen Studie von Perkonigg et al. [29] wurde bei 87,5 % der PTBS-Patienten mindestens eine weitere psychische Störung diagnostiziert. Die Autoren postulieren, dass in etwa einem Drittel der Fälle zuvor bestehende psychopathologi­ sche Faktoren zur Entstehung einer primären Vulnerabilitat oder einer bestimmten Risikokonstellation beitragen (z.B. bei bekannter Alkohol- oder Substanzabhängigkeit). Auch könne beispielsweise durch Angst- oder depressive Störungen die Schwelle für das Auftreten einer Posttraumatischen Belastungs­ störung nach einem entsprechenden Ereignis gesenkt werden. Gleichwohl entwickelten sich die komorbiden psychischen Störungen in der weit überwiegenden Zahl der Fälle sekundär nach einer PTBS. Dies gelte insbesondere für somatoforme Störungen, Agoraphobien, generalisierte Angststörungen und affektive Störungen, wobei nach Ansicht einiger Autoren der Posttraumatischen Belastungsstörung die Rolle eines maßgebli­ chen Risikofaktors zukommt [6]. Auch die Studie von Zlotnick et al. bestätigt die hohe Prävalenz komorbider Störungen und nennt vor allem affektive Störungen, Angststörungen, Sub­ stanzmissbrauch und Somatisierungsstörungen [36]. Im Hinblick auf ein differentialtherapeutisches Vorgehen ist es in der klinischen Praxis auch deshalb wichtig, distinkte Typen einer PTBS mit jeweils vorherrschender Symptomatik zu un­ terscheiden [1], wobei sich der somatoforme Typus vorrangig durch Schmerzen und der depressive Typus durch Vermei­ dungsverhalten, Selbstwertverlust, sozialer Rückzug und Unfähigkeit zu zielorientierten Alltagshandlungen auszeichnet. Die Posttraumatische Belastungsstörung · M. Sieberer · M. Ziegenbein Aktuelles Wissen für Anästhesisten Refresher Course Nr. 39 April 2013 · Nürnberg Psychobiologisches Modell der Posttraumatischen Belastungsstörung In den letzten Jahren hat die Forschung zu den neuro- bzw. psychobiologischen Grundlagen der PTBS einige Fortschritte erzielt. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass traumatische Erlebnisse im Gedächtnis in grundlegend ande­ rer Art und Weise abgespeichert werden, als es bei anderen wichtigen Ereignissen geschieht [7,12,28,3]. Während der Traumatisierung hinterlassen die Erlebnisse in der sogenannten „Furchtstruktur“, einer assoziativen Struktur [17] eine Art biologische Narbe. Ein Netzwerk aus den sinnlichen Eindrü­ cken des Traumas, insbesondere den Bildern aber auch den Geräuschen, Stimmen, Gerüchen und Körperempfindungen der traumatischen Situation, bildet die Furchtstruktur. Inner­ halb der Furchtstruktur sind die Eindrücke verknüpft mit den grundlegenden Bewertungen des Ereignisses, welche durch extrem bedrohliche Gefühle wie intensive Angst und Schre­ cken sowie den körperlichen Reaktionen, wie Herzrasen und Schwitzen gekennzeichnet sind. Die Furchtstrukturen trauma­ tisierter Menschen sind besonders groß und die Verbindungen zwischen den Elementen besonders stark, was dazu führt, dass eine Erinnerung an das Trauma zu einer Aktivierung einzelner ähnlicher Elemente der Furchtstruktur führen kann, und damit häufig weitere Elemente blitzartig mitaktiviert werden können. Im Gegensatz zu den Furchtstrukturen, wird das traumatische Erlebnis in anderen Gedächtnisformen nur sehr mangelhaft abspeichert, was vor allem das sogenannte autobiographische Gedächtnis betrifft. Beim autobiographischen Gedächtnis han­ delt es sich um eine sehr hoch elaborierte und gut organisierte Struktur, welche es uns erlaubt, einzelne persönliche Erlebnisse in den Zusammenhang unserer Lebensgeschichte zu stellen, also räumlich und zeitlich zuzuordnen. Ferner ermöglicht das autobiographische Gedächtnis, den Ablauf von Erlebnissen nachzuvollziehen und z.B. einem anderen Menschen darüber zu berichten. Im Gegensatz zu anderen bedeutsamen Erleb­ nissen ist die entsprechende Repräsentation von traumatischen Ereignissen im autobiographischen Gedächtnis nur sehr man­ gelhaft ausgeprägt [10,14]. Aus den Ergebnissen der Untersu­ chungen lässt sich ableiten, dass die Gehirnstrukturen (z.B. der Hippocampus), welche zur Bildung von Kontextinformationen benötigt werden, unter der extremen Aufregung während der traumatischen Erlebnisse in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. Daraus resultiert, dass die traumatischen Ereignisse im Wesent­ lichen auf reiner Wahrnehmungsebene abgespeichert sind und der jeweilige räumliche und zeitliche Zusammenhang nicht mehr abrufbar ist. Die Integration und Interpretation mithilfe des semantischen Gedächtnisses wird unterbrochen und die Speicherung findet als affektiver Zustand, als somatische oder sensorische Empfindung oder als visuelles Bild statt. Das Ergebnis ist ein abgespaltener nichtsymbolischer, unflexibler und unveränderbarer Inhalt traumatischer Erfahrung, der mit einer tiefgreifenden Veränderung der regulatorischen Funk­ tionen in den neuroanatomischen Strukturen Neokortex, lim­ bisches System und Stammhirn mit Hypothalamus einhergeht [33]. Die Posttraumatische Belastungsstörung · M. Sieberer · M. Ziegenbein Da von Neurobiologen und Hirnforschern [23,24] die PTBS als „biologische Narbe, die nicht heilt“ angesehen wird, können externale Hinweisreize (z.B. zurückkehren in das Land des Geschehens, erinnern durch Sprache, Gerüche, Teilaspekte des Geschehens und Teilaspekte des traumatischen Ereignisses) erneut schwere Symptome des PTBS auslösen. Bei entsprechender Triggerung ensteht also das Gefühl, die trau­ matisierenden Erlebnisse würden genau hier und jetzt erneut stattfinden. Trotz nicht vorhandener Gefährdung kommt es dabei zu einem Gefühl massiver Bedrohung. Das Erleben kritischer Umweltereignisse, wie etwa Traumata, kann über Prozesse der DNA-Methylierung oder Histonmo­ difizierung dauerhaft die Expression von Genen beeinflussen, was wiederum Einfluss auf die Funktionsweise neurobiologi­ scher Systeme hat, ohne dass es zu einer Veränderungen der primären Erbsubstanz, der DNA, kommt [34]. Diese soge­ nannten epigenetischen Einflüsse finden sich unter anderem bei Einwohnern von New York, die im Zusammenhang mit den Terroranschlägen auf das World Trade Center eine PTBS ent­wickelt haben. Auf der Ebene der hormonellen Regulation lassen sich bei PTBS-Patienten Veränderungen im Bereich der sogenannten „neuroendokrinen Stressachse“ nachvollziehen, wozu u.a. die Hypothalamus-Hypophysen-NebennierenrindenAchse (HPA-Achse), das sympathoadrenale medulläre (SAM-) Systems sowie das endogene Opiatsystems zählen. Zudem wurde bei PTBS-Patienten mit unterschiedlicher Traumatisie­ rung (Kriegserfahrung, sexueller Missbrauch in der Kindheit etc.) im Vergleich zu Gesunden und anderen psychiatrischen Patienten ein erhöhter CRF-Spiegel (Corticotropin-releasing Factor) in der Zerebrospinalflüssigkeit, eine verringerte ACTHFreisetzung (Adrenocorticotropes Hormon), eine erhöhte Anzahl von Glucocorticoid-Rezeptoren auf Lymphozyten und eine reduzierte Cortisol-Freisetzung nach Stimulation durch CRF nachgewiesen [35,4,30]. Die zentrale und periphere Freisetzung von Katecholaminen (Noradrenalin, Adrenalin) ist erhöht. Gleichzeitig findet sich bei diesen Patienten eine starke Reduktion der Alpha-2-adrenergenen Rezeptoren. Yohimbin, ein alpha-2-Rezeptorantagonist, der eine verstärkte Freisetzung von Katecholaminen hervorruft, löst bei PTBSPatienten Panikattacken und Flashbacks aus, jedoch nicht bei Gesunden. Mit der erhöhten Freisetzung von CRF und Noradrenalin kommt es auch zu einer vermehrten Bildung und Abgabe von Beta-Endorphinen, die mit einer Minderung der Schmerzempfindungen einhergeht [25]. Bisher durchgeführte PET-Untersuchungen zeigten bei PTBS-Patienten während der Präsentation traumaassoziierten Materials oder imaginierter traumatischer Geschehnisse eine Zunahme des Blutflusses im rechtsseitigen Gyrus cinguli und der Amygdala, bei gleichzei­ tiger Blutflussabnahme besonders in der Gegend des BroccaAreals, also eines wichtigen Areals der Sprachregion [32]. Diese Ergebnisse lassen also die Deutung zu, dass unter einer Triggerung bei PTBS-Patienten Hirnregionen, die an der Ent­‑ stehung und Wahrnehmung von Angst maßgeblich beteiligt sind, aktiviert werden und gleichzeitig das Sprachzentrum inaktiviert wird: Der Patient erlebt in dieser Situation also Angst, ohne entsprechend in Worte fassen zu können. 3 Refresher Course Nr. 39 Aktuelles Wissen für Anästhesisten April 2013 · Nürnberg Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörung Eine Grundvoraussetzung der Behandlung von Patienten mit einer PTBS lautet, dass professionelle Hilfe weder erzwungen noch im Sinne einer prophylaktischen Routine empfohlen werden sollte. Emotionale Reaktionen auf ein Trauma sollten zunächst als physiologisch und nicht als grundsätzlich patho­ logisch aufgefasst werden. Die rasche Wiederaufnahme all­ täglicher Arbeiten und Pflichten nach einem erlebten Trauma sollte im Sinne einer Ressourcenaktivierung daher unterstützt und den Betroffenen empfohlen werden. Bei den Therapiekonzepten, die im Rahmen der Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung zur Anwendung kommen, handelt es sich fast ausnahmslos um multidimen­ sionale Ansätze mit dem primären Ziel einer psychischen Stabilisierung. Diese Entwicklung ist sicherlich auch auf die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse zurückzuführen, die ein multifaktorielles Entstehungsmodell der Posttraumatischen Belastungsstörung postulieren. Dabei spielen neben psycho­ dynamischen-, entwicklungspsychologischen- und kognitivbehavioralen Ansätzen auch neurobiologische Modelle eine wesentliche Rolle. Im Rahmen der Therapie kommen daher unter anderem psychodynamische Therapieansätze [22], behaviorale und kognitive Behandlungsansätze [27,8] oder Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) von Shapiro [31] zur Anwendung. Die Behandlung sollte durch entsprechend qualifizierte ärztliche oder psychologische Psy­ chotherapeuten erfolgen. Am Anfang steht das Herstellen einer sicheren Umgebung (Schutz vor weiterer Traumaeinwirkung) und die Organisation bzw. Aktivierung des psychosozialen Helfersystems. Ein nächster Schritt beinhaltet eine differenzierte diagnostische Einordnung und gegebenenfalls die Einleitung einer engmaschigen therapeutischen Begleitung, die ressour­ cenorientierte Interventionen (z.B. Distanzierungstechniken und imaginative Verfahren) integrieren sollte. Wenn darunter eine nachhaltige psychische Stabilität erreicht werden konnte, kann eine Traumabearbeitung im engeren Sinne erwogen wer­ den. Im Rahmen der Traumabearbeitung kommt es zu einer „dosierten“ Rekonfrontation mit dem auslösenden Ereignis mit dem Ziel der Durcharbeitung und Integration der Traumaerleb­ nisse unter geschützten therapeutischen Bedingungen. Neben den erwähnten psychotherapeutischen Verfahren werden ad­ juvante Verfahren (z.B. stabilisierende Körpertherapie, Kunst-, Musik- und Ergotherapie etc.) in den Gesamtbehandlungsplan einbezogen. Ob und wann eine Traumabearbeitung aber konkret stattfin­‑ den soll, bleibt im Individualfall zu entscheiden. Unbedingte Vor­aussetzungen dafür sind neben der ausreichenden Stabili­ tät, dass eine weitere Traumaeinwirkung oder ein neuerlicher Täterkontakt ausgeschlossen sind. Bei traumatisierten Flücht­ lingen oder Asylsuchenden ist ein zusätzliches Problem, dass eine angemessene Bearbeitung traumatischer Erfahrungen unter den Bedingungen eines unseren Aufenthaltsstatus und insbesondere bei drohender Abschiebung kaum möglich 4 erscheint, da eine sichere und längerfristig Halt gebende the­‑ rapeutische Beziehung nur schwer aufgebaut werden kann [21]. Das Setting ist in Abhängigkeit von der Schwere der Störung und dem Stabilisierungsbedarf zu wählen (Schwer­ punktpraxen, Ambulanzen / Institutsambulanzen, Schwer­ punktstationen, Tageskliniken). Ergänzend zu diesen psychotherapeutischen Verfahren kommt der Psychopharmakotherapie eine Bedeutung zu. Mit großer Übereinstimmung schreiben internationale Guidelines den Psychopharmaka in der Behandlung der PTBS eine nach­ geordnete Rolle zu, die im Sinne einer symptomorientierten medikamentösen Therapie dann erfolgen kann, wenn eine traumafokussierte psychologische Therapie nicht möglich ist oder bisher nicht ausreichend weitergeholfen hat [16]. Psycho­ pharmaka sind demnach nicht Therapie der ersten Wahl bei der PTBS und können in aller Regel eine psychotherapeutische Intervention nicht ersetzen. Obgleich Vertreter nahezu aller Klassen von Psychopharmaka in der Behandlung der PTBS im klinischen Alltag verordnet werden, gibt es aus wissenschaft­ lichen Studien bisher nur wenig Evidenz für deren Einsatz. Am häufigsten werden bei PTBS die Antidepressiva der Klasse Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI), namentlich vor allem Paroxetin, aber auch Citalopram oder die ältere Substanz Fluoxetin eingesetzt. Empfehlungen gibt es alternativ auch für Mirtazapin oder das trizyklische Antidepressivum Amitriptylin. Eine gelegentlich aufgrund vorliegender Studien empfohlene Behandlung mit dem irreversiblen MAO-Hemmer Phenelezin sollte wegen der pharmakologischen Besonderheiten dieses Wirkstoffes (u.a. bzgl. des Interaktionspotentials) aber Spezialisten vorbehalten bleiben. Bei den Antidepressiva aus der Stoffgruppe der Serotoninwiederaufnahmehemmer ist auf die Suizidgefährdung bei Eindosierung und Dosisanpassungen zu achten. Bei Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungs­ störung besteht nachweislich eine erhöhte Suchtgefährdung, weshalb Substanzen mit erhöhtem Suchtpotential (besonders Benzodiazepine) nur in Krisensituation und unter engmaschi­ ger ärztlicher Kontrolle Verwendung finden sollten. Präventionsaspekte Bei der PTBS handelt es sich um eine definiert beginnende und zur Chronifizierung neigende sowie mit diversen Folge- und Begleiterkrankungen assoziierte psychische Störung. Daher erscheinen Präventivmaßnahmen hier besonders sinnvoll. Die PTBS nimmt, was die Möglichkeit präventiven Vorgehens betrifft, eine geradezu einzigartige Stellung unter den psychi­ schen Störungen ein, da mit dem auslösenden Trauma ein unübersehbares Ereignis den Ausgangspunkt für eine Sekun­ därprävention im Sinne einer Postexpositionsprophylaxe bildet. Auch die Erkenntnis, dass bestimmte Formen des Traumas mit hoher Penetranz zur Ausbildung einer PTBS führen, sollte Anlass sein, sich über die Möglichkeiten einer Prävention nach bestimmten Ereignissen mit hohem Traumatiserungsrisiko (z.B. sexuelle Übergriffe) Gedanken zu machen. Die Posttraumatische Belastungsstörung · M. Sieberer · M. Ziegenbein Refresher Course Nr. 39 Aktuelles Wissen für Anästhesisten April 2013 · Nürnberg Literatur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Alacron RD, Deering CG, Glover SG et al. (1997). Should there be a clinical typology of posttraumatic stress disorder. Aust New Zeal J Psychiatry 31:159-167 American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4 ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Bremner DJ, Krystal JH, Southwick SM, Charney DS (1995). Functional neuroanatomical correlates of the effects of stress on memory. J Traum Stress; 8:527-553. Bremner, J.D., Ma. Narayan, E.R. Anderson, L.H. Staib, H.L. Miller und D.S. Charney (2000): “Hippocampal volume reduction in major depression“, American Journal of Psychiatry 157: 115-117. Breslau N, Davis GC, Peterson EL, Schultz L. Psychiatric sequelae of posttraumatic stress disorder in women. Arch Gen Psychiatry 1997; 54(1):81-7. Breslau N, Davis GC, Schultz LR (2003) Posttraumatic stress disorder and the incidence of nicotine, alcohol, and other drug disorders in persons who have experienced trauma. Arch Gen Psychiatry 60:289–294 Brewin, C. R. (2001). A cognitive neuroscience account of posttraumatic stress disorder and its treatment. Behav Res Ther, 39, 373-393. Brom D, Kleber RJ, Defares PB (1989). Brief psychotherapy for posttraumatic stress disorder. J Consult Clin Psychol 57:607-612 Brune M. Posttraumatische Störungen. In: Haasen C, Yagdiran O (Hrsg.): Beurteilung psychischer Störungen in einer multikulturellen Gesellschaft. Freiburg: Lambertus-Verlag, 2000: 107-124. Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychol Rev, 107, 261-288. Creamer, M., Burgess, P. & McFarlane, A. C. (2001) Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. Psychological Medicine, 31,1237–1247. Dalgleish, T. (2004). Cognitive approaches to posttraumatic stress disorder: the evolution of multirepresentational theorizing. Psychol Bull, 130, 228-260. Davydow DS, Zatzick D, Hough CL, Katon WJ. (2013). A longitudinal investigation of posttraumatic stress and depressive symptoms over the course of the year following medical-surgical intensive care unit admission. Gen Hosp Psychiatry. Jan 28 [Epub ahead of print] Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of post­ traumatic stress disorder. Behav Res Ther, 38, 319-345. Fischer G, Riedesser P. Lehrbuch der Psychotraumatologie. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 1999. Flatten G, Gast U, Hofmann A, Knaevelsrud Ch, Lampe A, Liebermann P, Maercker A, Reddemann L, Woller W (2011): S3 - Leitlinie Posttraumatische Belastungsstorung. Trauma & Gewalt 3: 202-210 Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99, 20-35. Foa EB (1997) Trauma and women: course, predictors, and treatment. J Clin Psychiatry 58(Suppl 9):25-28 Friedman MJ, Schnurr PP, McDonagh-Coyle A (1994) Posttraumatic stress disorder in the military veteran. Psychiatr Clin North Am 17:265-277 Gäbel U, Ruf M, Schauer M, Odenwald M, Neuner F. Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und Die Posttraumatische Belastungsstörung · M. Sieberer · M. Ziegenbein 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. Z Klin Psychol Psychother 2006;35:12-20. Henningsen F (2003). Traumatisierte Flüchtlinge und der Prozess der Begutachtung. Psychoanalytische Perspektiven. Psyche; 2:97-120. Horrowitz MJ (1986). Stress response syndromes. 2nd edn. Jason, Aroson, Northvale, NJ Huether, G.: “The central adaptation syndrome: Psychosocial stress as a trigger for adaptive modifications of brain structure and brain function“, Prog. Neurobiol. 48: 569-612, (1996). Huether G., S. Doering, U. Rüger, E. Rüther, G. Schüssler: “The stressreaction process and the adaptive modification and reorganization of neuronal networks“, Psychiatry Research 83-95, (1999). Julien, R.M.: “Drogen und Psychopharmaka“, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, (1997). Kessler R C, Sonnega A, Bromet E, Hughes M & Nelson C B (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry 52 (12), 1048-1060. Kilpatrick DG, Veronen LJ, Resick PA (1982). Psychological sequelae to rape: Assessment and treatment strategies. In: Doleys DM, Meredith RL, Ciminero AR (eds) Behavioral medicine: Assessment and treatment strategies. Plenum, New York, pp 473-497 Krystal JH, Bennett AL, Bremner JD et al. (1995). Towards a cognitive neuroscience of dissociation and altered memory functions in post-traumatic-stress-disorder. In: Friedman MJ, Charney DS, Deutch AY (Eds) From Normal Adaptation to PostTraumatic-Stress-Disorder. Lipincott, Philadelphia Perkonigg A, Kessler R C, Storz S & Wittchen H-U (2000). Traumatic events and posttraumaticstress disorder in the commu­ nity: prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 46-59. Sapolsky, R.M.: “Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders“, Arch. Gen. Psychiatry 57: 925-935, (2000). Shapiro F (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols, and procedures. Guilford, New York Shin, L.M., S.M. Kosslyn, R.J. McNally, N.M. Alpert, W.L. Thompson, S.C. Rrauch, M.L. Macklin und R.K. Ptman: “Visual imagery and perception in posttraumatic stress disorder. A positron emission tomographic investigation“, Arch. Gen. Psychiatry 54: 233-241, (1997). Van der Kolk BA, Fisler R (1995). Dissociation and the fragmen­ tary nature of traumatic memories: Overview and exploratory study. J Traum Stress; 8:505-525. Yehuda, R., Bierer LM: “The relevance of epigenetics to PTSD: Implications fort he DSM-V. J Trauma Stress 2009 [Epub ahead of print]. Yehuda, R., E.L. Giller und J.W. Mason: “Psychoneuroendocrine assessment of posttraumatic stress disorder“, Progress in Neuro-Psy­ chopharmacology and Biological Psychiatry 17: 541-550, (1993). Zlotnick C, Johnson J, Kohn R, Vicente B, Rioseco P & Saldivia S (2006). Epidemiology of trauma, post-traumatic stress disorder (PTBS) and co-morbid disorders in Chile. Psychological Medicine 36, 1523-1533. 5